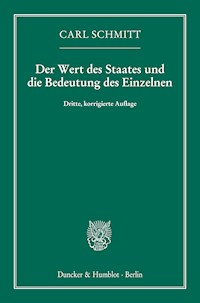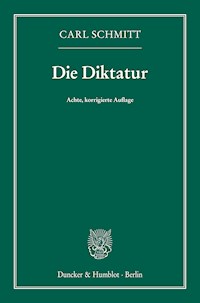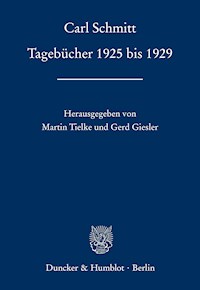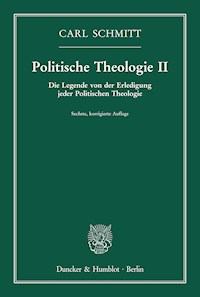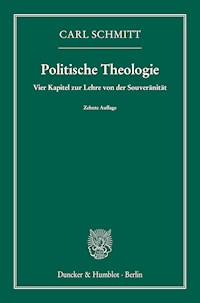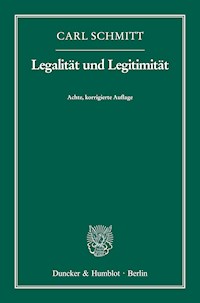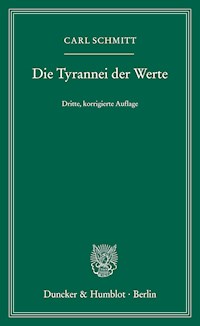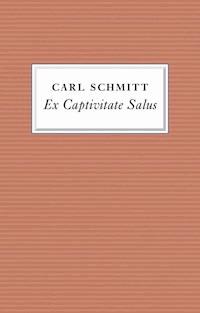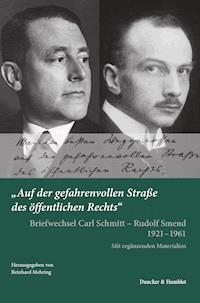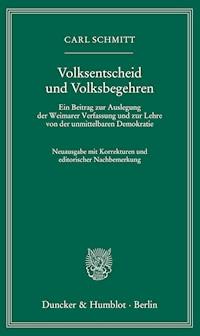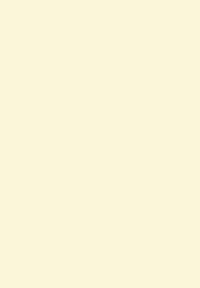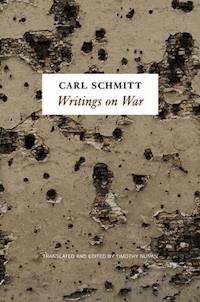44,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Carl Schmitt gehört nach wie vor zu den anregendsten und zugleich umstrittensten politischen Denkern des 20. Jahrhunderts. In seiner Verfassungslehre formulierte er grundsätzliche, auch heute noch immer gültige Gedanken zu einem juristischen Kernthema – weshalb sich der Verlag zur zehnten Auflage entschlossen hat. »Die vorliegende Arbeit ist weder ein Kommentar noch eine Reihe monographischer Einzelabhandlungen, sondern der Versuch eines Systems. In Deutschland liegen heute zur Weimarer Verfassung ausgezeichnete Kommentare und Monographien vor, deren hoher Wert in Theorie und Praxis anerkannt ist und keines Lobes mehr bedarf. Es ist aber notwendig, sich außerdem auch um den systematischen Aufbau einer Verfassungstheorie zu bemühen und das Gebiet der Verfassungslehre als besonderen Zweig der Lehre des öffentlichen Rechts zu behandeln.« Auszug aus Carl Schmitts Vorwort zur 1. Auflage 1928
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
CARL SCHMITT
Verfassungslehre
CARL SCHMITT
Verfassungslehre
Elfte Auflage
Duncker & Humblot · Berlin
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Erste Auflage
1928
Zweite Auflage
1954
Dritte Auflage
1957
Vierte Auflage
1965
Fünfte Auflage
1970
Sechste Auflage
1983
Siebente Auflage
1989
Achte Auflage
1993
Neunte Auflage
2003
Zehnte Auflage
2010
Alle Rechte vorbehalten © 2017 Duncker & Humblot GmbH Druck: Das Druckteam, Berlin Printed in Germany
ISBN 978-3-428-15206-3 (Print)ISBN 978-3-428-55206-1 (E-Book)ISBN 978-3-428-85206-2 (Print & E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706♾
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Vorbemerkung des Verlages zur 8. Auflage
Carl Schmitts , Verfassungslehre' erschien erstmalig 1928 und hat seitdem zahlreiche Neuauflagen erfahren. Die Schriftqualität der Nachdrucke wurde allerdings mit der Zeit gemindert, weshalb wir uns mit der hier vorgelegten Auflage zu einem Neusatz entschlossen haben. Dabei wurde der Seitenumbruch des arabisch numerierten Hauptteils unverändert belassen. Behutsam wurden bisher zum Teil nicht gegebene typographische Vereinheitlichungen vorgenommen; offensichtliche orthographische sowie grammatische Fehler wurden beseitigt. Stilistische Eigenheiten Schmitts blieben hingegen unberührt. Die erstmals eingefügten Kolumnentitel geben dem Leser eine sinnvolle Orientierungshilfe an die Hand.
Berlin, im Juli 1993
Duncker & Humblot
Dem Andenken meines Freundes
Dr. Fritz Eisler aus Hamburg
gefallen am 27. September 1914
Vorbemerkung
Die anhaltende Nachfrage nach dieser „Verfassungslehre“ dürfte sich daraus erklären, daß sie den Typus einer rechtsstaatlich-demokratischen Verfassung mit einer bis auf den heutigen Tag überzeugenden Systematik entwickelt hat. Das Buch behält deshalb, ohne Rücksicht auf die Weitergeltung der von ihm als Beispiel herangezogenen Verfassungsbestimmungen, seinen praktischen und theoretischen Wert, solange der Typus der rechtsstaatlich-demokratischen Verfassung positive Geltung hat. Das ist sowohl in der Bundesrepublik Deutschland und ihren Ländern wie auch in den andern Staaten des demokratischen Westens der Fall.
Nur an der Hand einer echten Systematik hat die Vergleichung und Veranschaulichung verschiedener Verfassungen einen guten Sinn, denn nur so ist eine rechtswissenschaftliche Erkenntnis der spezifischen Denkmodelle möglich. Ein Werk, dem diese Systematik gelungen ist, braucht nicht in einen Wettlauf mit den zahlreichen Verfassungstexten einzutreten, die sich im Lauf der Zeit ergeben, solange eben der Typus Bestand hat. Es kann sogar richtiger sein, hier Zurückhaltung zu üben, um den Typus klarer hervortreten zu lassen.
So rechtfertigt sich der unveränderte Abdruck eines Buches, dessen erste Ausgabe im Jahre 1928 erschienen ist und das in dieser Gestalt im Inlande wie im Auslande bis auf den heutigen Tag Anerkennung gefunden hat.
März 1954
Carl Schmitt
Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist weder ein Kommentar noch eine Reihe monographischer Einzelabhandlungen, sondern der Versuch eines Systems. In Deutschland liegen heute zur Weimarer Verfassung ausgezeichnete Kommentare und Monographien vor, deren hoher Wert in Theorie und Praxis anerkannt ist und keines Lobes mehr bedarf. Es ist aber notwendig, sich außerdem auch um den systematischen Aufbau einer Verfassungstheorie zu bemühen und das Gebiet der Verfassungslehre als besondern Zweig der Lehre des öffentlichen Rechts zu behandeln.
Dieser wichtige und selbständige Teil der Publizistik hat bei uns in der letzten Generation keine Ausbildung erfahren. Seine Fragen und Materien wurden entweder im Staatsrecht mit sehr verschiedenartigen öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten oder in der allgemeinen Staatslehre mehr oder weniger versprengt und beiläufig erörtert. Das erklärt sich geschichtlich aus der Lage des Staatsrechts der konstitutionellen Monarchie, vielleicht auch aus der Eigenart von Bismarcks Reichsverfassung, deren genialer Wurf elementare Einfachheit und komplizierte Unfertigkeit vereinigte, am meisten aber wohl aus dem politischen und sozialen Sicherheitsgefühl der Vorkriegszeit. Eine bestimmte Auffassung von „Positivismus" diente dazu, verfassungstheoretische Grundfragen aus dem Staatsrecht in die allgemeine Staatslehre zu verdrängen, wo sie zwischen Staatstheorien im allgemeinen und philosophischen, historischen und soziologischen Angelegenheiten eine unklare Stelle fanden. Es darf hier daran erinnert werden, daß auch in Frankreich eine Verfassungslehre sich erst spät entwickelt hat. Im Jahre 1835 wurde (für Rossi) ein Lehrstuhl des Verfassungsrechts in Paris errichtet, den man aber 1851 (nach dem Staatsstreich Napoleons III.) wieder beseitigte. Die Republik hat dann 1879 einen neuen Lehrstuhl geschaffen, aber noch 1885 beklagte es Boutmy (in seinen Etudes de Droit constitutionnel), daß der bedeutendste Zweig des öffentlichen Rechts in Frankreich vernachlässigt sei und keinen anerkannten Autor aufweise. Heute findet die Eigenart dieses Teiles des öffentlichen Rechts in berühmten Namen wie Esmein, Duguit, [XII]Hauriou, ihren Ausdruck. Es ist zu erwarten, daß die wissenschaftliche Behandlung der Weimarer Verfassung auch in Deutschland zur Ausbildung einer Verfassungslehre führt, wenn nicht außen- oder innerpolitische Störungen die ruhige und gesammelte Arbeit verhindern. Die öffentlich-rechtlichen Erscheinungen der letzten Jahre, besonders auch die Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, lassen diese Tendenz bereits erkennen. Wenn die Praxis einer richterlichen Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen sich weiterentwickelt — wie es nach der heutigen Stellungnahme des Reichsgerichts zu erwarten ist — so wird das ebenfalls zu einer Beschäftigung mit der verfassungstheoretischen Seite aller Rechtsfragen führen. Schließlich darf ich noch erwähnen, daß auch die Erfahrungen, die ich seit 1919 in Vorlesungen, Übungen und Examen machen konnte, diese Ansicht von der Verfassungslehre als einem selbständigen, für sich zu behandelnden Gebiet des öffentlichen Rechts bestätigen. Schon jetzt dürfte ein großer Teil der Universitäts-Vorlesungen über Allgemeine Staatslehre (Politik) in Wahrheit Verfassungslehre sein.
Weil hier zunächst nur ein einfacher Grundriß entworfen werden soll, kam es nicht darauf an, die einzelnen Fragen des Staatsrechts monographisch zu erschöpfen und die Literatur bibliographisch aufzuzählen. Sowohl in den Kommentaren zur Weimarer Verfassung von Anscbütz und von Giese, wie in dem Grundriß des Reichsund Landesstaatsrechts von Stier-Somlo finden sich übrigens gute Zusammenstellungen, so daß es nicht notwendig war, eine Aufzählung von Buchtiteln zu wiederholen. In einer wissenschaftlichen Darlegung sind Zitate und Auseinandersetzungen allerdings unerläßlich. Doch sind sie hier in erster Linie als Beispiele gedacht und sollen die Stellung bestimmter Einzelfragen im System der Verfassungslehre verdeutlichen. Immer handelte es sich vor allem um die klare und übersichtliche, systematische Linie. Das muß betont werden, weil es gegenwärtig in Deutschland an systematischem Bewußtsein zu fehlen scheint und sogar schon in populärwissenschaftlichen Sammlungen (die ihre Rechtfertigung doch nur durch strengste Systematik erhalten können) die Weimarer Verfassung „in Form eines freien Kommentars", d. h. in Notizen zu den einzelnen Artikeln behandelt wird. Gegenüber der kommentierenden und glossierenden Methode, aber auch gegenüber der Auflösung in Einzeluntersuchungen, soll hier ein systematischer Rahmen gegeben werden. Damit sind weder alle Fragen des Staatsrechts noch alle Fragen der allgemeinen Staats[XIII]lehre beantwortet. Aber nach beiden Seiten, für die allgemeinen Prinzipien wie für manche Einzelfragen, dürfte das eine Klärung bedeuten, falls es wirklich gelungen sein sollte, eine Verfassungslehre in dem hier gedachten Sinne zu entwickeln.
In der Hauptsache ist die Verfassungslehre des bürgerlichen Rechtsstaates dargestellt. Darin wird man keinen Einwand gegen das Buch finden können, denn diese Art Staat ist heute im allgemeinen noch vorherrschend und die Weimarer Verfassung entspricht durchaus seinem Typus. Deshalb schien es auch zweckmäßig, in den Beispielen vor allem auf die klassischen Ausprägungen französischer Verfassungen zu verweisen. Doch soll jener Typus keineswegs zu einem absoluten Dogma erhoben werden, dessen geschichtliche Bedingtheit und politische Relativität ignoriert werden müßten. Es gehört im Gegenteil zu den Aufgaben einer Verfassungslehre, nachzuweisen, wie sehr manche überlieferten Formeln und Begriffe ganz von früheren Situationen abhängig und heute nicht einmal mehr alte Schläuche für neuen Wein, sondern nur noch veraltete und falsche Etiketten sind. Zahlreiche dogmatisierte Vorstellungen des heutigen öffentlichen Rechts stecken noch ganz in der Mitte des 19. Jahrhunderts und haben den (längst entfallenen) Sinn, einer „Integrierung" zu dienen. Diesen von Rudolf Smend für das Staatsrecht fruchtbar gemachten Begriff möchte ich hier verwerten, um auf einen einfachen Sachverhalt hinzuweisen: damals, im 19. Jahrhundert, als die heute noch vorgebrachten Definitionen vom Gesetz und andern wichtigen Begriffen entstanden, handelte es sich um die Integrierung einer bestimmten sozialen Schicht, nämlich des gebildeten und besitzenden Bürgertums, in einen bestimmten, damals bestehenden Staat, nämlich die mehr oder weniger absolute Monarchie. Heute, bei völlig veränderter Sachlage, verlieren jene Formulierungen ihren Inhalt. Man wird mir erwidern, daß auch die Begriffe und Unterscheidungen meiner Arbeit von der Zeitlage bedingt sind. Aber dann wäre es doch schon ein Vorteil, wenn sie wenigstens in der Gegenwart ständen und nicht eine längst entschwundene Situation voraussetzten.
Eine besondere Schwierigkeit der Verfassungslehre des bürgerlichen Rechtsstaates liegt darin, daß der bürgerlich-rechtsstaatliche Bestandteil der Verfassung sogar heute noch mit der ganzen Verfassung verwechselt wird, obwohl er in Wahrheit sich nicht selbst genügen kann, sondern zu dem politischen Bestandteil nur hinzukommt. Daß man — rein fiktiv — die Prinzipien des bürgerlichen Rechtsstaates mit der Verfassung überhaupt gleichstellt, hat dazu geführt, wesentli[XIV]che Vorgänge des Verfassungslebens außer acht zu lassen oder zu verkennen. Am meisten hat die Behandlung des Begriffes der Souveränität unter dieser Methode der Fiktionen und Ignorierungen gelitten. In der Praxis entwickelt sich dann die Übung apokrypher Souveränitätsakte, für die es charakteristisch ist, daß staatliche Behörden oder Stellen, ohne souverän zu sein, doch gelegentlich und unter stillschweigender Duldung Souveränitätsakte vornehmen. Die wichtigsten Fälle sind in der folgenden Darlegung an ihrem Platz erwähnt (S. 108, 150, 177). Eine ausführliche Erörterung dieser Frage würde in die Lehre von der Souveränität und damit in die allgemeine Staatslehre gehören. Auch die Auseinandersetzung mit der Souveränitätstheorie von H. Heller (Die Souveränität, Berlin, 1927) beträfe Fragen der Staatslehre und muß in einem andern Zusammenhang versucht werden. Hier war nur das zu behandeln, was zur Verfassungslehre im eigentlichen Sinne gehört. Die Lehre von den Staatsformen im allgemeinen wie die Lehre von der Demokratie, Monarchie und Aristokratie im besondern wurde aus dem gleichen Grunde auf das für eine Verfassungslehre (zum Unterschied von einer Staatslehre) Unumgängliche beschränkt. Übrigens ist selbst in dieser Beschränkung der vom Verlag vorgesehene Umfang des Buches bereits überschritten.
Während der Drucklegung erschienen eine Reihe von Schriften und Aufsätzen, die für das Thema einer Verfassungslehre von besonderem Interesse sind und deren große Zahl beweist, daß die spezifisch verfassungstheoretische Seite des Staatsrechts stärker hervortritt. Die Verhandlungen der deutschen Staatsrechtslehrer-Tagung 1927 sind nach dem Bericht von A. Hensel im Archiv des öffentlichen Rechts, Bd. XIII N. F. S. 97 f. zitiert, weil die vollständige Publikation (Heft 4 der Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer, bei W. de Gruyter) erst im Dezember 1927 erschien. Während der Drucklegung wurden mir noch folgende Veröffentlichungen bekannt, die hier wenigstens erwähnt seien: Adolf Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht (bei J. Springer), Walter Jellinek, Verwaltungsrecht (bei J. Springer), O. Koellreutter, Aufsatz „Staat" in dem von Stier-Somlo und A. Elster herausgegebenen Handwörterbuch der Rechtswissenschaft; die Aufsätze von G. Jèze, L’entrée au service public (Revue du droit public, XLIV), Carré de Malberg, La constitutionnalité des lois et la Constitution de 1875, Berthélemy, Les lois constitu[XV]tionnelles devant les juges (Revue politique et parlementaire CXXXII/III) und W. Scheuner, Über die verschiedenen Gestaltungen des parlamentarischen Regierungssystems (Archiv des öffentlichen Rechts, XIII). Für den Januar 1928 ist eine neue Auflage des Kommentars zur Reichsverfassung von Poetzsch-Heffter (bei O. Liebmann) angezeigt; leider war es nicht möglich, das neue Werk dieses hervorragenden Juristen noch heranzuziehen. Ferner ist ein Buch von Rudolf Smend über verfassungstheoretische Fragen angekündigt. Ich habe in meiner vorliegenden Arbeit versucht, mich mit seinen bisherigen Veröffentlichungen auseinanderzusetzen und habe den Reichtum und die tiefe Fruchtbarkeit seiner Gedanken eigentlich erst in der Auseinandersetzung ganz erfahren. Deshalb bedauere ich es besonders, daß ich die zu erwartende verfassungstheoretische Darlegung nicht mehr kennenlernen und verwerten konnte.
Bonn, Dezember 1927.
Carl Schmitt
Inhaltsverzeichnis
I. Abschnitt
Begriff der Verfassung
§1
Absoluter Verfassungsbegriff (Die Verfassung als einheitliches Ganzes)
I.
Verfassung als Gesamtzustand konkreter Einheit und Ordnung oder als Staatsform („Form der Formen“) 3. — oder als Prinzip der Bildung der politischen Einheit 5.
II.
Verfassung im normativen Sinne („Norm der Normen“) 7.
§2
Relativer Verfassungsbegriff (Die Verfassung als eine Vielheit einzelner Gesetze)
I.
Auflösung der Verfassung in Verfassungsgesetze 11.
II.
Die geschriebene Verfassung 13.
III.
Erschwerte Abänderbarkeit als formales Kennzeichen des Verfassungsgesetzes 16.
§3
Der positive Verfassungsbegriff (Die Verfassung als Gesamtentscheidung über Art und Form der politischen Einheit)
I.
Die Verfassung als Akt der verfassunggebenden Gewalt 21.
II.
Die Verfassung als politische Entscheidung 23. — Entscheidungen der Weimarer Verfassung 23. — Praktische Bedeutung der Unterscheidung von Verfassung und Verfassungsgesetz (Verfassungsänderung, Unantastbarkeit der Verfassung, Grundrechte, VerfassungsStreitigkeiten , Eid auf die Verfassung, Hochverrat) 25.
III.
Der Kompromißcharakter der Weimarer Verfassung, echte und Scheinkompromisse (Schul- und Kirchenkompromiß) 28.
§4
Idealbegriff der Verfassung (in einem auszeichnenden Sinne, wegen eines bestimmten Inhalts so genannte „Verfassung“).
I.
Vieldeutigkeit der Idealbegriffe, insbesondere Freiheit 36.
II.
Der Idealbegriff der bürgerlich-rechtsstaatlichen Verfassung 37.
III.
Die beiden Bestandteile der modernen Verfassung 40.
§5
Die Bedeutungen des Wortes „Grundgesetz“, Grundnorm oder lex fundamentalis (Zusammenfassende Übersicht)
I.
9 Bedeutungen des Wortes Grundgesetz 42.
II.
Verbindungen der verschiedenen Bedeutungen 43.
III.
Verfassung bedeutet im vorliegenden Buch Verfassung im positiven Sinne 44.
§6
Entstehung der Verfassung
I.
Eine Verfassung entsteht durch einseitige Entscheidung oder gegenseitige Vereinbarung 44.
II.
Geschichtliche Übersicht über die Entstehung der modernen europäischen Verfassungen (1. mittelalterlicher Feudal- und Ständestaat, insbesondere die Magna Carta; 2. Das deutsche Reich bis 1806; 3. Der Staat des absoluten Fürsten; 4. Die Revolution von 1789; 5. Die monarchische Restauration 1815-1830; 6. Die Julirevolution 1830; 7. Die konstitutionelle Monarchie in Deutschland; 8. Norddeutscher Bund 1867 und Deutsches Reich 1871; 9. Die Weimarer Verfassung 1919) 44.
§7
Die Verfassung als Vertrag (Der echte Verfassungsvertrag)
I.
Unterscheidung des sog. Staats- oder Sozialvertrages vom Verfassungsvertrag 61.
II.
Der echte Verfassungsvertrag als Bundesvertrag. Unechte Verfassungsverträge innerhalb einer politischen Einheit 62.
III.
Der echte Verfassungsvertrag als Status-Vertrag (Kritik des Satzes: pacta sunt servanda) 66.
IV.
Verfassung und völkerrechtliche Verträge 71.
§8
Die verfassunggebende Gewalt .
I.
Die verfassunggebende Gewalt als politischer Wille 75.
II.
Subjekt der verfassunggebenden Gewalt (Gott, Volk oder Nation, König, eine organisierte Gruppe) 77.
III.
Betätigung der verfassunggebenden Gewalt, insbesondere die demokratische Praxis (Nationalversammlung, Konvent, Plebiszit 82.
§9
Legitimität einer Verfassung
I.
Arten der Legitimität einer Verfassung 87.
II.
Legitimität einer Verfassung bedeutet nicht, daß eine Verfassung nach früher geltenden Verfassungsgesetzen zustande gekommen ist 88.
III.
Dynastische und demokratische Legitimität 90.
§10
Folgerungen aus der Lehre von der verfassunggebenden Gewalt, insbesondere der verfassunggebenden Gewalt des Volkes
I.
Ständiges Vorhandensein (Permanenz) der verfassunggebenden Gewalt 91.
II.
Kontinuität des Staates bei Verfassungsbeseitigung und -durchbrechung, sofern nur die verfassunggebende Gewalt die gleiche bleibt 93.
III.
Das Problem der Kontinuität bei Änderung des Subjekts der verfassunggebenden Gewalt (Verfassungsvernichtung) 94, insbesondere Kontinuität des Deutschen Reiches 1918/19 95.
IV.
Unterscheidung der verfassunggebenden Gewalt des Volkes von jeder konstituierten, d. h. verfassungsgesetzlichen Gewalt 98.
§11
Aus dem Begriff der Verfassung abzuleitende Begriffe (Verfassungsänderung, Verfassungsdurchbrechung, Verfassungssuspension, Verfassungsstreitigkeit, Hochverrat)
I.
Übersicht 99.
II
Verfassungsgesetzliche Verfassungsänderungen (Verfassungsrevision, Amendement) 101, Grenzen der Befugnis zu Verfassungsänderungen 102, Verfassungsdurchbrechungen und apokryphe Souveränitätsakte 106, Verfassungssuspension 109.
III.
Verfassungsstreitigkeiten 112.
IV.
Die Verfassung als Angriffs- und Schutzobjekt bei Hochverrat 119.
II. Abschnitt
Der rechtsstaatliche Bestandteil der modernen Verfassung
§12
Die Prinzipien des bürgerlichen Rechtsstaates
I.
Unterscheidung des rechtsstaatlichen Bestandteils vom politischen Bestandteil der modernen Verfassung 125; die beiden Prinzipien des bürgerlichen Rechtsstaates: Grundrechte (Verteilungsprinzip) und Gewaltenunterscheidung (organisatorisches Prinzip) 126.
II.
Der Begriff des Rechtsstaates und einzelne Kennzeichen (Gesetzmäßigkeit, Verwaltungsgerichtsbarkeit, Meßbarkeit aller staatlichen Befugnisse, Unabhängigkeit der Richter, Justizförmigkeit, Problem der politischen Justiz) 129.
§13
Der rechtsstaatliche Gesetzesbegriff
I.
Recht und Gesetz im bürgerlichen Rechtsstaat 138.
II.
Der sog. formelle Gesetzesbegriff 143.
III.
Der politische Gesetzesbegriff 146.
IV.
Die Bedeutung des generellen Charakters der Rechtsnorm 151.
§14
Die Grundrechte
I.
Geschichtliche Übersicht 157.
II.
Geschichtliche und rechtliche Bedeutung der feierlichen Erklärung von Grundrechten 161.
III.
Sachliche Einteilung und Unterscheidung der Grundrechte 163.
IV.
Institutionelle Garantien sind von Grundrechten zu unterscheiden 170.
V.
Grundpflichten sind im bürgerlichen Rechtsstaat nichts anderes als verfassungsgesetzliche Pflichten 174.
VI.
Einteilung der Grundrechte hinsichtlich des Schutzes gegen Einschränkungen und Eingriffe 175.
§15
Die Unterscheidung (sog. Teilung) der Gewalten
I.
Die geschichtliche Entstehung der Lehre von der Gewaltenunterscneidung 182.
II.
Trennung und Balancierung der Gewalten 186; Schema ihrer strengen Trennung 187; Schema einiger Balancierungen 197.
§16
Bürgerlicher Rechtsstaat und politische Form
I.
Die Verfassung des bürgerlichen Rechtsstaates ist immer eine gemischte Verfassung 200; Die Staatsformen werden zu Formen unterschiedener und geteilter Gewalten (Legislative, Exekutive) 202.
II
Die zwei Prinzipien politischer Form (Identität und Repräsentation) 204.
III.
Begriff der Repräsentation 208.
IV.
Die moderne Verfassung als Verbindung und Mischung bürgerlich-rechtsstaatlicher Prinzipien mit politischen Formprinzipien 216.
III. Abschnitt
Der politische Bestandteil der modernen Verfassung
§17
1. Die Lehre von der Demokratie, Grundbegriffe
I.
Übersicht über einige Begriffsbestimmungen 223.
II.
Der Begriff der Gleichheit (allgemeine Menschengleichheit, substantielle Gleichheit) 226.
III.
Definition der Demokratie 234.
§18
Das Volk und die demokratische Verfassung .
I.
Das Volk vor und über der Verfassung 238.
II.
Das Volk innerhalb der Verfassung (Wahlen und Abstimmungen) 239.
III.
Das Volk neben der verfassungsgesetzlichen Regelung (öffentliche Meinung) 242.
IV.
Übersicht über die Bedeutungen des Wortes „Volk” für eine moderne Verfassungslehre 251.
§19
Folgerungen aus dem politischen Prinzip der Demokratie
I.
Allgemeine Tendenzen 252.
II.
Der Staatsbürger in der Demokratie 253.
III.
Die Behörden (demokratische Methoden der Bestimmung von Behörden und Beamten) 256.
§20
Anwendungen des politischen Prinzips der Demokratie auf den einzelnen Gebieten des staatlichen Lebens
I.
Demokratie und Gesetzgebung (insbesondere Volksentscheid und Volksbegehren) 258.
II.
Demokratie und Regierung (insbesondere Herstellung unmittelbarer Beziehungen von Regierung und Volk) 265.
III.
Demokratie und völkerrechtlicher Verkehr 269.
IV.
Demokratie und Verwaltung 271.
V.
Demokratie und Justiz 273.
§21
Grenzen der Demokratie
I.
Grenzen des Prinzips der Identität 276.
II.
Grenzen aus der Natur des Volkes 277.
III.
Grenzen in der Praxis der heutigen Demokratie 277.
IV.
Kritik des Satzes: „Mehrheit entscheidet“ 278.
§22
2. Die Lehre von der Monarchie .
I.
Begründungen der Monarchie (theokratische, patriarchalische, patrimoniale, Beamten- und zäsaristische Monarchie) 282.
II.
Verfassungstheoretische Bedeutung der verschiedenen Rechtfertigungen der Monarchie 285.
III.
Die Stellung des Monarchen in der modernen Verfassung 288.
IV.
Der Staatspräsident in einer republikanischen Verfassung 290.
§23
3. Aristokratische Elemente in modernen bürgerlich-rechtsstaatlichen Verfassungen
I.
Das aristokratische Prinzip als Mittel der Gewaltenunterscheidung 292.
II.
Idee und Rechtfertigung des Zweikammersystems 293.
III.
Die geschichtlichen Typen des Zweikammersystems (Oberhaus, Herrenhaus, Senat, Staatenhaus) 295.
IV.
Zuständigkeit und Befugnisse des Oberhauses 299.
V.
Unvereinbarkeit der Doppelmitgliedschaft 303.
§24
4. Das parlamentarische System
I.
Vieldeutigkeit des Wortes „Parlamentarismus“, insbesondere die vier Unterarten (präsidentielles, Parlaments-, Premier- und Kabinett-System) 303.
II.
Die ideellen Grundlagen des parlamentarischen Systems (geschichtliche Lage des Bürgertums, Bildung und Besitz, öffentliche Diskussion; 307.
III.
Folgerungen aus dem Grundgedanken des parlamentarischen Systems (Repräsentation, Öffentlichkeit, Diskussion) 316.
§25
Geschichtliche Übersicht über die Entwicklung des parlamentarischen Systems
I.
Wichtigste Daten der geschichtlichen Entwicklung in England 320.
II.
Die Entwicklung in Frankreich und Belgien 326.
III.
Die Entwicklung in Deutschland 330.
§26
Übersicht über die Gestaltungsmöglichkeiten des parlamentarischen Systems
I.
Entscheidender Gesichtspunkt: Übereinstimmung von Parlament und Regierung 338.
II.
Mittel, um die Übereinstimmung zu bewirken 338.
III.
„Fälle“ der parlamentarischen Verantwortlichkeit („Kabinettsfälle“) 339.
§27
Das parlamentarische System der Weimarer Verfassung.
I.
Die Verbindung der vier Untersysteme 340.
II.
Übersicht 342.
III.
Die Praxis des parlamentarischen Systems der Weimarer Verfassung 1. Das Vertrauen des Reichstages (Art. 54 RV. Satz 1 und Satz 2) 343; 2. „Der Reichskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik“ (Art. 56) 345; 3. Das Kabinettsystem 348; 4. Das präsidentielle System 350.
§28
Die Auflösung des Parlaments
I.
Arten der Auflösung (monarchische, präsidentielle, ministerielle, Selbstauflösung, Auflösung auf Volksbegehren) 353.
II.
Das Auflösungsrecht des Reichspräsidenten 355.
IV. Abschnitt
Verfassungslehre des Bundes
§29
Grundbegriffe einer Verfassungslehre des Bundes
I.
Übersicht über die Arten zwischenstaatlicher Beziehungen und Verbindungen (Völkerrechtsgemeinschaft, Einzelbeziehungen, Bündnis, Bund) 363.
II.
Folgerungen aus der Begriffsbestimmung des Bundes (Befriedung, Garantie, Intervention, Exekution) 367.
III.
Die rechtlichen und politischen Antinomien des Bundes und ihre Aufhebung durch das Erfordernis der Homogenität 370.
§30
Folgerungen aus den Grundbegriffen der Verfassungslehre des Bundes .
I.
Jeder Bund hat als solcher eine politische Existenz mit einem selbständigen jus belli 379.
II.
Jeder Bund ist als solcher sowohl völkerrechtliches wie staatsrechtliches Subjekt 379.
III.
Jeder Bund hat ein Bundesgebiet 383.
IV.
Bundesrepräsentation, Bundeseinrichtungen und -behörden, Bundeszuständigkeit 384.
V.
Hochverräterische Unternehmungen gegen den Bund 387.
VI.
Demokratie und Föderalismus (insbesondere Art. 18 RV.) 388.
Register
Register der Artikel der Reichsverfassung 392.
Namenregister 394.
Sachregister 398.
Abkürzungen
RV.
Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919 (Weimarer Verfassung)
aRV.
Verfassung des Deutschen Reichs vom 16. April 1871 (Bismarcks Verfassung)
Prot.
Bericht und Protokolle des Achten Ausschusses der verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung (Berichte Nr. 21) über den Entwurf einer Verfassung des Deutschen Reichs (Carl Heymanns Verlag, Berlin, 1920)
AöR.
Archiv des öffentlichen Rechts
JöR.
Jahrbuch des öffentlichen Rechts
JW.
Juristische Wochenschrift
Die Hinweise auf die bekannten Veröffentlichungen (wie Anschütz, Kommentar; Poetzsch, Kommentar; Giese, Kommentar; Wittmayer, Weimarer Reichsverfassung; Meyer-Anschütz usw.) sowie die übrigen Zitierungen dürften ohne weiteres verständlich sein. L. Duguit, Manuel de Droit constitutionnel, ist gelegentlich nicht nach der neuesten Auflage (1923), sondern wegen der ausführlicheren geschichtlichen Darlegungen nach der ersten Auflage (190/) zitiert.
I. Abschnitt
Begriff der Verfassung
§ 1 Absoluter Verfassungsbegriff
(Die Verfassung als einheitliches Ganzes)
Das Wort „Verfassung" hat einen verschiedenen Sinn. In einer allgemeinen Bedeutung des Wortes ist alles, jeder Mensch und jedes Ding, jeder Betrieb und jeder Verein irgendwie in einer „Verfassung" und kann alles mögliche eine „Verfassung" haben. Daraus ergibt sich kein spezifischer Begriff. Das Wort „Verfassung" muß auf die Verfassung des Staates, d. h. der politischen Einheit eines Volkes beschränkt werden, wenn eine Verständigung möglich sein soll. In dieser Beschränkung kann es den Staat selbst, und zwar den einzelnen, konkreten Staat als politische Einheit oder als eine besondere, konkrete Art und Form der staatlichen Existenz bezeichnen; dann bedeutet es den Gesamtzustand politischer Einheit und Ordnung. „Verfassung" kann aber auch ein geschlossenes System von Normen bedeuten und bezeichnet dann ebenfalls eine Einheit, jedoch keine konkret existierende, sondern eine gedachte, ideelle Einheit. In beiden Fällen ist der Verfassungsbegriff absolut, weil er ein (wirkliches oder gedachtes) Ganzes angibt. Daneben herrscht heute eine Ausdrucksweise, welche eine Reihe von bestimmt gearteten Gesetzen Verfassung nennt. Verfassung und Verfassungsgesetz werden dabei als dasselbe behandelt. Auf diese Weise kann jedes einzelne Verfassungsgesetz als Verfassung erscheinen. Der Begriff wird infolgedessen relativ; er betrifft nicht mehr ein Ganzes, eine Ordnung und eine Einheit, sondern einige, mehrere oder viele besonders geartete gesetzliche Einzelbestimmungen.
[4] I.Verfassung im absoluten Sinne kann zunächst die konkrete, mit jeder existierenden politischen Einheit von selbst gegebene Daseinsweise bedeuten.
Diesen Sinn hat das Wort „Verfassung" oft bei den griechischen Philosophen. Nach Aristoteles ist der Staat (πολιτεία) eine Ordnung (τάξις) des natürlich gegebenen Zusammenlebens von Menschen einer Stadt (πόλις) oder eines Gebietes. Die Ordnung betrifft die Herrschaft im Staat und ihre Gliederung; kraft ihrer ist ein Herrscher (κύριος) da. Zu ihr gehört aber auch das lebendige, in der seinsmäßigen Eigenart des konkreten politischen Gebildes enthaltene Ziel (τέλος) dieser Ordnung (Politik Buch IV, Kap. I, 5). Wird diese Verfassung beseitigt, so hört der Staat auf; wird eine neue Verfassung begründet. So entsteht ein neuer Staat. Isokrates (Areopag. 14) nennt die Verfassung die Seele der Polis (φύχη πόλεως ή πολιτεία). Am besten wird diese Vorstellung von der Verfassung vielleicht durch einen Vergleich verdeudicht: Das Lied oder Musikstück eines Chores bleibt dasselbe, wenn die Menschen, die es singen oder aufführen, sich ändern oder wenn der Platz sich ändert, an welchem sie singen oder musizieren. Die Einheit und Ordnung liegt in dem Lied und in der Partitur, wie die Einheit und Ordnung des Staates in seiner Verfassung liegt.
'Wenn Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 491, die Verfassung als „eine Ordnung, der gemäß der staatliche Wille sich bildet", hinstellt, so verwechselt er eine seinsmäßig vorhandene Ordnung mit einer Norm, der gemäß etwas gesetzmäßig und richtig funktioniert. Alle hier in Betracht kommenden Vorstellungen, wie Einheit, Ordnung, Ziel (τέλος), Leben, Seele, sollen etwas Seiendes, nicht etwas nur Normatives, richtigerweise Gesolltes angeben.
In diesem Sinne wird das Wort „status" (neben anderen Bedeutungen des vieldeutigen Wortes, z. B. Zustand im allgemeinen, Stand usw.) besonders im Mittelalter und im 17. Jahrhundert gebraucht. Thomas von Aqnin unterscheidet in seiner Summa theologica (I, II, 19, 10 c) als Staatsformen (status) im Anschluß an Aristoteles 1. den aristokratischen Staat (status optimatum), in welchem eine irgendwie ausgezeichnete und hervorragende Minderheit regiert (in quo pauci virtuosi principantur); 2. die Oligarchie (status paucorum), d. h. die Herrschaft einer Minderzahl, ohne Rücksicht auf eine besondere auszeichnende Qualität; 3. die Demokratie (den status popularis), in welchem die Menge der Bauern, Handwerker und Arbeiter herrscht. Bodinus (Les six livres de la République, 1. Ausgabe 1577, besonders im VI. Buch) unterscheidet nach solchen Staatsformen Volksstaat (état populaire), monarchischer Staat (état royal) und aristokratischer Staat. Bei Grotius (De iure belli ac pacis 1625) ist status, soweit der Ausdruck hier interessiert, die „forma civitatis" und damit auch Verfassung. In ähnlicher Weise spricht Hobbes (z. B. De cive 1642, cap. 10) von status monarchicus, status democraticus, status mixtus usw.
Mit einer erfolgreichen Revolution ist daher ohne weiteres ein neuer Status und eo ipso eine neue Verfassung gegeben. So konnte in Deutschland nach der Umwälzung vom November 1918 der Rat der Volksbeauftragten in einer Bekanntmachung vom 9. Dezember 1918 von der „durch die Revolution gegebenen Verfassung" sprechen (W. Jellinek, Revolution und Reichsverfassung, Jahrb. des öffentl. Rechts IX, 1920, S. 22).
Dieser Begriff von Verfassung steht im Gegensatz zu den vorigen Begriffen, welche von einem Status (in dem Sinne einer statischen Einheit) sprechen. Doch ist in der Vorstellung des Aristoteles das dynamische Element ebenfalls vorhanden, die scharfe Trennung von Statisch und Dynamisch hat etwas Künstliches und Gewaltsames. Auf jeden Fall bleibt dieser „dynamische" Begriff von Verfassung in der Sphäre des (werdenden) Seins und des Existierens; die Verfassung wird also noch nicht (wie nach dem unter II zu behandelnden Verfassungsbegriff) zu einer bloßen Regel oder Norm, unter welche man subsumiert. Die Verfassung ist das aktive Prinzip eines dynamischen Prozesses wirksamer Energien, ein Element des Werdens, aber wirklich, nicht eine geregelte Prozedur von „Sollens"-Vorschriften und Zurechnungen.
Lorenz von Stein hat diesen Verfassungsbegriff in einem großen systematischen Zusammenhang dargelegt. Er spricht zwar nur von den französischen Verfassungen seit 1789, trifft aber gleichzeitig ein allgemeines dualistisches Prinzip der Verfassungslehre, das besonders bei Thomas von Aquin (Summa Theol., I, II, 105, art. 1) deutlich erkannt ist, indem zwei Dinge hervorgehoben werden (duo sunt attendenda): einmal die Beteiligung aller Bürger an der staatlichen Willensbildung (ut omnes aliquam partem habeant in principatu) und zweitens die Art der Regierung und Herrschaft (species regiminis vel ordinationis principatuum). Es ist der alte Gegensatz von Freiheit und Ordnung, der mit dem Gegensatz der unten (§ 16, II) zu entwickelnden politischen Formprinzipien (Identität und Repräsentation) verwandt ist. Für Stein sind die ersten Verfassungen der Revolution von 1789 (nämlich die Verfassungen von 1791, 1793, 1795) im eigentlichen Sinne Staats-Verfassungen im Gegensatz zu den Staats-Ordnungen, welche mit Napoleon (1799) beginnen. Der Unterschied liegt in folgendem: Die Staats Verfassung ist diejenige Ordnung, welche die Übereinstimmung der Einzel-Willen mit dem staatlichen Gesamtwillen herbeiführt und die einzelnen zu lebendigen Gliedern des staatlichen Organismus zusammenfaßt. Alle Verfassungs-Einrichtungen und -Vorgänge haben den Sinn, daß der Staat „sich als die persönliche Einheit des Willens aller freien, zur Selbstbeherrschung bestimmten Persönlichkeiten erkennt". Die Staats-Ordnung dagegen betrachtet die einzelnen und die Behörden schon als Glieder des Staates und verlangt von ihnen Gehorsam. In der Staats-Verfassung steigt das staatliche Leben von unten nach oben; in der Staats-Ordnung wirkt es von oben nach unten. Die Staats-Verfassung ist freie Bildung des Staatswillens; die Staats-Ordnung ist organische Vollziehung des so gebildeten Willens (Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich, Bd. I, Der Begriff der Gesellschaft, Ausgabe von G. Salomon, München 1921, Bd. I, S. 408 / 9; ferner Verwaltungslehre, I, S. 25). — Der Gedanke, daß die Verfassung das wirkende Grundprinzip politischer Einheit ist, hat in dem berühmten Vortrag von F. Lassalle, Über Verfassungswesen, 1862, einen prägnanten Ausdruck gefunden: „Wenn also die Verfassung das Grundgesetz eines Landes bildet, so wäre sie ... eine tätige Kraft." Diese tätige Kraft und das Wesen der Verfassung findet Lassalle in den tatsächlichen Machtverhältnissen.
Für das verfassungstheoretische Denken des deutschen 19. Jahrhunderts ist Lorenz von Stein die Grundlage gewesen (und gleichzeitig die Vermittlung, in welcher Hegels Staatsphilosophie lebendig blieb). Bei Robert Mohl, in der Rechtsstaatslehre von Rudolf Gneist, bei Albert Haenel, überall sind die Gedanken von Stein zu erkennen. Das hört auf, sobald das verfassungstheoretische Denken aufhört, nämlich mit der Herrschaft der Methoden von Laband, die sich darauf beschränkten, an dem Text verfassungsgesetzlicher Bestimmungen die Kunst der Wortinterpretation zu üben; man nannte das „Positivismus".
[7] Erst Rudolf Smend hat in seinem Aufsatz „Die politische Gewalt im Verfassungsstaat und das Problem der Staatsform" (Festgabe für W. Kahl, Tübingen 1923) das verfassungstheoretische Problem wieder in seinem ganzen Umfang gestellt. Auf die Gedanken dieses Aufsatzes ist im folgenden noch öfters zurückzukommen. So, wie sie bisher — leider nur in einer Skizze — vorliegen, scheint mir die Lehre von der „Integrierung" der staatlichen Einheit eine unmittelbare Fortsetzung der Lehren von Lorenz von Stein zu enthalten.
Die Redewendung, daß nicht Menschen, sondern Normen und Gesetze herrschen und in diesem Sinne „souverän" sein sollen, ist sehr alt. Für die moderne Verfassungslehre kommt folgende geschichtliche Entwicklung in Betracht: In der Zeit der monarchischen Restauration in Frankreich und unter der Julimonarchie (also von 1815 bis 1848) haben besonders die Vertreter des bürgerlichen Liberalismus, die sogenannten „Doktrinäre", die Verfassung (die Charte) als „souverän" bezeichnet. Diese merkwürdige [8] Personifizierung eines geschriebenen Gesetzes hatte den Sinn, das Gesetz mit seinen Garantien der bürgerlichen Freiheit und des Privateigentums über jede politische Macht zu erheben. Auf diese Weise war die eigentlich politische Frage, ob der Fürst oder das Volk souverän sei, umgangen; die Antwort lautete einfach: weder der Fürst noch das Volk, sondern „die Verfassung" ist souverän (vgl. unten § 6, II, 7, S. 54). Das ist die typische Antwort der Liberalen des bürgerlichen Rechtsstaates, für welche sowohl die Monarchie wie die Demokratie im Interesse der bürgerlichen Freiheit und des Privateigentums beschränkt wird (darüber unten § 16, S. 216). So spricht ein typischer „Doktrinär" der Restaurations- und Louis-Philippe-Zeit, Royer-Collard, von der Souveränität der Verfassung (Nachweise bei J. Barthélemy, Introduction du régime parlementaire en France, 1904, S. 20 ff.); Guizot, ein klassischer Vertreter liberaler Rechtsstaatlichkeit, spricht von der „Souveränität der Vernunft", der Gerechtigkeit und anderer Abstrakta, in der richtigen Erkenntnis, daß eine Norm nur insoweit „souverän" heißen kann, als sie nicht positiver Wille und Befehl, sondern das rational Richtige, Vernunft und Gerechtigkeit ist, also bestimmte Qualitäten hat; denn sonst ist eben derjenige, der will und befiehlt, souverän. Tocqueville hat für die französische Verfassung von 1830 in konsequenter Weise die Unabänderlichkeit der Verfassung vertreten und betont, daß sämtliche Befugnisse des Volkes, des Königs wie des Parlaments aus dieser Verfassung abgeleitet und außerhalb der Verfassung alle diese politischen Größen nichts sind („hors de la Constitution il ne sont rien", Anm. 12 zu Bd. I, cap. 6 der „Démocratie en Amérique").
Die in vielen Büchern (Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatz, 2. Aufl. 1923; Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, 1920; Der soziologische und der juristische Staatsbegriff, 1922; Allgemeine Staatslehre, 1925) wiederholte Staatslehre von H. Kelsen stellt ebenfalls den Staat als ein System und eine Einheit von Rechtsnormen dar, freilich ohne den geringsten Versuch, das sachliche und logische Prinzip dieser „Einheit" und dieses „Systems" zu erklären, und ohne auseinanderzusetzen, wie es kommt und nach welcher Notwendigkeit es sich fügt, daß die vielen positiven gesetzlichen Bestimmungen eines Staates und die verschiedenen verfassungsgesetzlichen Normen ein solches „System" oder eine „Einheit" bilden. Das politische Sein oder Werden der staatlichen Einheit und Ordnung wird in ein Funktionieren verwandelt, der Gegensatz von Sein und Sollen wird mit dem Gegensatz von substantiellem Sein und gesetzmäßigem Funktionieren beständig vermengt. Die Theorie wird aber verständlich, wenn man sie als letzten Ausläufer der vorerwähnten echten Theorie des bürgerlichen Rechtsstaates ansieht, welche aus dem Staat eine Rechtsordnung zu machen suchte und darin das Wesen des Rechtsstaates erblickte. In seiner großen Epoche, im 17. und 18. Jahrhundert, fand das Bürgertum die Kraft zu einem wirklichen System, nämlich zu dem individualistischen Vernunft- und Naturrecht, und bildete aus Begriffen wie Privateigentum und persönliche Freiheit in sich selbst geltende Normen,
[9] welche vor und über jedem politischen Sein gelten, weil sie richtig und vernünftig sind und daher ohne Rücksicht auf die seinsmäßige, d. h. positiv-rechtliche Wirklichkeit ein echtes Sollen enthalten. Das war konsequente Normativität; hier konnte man von System, Ordnung und Einheit sprechen. Bei Kelsen dagegen gelten nur positive Normen, d. h. solche, welche wirklich gelten; sie gelten nicht, weil sie richtigerweise gelten sollen, sondern ohne Rücksicht auf Qualitäten wie Vernünftigkeit, Gerechtigkeit usw. nur deshalb, weil sie positiv sind. Hier hört plötzlich das Sollen auf und bricht die Normativität ab; statt ihrer erscheint die Tautologie einer rohen Tatsächlichkeit: etwas gilt, wenn es gilt und weil es gilt. Das ist „Positivismus". Wer im Ernst darauf besteht, daß „die" Verfassung als „Grundnorm" gelten und alles andere Geltende sich daraus ableiten soll, darf nicht beliebige, konkrete Bestimmungen, weil sie von einer bestimmten Stelle gesetzt werden, anerkannt sind und deshalb als „positiv" bezeichnet werden, also nur faktisch wirksam sind, zur Grundlage eines reinen Systems von reinen Normen nehmen. Nur aus systematischen, ohne Rücksicht auf „positive" Geltung normativ konsequenten, also in sich selbst, kraft ihrer Vernünftigkeit oder Gerechtigkeit richtigen Sätzen läßt sich eine normative Einheit oder Ordnung ableiten.
2. In Wahrheit gilt eine Verfassung, weil sie von einer verfassunggebenden Gewalt (d. h. Macht oder Autorität1) ausgeht und durch deren Willen gesetzt ist. Das Wort „Wille" bezeichnet im Gegensatz zu bloßen Normen eine seinsmäßige Größe als den Ursprung eines Sollens. Der Wille ist existentiell vorhanden, seine Macht oder Autorität liegt in seinem Sein. Eine Norm kann gelten, weil sie richtig ist; dann führt die systematische Konsequenz zum Naturrecht und nicht zur positiven Verfassung; oder eine Norm gilt, weil sie positiv angeordnet ist, d. h. kraft eines existierenden Willens. Eine Norm setzt niemals sich selbst (das ist eine phantastische Redensart), sondern sie wird als richtig anerkannt, weil sie aus Sätzen ableitbar ist, deren Wesen ebenfalls Richtigkeit und nicht nur Positivität, d. h. wirkliches Angeordnetsein ist. Wer sagt, daß die Verfassung als Grund norm (nicht als positiver Wille) gelte, behauptet daher, daß sie kraft bestimmter logischer, moralischer oder anderer inhaltlicher Qualitäten ein geschlossenes System von richtigen Sätzen zu tragen imstande ist. Zu sagen, daß eine Verfassung nicht wegen ihrer normativen Richtigkeit, sondern nur wegen ihrer Positivität gelte und trotzdem als reine Norm ein System oder eine Ordnung von reinen Normen begründe, ist eine widerspruchsvolle Verwirrung.
[10] Es gibt kein geschlossenes Verfassungssystem rein normativer Art, und es ist willkürlich, eine Reihe einzelner Bestimmungen, die man als Verfassungsgesetze auffaßt, als systematische Einheit und Ordnung zu behandeln, wenn nicht die Einheit aus einem vorausgesetzten einheitlichen Willen entsteht. Ebenso ist es willkürlich, ohne weiteres von Rechtsordnung zu sprechen. Der Begriff der Rechtsordnung enthält zwei völlig verschiedene Elemente: das normative Element des Rechts und das seinsmäßige Element der konkreten Ordnung. Die Einheit und Ordnung liegt in der politischen Existenz des Staates, nicht in Gesetzen, Regeln und irgendwelchen Normativitäten. Die Vorstellungen und Worte, welche von der Verfassung als einem „Grundgesetz" oder einer „Grundnorm" sprechen, sind meistens unklar und ungenau. Sie unterstellen einer Reihe höchst verschiedenartiger Normierungen, z. B. den 181 Artikeln der Weimarer Verfassung, eine systematische, normative und logische „Einheit". Angesichts der gedanklichen und inhaltlichen Verschiedenheit der in den meisten Verfassungsgesetzen enthaltenen einzelnen Bestimmungen ist das nichts als eine grobe Fiktion. Die Einheit des Deutschen Reiches beruht nicht auf jenen 181 Artikeln und ihrem Gelten, sondern auf der politischen Existenz des deutschen Volkes. Der Wille des deutschen Volkes, also etwas Existenzielles, begründet, über alle systematischen Widersprüche, Zusammenhangslosigkeiten und Unklarheiten der einzelnen Verfassungsgesetze hinweg, die politische und staatsrechtliche Einheit. Die Weimarer Verfassung gilt, weil das deutsche Volk „sich diese Verfassung gegeben" hat.
3. Die Vorstellungen von der Verfassung als einer normativen Einheit und etwas Absolutem erklären sich geschichtlich aus einer Zeit, in der man die Verfassung für eine geschlossene Kodifikation hielt. In Frankreich herrschte 1789 dieser rationalistische Glaube an die Weisheit eines Gesetzgebers, und man traute sich zu, einen bewußten und vollständigen Plan des gesamten politischen und sozialen Lebens zu formulieren; ja, manche hatten Bedenken, auch nur die Möglichkeit einer Abänderung und Revision in Erwägung zu ziehen. Aber der Glaube an die Möglichkeit eines geschlossenen, den Staat in seiner Totalität erfassenden, endgültig richtigen Systems normativer Bestimmungen ist heute nicht mehr vorhanden. Heute ist das gegenteilige Bewußtsein verbreitet, daß der Text jeder Verfassung von der politischen und sozialen Lage ihrer Entstehungszeit abhängig ist. Die Gründe, aus denen bestimmte gesetzliche Fest [11]legungen gerade in eine „Verfassung" und nicht in ein einfaches Gesetz geschrieben werden, hängen von politischen Erwägungen und Zufällen der Parteikoalitionen ab. Mit dem Glauben an Kodifikation und systematische Einheit entfällt aber auch der reine Normbegriff der Verfassung, wie ihn die liberale Idee eines absoluten Rechtsstaates voraussetzt. Er war nur solange möglich, als die metaphysischen Voraussetzungen des bürgerlichen Naturrechts Glauben fanden. Die Verfassung verwandelt sich jetzt in eine Reihe von einzelnen positiven Verfassungsgesetzen. Wenn trotzdem heute immer noch von Grundnorm, Grundgesetz usw. gesprochen wird — es erübrigt sich, hierfür Beispiele und Nachweise zu zitieren —, so geschieht das unter der Nachwirkung überlieferter Formeln, die längst leer geworden sind. Ebenso ist es ungenau und verwirrend, dann immer noch von „der" Verfassung zu sprechen. In Wahrheit meint man eine unsystematische Mehrheit oder Vielheit verfassungsgesetzlicher Bestimmungen. Der Begriff der Verfassung ist zum Begriff des einzelnen Verfassungsgesetzes relativiert.
§2 Relativer Verfassungsbegriff
(Die Verfassung als eine Vielheit einzelner Gesetze)
Die Relativierung des Verfassungsbegriffes besteht darin, daß statt der einheitlichen Verfassung im Ganzen, nur das einzelne Verfassungsgesetz, der Begriff des Verfassungsgesetzes aber nach äußerlichen und nebensächlichen, sog. formalen Kennzeichen bestimmt wird.
I. Verfassung im relativen Sinne bedeutet also das einzelne Verfassungsgesetz. Jede inhaltliche und sachliche Unterscheidung geht verloren infolge der Auflösung der einheitlichen Verfassung in eine Vielheit einzelner, formal gleicher Verfassungsgesetze. Ob das Verfassungsgesetz die Organisation des staatlichen Willens regelt oder irgendeinen anderen Inhalt hat, ist für diesen „formalen" Begriff gleichgültig. Es wird überhaupt nicht mehr gefragt, warum eine verfassungsgesetzliche Bestimmung „grundlegend" sein muß. Diese relativierende, sog. formale Betrachtungsweise macht vielmehr unterschiedslos alles, was in einer „Verfassung" steht, gleich, d. h. gleich relativ.
[12] In der Weimarer Verfassung finden sich zahlreiche solcher verfassungsgesetzlichen Bestimmungen, von denen ohne weiteres ersichtlich ist, daß sie nicht grundlegend im Sinne eines „Gesetzes der Gesetze" sind: z. B. Art. 123 Abs. 2: „Versammlungen unter freiem Himmel können durch Reichsgesetz anmeldepflichtig gemacht und bei unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit verboten werden." Art. 129 Abs. 3 Satz 3: „Dem Beamten ist Einsicht in seine Personalnachweise zu gewähren." Art. 143: „Die Lehrer an öffentlichen Schulen haben die Rechte und Pflichten von Staatsbeamten." Art. 144, S. 2: „Die Schulaufsicht wird durch hauptamtlich tätige fachmännisch vorgebildete Beamte ausgeübt." Art. 149 Abs. 3: „Die theologischen Fakultäten an den Hochschulen bleiben erhalten." Alles das sind gesetzliche Regelungen, welche durch die Aufnahme in „die Verfassung" Verfassungsgesetze geworden sind. Die Aufnahme in „die Verfassung" erklärt sich aus der geschichtlichen und politischen Situation des Jahres 1919. Die Parteien, auf deren Zusammenwirken die Mehrheit der Weimarer Nationalversammlung beruhte, legten Wert darauf, gerade diesen Bestimmungen den Charakter von verfassungsgesetzlichen Normen zu geben. Ein sachlicher Grund, der mit rechtslogischer Notwendigkeit diese Einzelbestimmungen von anderen, ebenfalls sehr wichtigen Bestimmungen unterscheidet, ist nicht zu erkennen. Man hätte ebensogut in die Verfassung hineinschreiben können, daß die Zivil-Ehe und die Auflösbarkeit der Ehe garantiert werden, daß Testamentsfreiheit besteht, daß der Jagdberechtigte den Wildschaden in voller Höhe zu ersetzen hat oder daß die Mieten in den nächsten zehn Jahren nicht gesteigert werden dürfen.
Solche verfassungsgesetzlichen Einzelheiten sind für eine unterschiedslos formalisierende und relativierende Betrachtungsweise alle gleich „fundamental". Der Satz des Art. 1 Abs. 1 RV. : „Das Deutsche Reich ist eine Republik" und der Satz des Art. 129, daß „dem Beamten Einsicht in seine Personalnachweise zu gewähren" ist, heißen beide „Grundnormen", „Gesetz der Gesetze" usw. Es ist aber selbstverständlich, daß bei solcher Formalisierung nicht etwa jene Einzelbestimmungen fundamentalen Charakter erhalten, sondern umgekehrt, die echten Fundamentalbestimmungen auf die Stufe der verfassungsgesetzlichen Einzelheiten herabgedrückt werden.
Die „formalen" Merkmale des Verfassungsbegriffs sind nunmehr zu erörtern. Doch muß nochmals daran erinnert werden, daß die Verwirrung der heute üblichen Ausdrucksweise und Begriffsbildung sehr groß ist. Erstens wird Verfassung (als Einheit) und Verfassungsgesetz (als Einzelheit) stillschweigend gleichgestellt und verwechselt; zweitens wird „Verfassung im formalen Sinne" und „Verfassungsgesetz im formalen Sinne" nicht unterschieden; und endlich werden zur Bestimmung des „formalen" Charakters zwei Merkmale angegeben, die von ganz disparaten Gesichtspunkten aus gewonnen sind: einmal wird als „Verfassung im formalen Sinne" nur eine geschriebene Verfassung bezeichnet, und andrerseits soll das Formale des Verfassungsgesetzes und der stillschweigend damit gleichgestellten Verfassung darin bestehen, daß seine Abänderung an erschwerte Voraussetzungen und Verfahren gebunden ist.
[13] II.Die geschriebene Verfassung. Das „Formale" der geschriebenen Verfassung kann natürlich nicht darin liegen, daß irgend jemand irgendwelche Bestimmungen oder Abmachungen zu Papier bringt, beurkundet oder beurkunden läßt und deshalb eine schriftliche Urkunde vorliegt. Der Charakter des Formalen kann nur daraus gewonnen werden, daß bestimmte Eigenschaften, sei es der beurkundenden Person oder Stelle, sei es des beurkundeten Inhaltes, es rechtfertigen, von einer Verfassung im formalen Sinn zu sprechen. Geschichtlich betrachtet können Inhalt und Bedeutung der geschriebenen Verfassung sehr mannigfaltig und verschieden sein.
Im 19. Jahrhundert z. B., bis zum Jahre 1848, forderte das deutsche Bürgertum im Kampf mit der absoluten Monarchie eine geschriebene Verfassung. Hier wurde der Begriff der geschriebenen Verfassung zu einem Idealbegriff, in welchen die verschiedenartigsten Forderungen des bürgerlichen Rechtsstaates hineingelegt wurden. Es versteht sich von selbst, daß diese Forderungen des liberalen Bürgertums nach einer geschriebenen Verfassung nicht dadurch erfüllt waren, daß der König irgendeine Anordnung mit irgendeinem Inhalt erließ und darüber eine Urkunde angefertigt wurde. Als geschriebene Verfassung im Sinne dieser politischen Forderung galt nur das, was inhaltlich diesen Forderungen entsprach; vgl. darüber unten § 4, S. 39.
Die Gründe, welche dazu geführt haben, gerade eine geschriebene Verfassung als Verfassung im formalen Sinne zu bezeichnen, sind ebenfalls sehr verschieden und gehen von entgegengesetzten Gesichtspunkten aus, die hier unterschieden werden müssen. Zunächst ist es die allgemeine Vorstellung, daß etwas, was schriftlich fixiert ist, besser bewiesen werden kann, daß sein Inhalt stabil und gegen Änderungen geschützt ist. Die beiden Gesichtspunkte, Beweisbarkeit und größere Stabilität, genügen aber nicht, um in prägnantem Sinne von etwas Formalem zu sprechen. Vielmehr muß die Niederschrift von einer maßgeblichen Stelle ausgehen; es wird ein als maßgebend anerkanntes Verfahren vorausgesetzt, ehe das Geschriebene als authentisch geschrieben gelten kann. Niederschrift und Beurkundung kommen also zu einem bestimmten Verfahren nur hinzu und sind nicht das Entscheidende. Die geschriebene Verfassung muß in einem besonderen Verfahren zustande kommen, das heißt nach den Forderungen des deutschen Bürgertums des 19. Jahrhunderts: vereinbart werden (vgl. unten § 6, S. 54). „Wenn ich diese Frage (nach dem Wesen der Verfassung) einem Juristen stelle, so wird er mir hierauf etwa eine Antwort geben wie folgt: Eine Verfassung ist ein zwischen König und Volk beschworener Pakt, welcher die Grundprinzipien der Gesetzgebung und Regierung in einem Lande feststellt" (Lassalle, 1862). Die Verfassung wäre also ein geschriebener Vertrag.[14] Aber nachdem sie einmal zustande gekommen ist, wird sie im Wege der Gesetzgebung geändert und erscheint als geschriebenes Gesetz. In beiden Fällen handelt es sich natürlich nur darum, daß die Volksvertretung (das Parlament) mitwirkt; die Begriffe „Vertrag" und „Gesetz" haben nur den politischen Sinn, die Mitwirkung der Volksvertretung sicherzustellen. Die Beurkundung kommt hinzu, wie andere Formalitäten, z. B. die feierliche Beeidigung. Solche formalen Kennzeichen können sich niemals selbst genügen.
Es wurde aber schon erwähnt, daß der Glaube an solche Kodifikationen heute fehlt. Die Verfassungen der verschiedenen Staaten erscheinen als eine Reihe verschiedenartig zusammengesetzter Normierungen: organisatorische Bestimmungen über die wichtigsten staatlichen Behörden, über das Verfahren der Gesetzgebung und die Regierung, Programme und Richtlinien allgemeiner Art, Garantien gewisser Rechte und zahlreiche Einzelbestimmungen, die nur deshalb in die Verfassung hineingeschrieben werden, weil man sie den wechselnden Parlamentsmehrheiten entziehen will und weil die Parteien, welche den Inhalt der „Verfassung" bestimmen, die Gelegenheit benutzen, um ihren parteimäßigen Forderungen den Charakter von Verfassungsgesetzen zu verleihen. Auch wenn eine solche Reihe von Verfassungsgesetzen durch eine eigens zu diesem Zweck berufene verfassunggebende Versammlung beschlossen ist, liegt die Einheit der in ihr enthaltenen Bestimmungen nicht in ihrer inhaltlichen, systematischen und normativen Geschlossenheit, sondern außerhalb dieser Normen in einem politischen Willen, der alle diese Normen überhaupt erst zu Verfassungsgesetzen macht und als ihre einheitliche Grundlage ihre Einheit von sich aus bewirkt. In allen Ländern mit geschriebenen Verfassungen liegt heute in Wahrheit nur eine Mehrheit geschriebener Verfassungsgesetze vor.
So wird allgemein angenommen, daß Frankreich eine geschriebene Verfassung, eine Verfassung im formalen Sinne habe, und man spricht von „der" Verfassung des Jahres 1875, weil in diesem und den folgenden Jahren mehrere der wichtigsten Verfassungsgesetze ergangen sind. Bei den Verfassungsgesetzen des Jahres 1875 fehlt es aber, wie Barth élemy-Duez, S. 39 ff., richtig sagt, an jeder Methode, an jeder dogmatischen Vollständigkeit, sogar an dem Willen, vollständig und erschöpfend zu sein. „Il n'y a pas de Constitution; il y a des lois constitutionnelles." Im übrigen beruht alles auf Gewohnheit und Überlieferung, und es wäre ganz unmöglich, an der Hand der Texte dieser Verfassungsgesetze das staatliche Leben der französischen Republik zu erkennen und in ihnen in irgendeinem auch nur annähernd systematischen Sinne die erschöpfende Normierung des französischen Staatsrechts zu sehen.
Die Weimarer Verfassung ist im Vergleich zu diesen französischen Verfassungsgesetzen systematischer und vollständiger, was ihren organisatorischen Teil angeht. Aber sie enthält ebenfalls eine Reihe von einzelnen Gesetzen und heterogenen Prinzipien, so daß es auch hier nicht zulässig ist, von einer Ko [16]difikation im materiellen Sinne zu sprechen. Auch hier löst sich die geschlossene Einheit einer verfassungsgesetzlichen Kodifikation in eine Summe zahlreicher verfassungsgesetzlicher Einzelbestimmungen auf.
III.Erschwerte Abänderbarkeit als formales Kennzeichen des Verfassungsgesetzes. Das formale Merkmal der Verfassung und (unterschiedslos) des Verfassungsgesetzes wird darin gefunden, daß Verfassungsänderungen einem besonderen Verfahren mit erschwerten Bedingungen unterliegen. Durch die erschwerten Änderungsbedingungen soll die Dauer und Stabilität der Verfassungsgesetze geschützt werden und wird die „Gesetzeskraft erhöht".
Verfassungsgesetze sind nach Haenel (Staatsrecht I, S. 125, der übrigens auch hier der typischen Verwechslung von Verfassung und Verfassungsgesetz erliegt) „äußerlich hervorgehobene Gesetze, denen unter den gegebenen politisch-historischen Verhältnissen eine hervorragende Bedeutung beigemessen wurde und welche besondere Bürgschaften der Dauer und der Unverletzlichkeit dadurch empfingen, daß ihre Abänderungen an erschwerte Formen gebunden und ihre Einhaltung durch besondere Verantwortlichkeitsverhältnisse gesichert wurden". Diese Begriffsbestimmung Haenels ist noch besonders substantiell. G. Jellinek definiert einfach: „Das wesentliche rechtliche Merkmal von Verfassungsgesetzen liegt ausschließlich in ihrer erhöhten Gesetzeskraft ... daher sind jene Staaten, die keine formellen Unterschiede innerhalb ihrer Gesetze kennen, viel konsequenter, wenn sie die Zusammenfassung einer Reihe von Gesetzesbestimmungen unter dem Namen einer Verfassungsurkunde ablehnen" (Allg. Staatslehre, S. 520; Gesetz und Verordnung, S. 262); ferner Laband, Staatsrecht II, S. 38 ff. Egon Zweig, Die Lehre vom Pouvoir constituant, 1909, S. 5 / 6, W. Hildesheimer, Über die Revision moderner Staatsverfassungen (Abhandlungen aus dem Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, XV 1, Tübingen 1918) S. 5 ff.
1. Es gibt Staaten, in welchen alle gesetzlichen Bestimmungen ohne Rücksicht auf ihren Inhalt im Wege eines einfachen Gesetzes abgeändert werden können. Hier fehlt also jeder besondere Schutz gegen Änderungen und ist in dieser Hinsicht auch zwischen Verfassungsgesetzen und einfachen Gesetzen keinerlei Unterschied mehr, [17] so daß man „formal" gar nicht von Verfassungsgesetzen sprechen dürfte. Man spricht hier von biegsamen (flexiblen) Verfassungen, ein Sprachgebrauch, bei welchem die Frage offenbleibt, was unter „Verfassung" und „Verfassungsgesetz" überhaupt noch verstanden wird.
Als das Hauptbeispiel eines Landes ohne „Verfassung im formalen Sinne" gilt England, weil hier kein Unterschied gemacht wird zwischen wichtigen organisatorischen Bestimmungen, etwa über das Verhältnis von Oberhaus und Unterhaus, und irgendeinem andern im Vergleich dazu ganz unwichtigen Gesetz, etwa einem Gesetz über die Ausübung des Dentistenberufes. Alle Gesetze ohne Unterschied kommen durch Parlamentsbeschluß zustande, so daß formal die Verfassung von einer solchen Dentistenordnung nicht verschieden wäre. Die Unzulänglichkeit einer solchen Art von „Formalismus" zeigt sich schon an der Absurdität dieses Beispiels.
Zum Unterschied von diesen „biegsamen Verfassungen" heißen andere Verfassungen starr (rigide). Eine absolut starre Verfassung müßte jede Änderung irgendeiner ihrer Bestimmungen verbieten. In diesem absoluten Sinne dürfte es heute keine starren Verfassungen mehr geben. Doch kommt es vor, daß für einzelne Verfassungsbestimmungen ein formelles verfassungsgesetzliches Verbot der Änderung besteht. So verbietet ein französisches Gesetz vom 14. August 1884, die Staatsform der Republik zum Gegenstand eines verfassungsändernden Antrages zu machen. Das ist ein besonderer Fall, dessen eigentliche Bedeutung später zu behandeln ist. Für die hier zu erörternde formale Betrachtungsweise macht er im übrigen die französische Verfassung noch nicht zu einer absolut starren Verfassung.
Es werden aber auch solche Verfassungen als starr oder rigide bezeichnet, in welchen verfassungsgesetzlich die Möglichkeit von Verfassungsänderungen oder -revisionen vorgesehen ist, diese Änderung oder Revision aber an besondere, erschwerte Voraussetzungen oder Verfahren gebunden ist.
Beispiele: Art 76 RV.: „Die Verfassung kann im Wege der Gesetzgebung geändert werden. Jedoch kommen Beschlüsse des Reichstages auf Abänderung der Verfassung nur zustande, wenn zwei Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl anwesend sind und wenigstens zwei Drittel der Anwesenden zustimmen. Auch Beschlüsse des Reichsrates auf Abänderung der Verfassung bedürfen einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen." Art. 78 aRV.: „Veränderungen der Verfassung erfolgen im Wege der Gesetzgebung. Sie gelten als abgelehnt, wenn sie im Bundesrat 14 Stimmen gegen sich haben." Art. 8 des französischen Verfassungsgesetzes vom 25. Februar 1875 bestimmt, daß Verfassungsänderungen durch Beschluß einer „Nationalversammlung", d. h. der zu einer einzigen Versammlung vereinigten beiden Kammern — Deputiertenkammer und Senat — vor sich gehen. Ferner Art. 118 ff. der Schweizerischen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 (mit Unterscheidung von Total- und Partialrevision); Art. V der Amerikanischen Bundesverfassung von 1787 usw. vgl. unten § 11, S. 106.
Wenn keine verfassungsgesetzlichen Bestimmungen über Verfassungsänderungen bestehen (z. B. in den französischen Verfassungen [18] [Charten] von 1814 und 1830), kann es zweifelhaft sein, ob eine biegsame oder eine absolut starre Verfassung anzunehmen ist, d. h. ob verfassungsgesetzliche Änderungen im Wege eines einfachen Gesetzes zustande kommen oder ob das Schweigen der Verfassung bedeutet, daß Änderungen überhaupt verboten sind.
Die richtige Antwort lautet: Hier kann nur die Verfassung als Ganzes durch einen Akt der verfassunggebenden Gewalt beseitigt werden, während verfassungsge$efz/*c^e Änderungen allerdings verboten sind. Unrichtig Hildesheimer a. a. O. S. 8, dessen Beweisführung durch die Verwechslung von Verfassung und Verfassungsgesetz leider ganz unklar werden mußte.
2. In dem Erfordernis erschwerter Abänderbarkeit liegt eine gewisse Garantie der Dauer und Stabilität. Doch entfallen Garantie und Stabilität selbstverständlich, wenn eine Partei oder Parteikoalition über die nötigen Mehrheiten verfügt und irgendwie in der Lage ist, den erschwerten Voraussetzungen zu genügen. In Deutschland ist es, trotz der großen Parteizersplitterung, seit dem Jahre 1919 zu zahlreichen Gesetzen gekommen, die den Anforderungen des Art. 76 RV. entsprechen und deshalb als „verfassungsändernd" bezeichnet werden. Der ursprüngliche Sinn der Garantie einer Verfassung mußte verlorengehen, wenn die Verfassung als Ganzes zu einer Mehrheit von einzelnen Verfassungsgesetzen relativiert wurde. Die Verfassung ist nach Inhalt und Tragweite immer etwas Höheres und Umfassenderes als irgendein einzelnes Gesetz. Der Inhalt der Verfassung war nicht wegen seiner erschwerten Abänderbarkeit etwas Besonderes und Ausgezeichnetes, sondern umgekehrt: wegen seiner fundamentalen Bedeutung sollte er die Garantie der Dauer erhalten. Diese Erwägung verlor an Gewicht, wenn es sich nicht mehr um „die Verfassung", sondern um eines oder mehrere der zahlreichen einzelnen Verfassungsgesetze handelte. Jetzt stellte sich ein ganz einfacher, parteitaktischer Gesichtspunkt heraus: die erschwerte Abänderbarkeit war nicht mehr die Folge der Verfassungsqualität, sondern umgekehrt: man machte eine Bestimmung zum Verfassungsgesetz, um ihr aus irgendwelchen praktischen Gründen (die mit Grundnorm oder dergleichen nichts zu tun haben) Schutz vor dem Gesetzgeber, d. h. vor den wechselnden Parlamentsmehrheiten zu verleihen. Wenn in Frankreich im August 1926 durch Beschluß einer Nationalversammlung eine sog. „Caisse autonome" gebildet wird, um gewisse Einkünfte zur Tilgung der öffentlichen Schuld verfassungsgesetzlich sicherzustellen und den budgetrechtlichen Beschlüssen der jeweiligen Parlamentsmehrheit zu entziehen, so ist das wohl etwas prak [19]tisch sehr Wichtiges, aber nicht in dem alten Sinne „fundamental". Wenn die Bildung der Volksschullehrer nach den Grundsätzen „höherer Bildung" zu regeln (Art. 143 Abs. 2), der Religionsunterricht ordentliches Lehrfach in den Schulen (Art. 149 Abs. 1), dem Beamten Einsicht in seine Personalnachweise zu gewähren ist (Art. 129), so sind das gewiß sehr wichtige Bestimmungen, aber sie haben nur insofern den Charakter von „Verfassungsgesetzen", als sie vor abändernden Beschlüssen wechselnder Parlamentsmehrheiten geschützt sind.
Durch die Relativierung der Verfassung zum Verfassungsgesetz und die Formalisierung des Verfassungsgesetzes ist die sachliche Bedeutung der Verfassung ganz zurückgetreten. „Das wesentliche rechtliche Merkmal von Verfassungsgesetzen liegt ausschließlich in ihrer erhöhten formellen Gesetzeskraft" (G. Jellinek