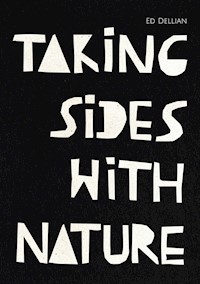
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch - wird die Philopsophie der "Aufklärung" (Kant und Nachfolger" als Herrschaftsanspruch über die Natur identifiziert und zurückgewiesen, - wird die unbekannte "exerimentelle Philosophie" (Galilei; Newton) als realistische Naturlehre rehabilitiert, - wird die moderne Physik (Einstein und Nachfolger) als Science Fiction entlarvt und verworfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Zum Geleit: Wie eine Fiktion die Realität korrumpiert
Vorwort
Teil I: Nachricht von den Antipoden Zurück zur Natur? Eine Wiederaufnahme?
I Antipoden
II Helden der autonomen Vernunft
III Weltbilder
IV Die Vernünftigkeit der Vernunft
V Der Kosmos, die Wahrheit – und die Hypothesen
VI Von Copernicus zu Bruno, Kepler, Galilei und Newton
VII Der Fall Galilei
VIII Experimental Philosophy – die kosmozentrische Hinwendung zur Natur im 17. Jahrhundert
IX Die anthropozentrische Reaktion: Kampf gegen die Natur
X Aufklärung über Aufklärung
XI »Was kann ich wissen?« (Über Glauben und Wissen)
XII Albert Einstein und »die Pippi-Langstrumpfisierung« der Weltanschauung
Teil II: Ignoranz und Anmaßung: Albert Einstein vergewaltigt Newtons Naturlehre
I Zu Einsteins Aufsatz über »Newtons Mechanik« (1927)
II Einsteins Text – und die notwendigen Kommentare
III Zusammenfassung und Schlusswort
Anhang
Einstein und die Quantenmechanik
Namensliste
Weitere Buchveröffentlichungen des Verfassers
Zum Geleit: Wie eine Fiktion die Realität korrumpiert.
Christian Morgenstern (1871–1914):
Die unmögliche Tatsache.
Palmström, etwas schon an Jahren,
wird an einer Straßenbeuge
und von einem Kraftfahrzeuge
überfahren.
»Wie war« (spricht er, sich erhebend
und entschlossen weiterlebend)
»möglich, wie dies Unglück, ja –:
daß es überhaupt geschah?
Ist die Staatskunst anzuklagen
in Bezug auf Kraftfahrwagen?
Gab die Polizeivorschrift
hier dem Fahrer freie Trift?
Oder war vielmehr verboten,
hier Lebendige zu Toten
umzuwandeln, – kurz und schlicht:
Durfte hier der Fahrer nicht –?«
Eingehüllt in feuchte Tücher
prüft er die Gesetzesbücher
und ist alsobald im Klaren:
Wagen durften dort nicht fahren!
Und er kommt zu dem Ergebnis:
»Nur ein Traum war das Erlebnis.
Weil«, so schließt er messerscharf,
»nicht sein kann was nicht sein darf«.
Vorwort
I
Weltanschauungen ändern sich. Das lehrt die Erfahrung. Die Christen des ersten Jahrtausends lebten in der Schöpfung Gottes. Diese stellte das für alle verbindliche, absolut wahre, reale, räumlich-zeitliche Maß- und Bezugssystem aller Dinge. Die frühe christliche Weltanschauung war kosmozentrisch und theozentrisch geprägt: Im Zentrum, auf das sich »alles« bezog, stand der geschaffene Kosmos und dessen Schöpfer. Er gab allen Dingen ihr Maß, an dem sie zu erkennen waren: »Du hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht bestimmt«, schreibt die Bibel.
Dagegen die säkulare Neuzeit. Sie denkt und lebt anthropozentrisch. Ihr gilt der Mensch als maß-gebendes Zentrum und Maß aller Dinge. Sie kennt ausschließlich subjektive Sichtweisen auf die ausschließlich materielle Welt. Verbindlich ist ihr nur das Unverbindliche. Partei ergreift sie für die menschliche Erfindungskraft. Wissen stützt man auf menschliche Gedanken, auf Theorien und Hypothesen. Räumlich-zeitliche Maß- und Bezugssysteme erscheinen beliebig variabel. Alle Erkenntnisse gelten als fiktional, hypothetisch, stets revidierbar, immer relativ, abhängig vom jeweiligen Standort, niemals wirklich endgültig erwiesen; ja – niemals beweisbar: »Any physical theory is only a hypothesis; you can never prove it« (Stephen Hawking).
Einsteins Relativitätstheorien entsprechen alledem. Ob sie »richtig« sind oder nicht, ist in der anthropozentrischen Gegenwart eine müßige Frage. Dass sie mit ihren eigenen Voraussetzungen übereinstimmen, ist vielfach bestätigt und steht fest. Seit mehr als hundert Jahren hält man sie deshalb für den eigentlichen Ausdruck, ja für das Fundament des modernen wissenschaftlichen Zeitalters.
Sind Weltanschauungen beliebig vertauschbar? Das meinte einmal ein Münchner Freund. Er widersprach meiner Kritik der modernen Weltsicht mit den unnachahmlich lakonischen bayerischen Worten: »Mir is’s a-so lieber.« Er wollte seine gewohnten Überzeugungen beibehalten, im relativistischen Glauben, sie seien so gut wie alle anderen, denn die eine Wahrheit gebe es ohnehin nicht. Wäre demnach Relativismus und Beliebigkeit das letzte Wort, so wäre alle Wissenschaft bloß mehr oder weniger unterhaltsame Literatur. Ich habe aber dieses Buch geschrieben, um zu zeigen: Die anthropozentrische Pippi-Langstrumpf-Welt, die sich jedermann so denken könnte, wie es ihm gefällt, steht nicht nach Belieben zur Wahl. Die Erfahrung lehrt, dass es eine kosmische Wirklichkeit gibt, die, weil sie wirklich »ist«, auch »wirklich wahr« ist, so dass die relativistische Weltsicht an ihr zerschellt.
Diese Wirklichkeit der Welt ist aus dem Blickfeld geraten, seit menschliche Gedanken darüber bestimmen, ob Tag, ob Traum, ob Sein oder Nichtsein. Sie muss aber wieder erkannt und sie muss endlich verstanden werden, wenn die geschaffene Natur vor gewalttätiger Zerstörung und wenn die Vernunft der kosmischen Ordnung bewahrt werden soll, in der wir in Wahrheit leben, weben und sind – und alle Dinge.
II
Ist die Natur Freund oder Feind?
Politiker entwickeln ökologische »Visionen«, Aktivisten möchten »die Welt verbessern« – nach ihren Vorstellungen. Einmal für die Natur, ein andermal gegen sie. Der Regenwald soll erhalten, die natürliche Geschlechterordnung soll beseitigt werden. Alle wollen den Klimawandel »in den Griff bekommen«. Die Formulierung verrät den Anspruch auf Herrschaft über die natürliche Wirklichkeit der Welt.
Seit Jahrhunderten wird die Weltanschauung der westlichen Hemisphäre immer wieder von »Ideen« geprägt, heimgesucht von einander abwechselnden Produkten der menschlichen Einbildungskraft. Sie entspringen allesamt dem Glauben, der Mensch könne die Welt durch sein Denken beherrschen und verändern. Weltweit lenkt auch den »wissenschaftlichen« Betrieb im technischen Zeitalter ein Gedanke: die Idee, der Mensch könne und müsse sich nach seinem Maß und Ermessen die Natur dienstbar machen. Die Wissenschaften, die sich mit der Natur befassen, sind – entgegen verbreitetem Mythos – keineswegs weltanschaulich neutral. Gerade die sogenannten »Naturwissenschaften« leben methodisch und in ihren Zielsetzungen von der anthropozentrischen Herrschafts- und Beherrschungs-Perspektive der Moderne. Das Ergebnis ist ein »instrumentalistisches« Natur- und Wissenschaftsverständnis. Es geht der so organisierten Wissenschaft in aller Regel nicht darum, natürliche Abläufe wirklich zu verstehen, sondern um ihre Manipulation zur Durchsetzung menschlicher Pläne. Die Wissenschaft ist Partei. Nicht für die Natur, nicht für die Wahrheit. Sie ist immer Partei »für den Menschen«, für seine Hypothesen, für seine Utopien.
Nun mehren sich aber die Flammenschriften an der Wand, dass es dringlich geboten sein könnte, gegen den menschlichen Beherrschungsanspruch für die Natur Partei zu ergreifen, um mit ihr in Frieden zu leben. Was das konkret heißt, wird im Folgenden skizziert. Notwendig ist dazu nicht weniger als eine kosmozentrische Revolution. Es gilt, die hypothetische Weltsicht zu überwinden. Wer die Natur seinen Hypothesen unterwirft, nimmt bereits Partei gegen sie. Es gilt aber, die natürlichen Prinzipien der realen kosmischen Weltordnung in Raum und Zeit wiederzuentdecken und zu respektieren und dadurch die dominierende realitätsferne, nur scheinbar ideologiefreie, in Wahrheit aggressiv natur-, realitäts- und wahrheitsfeindliche Wissenschaft, Wissenschaftsphilosophie und Weltanschauung zu überwinden: Taking Sides With Nature. Eine uralte Weisheit, immer wieder verschüttet, kommt von Neuem ans Licht: Die Natur, der Kosmos, nicht der Mensch, ist das wahre Maß aller Dinge. Deshalb heißt, für die Natur Partei ergreifen, auch, für die Wahrheit Partei ergreifen: Taking Sides With Truth. Den Titel meines Buches ergänzt ein Untertitel, der sich an Galileis »Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme« von 1632 anlehnt. Auch dort ging es um Realität oder Fiktion, und um die Wahrheit.
Im Folgenden findet man einen »Teil I«, betitelt »Nachricht von den Antipoden«, und einen Teil II »Ignoranz und Anmaßung«. Teil I ist ein Essay über zwei antipodische Weltanschauungen, die »kosmozentrische« experimentelle Philosophie des 17. Jahrhunderts, und die »anthropozentrische« Alternative, wie sie davor in der Scholastik galt und wie sie seit der »Aufklärung« des 18. Jahrhunderts wieder dominiert, bis heute. Beide Perspektiven trennt ein verborgener Abgrund. Verborgen, versteckt wird er unter dem Mythos, das Wissen der Menschen von Wirklichkeit und Welt, also »die Wissenschaft«, habe seit den modernen Anfängen eine kontinuierlich »fortschrittliche« und stets von neuen Ideen getragene, immer »aufwärts« führende Entwicklung genommen.
In Wahrheit ereignete sich zuletzt mit der Aufklärung etwa ab 1750 eine reaktionäre weltanschauliche Rolle rückwärts, eine neuscholastische Wiederherstellung des spätmittelalterlichen Herrschaftsanspruchs der menschlichen Ratio, eine Zeitenwende von ungeheurer Tragweite. Sie verwandelte die gerade erst in Italien (Galileo Galilei) und in England (Isaac Newton) erneuerte kosmozentrischrealistische, auf die Erfahrung der Natur gegründete natürliche Philosophie (philosophia naturalis), zurück in ein auf menschliche Hypothesen gegründetes intellektuelles Konstrukt. Man kennt es unter der Bezeichnung »Physik«. Es war und ist eine anthropozentrische »Theorie« der Natur: eine realitätsferne materialistische und relativistische Herrschaftsideologie. Unter ihrer Anleitung sind nun in rund drei Jahrhunderten ganz unübersehbar Folgen eingetreten, die den Fortbestand der menschlichen Kultur in Frage stellen.
Die intellektuelle Zerstörung der kosmozentrischen Weltsicht und Naturlehre Galileis und Newtons setzte im 20. Jahrhundert Albert Einstein fort. Das ist der Gegenstand von Teil II. Hier geht es im Detail um die moderne Ignoranz gegenüber der Wirklichkeit der Natur und um die Anmaßung, mit der Einstein und andere versuchten, die Ergebnisse der galilei-newtonischen, erfahrungsbegründeten und deshalb realistischen und wahren Naturforschung in den Schatten zu stellen, damit ihr eigenes Licht heller leuchte. Einsteins »Relativitätstheorien« sind herausragende Beispiele der in Wissenschaft und Philosophie herrschenden anthropozentrischen Ideologie, welche die menschliche Einbildungskraft über alles bewundert und jede der Natur selbst innewohnende Vernunft oder Wahrheit ignoriert.
An Einsteins Theorien kann allerdings musterhaft nachgewiesen werden, dass menschliche Ideen (Hypothesen) immer nur Fiktionen hervorbringen, Märchen oder »fabulae«, Fabeln, wie Isaac Newton sie nannte; niemals jedoch wahre Einsichten in die Wirklichkeit der Natur. Zu zeigen ist, dass hierfür die logische Mangelhaftigkeit oder Zirkularität der anthropozentrischen Weltanschauung verantwortlich ist. Sie prägt nicht nur die realitäts- und wahrheitsfernen Relativitätstheorien, sondern die gesamte moderne Naturwissenschaft, wo immer sie sich auf Hypothesen stützt. Zu zeigen ist insbesondere, wie auch der aktuelle Versuch, Einsteins allgemeine Relativitätstheorie zu »beweisen«, indem man angeblich Phänomene identifiziert, welche diese Theorie »vorhersagt« (»schwarze Löcher«, »Gravitationswellen«), an den Denkgesetzen scheitert, weil zur Interpretation der Phänomene im Sinne des »Vorhergesagten« die Realität der Vorhersage vorausgesetzt werden muss und deshalb auch tatsächlich kurzerhand vorausgesetzt wird (petitio principii). Man kann aber die Existenz des Einhorns nicht mit einem Märchen beweisen, in dem es vorkommt. Man kann aus Prinzipien, die nur durch Denken gewonnen werden, unmöglich realistische und deshalb wahre Erkenntnisse über die Wirklichkeit herleiten und niemals ein wahres Bild von der realen Welt.
Teil I: Nachricht von den Antipoden
Zurück zur Natur? Eine Wiederaufnahme?
I Antipoden
Auf dem Rund der Erdkugel liegt jedem Ort ein anderer Ort genau gegenüber. Dessen Bewohner nennt man, vom Bezugsort aus gesehen, »Antipoden«, die »Gegenfüßler«: Menschen an »antipodisch« gelegenen Orten der Welt stehen sich sozusagen mit den Füßen gegenüber.
Weltanschauliche Antipoden vertreten diametral einander gegenüberstehende weltanschauliche Positionen. Eine »Nachricht von den Antipoden« berichtet über eine Weltanschauung, die derjenigen des Empfängers der Nachricht genau entgegengesetzt ist.
Die gegenwärtig dominierende »wissenschaftliche Weltanschauung« hält die Welt »an sich« für ungeordnet. Spricht die Natur gegen diese Annahme, weisen Phänomene auf eine ordnende Intelligenz hin (»Intelligent Design«), so erklärt man das für Schein und Zufall. Ordnung bringt in das ursprüngliche Chaos nach dieser Auffassung erst der Mensch. Er ist das Maß- und Bezugssystem aller rationalen Erkenntnis. »Homo mensura«: Die menschliche Vernunft gilt als das »Maß aller Dinge«. Die Ordnungsprinzipien der »Ideen« des Menschen, seiner Gedanken, seines Denkens, die Gesetze der Logik sind die Prinzipien, die auch die Welt ordnen sollen. Der vernünftige, der »aufgeklärte« Mensch begreift nur die nach seinem Maß geordnete Welt als rationales Gefüge; also will er sie nach seinem Maß einrichten und ihr vorschreiben, wie sie sein soll. Mit einem Wort Immanuel Kants: »Die Vernunft sieht nur das ein, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt.«
Diese »idealistische«, an menschlichen »Ideen« orientierte Sichtweise wird im Folgenden als anthropozentrische Weltanschauung bezeichnet. Da hiernach jeder Mensch (anthropos) als »Maß aller Dinge« gilt, so ist alle Erkenntnis, »anthropozentrisch« gesehen, relativ, nämlich bedingt durch den jeweiligen Standort des menschlichen Beobachters. »Wahrheit« ist in diesem Sinnzusammenhang nichts Objektives; woran wäre sie verbindlich zu messen? Wahrheit ist hier nur eine Eigenschaft von Sätzen. Sie ist allein mit der logischen Folgerichtigkeit dessen, was man, gesagt oder geschrieben, aus »Hypothesen« (Ideen oder Prämissen) herleitet (deduziert), gegeben. Die Wahl der Hypothesen ist aber prinzipiell so frei, wie das Denken frei ist, und so ist die Wahrheit relativ. Deshalb sagt man »relativistisch« folgerichtig oder »plausibel«, jeder habe »seine« eigene Erkenntnis oder »Wahrheit«. Im Berliner Wahlkampf brachte vor einigen Jahren eine »grüne« Partei den umfassend-totalen Geltungsanspruch dieser Weltanschauung auf die treffende Formel: »Dein Gott, dein Sex, dein Ding.«
Die »antipodische« weltanschauliche Alternative hierzu erkennt die sinnliche Erfahrbarkeit einer realen Welt »da draußen« als Beweis für deren Existenz. Die Erfahrung der Natur vermittelt dem Menschen seit Jahrtausenden Kenntnisse von der messbaren metrischen Verfasstheit und Ordnung dieser Welt. Die Welt erweist sich real als Kosmos, als metrisch geordnetes, räumlich-zeitliches »Maß- und Bezugssystem« rationaler, »geometrisch« messender Erkenntnis. Alles, was in Raum und Zeit erfahrbar existiert und »ist«, wird messend, relativ zu den unverrückbaren kosmischen Maßstäben »Raum« und »Zeit«, als real, als »wirklich« und »wahr« existierend erkannt. »Wahrheit« ist in diesem Sinnzusammenhang keine Eigenschaft von Sätzen, kein Gegenstand der Logik: Sie ist vielmehr eine Eigenschaft oder ein Charakteristikum des Seins. »Wahr« ist, was wirklich ist und wirklich ist. Die skizzierte Weltanschauung nenne ich »realistisch« oder auch »kosmozentrisch«.
Die alternative »anthropozentrische« Haltung zieht unter dem Signum der »Meinungsfreiheit« nach sich, »alles« für beliebig, relativ, und standpunktabhängig zu halten. Das ist der Kern des weltanschaulichen Glaubensbekenntnisses der wissenschaftlichen Moderne. Ich stelle dem im Folgenden als »Nachricht von den Antipoden« die »kosmozentrische Alternative« gegenüber. Zu zeigen ist, dass die herrschende skeptizistische, nur scheinbar vernunftorientierte anthropozentrische Weltanschauung widersprüchlich ist. Indem sie die Möglichkeit objektiver Erkenntnis leugnet, verleugnet sie die Natur, und verweist sie die Menschen darauf, autoritären Meinungsführern blindlings zu glauben und zu folgen. So hindert sie die Entfaltung wirklich vernunftgeleiteter, nämlich wahrheitsfähiger und damit gottfähiger Menschlichkeit in der wirklichen Welt.
II Helden der autonomen Vernunft
Zur Person: Immanuel Kant. Ihm steht im Jahr 2024 ein großes Jubiläum bevor. 1724 ist das Geburtsjahr dieses »Philosophen der Aufklärung«. Kant lebte bis 1804. In seine Lebenszeit fällt das Todesjahr Isaac Newtons 1727 sowie die Veröffentlichung von Voltaires »Elémens de la philosophie de Newton«. 1738 macht Voltaire damit die 1687 in London erschienene philosophisch-realistische Naturlehre Newtons auf dem Kontinent bekannt. 1755 veröffentlicht Kant eine »Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels«. Im Untertitel heißt es, sie sei »nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt«. Der Philosoph Immanuel Kant versteht sich als Naturforscher in der Nachfolge Galileis und Newtons. 1786 erscheint, vermeintlich wieder nach »Newtonischen« Grundsätzen, Kants Werk über die »Metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft«. Es wird für die folgende Epoche der Physik oder »klassischen Mechanik«, die man auch die »newtonsche« nennt, und damit für das neue, das säkulare »wissenschaftliche« Zeitalter bis ins beginnende 20. Jahrhundert wegweisend. Dann revolutioniert Albert Einstein die Naturlehre Newtons, wie er sie versteht, und damit auch die Lehre Kants, nach seinen Grundsätzen.
Albert Einstein wird 1879 geboren. Er lebt bis 1955. Schon als Schüler liest er begeistert Kant, wie er auch den Kantianer Ernst Mach liest, der 1883 ein folgenreiches Buch »Die Mechanik in ihrer Entwicklung« veröffentlicht hat. Machs Buch erlebt fünfzig Jahre lang bis 1933 neun Auflagen. Es transportiert auf anthropozentrischer Grundlage, gegen Galileis und Newtons Lehre von Raum und Zeit, erstmals eine kritische »relativistische« Sicht auf die Prinzipien der natürlichen, realistischen Bewegungslehre Newtons. Diese Perspektive prägt nicht nur den jungen Naturwissenschaftler Einstein und seine »Relativitätstheorien« von 1905 und 1915, mit denen er (wie er meint) Newtons Naturlehre korrigiert. Ernst Machs von Kant inspiriertes Buch prägt auch eine ganze Generation von Naturwissenschaftlern. In den 1920er Jahren entsteht auf diesem philosophischen Nährboden die »moderne Physik«. Repräsentiert wird sie durch die Quantenmechanik Werner Heisenbergs (1925) und Erwin Schrödingers (1926), in erster Linie aber durch Einsteins Relativitätstheorien. Mit diesen hat Einstein auch die der Quantenmechanik voraus gehende »klassische« Lehre von der Bewegung der Körper in Raum und Zeit revolutioniert, so dass die moderne Physik insgesamt aus der Einsteinschen Revolution hervorgeht. Und aus der anthropozentrischen »Kantischen« Philosophie Einsteins: Charakteristisch ist sein bekanntes, oft zitiertes Wort zu Heisenberg, erst und nur »Theorien« würden Auskunft darüber geben, was Wissenschaftler in der Natur beobachten. »Natur« wäre dann nichts real Gegebenes, sondern das, was der Mensch dafür hält.
Was unterscheidet Kant und Einstein von Newton, was verbindet Kant mit Einstein? Es ist, wie hier gezeigt wird, die Weltanschauung. Kant und Einstein verbindet die moderne anthropozentrische Weltanschauung, das materialistisch-relativistische menschengemachte Weltbild. Und dieses Weltbild unterscheidet sich von demjenigen Newtons diametral oder eben »antipodisch«.
III Weltbilder
Bei dem Wort Weltbild denkt man an die Astronomie, an das sogenannte »heliozentrische« Weltbild der Neuzeit. Man nennt es nach Nicolaus Copernicus auch »copernicanisch«. Aber nicht Copernicus (1473-1543), sondern erst Johannes Kepler (1571-1630) lehrte die Zentralstellung der Sonne (griech. helios) im Sonnensystem. Ihr Mittelpunkt sollte der ruhende Punkt sein, um den sich die Bahnen aller anderen Körper des Systems drehen. Das sind die Planeten, einschließlich der Erde. Das Zentrum der Sonne wäre hiernach der gemeinsame ruhende Bezugspunkt ihrer – nach Kepler leicht elliptischen – Umlaufbahnen.
Man denkt bei dem Wort Weltbild auch an die vorneuzeitliche »geozentrische« Alternative, philosophisch begründet von Aristoteles, später dann mathematisch entwickelt von dem Astronomen Ptolemäus. Diese ältere Perspektive beschreibt das Sonnensystem (weitgehend in Übereinstimmung mit dem Augenschein) so, dass die Sonne, ebenso wie die Planeten, um eine Mitte wandert, in der nun als ruhender Bezugspunkt und Zentrum der umlaufenden Bewegungen gaia, die Erde, stehen soll.
Philosophen verwenden diese astronomischen Weltbilder seit langem metaphorisch, um weltanschauliche Positionen zu beschreiben. Jedem Weltbild, ob geozentrisch, ob heliozentrisch, liege eine andere Weltanschauung zugrunde. So soll mit der geozentrischen aristotelischen Perspektive nicht nur die Erde, sondern »der Mensch«, der irdische Beobachter der Naturerscheinungen, zusammen mit der Erde, auf der er steht, als »Bezugssystem« gelten, als der ruhende Bezugspunkt, um den »alles sich dreht«.
Bertolt Brecht zeigt das in seinem Theaterstück von 1939: »Leben des Galilei«. Galileo Galilei wandte sich vor vierhundert Jahren gegen die geozentrische Kosmologie des Aristoteles. Er setzte die von Nicolaus Copernicus erkannte Wahrheit dagegen, dass sich die Erde wie die anderen Planeten um einen Mittelpunkt bewegt, und zwar konzentrisch zur Bahn der Sonne, welche den gemeinsamen Mittelpunkt in engster kosmischer Nähe ebenfalls umläuft. Im sechsten Akt von Brechts Galilei-Stück tritt ein »sehr alter Kardinal« auf. Dieser, im geistigen Rahmen der geozentrischen, seit Thomas von Aquin aristotelisch-scholastischen Philosophie der christlichen Kirche, trägt vor, Galilei sei mit seiner astronomischen Lehre ein »Feind des Menschengeschlechts«. Er versetze »den Menschen aus dem Mittelpunkt des Weltalls irgendwohin an den Rand«. Dabei sei doch »der Mensch die Krone der Schöpfung«. Galilei wolle »die Erde erniedrigen« und »beschmutze sein eigenes Nest«. Dagegen er, der Kardinal, wisse, dass die Erde ruht, als Mittelpunkt des Alls. Er selbst sei deshalb im Mittelpunkt, und so sei »der Mensch, die Anstrengung Gottes, das Ebenbild Gottes, das Geschöpf in der Mitte«: er, der Mensch, um den alles kreist, und auf dem das Auge Gottes ruht …
Homo mensura – der Mensch also wäre »das Maß aller Dinge«. Diese Formel umfasst die geozentrische Kosmologie und zugleich den Kern dessen, was man die anthropo-zentrische Weltsicht und Weltanschauung nennt (anthropos, der Mensch, im Zentrum). Es ist nicht die Weltanschauung von Copernicus, Galilei und Newton. Es ist die Weltanschauung Kants, Einsteins und des säkularen Zeitalters. Man nennt es jetzt auch das »Anthropozän«: die »menschengemachte Welt«.
Zwar scheint dem philosophisch-weltanschaulichen Anthropozentrismus seit dem Beginn der Neuzeit die »heliozentrische« Perspektive im Weg zu stehen. Hebt sie doch scheinbar zugleich mit der Zentralstellung der Erde die zentrale Position und Bedeutung des Menschen als »Maß aller Dinge« auf. Die neue Perspektive misst mit Kepler die Bewegungen der Planeten relativ zur Sonne als dem vermeintlich ruhenden Zentrum. Zu den Planeten gehört nun auch die Erde und der mit ihr um die Sonne bewegte Mensch. Er wird aus dieser Sicht als Zufallsprodukt der Evolution beschrieben, als »Zigeuner am Rande des Universums« (Jacques Monod, 1972).
Aber die Dezentralisierung des Menschen, seine Versetzung »aus der Mitte« und »an den Rand des Universums« gilt auch für Kant und Einstein nur im engen astronomischen Sinn. Heliozentrisch ist lediglich ihre astronomische Perspektive, in der die Zentralstellung der Sonne als ruhender Bezugskörper der Himmelsbewegungen behauptet wird: so in Kants »Allgemeiner Naturgeschichte und Theorie des Himmels« von 1755. Heliozentrisch in diesem Sinn ist auch die Kosmologie Albert Einsteins, das heißt seine allgemeine Relativitätstheorie von 1915.
Dennoch bleibt das Weltbild, die Weltanschauung Kants, Einsteins und der Moderne nach der Keplerschen heliozentrischen »Revolution« der Astronomie durchaus anthropozentrisch. Genau betrachtet ist, wie ich zeigen werde, gerade Kepler ein Repräsentant des modernen Anthropozentrismus. Die vor achthundert Jahren mit der christlichen Aristoteles-Rezeption in der Scholastik herrschend gewordene Idee, der Mensch selbst, bzw. die menschliche Vernunft, sei als zentrales Bezugssystem jeglicher Erkenntnis das Maß aller Dinge, bleibt gegen alle »Revolutionen« als anthropozentrisch aufgeklärte Weltanschauung in Kraft. In der Religion hat sie zu Keplers Zeit seit langem schon die Verehrung des transzendenten Schöpfergottes durch die Anbetung seines diesseitigen, Mensch gewordenen Sohnes Jesus von Nazareth ersetzt. Damit kommt in diesem Bereich eine »christozentrische« Variante des Anthropozentrismus zur Geltung (Johann Baptist Metz, 1962). Sie verändert aber die humanistische Fokussierung »auf den Menschen« nicht. Vielmehr dominiert die scholastische »Christozentrik« ab dem Jahr 1517, in dem Martin Luther zu Wittenberg seine Thesen verkündet. Luther lehrt eine strikte Bindung der religiösen Wahrheit an »das Wort« Jesu Christi. Es ist aber das Wort des »Mensch gewordenen« Gottes, und es ist eine menschengemachte, eine humanistische und deshalb trotz allem transzendenten Beiwerk anthropozentrische Lehre. Der Menschheitslehrer Martin Luther erhebt für die von Menschen geschriebene Bibel (als »Wort Gottes«) den ausschließlichen Wahrheitsanspruch.
Im 18. Jahrhundert dann befreit sich die menschliche Vernunft ganz von der religiösen Fessel. Sie befreit sich zu sich selbst. Homo mensura. Der Mensch wird definitiv und ausschließlich sein eigenes »Bezugssystem«. Seit der »Kantischen Aufklärung« feiert die autonome Vernunft in Philosophie und Wissenschaft ihre Triumphe. Diese verdankt sie der Rationalität und der Logik des methodischen Denkens. Die anthropozentrische Weltanschauung wird zum Fundament und die ihr entsprechende absolute Gedankenfreiheit ist der Ausdruck des Selbstverständnisses des modernen »aufgeklärten« Menschen.
IV Die Vernünftigkeit der Vernunft
Die anthropozentrische Überzeugung vom absoluten Vorrang der menschlichen Vernunft als Quelle und Maßstab aller Erkenntnis war in der Scholastik des 13. Jahrhunderts der christlichen Weltanschauung entgegengetreten. Bis dahin hatte das Christentum, seit es existiert, jahrhundertelang eine kosmozentrische und theozentrische Weltsicht zur Grundlage. Kosmozentrisch erkannte man von der platonischen Philosophie der Antike her die Gesamtheit dessen, was wirklich existiert und »ist«, als ein geordnetes Ganzes, als rational geschaffenen »Kosmos«, im Gegensatz zum ungeordneten »Chaos«. Die rationalen Ordnungsprinzipien des Kosmos entsprachen der menschlichen Erfahrung. Sie galten als das reale, wirklich wahre Bezugssystem menschlichen Wissens. Theozentrisch war diese Weltanschauung insofern, als die erkennbare rationale Struktur unmittelbar auf ein Prinzip verwies, aus dem dieser kausal als »Schöpfung« hervorgegangen war: ein Prinzip namens Gott, dessen Vernunft sich als »Gesetz der Natur« in der kosmischen Ordnung widerspiegelte.
So lehrte etwa Hildegard von Bingen, naturwissenschaftlich und medizinisch gebildete Äbtissin des Benediktinerklosters Rupertsberg bei Bingen, im 12. Jahrhundert: Gott kann nicht geschaut werden, sondern wird durch die Schöpfung erkannt. Wie der Apostel Paulus es schon im ersten christlichen Jahrhundert in einem Brief an die Römer geschrieben hatte: Die natürliche Erfahrung der vor aller Augen liegenden Schöpfung beweist (a posteriori!) die Wirklichkeit des Schöpfers. Der kosmozentrisch orientierte Mensch war dadurch »wahrheitsfähig« und zugleich »gottfähig«. Dass Gott wirklich »ist«, wusste im ersten Jahrtausend nach Christus, soweit das Christentum die Weltanschauung bestimmte, jedermann.
Verdrängt wurde diese auf die natürliche Erfahrung und auf die Beobachtung der Natur gegründete christliche Gottesgewissheit, vergessen wurde das uralte, kosmozentrisch-theozentrische Wissen von der vorgegebenen Ordnung des Kosmos, als mit der Rezeption der aristotelischen anthropozentrischen Philosophie im 13. Jahrhundert die menschliche Vernunft als intellektuelles Apriori zur Quelle aller Erkenntnis avanciert. Man liest nun nicht mehr (mit Augustinus) metaphorisch im »Buch der Natur«, das (wie Platon in alter Zeit wusste und wie Galilei im 17. Jahrhundert wieder wissen wird) in der Sprache der Geometrie geschrieben ist. Stattdessen hält die »Scholastik« jetzt den Inhalt der literarischen Schriften des Menschen Aristoteles für den Inbegriff dessen, was die Menschheit überhaupt wissen könne.
Der Scholastiker Thomas von Aquin will Christentum und intellektuellen Aristotelismus in eins fassen. Was er schafft, ist aber nur scheinbar eine Synthese. Tatsächlich dominiert fortan in Philosophie und Wissenschaft die anthropozentrische Weltanschauung. Sie dominiert aber auch in der Theologie, wo sie unter dem irreführenden Terminus »christozentrisch« verborgen wird, als eine Sichtweise, die den Menschen Jesus von Nazareth zum Mittel- und Bezugspunkt macht. Diese »nominalistische« Perspektive prägt und beherrscht seit Thomas von Aquin das Christentum. »Thomismus« und »Christozentrismus« bestimmen die Philosophie der Theologen. Fünfhundert Jahre nach Thomas von Aquin avanciert dann der Anthropozentrismus mit Immanuel Kant offen zur Philosophie der Protestanten, während die katholische Kirche sich dem nicht weniger anthropozentrischen »Thomismus« verpflichtet fühlt. Metamorphosen des Christentums – oder: Ersetzung der Wahrheit Gottes durch philosophische menschliche Ideen?
Die Gelehrten wissen freilich, dass alle aus apriorischen Vernunftprinzipien, also aus Gedanken hergeleiteten menschlichen Erkenntnisse, hypothetisch sind. Das heißt, sie sind nur insofern »wahr«, wie die ihnen zugrunde liegenden Prinzipien »wahr« sind. Oder anders gesagt: Die Wahrheit ist, so gesehen, »absolut relativ«. Denn die Annahme, eine Erkenntnis sei wahr, setzt die Wahrheit der apriorischen Gedanken (Prinzipien), aus denen sie logisch folgt, unbedingt voraus. Da nun die Gedanken absolut frei sind, so sind sie aber immer nur »möglich«, niemals wirklich »wahr«; denn woran sollte das gemessen werden? Wer also eine aus Hypothesen, aus gedanklichen Prinzipien hergeleitete Erkenntnis für wahr erklärt, behauptet zugleich die Wahrheit der zugrunde liegenden Ideen. Also beruht dieser Wahrheitsanspruch auf einem logischen Fehler, den man »petitio principii« nennt: Man unterstellt willkürlich – ohne Beweis – die Wahrheit der Prinzipien, aus denen die angeblich wahre Erkenntnis hergeleitet wird.
Die Wahrheitsferne der hypothetisch-deduktiven philosophischen Methode erklärt, weshalb die moderne Philosophie und Wissenschaft keinen Wahrheitsanspruch erhebt. Alle menschliche Erkenntnis wird, weil immer nur hypothetisch, immer vorläufig, nur als stets widerlegbare Vermutung akzeptiert. Conjectures und Refutations (Karl Popper) bestimmen den Gang oder »Fortschritt« des Wissens im wissenschaftlichen Zeitalter.
V Der Kosmos, die Wahrheit – und die Hypothesen
Anthropozentrisch im weltanschaulichen Sinn ist, ebenso wie das »geozentrische« scholastische Weltbild, in Wahrheit auch die seit dem 16. Jahrhundert verbreitete »heliozentrische« Astronomie. Denn diese stützt sich keineswegs auf wissenschaftliche und astronomische Beobachtung und Erfahrung der Natur und des Kosmos, sondern auf menschliche Gedanken, auf eine menschliche »vernünftige« Idee, auf eine Hypothese, als apriorisches Prinzip. Es ist die aus der aristotelischen Physik kommende Idee, im Zentrum der umlaufenden Bewegung der Planeten müsse sich unbedingt ein materieller »Bezugskörper« befinden, als ruhender Mittelpunkt der auf ihn bezogenen Umläufe (»Zentralkörperhypothese«). Diese Hypothese begründet den Materialismus und Relativismus der modernen Lehre von der Bewegung, die mit der Astronomie beginnt.
Nicolaus Copernicus war nicht der Urheber, und er war auch kein Anhänger dieser Hypothese. Copernicus’ Astronomie entstand im 16. Jahrhundert mit und aus dem anti-scholastischen Impetus der Renaissance. Sie entstand als eine nicht auf menschliche Gedanken, sondern ausschließlich auf Beobachtung und Erfahrung der Natur gegründete Lehre. Die »kosmozentrische«, nicht auf apriorische Hypothesen gegründete geometrische Methode, die realen Verhältnisse zu messen, führte Copernicus zur Erkenntnis der natürlichen Verfassung des Sonnensystems, die so ist, wie sie ist und wie sie immer schon war. Diese Verfassung ist aber durchaus nicht »heliozentrisch«. Die Sonne steht tatsächlich und in Wahrheit nicht als ruhender Bezugskörper im Zentrum der Umlaufbewegungen der Planeten. Richtig ist zwar, wie Copernicus fand, dass sich die Erde tatsächlich bewegt, wie alle anderen Planeten auch. Aber das Zentrum dieser Bewegungen, der gemeinsame Drehpunkt aller Körper des Systems, die »Mitte der Welt«, liegt nicht in der Mitte der Sonne. Es ist gar kein »Körper«. Es ist vielmehr ein leerer geometrischer Punkt im Raum, abseits der Sonnenmitte. Um diesen Punkt (das modern sogenannte »Baryzentrum«) wandert auch die Sonne, auf engster Bahn. Diese Bahn liegt konzentrisch innerhalb der Umlaufbahnen der weiter entfernten Planeten. Das macht aber das System nicht »heliozentrisch«; denn, noch einmal: Das Zentrum ist leer.





























