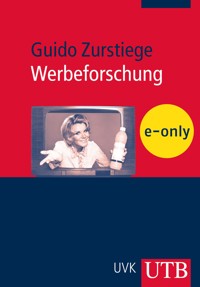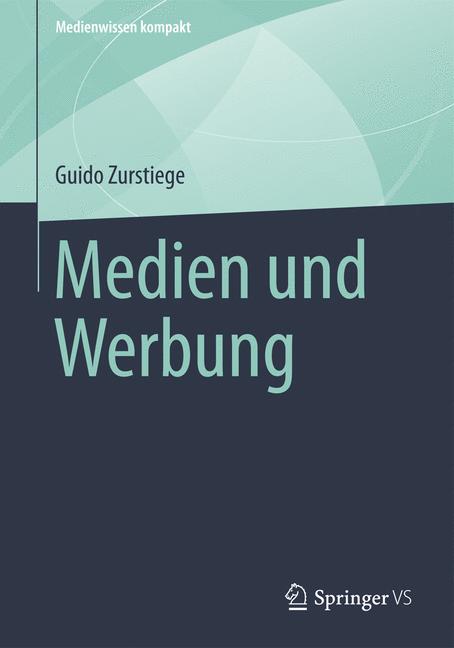17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In einer Zeit, in der jeder permanent sendet und auf Empfang ist, stellt die Fähigkeit zur Entnetzung eine der wichtigsten Bedingungen für die Selbstbehauptung und Selbstbestimmung des Individuums dar. Die allseits gesteigerte Kommunikation und Konnektivität erzeugt ein ebenfalls gesteigertes Bedürfnis nach kommunikativem Rückzug und Verzicht. Ob aus Verdruss über den Verfall des politischen Diskurses oder als Reaktion auf den Zwang zur permanenten Entblößung, ob aus Angst vor den auf Dauerüberwachung programmierten Medien des technologischen Habitats oder als Versuch der Rückgewinnung von Kontrolle über das aus den Fugen geratene eigene Mediennutzungsverhalten: Jeder braucht heute Taktiken der Entnetzung, um den Herausforderungen des digitalen Zeitalters erfolgreich zu begegnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Guido Zurstiege
Taktiken der Entnetzung
Die Sehnsucht nach Stille im digitalen Zeitalter
Suhrkamp
»In einer von Informationen überfluteten Kultur besteht der revolutionärste Akt womöglich darin, so wenig wie möglich so leise und so langsam wie möglich zu sagen.«
Alex Ross (2018)
Inhalt
Einleitung
Eine sehr kurze Geschichte des Medienverzichts
Gehetzt, gereizt, gestresst
Taktiken – eine Praxis von unten
Apostel der Entnetzung
Löscht euren Social-Media-Account!
Lernt Medien zu nutzen!
Macht mal Pause!
Konnektivitätsverzicht
Verzicht verhandeln
Verlust verlängern
Vernetzung verweigern
Digitale Selbstverteidigung
Verweigern der Sichtbarkeit
Reden und Schweigen
Dem Hass die kalte Schulter zeigen
Rückzug in die Echokammer
Die Generalisierung des Zweifels
Die Erschöpfung der Zuschauer
Die Theorie der Verschwörung
Vorbeugende Selbstfürsorge
Murphy's Moore's Law – freiwilliger Downgrade
Zocken, wenn's passt – eigene Regeln formulieren
Der Fernseher auf Rollen – sich selbst austricksen
Fazit
Nachwort
Literatur
Anmerkungen
Einleitung
Am 28. Juni 2018 um kurz nach halb drei Uhr nachmittags stürmte der mit einer Schrotflinte bewaffnete Jarrod W. Ramos in die Redaktion der kleinen US-amerikanischen Tageszeitung CapitalGazette in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland und eröffnete das Feuer. Fünf Menschen starben an diesem Tag, viele weitere wurden verletzt, weil sich der wegen Stalkings verurteilte Ramos durch einen Bericht der Zeitung schlecht behandelt fühlte. Für viele, die aus den Nachrichten von dieser Tat erfuhren, war klar: Hier treffen sich die unverhohlene Hetze gegen vermeintliche »Fake News« und die mangelnde Bereitschaft der Amerikaner, ihr Waffenrecht zu verschärfen, zum mörderischen Schulterschluss. Medien und Waffen – zwei von vielen Streitpunkten, die das gegenwärtige politische Klima der USA geradezu vergiften. Das Magazin The New Yorker veröffentlichte wenig später einen Cartoon, der einen Arzt im Gespräch mit seinem Patienten zeigt. »Ihr Problem besteht darin«, sagt der Arzt, »dass Sie den aktuellen Ereignissen zu viel Aufmerksamkeit schenken.« Treffender lässt sich das aktuelle politische Klima in den Vereinigten Staaten nicht auf den Punkt bringen. Kaum ein Tag vergeht ohne Geschehnisse und Nachrichten, die geradezu krank machen. Kaum ein Tag vergeht ohne Fassungslosigkeit, Scham und Trauer.
Nur wenige Tage vor der Attacke auf die Zeitungsredaktion in Annapolis hatte First Lady Melania Trump ein Flüchtlingscamp an der mexikanischen Grenze besucht, um dem Null-Toleranz-Kurs ihres Mannes ein paar versöhnliche Bilder zur Seite zu stellen. Kinder waren von ihren Eltern getrennt und in Lagern interniert worden. Erschütternde Bilder waren um die Welt gegangen. Die PR-Aktion der First Lady missglückte gründlich. »I really don't care, do you?« stand in großen Lettern auf ihrem Parka, als sie in ihr Flugzeug stieg. Wer diese Bilder im Fernsehen gesehen hatte, musste sich fragen, was man auf so viel Dummheit und Arroganz der Macht noch entgegnen kann. Vielen fehlten die Worte. Auch für meine US-amerikanische Kollegin Tori, die ich zu einem Vortrag über Hassrede im Internet und den Kollaps des politischen Diskurses in den USA nach Tübingen eingeladen hatte, war dies kaum noch auszuhalten. Sie wollte darüber sprechen, wie viele US-amerikanische Intellektuelle inzwischen geradezu angewidert den Blick von den Nachrichten abwenden und verstummen. Die Bilder aus Annapolis und aus den Flüchtlingscamps lieferten dafür abermals die passenden Belege. Nach der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten seien viele ihrer Freunde und Bekannten in eine Art Medienausstand getreten und hätten auf jegliche Nachrichten verzichtet. Nicht aus Trotz oder Protest über die Berichterstattung hätten sie dies getan, nicht aus Desinteresse oder Misstrauen, sondern weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten hätten.1
Jene tief in die Verfassung der Vereinigten Staaten eingeschriebene Auffassung, dass es nur eine angemessene Antwort auf öffentlich vorgetragene Lügen und Verleumdungen gibt, nämlich die immer und immer wieder vorgetragene Gegenrede, jener feste Glaube daran, dass sich auf dem Markt der Ideen stets das bessere Argument durchsetzen werde, hat nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande für viele Zeitungsleser und Fernsehzuschauer an Überzeugungskraft eingebüßt. Denn das Ausmaß an Arroganz und Willkür, von dem die Nachrichten berichten, die Ungeniertheit, mit der von Seiten der neuen »Anti-Eliten-Eliten« vom Schlage Trumps Journalisten verhöhnt und vor laufender Kamera diffamiert werden,2 all dies hat heute solche Dimensionen erreicht, dass es weiten Teilen des Publikums im wahrsten Sinne des Wortes die Stimme verschlägt. Stille, Schweigen, kommunikativer Rückzug – mehr als jemals zuvor sind dies heute relevante Kategorien der Gegenwartsdiagnose, so lautet die These dieses Buches. An fast jeder Stelle im Mediensystem lassen sich gegenwärtig nicht nur Phänomene der gesteigerten Kommunikation und Konnektivität, sondern auch des Rückzugs und des Verzichts beobachten. Sei es aus Verdruss über den Verfall des politischen Diskurses oder als Reaktion auf den Zwang zur permanenten Selbstoffenbarung in den sozialen Medien, sei es aus Angst vor den auf Überwachung programmierten Medien des technologischen Habitats oder als Versuch der Rückgewinnung von Kontrolle über das aus den Fugen geratene eigene Mediennutzungsverhalten. Das gesteigerte Bedürfnis nach Stille und Medienverzicht ist das Symptom einer Gesellschaft, deren Lärm für viele nicht mehr anders auszuhalten ist als durch eine selbstverordnete Sendepause. Darum geht es in diesem Buch.
Eine sehr kurze Geschichte des Medienverzichts
Wo es ernst wird, wird es still. Das gilt in vielen Lebenslagen. In Liebe als Passion schreibt der Soziologe Niklas Luhmann, dass die kommunikative Mitteilung von Liebe, gemessen an den besonders intensiv erlebten und in diesem Sinne sehr heißen Emotionen, um die es dem Liebenden geht, in aller Regel an chronischer Unterkühlung leidet. Wer von Liebe spricht, will Einmaligkeit, Einzigartigkeit und Authentizität zum Ausdruck bringen.3 Und alles, was ihm für die Mitteilung dieser großen Gefühle bleibt, sind bloß jene ausgelaugten Worte, mit denen alle Seifenopern und Fernsehschmonzetten der Welt um die Wette schmachten.4 Wenn es ernst wird, wenn es heiß wird, wenn man sich seinem emotionalen Erdkern nähert, so Luhmann, dann ist es das Beste, man ist still und schweigt.5 Nur wer auch schweigen kann, beherrscht alle Register der Kommunikation, lautet seine Botschaft. Schweigen ist nicht das Gegenteil von Kommunikation, sondern Kommunikation mit anderen Mitteln. Die aus dem Schweigen erwachsende Stille tritt ein, wenn wir eine Pause machen, eine Handlung unterbrechen, etwa ein Buch zur Seite legen und darüber nachdenken, was wir soeben gelesen haben. Stille kann eine soziale Handlung sein, etwa überall dort, wo sie ein Schweigen einkleidet. Sie kann eine geistige Tätigkeit sein, wo sie auf Achtsamkeit hin ausgerichtet ist. Stille eröffnet spirituelle Erfahrungen, wo sie aus der Andacht hervorgeht, ist ein spezifisches Bewegungsmuster, wo sie stillhalten bedeutet. Sie kann ein sozialer Zustand sein, überall dort, wo sie die Stimme der Einsamkeit ist. Und Stille ist, wie Luhmann durchblicken lässt, möglicherweise überall dort die Ultima Ratio, wo es um heiße Informationen eines bestimmten Zuschnitts geht. Eine Kulturgeschichte der Stille und des Schweigens, so lässt sich festhalten, würde wohl Bände füllen. Denn Stille ereignet sich in unzählbar vielen Formen und in ebenso unzählbar vielen Kontexten und besitzt sehr unterschiedliche Bedeutungen.
Das spiegelt sich auch in den vielen akademischen Zugängen der Stille-Forschung wider. Die Theologie weiß, dass nahezu alle Religionsgemeinschaften der Welt Zustände des spirituellen Empfindens beschreiben, die sich nur in der Stille und durch sie vollziehen.6 Die Linguistik hat eine Vorstellung von der bedeutungsvollen Lücke zwischen den Wörtern. Stille verleiht der Sprache Klarheit und Struktur.7 Die Gesprächsforschung geht davon aus, dass es ohne Stille in der Konversation keinen Wechsel der Sprecher gäbe.8 Die Sprachphilosophie kennt die Stille und das Schweigen als »passive Lüge«, aber auch als Verstummen, das sich in existenziellen Lebenslagen der Angst, der Scham oder des Schmerzes, oftmals ohne dass wir daran etwas ändern könnten, zwischen das Reden und das Schweigen schiebt.9 Die Kommunikationswissenschaft hat sich intensiv mit der Stille des Schweigenden beschäftigt, der seine Meinung aus Angst vor sozialer Isolation verheimlicht.10 Die Kunstgeschichte schätzt die beredsame Stille der monochromen Leinwand. Stille, so schrieb die US-amerikanische Essayistin Susan Sontag einmal gegen Ende der sechziger Jahre in der Hochzeit des sich in der New Yorker Kunstszene etablierenden Minimalismus, gelte in der zeitgenössischen Ästhetik geradezu als Beleg für die Ernsthaftigkeit eines Kunstwerks.11 Die Rhetorik weiß, wie wichtig es für einen guten Redner ist, im richtigen Moment innezuhalten.12 Die Musikwissenschaft betont die Wirkung der Pause. Stille in der Musik, so hat einer ihrer bekanntesten Advokaten, John Cage, einmal gesagt, öffnet die Türen der Musik für die Klänge der Welt.13 Die Filmwissenschaft beschreibt die geradezu mystische Aura des schweigenden Protagonisten, und sie weiß, dass die stillen Bilder des Stummfilms durch die Beredsamkeit der Inszenierung ausgeglichen werden.14 Die Medienwissenschaft behandelt die Stille als eine »uneigentliche mediale Situation«, als technologische Panne, die das hinter der oftmals habitualisierten Mediennutzung zwar vorhandene, aber doch oft stillschweigend vorausgesetzte und in diesem Sinn stillgestellte Mediendispositiv wahrnehmbar macht.15 Die Medienwissenschaft kennt die Stille aber auch als inszenierten »Differenzeffekt« zum ansonsten chronisch lauten Programm. Sie weiß, dass Stille oft ein Effekt von Selektionsroutinen oder eine strukturelle Folge der täglichen Transformation von aktuellen in verbrauchte und auf diese Weise gewissermaßen zum Schweigen gebrachte Themen ist.16 Die Wissenschaftsforschung beschreibt Stille als notwendige, jedoch vielerorts knappe Ressource der Wissensproduktion.17 Die Pädagogik geht davon aus, dass Verstehen niemals ohne den stillen Fokus auf den Lerninhalt zu haben ist.18 Für die Medienforschung ist Stille als Ausgangspunkt der Mediennutzung ein vorausgesetztes Phänomen. Ganz bestimmte Medien bedingen in spezifischer Weise das Schweigen und das Stillhalten des Rezipienten. Es gibt maximal »fesselnde« Medien wie etwa das Kino, und es gibt Medien, die dem Rezipienten vergleichsweise viel Bewegungsfreiheit lassen, wie etwa das Smartphone. Es gibt Medien wie den Brief, das Buch oder die Zeitung, die eine strikte Rollentrennung zwischen Sprechen und Hören bedingen. Es gibt wiederum Medien wie Skype, WhatsApp, Onlinenews etc., die diese Trennung verflüssigen.
Der Begriff der Stille, der kommunikativen Enthaltsamkeit, des Medienverzichts, des Rückzugs aus der Welt des Lärms, so zeigen diese wenigen Beispiele, ist kulturell enorm aufgeladen und in vielen Fällen positiv konnotiert. Er steht im Zentrum einer sich erst allmählich zu einem übergeordneten Verbund der Disconnection Studies formierenden Forschung, die sich aus vielen unterschiedlichen akademischen Disziplinen speist. Zentnerschwer wiegt der Begriff der Stille, denn er ist angefüllt mit Spiritualität, Achtsamkeit, Ernsthaftigkeit und Wahrhaftigkeit sowie mit der Erwartung, die Stille gehe stets etwas Großem voraus. Dies ist die eine Seite der Stille. Aber nicht in allen Zusammenhängen ist die Stille ausschließlich positiv konnotiert. Spätestens seit der Industrialisierung gilt sie auch als Indikator für eine mögliche Störung, während mit ihrem Gegenteil, der Geräuschhaftigkeit, dem Lärm, das Funktionieren der Maschine in Verbindung gebracht wird.19
Bereits im 14. Jahrhundert ist diese zweite Bedeutungsschicht fest im Wortschatz der deutschen Sprache verankert. Da ist eben auch die Windstille, die das bewegungslos auf dem Meer treibende Schiff den Launen der Natur aussetzt. Still ist das stehende und möglicherweise faule Gewässer. Still ist der Tatenlose. Still ist, wer ein womöglich dunkles Geheimnis hütet. Still ist, wer sich nicht zu erkennen geben will. All dies steht für die andere, die unheimliche Seite der Stille.20 Stille kann von oben verordnet und mit Macht durchgesetzt werden, um das laute Denken anderer zu unterdrücken. Dann ist Stille das Ergebnis von Zensur. Sie kann aber auch verordnet und mit Macht durchgesetzt werden, um das Denken und den Austausch zu ermöglichen. Dies geschieht etwa in jeder Bibliothek, in der das laute Sprechen untersagt ist. Stille kann aus einem inneren Bedürfnis erwachsen. Man schweigt vor sich selbst, macht sich und anderen möglicherweise etwas vor. Stille kann indessen aus einem inneren Bedürfnis entstehen und im Sinne Luhmanns zum angemessenen Ausdruck von heißen Informationen und Intimität werden.21 Wer still ist, so lässt sich all dies zusammenfassen, kann also auf tiefere Einsichten hoffen, muss sich aber auch auf möglichen Widerstand einstellen. Welche der Möglichkeiten aufgerufen wird, ist situationsabhängig und kulturspezifisch.
Überhaupt erweist sich Kultur als eine der wichtigsten Determinanten für die Bewertung von Phänomenen der Stille, des Stillhaltens und der kommunikativen (Selbst-)Beschränkung. Während in den meisten asiatischen und in vielen indianischen Kulturkreisen Stille im Gespräch ein stark normierter Ausdruck des respektvollen Umgangs miteinander ist, wird in den meisten westlichen Kulturen Schweigen in Gesprächssituationen als Verschlossenheit, wenn nicht sogar als Unhöflichkeit ausgelegt. Westliche Kulturen orientieren sich bis heute am Leitbild des antiken Dialogs. Das Gespräch, die Rede und die Gegenrede, sie befruchten sich wechselseitig so sehr, dass sie geradezu eine Quelle unseres Denkens darstellen. Das Sprechen ist nicht nur Zeuge des Gedankens, vielmehr ist es auch dessen Werkzeug. Es ist eine Form der Rückkopplung, mit dessen Hilfe sich Menschen beim Denken selbst beobachten und stabilisieren. Sprechen ist denken.22 Obwohl sich für das Schreiben ein ähnlicher Zusammenhang behaupten lässt, besitzt das Sprechen in der abendländischen Kultur seit der Antike eine vorgeordnete Stellung, während die Erfindung der Schrift bereits die frühen Gelehrten und Philosophen misstrauisch machte.23 Bis weit ins Mittelalter hinein wurde alles Geschriebene stets vom Gesprochenen her als Manifestation eines ursprünglich mündlich vorgetragenen Textes gedacht.
In gewisser Weise hat die Erfindung der Schrift die Sprache von einer natürlichen zu einer künstlichen Kultur-Technik gemacht. Denn es gibt unendlich viele Möglichkeiten, natürlich zu sprechen, hingegen gibt es keine einzige Möglichkeit, natürlich zu schreiben.24 Im Kern betreffen die meisten der daraus resultierenden Vorbehalte gegenüber der Verwendung der Schrift die Integrität des menschlichen Denkens. In der abendländischen Kultur ist vor allem Platons Einwand gegen die Schrift bekannt geworden. Die Schrift, so sagt Sokrates in Platons Phaidros,25 schwäche den menschlichen Verstand, weil sie ihm die ihn konstituierende Aufgabe des Erinnerns abnehme.26 Hinter dieser Kritik an der Schrift verbirgt sich ein wichtiges Argument, das bis weit in unsere Zeit hinein die meisten medientheoretischen Debatten wie ein roter Faden durchzieht: Jedes Medium erweitert den Menschen, und zugleich nimmt es ihm etwas.27 Mit diesem Argument ist in sehr grundsätzlicher Weise eine Gewinn- und Verlustrechnung verbunden, die in vielen gesellschaftlichen Debatten in Bezug auf die Chancen und Risiken neuer Medientechnologien eine Rolle spielt.
Es ist geradezu eine Konstante der Mediengeschichte, dass für jedes neue Medium im Zuge seiner gesellschaftlichen Durchsetzung in zahlreichen gesellschaftlichen Debatten eine solche Gewinn- und Verlustrechnung aufgemacht wird.28 Jedes neue Medium wird in diesem Sinn mit großen Erwartungen hinsichtlich seiner Potenziale, aber auch mit ebenso großen Befürchtungen mit Blick auf die individuellen und gesellschaftlichen Risiken verbunden. Die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern brachte etwa eine revolutionäre Demokratisierung des Wissens mit sich, in deren Folge die modernen Wissenschaften entstanden. Rationalität, Meinungsfreiheit, der freie Zugang zu Wissen, all dies wurde seitdem zu bestimmenden Merkmalen moderner, auf Rationalität und freien Austausch hin ausgerichteter Gesellschaften. Gleichzeitig führte der Buchdruck bereits im Urteil nicht weniger Zeitgenossen Gutenbergs zu einer Erosion der traditionellen Deutungshoheit. Waren es zuvor kirchliche und weltliche Eliten gewesen, deren Hermeneutik die korrekte Auslegung von Texten bestimmte, konnte sich in der Gutenberg-Galaxis plötzlich jeder sein eigenes Urteil bilden. Das war ungeheuerlich, und nicht alle begrüßten dieses befreiende Potenzial des Buchdrucks daher mit der gleichen überschäumenden Freude, wie es die Mediengeschichtsschreibung heute rückblickend tut. Bis weit ins 18. und 19. Jahrhundert hinein galt das Lesen gedruckter Texte als Privileg, das nicht allen Mitgliedern einer Gesellschaft im gleichen Maße zustand. Als sich etwa im 18. Jahrhundert mit der Erfindung der neuen literarischen Gattung des Romans das Leseverhalten der damaligen Menschen revolutionär veränderte, indem an die Stelle der intensiven Lektüre eines Buches, der Bibel, die exzessive Lektüre vieler verschiedener Bücher trat, wurde dieses neue Leseverhalten besonders kritisch mit Blick auf weibliche Leser beurteilt und in vielen Fällen rigoros sanktioniert.29
Gewinn- und Verlustrechnungen in Bezug auf die Chancen und Risiken neuer Medien werden nicht nur in gesellschaftlichen Debatten aufgemacht, sondern sie liegen auch vielen individuellen Entscheidungen der Mediennutzung und im Kern verschiedenen Formen des Medienverzichts zugrunde. Viele Formen der bewussten Abkehr von Medien basieren in diesem Sinn auf einem Nutzenkalkül, das den jeweiligen Verzicht zu einer bedeutungsvollen, ja, sinntragenden Handlung macht. Manche Menschen, die heute auf die Nutzung bestimmter Medien verzichten, tun dies, um kreativer zu werden, andere, um produktiver zu werden, oder, um mehr Zeit mit ihren »echten« Freunden zu verbringen.30 Wiederum andere verzichten auf die Nutzung von Medien, um gesünder zu leben.31 Manche Nichtnutzer drücken sich mit ihrem Verzicht aus, stellen ihre Verweigerungshaltung in Form eines demonstrativen Nichtkonsums zur Schau, um damit ihre Persönlichkeit zu unterstreichen.32 Für andere ist die Verweigerung digitaler Medien eine Form des zivilgesellschaftlichen Engagements33 oder ein wichtiges Element des persönlichen »Lifestyles«.34 In all diesen Fällen erfüllt die bewusste Nichtnutzung bestimmter Medien einen Zweck, ist ein Mittel, um sich zu positionieren, eine Haltung auszudrücken, etwas zu erreichen. Hier wird sichtbar, in welchen Fällen die voranschreitende Mediatisierung unserer Gesellschaft zu Diskontinuitäten, zu Brüchen, aber auch zu Konflikten mit konkurrierenden Leitmotiven der gesellschaftlichen Entwicklung führt.
Die Mediengeschichte der jüngeren Vergangenheit ist voll von solchen Versuchen der Positionierung durch Verzicht. Als etwa gegen Ende der achtziger Jahre der Anrufbeantworter in immer mehr bundesdeutschen Haushalten anzutreffen war und sich allmählich zu einem Statussymbol entwickelte, schlug ihm ebenso große Zustimmung entgegen wie Ablehnung und Kritik. Schon lange vor der flächendeckenden Einführung von Mobilfunknetzen ermöglichte es der Anrufbeantworter, nie wieder einen (wichtigen) Anruf zu verpassen. Plötzlich konnte man überdies entscheiden, ob man einen Anruf von einer bestimmten Person annehmen oder ignorieren wollte. Man musste einfach nur abwarten, wer der Anrufer war, und konnte sich dann entscheiden. Aber nicht alle Besitzer eines Telefonanschlusses vermochten darin einen klaren Vorteil zu erkennen. Manche weigerten sich demonstrativ, auf »den AB« zu sprechen, andere verzichteten auf die Anschaffung dieser neuen technologischen Errungenschaft der Telekommunikation. Viele taten dies mit dem expliziten Hinweis darauf, dass man das Recht auf Nichterreichbarkeit habe und selbst bestimmen wolle, wann man mit wem telefoniere. Keinen Anrufbeantworter zu haben galt nicht wenigen als schick, als Statement und selbstbewusster Ausdruck einer emanzipierten, authentischen Lebensweise. Dieses Begründungsmuster wiederholte sich bei der flächendeckenden Einführung des Mobiltelefons in den neunziger Jahren und der Verbreitung des Smartphones nach der Jahrtausendwende nahezu unverändert.
Die Betonung des Rechts auf kommunikative Selbstbestimmung sowie die Emphase einer Moral der Authentizität bilden bis heute zentrale Leitmotive der Nichtnutzung spezifischer Medien. Menschen, die ganz bewusst auf das Fernsehen verzichten, bringen diese beiden Argumente ebenso in Anschlag wie Menschen, die auf Facebook, WhatsApp oder Snapchat verzichten. Viele Nichtnutzer distanzieren sich sehr bewusst und reflektiert von spezifischen Medien und lehnen diese auf der Grundlage einer dezidierten Einstellung explizit ab. Sie kehren sich ab von den Inhalten des Mediums, von der zeitlichen Belastung, die es seinen Nutzern abverlangt, oder von der hinter den inhaltlichen Angeboten des Mediums stehenden Industrie. Für eine andere Gruppe von Nichtnutzern ist der Verzicht auf Medien in vielen Fällen aber auch ein Ausdruck des Bemühens um Selbstfürsorge: Man gibt auf sich acht.35
Phänomene des Medienverzichts und der Medienverweigerung haben eine lange, sehr facettenreiche Geschichte und lassen sich bis zu den Anfängen der Massenpresse im 19. Jahrhundert zurückverfolgen.36 Fasst man jedoch die Untersuchungen zusammen, die sich dezidiert mit diesen Phänomenen beschäftigen, gelangt man schnell zu dem Ergebnis, dass die Forschung der vergangenen Jahrzehnte hier nicht gerade einen Schwerpunkt gesetzt hat. Das geringe Interesse an den Nichtnutzern hat verschiedene Ursachen. Zum einen hat sich die Rezipientenforschung traditionellerweise stark an den Leitwerten der Medienpraxis und damit an Zuschauerquoten und Reichweiten orientiert. Vor dem Hintergrund dieser Ausrichtung am Mainstream der Zuschauer, Leser und Zuhörer ist die vergleichsweise kleine Gruppe der Nichtnutzer kaum ins Gewicht gefallen. Diese Sichtweise änderte sich allmählich zu Beginn der neunziger Jahre, als man mit Blick auf Internetnutzer feststellte, dass die sogenannten Internetdropouts im Durchschnitt jünger, ärmer und schlechter ausgebildet waren als die Mehrheit der Internetnutzer.37 Die These von der digitalen Kluft war geboren. Vor dem Hintergrund dieser Beobachtung hat die kanadische Ökonomin Sally Wyatt dafür plädiert, die Nichtnutzer von Medien systematisch stärker zu berücksichtigen, allerdings nicht nur unter dem Aspekt der fehlenden Teilhabe am technologischen Fortschritt, sondern auch um zu vermeiden, dass alle Nichtnutzer automatisch als verhinderte Nutzer begriffen werden.38 Eine wachsende Anzahl von Beobachtern weist inzwischen darauf hin, dass der starke Forschungsfokus auf die Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien im Ergebnis zu einer Pathologisierung der Nichtnutzung geführt habe.39 Zu unterscheiden seien nämlich verschiedene Typen von Nichtnutzern, die »have-nots« und die »want-nots«, jene, die nicht könnten, und jene, die aus einer Vielzahl höchst unterschiedlicher Gründe nicht wollten.
Es gibt mindestens noch zwei weitere Gruppen. Dies sind zumindest temporär die wohl größten, wenn auch veränderlichsten Abstinenz-Gruppen: die »not-yets« und die »no-mores«. Wie bei nahezu jeder Technologie ist es auch bei der gesellschaftlichen Diffusion von Medientechnologien zunächst einmal nur eine verschwindend kleine Gruppe von Menschen, die zu den sogenannten Early Adopters zählt und einem gesellschaftlichen Trend vorausgeht. Der überwiegende Teil der Menschen sind diejenigen, die eine neue Technologie nicht nutzen. Diese große Gruppe hat von ihr in aller Regel entweder noch nichts gehört, verharrt in der Nutzung der jeweils älteren und etablierten Technologie oder verhält sich einfach nur vorsichtig und abwartend, lässt also erst einmal andere die Sache ausprobieren.
Es ist interessant zu beobachten, dass viele der frühen Verwender zu einem späteren Zeitpunkt, wenn etwa die bisher zögerlichen Gruppen mit der Nutzung der Technologie beginnen, selbst bereits nicht mehr zu den Nutzern des Mediums gehören, sondern längst ihre Fühler in eine andere Richtung ausgestreckt haben. Genau diese Entwicklung lässt sich seit einigen Jahren bei Facebook beobachten.40 In der Anfangsphase waren es vor allem junge gebildete Menschen, die sich über das soziale Netzwerk austauschten und miteinander im Kontakt blieben. Ihre Eltern indessen setzten, manchmal mit erhobenem Zeigefinger, weiterhin auf das Telefon, den Brief oder das persönliche Gespräch und kommentierten nur stirnrunzelnd die Zahl »sogenannter« Freunde ihrer Kinder. Heute ist es vor allem diese Generation der Eltern und Großeltern, die sich einen Facebook-Account zulegt und aktiv verwendet. Schließlich hatten die Eltern und Großeltern also doch ein Einsehen und übernehmen heute, was ihre Kinder und Enkelkinder Jahre zuvor begonnen haben. Gleichzeitig ist Facebook für die meisten dieser Kinder und Enkelkinder inzwischen ein alter Hut. Plötzlich sind nun sie es, die Facebook nicht mehr oder zumindest nur noch sporadisch nutzen und die Freundeslisten ihrer Eltern stirnrunzelnd kommentieren. »Kind, melde dich doch einmal wieder!«, hörten sie früher von ihren Eltern. Heute bekommen sie von ihnen per WhatsApp die Nachricht, doch bitte einmal wieder etwas auf Facebook von sich zu posten.
Nicht jeder Verzicht auf Medien erwächst aus einem bewussten Kosten-Nutzen-Kalkül oder lässt sich mit einem Punkt auf einer Diffusionskurve der gesellschaftlichen Verbreitung eines Mediums in Verbindung bringen. Viele Menschen, die auf die verlockenden Angebote der digitalen Medien verzichten, tun dies, ohne groß darüber nachzudenken. Viele, die keinen Facebook-Account haben, die weder bei Twitter noch bei Snapchat oder Instagram anzutreffen sind, viele, die ihre Bücher lieber in der Buchhandlung um die Ecke als bei Amazon kaufen und überhaupt niemals auf die Idee kämen, ein Buch zu lesen, das nicht auf Papier gedruckt, sondern an einen Bildschirm ausgeliefert wird, brauchen dazu keine Einstellung, keine demonstrativ zur Schau gestellte Verweigerungshaltung. Sie kommen ganz einfach ohne all dies aus. Viele, die heute bewusst auf bestimmte Medien oder auch nur auf spezifische Angebote im Programm dieser Medien verzichten, tun dies auf der Grundlage eines oftmals implizit bleibenden Nutzenkalküls. Sie denken jedenfalls deutlich mehr über die aus ihrer Sicht besseren Handlungsalternativen als über ihren weniger spektakulären Verzicht nach. Wer am Wochenende lieber wandern geht, als Fernsehen zu schauen, für den ist diese Form der aktiven Freizeitgestaltung eben ein selbstverständlicher und weitgehend unhinterfragter Bestandteil seiner aktiven Lebensführung.
Es gibt überdies zahlreiche Formen der Nichtnutzung von Medien, die punktuell und situativ sind. Sie basieren auf keiner grundsätzlichen Entscheidung, die mit der Pathosformel »für immer und ewig« versehen werden könnte. »Es passt halt gerade so«, bringt die Sache eher auf den Punkt. In der Tat sind die Grenzen zwischen Nutzern und Nichtnutzern von Medien oftmals fließend. Schätzungen zufolge verbergen sich hinter mehr als der Hälfte aller Facebook-Accounts sogenannte »Lurker«, also »lauernde« Teilnehmer, die zwar gelegentlich Inhalte konsumieren, aber selbst keine Inhalte einbringen.41 In bestimmten Phasen ihres Lebens legen sich Menschen einen Social-Media-Account zu und verwenden viel Zeit darauf, ihn zu pflegen und mit Inhalten zu füllen. In anderen Lebensphasen lassen sie ihr Konto brachliegen.42 Die Ursachen für solche Schwankungen der Mediennutzung können vielfältig sein. Der Umzug in eine neue Wohnung mit dem damit vorübergehend verbundenen Offlinestatus kann eine Phase der Abstinenz einleiten ebenso wie ein Providerwechsel. Die zerborstene Frontscheibe eines Smartphones, deren Ersatz sich aus unerfindlichen Gründen in die Länge zieht, kann den Ausschlag geben ebenso wie eine Prüfungsphase in der Schule, ein langersehnter Urlaub oder eine neue Bekanntschaft.
Versteht man Medienverweigerung und Medienverzicht als bewusste Handlungen, lassen sich der Nichtnutzung von Medien sehr unterschiedliche Gründe zuschreiben. In vielen Fällen dient sie einem ganz bestimmten Zweck. Wer abends nach Hause kommt und sein Smartphone auf stumm schaltet, der möchte möglicherweise einen ungestörten Abend verbringen. Wer so handelt, tut etwas ganz und gar anderes als jemand, der bewusst kein Smartphone von Apple kauft, weil er damit vermeiden möchte, einen global operierenden Konzern zu unterstützen. Wiederum etwas anderes macht derjenige, der neuen Medien wie dem Smartphone grundsätzlich kritisch gegenüber eingestellt ist und daher auf die Nutzung eines iPhones verzichtet.43 Bei allen Unterschieden, die sich zwischen Nichtnutzern und Nutzern konstatieren lassen, gilt aber auch, dass Menschen, die sich situativ oder langfristig, bewusst oder unbewusst, mit oder ohne Emphase entscheiden, auf ein bestimmtes Medium oder auf ein bestimmtes Medienangebot zu verzichten, etwas ganz Ähnliches tun wie Menschen, die sich aus denselben Gründen dafür entscheiden. Denn beide Gruppen beziehen sich in ihrem Handeln auf ebendiese Medien, und sie tun dies immer aus den Geschichten und Diskursen ihres Lebens heraus.44 Mediennutzung und Medienabstinenz sind also keine kategorisch unterschiedlichen Handlungsweisen, sondern Elemente eines medienbezogenen Handlungszusammenhangs.
Das in diesem Buch entwickelte Plädoyer für die stärkere Beschäftigung mit Phänomenen der medienbezogenen Stille, des Schweigens sowie der Nichtnutzung von Medien richtet seine Emphase daher nicht auf einen neuen, noch zu bearbeitenden Forschungsbereich, sondern vielmehr auf einen bestehenden, den es um eine neue Perspektive zu erweitern gilt. Die Medienforschung der vergangenen Jahre war fast ausnahmslos durch eine Startoperation getragen: Im Fokus standen Kommunikation im Sinne der Mitteilung von Informationen, Aneignung im Sinne der aktiven Auseinandersetzung mit Medienangeboten sowie Zuschauerquoten und Reichweiten. So fügten sich die gesammelten Beobachtungen jedoch zu einer gleichsam halbierten Theorie der gesellschaftlichen Kommunikation. Diese Theorie war halbiert, weil sie blind war für zentrale Elemente der Kommunikation, die jedem Sprechakt, jeder Mediennutzung immanent sind: der Ruhe, des Schweigens, des Medienverzichts. Menschen, die in irgendeiner Weise auf Medien verzichten, sind freilich nicht deswegen ein so wichtiger Untersuchungsgegenstand, weil sie zahlenmäßig besonders stark ins Gewicht fielen oder weil sie es geschafft hätten, sich außerhalb einer Gesellschaft zu positionieren, die sich bis in ihren letzten Winkel der Logik der Medien verschrieben hat. Die Big Five der digitalen Plattformökonomie – Amazon, Google, Facebook, Apple und Microsoft – sind angetreten, um zum »Betriebssystem« im Leben ihrer Verwender zu werden.45 Das Leben der meisten Menschen, und auch das Leben derjenigen, die auf Medien in irgendeiner Weise verzichten, findet daher heute nicht mehr nur mit den Medien statt, sondern in einem weit umfassenderen Sinn in ihnen. Der Ausstieg aus diesem Medien-Leben46 ist eine Fiktion. Aber nicht obwohl, sondern gerade weil dies so ist, sind die Sendepause, die Stille, das Schweigen, die Nichtnutzung von Medien so aufschlussreiche Kategorien der Beschreibung gegenwärtiger Gesellschaften.
Je wichtiger eine Technologie ist, je mehr sie das Leben der Menschen beeinflusst, desto weniger sichtbar ist sie.47 In gesteigertem Maße gilt dies für die digitalen Medien, deren technologischer Eros sich ganz wesentlich aus der Tatsache speist, dass sie sich als mehr oder weniger unsichtbare Helfer in den Alltag integrieren. Immerhin ist genau dies seit über 20 Jahren in unterschiedlichen Varianten das vorherrschende Leitmotiv der Medienentwicklung gewesen: als »Ambient Intelligence« bei Philips, als »Pervasive Computing« bei IBM, als »Proactive Computing« bei Intel und als »Ubiquitous Computing« wie bei Xerox.48 In einer Zeit, in der die Unsichtbarkeit des Medienhandelns im Sinne einer regelrechten Medienvergessenheit nicht nur die Konsequenz einer erfolgreichen gesellschaftlichen Etablierung von Medien ist, sondern eine – wenn nicht sogar die – dominante Ideologie der Technologieentwicklung darstellt, ist die Verlagerung der Beobachtungsperspektive auf die Sendepause, die Stille, das Schweigen, die Nichtnutzung von Medien ein sinnvoller heuristischer Kniff, mit dessen Hilfe beobachtbar wird, was sich zunehmend der Beobachtung entzieht, weil es aufgrund einer Politik der Invisibilisierung ein selbstverständlicher, weitgehend unhinterfragter Bestandteil des Alltags geworden ist. Phänomene der Stille, des Schweigens, der Nichtnutzung von Medien besitzen nicht nur aufgrund eines allseits gestiegenen Bedürfnisses nach Stille große Relevanz, sondern auch weil sich die Symptome mediatisierter Gesellschaften in diesem Sinn ex contrario49 besser beobachten lassen. Gerade dort, wo bewusst auf Kommunikation und Mediennutzung verzichtet wird, lassen sich jene Abwägungsprozesse zwischen Reden und Schweigen, zwischen Teilnahme und Verzicht klar beobachten, die angesichts der »fürsorglichen Belagerung«50 durch die digitalen Medien heute das weiße Rauschen im Hintergrund eines vollvernetzten Lebens bilden.
Gehetzt, gereizt, gestresst
Zum Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Gesellschaft dank der digitalen Medien allem Anschein nach in der Zukunft angekommen. Der medientechnologische Fortschritt bewegt sich jedoch wie ein Ruderer vorwärts, die Vergangenheit im Blick, das Ziel im Rücken. Nachdem der Gesellschaft im Zuge ihrer funktionalen Differenzierung die Gemeinschaft als bestimmendes Prinzip abhandengekommen ist und das Leben zunehmend in streng voneinander getrennten Betriebseinheiten stattfindet, sind es ausgerechnet jene Medien an der Spitze des technologischen Fortschritts, die ihren Nutzern versprechen, längst abgelegte Kategorien der gesellschaftlichen Ordnung wiederzubeleben: Gemeinschaft, Nähe, Erfahrung und Unvermitteltheit.51 Nach dem Verlust der transzendentalen Gewissheit und der existenziellen Zugehörigkeit zu einer großen Gemeinschaft, wie sie früher Staat und Kirche sowie lokal stark begrenzte Siedlungsformen gewährleisteten, bedienen die digitalen Medien heute geradezu nostalgische Erwartungen an die Wiedervereinigung von Gesellschaft und Gemeinschaft.
Als einer der bekanntesten Fürsprecher dieser Medienutopie kann bereits der kanadische Medienphilosoph Marshall McLuhan gelten, der einst seine ganze Hoffnung auf das Fernsehen als das »Fenster zur Welt« richtete. McLuhan starb in der Silvesternacht des Jahres 1980, einige Jahre bevor er hätte erleben können, wie das Internet genau dieses Versprechen in abermals gesteigerter Form seinen Nutzern unterbreiten sollte. Er hätte dann aber auch gesehen, dass heutige Mediennutzer geradezu zerrissen sind zwischen den scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten der Vernetzung auf der einen Seite und dem Bedürfnis nach Grenzziehung auf der anderen. Permanent online und vernetzt zu sein bedeutet, sich stets zwischen der Erfahrung von digitalem Empowerment und digitalem Overpowerment zu bewegen.52 Viele Mediennutzer kranken im wahrsten Sinne des Wortes am Fehlen der Stille, der Ruhe, des Rückzugs. Daher ist so oft von suchtartigen Formen der Mediennutzung die Rede,53 von medienbezogenen Erschöpfungssyndromen und Depressionen, von zahllosen Varianten des Overloads, von der Fear of Missing Out (FOMO) oder von einem wachsenden Aufmerksamkeitsdefizit.
Gehetzt, gereizt, gestresst sind also die Mediennutzer von heute.54 Vor dem Hintergrund dieser Diagnose beginnt sich derweil ein neuer, auf die digitalen Medien bezogener Diskurs zu formieren, der ein zentrales Argument früherer Diskurse gewissermaßen auf den Kopf stellt. Während in zahlreichen medientheoretischen Debatten der vergangenen Jahre darüber reflektiert wurde, unter welchen Bedingungen Menschen bereit sind, einem Computer menschliche Intelligenz zuzuschreiben, legen aktuelle Diskurse nahe, dass nun die Mediennutzer selbst an der Reihe sind, sich Qualitäten zuzulegen, die sie zu satisfaktionsfähigen Partnern jener Medientechnologien machen, die nach menschlichem Vorbild erschaffen worden sind.55 Das erklärt den Boom des Begriffs der Medienkompetenz, die im Urteil vieler Beobachter heute neu erlernt werden muss, um den Herausforderungen der digitalen Medien angemessen begegnen zu können. Die großen Konzerne der Plattformökonomie stehen im Schlaglicht der Kritik wie einst Axel Springer und seine mächtige Bild-Zeitung. »Enteignet Springer!«, lautete der Kampfschrei damals. »Werdet endlich erwachsen, lernt Medien zu nutzen!«, heißt er heute.
Die vielen Phänomene des Overpowerments, des Überwältigtseins von den neuen ungeahnten Möglichkeiten der digitalen Medien, zeigen, dass es heute ganz offensichtlich eine besondere Herausforderung darstellt, Medien richtig zu nutzen. In einer Zeit omnipräsenter und ubiquitärer Medien ist es schwierig, die Selbstbehauptung des Subjekts im Spannungsfeld von »kognitiver Autonomie und sozialer Orientierung« richtig auszubalancieren.56 »Wo bist du gerade?«, »Woran denkst du in diesem Moment?«, »Lass andere wissen, was du gerne liest, siehst, tust …«, »Zeig dich!«, »Track dich!«, »Track mich!«. All die Partizipationsangebote und Aufforderungen zur Artikulation des eigenen Profils, die heutige Mediennutzer täglich erhalten, sind Ausdruck der Tatsache, dass sich große Teile der Gesellschaft im kollektiven Rausch eines neuen digitalen Gemeinschaftserlebens befinden. Sie zeigen aber ebenso deutlich, dass das Recht jedes Einzelnen auf Distanz zu anderen Menschen permanent bedroht ist. Es ist vor diesem Hintergrund wenig überraschend, dass seit einigen Jahren ausgerechnet die Gruppe der Introvertierten besondere publizistische Aufmerksamkeit erhalten hat. Bestseller wie das Buch Still: Die Kraft der Introvertierten der US-amerikanischen Aktivistin und Unternehmerin Susan Cain haben ein Massenpublikum erreicht.57Der Spiegel weiß von der starken Wirkung leiser Töne zu berichten,58 die New York Times gibt Empfehlungen für In-sich-Gekehrte,59 ja, und auch die Apotheken Umschau nimmt sich der »unterschätzten Eigenschaft« der Introvertiertheit an.60
Menschen besitzen die einmalige Fähigkeit, buchstäblich aus sich herauszugehen, sich zu artikulieren, ihr Denken zu denken und dieses Denken in Worte zu kleiden, um so in eine Art öffentliche Beziehung zu sich selbst zu treten. Jeder Mensch ist in diesem Sinn exzentrisch veranlagt. Zugleich sind Menschen aber auch in einer bestimmten Umwelt positionierte Lebewesen, die grundsätzlich in der Lage sein müssen, sich effektiv von dieser Umwelt abzugrenzen, um als Individuen überhaupt existieren zu können. Mit Haut und Haaren in eine Gemeinschaft integriert zu sein wäre daher nur zu dem Preis eines weitgehenden Identitätsverlusts zu haben. Genau aus diesem Grund »trägt jedes Zusammenleben den Keim des Aneinandervorbeilebens in sich«.61 Kein Desinteresse ist dies, sondern die »Klugheit des Herzens«,62 eine Lebensweise, die Grenzen respektiert, auf Takt setzt, das Bedürfnis nach Distanz anerkennt und den Begriff der Rolle im breiten Wortsinne als etwas versteht, das man ist und das man spielt. Um ihre Autonomie und Selbstbehauptung als Individuen aufrechterhalten zu können, brauchen Menschen Interaktionsrituale, sie brauchen Höflichkeit, Takt und die Sicherheit abstrakter Rollen. In einer Welt, in der das Individuum geradezu ununterbrochen kommunikativ von außen adressiert wird, in einer Welt, in der die ständige kommunikative Verfügbarkeit des Individuums die Norm ist, werden Selbstbehauptung und Selbstbestimmung zu nachgerade prekären Kategorien.
Das Verhältnis von Selbstbestimmung und Medialität steht im Zentrum zweier scheinbar diametral entgegengesetzter philosophischer Traditionen. Die eine Tradition, die romantische, stellt den Menschen mit seiner Kapazität zur unvermittelten Kommunikation ins Zentrum. Nur er verfügt über die Fähigkeit, sein Innerstes nach außen zu kehren und zugleich Empathie für sein Gegenüber zu entwickeln. Aus dieser Perspektive bedeuten mehr Medien kurz gesagt weniger Mensch. Denn Medien sind per definitionem immer dazwischengeschaltete Instrumente. Sie verzerren, verwässern, verunreinigen in diesem Sinne die einmalige Gabe des Menschen. Die echte Gabe, sich mitzuteilen und zugleich Empathie entwickeln zu können, kommt ohne Medien aus. Die zweite philosophische Tradition setzt den Menschen als Mängelwesen ins Zentrum. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das allein aus eigenen Kräften heraus, ohne den Einsatz von Technik, nicht überlebensfähig wäre. Aus dieser Perspektive betrachtet sind Medien gewissermaßen Prothesen, die seine Fähigkeiten zur Kognition und Kommunikation mit anderen überhaupt erst zur vollen Entfaltung bringen. Aus dieser zweiten Perspektive bedeuten mehr Medien kurz gesagt auch mehr Mensch.63
In jüngster Zeit häufen sich Stimmen, die diese beiden philosophischen Positionen in zwei diametral entgegengesetzte medienbezogene Szenarios überführen und eine Zukunft prognostizieren, in der es nur noch voll vernetzte oder vollends entnetzte Mediennutzer gibt. Es wäre dies eine Gesellschaft, in der man entweder Nachrichten nur noch online oder nur noch per Zeitung konsumiert, in der man nur noch über die sozialen Medien im Austausch miteinander ist oder per Schneckenpost. Indessen gibt es Anzeichen, die darauf hindeuten, dass diese strikte Entgegensetzung von Vernetzung und Entnetzung an der Realität vorbeigeht. Eine Reihe von Entwicklungen weisen nämlich vielmehr darauf hin, dass sich die voranschreitende Vernetzung der Gesellschaft und das individuelle Bestreben, sich punktuell zu entnetzen, in einem wechselseitigen Steigerungsverhältnis gegenseitig bedingen und zwei Seiten einer Medaille sind. Denn es ist geradezu eine anthropologische Grundkonstante, dass jede Form der gesteigerten Nähe nach ihrer jeweils spezifischen Form der Distanz sucht. Im Schatten jedes neuen noch so spektakulären Rituals der Vernetzung entstehen unzählige neue Rituale der Entnetzung. Im Schatten jeder neuen Medientechnologie, die mehr Information, mehr Unterhaltung und mehr sozialen Austausch verspricht, entstehen ebenso unzählige neue Medientechnologien, die von alldem weniger, aber möglicherweise Besseres versprechen. Im Schatten der Mediatisierung jedes neu aufgeschlossenen gesellschaftlichen Ortes entstehen in der Gesellschaft unzählige andere Orte, die sich neuerdings abschließen, um demonstrativ offline zu sein.
Medien sind ein selbstverständlicher Bestandteil im Leben der meisten Menschen. Gleichzeitig ist es schwer, heute jemanden zu finden, der nicht in irgendeiner Weise seinen Medienkonsum regulieren würde. Viele leisten Medienverzicht, auch wenn sie dies oft ganz unbewusst mit derselben Vergessenheit tun, in der sie Medien nutzen. Im schnelllebigen Alltag verständigt man sich mit seinem Partner per SMS und WhatsApp, hält sich auf dem Laufenden, koordiniert gemeinsame Unternehmungen. Aber natürlich gibt es immer noch viele Momente, in denen eine kleine handschriftliche Notiz am Kühlschrank tausend Mal mehr sagt als jede elektronische Nachricht. Im Büro gehören der Computer, das Tablet und das Smartphone zum selbstverständlichen Inventar. Aber viele legen am Arbeitsplatz all dies auch einmal beiseite und suchen das persönliche Gespräch mit dem Kollegen, anstatt eine E-Mail zu schreiben. Vermutlich sind noch nie so viele kleine schwarze Papierschreibhefte (notebooks) verkauft worden wie heute, da nahezu in jedem Haushalt ein elektronisches Notebook steht. Es ist erstaunlich, dass ausgerechnet in einer Zeit, in der Musik immer häufiger über Streaming-Dienste bezogen wird, die Musikkassette und die Langspielplatte aus Vinyl eine regelrechte Renaissance erleben.64 Es ist ebenso erstaunlich, wie viele Menschen heute berichten, dass sie ihren Arbeitsalltag neu zu strukturieren versuchen, um sich wieder besser fokussieren zu können; wie viele Menschen von den Regeln ihrer Mediennutzung erzählen, die sie sich selbst oder ihren Kindern auferlegen, um ihre Zeit sinnvoll einzuteilen, Freundschaften zu pflegen, ihren Hobbys nachzugehen.
Es ist unmöglich, all diese kleinen Gesten zu protokollieren, sichtbar zu machen als Erkennungszeichen einer Bewegung, die sich in einem kollektiven Demonstrativum gegen Medien richtet. Keiner derer, die ihr Smartphone erst eine Woche nach dem Zerbersten des Displays zur Reparatur in die Handyklinik bringen, keiner, der seine Notizen wieder handschriftlich verfasst oder seine Langspielplatten nach vielen Jahren des Exils im Keller wieder in den Wohnzimmerschrank stellt, würde sich als Verweigerer bezeichnen. Oft sind es lokale Akte der Subversion, punktuelle Handlungen des Verzichts, ein kurzes Zögern, spontane Entscheidungen für eine andere, analoge Medien involvierende Handlungsoption. Viele der heutigen Mediennutzer verhalten sich intuitiv so, wie es früher gesellschaftliche Führungseliten getan haben und schaffen sich Freiräume der Nichterreichbarkeit, budgetieren ihre freie Zeit so, dass ihnen ungestörte Zeit zur Kontemplation bleibt, selektieren die von außen kommenden Informationen rigoros in Bezug auf ihre Relevanz. Es sind die vielen kleinen, im Alltag oftmals unbemerkten Gesten der bewussten Mediennutzung, aber auch des mehr oder weniger bewussten Verzichts auf Medien wie diese, die zeigen, dass die voranschreitende Mediatisierung westlicher Gesellschaften ihre eigene Dialektik produziert. Auch in einer Zeit der gesteigerten Verfügbarkeit von Medien und Kommunikation verhalten sich Mediennutzer also durchaus eigensinnig und werden nicht kollektiv und pauschal »mediatisiert«.
Man darf sich Mediatisierung, also die voranschreitende Durchdringung der Gesellschaft mit Medien, nicht als einen linearen Prozess vorstellen, der jeden Menschen jederzeit und an jedem Ort im selben Umfang voll und ganz erfasst. Wie bei vielen anderen Prozessen der gesellschaftlichen Verbreitung neuer Errungenschaften handelt es sich auch bei der Mediatisierung um eine allmähliche Entwicklung mit zahlreichen Diskontinuitäten und Brüchen.65 Solche Brüche werden beobachtbar als kaum zu überhörender Unterton medienbezogener Debatten, wie sie in der Öffentlichkeit geführt werden. Die Enthüllungen Edward Snowdens, die vielen schwelenden Datenschutzskandale, aber auch öffentlich diskutierte Phänomene des Information-Overloads und des Aufmerksamkeitsdefizits heutiger Mediennutzer, des suchtähnlichen Mediennutzungsverhaltens, der Cyberkriminalität, der Propaganda, des Pornografie- oder Waffenhandels im Dark Web sind stete Quellen der Verunsicherung und des Unbehagens. Dies alles bildet das ständige Grundrauschen jeder Episode der Mediennutzung, die sich daher heute notwendigerweise immer in einem Spannungsfeld zwischen Affirmation und Ablehnung bewegt.
Inzwischen gehen immer mehr Menschen dazu über, ihre Smartphones, Tablets und Notebooks, die allesamt im Verdacht stehen, entsicherte und durchgeladene Waffen eines verdeckten Überwachungsangriffs zu sein, mit einem Klebestreifen über der Kamera zu entschärfen.66 Die abgeklebte Webcam über dem Bildschirm des Smartphones oder des Notebooks ist geradezu das Sinnbild für eine Fülle von Taktiken des Widerstands, mit denen Mediennutzer sich selbst, aber auch anderen signalisieren, dass sie sich der permanenten Möglichkeit einer im Hintergrund laufenden verdeckten Beobachtung bewusst sind. Vor einigen Jahren machte eine erstaunliche Nachrichtenmeldung die Runde, in der der damals noch im Amt befindliche FBI-Direktor James B. Comey in einer öffentlichen Diskussion bestätigte, dass er seine Webcam überdecke. Schon lange ist das Abkleben der Webcam also nicht mehr das Verhalten einer esoterischen oder paranoiden Minderheit, sondern Ausdruck einer weitverbreiteten, tiefsitzenden Verunsicherung sowie ein Beleg der Tatsache, dass heutige Mediennutzer einen ständigen Balanceakt zu leisten haben im Spannungsfeld zwischen Reden und Schweigen, Tun und Lassen, Zeigen und Verhüllen. Der Klebestreifen über der Webcam ist der Stoßseufzer einer Gesellschaft, deren Medien einerseits das soziale Leben am Laufen halten, andererseits aber zu einem Machtfaktor an sich geworden sind, vor dem man auf der Hut ist.
Man kann eigentlich heute keine Medien mehr nutzen, ohne nicht an jeder Ecke mit der Mahnung konfrontiert zu werden: Gib acht! – ohne sich selbst zu vergewissern, und wenn auch nur durch einen kleinen Klebestreifen, dass man wachsam ist und den Unschuldsbekundungen der großen IT-Konzerne nicht traut, und dies möglicherweise auch zu Recht. Im Sommer 2018 förderte eine Recherche der Nachrichtenagentur Associated Press zu Tage, dass Google die Bewegungsmuster von Smartphone-Nutzern auch dann beobachtet, wenn diese die entsprechende Funktion auf ihrem Gerät deaktiviert haben.67 Viele sehen in Meldungen wie diesen den Beweis dafür, dass die großen Konzerne der Plattformökonomie so lange nach eigenem Ermessen verfahren und ihren Profit daraus schlagen werden, bis ihnen der Staat einen Strich durch die Rechnung macht. Bis dahin entwickeln mehr und mehr Nutzer ein immer deutlicher zu beobachtendes Unbehagen in der digitalen Medienkultur.
Angesichts der Tatsache, dass viele Menschen den Medien heute mit einer Mischung aus Faszination und einer gesteigerten Form von Wachsamkeit und Misstrauen begegnen, ist es kein Wunder, dass das gegenwärtige Kommunikationsklima zugleich durch die geradezu hingebungsvolle Nutzung der Medien und durch eine profunde Sehnsucht nach Authentizität gekennzeichnet ist. Der Mailänder Künstler Biancoshock hat dieser Sehnsucht mit seinem Projekt Web 0.0 Ausdruck verliehen.68 Schauplatz der Kunstaktion war das kleine Dorf Civitacampomarano in der italienischen Provinz Campobasso. Rund 400 überwiegend ältere Einwohner leben in Civitacampomarano, die meisten von ihnen ohne Internetzugang. Dennoch twitterten sie, tauschten sich über Facebook aus, kauften bei eBay und Amazon ein und fanden bei Wikipedia Antworten auf ihre Fragen. Es gab all dies auch ohne das Internet, weil Biancoshock die Bewohner von Civitacampomarano mit ein bisschen Farbe ans Netz angeschlossen hatte: Auf der Telefonzelle erhob sich das Erkennungszeichen des Kurznachrichtendienstes WhatsApp. Die Parkbank war in dem leuchtenden Blau Twitters angemalt. Daneben war auf einem Schild das Logo mit dem zwitschernden Vögelchen platziert. Über dem öffentlichen Aushang an der Piazza leuchtete weiß auf blauem Grund der Schriftzug Facebooks. Der kleine Laden um die Ecke, in dem man frische Eier und Olivenöl kaufen kann, hieß von nun an eBay. Es gibt ein soziales Leben ohne die sozialen Medien, lautet die Botschaft dieser Kunstaktion.
Die sozialen Medien haben nichts Neues im Angebot, sondern nur die technisierte Version dessen, was Menschen schon immer leidenschaftlich gern praktiziert haben: Kommunikation und Austausch, Information, Meinungsbildung, Unterhaltung. Kein Mensch wäre bereit, darauf zu verzichten. Dennoch bedarf es in manchen Fällen schon einer Naturkatastrophe, um wieder den Zustand eines authentischen Miteinanders zu erleben, wie er früher einmal üblich war. Als im September des Jahres 2018 der Hurrikan Florence über die Südstaaten der USA hinwegfegte und in weiten Landesteilen ein regelrechtes Bild der Verwüstung hinterließ, berichtete die ARD-Korrespondentin Claudia Sarre direkt aus Wilmington, einer der am stärksten betroffenen Städte des Bundesstaates North Carolina. »Für viele Anwohner«, so erzählte ihr Will, der den Sturm glimpflich überstanden hatte, »ist Mischas Irish Pub ein Zufluchtsort. ›Die Leute kommen hierher, um mit anderen zusammen zu sein. […] Wie früher, ohne Handy, ohne Fernseher, ohne Internet – dafür mit Kerzenlicht, einer Bar und einem Bier.‹«69 Es ist bezeichnend, dass sich der viel beschworene amerikanische Optimismus während einer Naturkatastrophe ausgerechnet auf die erzwungene Entnetzung und die, wenn auch unfreiwillige und wohl auch nur vorübergehende Rückbesinnung auf authentische Formen der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht richtet.
In den soziologischen Fachdebatten ist die Sehnsucht nach Authentizität freilich schon ein lange etabliertes Thema. Bereits für Max Weber war sie gewissermaßen auf der Kostenseite der Rationalisierung moderner, entzauberter Gesellschaften zu verbuchen. Ebenso hat es der französische Soziologe und Theologe Jacques Ellul mit Blick auf die Folgen einer voranschreitenden Technisierung der Gesellschaft getan. Prozesse der anomischen Entfremdung wurden in der klassischen Soziologie von Émile Durkheim beschrieben. In zeitgenössischen Berichten wird dasselbe Thema etwa in den kritischen Gesellschaftsanalysen Robert Putnams oder Sherry Turkles aufgegriffen.70 Alldem haben jene, die heute zu mehr Achtsamkeit im Medienhandeln aufrufen, einen zeitgemäßen, für weite Teile der Öffentlichkeit klar vernehmbaren Ausdruck verliehen.71