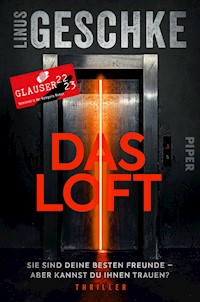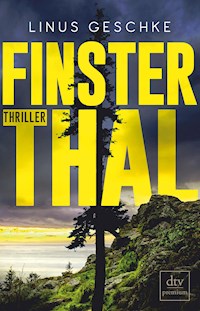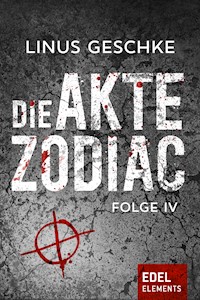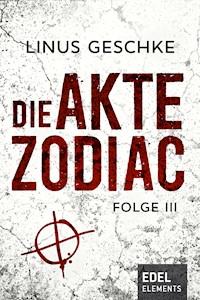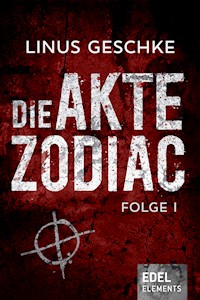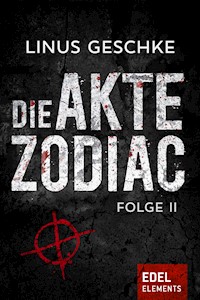9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Oktober 1997: Zwei junge Pärchen zelten im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Zwei Tage später wird eines der Paare tot im Wald gefunden, das andere bleibt verschwunden. Gegenwart: Der Kölner Reporter Jan Römer berichtet in der Rubrik »Ungelöste Kriminalfälle« über die Morde. Was geschah in jener Nacht in den Ardennen? Fiel das zweite Paar demselben Täter zum Opfer, oder brachten sie selbst ihre Freunde um und tauchten nach der Tat unter? Gemeinsam mit seiner besten Freundin Mütze beginnt Jan Römer zu ermitteln — und sticht in ein Wespennest ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Es ist der mysteriöseste Mordfall, über den der Journalist Jan Römer je für die Rubrik »Ungelöste Kriminalfälle« berichtet hat: 1997 wurde ein junges Pärchen im Grenzgebiet zwischen Eifel und Ardennen ermordet, ein zweites verschwand spurlos. Nach der Veröffentlichung erhält Römer einen anonymen Anruf: Der Mann bietet Römer neue Informationen über den Doppelmord an. Kennt er den Mörder, und weiß er, was mit dem zweiten Pärchen geschah?
Doch bei einem Treffen wird der Informant vor Römers Augen aus dem Hinterhalt erschossen. Römer, den die Kugeln nur knapp verfehlt haben, weiß, dass weitere Recherchen lebensgefährlich sind. Trotzdem macht er sich gemeinsam mit seiner besten Freundin Stefanie »Mütze« Schneider auf in die Ardennen, um dort nach alten und neuen Spuren zu suchen – und herauszufinden, was in jener Nacht wirklich geschah.
Der Autor
Linus Geschke, geboren 1970, arbeitet als freier Journalist für führende deutsche Magazine und Tageszeitungen, darunter Spiegel Online, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Manager Magazin. Als begeisterter Taucher verfasst er zudem Tauch- und Reisereportagen, für die er bereits mehrere Journalistenpreise gewonnen hat. Linus Geschke lebt in Köln.
Von Linus Geschke ist in unserem Hause außerdem erschienen:
Die Lichtung
LINUS GESCHKE
KRIMINALROMAN
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1192-0
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage März 2016
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Titelabbildung: © getty images/image source (Wald); © plainpicture / KuS (Fuchs); © FinePic®
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Für meine Mutter, Ariane und Emma.
Und für alle anderen Menschen, die wissen, dass man ohne Rückgrat nicht aufrecht gehen kann.
Wir alle tragen das Gute in uns. Ebenso das Böse. Doch während wir das eine nach außen kehren, um unsere Mitmenschen daran teilhaben zu lassen, halten wir das andere in den dunkelsten Winkeln unserer Seele verborgen. Haben es dort in Ketten gelegt, die aus Moral, Empathie und Toleranz geschmiedet sind.
Den meisten Menschen gelingt dies zeit ihres Lebens ganz gut.
Anderen weniger.
Und einigen gar nicht.
In den Medien werden diese Menschen dann häufig als Verkörperung des Bösen bezeichnet. Sie sind es, weil die dunkle Seite in ihnen übermächtig ist. Vielleicht auch, weil sie selbst zu schwach sind. Sie haben die Finsternis wie einen Parasiten in sich getragen und ungestört groß werden lassen, bis dieser nach Nahrung schreiend an die Oberfläche drang, die Herrschaft über seinen Wirtskörper übernahm und menschliche Monster schuf.
Einige dieser Monster sind zu Mythen geworden, bei denen es schwerfällt, zwischen Wahrheit und Legende zu unterscheiden. Jack the Ripper. Theodore »Ted« Bundy. Charles Manson. Jeder kennt ihre Geschichten, über ihre Taten gibt es unzählige Dokumentationen, und dennoch bleibt das dahintersteckende Warum meist ungeklärt.
Viele dieser berühmt-berüchtigten Monster sind mittlerweile gestorben. Andere vegetieren dahin, abgeschirmt in Hochsicherheitsanstalten. Aber am meisten Angst macht uns das Böse, das unerkannt unter uns lebt. In derselben Gemeinde, dem gepflegten Reihenhaus gegenüber. Vielleicht haben sie Frauen und Kinder; vielleicht beziehen sie Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen oder achten im Supermarkt darauf, dass der Kaffee fair gehandelt wurde. Oft sind es unauffällige und adrett gekleidete Menschen, die samstagmorgens den Nachbarn grüßen, wenn man sich beim Rasenmähen sieht. Sie sind groß oder klein, älter oder jünger, und es gibt nur ein Merkmal, das sie verbindet. Das Gute stellt bei ihnen nicht mehr als eine hauchdünne Fassade dar; ähnlich wie die glitzernde Oberfläche des Meeres, die verbirgt, was sich in den Tiefen darunter befindet. Sie sind nicht wie andere.
Weil die Werte der Gesellschaft ihnen nichts bedeuten.
Weil sie glauben, über ihnen zu stehen.
Weil sie böse sind.
OKTOBER 1997
Kalte Luft strömte durch ihre Lungen und ließ sie schlagartig wach werden. Eine Sekunde lang glaubte sie, in der Nähe ein Motorengeräusch zu hören, aber das konnte nicht sein. Nicht hier, in dieser abgeschiedenen Gegend, mitten im Wald.
Langsam kroch Britta aus ihrem Schlafsack und richtete sich auf. Lauschte. Neben ihr schnarchte ihr Freund Christian leise. Sie hörte, wie der kalte Eifelwind seufzend um die dünne Plane des Zeltes strich. Sonst nichts.
Beruhigt lehnte sie sich zurück und drückte auf den kleinen Knopf, der seitlich aus ihrer Armbanduhr ragte. Die Beleuchtung des Zifferblatts ging an. Vier Uhr siebenunddreißig. Noch zwei Stunden bis Sonnenaufgang.
Dann war es plötzlich wieder da.
Es klang nach winzigen Steinchen, die unter schweren Schuhsohlen knirschten. Die Geräusche mussten von dem Forstweg kommen, der keine zehn Meter von ihrem Zeltplatz entfernt durch den Wald führte. Ungefähr von dort, wo das kleine Fleckchen Wiese lag, auf dem ihre Freunde campierten. Kurz überlegte sie, Christian zu wecken, dann verwarf sie den Gedanken wieder. Er würde sie sowieso nur auslachen und irgendwelche blöden Sprüche von sich geben – außerdem kam ihr die Situation bislang nicht bedrohlich vor.
Obwohl …
Sie versuchte, einen Blick durch die fensterähnliche Öffnung des Zeltes zu werfen, die der Durchlüftung diente. Der hinter den Wolken stehende Mond spendete nur ein fahles, eisiges Licht, in dem sie lediglich die Konturen der umliegenden Bäume, die Umrisse der Büsche erahnen konnte. Hatte sie sich die Schritte ebenso wie das Motorengeräusch vielleicht nur eingebildet? Sie beugte sich weiter zur Seite, konnte aus ihrem Blickwinkel heraus jedoch nichts Außergewöhnliches erkennen. Alles, was blieb, war dieses sonderbare Gefühl im Bauch.
Sie drehte sich um, und ihre Finger tasteten suchend nach dem Rucksack, den sie neben die Luftmatratze gestellt hatte. Das Pfefferspray, das sie für bedrohliche Situationen angeschafft hatte, lag im vordersten Fach. Sie griff danach und war dankbar, dass sie es trotz Christians Sticheleien eingepackt hatte, der sie gefragt hatte, gegen wen sie das Spray eigentlich einsetzen wollte – gegen den bösen schwarzen Mann oder gegen ihn, wenn er Sex haben wollte?
Draußen knirschte es erneut. Kein Zweifel diesmal, da war jemand. Zu ihrer Erleichterung entfernten sich die Schritte kurz darauf jedoch in Richtung des Parkplatzes, der ein paar hundert Meter entfernt an der Bundesstraße lag, und Britta stieß die angehaltene Luft erleichtert aus. Fast hätte sie sogar gelacht – wahrscheinlich waren es nur nächtliche Wanderer gewesen, die der Zufall an diesen gottverlassenen Ort in der Eifel geführt hatte.
Dann kamen die Schritte zurück. Sie klangen anders diesmal, fester und energischer.
Ein anderer Mann.
Erneut versuchte sie, durch die Öffnung etwas zu erkennen, aber ihr Blick reichte nicht weiter als bis zu den Stämmen der Tannen, die das Zelt umschlossen und die noch dunkler waren als die Nacht dahinter. Und nun, wo sie noch angestrengter lauschte, hörte sie auch jemanden atmen.
Tief.
Angestrengt.
Und irgendwie auch … hechelnd.
Einen Sekundenbruchteil spielte sie mit dem Gedanken, sich laut zu räuspern, um ihn wissen zu lassen, dass hier jemand zeltete. Dann verwarf sie den Gedanken wieder – sie wollte gar nicht, dass er das wusste. Wollte lieber unter den Bäumen und hinter dem Dickicht verborgen bleiben, wo ihr Zelt mit der Dunkelheit des Waldes verschmolz und ihr ein Gefühl der Unsichtbarkeit verlieh.
Schlagartig fühlte sie sich in diesem Moment an ihre Kindheit erinnert. An die Zeit, als sie fünf oder sechs Jahre alt gewesen war. Sie war damals nicht gerne die Kellertreppe heruntergegangen, weil sie sich eingebildet hatte, dass in der Dunkelheit etwas auf sie lauern könnte. Schon der Moment, in dem sie die Tür geöffnet und die Hand ausgestreckt hatte, um das Licht einzuschalten, war ihr zuwider gewesen. Was, wenn da unten etwas lebte und nach ihr griff … eine Klaue mit Fingernägeln vielleicht, scharf wie Krallen … und sie in die Dunkelheit zog?
Damals war die Angst lediglich ihrer kindlichen Phantasie geschuldet gewesen. Monster, die unter dem Bett lauerten, irgendwelche dämonischen Kreaturen, die in finsteren Kellern hausten – Alpträume einer Sechsjährigen, die in der Dunkelheit geboren wurden. Jetzt war es wieder dunkel. Stockfinster sogar. Und Britta fühlte sich, als ob sie wieder sechs wäre.
Dann hörte sie, wie das Atmen draußen lauter wurde und die Füße sich bewegten. Würde der Unbekannte vor ihrem Zelt stehen bleiben? Er tat es nicht. Langsam ging er vorbei, und sie glaubte, dass sich die Schritte im Weitergehen abwandten und wieder leiser wurden. Wer auch immer da draußen sein mochte – er bewegte sich jetzt in Richtung des Zeltes ihrer Freunde, das Susanne und Thomas ein ganzes Stück entfernt aufgeschlagen hatten, damit beide Paare, nun ja … ein wenig Privatsphäre hatten.
Vorsichtig drehte Britta sich um und rüttelte Christian wach. Sein Murren unterband sie, indem sie ihm kurz die Hand auf den Mund presste. Dann flüsterte sie: »Da draußen ist jemand.«
»Wer soll denn da …«, murmelte er schlaftrunken.
»Psst!«
Sie hatte sich schon wieder abgewendet und den Blick auf die Zeltöffnung gerichtet. Langsam erhob sich auch Christian und kam zu ihr gekrabbelt. Dicht an die Plane gekauert, warteten sie ab.
Alles blieb still.
Zögerlich stand Britta auf und zog den Reißverschluss des Zeltes im Zeitlupentempo nach oben, bis es zur Hälfte offen stand. Draußen war immer noch nichts zu sehen, nur Finsternis. Sie atmete tief ein. Ihre Knie zitterten. Als irgendwo ein Käuzchen schrie, setzte ihr Herz kurz aus. Ihre Hände spielten mit der Dose Pfefferspray, während sie fieberhaft überlegte, was sie jetzt tun sollte.
Die Polizei rufen? Das wäre eine Möglichkeit. Allerdings hatte ihr Handy gestern in dem abgelegenen Waldgebiet gar nicht funktioniert. Und selbst wenn sie Empfang hatte – was sollte sie der Polizei sagen? Die Schritte konnten auch von zwei Wanderern stammen, die unschlüssig waren. Von einem Förster und seinem Gehilfen. Von irgendwelchen bescheuerten Ornithologen, die nachts Vögel beobachteten.
Sie blickte nervös durch den Spalt, den der offenstehende Reißverschluss erzeugte, und spürte dabei, wie Christian seine Hand auf ihre Schulter legte. Ihre Augen versuchten immer noch, das Dickicht zu durchdringen. War dort, zwischen den Bäumen, eine Bewegung zu sehen? Verbarg sich dort jemand und wartete auf sie? Ihr Herz raste. Ihr Puls klopfte gegen den Hals, als sei er ein lebendiges Wesen, welches dem Gefängnis ihres Körpers entfliehen wollte. »Bitte, lieber Gott«, flehte sie stumm. »Lass ihn gehen … lass ihn bitte, bitte gehen.«
Die Spannung zehrte an ihren Nerven. Lange würde sie das nicht mehr aushalten. Irgendwann musste sie etwas tun, musste handeln. Es gab nichts Schlimmeres als Ungewissheit. Sie legte ihre Finger vorsichtig um den Schlitten des Reißverschlusses und versuchte, ihn möglichst lautlos ganz nach oben zu schieben. Millimeter um Millimeter öffnete sich das Zelt.
»Bleib hier«, flehte Christian leise und griff nach ihrem Arm. Sie schüttelte ihn ab. Steckte den Kopf ins Freie und wagte kaum zu atmen. Aus der Dunkelheit drangen jetzt zwei Stimmen zu ihr. Die männliche kam ihr fremd und dominant vor, die andere klang unterwürfig, verängstigt und vertraut.
Sie gehörte Susanne.
Ihrer Freundin.
Britta bekam nur ein paar Worte mit, deren Sinn sie nicht verstand. Ebenso wenig wie den Schrei, der kurz darauf folgte und der so hoch, schrill und durchdringend war, dass er irgendetwas in ihr zerriss. Ihre Gefühle in zwei Hälften teilte, die fortan gegeneinander ankämpften.
Als der Wind auffrischte und rauschend durch die Tannen fuhr, traf Britta eine Entscheidung. Obwohl ihr Herz bis zum Hals schlug, erhob sie sich, verließ das Zelt und schlich langsam auf den Forstweg zu. Nur unbewusst nahm sie wahr, wie Christian ihr folgte. Schritt für Schritt tastete sie sich mit ihm im Schlepptau durch das Unterholz, bis sie nur noch wenige Meter von dem Pfad entfernt war. Plötzlich hörte sie zwei Männer lachen. Sie ging in die Hocke und versteckte sich hinter einem Busch. Dann ging alles sehr schnell.
Ein harter Aufprall, dann das Geräusch von Stoff, der ruckartig zerrissen wurde. Anschließend ein Sekundenbruchteil der Stille, der noch unerträglicher war als alles andere und durch einen Schrei beendet wurde, der nichts Menschliches mehr hatte.
Britta hätte später nicht mehr sagen können, wie lange sie dort gekauert hatte. Irgendwann hörten die Schreie endlich auf. Sie traute sich, den Busch vorsichtig zur Seite zu biegen und einen Blick auf die Wiese zu werfen.
Das Zelt ihrer Freunde glänzte silbern im Mondlicht. Aber es war nicht der unwirkliche Schimmer, der alles auslöschte, was bislang ihr Leben gewesen war. Auch nicht Susanne, deren regloser Körper mit dunklen Flecken übersät auf der Wiese lag. Es waren die beiden Männer, die danebenstanden und dafür sorgten, dass die Alpträume ihrer Kindheit in diesem Moment Wirklichkeit wurden.
GEGENWART
Der Cursor jagte auf dem Bildschirm von links nach rechts und hinterließ dabei einen Buchstaben nach dem anderen. Am Ende der Zeile rutschte er eine Reihe tiefer, und das Spiel begann von vorne. Mein Blick folgte ihm, während meine Gedanken völlig in der Story versunken waren. Ich hockte da wie unter einer unsichtbaren Glocke, die alles ausblendete, was nichts mit der Geschichte zu tun hatte.
Ich hörte nichts. Weder das Klappern der Tastaturen, mit denen Kollegen ihre Meldungen in den Computer hauten, noch das Geräusch von Stöckelschuhen, die hinter mir ihr typisches Klack-klack auf dem blankgewienerten Boden erzeugten. Ich war gefangen in einer Geschichte voller Rätsel, die wie für Verschwörungstheoretiker gemacht erschien und genau das war, was wir Monat für Monat für unsere Rubrik Ungelöste Kriminalfälle brauchten.
Im Herbst 1997 waren zwei junge Pärchen – der zwanzigjährige Thomas Leibach und seine achtzehnjährige Freundin Susanne Ritter sowie der neunzehnjährige Christian Wagner und die gleichaltrige Britta Lehmann – mit ihren Geländemaschinen über ein verlängertes Wochenende in die Eifel aufgebrochen. Sie hatten in dem Grenzgebiet zwischen Deutschland und Belgien zelten wollen, einfach nur eine gute Zeit haben, lieben und lachen.
Keiner der vier wurde danach wieder lebend gesehen. Ein Lokaljournalist, der in dem Gebiet Naturfotos machen wollte, hatte drei Tage nach dem Aufbruch der Pärchen zwei Leichen gefunden. Susanne Richter lag blutverschmiert und nur mit einem zerrissenen Schlüpfer bekleidet hinter einem Zelt, mitten im Wald auf einer kleinen Wiese. Ihr Leichnam wies mehrere tiefe Stichwunden auf, das linke Jochbein war durch Schlageinwirkung gebrochen. Anhand der gefundenen Fußspuren und des vermuteten Tatablaufs war die Polizei später von zwei Tätern ausgegangen. Die Obduktion ergab, dass Susanne Richter vor ihrem Tod vergewaltigt worden war, wobei der Täter Spermaspuren hinterlassen hatte.
Keine zwanzig Meter von ihrem Leichnam entfernt hatte der Fotograf dann auch den leblosen Körper von Thomas Leibach entdeckt, der halb im Unterholz lag. Auch er war erstochen wurden. Die Rechtsmediziner stießen auf vier Wunden, von denen zwei tödlich waren: eine am Oberarm, eine im Brust- und zwei im Bauchbereich. Abwehrverletzungen an Händen und Unterarmen wiesen auf einen zuvor stattgefundenen Kampf hin.
Christian Wagner und Britta Lehmann dagegen waren verschwunden und sind es bis heute geblieben. Diese Tatsache hatte verschiedenen Theorien und wildesten Spekulationen Tür und Tor geöffnet. Die meisten Leute glaubten, dass Christian und Britta denselben Tätern zum Opfer gefallen waren, dass man sie entführt und ihre Leichen später in dem undurchdringlichen Waldgebiet nahe der belgischen Grenze vergraben hatte.
Andere wiederum vermuteten, dass die Verschwundenen selbst die Mörder waren – dass die beiden ihre Freunde umgebracht hatten und dann untergetaucht seien. Diese Theorie war es auch, auf der der Fokus vieler Medienberichte gelegen hatte, insbesondere, was den Boulevardjournalismus betraf.
Ich aber war anderer Meinung. Für mich war die bevorzugte Theorie der Polizei auch die plausibelste: Zwei Triebtäter waren in dieser Nacht über die beiden Pärchen hergefallen, während sie im Schlaf gelegen hatten. Sie hatten ein Paar getötet, das andere verschleppt, später umgebracht und sich dann ihrer Leichen entledigt. Dafür sprach auch, dass die Spermaspuren, die die Polizei bei Susanne Ritter gefunden hatte, nicht mit der DNA des verschwundenen Christian Wagner übereinstimmte.
Aber das war Logik, und gerade Menschen, die gerne an Verschwörungstheorien glaubten, wollten davon nichts wissen. Warum, so argumentierten sie, wurden die Leichen dann nie gefunden? Und – was hatten die vier da eigentlich gemacht; so tief im Wald, abseits aller Landstraßen?
Fragen, auf die ich auch keine Antwort kannte.
Als ich fertig war, las ich meinen Bericht noch einmal durch und schickte ihn dann über eine interne Datenleitung an unseren Grafiker, damit er ihn setzen konnte. Wir hatten Fotos des Tatorts im Archiv, Suchbilder der Vermissten und eine Google-Earth-Darstellung des betreffenden Gebiets. Später würde er mir das Ganze dann wieder zurückleiten, damit ich die passenden Bildunterschriften schreiben konnte. Insgesamt würde sich die Strecke über acht Seiten ziehen. Auch, wenn Die Reporter ein Nachrichtenmagazin war: Die Rubrik Ungelöste Kriminalfälle kam bei unseren Lesern so gut an, dass sie ein fester Bestandteil des Hefts geworden war und ich der Mann, der sich darum zu kümmern hatte.
Ich hatte die Rubrik übernommen, nachdem ich einen Bericht über einen Mordfall geschrieben hatte, der meine eigene Jugendclique betraf. Es war uns gelungen, einen Mörder zu überführen, den ich als Teenager in den 80er Jahren als Freund bezeichnet hatte. Zu einer Zeit, in der Mopeds, Neue Deutsche Welle und die erste Liebe mein Leben beherrschten.
Auch damals war ein junges Pärchen bestialisch getötet worden, und vielleicht war das der Grund, warum mir die jetzige Geschichte so naheging. Ich fragte mich immer wieder, was genau in dieser Nacht passiert sein könnte und was die jungen Menschen vor ihrem Tod erlitten hatten.
Ein Mord, gerade in Tateinheit mit einer Vergewaltigung, ist immer ein grausames Verbrechen. Besonders schockierend aber ist es, wenn Menschen betroffen sind, die noch ganz am Anfang eines Lebens gestanden hatten, das ihnen durch die Tat gewaltsam geraubt wurde. Wenn man als Journalist über einen solchen Fall berichtete, war man immer der Versuchung ausgesetzt, den Schwerpunkt der Story auf den oder die Täter zu legen. Diese Herangehensweise hatte auch durchaus ihre Berechtigung, immerhin war der Täter für den Leser das spannendste Element bei einem Kriminalfall. Dennoch war es mindestens genauso wichtig, die Toten in einem solchen Bericht auch als Menschen darzustellen, nicht nur als Opfer. Ihre Namen mit einem Leben zu verbinden, das sie gelebt, erhofft und erträumt hatten.
Zwei Wochen später wurde die Story über die Eifelmorde dann veröffentlicht. Sie erschien in einer der meistverkauften Ausgaben der letzten Zeit, und uns erreichten zahlreiche Meinungen dazu. Einige Leser glaubten, eine Theorie liefern zu können, die zu allen Fakten passte. Andere wollten die vermissten Personen später noch gesehen haben, mal in Bielefeld, mal in Rio de Janeiro. Ein Wünschelrutengänger bot uns sogar an, die Leichen zu finden, wenn wir ihm dafür eine fünfstellige Summe zahlten.
Ich kannte solche Leserreaktionen bereits, so war es bislang bei allen Folgen der Ungelösten Kriminalfälle gewesen. Dennoch scherten sie mich nicht. Was mich anging, war der Fall abgeschlossen. Ich hatte alles in den Bericht gepackt, was mir wichtig erschien, und nicht vor, mich jetzt noch an weiterführenden Spekulationen zu beteiligen.
»Jan?«
Seufzend drehte ich mich zu unserer Politikredakteurin um, deren Arbeitsplatz an meinen grenzte. Monika Lettmann deckte ihren Telefonhörer mit einer Hand ab, während sie mit dem Zeigefinger der anderen darauf deutete und sagte: »Hier ist ein Leser dran, der dich unbedingt sprechen will. Soll ich durchstellen oder ihm sagen, du wärst nicht da?«
Kurz überlegte ich, ihn von meiner Kollegin abwimmeln zu lassen, dann entschied ich mich dagegen. Ich musste meinen Ruf, mich gerne vor Alltagsaufgaben zu drücken, ja nicht noch zusätzlich befeuern. »Gib her.«
Drei Sekunden später klingelte mein Telefon. »Jan Römer, Redaktion Die Reporter. Was kann ich für Sie tun?«
»Sind Sie der, der den Bericht über die Verschwundenen geschrieben hat?«
Im ersten Moment wusste ich nicht, wovon der Mann sprach. »Welche Verschwundenen?«
»Die in der Eifel. Sie wissen schon – zwei Tote, zwei Vermisste.«
Unbewusst verdrehte ich die Augen und begann, mit dem Kugelschreiber Kringel aufs Papier zu zeichnen. »Ja, der bin ich.«
»Ginster mein Name, Frank Ginster. Ich hätte da was für Sie.«
Ich musste aufpassen, nicht genervt die Luft auszustoßen. Schon wieder irgendein Spinner, der glaubte, eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben.
»Und?«
»Was und?«
»Na, was haben Sie für mich?«
»Darüber würde ich ungern am Telefon sprechen. Können wir uns nicht treffen? Und bringen Sie direkt das Scheckbuch mit, das sie ja sicher für solche Fälle in der Redaktion haben.«
Ich lachte kurz auf. »Da muss ich Sie enttäuschen, Herr Ginster. Wir zahlen nicht für Informationen – es sei denn, Sie hätten etwas wirklich Spektakuläres zu bieten.«
»Was ich habe, ist jede Summe wert«, sagte er nach einer kurzen Pause. »Beispielsweise die Wahrheit darüber, was in jener Nacht passiert ist.«
Er klang so überzeugend, dass ich augenblicklich den Kugelschreiber weglegte. »Sie wollen mir sagen, dass Sie wissen, was aus … Moment …«
»Britta Lehmann und Christian Wagner.«
»Genau … Sie haben Informationen darüber, was mit den beiden geschehen ist?«
»Nicht nur Informationen«, sagte er und schnaubte in den Hörer. »Ich kann Ihnen die ganze Geschichte liefern, von vorne bis hinten. Aber das läuft nicht kostenlos; nicht bei dem Risiko, das ich eingehe. Wenn Sie die Story haben wollen, müssen Sie dafür zahlen, und das nicht zu knapp.«
Ich überlegte kurz. Natürlich gab es in unserer Redaktion einen Topf, der für Informanten gedacht war. Und es gab zwei Voraussetzungen, um diesen zu öffnen: Zum einen musste die Geschichte wirklich ein Knüller sein – einer, der unsere Auflage steigerte oder geeignet war, das Image des Magazins anzuheben. Zum anderen mussten die gelieferten Informationen mit Beweisen unterfüttert sein. Unbestätigte Gerüchte, wilde Spekulationen und abgedrehte Mutmaßungen bekamen wir schon zur Genüge angeboten.
»Sie können Ihre Behauptungen auch belegen?«, fragte ich.
»Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ich habe die besten Beweise, die Sie sich vorstellen können. Also, wie sieht es aus – treffen wir uns?«
Ich wusste nicht, warum ich es zuvor nicht bemerkt hatte, aber der Mann klang angetrunken. Nicht wirklich besoffen, aber man hörte seiner Stimme einen gewissen Alkoholkonsum an. Sofort wurde ich wieder skeptisch, aber da war gleichzeitig auch dieses Gefühl in meinem Bauch. Eine kaum zu unterdrückende Neugierde, die mich dazu brachte, dem Treffen zuzustimmen.
»Einverstanden«, sagte ich. »Wann und wo?«
»Wie wäre es direkt morgen? Bei mir zu Hause in Euskirchen.«
Ich nahm den Kugelschreiber wieder in die Hand und schrieb neben den Kringeln die Adresse auf, die er mir nannte.
*
»Ach komm – du magst ihn nur nicht.«
»Nicht mögen ist zu viel gesagt. Ich glaube einfach nicht, dass er zu dir passt, das ist alles.«
Mütze schaute mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Ein wenig kritisch wie immer, wenn es um ihren neuen Freund ging. Und sie hatte recht, ich mochte ihn wirklich nicht, vermied es aber, ihr das so deutlich zu sagen. Schließlich war es ihr Leben, ihre Entscheidung.
Seitdem mich meine Frau vor ein paar Monaten verlassen hatte, traf ich mich wieder häufiger mit Mütze, um zu reden und dem Gefühl des Alleinseins zu entfliehen. Mütze war eine ehemalige Kollegin von mir und hieß eigentlich Stefanie Schneider, wurde aber von allen nur mit ihrem Spitznamen angesprochen, den sie ihren ständig wechselnden Kopfbedeckungen verdankte. Sie war 32 Jahre alt, hatte braune Rehaugen und dunkelblonde Haare, die sie meist zu einem Zopf gebunden trug. Auch als sie eine Erbschaft gemacht und anschließend beim Reporter aufgehört hatte, waren wir befreundet geblieben. Sie half mir bei Recherchen, unterstützte mich bei Ermittlungen und war Freundin und Vertraute zugleich.
»Vielleicht müsstest du Philipp einfach nur besser kennenlernen«, sagte sie jetzt. »Ich bin mir sicher, dass ihr beiden gut miteinander auskommen würdet. Du würdest dann schon feststellen, was für ein außergewöhnlicher Mensch er ist.«
Er ist ein außergewöhnliches Weichei, dachte ich. Sagte aber: »Natürlich ist er das.«
»Und er ist intelligent.«
»Habe ich jemals etwas anderes behauptet?«
»Dazu einfühlsam, humorvoll und tiefgründig.«
Ich schaute sie grinsend an. »Jetzt mal ehrlich, Mütze: Du bist heimlich mit Woody Allen zusammen, stimmt’s?«
Sie verdrehte die Augen und sah aus, als hätte sie die Gesichtszüge großer Karpfen studiert. Extrem missmutig und mit hängenden Mundwinkeln.
»Bitte, mach das nicht«, flehte ich sie an. »Wenn du damit nicht aufhörst, wird dein Gesicht irgendwann so bleiben, und Woody Allen wird dich gegen eine junge Asiatin eintauschen.«
Der Tritt gegen mein Schienbein war nicht ohne, aber wenigstens lächelte sie jetzt.
»Und du?«, fragte sie anschließend. »Was ist mit dir und Sarah – vermisst du sie?«
»Natürlich tue ich das. Aber noch mehr vermisse ich Lukas.«
»Sei froh, dass ihr wenigstens nicht so einen Rosenkrieg führt wie viele andere Paare und du den Jungen regelmäßig siehst.«
»Ja, schon, aber das ist nicht dasselbe. Es sind halt nur Besuche, Mütze. Kein gemeinsames Leben mehr. Und Lukas ist gerade neun geworden – hast du eine Ahnung, wie stark Kinder sich in dem Alter verändern? Und wie wenig ich davon jetzt nur noch mitbekomme?«
Sie schaute mich an und schwieg. Das war einer der Punkte, die ich so an ihr schätzte. Mütze wusste, wann sie reden musste und wann es besser war, einfach mal nichts zu sagen. Nicht viele Menschen beherrschten diese Kunst, und meistens war Schweigen ja auch etwas Bedrückendes. Nicht jedoch in diesem Fall. Hier zeugte es von einer engen Vertrautheit, die sich über Jahre hinweg aufgebaut hatte.
Augenblicklich tat es mir leid, dass ich sie wegen Philipp aufgezogen hatte. Ich nahm mir vor, beim nächsten Mal einfühlsamer zu reagieren. Wenn dieses Weichei sie tatsächlich glücklich machte, würde ich irgendwie schon lernen, mit ihm klarzukommen.
Dann wechselte ich das Thema. »Hast du eigentlich den Bericht über den Doppelmord in der Eifel gelesen? Die Geschichte mit dem bis heute verschwundenen Pärchen?«
»Natürlich habe ich das. Sehr spannend, sehr mysteriös. Wahrscheinlich habt ihr euch danach vor Spinnern kaum noch retten können.«
»Einer dieser Spinner hat gestern in der Redaktion angerufen und behauptet, er könne uns verraten, was mit den Verschwundenen passiert ist. Er sagt, er hätte sogar Beweise dafür. Morgen treffe ich mich mit ihm.«
»Und? Glaubst du, da ist was dran?«
Ich zuckte die Schultern. »Ehrlich gesagt, mache ich mir keine großen Hoffnungen. Du kennst das ja noch aus deiner Zeit beim Magazin – in 99 Prozent aller Fälle entpuppen sich solche Anrufe als Seifenblasen.«
»Aber ein guter Journalist ist immer auf der Suche nach dem einen Prozent, stimmt’s?«, entgegnete sie lächelnd. »Na ja, versuch’s halt, man weiß ja nie. Ich hab nach dem Lesen auch lange gerätselt, was damals passiert sein könnte.«
Das verblüffte mich nicht. Wenn es auf der Welt irgendetwas gab, von dem Mütze nie genug bekam, dann waren es ungelöste Kriminalfälle. Ihre ganze Bücherwand bestand aus solchen Themen: Unzählige Theorien über das Attentat auf John F. Kennedy, die Morde von Jack the Ripper, die ungeklärten Verbrechen des Zodiac-Killers in den sechziger Jahren. Ich hatte sie oft gefragt, warum sie so viel Zeit mit derart düsteren Gedankenspielen verbrachte, und immer hatte ihre Antwort gelautet, dass sie sich damit herrlich entspannen und vom Alltag ablenken konnte.
»Und?«, wollte ich wissen. »Bist du dabei auf irgendeine Theorie gestoßen, an die wir nicht gedacht haben? Was denkst du, was damals geschehen ist?«
Sie lehnte sich zurück und wog ihre Worte genau ab. »Ich denke, dass es in etwa so abgelaufen ist, wie du es in dem Bericht geschildert hast. Irgendwelche Irren haben die zwei Pärchen zeitlich versetzt ermordet und die Leichen dann an unterschiedlichen Stellen entsorgt. Irgendwann, wenn niemand mehr damit rechnet, werden wahrscheinlich zwei Wanderer auf ihre Überreste stoßen.«
»Also kein großes Mysterium?«
Sie zuckte die Schultern. »Mir ist zumindest keine andere Erklärung eingefallen, die sich plausibel mit den Fakten in Einklang bringen ließe. Aber lass mich trotzdem wissen, was bei dem Treffen morgen herauskommt – ich bin ja neugierig. Oder soll ich mitkommen?«
»Besser nicht«, sagte ich, nachdem ich kurz darüber nachgedacht hatte. »Der Kerl wirkte am Telefon sowieso schon nervös, und ich weiß nicht, wie er reagiert, wenn plötzlich eine zweite Person mitkommt.«
Sie nickte, und das Thema war damit auch durch. Wir bestellten anschließend noch zwei weitere Kölsch und redeten eine Zeitlang über dies und das, bevor wir gegen 22 Uhr auseinandergingen. Sie machte sich auf den Weg zu Philipp, ich ging zurück in meine leere Wohnung.
Keine Stunde später lag ich schon im Bett. Ob es an dem Telefonat mit Ginster lag oder an dem Gespräch mit Mütze: In dieser Nacht schlief ich unruhig. Träumte wirr von dunklen Wäldern und gesichtslosen Gestalten, die darin umherirrten.
*
Von der Abfahrt der A1 aus war es nur ein kurzes Stück bis Euskirchen. Das Navigationsgerät lotste mich durch den Ort zu einer kleinen Siedlung, die aus einer sonderbaren Mischung aus heruntergekommenen Einfamilienhäusern und plattenbauähnlichen Betonanlagen bestand. Ich glaubte fast schon an einen Systemfehler, als das Navigationsgerät endlich verkündete, dass ich nur noch einmal links abbiegen müsste, dann hätte ich mein Ziel erreicht.
Die Straße wirkte, obwohl in unregelmäßigen Abständen bebaut, merkwürdig verlassen. Auf den Bürgersteigen waren keine Menschen zu sehen, am Straßenrand stand Sperrmüll, und die regenschweren Wolken am Himmel verstärkten noch das Bild von Trostlosigkeit, das hier herrschte. Hinter der angegebenen Adresse verbarg sich ein windschiefes Häuschen aus der Vorkriegszeit, von dessen Fassade bereits der Putz abbröckelte. Der kleine Vorgarten war von Unkraut überwuchert, ein einsamer Gartenzwerg hatte Moos angesetzt. Die an der Seitenwand angeschraubte Satellitenschüssel war der einzige Hinweis auf die Moderne, und ich fragte mich, was für eine Art Mensch man sein musste, um hier zu leben.
Dann klingelte ich und hörte kurz darauf das Klappern von Schlüsseln, bevor die Haustür geöffnet wurde. Der Mann, der dann vor mir stand, bildete mit dem Haus eine seltsam perfekte Einheit. Er war einen Kopf kleiner als ich, wahrscheinlich nur einen Meter fünfundsiebzig groß, hager, fast schon ausgezehrt. Bekleidet war er mit einer braunen Cordhose sowie einem hellen Polohemd mit Querstreifen, das zwei Nummern zu groß war. Sein dünnes Haar trug er eng an den Schädel geklatscht, und die Finger der Hand, die er mir entgegenstreckte, waren nikotingelb. Ich schätzte ihn auf Mitte vierzig, aber es mussten Jahre gewesen sein, die es nicht gut mit ihm gemeint hatten.
»Herr Römer?«, fragte er anstelle einer Begrüßung.
Ich nickte.
»Kommen Sie herein.«
Das Wohnzimmer sah anders aus, als ich es erwartet hatte. Die Möbel waren einfach und abgewohnt, aber der Raum selber war penibel sauber gehalten. Mein Blick fiel auf eine grüne Couch und eine schwere Wohnzimmerwand aus Nussbaum, in der sich allerhand Nippes befand; angefangen von kleinen Figürchen bis hin zu Porzellantassen, die wie Ausstellungsstücke drapiert waren. Auf dem Wohnzimmertisch lag eine buntgemusterte Decke, auf der eine blaue Vase mit weißen Tulpen stand.
Das Innere des Hauses wirkte, als sei das 21. Jahrhundert hier noch nicht angekommen. Die komplette Einrichtung schien irgendwie nicht zu einem Mann seines Alters zu passen; dazu verströmte sie einen Geruch, den ich bisher immer mit den Wohnungen alter Menschen assoziiert hatte. Ich überlegte, ob Frank Ginster das Haus inklusive der darin befindlichen Möbel vielleicht von seinen Eltern geerbt hatte.
»Lassen Sie uns nach hinten in den Garten gehen«, sagte er, während seine wässrigen Augen mich aufmerksam musterten. »Ich habe da alles vorbereitet, was wichtig ist.«
So ungepflegt der Vorgarten auch ausgesehen hatte, hinten heraus war es nett. Es roch nach frisch gemähtem Gras, ein paar Sträucher umrahmten die kleine Terrasse, und der Anblick des angrenzenden Waldgebietes hatte etwas Majestätisches an sich. Wir setzten uns an einen weißen Plastiktisch, auf dem Frank Ginster eine Thermoskanne mit Kaffee sowie Milch, Zucker und zwei Tassen bereitgestellt hatte. Nachdem wir uns daraus bedient hatten, fragte ich ihn, was genau er anzubieten hätte.
»Ich werde es nicht mehr lange machen«, sagte er und zuckte bedauernd die Schultern. »Wenn der Arzt richtig liegt, lässt der gottverdammte Krebs mir noch vier, fünf Monate Zeit. Und die will ich nutzen. Vielleicht mache ich ja noch eine große Reise, wer weiß … Jedenfalls brauche ich Geld. Viel Geld. Und außerdem«, er sah mir zum ersten Mal direkt in die Augen, »will ich nicht mit dem Gedanken abtreten, dass die Schweine ungeschoren davonkommen.«
Ich schaute ihn nachdenklich an. Generell hielt ich nicht viel davon, in den Augen von Menschen zu lesen, dafür hatte ich schon zu viele gute Lügner erlebt. Aber in seinen Augen lag etwas, das ich kannte und das man so leicht nicht vorspielen konnte: echter, tiefer Schmerz.
»Wollen wir damit anfangen, dass Sie mir erzählen, in welcher Verbindung sie zu den damaligen Ereignissen stehen?«
Ginster beugte sich zur Seite und reichte mir einen braunen Umschlag, der neben seinem Stuhl gelegen hatte. »Schauen Sie sich die Bilder in Ruhe an«, forderte er mich auf. »Das erspart mir jede Menge Erklärungen.«
Neugierig griff ich hinein und zog als Erstes ein Foto heraus, dem man ansah, dass es noch mit einer Analogkamera aufgenommen worden war. Die Gesichter der vier jungen Menschen darauf kamen mir vage bekannt vor. Sie standen fröhlich lachend vor zwei leichten Geländemotorrädern, die mit Tankrucksäcken und Satteltaschen beladen waren. Hinter ihnen war eine bewaldete, hügelige Landschaft zu sehen.
Während ich ihre Gesichter betrachtete, spürte ich parallel, wie mir kalt wurde, obwohl es ein spätsommerlich warmer Oktobertag war. Ich legte das Bild neben meine Kaffeetasse und fragte Ginster, ob es ihm etwas ausmachen würde, wenn ich meine Jacke aus dem Auto holen ginge.
»Nur zu«, sagte er. »Ich trage das alles schon lange mit mir herum. Auf ein paar Minuten mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht an.«
Ich nickte, stand auf und verließ das Haus auf demselben Weg, auf dem ich es betreten hatte. Ließ die Haustür hinter mir offen stehen, holte meine Jacke aus dem Alfa und ging zurück. Keine zwei Minuten konnten vergangen sein, als ich den Garten wieder betrat und die Hölle losbrach.
Irgendetwas schlug neben mir gegen die Häuserwand und ließ den Putz explodieren. Weitere Einschläge folgten, die wie ein heftiger Hagelschauer klangen. Projektile zischten wie wütende Hornissen an mir vorbei. Ich schrie und sah, wie Feuerblumen in dem angrenzenden Waldstück aufloderten. Der Schütze musste eine automatische Waffe in den Händen halten – die Treffer wanderten in schneller Folge von links nach rechts.
In derselben Sekunde sprang Frank Ginster auf und rannte auf mich zu. Im Laufen streckte er mir eine Hand entgegen. Der dazugehörende Arm war blutverschmiert, der Mund zu einem stummen Schrei geöffnet. Dann stürzte er, als hätte ihn jemand in den Rücken getreten.
Ich lief ihm entgegen, ohne mir der tödlichen Gefahr wirklich bewusst zu sein. Adrenalin jagte durch meine Blutbahn, Grasbüschel wurden neben meinen Füßen aus dem Rasen gerissen. Im Laufen hielt ich meinen Blick starr auf Ginster gerichtet, der mühsam auf mich zu kroch. Sein Gesicht sah unversehrt aus, aber auf seinem Poloshirt breiteten sich rote Flecken aus.
Dann hörten die Schüsse so schlagartig auf, wie sie gekommen waren. Ich sank auf die Knie und versuchte, an mein Handy zu gelangen, während Frank Ginster sich an mein Bein klammerte. Als ich es in der Hand hielt, wählte ich die Notrufnummer, beantwortete wie in Trance alle Fragen – wer ich war, wo wir uns befanden, was gerade passiert war.
Anschließend nahm ich den Schwerverletzten in den Arm. Versicherte ihm, dass alles wieder gut werden würde. Dass der Krankenwagen bereits unterwegs sei. Er schien mich zu verstehen, aber unter meinen Händen spürte ich, wie er starb. Eine Eisenklammer legte sich um meine Brust. Noch einmal öffnete er die Augen und hob die Hand, als wolle er sich an mir und seinem Leben festkrallen. Dann glitt die Hand ab, sackte nach unten und blieb, Handfläche nach oben, auf dem Rasen liegen. Ich hielt ihn in den Armen und schrie, während ich auf Hilfe wartete.
In dem Moment zuckte ein Blitz vom Himmel herab. Er zerteilte die Wolken wie das Schwert eines wütenden Gottes. Als sie sich wieder schlossen, war Frank Ginster tot.
*
Die nächsten drei Tage zogen wie ein Film vorbei. Teilnahmslos ließ ich alles über mich ergehen. Die Vernehmungen bei der Polizei, Mützes Anrufe, die besorgten Nachfragen der Kollegen. Die Welt war in ein nebulöses Grau gehüllt, meine Gefühle wie sediert.
Passend dazu prasselte ein nicht enden wollender Regen auf Dächer und Fensterscheiben ein und ließ diese schrecklichen Tage noch schrecklicher werden. Sarah kümmerte sich in der Zeit rührend um mich: Sie kochte Essen, das ich nicht aß, sagte tröstende Worte, die mich nicht erreichten, und gab mir Streicheleinheiten, die ich nicht wollte.
Ich duschte nicht, behielt drei Tage lang dieselben Klamotten an und verkroch mich in meiner Wohnung. Am Samstag schließlich konnte ich mich selbst nicht mehr riechen. Nach der Dusche betrachtete ich mich eine Zeitlang im Spiegel und fragte mich, was mit meinem Gesicht passiert war. Mit meinem Körper. Die grauen Strähnen in den ansonsten dunklen Haaren stachen stärker hervor. Der Muskeltonus wirkte schwammiger. Ich war einen Meter fünfundachtzig groß, kam mir aber kleiner vor. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich alt fühlte. Ausgebrannt und innerlich leer.
Frank Ginster war tot, und es war lediglich einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass ich weiterleben durfte. Gläubige Menschen würden diese Fügung als Geschenk Gottes bezeichnen, und auch ich verstand mittlerweile, dass ich nicht das Recht hatte, das eigene Leben weiterhin mit Füßen zu treten.
Als Erstes beschloss ich, wieder mehr für meinen Körper zu tun, das Boxtraining zu intensivieren, welches ich vor einem Jahr begonnen hatte. Dann musste ich die Trennung von Sarah endgültig vollziehen – nicht nur körperlich und räumlich, sondern auch seelisch. Ich musste endlich akzeptieren, dass sie meine Ex war; vielleicht zu einer guten Freundin werden konnte, aber nicht mehr meine Frau sein wollte.
Mitten in diese Gedankengänge hinein klingelte das Telefon. Ich riss mich von meinem armseligen Spiegelbild los und erreichte es gerade noch, bevor der Anrufbeantworter anging.
»Römer.«
»Hauptkommissar Martin Mayer hier – wie geht es Ihnen?«
Kurz musste ich überlegen, dann erinnerte ich mich. Mayer war damals an den Ermittlungen beteiligt gewesen, die den Doppelmord aus meiner Jugendzeit betrafen. Ein gewissenhafter Polizist, den ich in guter Erinnerung hatte.
»Herr Mayer – was verschafft mir die Ehre?«
»Es geht um den ermordeten Frank Ginster. Die Kollegen aus Euskirchen haben uns um Amtshilfe gebeten, da einige der Spuren nach Köln führen. Sie sind eine davon.«
»Hatten wir das nicht schon?«
»Was?«
»Dass Sie mich grundlos einer Straftat verdächtigen?«
Er lachte. »Ich kann Sie beruhigen: Sie stehen keineswegs unter Verdacht. Aber wir haben hier etwas, das Sie interessieren könnte.«
»Ich höre.«
»Warum setzen Sie sich nicht einfach ins Auto, kommen in unser schönes Präsidium, und ich erkläre es Ihnen?«
Auf dem Weg dorthin hatte ich befürchtet, dass auch sein Kollege Kretschmann anwesend sein würde. Ein Kerl wie eine Bulldogge, dessen cholerische Aggressivität sein hervorstechendstes Charaktermerkmal war. Zum Glück aber war Mayer allein, als ich sein Büro betrat. Ein Mann Ende vierzig, ruhig und besonnen. Ein nachdenklich wirkender Polizist, der mir zuerst einen Kaffee anbot, dann ein Foto des Ermordeten auf den Tisch legte und sagte: »Frank Ginster – der Tote.«
Ich nickte.
»Falsch«, sagte er und lächelte freudlos. »Einen Frank Ginster gibt es nicht. Seine Papiere waren gefälscht – und das noch nicht einmal sonderlich gut.«
Fassungslos starrte ich ihn an.
»Dieser angebliche Frank Ginster hat das Haus vor mehr als fünfzehn Jahren gemietet«, fuhr er fort. »Er war seitdem nirgendwo fest angestellt und hat sich, soweit wir das bisher ermitteln konnten, mit Gelegenheitsjobs und Geld vom Sozialamt über Wasser gehalten.«
»Und die Ämter haben nicht geprüft, ob seine Papiere echt sind?«
Mayer zuckte die Schultern, bevor er fortfuhr: »Da wir nicht wussten, um wen es sich bei dem Toten in Wirklichkeit handelte, haben wir eine DNA-Analyse in Auftrag gegeben.«
»Und?«
»Das endgültige Gutachten steht noch aus, aber es deutet alles darauf hin, dass Frank Ginster und Christian Wagner ein und dieselbe Person waren.«
Ich glaubte, mich verhört zu haben. Derselbe Christian Wagner, der 1997 in der Eifel mit dabei gewesen war und bis heute als vermisst galt? Mir war keine Ähnlichkeit zwischen den beiden aufgefallen. Oder doch? Vielleicht jetzt, wenn man es wusste …
Mayer lehnte sich zurück und schaute mich mit einem Blick an, den ich nur schwer deuten konnte. Eine Mischung aus Neugierde und Misstrauen vielleicht. Dann wollte er wissen, wie ich mit Frank Ginster beziehungsweise Christian Wagner in Kontakt gekommen war.
»Aber das habe ich doch schon der Polizei in …«
»Ich weiß«, sagte er ruhig. »Erzählen Sie es mir bitte einfach noch einmal.«
Also erzählte ich es ihm von vorne bis hinten und in aller Ausführlichkeit. Als ich mit meinem Bericht fertig war, verschränkte Mayer die Hände und stützte sein Kinn auf die Fingerknöchel. »Mehr hat Wagner nicht gesagt?«, fragte er, wobei seine Stimme leicht enttäuscht klang. »Weder welche Informationen er hatte noch einen Hinweis darauf, was in jener Nacht geschehen ist?«
Ich ging das Treffen gedanklich noch einmal durch. Die ersten Minuten, meinen Weg zum Auto, die Schüsse. Dann fiel mir etwas ein: »Was ist mit dem Umschlag?«
»Was für ein Umschlag?«
»Ginster … ich meine, Wagner … hatte für unser Gespräch einen Umschlag vorbereitet. Braun, DIN A4. Darin waren Bilder und Unterlagen, aber alles, was ich gesehen habe, war ein Foto der vier neben ihren Enduros.«
»Wo befand sich der Umschlag, als das Attentat stattfand?«
»Er lag auf dem Tisch, ganz sicher. Ich hatte ihn dort abgelegt, während ich mir das erste Foto angeschaut habe. Haben ihre Kollegen ihn nicht gefunden?«
Der Kommissar schüttelte den Kopf. »Ich frage später sicherheitshalber noch mal nach, aber in der Ermittlungsakte wird kein solcher Umschlag erwähnt.«
Meine Gedanken rasten.
Was war nach den Schüssen passiert?
Die Polizei war gekommen, Sanitäter waren durch den Garten gerannt. Ein paar Personen in Zivil waren auch dabei gewesen, Notärzte vielleicht, unter Umständen sogar Nachbarn. Um mich herum hatte Chaos geherrscht, ich selbst hatte unter Schock gestanden. Wäre es mir aufgefallen, wenn jemand nach dem Umschlag gegriffen hätte? Sicher nicht. Und auch sonst wäre die Gefahr der Entdeckung für den Täter gering gewesen. Wenn der Mörder die Nerven gehabt hatte, direkt am Tatort aufzutauchen, konnte er den Umschlag in seinen Besitz gebracht haben.
Ich ärgerte mich, dass ich meine Jacke holen gegangen war, anstatt mir zuerst die Unterlagen anzuschauen. Dann fiel mir auf, wie töricht der Gedanke war: Hätte ich das gemacht, würde ich jetzt ebenfalls in der Rechtsmedizin liegen. Von Schüssen zersiebt wie der Mann, dem seine falsche Identität fast zwanzig Jahre lang das Leben gerettet hatte. Bis er bei unserem Magazin angerufen hatte, um die Wahrheit über das zu erzählen, was 1997 in einem abgelegenen Waldgebiet zwischen Eifel und Ardennen passiert war.
Nachdenklich schaute ich Mayer an. »Das ist noch nicht alles, oder?«
»Wie meinen Sie das?«
»Sosehr ich Ihre Offenheit auch schätze, Herr Mayer, es fällt mir doch schwer, zu glauben, dass Sie mir das nur erzählt haben, weil ich so ein netter Kerl bin. Also – was wollen Sie wirklich von mir?«
Seine Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln, halb spöttisch, halb anerkennend. »Ich möchte, dass Sie an der Story dranbleiben. Wir vermuten, dass Ihr Bericht über das Verbrechen die Dinge auf irgendeine Art und Weise wieder in Bewegung gebracht hat. Dass wieder jemand sterben musste, ist natürlich tragisch, es wirft aber auch eine ganz entscheidende Frage auf.«
Ich ahnte, worauf er hinauswollte. »Woher wussten die Mörder, dass Frank Ginster und Christian Wagner ein und dieselbe Person waren? Und – es kann kein Zufall sein, dass sie es genau zu dem Zeitpunkt herausfanden, an dem er mir die Informationen verkaufen wollte.«
»Noch können wir nicht sicher sein, dass die beiden Verbrechen wirklich in einem Zusammenhang stehen, aber … Ja, alle Indizien deuten darauf hin.« Er räusperte sich. »Schauen Sie, wenn Sie die Berichterstattung fortsetzen, erzeugen wir im Umfeld der Täter vielleicht Unruhe. Und Täter, die unruhig sind, machen bekanntlich Fehler.«
»Sie wollen also, dass ich die wahre Identität des Ermordeten in einem Bericht aufdecke?«
Er schüttelte den Kopf. »Auf keinen Fall – das ist ein Ass, das wir gerne so lange wie möglich im Ärmel behalten würden. Ganz abgesehen davon, dass Sie sich damit zu stark exponieren würden. Nein … alles, was ich möchte, ist, dass Sie ab und zu neue Erkenntnisse streuen, die wir Ihnen liefern. Nichts Dramatisches, nur das eine oder andere Detail, um das öffentliche Interesse wachzuhalten. Könnten Sie das für uns tun?«
Ich dachte kurz über seinen Vorschlag nach. »Ich versuche es, Herr Mayer, kann aber nichts versprechen. Ich arbeite bei dem Magazin, aber es gehört mir nicht, und es kann schwer werden, in der Redaktion Geschichten durchzusetzen, die keine neuen Fakten beinhalten.«
Er lächelte, als wenn er mit dieser Antwort bereits gerechnet hätte. »Das schaffen Sie schon. Und im Gegenzug könnte am Ende die größte Story warten, die Sie jemals geschrieben haben. Eine Story wohlgemerkt, die Sie dann exklusiv hätten. Außer Ihnen und uns weiß bislang noch niemand, dass Ginster und Wagner ein und dieselbe Person sind.«
»Dieses Mal liegen Sie falsch«, sagte ich und schaute ihm in die Augen. »Sie haben die Mörder vergessen.«
*
Ich täuschte einen linken Körperhaken an und schlug mit der Rechten in Richtung seines Gesichts, landete aber nur auf der Deckung. Umgehend kassierte ich meinerseits einen Treffer seiner Führhand und sah, wie Arslan grinste.
»Komm schon, alter Mann, das muss schneller gehen!«
Mit Anfang vierzig war man vielleicht kein Teenager mehr, aber alter Mann? Irgendetwas löste sich und stieg in mir auf. Wut. Weniger wegen der Bemerkung, sondern eher als Reaktion auf die Geschehnisse der letzten Tage. Alles kam in diesem Moment zusammen: Die Trennung von Sarah, die Ermordung von Christian Wagner, der Frust über meine Hilflosigkeit. In den vergangenen Jahren hatte ich gelernt, dass diese Wut ein Teil von mir war. Hatte sie akzeptiert, und normalerweise war sie ja auch nur eine winzige, kaum wahrnehmbare Wolke in meinem Inneren.
Aber manchmal, in Augenblicken wie diesen, breitete sie sich rasend schnell aus und bestimmte mein Handeln. Also legte ich noch mehr Wucht in die Schläge. Wollte Arslan treffen, ihm irgendwie weh tun. Spielerisch leicht wich er meinen unvorbereiteten Attacken aus und verpasste mir einen Leberhaken.
»Ende«, sagte ich und hob kapitulierend die Fäuste. »Genug für heute.« Die Wut war weg – ebenso schnell, wie sie mich übermannt hatte.
Meine anschließende Entschuldigung wischte er mit einer Handbewegung zur Seite, dann verließen wir den Ring des Boxstudios, das Arslan zusammen mit seinem Bruder Erkan leitete. Es war noch kein Jahr her, da hatten die beiden mir zusammen mit ihrem jüngsten Bruder Oktay geholfen, den Mörder aus meiner ehemaligen Clique zu überführen. Ach Quatsch, geholfen – ohne die drei würde der Täter immer noch frei herumlaufen, anstatt lebenslänglich hinter den Mauern einer Hochsicherheitsanstalt zu sitzen.
»Mach dir nichts draus«, sagte Arslan und schlug mir grinsend auf die Schulter. »Du hast echt Talent! Wenn du fünfundzwanzig Jahre früher angefangen hättest, hätte aus dir garantiert etwas werden können …«
Erneut versuchte ich, seinen Oberarm zu treffen, verfehlte ihn aber. Der Kerl war einfach zu schnell für mich. Arslan war Mitte zwanzig und einer der technisch besten Boxer, die ich jemals gesehen hatte. Ohne die Knieverletzung, die er sich vor acht Monaten bei einem Kampf um die Deutsche Meisterschaft zugezogen hatte, hätte er es zum Vollprofi bringen können. Ich hatte genügend Boxkämpfe gesehen, um dies beurteilen zu können: Er war ein Ausnahmetalent.
Wir verabredeten uns für übermorgen, dann beeilte ich mich, unter die Dusche zu kommen. Meine Kondition war am Ende, und die Zeit drängte. Es war jetzt 19.07 Uhr; in einer knappen Stunde war ich mit Mütze verabredet, und sie hasste es, wenn man sie warten ließ.
Mütze hatte mich gestern angerufen, kurz nachdem ich das Präsidium verlassen hatte. Bei dem Telefonat hatte ich ihr erzählt, dass Frank Ginster und Christian Wagner dieselbe Person waren – auch wenn Mayer mich um Verschwiegenheit gebeten hatte. Doch ich kannte Mütze, er nicht. Angesichts unseres Verhältnisses wäre es für mich einem Vertrauensbruch gleichgekommen, ihr die Wahrheit zu verschweigen.
*
Das Schäfers lag an der Subbelrather Straße, keine hundertfünfzig Meter von der Wohnung entfernt, die ich nach der Trennung von Sarah bezogen hatte. Viel Holz, fünfzehn Tische und drei Flachbildfernseher, die unter der Decke hingen. Entlang dem Tresen vor dem Barspiegel standen endlose Reihen von Flaschen – dunkelblau und schlank, schwarz mit roten Wachssiegeln, milchig weiß wie Eis, das man aus der Oberfläche eines Sees herausgesägt hatte. Andere wiederum waren bernsteinbraun, ein einziges Leuchten aus Wärme und Licht.
Mütze saß ganz hinten, mit dem Rücken zur Wand. Sie hockte da wie John Wayne in einem dieser Western, in denen es überlebenswichtig war, ständig die Tür im Blick zu haben. Wie immer trug sie dabei ein Baseballcap, heute in klassischem Weiß ohne Schriftzug. Die dunkelblonden Haare hatte sie zu einem hohen Zopf gebunden, auf ihrem dunkelblauen Kapuzenpulli stand Why be normal?
Nachdem wir uns begrüßt, Getränke bestellt und zwei Rumpsteaks mit Folienkartoffeln geordert hatten, fragte sie, wie es mir mittlerweile gehe.
»Ganz gut«, antwortete ich. »Wird schon wieder.«
»Den Schock bereits verdaut?«
Ich nickte, worauf sie mich misstrauisch und ein wenig oberlehrerhaft anschaute. »Ernsthaft?«
»Natürlich nicht«, gab ich zu, »aber ich habe schon Schlimmeres erlebt. Du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Ich brauche einfach nur ein wenig Zeit, um das Ganze für mich zu verarbeiten.«
»Wenn es dir halbwegs gutgeht«, sagte sie und neigte den Kopf zur Seite, »brauche ich ja auch nicht lange drum herumzureden. Ich will rein, Jan!«
»Wo rein?«
»In die Story. In die Nachforschungen. Und jetzt sag mir nicht, dass die Geschichte für dich abgeschlossen ist. Das glaube ich dir nämlich nach allem, was passiert ist, keine Sekunde.«
Ich trank einen Schluck Kölsch, um Zeit zu gewinnen. »Was schwebt dir vor?«
»Ich will einfach nur dabei sein. Seitdem du mir erzählt hast, wer Frank Ginster wirklich war, denke ich pausenlos darüber nach. Der Fall fasziniert mich, und vier Augen sehen bekanntlich mehr als zwei. Und außerdem«, sie räusperte sich, »kennst du niemanden, der so gut recherchieren kann wie ich.«
Ich wusste, dass sie recht hatte, und sie wusste, dass ich das wusste. Äußerlich würde ich mich vielleicht noch ein wenig zieren können, innerlich jedoch war die Entscheidung schon gefallen.
Dann kamen unsere Steaks, und sie gehörten zu den besten, die man in Köln bekommen konnte. Groß, saftig und auf den Punkt gebraten. Ich stürzte mich sofort auf meins, bis mir bewusst wurde, dass Mütze ihres unberührt stehen ließ, und mich unverwandt ansah.
»Okay, okay«, sagte ich zwischen zwei Bissen, »du bist drin. Die nächste Woche habe ich eh noch frei, und die Zeit können wir nutzen, um herauszufinden, was damals passiert ist. Das heißt … wir können es zumindest probieren.«
Sie grinste und machte sich augenblicklich über ihr Fleisch her, dass sie in Rekordzeit verputzte. Als wir mit dem Essen fertig waren, bestellten wir noch zwei Ramazotti, stießen miteinander an, kippten sie hinunter und lehnten uns zufrieden zurück.
Dann griff sie nach ihrer Zigarettenschachtel und fragte, ob ich mit ihr vor die Tür kommen würde. Natürlich ging ich mit. Ich hätte nicht sagen können, warum es mir gefiel, dass Mütze rauchte, aber es war so. Vielleicht erschien sie mir dadurch menschlicher, nicht ganz so perfekt, wie sie ansonsten oftmals wirkte.
»Hast du dir schon Gedanken gemacht, wo wir anfangen sollen?«, fragte sie, als wir in der Kälte standen und der Qualm ihrer Kippe sich kräuselnd in den Nachthimmel erhob.
»Natürlich. Ganz am Anfang. An dem Ort, an dem alles begonnen hat.«
*
Die Eifel erstreckte sich von Aachen bis nach Trier, von der belgischen Grenze bis nach Koblenz. Hochmoore, erloschene Vulkane und fünfzehn Talsperren – ein über 7000 Quadratkilometer großes Gebiet. Im Norden lag der Nationalpark Eifel, den manche Reiseführer gerne als »Eifel-Amazonas« bezeichneten: Eine Gegend mit nahezu undurchdringlichen Waldgebieten, in der sich Bäche durch dichtes Unterholz schlängelten und Seen für blaue Farbtupfer sorgten.
Die Straßen, die wir passierten, waren kaum befahren. Die Landschaft weit und still. Kleine Ortschaften huschten vorbei, ohne einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Hier und da grasten ein paar Pferde auf einer Koppel.
Wir durchquerten Schleiden und legten rund zwölf Kilometer auf der B258 zurück, bis sie einen scharfen Rechtsknick machte. Kurz dahinter lag, versteckt hinter Bäumen, ein Parkplatz. Auf dem hölzernen Schild nahe der Einfahrt war der Name Wahlerscheid zu lesen.
»Willkommen in der Mitte von nirgendwo«, sagte ich und stellte den Motor ab.
Mütze schwieg und blickte starr durch die Windschutzscheibe auf den dunklen Wald vor uns, der so dicht war, dass die Sonne kaum eine Chance hatte, zum Erdboden durchzudringen.
»Irgendwie unheimlich«, sagte sie. »Findest du nicht?«
»Es ist nur ein Wald, nicht bedrohlicher als andere Wälder auch. Wahrscheinlich hast du diesen Eindruck, weil du weißt, was hier passiert ist.«
Sie ging nicht darauf ein, öffnete die Tür und stieg aus. Ich folgte ihr. Die Luft war so klar und frisch, dass sie fast schon in der Nase weh tat. Es war kühl, kein Verkehrslärm war zu hören, und die Vögel sangen. Einen Augenblick lang stieg eine Ahnung in mir auf, wie freundlich und friedlich das Leben sein konnte. Dann unterbrach Mütze meinen Gedankengang, und der Moment war vorbei.
»Der Forstweg da muss es sein«, sagte sie und deutete auf einen Pfad, der vom Parkplatz aus in den Wald führte.
Es war gegen Mittag, und die Sonne hatte ihren höchsten Stand erreicht, doch sobald wir den Tannenwald betraten, wurde es dunkler, und die Luft begann, feucht und modrig zu riechen. Ich stellte mir vor, wie hier vor knapp zwanzig Jahren vier junge Menschen mit ihren Geländemaschinen entlanggefahren waren, fröhlich und unbeschwert. Nicht ahnend, dass mindestens zwei von ihnen den Wald nicht wieder lebend verlassen würden.
»Was ist das?«
Mütze deutete auf eine Anlage, die abseits des Pfades lag. Sie war mit Moos und Pflanzen überwuchert, die Konturen wirkten fast quadratisch. Wir gingen darauf zu und erkannten, dass das Gebilde aus großen Betonbrocken bestand, die aussahen, als hätte ein Riese sie in einem Tobsuchtsanfall durcheinandergewürfelt.
»Wirkt irgendwie militärisch«, meinte Mütze nachdenklich.
»Ja«, stimmte ich ihr zu. »Könnte eine gesprengte Bunkeranlage aus dem Zweiten Weltkrieg sein.«
»Wer baut denn Bunker mitten im Wald?«
»Das gesamte Gebiet hier war in den letzten Kriegstagen heftig umkämpft. So etwas wie die letzte Verteidigungslinie Hitlers, als die Alliierten näher rückten.«
Ich versuchte, mir die Kartographie der Gegend ins Gedächtnis zu rufen. »Die belgische Grenze kann maximal ein, zwei Kilometer entfernt sein«, erläuterte ich anschließend. »Auch die Ardennenoffensive ging hier los.«
Ihre Nase kräuselte sich. »Die was?«
Unwillkürlich musste ich grinsen. Mütze hatte verdammt viele Interessen – Militärhistorie gehörte offenbar nicht dazu.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.