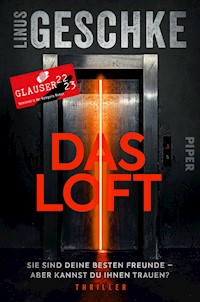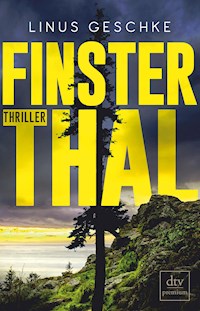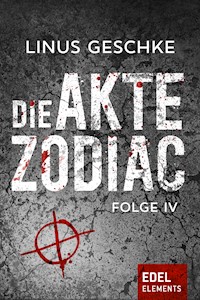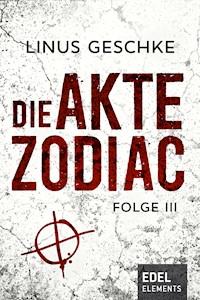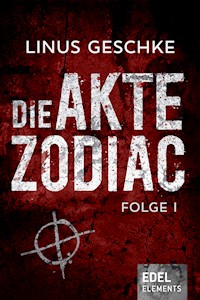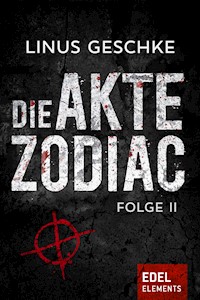9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In den 80ern wurde dein bester Freund getötet - jetzt jagst du seinen Mörder. Sommer 1986: Eine Kölner Clique verbringt ein Party- Wochenende in einer Blockhütte im Bergischen Land. Zwei Tage lang Bier, Musik, Baggersee und Flirts. Am Ende sind zwei junge Menschen tot – das Mädchen vergewaltigt und erstochen, der Junge brutal erschlagen. Der Doppelmord wird nie aufgeklärt. Der Kölner Zeitungsredakteur Jan Römer soll Jahre später über den ungelösten Kriminalfall schreiben. Römer erinnert sich gut, denn das Wochenende im Wald war das Ende seiner Jugend – er gehörte selbst zu jener Clique. Gemeinsam mit seiner besten Freundin Mütze will er herausfinden, was damals wirklich geschah. Zu spät merkt er, in welche Gefahr er sich dadurch bringt... »Eines jener Bücher, wo man die Nacht durchliest, um zu wissen, wie es ausgeht. Und sich hinterher ein kleines bisschen cooler fühlt, weil man auch in den 80ern aufgewachsen ist.« Stefan Gerold/Neue Westfälische »Endlich nach langer Zeit wieder ein Buch, das süchtig macht. Genau die richtige Mischung aus Witz, guten Figuren und Spannung, die einen bis zur letzten Seite bannt.« Katja Mitic/Die Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Jan Römer ist Redakteur beim Kölner Magazin Die Reporter. Als er für die Rubrik »Ungelöste Kriminalfälle« über einen Doppelmord an zwei Teenagern schreiben soll, der 1986 geschah, katapultiert ihn das weit in die eigene Vergangenheit: Er gehörte damals zu jener Clique, aus der die beiden Opfer stammten. Wie konnte er nur die Zeit vergessen, als Neue Deutsche Welle und Mopeds sein Leben bestimmten? Jan erinnert sich an die Freunde von damals und an das brütend heiße Wochenende, das mit einem Ausflug ins Bergische Land begann und für zwei Menschen mit dem Tod endete.
Gemeinsam mit seiner ehemaligen Kollegin Stefanie »Mütze« Schneider beginnt Jan Römer zu recherchieren. Doch schnell bekommt er zu spüren, dass er damit jemandem zu nahe tritt. Aber wem? Jan muss herausfinden, was in jenem Sommer 1986 wirklich geschah …
Der Autor
Linus Geschke, geboren 1970, arbeitet als freier Journalist für führende deutsche Magazine und Tageszeitungen, darunter Spiegel Online, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Manager Magazin. Als begeisterter Taucher verfasst er zudem Tauch- und Reisereportagen, für die er bereits mehrere Journalistenpreise gewonnen hat. Linus Geschke lebt in Köln.
Linus Geschke
KRIMINALROMAN
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-taschenbuch.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Oktober 2014
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2014
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Titelabbildung: © Nikki Smith/arcangel images
ISBN 978-3-8437-0976-7
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Ich wollte die Mappe nicht öffnen. Spürte, dass ihr Inhalt etwas war, das besser verborgen bleiben sollte. Manche nannten das eine dunkle Vorahnung. Ein nicht zu bestimmendes Gefühl, das einen überkam, sobald sich drohendes Unheil abzeichnete.
Sie lag vor mir auf dem Tisch. Eigentlich hatte sie nichts Bedrohliches an sich. Es war eine ganz gewöhnliche braune Mappe, die mit weißen Gummibändern zusammengehalten wurde. Ich zupfte an ihnen herum. Ungeklärter Kriminalfall stand auf dem Deckel, darunter Bergisches Land und die Jahreszahl 1986.
Ich hob den Blick und schaute mich um. Meine Kollegen tranken mit abgespreizten Fingern Kaffee und knabberten lustlos an vertrockneten Keksen. Acht Männer in leichten Sommeranzügen und drei Frauen in hellen Business-Kostümen. Niemand schien meine dunkle Vorahnung zu teilen. Alles war wie immer.
»Was soll das?«, fragte ich laut und deutete auf die Mappe.
Kemper drehte sich um. Seit elf Jahren war er der Chefredakteur unseres Magazins Die Reporter, und er wusste, dass die Unterlagen nicht dort liegen sollten. Nicht vor mir. Ich war für Reise und Sport zuständig, nicht für Verbrechen.
»Da kommen wir gleich noch zu«, sagte er und wendete sich wieder ab.
Vielleicht war meine Ahnung unbegründet. Vielleicht ging es um etwas ganz anderes. Vielleicht war alles ganz harmlos. Mir aber waren das entschieden zu viele vielleicht.
»Warum gleich? Lass uns jetzt drüber reden, Arnold.«
Kemper seufzte und schaute mich an. »Am Freitag hatte Kollege Reinhardt einen Autounfall. Nichts Dramatisches, hab vorhin mit seiner Frau telefoniert. Aber er wird wohl eine Zeitlang ausfallen. Und bis er wieder da ist, müssen wir das Ressort Zeitgeschichte auf mehrere Schultern verteilen. Das heißt für dich: Du machst die Geschichte.«
Ich war 43 Jahre alt. Knapp 20 davon als Autor und Journalist tätig und lange genug beim Reporter, um zu wissen, dass ich mir Diskussionen über Aufträge mit Kemper sparen konnte. Normalerweise hätte ich spätestens an dieser Stelle nachgegeben.
Aber nicht heute. Nicht hierbei.
»Worum geht’s?«
»Mensch, Jan …«, sagte er und verdrehte die Augen. »Das steht doch alles da drin. Schau halt rein!«
»Aber …«
»Okay, okay, wenn Herr Römer unbedingt eine persönliche Einweisung braucht: Es geht um einen Doppelmord im Bergischen Land. Irgendein Irrer hat 1986 zwei Teenager umgebracht. Wenn ich’s richtig im Kopf habe, ein 16-jähriges Mädchen und deren Freund.«
Er legte eine kurze Pause ein und schaute mich nachdenklich an. »Du warst doch damals in etwa so alt wie die Opfer … kannst du dich nicht an den Fall erinnern? Die Geschichte muss doch groß durch die Medien gegangen sein.«
Es fühlte sich an, als hätte mir jemand mit Anlauf in den Magen getreten. Mir wurde schlecht. Die Gesichter meiner Kollegen verschwammen.
Kemper merkte davon nichts. Ungerührt fuhr er fort: »Wie dem auch sei – mach mir ’ne schön menschliche Geschichte daraus, und ich geb dir sechs Seiten im Heft, okay?«
Ich konnte mich an den Fall erinnern. Mehr, als mir lieb war.
Sommer 1986: So heiß, dass es einen in den Wahnsinn trieb. Da war die Blockhütte. Menschen lachten. Es roch nach Bier und Grillfleisch.
Meine Hände krampften sich um die Stuhllehnen, das Zimmer begann sich zu drehen.
Um mich herum war Dunkelheit.Ich stand im Wald. Der Mond war ein silberner Knopf, hinter hohen Bäumen an ein tiefschwarzes Firmament genäht.
Ich spürte, wie mir schwindelig wurde, und musste die Augen schließen. Meine Gedanken rasten. Das stimmt nicht. Der Junge war nicht der Freund des Mädchens. Sie hat alle verrückt gemacht.
Ich wollte die Augen wieder öffnen und der Erinnerung entfliehen, aber es war zu spät. Kalter Schweiß stand mir auf der Stirn, und ich spürte, wie er mir vom Nacken den Rücken herunterlief. Ich brauchte etwas zu trinken, ganz dringend. Dann kippte ich vom Stuhl.
Als ich wieder zu mir kam, blickte ich in das besorgte Gesicht von Monika Lettmann. »O Gott, Herr Römer – was ist denn mit Ihnen los? Sollen wir einen Arzt rufen?«
»Nein, keinen Arzt«, krächzte ich. »Nur ein kaltes Glas Wasser bitte. Mir ist einfach nur schwindelig geworden.«
Kurz darauf wurde Monika Lettmann aus meinem Blickfeld gedrängt, in das sich dann Arnold Kemper schob. Auch er musterte mich eindringlich. Ich bemühte mich, ihn anzusehen. Mein Hirn war noch träge, schien jedoch langsam wieder auf Touren zu kommen. Dann sah ich die Dose Cola, die er in der Hand hielt, und das Kondenswasser an ihr, das wie kleine Perlen zu Boden tropfte.
»Danke, Arnold.«
»Schön langsam trinken«, sagte er erstaunlich sanft.
Ich nahm ihm die Dose aus der Hand und trank sie in einem Zug leer. Anschließend versuchte ich mich an einem Lächeln. Nur nichts anmerken lassen. Es klappte.
»Ich glaub es nicht … hat man so was schon gesehen?«, sagte Kemper erleichtert und drehte sich beifallheischend zu den anderen um. »Da gibt man dem Kerl einmal einen Auftrag außerhalb der Reihe, und was ist? Er bekommt einen Schwächeanfall.«
Theatralisch schüttelte er den Kopf. »Kann mir mal jemand erklären, wo die ganzen Reporter der guten alten Schule hin sind? Die nächtelang vor Haustüren ausharrten und jeden Stein umdrehten, um an ein Fitzelchen an Informationen zu gelangen? Nur noch Weicheier hier – und ich darf mir für die Verlagsleitung immer neue Ausreden einfallen lassen, warum unsere Auflage Woche für Woche tiefer in den Keller sinkt.«
Dann schaute er wieder mich an. »Pack dir die Unterlagen über den Fall ein und fahr nach Haus. Nimm dir morgen frei und les dich rein. Und dann machst du mir eine Geschichte daraus, die mehr beinhaltet als aufgewärmte Polizeiberichte.«
*
Eine halbe Stunde später war ich in Sülz angekommen und parkte den Wagen vor unserem Haus in der Gerolsteiner Straße. Kurz nach der Hochzeit hatten Sarah und ich hier eine Vierzimmerwohnung gekauft und diese Entscheidung auch nie bereut. Aus dem ehemaligen Arbeiterviertel war über die Jahre eine Gegend für Akademiker und gutverdienende Familien geworden, die Bionade tranken, in Bioläden einkauften und Latte macchiato bestellten, weil ihnen das Wort Milchkaffee zu ordinär erschien. Die neuen Spießer also. Wahrscheinlich war ich auch einer von ihnen.
Als ich die Wohnungstür aufschloss, wurde mir erneut übel. In der Redaktion hatte ich ein paar Sekunden lang gedacht, ich würde in einem billigen Drehstuhl aus Kunstleder sterben, ein Herzinfarkt vielleicht. Das Letzte, was ich gehört hätte, wäre Kempers Stimme gewesen, der einem Kollegen den Auftrag gibt, eine Story aus meinem Ableben zu stricken: »So was schön Menschliches halt.«
Zumindest das war mir erspart geblieben. Ich ging in die Küche, nahm den Orangensaft aus dem Kühlschrank und goss mir ein Glas ein. Die Akte über die beiden Morde hatte ich im Wohnzimmer auf das Sideboard gelegt, direkt neben das Bild von Sarah und Lukas. Meine Frau war gestern mit unserem Sohn nach St. Peter-Ording gefahren, und ich wollte am nächsten Sonntag nachkommen. Lukas hatte im vorigen Urlaub sein achtjähriges Herz an das Windsurfen verloren, und seitdem gab es für ihn nichts Wichtigeres mehr – abgesehen vielleicht von seiner Playstation und den ebenso verzweifelten wie vergeblichen Versuchen des 1. FC Köln, sportlich wieder an glorreiche Zeiten anzuschließen.
In diesem Moment bedauerte ich zutiefst, dass ich meinen Urlaubsantrag erst verspätet eingereicht und prompt die erste Ferienwoche nicht mehr genehmigt bekommen hatte. Wenn ich heute am Strand gelegen und Lukas beim Windsurfen zugeschaut hätte, wäre dieser Auftrag an irgendeinen Kollegen gegangen. Ich hätte nie diese verdammte braune Mappe gesehen und den Sommer 1986 da lassen können, wo ich ihn seit 27 Jahren begraben hielt – tief versteckt in den hintersten Winkeln meines Gehirns.
Mit dem Orangensaft in der Hand legte ich mich auf die Liege im Wohnzimmer. Sie war das einzige Möbelstück in unserer Wohnung, von dem ich behauptete, es gehöre mir und nicht uns. Die Liege war geformt wie ein umgefallenes S und mein Lieblingsplatz, wenn ich mir in Ruhe einen Spielfilm oder eine Doku anschauen wollte. Ich roch den Duft des weichen Leders und wartete darauf, dass sich mein Körper wie gewohnt entspannen würde.
Es klappte nicht.
Meine Gedanken fuhren Achterbahn und jagten kreuz und quer durch meinen Kopf, ohne ein konkretes Ziel zu erreichen. Ich atmete tief durch und versuchte, mich auf die Zeit zu konzentrieren, in der ich noch ein Teenager gewesen war, der zu allem eine Meinung, aber von wenig eine Ahnung gehabt hatte.
Irgendwann erschien das Bild eines Sommers vor meinen Augen. Ein Sommer, in dem der Himmel immer hellblau war, ein paar Schäfchenwolken vereinzelte Tupfer bildeten und Sonnenstrahlen auf jugendlichen Körpern explodierten. Alle um mich herum schienen in Jeans, Turnschuhen und weißen T-Shirts zu stecken, kauten Kaugummi und strotzten vor Unternehmungslust. Dieser Sommer roch nach frisch gemähtem Gras und dem Zweitaktbenzin, mit dem wir unsere Mopeds und Achtziger betankten, damit sie uns in eine Welt hinaustrugen, von der wir nicht viel wussten, aber überzeugt waren, dass es bald die unsere sein würde. Es war ein Sommer, der sich nach Neuer Deutscher Welle und Depeche Mode anhörte, der schmeckte wie das Zitroneneis beim Italiener und duftete wie diese süßen Parfüms, die damals alle Mädchen benutzten – nicht verführerisch, eher unschuldig riechend. Vielleicht waren wir das damals auch noch: Unschuldige.
Zwei Dinge prägten diese Zeit stärker als alle anderen: meine erste große Liebe und meine Freunde – die besten Freunde, die ich jemals gehabt hatte. Ich projizierte die in den Jahren undeutlich gewordenen Gesichter an meine Augenlider, und mit der Zeit fielen mir auch die dazugehörigen Namen wieder ein. Tanja und Christine, Mike und Alex, Rolf und Marion, Paul und …
»Sag ihn«, dachte ich, »sag ihn doch einfach! Du wirst sie doch sowieso nie vergessen.«
»Lara«, flüsterte ich in die Stille der Wohnung hinein, und dann noch einmal, diesmal lauter: »Lara!«
Augenblicklich krampften sich meine Eingeweide zusammen. Ich schaffte es gerade noch ins Bad, wo ich mich würgend in die Toilettenschüssel erbrach. Die hochkommende Säure brannte widerlich im Hals, vielleicht war der Orangensaft doch keine so gute Idee gewesen.
Während ich noch auf den Bodenfliesen kniete, begann ich, darüber nachzudenken, dass sich die entscheidenden Ereignisse jenes Sommers auf eine einzige Woche Anfang August konzentriert hatten. Jetzt war wieder August, und ich hatte eine knappe Woche Zeit, bis ich bei Sarah und Lukas in St. Peter-Ording sein musste. Das erschien mir angemessen – ich musste die Zeit nur richtig nutzen. Nach dem Vorfall heute Morgen würde es mir nicht schwerfallen, Kemper eine plausible Erklärung zu liefern, weshalb ich bis zu meinem Urlaubsbeginn nicht mehr in der Redaktion erscheinen konnte. »Scheiß auf Reise und Sport«, dachte ich. Arnold würde schon einen Deppen finden, dem er die Rubriken aufhalsen konnte.
Nachdem ich mich hochgerappelt hatte, putzte ich mir die Zähne und ließ eiskaltes Wasser über mein Gesicht laufen. Ich war unglaublich müde, in meinen Beinen schienen kiloschwere Bleistücke zu stecken. Langsam schleppte ich mich ins Wohnzimmer zurück und begann, Mützes Nummer zu wählen. Die Unterlagen über den Fall ließ ich weiterhin auf dem Sideboard liegen. Ich fühlte mich nicht annähernd fit genug, um mir jetzt schon Einzelheiten anzuschauen.
»Schneider«, meldete sich eine weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung. So schnell, wie sie den Hörer abnahm, musste sie direkt neben dem Telefon gestanden haben.
»Ich bin’s, Jan. Hast du Zeit?«
»Prinzipiell schon. Was gibt’s denn?«
»Ich brauch dich, Mütze.«
Eine kurze Pause entstand. Ihre Stimme war leiser geworden, als sie sagte: »Was ist denn los? Du hörst dich echt fertig an.«
»Bin ich auch. Passt es dir, wenn ich jetzt direkt vorbeikomme?«
Es passte. Ich zog mir eine Jeans und ein locker sitzendes T-Shirt an und verließ die Wohnung. Kurz darauf klingelte ich an ihrer Tür. Mütze hieß mit richtigem Namen Stefanie Schneider, wohnte nur zwei Straßen weiter und war, nachdem sie vor neun Jahren in unserer Redaktion ein Volontariat absolviert hatte, zu einer guten Freundin geworden – einer rein platonischen Freundin, wohlgemerkt. Wie alle, die sie kannten, nannte ich sie Mütze, weil sie ihre Wohnung nie ohne Kopfbedeckung verließ. Im Winter und Frühling trug sie farblich abenteuerliche Strickmützen, die im Sommer und Herbst diversen Baseballkappen wichen.
»Was ist denn los?«, fragte sie, nachdem sie die Tür geöffnet hatte. »Du siehst noch übler aus, als du dich angehört hast. Ist irgendwas mit Sarah oder Lukas passiert?«
Große braune Ponyaugen schauten mich besorgt unter einem 49ers-Cap an, aus dem hinten ein dunkelblonder Zopf baumelte.
»Nein, denen geht’s gut. Die sind an der Nordsee, liegen in der Sonne und surfen auf den Wellen. Aber ich hab ein Problem. Ein berufliches, das gleichzeitig aber auch … ziemlich privat ist.«
Mit meinen beruflichen Problemen kannte sie sich aus, mit meinen privaten weniger. Vor zwei Jahren hatte Mütze eine mittelschwere Erbschaft gemacht und noch am selben Tag den Journalistenjob hingeschmissen, von dem sie sich wohl mehr versprochen hatte, als über Großbaustellen und Lokalpolitiker zu berichten. Seitdem besaß sie eine Visitenkarte, auf der anstelle einer Berufsbezeichnung das Wort »Privatier« stand.
»Privatierin klingt doch scheiße, oder?«, hatte sie mit breitem Grinsen gesagt, und wer wollte ihr da widersprechen.
Wenn Mütze Langeweile hatte und es sich anbot, half sie mir manchmal, Fakten zu recherchieren, die ich für einen Artikel brauchte. Eine für beide Seiten vorteilhafte Konstellation: Sie freute sich über ein wenig Abwechslung in ihrem Privatier-Dasein und ich mich über kompetente Hilfe. Die zudem auch noch völlig kostenlos war, da Mütze sich wegen ihrer Erbschaft nicht traute, mir dafür etwas in Rechnung zu stellen. Außerdem konnten wir so ab und zu Zeit miteinander verbringen, ohne dass Sarah direkt einen Eifersuchtsanfall bekam.
Ich folgte Mütze ins Wohnzimmer und ließ mich auf die cremefarbene Stoffcouch fallen. Der Raum wurde von einem riesigen Flachbildfernseher dominiert, unter dem ein ultramodernes Soundsystem steckte. An den Längswänden standen Sideboards aus Pinienholz, die dem Ganzen ein mediterranes Flair verliehen. Und Bücher. Viele Bücher. Auf den Sideboards, in einem Regal, zu Stapeln aufgeschichtet auf dem Boden.
Mütze war in der Küche verschwunden und kam kurz darauf mit zwei Gläsern wieder, in denen frisch gepresster Zitronensaft schwappte, den sie gezuckert und mit Mineralwasser aufgefüllt hatte. Ich nahm einen Schluck, lehnte mich zurück und begann, von dem Fall zu erzählen.
Ich ließ nichts aus. Fast nichts. Ich offenbarte ihr, dass ich damals derselben Clique angehört hatte wie die Opfer und mich an weite Teile des Sommers noch gut erinnern konnte. Aus irgendeinem Grund verschwieg ich ihr jedoch, dass ich zu dem Zeitpunkt des Verbrechens ebenfalls im Bergischen Land war – und ihrem unschuldigen Gesichtsausdruck nach zu urteilen, war sie weit davon entfernt, irgendetwas zu ahnen.
»Mensch, Jan«, sagte sie, als ich fertig war. »Wenn du ein Bulle wärst und ich dein Chef, dann würde ich jetzt sagen: Römer, Sie sind befangen. Geben Sie den Fall gefälligst an einen Kollegen ab!«
»Nichts da«, sagte ich und lächelte. Es war mein erstes aufrichtiges Lächeln an diesem Tag. »Da muss und da will ich jetzt durch. Ich kann das nicht noch einmal verdrängen, ohne mir zumindest vorher bewusst vor Augen zu führen, was damals alles passiert ist. Verstehst du?«
Sie nickte, obwohl ich nicht glaubte, dass sie es wirklich verstehen konnte. Wie auch? Sie war behütet aufgewachsen, ihr ganzes Leben war gradlinig verlaufen. Niemand hatte ihren besten Freund erschlagen. Keiner ein Mädchen vergewaltigt und abgestochen, das sie gut gekannt hatte. Ihre Träume wurden nicht von den Dämonen mühsam unterdrückter Erinnerungen heimgesucht. Ich wünschte ihr von ganzem Herzen, dass sich daran auch nie etwas ändern würde.
Dann schaute ich ihr in die Augen. »Fünf Tage, Mütze, nur fünf Tage. So viel sollte einem die eigene Vergangenheit doch wert sein, oder?«
»Wenn ich dir dabei helfen kann, dann mach ich das gerne, das weißt du.«
Nichts anderes hatte ich hören wollen.
Als die Dämmerung kam, saßen wir immer noch auf ihrem Balkon; das Wohnzimmer hatten wir schon vor Stunden verlassen. Ein kräftiges Indigoblau färbte den Himmel von den Rändern her dunkel wie eine Tinteninfusion. Vor uns auf dem Tisch lagen Zettelchen, auf denen wir unsere Pläne für die nächsten Tage notiert hatten.
Sämtliche alten Polizeiberichte lesen und auswerten.
Meine alten Freunde aufspüren und befragen.
Herausbekommen, woran sie sich erinnern können.
Die Orte des Geschehens aufsuchen.
In meinen Erinnerungen wühlen.
Mütze wollte sich dabei auf Aufgaben konzentrieren, die Distanz erforderten, ich auf persönliche Dinge, den ganzen emotionalen Part.
Jetzt fühlte ich mich ermattet und ausgelaugt. Am liebsten hätte ich Scotty angefunkt, damit er mich augenblicklich ins Bett beamen würde. Mütze dagegen wirkte frisch und ausgeruht. Sie saß mir gegenüber und rauchte entspannt eine Zigarette, deren Glut in der hereinbrechenden Dunkelheit ab und zu rötlich aufleuchtete wie ein Bremslicht.
»Wo hat sich eure Clique eigentlich immer getroffen?«
»Im Park«, sagte ich und lächelte. »Ich weiß gar nicht mehr, wer auf den Namen gekommen ist. Aber solange ich ihn kenne, hieß er so: der Park.«
»So was wie der Volksgarten?«
»Nein – eigentlich war es auch kein Park im eigentlichen Sinne, sondern ein hinter einer Toreinfahrt liegendes Gelände mit Wiesen, Bäumen und einem kleinen Spielplatz. Ich hab keine Ahnung, ob es ihn heute überhaupt noch gibt.«
Sie drückte ihre Zigarette aus und schaute mich an. Pure Energie blitzte aus ihren Augen.
»Bring mich hin!«, sagte sie.
»Jetzt?«
»Ich will sehen, wo alles angefangen hat.«
»Aber …«, begann ich zu widersprechen. Ich wollte nur noch nach Hause. Außerdem würde Sarah bald anrufen, wie jeden Abend, bevor sie ins Bett ging. Entweder, um mir eine gute Nacht zu wünschen oder um mich zu kontrollieren – ich war mir da nie ganz sicher.
»Kein Aber, Jan«, sagte sie und stand auf. »Du kannst mich doch nicht die ganze Zeit mit deiner Vergangenheit zutexten und dann sang- und klanglos von der Bildfläche verschwinden, ohne dass ich mir ein konkretes Bild machen konnte. Komm schon – los geht’s!«
Ich stöhnte. Mütze war 14 Jahre jünger als ich, und in diesem Moment schien jedes einzelne davon zentnerschwer auf meinen Schultern zu lasten. Aber ich hatte auch keine Kraft mehr zur Gegenwehr, und außerdem, so ganz im Hinterkopf, reizte mich der Gedanke, den Park wiederzusehen.
Seufzend raffte ich mich auf und griff nach den Autoschlüsseln.
Kurz darauf parkten wir im Kartäuserwall und blickten auf den Ort, der für mich der Park gewesen war. Alles sah noch genauso aus, wie ich es in Erinnerung gehabt hatte: die Häuser, die Straße, das hundert Meter entfernt liegende Altersheim. Auch die Toreinfahrt war nahezu unverändert, nur dass der Zugang in den Hof jetzt durch ein Rolltor versperrt war, das es früher nicht gegeben hatte. Merkwürdigerweise erschien mir die Umgebung dennoch seltsam fremd, wie eine Stätte, die ich zwar gekannt, mit der mich emotional jedoch nichts verbunden hatte.
Auch Mütze wirkte enttäuscht. Was auch immer sie sich von diesem Ausflug versprochen hatte: Hier gab es keine spukenden Geister der Vergangenheit, die nur auf uns gewartet hatten. Keine erhellenden Einblicke. Nur eine verschlossene Hofeinfahrt, die in ihrer Banalität fast schon komisch wirkte.
Ich wollte Mütze gerade fragen, ob wir wieder zurückfahren sollten, als im Rückspiegel Scheinwerfer auftauchten. Ein silberfarbener Opel Astra bremste hinter uns ab, fuhr auf den Bürgersteig und blieb mit laufendem Motor vor dem verschlossenen Tor stehen. Während der Wagen in die Nacht dieselte, stieg der Fahrer aus, kramte einen Schlüssel aus der Hosentasche und schob ihn in den metallenen Kasten, der neben dem Rolltor angebracht war. Kurz darauf wurde es von einem unsichtbaren Antrieb in die Höhe gezogen und gab den Blick frei auf den dahinter liegenden Hof, perfekt ausgeleuchtet durch die Scheinwerfer des Opels.
Da lag sie also vor mir, meine Vergangenheit. Insgesamt betrachtet war es eine glückliche, unschuldige Zeit gewesen, und obwohl es auch Schattenseiten gegeben hatte, riefen die Erinnerungen daran jetzt doch eine beklemmende Sehnsucht in mir hervor. Ich versuchte, dies vor mir selbst zu erklären, indem ich mir sagte, dass mein Innenleben gerade in Aufruhr war, weil so vieles auf mich einstürzte. Mir gingen meine verstorbenen Eltern durch den Kopf, meine Jugend, meine damaligen Freunde. Und auch all die Dinge, die unerledigt geblieben waren, weil diese Zeit ein so abruptes vorzeitiges Ende fand. Rückblickend war es mir manchmal so vorgekommen, als hätte das Böse damals noch keinen Platz in meinem Leben gehabt. Aber das stimmte nicht. Es war da gewesen. Schon immer.
AUGUST 1986
Alex Riewer und ich standen in einem Tempel aus Licht und Glück. Der abendliche Sommerwind streichelte unsere Haut, der Gesang aus 45 000 Kehlen unsere Seele. Der Fußballrasen unter uns sah dermaßen grün aus, dass man denken könnte, jemand hätte ihn angemalt. Im weiten Oval feierten die Fans, ein einziges rot-weißes Freudenmeer brandete durch das Müngersdorfer Stadion. Ich schaute hoch zur Anzeigetafel. 1. FC Köln: 3, VfL Bochum: 0. Es war 1986, ein Freitagabend Anfang August, und es lief die 86. Spielminute.
Alex beugte sich hinüber zu den drei Jungs, die links von uns standen. Fränzchen, Thorsten und Helmut, den alle nur Heli nannten und den ich nie anders als kaugummikauend gesehen hatte. Die drei kamen wie wir aus der Kölner Innenstadt, wohnten in der Nähe des Neumarkts und gehörten einer Clique an, mit der wir lose befreundet waren.
Ich wendete mich ab und konzentrierte mich wieder auf das Geschehen auf dem Rasen. Von ihrem Gespräch bekam ich nur Wortfetzen mit. Es ging um die Pläne nach dem Spiel. »Bochumer klatschen«, hörte ich Fränzchen sagen.
»Was geht jetzt?«, fragte Heli nach dem Schlusspfiff und schob sich ein neues Kaugummi in den Mund. »Seid ihr mit dabei oder nicht?«
Ich sah den fragenden Blick von Alex und schüttelte leicht den Kopf. Gerade so, dass er es mitbekam, die anderen jedoch nicht.
»Ansonsten echt gerne, sch… sch… scheiß Bochumer«, sagte Alex. Er stotterte immer, wenn er aufgeregt war. »Aber heute steht noch ’ne Party an und da sind voll die super Bräute am Start.«
»Klingt geil. Wo denn?«, fragte Heli interessiert.
»Ist leider privat in ’nem Partykeller.«
Alex zuckte bedauernd die Schultern. »Da könnt ihr nicht mit, sonst flippt der Alte von dem Kumpel aus, dem der Keller gehört. Der kann es nicht abhaben, wenn da Fremde mitkommen.«
»Scheißegal«, sagte Fränzchen und winkte ab. »Dann hauen wir die Bochumer eben alleine weg. Und euch viel Spaß mit den Schüssen. Steckt einen für uns mit rein, ja?«
»Ja, klar«, sagte Alex und grinste, dann gingen wir. Raus aus der Arena und den Fußweg entlang, der vom Stadion zur Haltestelle der Straßenbahn führte. Unter unseren Füßen knirschte der Kies, hinter uns schoben die Massen, noch immer Schlachtgesänge schmetternd, die alle von Treue und Liebe zum Verein erzählten.
Ich schaute meinen Kumpel an. Alex war fast einen Kopf kleiner als ich, hatte dunkelbraune Locken und ausgeprägte Grübchen, um die ich ihn unsagbar beneidete. Aus irgendeinem Grund waren die bei den Mädels der absolute Reißer – kaum eine, die Alex nicht niedlich fand.
Er hätte nie offen zugegeben, dass die angebliche Party nur ein Vorwand gewesen war, um sich ohne Gesichtsverlust vor der Schlägerei drücken zu können. Also fragte ich nicht nach. Ich kannte ihn und er kannte mich. So war das eben, wenn man mehr Zeit miteinander verbrachte als mit der eigenen Familie.
Das Spiel war schon eine gute Stunde vorbei, als Alex und ich an der Ulrichgasse wieder aus der Straßenbahn stiegen. Direkt neben der mittelalterlichen Ulrepforte bogen wir in den Kartäuserwall ab. Eine schmale Seitenstraße, die geradewegs auf die Severinstraße und den Chlodwigplatz führte und somit mitten hinein ins Herz der Kölner Südstadt.
Hinter einer Hofeinfahrt erreichten wir unser Revier. Den Ort, an dem wir uns jeden Tag trafen und den wir nur den Park nannten. Nie musste man sich groß verabreden, irgendwer war immer da. Aber der Park war viel mehr als nur ein praktischer Treffpunkt. Hier lernten wir, wie man sich streitet und wieder verträgt. Hier schlossen wir Bündnisse und brachen sie wieder. Hier prügelten und vertrugen wir uns. Und jeden Abend wurde ein Schlussstrich gezogen, bevor dann am nächsten Tag wieder neue Allianzen entstanden. Für uns war das nicht einfach nur ein halb verwildertes Gelände hinter einer Hofeinfahrt – es war unsere Schule des Lebens.
Wenn man in den Park hineinwollte, musste man zuerst durch eine Toreinfahrt laufen, an die sich dann ein Hof mit mehreren Garagen anschloss. In der hintersten Ecke, zwischen der letzten Garage und einer gut zwei Meter hohen Backsteinmauer, gab es einen schmalen Durchgang, der in den eigentlichen Park führte. Er war vielleicht so groß wie zwei nebeneinanderliegende Tennisplätze und bestand aus einer von dornigen Büschen und hoch aufragenden Bäumen umgebenen Wiese, in deren Mitte sich ein Sandkasten befand, neben dem zwei Klettergerüste standen. Dennoch haben wir hier nie Kinder gesehen, die im Sand buddelten oder auf Gerüsten herumtobten. Auch keine Erwachsenen, die Klatsch austauschend auf den Bänken saßen. Vermutlich hatte die Nachbarschaft irgendwann akzeptiert, dass dieser Ort der unsere war, und sich mit ihrem Nachwuchs in den nahe gelegenen Volksgarten zurückgezogen.
Als Alex und ich den Hof betraten, lag er bereits völlig im Dunkeln. Das gesamte Areal wirkte wie ausgestorben. Nur ein leichter Wind strich durch die Bäume und brachte die Blätter zum Rauschen. Wir wollten uns gerade wieder umdrehen, als wir Stimmen hörten, die aus der Richtung eines abseits liegenden Geländers kamen. Während wir langsam darauf zu schlenderten, schälten sich die Gesichter von Tanja Busch und Rolf Greuel aus der Dunkelheit.
»Hey, wie war’s beim FC?«, fragte Tanja, nachdem sie uns gesehen hatte.
Sie schaute mich mit einem schiefen Lächeln an, während Rolf das tat, was er meistens tat: schweigen. Mit seiner dicken Hornbrille und dem watschelnden Gang erinnerte er mich immer an einen halbblinden Pinguin. Er war weder sportlich noch geistig eine Leuchte, hatte bis zum Sommer des letzten Jahres sogar eine Sonderschule besuchen müssen. Irgendwie hatte sein Vater es dann geschafft, ihm eine Ausbildung als Maurer bei einer großen Baufirma zu verschaffen. Der Mann war seit 23 Jahren Mitglied bei den Roten Funken und musste über grandiose Beziehungen verfügen.
»Super, die sch… sch… scheiß Bochumer mit 3:0 abgefertigt«, antwortete Alex und stieß triumphierend die Faust nach oben. »Anschließend wollten wir denen noch auf die Fresse hauen, aber die sind ja alle w… w… weggerannt, das feige Pack.«
Tanjas Mundwinkel umspielte ein spöttischer Zug. Dann sah sie zu mir herüber, was mich augenblicklich nervös machte. Sie war so alt wie ich und der Grund, warum ich in letzter Zeit häufig feuchte Träume bekam. Tanja hatte, obwohl sie schlank war, bereits ausgeprägte Kurven und ein niedliches Gesicht mit ein paar Sommersprossen und einer hinreißenden kleinen Lücke zwischen den Schneidezähnen. Dazu dunkelblondes Haar mit einem zu langen Pony, der ihr immer ein wenig wirr ins Gesicht fiel.
Und sie war clever, verdammt clever. Ich war gerne in ihrer Nähe und liebte es, mit ihr über alles Mögliche zu diskutieren. Selbst wenn es nur darum ging, welche Band gerade am angesagtesten war. Weniger begeistert war ich davon, dass ich bei diesen Diskussionen meist den Kürzeren zog.
»Und du, Jan?«, fragte sie und schaute mir in die Augen. »Wolltest du auch andere Fans verprügeln?«
Mein Gott – wie ich solche Fangfragen hasste! Sagte ich ja, hielt sie mich für einen Schläger. Sagte ich nein, war ich ein Feigling. Also musste ganz schnell eine Alternative her. Eine Gegenfrage vielleicht.
»Glaubst du etwa, ich hätte Alex bei so was alleine gelassen?«
»Hätte der nicht!«, rief Rolf dazwischen und schaute Tanja erbost an, obwohl sie die Frage ja gar nicht gestellt hatte. »Oder, Jan?«
Ich kam erst gar nicht zu einer Antwort.
»Keine Ahnung«, sagte Tanja. »Beim Jan kann man ja nie wissen, was er macht … oder eben auch nicht macht.«
Dann zog sie die Augenbrauen hoch und lächelte. Ihre Augen blitzten selbst in der Dunkelheit noch wie zwei blaue Edelsteine, die von hinten angestrahlt wurden. »Ist ja auch egal. Sagt mal lieber, was ihr heute noch vorhabt?«
»Ich mach gar nichts mehr«, hörte ich Rolf sagen. »Ich muss jetzt nach Hause. Morgen bin ich mit Papa bei den Roten Funken, und da singen die immer so ein Lied, das ich noch auswendig lernen muss.«
Ohne ein weiteres Wort watschelte er davon, der komische Karnevalsprinz. Rolf wohnte direkt am Park, und obwohl ihn niemand vermisste, wenn er mal nicht da war, gehörte er irgendwie dazu, wahrscheinlich, weil er schon immer da war. Ab und zu verarschten wir ihn, jedoch nie bösartig. Er duldete das, weil wir seine Freunde waren. Wahrscheinlich die einzigen, die er je gehabt hatte.
»Wollen wir ’ne Runde flippern gehen?«, fragte Alex.
Er wollte immer flippern. Jeden Tag. Und er war gut darin. In unserer Clique unschlagbar.
Ich nickte. Tanja sagte nichts.
»Prima«, freute sich Alex, der das wohl als Einverständniserklärung interpretierte. »Ich geh nur schnell neue Kippen kaufen und dann nix wie los.«
Ich blieb mit Tanja allein zurück. Eine Situation, die aufregend, aber gleichzeitig auch unangenehm war. Tanja schaute mich schweigend an, als würde sie auf irgendetwas warten, während ich mich zwang, nicht wegzuschauen. Mein Herz pochte, und ich hoffte, dass meine Ohren nicht Feuer fingen. Gleichzeitig überlegte ich, wie ich ihr näherkommen konnte, ohne mich der Gefahr einer Blamage auszusetzen.
Bevor meine Überlegungen zu einem Ziel führen konnten, sprang Tanja vom Geländer herunter. »Bis morgen, Doofmann!«, rief sie und verschwand winkend in der Dunkelheit.
Verblüfft über den schnellen Abgang schaute ich ihr nach. Dann ärgerte ich mich über meine Unsicherheit, über das Auslassen einer perfekten Gelegenheit. Anschließend ärgerte ich mich darüber, dass ich mich ärgerte. Warum waren Dinge, die von außen betrachtet so einfach schienen, plötzlich so kompliziert, wenn es um einen selbst ging? Warum hatte ich sie nicht einfach geküsst und mir dann eine passende Ausrede einfallen lassen, falls sie mir eine gescheuert hätte?
Ich setzte mich auf das Geländer. Auf exakt die gleiche Stelle, auf der Tanja eben noch gesessen hatte. Ich bildete mir sogar ein, noch ihre Körperwärme auf dem Metall spüren zu können. Dann dachte ich nach. Wieder und wieder stellte ich mir vor, was ich gerade hätte anders machen können, und jede Version endete damit, dass ich Tanja im Arm hielt. Und küsste.
Kurz darauf standen Alex und ich im Leuchtturm, einer von Zigarettenqualm durchzogenen Eckkneipe, die zwei Blocks vom Park entfernt lag. Abwechselnd prügelten wir eine kleine silberfarbene Kugel durch den altersschwachen Star-Wars-Flipper, der dabei Geräusche von sich gab, die sich wie die Laserschwert-Kämpfe zwischen Luke Skywalker und Darth Vader anhörten. Das Imperium schlägt zurück: »Ich bin dein Vater, Luke!«
Selbst jetzt, beim Flippern, konnte ich nur an Tanja denken: »Ich bin deine Freundin, Jan!«
Auf dem Stehtisch neben uns stellte der schnauzbärtige Wirt zwei Kölschgläser ab. Aus den Augenwinkeln sah ich seine behaarten Unterarme aus hochgekrempelten Hemdsärmeln hervorlugen, zwischen die Finger hatte er eine filterlose Roth-Händle geklemmt. »Ich schreib es auf den Deckel, Jungs«, sagte er, wobei seine Zigarettenasche zu Boden fiel.
»Hmm, ja … gut«, murmelte ich und verlor kurz die Konzentration. Mit einem höhnischen Klappern verschwand die Silberkugel zwischen den beiden Flipperarmen. Entnervt wendete ich mich ab. Wenigstens würde mein Bier jetzt nicht schal werden.
»Tipp vom Profi gefällig?«
»Nein, danke, Alex. Spar es dir.«
»Du solltest beim Flippern nicht immer an die Weiber denken, dann klappt’s auch mit dem Bonus.«
Solche Sprüche fehlten mir gerade noch. Sofort begann ich, mich zu verteidigen: »Ich habe überhaupt nicht an Tanja gedacht. Mich hat nur der blöde Wirt abgelenkt.«
»Wer hat von Tanja gesprochen?«
Jetzt lachte er, wobei die Grübchen seinen Mund wie Ausrufezeichen umschlossen. »Aber wenn du mir sagst, du hättest nicht an ihre Titten gedacht oder daran, wie es wäre, mal mit ihr in der Kiste zu landen, dann …«
»Jaja, schon gut! Ich hab an Tanja gedacht«, gab ich zu und trank das Kölsch in einem Zug aus. »Aber nicht gerade eben. Da hat mich einfach nur der Wirt abgelenkt.«
Alex schaute mich an und grinste. Es war so ein blödes, oberschlaues Grinsen, als wüsste er alles besser. »Da ist unser Janni wohl verknallt, was?«
»Bin ich nicht.«
»Bist du doch.«
»Ich bin … ach, leck mich doch!«
In diesem Moment wechselte der Wirt die Musikrichtung. Auf Neue Deutsche Welle folgte übelster deutscher Schlager. Schon das erste Lied machte mich fertig: Santa Maria von Roland Kaiser. Im ersten Augenblick verstand ich Tanja Maria.
Ich gab auf und seufzte. »Lass uns nach Hause gehen, ja? Ich bin platt, und morgen geht’s um zehn Uhr zum Heider Bergsee. Kannst ja mitkommen, wenn du Bock hast.«
»Wer ist denn noch dabei?«
»Nicht viele. Bis jetzt nur Mike und Markus.«
»Nee, lass mal, du Liebeskasper«, sagte Alex, nachdem er kurz darüber nachgedacht hatte. »Ich hab keinen Bock, so früh aufzustehen. Aber zu Christines Party am Abend seid ihr wieder zurück, oder?«
»Klar«, antwortete ich. »Ist doch die perfekte Gelegenheit, um Tanja rumzukriegen.«
»Haha … das will ich sehen.«
»Das wirst du sehen«, sagte ich und klang dabei überzeugter, als ich mich fühlte.
Eines war klar: Bis zur Party brauchte ich einen perfekten Plan, was Tanja anging. Und zwar einen, der nicht nur in meinem Kopf funktionierte.
*
Als ich am nächsten Morgen das Fenster öffnete, war ich auf einen Schlag hellwach. Der Himmel über der Stadt leuchtete in einem fast schon unanständigen Blau, und die Luft vibrierte von jener Spannung, wie sie besonderen Tagen zu eigen ist. Obwohl der alte Wecker mit dem albernen Mickymaus-Gesicht auf meinem Nachttisch erst 09:37 Uhr anzeigte, stand das Thermometer bereits auf 28 Grad. Ein Hitzerekord bahnte sich an, und der Wetterdienst verkündete, dass sich an den Temperaturen in den nächsten Tagen auch nichts ändern würde.
Ich streckte mich. Mein Zimmer sah mit seinen hellen Kiefermöbeln, der buntgemusterten Tapete und dem von Fußballaufklebern übersäten Schreibtisch noch genauso aus wie vor zehn Jahren. Nur der Sturzhelm, die Musikanlage und ein Poster von David Bowie deuteten darauf hin, dass hier jetzt ein Jugendlicher wohnte.
Das von meiner Mutter gemachte Frühstück ließ ich achtlos stehen. Stattdessen ging ich direkt in die Dusche und lehnte mich mit den Händen gegen die Wand, während kühles Wasser an meinem Körper herunterlief. Meine Gedanken kreisten fortwährend um die Party am Abend. Sobald ich die Augen schloss, konnte ich Tanja vor mir sehen. Wie sie lachte. Wie sie mich ansah. Wie ihre Lider sich schließen würden, wenn unsere Lippen sich näher kamen.
Nachdem ich mit Duschen fertig war, zog ich mir eine kurze Jeans an, dazu ein weißes T-Shirt und Turnschuhe, wie immer ohne Schnürsenkel, weil ich Schnürsenkel hasste. In meinem Zimmer stand schon mein fertig gepackter Rucksack, in den ich neben Schwimmsachen auch ein Badetuch, ein Stephen-King-Buch, eine Flasche Cola, zwei Raider und eine Packung Marlboro gepackt hatte. Das sollte als Verpflegung genügen, zumal Markus’ Mutter dafür bekannt war, dass sie ihrem Sohn bei jedem Ausflug so viel zu essen mitgab, dass es einer kompletten Fußballmannschaft als Tagesration reichen würde.
»Jan?«
»Ja, Mama?«
Sie war in mein Zimmer getreten. Hatte wie immer die Tür geöffnet, ohne anzuklopfen. Hinter ihr sah ich zwei prall gefüllte Tüten auf dem Boden stehen, die sie vom Einkauf mitgebracht hatte.
»Das ist aber schön, dass ich dich noch sehe«, sagte sie und lächelte. »Hast du auch gefrühstückt?«
»Hab keinen Hunger. Wir essen garantiert unterwegs was.«
Missbilligend zog sie die Augenbrauen zusammen. »Iss doch lieber was Anständiges, nicht immer dieses pappige Ding aus dem Hamburgerladen. Soll ich dir schnell ein Brötchen schmieren?«
»McDonald’s heißt der Laden. Und das pappige Ding ist ein Big Mäc.«
»Wie auch immer«, wischte sie meine Erklärung mit einer Handbewegung zur Seite. »Was ist jetzt mit dem Brötchen?«
»Danke, Mama«, sagte ich und gab mir Mühe, besonders lieb auszusehen. »Aber ich bekomme gerade wirklich nichts runter. Und später hole ich mir zu Mittag einen Salat, versprochen.«
Sie grinste mich an, wohl wissend, was von meinem Versprechen zu halten sei. Dann nahm sie mich in den Arm.
»Pass bloß auf dich auf«, sagte sie, küsste mich auf die Wange und streichelte über meinen Rücken. »Und komm gesund wieder. Ich lieb dich – vergiss das nicht!«
»Ich dich auch«, sagte ich, und diesmal war es die Wahrheit. Dann packte ich meinen Sturzhelm und meinen Rucksack und verließ die Wohnung. Die hinterhergerufenen Ermahnungen meiner Mutter, ich solle vorsichtig fahren und auf die Autos aufpassen, hatte ich bereits vergessen, als ich durch die Haustür trat. Ich überquerte die Straße und setzte mich auf das Biest, das unter einem Balkon stehend auf mich wartete. Das Biest; so hatte ich die Yamaha RD80 LC getauft, die ich vor einem Dreivierteljahr zum Geburtstag bekommen hatte. Direkt danach wurde sie einer Komplettoperation unterzogen. Alex besorgte aus Holland einen Zylinder mit mehr Hubraum, Paul Wontzek bearbeitete die Ein- und Auslasskanäle, und ich hatte mir vom Weihnachtsgeld, das von meiner Mutter, Tante Hedwig und Onkel Paul für Anziehsachen gedacht gewesen war, eine Auspuffanlage gekauft, auf deren Verpackung in fetten Lettern stand: Im öffentlichen Straßenverkehr verboten!
Zum Abschluss war die Optik dran. Rolfs Vater brachte die Yamaha, die damals noch ein langweiliges Weiß trug, in sein Autohaus. Als ich sie nach drei Tagen wieder abholte, erstrahlte sie in dem gleichen Rot, in dem Enzo Ferrari immer seine Autos lackieren ließ. Bezahlen musste ich die Lackierung nicht – Rolfs Vater verrechnete das mit den Nachhilfestunden, die sein Sohn das Jahr über von mir bekommen hatte.
Nur die turbinenartigen Felgen ließ ich schwarz. Ein wenig Understatement konnte nicht schaden. Und auch, wenn das Biest immer noch klang wie ein Rasenmäher auf Kokain – die Maschine war mein ganzer Stolz; das heißeste Moped der Gegend.
Von meiner Haustür bis zum Park brauchte ich keine zwei Minuten. Als ich auf den Hof bog, sah ich Markus schon abfahrbereit auf seiner Honda sitzen. Wie erwartet hatte er einen Rucksack dabei, der bis oben hin mit Butterbroten, Frikadellen, Äpfeln, Schokolade und allerhand anderem leckeren Zeug gefüllt war. Vermutlich hatten seine Eltern den Tagesausflug mit einem einwöchigen Überlebenstraining in den unbesiedelten Weiten Kanadas verwechselt. Oder sie hatten lediglich ein schlechtes Gewissen, das sie damit beruhigen wollten.
Markus’ Eltern waren Pächter einer großen und sehr beliebten Kneipe am Chlodwigplatz, in deren Kellerräumen es auch eine Kegelbahn gab. Sieben Tage in der Woche standen sie hinter der Theke, meist von elf Uhr morgens bis weit in die Nacht hinein. Wenigstens bestand mit ihren Überlebenspaketen keine Gefahr, dass Markus in der Zwischenzeit verhungerte. Das Ergebnis ihrer Fürsorge zeigte sich in fünfzehn Kilogramm Übergewicht, die sich vor allem im Bereich der Hüften und des Bauches angesiedelt hatten. Ständig musste er seine zu eng gekauften T-Shirts nach unten ziehen, weil sie sich wie ein Rollo über die Wampe hochkrempelten.
»Was geht ab?«, fragte ich, nachdem ich den Sturzhelm abgenommen hatte.
»Doofe Frage: Alles, was nicht fest ist«, entgegnete er und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Mit seinem runden Babygesicht und den strohblonden Haaren wirkte er auf den ersten Blick wie der dicke Junge aus Bullerbü.
»Aber Mike ist immer noch nicht da.«
Ich schaute auf die Uhr. Zwei Minuten nach zehn. Kein Grund zur Hektik. »Mach dich locker, der wird schon rechtzeitig …«
Ich wurde vom Knattern einer frisierten Achtziger unterbrochen. Mike rauschte an. Lange braune Haare schauten unter einem offenen Helm mit Kinnschutz hervor, wie ihn Motocross-Fahrer trugen. Mike; das war kein Spitzname, so hieß er wirklich. Genauer gesagt, Mike Küppers – keine Ahnung, was seine Eltern sich dabei gedacht hatten.
Wir schlugen uns zur Begrüßung gegenseitig auf die Schulter, ließen lachend ein paar Sprüche los. Fantasierten kurz herum, was heute Abend auf der Party mit den Mädels so alles abgehen könnte. Dann starteten wir unsere Mopeds und fuhren los.
Zuerst folgten wir der Vorgebirgsstraße, passierten das Stadion von Fortuna Köln und bogen dann am Südfriedhof auf den Militärring ab. Der Verkehr war grausam, obwohl es mitten in den Schulferien war. Wir schlängelten uns an den Autokolonnen vorbei bis zur Luxemburger Straße, die uns nach Hürth und aus Köln heraus führte. Langsam ließ der Verkehr nach. Wir flogen über die Landstraße, überholten Trecker, schnitten PKWs und ließen erschrockene Rentner hinter uns, die wild hupten, während wir mit dem Mittelfinger grüßten. Auf unseren Visieren zerplatzten Insekten wie kleine Wasserbomben, und die warme Luft roch, wie nur der Sommer riechen kann – nach purem Leben und satt vor Glück.
Ich fuhr direkt hinter Mike her. Nicht zum ersten Mal fiel mir dabei auf, was für ein breites Kreuz er hatte und welches Risiko er beim Überholen einging. Der Aufkleber auf seinem Helm passte perfekt zu seiner Fahrweise. No Mercy stand darauf, keine Gnade.
Anders als Markus und ich fuhr Mike eine Achtziger, die auf Geländemaschine getrimmt war. Lange Federwege, grobstollige Reifen. Kein Moped, mit dem ich gerne durch Kurven räubern würde, schon gar nicht in dieser Geschwindigkeit.
Während die Landstraße unter uns hinwegrauschte und die Bäume am Wegesrand zu einer grünen Wand verschmolzen, ließ ich meinen Gedanken freien Lauf und dachte über Mike nach. Ich kannte ihn länger als alle anderen aus der Clique, schon aus Grundschulzeiten. Früher einmal waren wir die besten Freunde gewesen, und wir wären es wohl bis heute geblieben, wenn ich an einem Tag im April nicht so feige gewesen wäre.
Wir hingen an diesem Tag gelangweilt im Hof herum und ließen die Zeit verstreichen. Mike saß etwas abseits und schraubte an seiner Malaguti. Tanja kicherte mit Marion über irgendwas, während Alex von einem Mädchen aus der Berufsschule erzählte, das nach seinen Aussagen wohl mehr Drogenerfahrungen haben musste als Keith Richards.
Auf dem Gelände hatte auch Paul Wontzek mit seinem Bruder Rainer eine Doppelgarage gemietet, in der sie ihre Motorräder abstellten. Bis zu diesem Tag war Paul fast wie ein Vorbild für mich gewesen. Er war seit einem Jahr volljährig, hatte ein Motorrad, lange schwarze Haare, dicke Muskeln und regelmäßigen Sex. Wir kamen mit den Wontzek-Brüdern gut aus. Wenn wir ein Problem mit unseren Achtzigern hatten, konnten wir sie um Hilfe bitten, uns Werkzeug ausleihen oder gute Tipps abholen. Zehn Kilometer der Höchstgeschwindigkeit meiner Yamaha verdankte ich alleine Pauls Talent, ihre Ein- und Auslasskanäle perfekt bearbeiten zu können.
Aber so umgänglich Paul sich auch uns anderen gegenüber verhielt, Mike hatte er gefressen. Wo immer er konnte, zankte er mit ihm. Ich habe nie verstanden, wo dieser Hass eigentlich herkam. Vielleicht sah er in Mike schon eine zukünftige Bedrohung seiner eigenen Position, vielleicht fühlte er sich auch einfach nur davon herausgefordert, dass Mike sich nichts gefallen ließ. Mike hatte eine zweifach gebrochene Nase und eine Narbe über der Oberlippe, die von einem lange zurückliegenden Fahrradsturz herrührte, und Paul nannte ihn deshalb oft »Hasenscharte«. Vor allem dann, wenn andere dabei waren.
Als Mike gerade dabei war, die Bremsbeläge an seinem Moped zu wechseln, trat Paul von hinten an ihn heran. »Na, Hasenscharte – was gibt es denn da zu schrauben? Lass mal besser die Pfoten davon; hast ja eh keine Ahnung.«
Mike reagierte nicht. Er konzentrierte sich weiterhin auf sein Moped und schien Paul gar nicht wahrzunehmen.
»Hey, Hasenscharte – ich rede mit dir!«
Wieder keine Reaktion.
Pauls Wangen färbten sich rot. »Was ist denn mit dem Wichser los? Stumm geworden, du Spacko?«
Langsam legte Mike sein Werkzeug zur Seite. »Warum verpisst du dich nicht einfach, hm?«
Seine Stimme klang dabei kein bisschen verunsichert. Als er einen Fuß auf den Boden setzte, als wolle er aufstehen und es mit Paul aufnehmen, explodierte die Situation.
Pauls Turnschuh traf mitten in sein Gesicht. Es klang, als hätte jemand mit voller Wucht einen Tennisball gegen die Wand getreten. Mike fiel nach hinten, aus seiner Nase schoss Blut. Bevor er sich schützen konnte, prasselten weitere Tritte auf ihn ein.
Paul geriet völlig außer Kontrolle und hörte erst auf, als Mike wie ein Embryo zusammengerollt auf dem Boden lag.
Ich hätte später gerne behauptet, dass ich die ganze Zeit über wie paralysiert gewesen wäre. Unfähig, irgendetwas zu unternehmen.
Aber das stimmte nicht.
Die Wahrheit war: Ich hatte schlicht und einfach zu viel Angst gehabt, um einzugreifen.
Und während ich einfach nur danebenstand und die Dinge geschehen ließ, griff Tanja ein: »Ich glaub, du hast sie nicht mehr alle«, schrie sie und schubste Paul von Mike weg. »Tickst du noch ganz sauber?«
Für einen Moment sah es so aus, als wollte Paul sich auch auf Tanja stürzen. Dann überlegte er es sich anders. Beugte sich stattdessen über Mike, spuckte ihm ins Gesicht und schrie: »Beim nächsten Mal gibst du mir gefälligst direkt eine Antwort, scheiß Hasenscharte!«
Dann drehte er sich zu uns um. »Und ihr glotzt nicht so blöd, klar?«
Wahrscheinlich waren es der Einsatz von Tanja und meine Sorge um sie gewesen, die meine Wut angeheizt hatten. Dies und die Schmach, die ich bei meinem Verhalten empfunden hatte. Feigheit, so dachte ich, ist deutlich schlimmer als eine Tracht Prügel.
»Lass ihn gefälligst in Ruhe – Mike hat dir nichts getan.«
Paul starrte mich an, sein Gesicht immer noch wutverzerrt. »Was mischst du dich da ein?«
»Es ist genug, verstanden?«
»Ja – das fin… finde ich auch«, stimmte Alex zu, der neben mich getreten war. »Lass ihn in Ruhe.«
»Oder?«
Paul ging einen Schritt auf Alex zu.
»Nichts oder«, sagte ich. »Es ist einfach gut jetzt, okay?«
Paul ließ seinen Blick abschätzig von Alex zu mir wandern. Dann drehte er sich um, trat gegen eine im Hof stehende Mülltonne, die scheppernd umfiel, und verließ das Gelände.
Wir blieben zurück und sahen zu Mike, der sich in der Zwischenzeit wieder aufgerichtet hatte. Marion beugte sich zu ihm herab und wollte ihre Hand auf seine Schulter legen, doch er stieß sie weg. Dann stand er auf, wischte sich das Blut von der Nase und fuhr fort, an seiner Malaguti zu schrauben, als sei nichts gewesen.
Aber es war etwas passiert. Jeder konnte das spüren, Alex, Tanja, Marion und ich.
Besonders ich.
Irgendetwas ging an diesem Tag zwischen Mike und mir kaputt, und ich war schuld daran. Wir redeten später noch miteinander, lachten noch miteinander, aber die besondere Nähe, die aus Vertrauen entsteht, fehlte fortan. Und an manchen Tagen fehlte mir auch Mike. So doll, dass es mich schmerzte. Unzählige Male habe ich mir vorgenommen, ihn auf den Vorfall anzusprechen, aber immer einen Rückzieher gemacht. Ich hatte Angst, als Paul damals auf ihn eingeschlagen hatte. Und jetzt hatte ich Angst, dass er mich fragen könnte, warum ich ihm nicht früher geholfen hatte. Eine Frage, auf die ich selber keine Antwort wusste.
Grell aufleuchtende Bremslichter brachten mich in die Gegenwart zurück. Wir bogen von der Luxemburger Straße ab, einmal links, zweimal rechts, dann hatten wir den See erreicht. Der Heider Bergsee lag inmitten eines Naturparks und war in den sechziger Jahren als Überbleibsel des Braunkohleabbaus entstanden. Für mich klang das paradox: Zuerst vernichtete man ganze Landschaften, die man dann später wieder mühevoll aufforsten musste.
An seinen Ufern lagen ein von Bäumen umgebener Ruderverein, ein das ganze Jahr über geöffneter Campingplatz und ein Restaurant, an das sich eine große Terrasse mit Bänken und Tischen anschloss.
Wir stellten unsere Mopeds auf dem Parkplatz ab und steuerten direkt die neben dem Restaurant gelegene Wiese an. Unterwegs hatte der Fahrtwind noch für Kühlung gesorgt. Jetzt lief mir der Schweiß ungehemmt die Stirn herunter, und das T-Shirt klebte unangenehm am Rücken.
»Scheiße, kein Platz mehr frei«, stellte Markus mit Blick auf die Familien fest, die sich bereits unter den wenigen Bäumen breitgemacht hatten. Viele hatten ihr Essen von zu Hause mitgebracht, es roch nach Kartoffelsalat und selbstgemachten Frikadellen, nach Sonnencreme, Schweiß und leichten Sommerparfüms.
»Egal«, sagte Mike. »Legen wir uns eben in die Sonne.«
Wir platzierten unsere Handtücher möglichst dicht am Wasser und stellten die Rucksäcke darauf ab. Ich schüttete einen halben Liter Mineralwasser in mich rein, dann sah ich mich um.
Um uns herum führte das Chaos Regie: Eltern schrien ihre Kinder an, die Kleinkinder anschrien, die heulend nach ihren Eltern schrien. Ein Stück entfernt jaulte ein Radio auf höchster Lautstärke die aktuellen Hits, während zehn Meter weiter mit einem Kassettenrecorder dagegengehalten wurde, aus dem Frl. Menke ihr Tretboot in Seenot besang. Es war heiß, es war laut, es war traumhaft schön.
Ich zog mich bis auf die Badehose aus und lief mit Mike runter zum Wasser, während Markus auf der Wiese zurückblieb.
»Ich hab noch nichts gegessen«, rief er uns nach. »Warum müsst ihr denn so ’ne Hektik machen?«
Ich drehte mich kurz um und lachte. Für Markus schien ein plötzlicher Hungertod die größte Bedrohung zu sein, schlimmer noch als ein sich anbahnender Hitzeschlag. Oder er wollte seine Wampe den kichernden Mädchen neben uns nicht unbekleidet zeigen. Sein Problem – mir war so heiß, dass ich keine Minute länger warten wollte.
Schon der erste Schritt ins kühle Nass kam einer Erlösung gleich. Mike zog sofort mit kräftigen Kraulschlägen in Richtung Seemitte davon, während ich mich in Ufernähe treiben ließ. Das Wasser war perfekt, nicht zu kalt und nicht zu warm. Die Luft duftete nach Wald und Wiesen. Ich schwamm auf dem Rücken liegend durch die Schatten der am Ufer stehenden Bäume. Einzelne Sonnenstrahlen stachen durch die Äste und Blätter hindurch, um flirrend auf der Wasseroberfläche zu sterben. Die kleinen Wellen um mich herum glitzerten wie Diamanten in der Sonne. Alle Geräusche nahm ich nur noch gefiltert wahr: das Schreien der Kinder, die Musik aus dem Radio, das Planschen der Badenden.
Ich bewegte die Beine nur langsam, gerade so stark, dass ich nicht unterging. Dabei dachte ich an Tanja und an den bevorstehenden Abend. Was ich sagen könnte, wie sie reagieren würde. Sämtliche Möglichkeiten wog ich ab, ging deren Erfolgsaussichten durch und legte mir einen Plan zurecht, bei dem Musik und Alkohol eine wichtige Rolle spielten. Irgendwann verlor ich das Zeitgefühl.
Als Mike mich an der Schulter packte, schreckte ich hoch wie jemand, der unsanft aus einem Traum gerissen wurde. Ich schluckte Wasser, hustete und bekam nur halb mit, was Mike mir zu sagen versuchte.
»Markus hat Ärger!«, wiederholte er. Ich spuckte das letzte bisschen Wasser aus und blickte in Richtung der Liegewiese. Drei Jugendliche hatten sich vor Markus aufgebaut, wobei einer ihm immer wieder den Zeigefinger gegen die Brust stieß.
Wir gaben Gas und erreichten nach Luft schnappend das Ufer. Einer der drei Jungs, die etwa in unserem Alter waren, verpasste Markus gerade einen Bodycheck, der ihn stolpern und zu Boden taumeln ließ. Den Wortfetzen konnten wir entnehmen, dass es sich bei dem Schubser offenbar um den Frl.-Menke-Fan mit dem quäkenden Kassettenrecorder handelte. Während wir im Wasser waren, hatte Markus wohl die Faxen dicke gehabt und sich beschwert.
Markus war dick und Markus war allein, die perfekte Beschreibung für ein einfaches Opfer hatten sie zumindest gedacht.
Wie die meisten Jugendlichen, die in einer Großstadt aufwachsen, kannten wir die goldene Regel. Wann immer sich ein Konflikt abzeichnet, sind die ersten Sekunden entscheidend dafür, wer die Oberhand behält. Wer zuerst Angst zeigt, hat verloren. Ich trat also auf die drei zu, bemühte mich um einen möglichst coolen Gesichtsausdruck, schaute dem Anführer fest in die Augen und sagte: »Probleme, du Arschloch?«
Er wich unwillkürlich zurück und warf einen Blick über die Schulter, als wolle er sich vergewissern, dass seine Kumpels noch da waren. Zum Glück konnte er nicht sehen, wie meine Knie zitterten.
»Was geht’s dich an?«, fragte er dann trotzig.
»Das da ist mein Kumpel! Wenn der ein Problem hat, ist es auch meins. Und somit gerade zu deinem geworden.«
Ich ging einen weiteren Schritt auf ihn zu. Kurzzeitig sah es so aus, als würde er abermals zurückweichen. Dann fiel ihm wohl ein, dass seine Freunde zuschauten und er haarscharf vor einer Blamage stand.
Er änderte daraufhin die Taktik und versuchte, das Ganze wie einen Spaß aussehen zu lassen.
»Okay, Freunde, alles in Ordnung«, versuchte er einzulenken. »Vergessen wir die Sache – dem Dicken ist ja nichts passiert.«
Als ich nicht antwortete, schaute er zu Mike, von dem er sich wohl mehr Verständnis erhoffte. »Nur weil dem Moppel die Musik zu laut ist, muss er ja nicht direkt ’ne Riesen-Welle machen. Oder, Kumpel?«
Ich konnte nicht glauben, dass ein Einzelner so dämlich war. Wäre ich an seiner Stelle, dann wäre Mike der Letzte gewesen, bei dem ich auf Verständnis gehofft hätte. Um das zu erkennen, hätte ein Blick in sein Gesicht genügt.