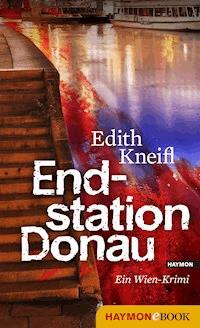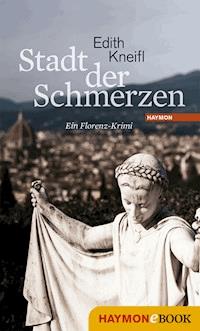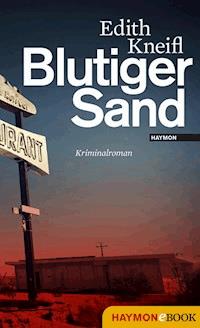18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Falter Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Tatort Kurzkrimis
- Sprache: Deutsch
Schräge, verruchte, historisch bedeutsame, gastronomisch erkundenswerte, stille wie laute, jedenfalls einzigartige Orte und Institutionen der Großstadt Wien werden in Edith Kneifls Kurzkrimis zum Tatort: das klassische Wiener Kaffeehaus ebenso wie das gemütliche Beisl, der gesellige Heurige, der puristische Würstelstand, der urbane Naschmarkt, der frivole Prater, der beschauliche Friedhof, das ehrwürdige Rathaus, das prächtige Schloss Schönbrunn, das elegante Burgtheater, die mächtige Hofburg, der nur allzumenschliche Gemeindebau und der idyllische Stadtpark. Die 13 spannenden Kriminalgeschichten zeichnen sich durch präzise Beobachtung, grandiose Milieuschilderungen und abgründige Machenschaften – gewürzt mit einer Prise schwarzen Humors – aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Edith Kneifl
Tatort Hauptstadt
13 Kriminalgeschichten aus Wien
Falter Verlag
© 2017 Falter Verlagsgesellschaft m.b.H.
1011 Wien, Marc-Aurel-Straße 9
T: +43/1/536 60-0, E: [email protected], W: www.falter.at
Alle Rechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub: 978-3-85439-598-0
ISBN Kindle: 978-3-85439-599-7
ISBN Printausgabe: 978-3-85439-594-2
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2017
Die Handlung der folgenden Kurzgeschichten ist frei erfunden. Manche Krimis sind von wahren Begebenheiten beeinflusst, trotzdem ist jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen rein zufällig.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Stadtpark ~ Walzerkönig
Rathaus ~ Hass
Prater ~ Wer erschoss den dritten Mann?
Beisl ~ Leichenschmaus
Naschmarkt ~ Diebin vom Naschmarkt
Kaffeehaus ~ The End, My Friend
Hofburg ~ Montevideo
Burgtheater ~ Festmahl
Heuriger ~ Die Cellospielerin
Schönbrunn ~ Die Altschönbrunner
Gemeindebau ~ Gloria
Würstelstand ~ Tschuschengriller
Friedhof ~ Die Donaufischerin
Autorin
Walzerkönig
Asche der Erinnerung
Aus dem Schatten sterbender Bäume taucht ein alter Mann auf. Den Blick auf den Boden gerichtet, die Hände in den ausgebeulten Manteltaschen vergraben, überquert er gemächlich die Ringstraße.
Im Kursalon, wo sich früher die vornehme Wiener Gesellschaft bei Tanzveranstaltungen und Promenadenkonzerten vergnügte, brennt kein Licht. Das Restaurant hat am Allerseelentag geschlossen. Verwaist auch die Terrasse vor dem Lokal.
Unweit des Kursalons klafft eine riesige Baugrube. Skelettartige Kräne ragen dort, wo einst das Hotel Intercontinental abends in vollem Glanz erstrahlte, in den sternenlosen Himmel.
Ein schwacher, goldener Schimmer dringt durch die Nebelglocke, die den Wiener Stadtpark umhüllt. Zwischen immergrünen Sträuchern und hohen Bäumen tut sich ein kleiner Platz auf.
Der alte Mann steuert geradewegs auf das vergoldete Denkmal von Johann Strauss Sohn zu. Ehrerbietig verbeugt er sich vor dem Walzerkönig. »Habe die Ehre, Schani«, murmelt er.
Sorgfältig wischt er dann mit einem Taschentuch die Bank vis-à-vis vom Denkmal ab, setzt sich, schlägt die Beine übereinander und zündet sich eine Zigarette an. Er genießt jeden Zug, so als rauchte er seine letzte Zigarette.
Nebelschwaden ziehen vorüber, vermischen sich mit der spärlichen Parkbeleuchtung und tauchen Johann Strauss in ein gespenstisches Licht. Ein kühler Wind wirbelt das Laub vor seinen Füßen auf und fegt den Staub über das Pflaster.
Plötzlich steht eine junge Frau vor dem Denkmal.
Der alte Mann hat nicht gesehen, aus welcher Richtung sie gekommen ist. Es scheint, als wäre sie einem finsteren Loch entstiegen. Sie ist ganz in Schwarz gekleidet, ihr Körper hebt sich kaum von der Dunkelheit ab.
Wortlos nimmt sie neben ihm auf der Parkbank Platz. »Haben Sie eine Zigarette für mich?«, fragt sie.
Der Alte reicht ihr sein Päckchen und gibt ihr Feuer.
Die Flamme erleuchtet ihre hübschen ebenmäßigen Züge. Sie sieht sehr jung aus, hat auffallend große, blaue Augen und schön geschwungene, volle Lippen. Ihre zarte, weiße Haut schimmert wie kostbares, hauchdünnes Porzellan. Unter ihrem langen, offenen Mantel trägt sie ein tiefdekolletiertes Kleid, das am Busen mit feiner Spitze besetzt ist.
Eleganz von gestern, denkt der alte Mann und schenkt ihr einen wohlwollenden Blick.
Sie raucht gierig, fast ohne die Zigarette aus dem Mund zu nehmen. Den Stummel wirft sie achtlos auf den Boden, zerquetscht ihn mit dem Absatz ihres Stöckelschuhs. Ihr burschikoses Benehmen passt nicht zu ihrem vornehmen Aussehen.
»Wie lange warten Sie hier schon auf mich?«, fragt sie. Ihre Stimme klingt verbraucht und viel zu tief für ihr Alter.
»Ich weiß es nicht, ich zähle die Stunden nicht mehr.«
Der Wind hat sich gelegt, der Nebel wird dichter, umfängt das ungleiche Paar.
Der alte Mann nimmt eine Flasche Rotwein und zwei Achtelgläser aus seinen Manteltaschen. »Das zweite Glas habe ich eigentlich für den Schani mitgebracht«, sagt er, »aber es wird ihm sicher nichts ausmachen, wenn Sie daraus trinken. Leider ist es kein Champagner.« Er blickt sie fragend an.
Sie reagiert nicht.
Er füllt die beiden Gläser mit Rebensaft, prostet Johann Strauss zu, führt das Glas an seine Lippen und nimmt einen Schluck. Dann zündet er sich eine zweite Zigarette an, das Päckchen legt er zwischen sich und das Mädchen auf die Bank.
»Bitte bedienen Sie sich.«
Sie nimmt sich eine Zigarette, bricht den Filter ab, klopft mit dem abgerissenen Ende auf ihren Handrücken.
Er gibt ihr Feuer.
Zittrige Schatten huschen über ihr Gesicht. Im warmen Schein der Flamme röten sich ihre bleichen Wangen und ihr rotblondes Haar leuchtet wie Feuer.
Mit gelangweilter Miene lehnt sie sich zurück, bläst den Rauch in die Luft, verfolgt ihn mit ihren Blicken, als wäre er ein kostbares, für immer verlorenes Geschenk.
Sie rauchen schweigend, starren in die Dunkelheit.
Er schenkt sich nach und deutet auf das nebelverhangene Gebäude vor ihnen.
»Das Restaurant im Kursalon hat heute leider geschlossen, und so habe ich mir meinen Wein selbst mitgebracht. Einst gab es hier ein berühmtes Tanzcafé. Im dazugehörigen Saal wird auch heutzutage noch manchmal getanzt oder konzertiert. Doch es ist nicht mehr wie früher, die heutige Jugend bevorzugt Events oder Clubbings, nicht wahr?«
Mit beinahe lauerndem Blick wartet er auf eine Reaktion. Aber es kommt nichts.
»In den 1960er-Jahren war das Hübner das beliebteste Tanzlokal der Stadt, beliebt vor allem bei uns jungen Leuten. Jeden Tag hat hier eine Kapelle zum Tanz aufgespielt. Lange her, das alles! Nun ja, nichts bleibt wie es ist, die ganze Umgebung des Stadtparks hat sich verändert, auch der Park selbst, die Laternen, die Wege, die Blumen und Sträucher, sogar der Mond ist anders …«
»Alles ändert sich, das Leben ist ein ständiges Kommen und Gehen.«
»Der Park hat schon vor vielen Jahren seine Unschuld verloren.« Er hält kurz inne, räuspert sich und fährt in stolzem Ton fort: »Hier habe ich mit ihr nächtelang Walzer getanzt.«
Ein verwegener Glanz legt sich über seine müden Augen, als sich sein Oberkörper sanft im Dreivierteltakt bewegt. »Der Walzer hat so etwas ungemein Sinnliches, Zartes, Verführerisches, finden Sie nicht?«
Wieder verhallt die Frage scheinbar ungehört. Gewöhnt daran, Selbstgespräche zu führen, setzt er unbeirrt fort: »Im Gras, dort hinter den Fliederbüschen …«, er deutet auf die kahlen, hohen Sträucher neben dem Strauss-Denkmal, »habe ich sie geliebt, wie ich zuvor noch keine Frau geliebt habe. Ich erinnere mich noch an den weichen, warmen Geruch ihres Körpers. Alle Mädchen haben damals so gerochen – als verwendeten sie dasselbe Parfüm ‒, doch sie roch ein wenig anders, süßlicher, femininer.«
Die Frau in Schwarz behält ihre gleichgültige Miene bei.
»Immer wenn die Nächte kälter und die Touristen weniger werden, komme ich an diesen Ort der Vergangenheit. Aber niemand ruft mich an seinen Tisch, kein Lächeln, keine süßen Blicke streifen mein Gesicht. Und doch kehre ich immer wieder hierher zurück, trinke Wein, rauche ein paar Zigaretten und schwelge in süßen Erinnerungen. Ich beobachte den Mond, der dem feuchten Rasen einen silbernen Glanz verleiht, und höre in der Ferne die wehmütigen Stimmen der Geigen.«
»Wiener Blut, eigner Saft, voller Kraft, voller Glut, Wiener Blut«, summt das Mädchen einen berühmten Strauss-Walzer.
Er überhört ihren Singsang, spricht mit heiserer Stimme weiter: »Seit über fünfzig Jahren sitze ich auf dieser Bank beim Denkmal des Walzerkönigs, der niemals fragt, was ich hier verloren habe. Hier habe ich über so manch sinnlosen Morgen geweint, hier habe ich meine letzten Jahre vertrunken und mit jedem Schluck Wein ist mir mein Elend ein wenig erträglicher erschienen.«
»Alkoholiker beenden ihr Leben zwangsläufig mit schleichendem Selbstmord.«
Die Altklugheit der jungen Frau beginnt ihm auf die Nerven zu gehen. Er schenkt sich wieder nach und füllt auch ihr Glas mit der rubinroten Flüssigkeit.
»Meine schönsten, aber auch meine traurigsten Nächte habe ich hier zu Füßen des Walzerkönigs verbracht. Er hat als Einziger Verständnis für meinen Schmerz gezeigt. Das weibliche Geschlecht hat ja auch ihm übel mitgespielt. Denken Sie nur an seine zweite Frau, die ihn so schmählich hintergangen hat. Nächtelang habe ich hier mit dem Schani den nostalgischen Klängen des Walzers gelauscht und dem Gemurmel des feinen Nieselregens zugehört, der die verlorene Zeit beweinte. Diese Bank und dieses Denkmal sprechen zu mir von Vergnügen und Leidenschaft, von Liebe und Glückseligkeit, von Gemeinheit und Falschheit, Betrug und Verrat. Sie erzählen mir immer wieder aufs Neue diese alten Geschichten.«
»Ist es nicht unsagbar traurig, nur mehr in Erinnerungen zu leben?«
»Erinnerungen beschönigen die Vergangenheit, lassen sie in neuem Licht erstrahlen.«
»Lohnt es sich denn, für falsche Erinnerungen zu leben?«
»Was heißt falsch? Links, zwei, drei, rechts, zwei, drei …, ich weiß noch alles ganz genau. Meine große Liebe hat mich nicht umsonst ‚Walzerkönig‘ genannt.«
»Der Walzerkönig ist längst tot.« Die junge Frau deutet auf das Denkmal.
»Ja, der Schani ist inzwischen zu Bronze erstarrt, aber ich bin noch recht lebendig«, sagt der Alte grinsend. Ihm fehlt einer der oberen Schneidezähne. Die Zahnlücke lässt ihn beinahe jungenhaft aussehen, wenn er lächelt. Er ist ärmlich, aber korrekt gekleidet, vielleicht sogar ein bisschen zu korrekt, um in so einer Nacht auf einer einsamen Parkbank zu sitzen. Dunkler Anzug, weißes Hemd, weinrote Fliege. Sein dunkelgrüner Lodenmantel sieht aus, als käme er gerade aus der Reinigung. Nur seine weißen, struppigen Haare, die unter der schmalen Krempe des schwarzen Hutes hervorschauen, bedürfen dringend eines Friseurs.
»Wo sind die alten, längst ergrauten Freunde geblieben? Was ist aus den vielen hübschen Mädchen geworden, die jeden Sonntag pünktlich zum Fünfuhrtee im Kursalon Hübner erschienen sind, um nach einer guten Partie Ausschau zu halten? Es scheint, als hätte ich sie alle überlebt.« Er lacht. Sein Lachen klingt nicht bitter, sondern herzlich, ja beinahe fröhlich.
»Es wird Zeit zu gehen«, sagt die junge Frau.
»Lassen Sie mich Ihnen noch von meinem letzten Walzer erzählen. Alles, was man zum letzten Mal macht, bekommt eine besondere Bedeutung, wird in der Erinnerung viel wichtiger, als es vielleicht ursprünglich war.«
Die junge Frau schüttelt den Kopf, trifft Anstalten aufzubrechen.
»So bleiben Sie doch bitte noch einen Augenblick. Rauchen wir eine letzte Zigarette zusammen?«
Zögernd greift sie nach der Schachtel, die er ihr mit flehendem Blick hinhält.
»Sie war ein besonders schönes Mädchen, etwa in Ihrem Alter und genauso attraktiv wie Sie. Ihr Gesicht hat nur aus Augen bestanden, aus wundervollen blauen Augen, in denen ich fast ertrunken wäre. Ihr rotblondes, lockiges Haar hat in weichen Wellen ihre Schultern umschmeichelt, und ihr fraulicher Körper hat sich deutlich unter ihrem enganliegenden Kleid abgezeichnet. Ein Kleid von demselben mysteriösen Blau wie ihre Augen. Heute liebe ich allein die Vorstellung, die ich mir von diesem Blau mache, die unbestimmte Ferne, den geheimnisvollen Zauber …, die Nacht war blau, der Mond, die späte Stunde …« Er schließt die Augen. »Blau würde Ihnen übrigens auch sehr gut stehen. Warum tragen Sie Schwarz? Es macht sie älter.«
»Haben Sie mir nicht von Ihrem letzten Walzer erzählen wollen«, unterbricht ihn die junge Frau unwirsch.
»Ich habe sie in die Arme genommen und wir haben einen Walzer getanzt, der nie zu enden schien. Alles um uns herum ist zur Kulisse für unseren Walzer geworden, zerflossen, im blauen Dunst der Zigaretten aufgegangen. Nachdem die Musiker ihre Instrumente eingepackt und sich wankend auf den Heimweg gemacht haben, sind wir hierher gegangen, auf diesen kleinen Platz, um dem größten österreichischen Komponisten aller Zeiten zu huldigen …«
»Wolfgang Amadeus Mozart?«
»Ich rede von Johann Strauss«, sagt er und wirft ihr einen bösen Blick zu. »Wir haben getanzt, bis sich der Nebel aufgelöst und der Morgen zu grauen begonnen hat. Der Walzer jener Nacht ist zur lebenslangen Sehnsucht für mich geworden. Die sanfte Harmonie jener vertrauten Klänge, gleich einer Hoffnung, die alles erfüllt, einem Traum, der wahr wird. Wieder und wieder möchte ich all dies erleben, möchte wiederholen, was vielleicht nicht wiederholbar ist. Wir waren das Leben, das man ahnungsvoll umarmt in einer schwarzen Nacht. Berauscht von Musik und Wein, verloren in süßer Trunkenheit, haben wir uns geliebt, so als hätten wir gewusst, dass das unsere letzte Nacht sein würde. Bei Sonnenaufgang hat sie mich für immer verlassen. Seit sie fort ist, komme ich immer wieder hierher, verbringe die Nächte allein mit dem großen Meister. Und Jahr für Jahr zu Allerseelen gedenken wir beide unserer Toten. Ich hoffe, dass auch sie eines Tages wieder hierherkommt. Und obwohl ich weiß, wie sinnlos diese Hoffnung ist, warte ich seit fünfzig Jahren. Als Sie heute aufgetaucht sind, habe ich im ersten Moment gedacht, dass sie es ist. Sie schauen ihr verblüffend ähnlich.«
Das Mädchen zieht die Brauen hoch, öffnet den Mund, will etwas sagen, doch er fährt rasch fort: »Fünfzig Jahre sind nichts. Mein fiebernder Blick irrt in die Vergangenheit, sucht die süße Erinnerung. Ich habe nach ihr nie mehr eine Frau geliebt. Der Rest meines Lebens ist ereignislos verlaufen, ein quälendes, sich unendlich in die Länge ziehendes Warten, hier, allein unter den alten Bäumen, dem ironischen Blick von Johann Strauss ausgesetzt, der meine ständige Rückkehr nur mehr mit Amüsement betrachtet. Heute, da ich ohne Liebe lebe, schätze ich die Süße und Wärme, die der Wein beschert. Zum Glück gelingt es dem Alkohol nicht, die Vergangenheit für immer in erbarmenswürdiges Vergessen zu hüllen. Aber ich fürchte die Nächte allein in meinem Bett, fürchte, meine Träume könnten getötet werden, habe Angst vor dem Vergessen, dem alles anheimfällt.«
Sie beginnt eine bekannte Melodie aus der »Fledermaus« zu summen: »Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist …«
Tränen laufen verstohlen über seine eingefallenen Wangen.
»Sie sind ein lebensmüder, sentimentaler alter Mann.«
»Aber nein, keineswegs. Ich bin heute hierhergekommen, um all ihre Küsse in den Küssen eines anderen Mundes zu tilgen, um in den Armen einer jungen Frau all die stürmischen Umarmungen von damals zu zerstreuen. Ja, ich muss nur trinken, tanzen und lieben, um das berauschende Gefühl von damals wiederzubeleben.«
Das Mädchen scheint ihm nicht mehr zuzuhören. Sie hat ihm den Rücken zugekehrt und starrt den vergoldeten Johann an.
Versonnen lächelnd betrachtet der Alte ihr langes, rotblondes Haar, das in sanften Wellen über ihre Schultern fällt.
»Ich habe Angst, sie, die Einzige, die ich je geliebt habe, wiederzusehen, Angst vor der Begegnung mit der Vergangenheit, Angst vor den dunklen, leeren Höhlen, die einst blau waren, Angst, ihre verfaulten Lippen zu küssen, ihren kahlen Schädel zu streicheln, Angst ihre vertrockneten Brüste zu liebkosen und ihren von Würmern angenagten Körper lieben zu müssen. Verfolgt vom Echo ihrer klappernden Gebeine, fühle ich keine besondere Traurigkeit mehr, noch verbittert mich die Erinnerung an jene herrliche Nacht voller Musik und dem unverwechselbaren Geruch des Flieders, noch bereue ich die Jahre, die ich vergeudet habe, ohne eine Frau, die mich liebt, allein mich aufs Bett werfend und den Tod erwartend. Alle Niederlagen scheinen mir heute nichtig und klein.«
»Nichts als Asche, die traurige Asche der Erinnerung.« Das Mädchen stand auf.
»Nein, warten Sie, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Sie ist von mir gegangen, in jener Nacht vor über fünfzig Jahren.« Er streckt der jungen Frau seine arthritischen Finger entgegen. »Mit diesen Händen habe ich sie erwürgt. Schuld waren der Wein, mein bester Freund und der verdammte Donauwalzer, den sie hier nicht mit mir getanzt hat, sondern mit ihm. Ich habe mitansehen müssen, wie sie mit diesem Verräter danach hinter den Fliederbüschen verschwunden ist. Seither hasse ich den Duft des Flieders! ‒ Zuerst hat mein falscher Freund mein Messer zu spüren bekommen. Das knirschende Geräusch, als ich es ihm zwischen die Rippen stieß, klingt noch immer in meinen Ohren. Ihr habe ich eigentlich nichts antun wollen, doch als sie zu schreien begann und nicht und nicht aufhörte, wusste ich mir nicht anders zu helfen, als sie endgültig zum Schweigen zu bringen.« Er wirft einen verlegenen Blick auf seine Hände. »Bis vor kurzem haben beide im Fundament des Hotel Intercontinental in Frieden geruht. Wie sehr habe ich sie um ihr gemeinsames kühles Grab beneidet! Aber nun werden ihre Gebeine bald ans Tageslicht kommen. Aus und vorbei ist es dann mit der ewigen Ruhe«, sagt er beinahe strahlend.
Die junge Frau schaut ihn mit ihren großen, blauen Augen prüfend an. »Auf Ihrer Stirn zeichnen so viele Winter. Ist es nicht endlich auch für Sie Zeit zu gehen?«
»Ausgerechnet heute, wo plötzlich die Vergangenheit aus dem Nebel falscher Träume auftaucht, die Erinnerungen an jenen Abend vor fünfzig Jahren noch einmal wahr werden?! Nein, ich will sie festhalten, ehe sie wieder entfliehen.«
Mit zitternder Hand greift sie nach seinem Zigarettenpäckchen, bietet auch ihm eine von seinen Zigaretten an. Sie scheint zu frieren. »Wir sollten uns beeilen, es wird kühl. ‒ Eine allerletzte Zigarette?«
Höflich bedankt sich der alte Mann.
Der Rauch der Zigaretten steigt in den schwarzblauen Himmel empor.
»Ich möchte den kümmerlichen Rest meines Lebens dem Wein und dem Walzer weihen«, sagt er, dämpft seine Zigarette aus, nimmt einen kräftigen Schluck direkt aus der Flasche und erhebt sich. Galant verbeugt er sich und fragt: »Darf ich Sie um diesen Tanz bitten, mein Fräulein?«
Sie schüttelt unwillig den Kopf.
»Nur einen kleinen Wiener Walzer? Diese letzte Bitte dürfen Sie mir nicht abschlagen.«
Er zieht seinen Mantel aus, legt ihn auf die Bank und bewegt sich rhythmisch und gelassen auf das Denkmal zu. Eine seltsame Verwandlung geht mit ihm vor. Sein müder Körper strafft sich, legt seine Schwäche ab. Aufrecht, mit eingezogenem Bauch und stolz vorgestreckter Brust, beginnt er sich langsam und elegant im Takt einer unhörbaren Melodie zu drehen. Ein arroganter Ausdruck beherrscht seine sonst so gutmütig blickenden Augen und ein selbstbewusstes Lächeln verjüngt sein trauriges Gesicht.
»Wollen Sie es nicht wenigstens versuchen? Ich werde Ihnen die Grundschritte beibringen.«
Sie steht auf und reicht ihm die Hand.
Er legt den rechten Arm um ihre Taille, zieht sie sanft an sich und flüstert ihr ins Ohr: »Schließen Sie die Augen, hören Sie einfach nur auf die Musik, besonders auf das sehnsüchtige Seufzen der Geigen. Stellen Sie sich vor, wir atmen nicht die kalte Herbstluft, sondern den berauschenden Duft des Frühlings.«
»Ein letzter Walzer«, murmelt sie, und ein kleines, spöttisches Lächeln erscheint auf ihren Lippen.
Sie tanzen einen Walzer auf dem kleinen Platz vor den Augen des großen Komponisten, geborgen im Nebel, eingehüllt in Finsternis.
In der zärtlichen Umarmung gibt er sich den vertrauten Klängen des Donauwalzers hin. Sie gehorcht dem festen Griff seiner Hände, bewegt rhythmisch ihren Körper, folgt ihm wie in Trance, fügt sich dem fordernden Druck seiner Schenkel, lässt sich treiben.
»Die Donau so blau, so blau, so blau«, summt er.
Während sie sich im Kreise drehen, blickt er ihr tief in die Augen. Seine Erregung steigt mit jeder Drehung. Zärtlich wiegt er sie in seinen Armen, beugt sich über sie und presst seine knochigen Lenden gegen ihren zarten Körper. Liebevoll streichelt er mit seiner rechten Hand ihren Rücken, berührt ihr weiches, warmes Fleisch und lässt seine Hand weiter in den tiefen Rückenausschnitt ihres langen, schwarzen Kleides wandern.
Seine Bewegungen werden schneller, immer schneller. Sekunden der Ekstase, die die Jahre der Trauer und Einsamkeit vergessen lassen. Er hebt sie hoch, lässt sie ein paar Zentimeter über dem Boden schweben.
Plötzlich spürt er die Wärme ihres Körpers nicht mehr. Trotz der heftigen Drehungen steigt Kälte in ihm auf. Das Klappern von blanken Knochen stört den Dreivierteltakt, den er in den Ohren hat. Er hat das Gefühl, ein Skelett in den Armen zu halten. Die zuckersüßen Stimmen der Geigen werden schwächer. Den Tod in den Armen, tanzt er seinen letzten Walzer, dreht sich weiter und weiter, immer weniger im Rhythmus, bis er schließlich ganz aus dem Takt kommt und ihm die Sinne schwinden. Sein Körper bäumt sich noch einmal auf, dann klappt er zusammen wie eine Marionette.
Die dicken Nebelschwaden lichten sich. Die Hochhäuser in Wien-Mitte tauchen schattenhaft aus dem Dunkel der Nacht auf. Ein herbstlicher Morgen, grau wie Asche, kündigt sich an.
Zu Füßen des Walzerkönigs liegt die Leiche eines alten Mannes, der seit fünfzig Jahren im Wiener Stadtpark Walzer tanzte.
Hass
In der Hitze der Stadt
Diese Frau muss weg. Der Mann, der dies dachte, war ein mächtiger Mann im Wiener Rathaus. Sein Wort hatte Gewicht. Gewicht gehabt. Seit eine grüne Stadträtin das Sagen in seinem Ressort hatte, fühlte sich Obersenatsrat Perkovic fast zu einem Kanzleigehilfen degradiert. Wie ein Wirbelwind war die neue Chefin durch seine Abteilung gebraust, hatte alles auf den Kopf gestellt. Die Magistratsabteilung für Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten, kurz MA 46 genannt, war seit ihrem Amtsantritt nicht mehr wiederzuerkennen. Junge, schlampig gekleidete Burschen und Mädchen mit extravaganten Frisuren, Tätowierungen und Piercings in Nasen und Ohren, stillende Mütter und jede Menge Vegetarier und Veganer tummelten sich heute in den Büros, nahmen die Plätze von seriösen Beamten ein. Plötzlich war auch Schluss mit Pünktlichkeit und Disziplin im altehrwürdigen Wiener Rathaus. Laute, schräge Musik und Gelächter schallten durch die Amtsstuben. Bei diesem Lärm konnte kein Mensch mehr ordentlich arbeiten. Die Hitze war jetzt, Ende Juni, außerdem unerträglich. Selbst die dicken alten Rathausmauern schützten die Beamten nicht vor den unmenschlichen Temperaturen. Es gehörten dringend Klimaanlagen angeschafft. Diese Energieverschwender kamen der grünen Stadträtin natürlich nicht ins Haus. Schließlich fiel ja auch der Klimaschutz in ihr Ressort. Als der Obersenatsrat vor ein paar Tagen bei ihr in dieser Causa vorstellig geworden war, hatte sie ihm einen Vortrag über die ozonabbauende Wirkung von Klimaanlagen und ihren Beitrag zur globalen Erderwärmung gehalten. Er war sich wie ein kleiner, dummer Junge vorgekommen.
Obersenatsrat Perkovic residierte in einem geräumigen Büro mit hohen Fenstern, von denen er in den Arkadenhof hinuntersehen konnte. Obwohl er wusste, dass nur heiße Luft hereinkam, öffnete er beide Fenster. Er fürchtete sonst zwischen all den Aktenbergen, die sich auf seinem Schreibtisch türmten, zu ersticken. Liebend gern flüchtete er an solch heißen Tagen in Besprechungen außer Haus. Obwohl er sich in letzter Zeit oft fragte, wieso seine Anwesenheit bei Besprechungen mit diversen Verkehrsplanern überhaupt noch erforderlich war. Er kam ohnehin kaum mehr zu Wort, seit die Jünger der Frau Stadträtin dort wild durcheinanderschrien und sich sowieso keiner mehr an das Protokoll hielt.
Als Beamter konnte er mit neunundvierzig Jahren noch nicht in Pension gehen. Wahrscheinlich hätte er sich rechtzeitig ein Rückenleiden zulegen sollen. Jetzt war es zu spät dafür. Selbst wenn er einmal im Jahr auf Kur fuhr, würde kein Arzt mehr die Invalidenpension für ihn beantragen. Außerdem wollte er gar nicht in Pension gehen. Obersenatsrat Perkovic war ein grauhaariger, großer, schlanker Mann ohne Wohlstandsbauch und Halbglatze. Viele der ledigen und vor allem die geschiedenen Mitarbeiterinnen in seinen Abteilungen machten ihm schöne Augen. Ein schlampertes Verhältnis am Arbeitsplatz kam für ihn jedoch nicht infrage. Er war ein sehr korrekter Mann. Korrumpierbare Beamte gab es genug im Wiener Rathaus, er gehörte nicht zu ihnen. Es war weniger eine Frage der Moral als seine Angst, von jemandem abhängig, jemandem verpflichtet zu sein, die ihn absolut unbestechlich machte. Er liebte seine Arbeit. Seine geschiedene Frau hatte oft behauptet, er wäre mit seinem Job verheiratet statt mit ihr. Sein libidinöses Verhältnis zu seiner Arbeit war letztendlich auch mit ein Scheidungsgrund gewesen – neben dem feschen Polizisten, mit dem sie verkehrte, während er die Verkehrsangelegenheiten der ganzen Stadt regelte. Seither litt er unter leichtem Verfolgungswahn, was in seiner Position als Obersenatsrat durchaus von Vorteil war. Er misstraute fast jedem, hielt es mit Wladimir Iljitsch Lenin: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Auch seine Abteilungsleiter hielt er dazu an, ihre Mitarbeiter streng im Auge zu behalten. Doch seit dem Amtsantritt der grünen Stadträtin geriet in der MA 46 alles mehr und mehr außer Kontrolle.
Mein Name ist Susi. Ich bin achtundzwanzig Jahre alt und arbeite als Sachbearbeiterin in der MA 46. Ich hasse Wien im Sommer. Vor allem hasse ich es, mit den Öffis fahren zu müssen. Die Ausdünstungen der mit ärmellosen T-Shirts und kurzen Hosen bekleideten Männer in Gesundheitsschlapfen und all das Testosteron, das diese erhitzten Körper verströmen, bringen mich jedes Mal fast zum Kotzen, wenn ich die U-Bahn, die Straßenbahn oder einen Autobus der Wiener Linien benützen muss. Funktionierende Klimaanlagen sind anscheinend ein Fremdwort in Wien. Ab Juni, ja manches Jahr schon ab Mai kommt man sich in den Öffis oft vor wie in einer Sauna. Wenn mir einer dieser fetten, verschwitzten Leiber zu nahe kommt, krieg ich regelmäßig die Krise. Selbst wenn mich nasse Arme nur streifen oder ich mich an einer klebrigen Stange oder einerGummischlinge anhalten muss, wird mir übel. Und wenn sich gar so ein Koloss neben mich setzt und seine dicken Schenkel an meinen zarten Körper presst, male ich mir immer aus, wie ich diesen Typen mit einer MP niedermähe, ihn mit einem Dutzend Kugeln durchlöchere und wie dann sein Blut an die Fensterscheiben spritzt und er schwer röchelnd zu Boden geht. Ich hasse Wien auch im Winter. U-Bahn-Waggons und Busse sind entweder überheizt oder es zieht drinnen wie in einem Vogelhaus. Außerdem stinkt es das ganze Jahr über in den Öffis fürchterlich nach Knoblauch und Zwiebel, weil all diese Idioten unbedingt ihre Kebabs und Hamburger während der Fahrt mampfen müssen. Ja, ich weiß, Essen beruhigt. Aber ist es denn wirklich so aufregend, mit der U-Bahn zu fahren, dass man sich mit Fett und Kohlehydraten vollstopfen muss, um sich zu beruhigen? Ich stelle mir gerne vor, wie all diese Junk-Food-Fresser an ihren fettigen, pampigen Weckerln ersticken. Wenn gar ein Fußballspiel im Hanappi- oder Happel-Stadion stattfindet, bin ich, wenn ich von meinem Büro im Rathaus mit der U-Bahn nach Hause fahre, oft einer Ohnmacht nahe. Der Bierdunst und das aggressive Gegröle dieser echten Wiener machen mir Angst. Ich wünsche den Fans jedes Mal eine Leberzirrhose oder zumindest eine Alkoholvergiftung an den Hals. Wie sehr sehne ich mich, sommers wie winters, nach der reinen, klaren Luft in meinem geliebten Waldviertel. Ich kann meinen zweiwöchigen Urlaub im August kaum mehr erwarten. Nichts wie weg aus der Hitze der Stadt!
Als Obersenatsrat in der MA 46 hatte Perkovic schon vor Jahren gemeinsam mit seinen engsten Mitarbeitern ein perfektes Verkehrskonzept für die Stadt Wien entwickelt. Zum Teil war es bereits realisiert worden. Doch seit eine rot-grüne Koalition die Hauptstadt regierte, hatte sein geniales Konzept Federn lassen müssen. Die grüne Stadträtin hatte viele seiner Ideen einfach ignoriert. Nein, nicht ignoriert, im Grunde hatte sie sein ganzes Konzept über den Haufen geworfen. Umsonst hatte er bei einem Termin mit dem Wiener Bürgermeister seine Bedenken gegen die verrückten Pläne der Vizebürgermeisterin geäußert. Sein oberster Chef hatte nur den Kopf geschüttelt. Perkovic war schwer enttäuscht. Sollte der Bürgermeister etwa gar ein Freund der Frauen sein? Nicht auszudenken! Nein, er musste dieser Ökofraktion halt irgendwelche Zugeständnisse machen. Schließlich war er auf sie angewiesen. Also lieber mehr Einnahmen aus Park-and-ride-Anlagen und der gesamten Wiener Parkraumbewirtschaftung und gleichzeitig die Fahrscheine für die öffentlichen Verkehrsmittel erhöhen, als Gratiskindergärten schließen oder höhere Mieten für Gemeindewohnungen verlangen, denn das würde ihn den Kopf kosten. Dann würde bald die Frau Vizebürgermeisterin auf seinem Sessel sitzen oder gar einer der Lieblinge der Margaretener oder Floridsdorfer Arbeiterschaft.
Obersenatsrat Perkovic kochte fast über vor Zorn, als er unverrichteter Dinge das Büro des Bürgermeisters verließ. Nach diesem unerquicklichen Gespräch versuchte er, wenigstens den mächtigen Wiener Magistratsdirektor für seine Sache zu gewinnen. Doch dieser schien sein Problem nicht für vordringlich zu halten und ließ ihn ebenfalls abblitzen.
Diese Frau muss endlich von der Bildfläche verschwinden, dachte Perkovic, als er in sein Büro, das sich neben dem der Stadträtin befand, zurückkehrte und ihr Lachen herüberhörte. Seine Fantasien machten nicht einmal vor Gewalt halt. Jemand müsste sie überfahren, wenn sie mit ihrem Fahrrad auf dem Ring unterwegs war. Dann würde ihr das Lachen schon vergehen. Fuhr die Frau Vizebürgermeister überhaupt Fahrrad? Soviel er gehört hatte, schwang sie sich gern fotogen auf ein Rad, um nach der nächsten Kurve, wenn die Fotografen außer Sichtweite waren, in ihren Dienstwagen zu steigen und sich mit 180 PS durch die Stadt chauffieren zu lassen.
In seinen schlaflosen Nächten schmiedete Obersenatsrat Perkovic alle möglichen Pläne, wie er sie am besten für immer loswerden könnte. Durch eine hübsche kleine Intrige vielleicht? Er könnte Gerüchte in die Welt setzen, behaupten, dass sie sich bestechen hatte lassen. Aber von wem? Von der Radfahrer- oder Fußgängerlobby, falls es so was überhaupt gab? Nein, völlig ausgeschlossen, das war absurd. Eine unangreifbare Politikerin – das gab es aber nicht, das wusste er aus jahrzehntelanger Erfahrung. Angefangen hatte das ganze Desaster mit der Bestellung eines Radfahrerbeauftragten. Es folgte eine Fußgängerbeauftragte. Was Absurderes hatte es in seinen Augen zwischen Paris und Moskau noch nicht gegeben. Die Parkpickerlerweiterung in die Außenbezirke war eine ihrer ebenso desaströsen Ideen wie die halbseidene Fußgängerzone in der Mariahilfer Straße … Nicht auszudenken, was sich diese Frau demnächst noch alles einfallen lassen würde!
Ich sitze im Zentrum der Macht, in der roten Hochburg Wien. Und ich sitze hier fest. Meine Verwandten sind sehr stolz darauf, dass ich einen Job in der Wiener Stadtverwaltung bekommen habe. Eine sichere Stelle, ein angemessenes Gehalt. Zwar bin ich nur eine kleine Sachbearbeiterin in der MA 46, aber immerhin bin ich demHimmel über Wien etwas näher als die normalsterbliche Bevölkerung. Und das lasse ich die Leute, die montags und donnerstags zu mir kommen, auch spüren. Montags und donnerstags haben wir von neun bis zwölf Uhr Parteienverkehr. Und dann kommen sie alle, die Unzufriedenen, die ewigen Raunzer, die Benachteiligten und geistig Zurückgebliebenen, und beschweren sich bei mir über zu schnell geschaltete Ampeln auf Fußgängerwegen, über präpotente Radfahrer, die gegen die Einbahn fahren würden, und natürlich über Autofahrer, die die Geschwindigkeitsbeschränkungen in der Stadt nicht einhielten. Viele dieser meist sehr ungustiös aussehenden Wienerinnen und Wiener schwitzen vor Erregung, weil sie es endlich bis in die heiligen Hallen des Wiener Rathauses geschafft haben, und manche riechen auch schrecklich aus dem Mund. Zum Glück befindet sich mein Schreibtisch zwischen mir und ihnen. Hin und wieder weht jedoch so eine Duftwolke aus warmem Leberkäs und billigem Deo zu mir herüber. Dann würde ich diesen braven Bürgern am liebsten sagen, dass ich, wenn ich einen Führerschein besäße, mit hundert Sachen durch die Stadt rasen und alles niedermähen würde, was mir in den Weg käme, Hunde, Kleinkinder und alte Damen. Ich hasse eben Wien und die Wiener. Und ich hasse vor allem meinen Chef, den Hammerl. Er ist ein verdammter Sklaventreiber und Kontrollfreak, ist sich nicht zu blöd, mich nach meiner Mittagspause abzupassen und mir nachzuweisen, dass ich sie um fünf Minuten überzogen habe. Ich empfahl ihm letztens, eine Stechuhr anzuschaffen. Diese Bemerkung kam nicht besonders gut an. Er verbat sich solche Frechheiten. Ich habe keine Angst vor ihm. Mein Onkel aus Simmering sitzt im Gemeinderat. Er hat mir diesen sicheren Job auf Bitten meiner Großmutter, die seine Mutter ist, verschafft. Ich sollte ihm eigentlich dankbar dafür sein, bin es aber nicht. Ich hasse meine Arbeit. Langweile mich fast zu Tode. Sachbearbeiterin –was ist das bloß für ein Beruf? Straßenbahn- oder U-Bahn-Fahrerin wäre ich gern geworden. Das haben mir jedoch meine Großeltern nicht erlaubt oder nicht zugetraut. Meine Eltern sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, als ich klein war, daher bin ich bei meinen Großeltern am Land aufgewachsen.
Seit der Wiener Bürgermeister, der ja im Grunde auch ein Bürgerlicher ist und sich wahrscheinlich deshalb so gut mit diesen ehrgeizigen, erfolgsorientierten Grünen versteht, einer Frau das Verkehrsressort überlassen hat, rücken wir dem absoluten Verkehrschaos näher und näher, dachte Obersenatsrat Perkovic, wagte es aber nicht, dies laut zu sagen. In seinen Abteilungen kursierten jede Menge Witze über Frauen und Verkehr. Leise, hinter vorgehaltener Hand, wurden sie von Mann zu Mann weitergegeben. Schließlich wollte keiner seiner Beamten riskieren, wegen sexistischer Äußerungen rauszufliegen. So wie gerade der arme Hammerl. Er hatte es bis zum Abteilungsleiter gebracht, war jedoch zuletzt über eine kleine graue Maus gestolpert. Diese Tussi hatte sich über ihn beschwert, war zur Frauenbeauftragten und auch zur Gleichbehandlungsbeauftragten gepilgert und hatte den Hammerl angeschwärzt. Angeblich hatte er ihr auf den kaum vorhandenen Hintern gegriffen und sie vor ihren Kolleginnen lächerlich gemacht. Die Damen von der Gleichbehandlungskommission und die Frauenbeauftragte bezeichneten seine harmlosen Witze als Mobbing. Und schon wurde dieser verdienstvolle Beamte in Frühpension geschickt. Dabei ist er nur ein Jahr älter als ich, also gerade erst fünfzig, dachte der Obersenatsrat.
Der Hammerl war kein schlechter Beamter gewesen, immer korrekt und sehr genau. Er war bestimmt auch kein Frauenfeind, hatte er doch eine ausgesprochen nette Frau zu Hause, die sich um die beiden Kinder kümmerte und ihm ein nettes Heim bereitete. Perkovic hatte den Hammerl so manches Mal um seine intakte Familie beneidet. Vor allem abends nach Dienstschluss, wenn er in seine große, leere Gemeindewohnung nach Ottakring hinausgefahren war. Auf ihn wartete schon seit vielen Jahren keiner mehr zu Hause. Genau gesagt, seit zehn Jahren und drei Monaten. Damals war ihm seine Frau mit einem kleinen Polizisten davongelaufen. Das musste man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Er war bereits Senatsrat gewesen und sie ließ ihn wegen eines Würstls von Revierinspektor sitzen. Nach vierzehnjähriger Ehe einfach so abhauen? Er konnte es bis heute nicht verstehen.
Seine neue Chefin erinnerte ihn ein bisschen an seine Exfrau. Rein äußerlich. Auch sie war schlank, dunkelhaarig und hatte wunderschöne Augen. Damit war die Ähnlichkeit zwischen den beiden jedoch schon wieder vorbei. Seine Ex war eine Schlampe. Die Frau Stadträtin eine Wölfin im Schafspelz. Eine radikale Feministin. Es hätte ihn nicht gewundert, wenn sie früher mal bei Greenpeace gewesen wäre. Er hatte ihre Vergangenheit gründlich durchleuchtet, aber leider nichts, absolut nichts gefunden, was er politisch gegen sie hätte verwenden können.
Offensichtlich war er der Einzige im ganzen Rathaus, der sie durchschaute. Denn sonst schien sie bei allen sehr beliebt zu sein, selbst bei den einfacheren Gemütern. Auch ihre politischen Gegner schmeichelten ihr und machten ihr manchmal sogar Komplimente.
Seit seine Genossen eine Koalition mit den Grünen eingegangen waren, verstand Petrovic die Welt nicht mehr. Kapierten diese Idioten denn nicht, dass die Bürgerlichen im grünen Janker die sozialdemokratische Bewegung unterwanderten? Nicht die Ultrarechten oder die Christlich-Konservativen waren die gefährlichsten Feinde der Sozialdemokratie, sondern diese sich links und sozial gebenden Bourgeoises, die meist aus den Nobelbezirken Wiens stammten. Andererseits war es auch kein Wunder, dass sich die Toskana-Fraktion der Wiener Roten so gut mit den grün angehauchten Bobos verstand. Waren sie doch alle Gourmets und liebten teure Weine. Perkovic fühlte sich zeitweise als letzter Vertreter der Interessen der Arbeiterklasse inmitten dieser ganzen bürgerlichen Mischpoche, die heute im Wiener Rathaus den Ton angab.
Den Hammerl bin ich unlängst auf elegante Art und Weise losgeworden. Meine oberste Chefin ist eine Frau und eine Grüne. Ich interessiere mich nicht für Politik und schon gar nicht für Politiker oder Politikerinnen. Angeblich habe ich es jedoch ihr zu verdanken, dass die Sache mit dem Hammerl so glatt über die Bühne gegangen ist. Ich sehe das umgekehrt: Sie kann froh sein, dass ich ihr durch meine Beschwerde einen triftigen Grund gegeben habe, diesen Tachinierer, der die Stadt nur viel Geld gekostet hat, zu entfernen. Ich habe mich in dieser Sache übrigens nicht direkt an die Frau Stadträtin gewandt. Denn sie ist ohnehin kaum in ihrem Büro anzutreffen, rast von einem Termin zum anderen, so wie halt alle Politiker. Ich bin mit meinem Problem zu der Frauenbeauftragten,habe ihr gesagt, dass mich mein Chef mobbt und sexuell belästigt und dass ich furchtbare Angst vor ihm habe. Deswegen kam es auch zu keiner Gegenüberstellung oder Aussprache. Mediation, glaube ich, nennt man das, habe ich abgelehnt. Tja, der Hammerl ist seit einer Woche in Pension. Unser Amtsdiener, der Typ, der uns morgens die Post und die Akten bringt, hat meine Aussage bestätigt und zu Protokoll gegeben, dass er mitangesehen habe, wie mir der Hammerl auf den Hintern geklopft hat, als ich beim Kopierer stand. Seither bin ich etwas freundlicher zu dem Mann, grüße ihn, wenn er das Büro betritt, und frage ihn sogar hin und wieder, ob er einen Kaffee möchte. Wir haben eine ganz tolle Kaffeemaschine in unserem Zimmer, sind berühmt für den besten Kaffee im ganzen Haus. Ich sage nur George Clooney. Sie wissen schon, welchen Kaffee ich meine, oder? Sogar unser oberster Chef, der Herr Obersenatsrat Perkovic, kommt manchmal auf einen Espresso zu uns. Er hat übrigens versucht, den Hammerl zu halten. Zum Glück hat er gegen die Frau Vizebürgermeister keine Chance gehabt. Es weht jetzt eben ein frischer Wind bei uns in der MA 46. Trotzdem bin ich nicht ganz zufrieden mit dieser Lösung meines Problems. Allein die Vorstellung, dass dieser Mensch jetzt bei fast achtzig oder auch nur siebzig Prozent seiner Bezüge zu Hause Däumchen drehen darf, macht mich wütend. Aber ich lasse mir nichts anmerken.
Wir sitzen zu dritt in einem Zimmer. Meine beiden Kolleginnen kann ich nicht ausstehen. Wann immer sie im Chor »Mahlzeit« rufen, wenn ich in der Mittagspause das Büro verlasse, würde ich ihnen am liebsten ihre von zu Hause mitgebrachten Rohkostsalate und Smoothie-Flascherln ins Maul stopfen. Sie quatschen ununterbrochen, leiden beide unter Sprechdurchfall. Stundenlang reden sie übers Essen und Abnehmen. Dabei ist nur eine von ihnen wirklich dick,