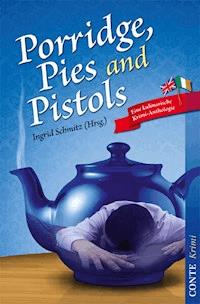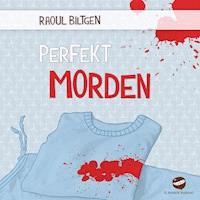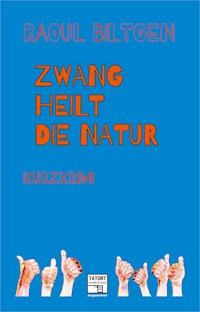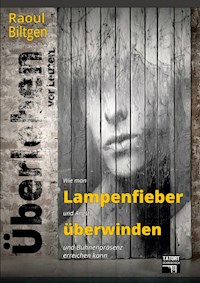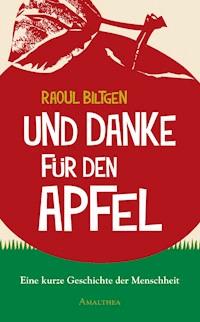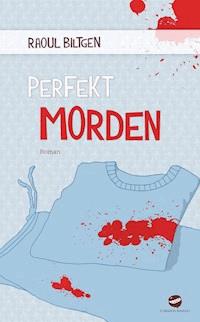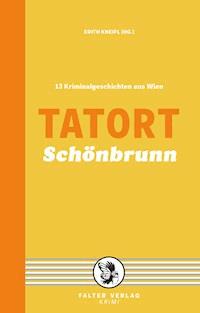
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Falter Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
„Kennen Sie Schönbrunn?“, fragt Edith Kneifl, Psychoanalytikerin, Autorin und Herausgeberin von Tatort Schönbrunn. Ungeachtet dessen, ob Sie die Frage mit Ja oder Nein beantworten, werden Sie bei der Lektüre des vorliegenden Bandes Schönbrunn kennenlernen – allerdings von einer Seite, die etwas überraschen mag, einer kriminellen, mörderischen Seite. Schönbrunn gehört heute zu den touristischen Hotspots der Metropole Wien und ist einer der Fixpunkte für jeden Wien-Besucher Diesen geschichtsträchtigen und einzigartigen Ort haben Edith Kneifl und zwölf weitere österreichische Krimiautorinnen und -autoren zum Schauplatz ihrer Kurzkrimis gemacht. Ob Dachböden, Geheimgänge, Dienstbotenwohnungen, Palmen- oder Wüstenhaus, die ehemaligen Stallungen, Rosengarten oder die Wiesen und Alleen im Park, alles wird zur Bühne für ihre packenden Kriminalgeschichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Edith Kneifl (Hg.)
Tatort Schönbrunn
13 Kriminalgeschichten aus Wien
Falter Verlag
© 2014 Falter Verlagsgesellschaft m.b.H.
1011 Wien, Marc-Aurel-Straße 9
T: +43/1/53660-0, E: [email protected], W: www.falter.at
Alle Rechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub: 978-3-85439-540-9
ISBN Kindle: 978-3-85439-550-8
ISBN Printausgabe: 978-3-85439-515-7
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2016
Die Handlung der folgenden Kurzgeschichten ist frei erfunden.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist rein zufällig.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorwort ~ Edith Kneifl
Wir sind barock! ~ Inge Podbrecky
Edith Kneifl ~ Die Altschönbrunner
Andreas Gruber ~ Katzenaugen
Beatrix Kramlovsky ~ Ars Moriendi
Peter Wehle ~ Das klinget so tödlich
Anni Bürkl ~ Prinzentode
Franz Zeller ~ Diebsgesindel
Nora Miedler ~ Des ewige Bummerl
Edwin Haberfellner ~ Ruinös
Clementine Skorpil ~ Pilzgeflecht
Günter Neuwirth ~ Der Dachschaden
Petra Hartlieb ~ Wer einmal lügt
Raoul Biltgen ~ Friedbert und der Feuerpott
Jacqueline Gillespie ~ Ein Mann von Ehre
Herausgeberin, Autorinnen und Autoren
Fußnoten
Vorwort
Draußen im Schönbrunnerpark
Sitzt ein alter Herr
Sorgenschwer
Gibt in aller Hergottsfrüh’
Schon für unser Wohl sich Müh’
»Anno 14« von Fritz Grünbaum (Text) und Ralph Bernatzky (Musik)
Kennen Sie Schönbrunn? Natürlich kennen Sie dieses Wahrzeichen von Wien. Aber waren Sie schon einmal im Schloss selbst? Haben Sie die Prunkräume der Habsburger je betreten? Oder gehören Sie zu jenen, die zwar Versailles, Sanssouci, die Eremitage, den Winterpalast der russischen Zaren und so manch andere hochherrschaftliche Residenz besichtigt haben, aber Schönbrunn lieber den Touristen aus aller Welt überlassen?
Mit der Anthologie »Tatort Schönbrunn« möchte ich Sie jedenfalls auf einen Spaziergang der besonderen Art durch das Machtzentrum der ehemaligen Donaumonarchie einladen: auf einen mörderischen. Das Erscheinungsjahr 2014 ist mit Bedacht gewählt. Begann doch vor genau hundert Jahren mit dem Ersten Weltkrieg der Untergang der österreichisch-ungarischen Monarchie, der uns Österreichern bis heute zu schaffen macht.
Sein heutiges Aussehen verdankt das ehemalige Jagdschlösschen im kaiserlichen Lust- und Tiergarten vor den Toren Wiens vor allem Maria Theresia. Die gebärfreudige Kaiserin brauchte dringend Platz für ihre zahlreichen Sprösslinge und den damit wachsenden Hofstaat. In enormem Tempo ließ sie daher das kleine »Jagd- und Lustschloss« erweitern und komfortabler einrichten. Verständlicherweise wollte sie die Fertigstellung noch erleben. Repräsentationsbauten des Barock dienten eben in erster Linie der Verherrlichung der Monarchen.
Ich lud zwölf renommierte österreichische Kriminalschriftstellerinnen und -schriftsteller ein, sich fernab von Habsburger-Nostalgie und Sisi-Romantik der Machtzentrale des »Hauses Österreich« als Tatort zu bedienen.
Auffallen wird Ihnen vielleicht, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen den wunderschönen Park oder den weltberühmten Tiergarten als Schauplatz für ihre Kriminalgeschichten wählten. Vielleicht fanden sie diese Orte inspirierender als den Barockpalast? Oder war es eine Frage des Respekts?
Einige richteten ihr Interesse auf die eher unbekannten, nicht öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten, z.B. den Dachboden oder die geheimen Stiegenaufgänge und Dienstbotenwohnungen des Schlosses. Andere wiederum ließen ihre Täter auf der Gloriette, im Palmenhaus oder in den ehemaligen Stallungen ihr Unwesen treiben.
Das Böse ist immer und überall, lauert hinter den schönbrunnergelben Fassaden des »goldenen Käfigs« genauso wie hinter einem Gebüsch oder Brunnen im wahrhaft kaiserlichen Park.
Viel Vergnügen mit diesen witzigen, aufregenden und mysteriösen Kriminalgeschichten über das prächtigste Symbol der k.u.k. Monarchie aus den Federn, oder besser gesagt PCs, von prominenten österreichischen Kriminalschriftstellerinnen und -schriftstellern wünscht Ihnen
die Herausgeberin Edith Kneifl
Inge Podbrecky
Wir sind barock!
Stil als Identitätsmerkmal
»Schönbrunn!«, seufzen Wienerin und Wiener, denn das einstige kaiserliche Prunkschloss zählt nicht gerade zu den bevorzugten Locations der Ortsansässigen. Schönbrunn bedeutet hier erst einmal den über Gebühr strapazierten und touristisch ausgeschlachteten Habsburgermythos: die rundliche Kaiserin Maria Theresia im Reifrock, im Kreis ihrer sechzehnköpfigen Kinderschar, Kaiser Franz Joseph, der Erste Beamte seines Landes, hier geboren und gestorben, und seine extravagante und depressive Frau, die Kaiserin Sisi. Viele Klischees verstellen bis heute den Blick auf Schönbrunn, viele davon im habsburgersüchtigen Austrofaschismus der 1930er-Jahre kreiert. Einen beträchtlichen Beitrag haben aber auch einige Filmproduktionen der 1950er-Jahre geleistet, wie »Maria Theresia« mit Paula Wessely (1952) und die »Sissi«-Trilogie (1955), die an Romy Schneider kleben blieb wie die Reste eines allzu süßen Desserts. Aber immerhin hat auch James Bond in Schönbrunn sein Unwesen getrieben (in »Hauch des Todes«, 1987), und auch Marianne Faithfull hat einmal die Kaiserin Maria Theresia verkörpert; das war in Sofia Coppolas »Marie Antoinette« von 2006.
Ein weiterer Grund, das Schloss zu meiden, sind für viele Einheimische die Großveranstaltungen der letzten Jahre: Mega-Freiluftkonzerte, nicht selten grimmig verregnet, Christkindlmarkt, Salon- und Schlossorchester spielen auf, natürlich Mozart, der in Schönbrunn 1762 der Kaiserin vorgespielt hat. »Der Wolferl ist der Kaiserin auf den Schoß gesprungen, hat sie um den Hals bekommen und rechtschaffen abgeküsst«, meldete der stolze Vater Leopold Mozart nach Salzburg. Kein Wiener Kind, vielleicht auch kein österreichisches Kind, das nicht an wenigstens einem Schulausflug durch die Große Galerie und hinauf zur Gloriette geschleppt worden wäre. Nicht grundlos allerdings – Kunst und Architektur sind vom Feinsten. Das riesige Schloss mit seinen über dreihundert Räumen steht schließlich auch für das Barock, den traditionellen österreichischen Identifikationsstil, repräsentiert er doch eine Epoche des Erfolgs, des Aufschwungs und der Prosperität im 18. Jahrhundert. Nicht umsonst bezieht ein Farbton in Goldocker seine Bezeichnung von Schloss Schönbrunn: Seinem Vorbild folgend wurden in Österreich-Ungarn staatliche Gebäude zwischen Bregenz und Czernowitz in Schönbrunnergelb gefärbelt, einem Farbton, für den die chemische Verbindung FeO(OH) verantwortlich ist. In Schönbrunn waren die besten Künstler ihrer Epochen beschäftigt: die Architekten Johann Bernhard Fischer von Erlach, Nikolaus Pacassi, Isidor Canevale, Ferdinand von Hohenberg und Johann Aman, der Gartenkünstler Jean Trehet, die Maler Sebastiano Ricci, Daniel Gran, Johann Wenzel Bergl, die Bildhauer Moll, Bayer, Schletterer und Hagenauer und viele andere mehr.
Aber Schönbrunn ist nicht nur das Riesenschloss der Habsburger, das die Republik Österreich übernahm, als das Vermögen der Familie mit den sogenannten Habsburgergesetzen von 1919 konfisziert wurde. Schönbrunn ist auch ein großes Parkareal, das viel mehr zu bieten hat als österreichische Klischees: Hier liegt der älteste noch betriebene Tiergarten Europas (und einer der besten); das Schönbrunner Bad, ein Freibad mit 50-Meter-Becken, profitiert von der Lage im Wald am Ostrand des Parks; ein putziges Rokokotheater wird noch immer bespielt. Kuriosa wie die Spielhütte des kleinen Kronprinzen Rudolf machen neugierig, in der Orangerie halten die Bundesgärten alljährlich ihre fantastische Zitrus-Schau ab, die Variationen der Laufstrecken im Park sind nahezu endlos, und die Eichhörnchen im Park sind so zutraulich wie sonst nirgends in Wien. Man sieht schon, die Einheimischen sind hin- und hergerissen: Einerseits nerven die Schönbrunn-Klischees durch ihre endlose Permanenz, andererseits ist man doch ein bisschen stolz auf diesen einstigen Mittelpunkt Zentraleuropas, und hin und wieder kommt man doch vorbei, denn der Park ist über die U-Bahn-Stationen Schönbrunn und Hietzing gut angebunden. Übrigens erhielt Kaiser Franz Joseph eine eigene Stadtbahn-Station zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Otto Wagner entwarf 1899 den prächtigen secessionistischen »Pavillon des k.u.k. Allerhöchsten Hofes« vor der äußeren Ostfassade der Schlossanlage. Der Kaiser hat ihn allerdings nur zwei Mal benützt.
Park und Schloss Schönbrunn gehören zu dem »kulturhistorisch und künstlerisch bedeutendsten Anlagen dieser Art in Europa«, liest man im Inventar der Kunstdenkmäler, und steht man einmal im imperialen Ehrenhof, ist man durchaus beeindruckt und einverstanden mit dem UNESCO-Welterbe-Status. Die Geschichte von Schönbrunn beginnt aber schon lange vor der heute dominanten barocken Phase. 1569 hat Kaiser Maximilian das Terrain der damals so genannten Katterburg gekauft. Hier stand ein Anwesen mit einer Mühle, das der Kaiser um eine Menagerie erweitern ließ. Vor 1619 soll Kaiser Matthias auf dem Gelände eine Quelle entdeckt haben, die bis heute am Ende des großen Ostparterres in einer barocken Fassung mitsamt Quellnymphe besteht. 1638 wählte Eleonora Gonzaga, Witwe Kaiser FerdinandsII., Schönbrunn als Wohnsitz. Aber erst für Kaiser Leopold entwarf Johann Bernhard Fischer von Erlach, einer der bedeutendsten Architekten seiner Zeit, um 1688 ein großes Prunkschloss als Symbol imperialer Ideologie, ein Projekt, das in einer zweiten Phase auf die immer noch beeindruckenden heutigen Dimensionen reduziert wurde. Um 1700 war das Hauptgebäude fertig. Vierzig Jahre später fand Kaiserin Maria Theresia Gefallen an Schönbrunn und beschloss, dort und nicht in der Hofburg ständig zu residieren. Dafür ließ sie einige Umbauten von Nikolaus Pacassi vornehmen; u.a. wurden nach dem Vorbild von Versailles auch hier in der Beletage des Ehrenhofs zwei prachtvolle Galerien als Festsäle eingebaut. Die kaiserliche Familie bewohnte damals den Westflügel. Der Mode des 18. Jahrhunderts entsprechend gab es hier neben den weiß-goldenen Rokoko-Ausstattungen auch Zimmer mit asiatischem Flair. Im Erdgeschoß liegen zum Garten hin die kühlen »Berglzimmer«, benannt nach dem Maler, der sie mit illusionistischen Pflanzen- und Landschaftsbildern ausstattete. Von hier ist es nicht weit zum Park: Hinter dem Schloss befindet sich das große Parterre mit dem grandiosen Neptunbrunnen, dahinter die 1775 erbaute Gloriette, eine klassizistische Struktur am oberen Ende des Parks, die trotz imposanter Größe wegen ihrer Offenheit kaum praktisch zu verwenden war, sondern nur der Repräsentation diente. Wer sich den Anstieg antut, wird mit einer großartigen Aussicht belohnt – unter anderem auf dem »Limoniberg«, benannt nach der zitronenartigen Kuppel der Kirche, die Otto Wagner am Steinhof erbaut hat.
Die Arbeit am Park war ebenfalls unter Kaiserin Maria Theresia in Gang gekommen. Jean Trehet legte einen großen französischen Garten mit geometrischen Beeten, Brunnen, exakt beschnittenen Bäumen und mythologischen Figuren an, in dessen langen Alleen man nicht überrascht wäre, eleganten Damen und Herren mit Perücken, Reifrock und Dreispitz zu begegnen. Schnurgerade Wege, die von Rondellen ausgehen, kanalisieren den Blick und finden ihren Abschluss in Brunnen und Skulpturen (so verläuft man sich nicht so leicht!). Einer späteren Bauphase unter Ferdinand Hohenberg (1770/80) verdankt der Park seine romantischen Akzente: Die Begeisterung der Epoche für römische und ägyptische Altertümer ließ künstliche Ruinen in Mode kommen. Der Obelisk, auf vier Schildkröten ruhend, trägt Pseudohieroglyphen, und die Römische Ruine scheint halbverfallen im Boden zu versinken. Hohenberg hat hier Bauteile aus dem unvollendeten Renaissanceschloss Neugebäude in Simmering weiter verwendet. Vielleicht hat er sich dazu von englischen Ruinenstücken anregen lassen.
Das kaiserliche Schloss erlebte eine aufregende Zeit, als 1805, nach der Einnahme Wiens, Napoleon Quartier in Schönbrunn bezog. Hier wurde 1809 der Friede von Schönbrunn zwischen Österreich und Frankreich unterzeichnet, der Österreich empfindliche Gebietsverluste bescherte. In Napoleons Räumen starb 1832 sein Sohn, der Herzog von Reichstadt, dessen Mutter Marie Luise eine Tochter Kaiser Franz’ II. gewesen war. Kaiser Franz Joseph amtierte am Ende seiner langen Regierungszeit in Schönbrunn – günstig für ihn, denn seine Freundin und Vertraute Katharina Schratt bewohnte ganz in der Nähe, nämlich in der Gloriettegasse, ein komfortable Villa. Karl, der letzte Kaiser, unterzeichnete in Schönbrunn am 10. November 1918 die Verzichtserklärung auf den Thron, bevor er das Land verließ.
Zu beiden Seiten des Schlosses liegen ausgedehnte Gebäude für das, was man Infrastruktur nennt: an der östlichen Meidlinger Seite eine große Orangerie, Glashäuser und Gärtnereien, im Westen, gegen Hietzing zu, die Wagenburg und der Reitstalltrakt, alles den Blicken entzogen durch lange, niedrige Seitenflügel, in denen bis heute nicht nur Magazine und Betriebe, sondern auch Wohnungen bestehen. Bereits 1919, im Jahr der Habsburgergesetze, hatten revolutionäre Arbeiterräte das Gartendirektorsstöckl beim Hietzinger Tor besetzt, und bald darauf wurden in den Gebäuden auf dem Areal Kriegsinvalide und pensionierte Staatsdiener untergebracht. Heute sind die Schönbrunner Wohnungen recht begehrt. Verwaltet wird der Park übrigens von den Österreichischen Bundesgärten, die hier historisch und botanisch wichtige Pflanzensammlungen und Schauhäuser wie Wüstenhaus und Palmenhaus betreiben und betreuen.
Der Glanz der kaiserlichen Residenz strahlte aus – weniger in das proletarische Meidling im Osten als nach Hietzing, den westlich angrenzenden Stadtteil. Dort etablierte sich seit dem 19. Jahrhundert eine wohlhabende Gesellschaftsschicht, die das Wohnen am prestigeträchtigen Stadtrand zu schätzen wusste. Daher hat sich in Hietzung eine beachtliche Anzahl schöner Wohnhäuser und Villen angesammelt, etwa die von Josef Hoffmann entworfene Villa Primavesi oder die Villa Schopp in der Gloriettegasse, aber auch einige Wohnhäuser von Adolf Loos. Vielleicht auch über Hietzing mag sich das sogenannte »Schönbrunner Deutsch« ausgebreitet haben, ein Soziolekt, der sich durch einen deutlich nasalen Tonfall auszeichnet und das vom Kaiserhof über den Adel ins Großbürgertum einsickerte. Dann und wann soll es sich angeblich noch in Hietzing oder Döbling Gehör verschaffen. Eigenartigerweise keinen Niederschlag gefunden hat Schönbrunn allerdings im Kulinarischen. Die Herausforderung einer Kreation von Schönbrunner Schnitzel, Nockerln, Knödeln und Ähnlichem wurde bisher von der lokalen Gastronomie noch nicht angenommen. Der »Schönbrunner Kaiserschmarrn«, der vor Ort angeboten wird, ist ein ganz gewöhnlicher Kaiserschmarrn.
Inge Podbrecky ist Kunsthistorikerin (Dr. phil.) mit Schwerpunkt Architekturgeschichte und -theorie des 19. und 20. Jahrhunderts. Für die Reihe Falters CITY-WALKS verfasste sie die Bände »Rotes Wien«, »Wiener Interieurs« und »Wiener Jugendstil«.
Edith Kneifl
Die Altschönbrunner
Eine noble Adresse
Ja, Mama, ich hasse die Touristen, die täglich unser geliebtes Schönbrunn stürmen, ebenso wie du. Habe ich dir bereits erzählt, dass gestern Amerikaner in der Schlosskapelle geheiratet haben und in einer Suite im Schloss die Hochzeitsnacht verbringen werden?
Ich weiß, die Amerikaner waren Schuld an Papas Tod. Aber bitte beruhige dich wieder, Mama. Wenn du dich weiterhin so aufregst, werde ich dir nichts mehr erzählen.
Ich habe dir von dieser Hotelsuite im Schloss sicher bereits berichtet. Doch, habe ich, Mama. Kann es sein, dass du in letzter Zeit etwas vergesslich geworden bist?
Ich werde nicht frech, verehrte Frau Mama. Das würde ich niemals wagen.
Was hast du gesagt? Ich soll nicht zulassen, dass diese neureichen Amerikaner die hochherrschaftlichen Räume beschmutzen?
Was soll ich dagegen unternehmen?
Und da war sie wieder, diese unerträgliche weinerliche Stimme, die ihm sagte, was er zu tun hatte.
Nein, das meinst du nicht im Ernst, Mama. Ich kann doch nicht einfach jemanden umbringen!
Natürlich hast du Recht, Mama. Die Betriebsgesellschaft ist an allem schuld, denen geht es nur ums Geld.
Es war ein schwüler Sommerabend Ende August. Josef marschierte hinauf in den Tirolergarten.
Mit dem ehemaligen Tirolerhof, den Erzherzog Johann westlich der Gloriette errichten hatte lassen, verknüpfte er höchst romantische Erinnerungen. Längst war der alte Tirolerhof durch einen Neubau in alpinem Stil ersetzt worden. Auch ein original Tiroler Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert war nach Wien transferiert worden. Auf diesem Schaubauernhof konnte man vom Aussterben bedrohte Haustierrassen bewundern. Es sah richtig ländlich aus hier oben.
Um diese späte Stunde waren keine lästigen Touristen mehr im Wirtshaus, sondern fast nur sogenannte »Altschönbrunner«. Josef nickte dem einen oder anderen Nachbarn zu, nahm allein an einem Tisch im Gastgarten Platz und bestellte ein großes Bier.
Die »Altschönbrunner« bildeten eine eingeschworene Gemeinschaft. Sie hielten bewusst Abstand zu den neuen Bewohnern und den Organisationen, die sich in den letzten Jahren im und ums Schloss angesiedelt hatten.
Der erste Schluck von dem kühlen Nass blieb Josef in der Kehle stecken. Keine drei Tische weiter saß, mit dem Rücken zu ihm, der kleine Mann, der ihm seine geliebte Werkstatt weggenommen hatte. Wenn das kein Wink des Schicksals war? Sein Gesicht rötete sich vor Zorn.
Seine schlaue Großmama hatte ihm einst eine Werkstatt im Hietzinger Viereckl besorgt. Oma Edeltraud hatte Gott und die Welt gekannt und vor allem hatte sie einen guten Draht zur Schlosshauptmannschaft gehabt, die früher die Wohnungen vergeben hatte.
Die Parterrewohnung hatte aus zwei geschickt angelegten Zimmern bestanden. Im hinteren Raum hatte Josef seine Werkstatt, im vorderen sein Büro gehabt. Er hatte seinen Beruf geliebt und sich nicht über mangelnde Kundschaft beklagen können. Allerlei berühmte Leute aus der besseren Gesellschaft und viele passionierte Jäger hatten zu seinen Stammkunden gezählt.
Josef hatte den seltenen Beruf eines Tierpräparators gelernt. Seine Großmutter hatte behauptet, er hätte äußerst geschickte Hände, und ein Handwerk wäre eben Goldes wert. Über seinen Verstand hatte sie sich weniger positiv geäußert. Allerdings nie ihm gegenüber, sondern nur gegenüber seiner Frau Mama, der sie ebenfalls unterstellte, über ein Spatzenhirn zu verfügen. Josef war bewusst, dass er nicht der Schlaueste war. Deshalb hatte er auch immer getan, was seine Großmama und später seine Frau Mama ihm befohlen hatten.
Über dreißig Jahre lang war er in seiner Werkstatt glücklich oder zumindest zufrieden gewesen. Vor nunmehr fast fünf Jahren hatte dieser kleine Mann mit der Halbglatze, der zum oberen Management der Betriebsgesellschaft gehörte, verhindert, dass sein Mietvertrag verlängert wurde. Josef konnte plötzlich an nichts anderes mehr denken. Er erinnerte sich nur allzu gut an diese schlimmste Zeit seines Lebens. Nicht einmal nach dem Tod seiner Großmutter hatte er sich so elend gefühlt wie nach dem verlorenen Prozess gegen die Schönbrunner Kultur- und Betriebsgesellschaft. Er hatte damals sogar daran gedacht, sich das Leben zu nehmen. Selbst seine egoistische Frau Mama hatte eingesehen, dass sie etwas unternehmen musste. Schweren Herzens erlaubte sie ihrem Sohn, seine Werkstatt in dem fünfzig Quadratmeter großen Gang ihrer Wohnung einzurichten. Sie hasste diese scheußlichen toten Tiere, an denen er so hing, und erlaubte Josef nur, einige wenige Meisterstücke in dem fensterlosen Raum auszustellen: einen Fuchs, einen Steinbock, eine Ratte, den Kopf eines Rehs und einen Seeadler. Die anderen ausgestopften Tiere hatte er nicht, wie versprochen, entsorgt, sondern im Keller, den seine Mama ohnehin nie betrat, aufgehoben. Dort unten hatten es seine Lieblinge angenehm kühl. Zu Kaisers Zeiten hatte man in den Kellerräumen von Schloss Schönbrunn sogar Eisblöcke, die aus dem Teich vor der Gloriette stammten, gelagert.
Josef hatte seither ständig Angst, auch die große Wohnung zu verlieren, wenn seine Mutter eines Tages sterben würde. Zwar war er bei ihr gemeldet, aber er befürchtete, das würde nicht ausreichen, war er doch in seiner Werkstatt ebenfalls ordentlich angemeldet gewesen.
Sein Anwalt hatte ihn bereits gewarnt. Er dürfe kein Gewerbe in der Wohnung seiner Mutter betreiben. Das sei ein Kündigungsgrund. Doch Josef nahm hin und wieder auch heute noch Aufträge von früheren Kunden an. Seit dem verlorenen Prozess misstraute er seinem Anwalt. Vermutete, dass er mit der Betriebsgesellschaft unter einer Decke steckte.
Als der Manager aufstand, verlor er beinahe das Gleichgewicht. Lehnte aber die Hilfe des Kellners ab. Wankend trat er den Heimweg an. Josef zahlte rasch und folgte ihm.
Der Mond versteckte sich hinter den Wolken. Josef konnte kaum sehen, wohin er trat. Aber die Wege im Schlosspark fand er auch im Dunkeln.
Der Betrunkene torkelte den Schönbrunnerberg hinunter. Geriet manches Mal ins Rutschen. Fing sich jedoch immer wieder.
Josef hielt gehörigen Abstand. Er wusste, wohin der andere wollte.
Dieser Mann hatte Josefs ehemalige Werkstatt mit der benachbarten Kleinwohnung zusammengelegt und bewohnte nun hundert Quadratmeter im Hietzinger Viereckl.
Heftiger Wind kam auf. Als die ersten Tropfen fielen, flüchtete sich Josef unter die hohen Bäume am Rande des Tiergartens. Die dichten alten Baumkronen hielten dem Regen stand. Er wurde kaum nass.
Ein Blitz erhellte den Neptunbrunnen und den kleinen Mann, der neben den wohlgestalteten, überlebensgroßen Figuren tatsächlich wie ein hässlicher Zwerg aussah.
Josef überlegte, ihn von hinten zu packen, seinen Kopf ins Wasser zu drücken und ihn zu ersäufen. Bei Neptun wäre dieser Quälgeist bestens aufgehoben, dachte er.
Ein zweiter Blitz, dem ein ohrenbetäubender Donner folgte, schlug in einen uralten Kastanienbaum, der noch aus der Kaiserzeit stammte, ein, spaltete ihn in zwei Teile. Die Axt Gottes hat zugeschlagen, dachte der fromme Josef und bekreuzigte sich.
Auf einmal war es stockfinster im Park. Stromausfall.
Bei strömendem Regen eilten die beiden Männer weiter, vorbei am Irrgarten und am Hietzinger Lindenwäldchen. Nur mehr wenige Schritte trennten sie voneinander.
»Verdammter Idiot, kannst du nicht aufpassen«, schrie der Manager plötzlich.
Josef erschrak. Erst nach ein paar Sekunden kapierte er, dass der Betrunkene mit der Statue des Herkules zusammengestoßen war.
Er flehte zu Gott, dass die Statue ins Wanken kommen und den Bösewicht erschlagen möge. Gott erhörte sein Flehen nicht. Herkules hielt dem fürchterlichen Sturme stand.
Der kleine Mann tastete sich an den restlichen Statuen entlang und vor zum Kammergarten. Er schien Josef, der ihm knapp auf den Fersen folgte, noch immer nicht bemerkt zu haben.
Als sie endlich das Hietzinger Viereckl erreichten, gingen die Laternen wieder an.
Rasch versteckte sich Josef hinter einer Bauhütte. Die Fassaden der einstöckigen Häuser wurden gerade renoviert. Die Gerüste waren zum Teil bereits abgebaut worden. Eine jämmerliche Funsel spendete genügend Licht, sodass die herumliegenden Eisenstangen deutlich zu sehen waren.
Josef griff nach einer von ihnen und schlug den kleinen Mann nieder.
Die Wunde auf seinem Hinterkopf begann sofort stark zu bluten. Josef vermeinte, ein leises Wimmern zu hören. Er schlug noch einmal zu. Das Blut wurde vom heftigen Regen weggeschwemmt. Ein rötliches Bächlein ergoss sich durch den leicht abfallenden Durchgang.
Josef beugte sich über den regungslos am Boden liegenden Manager und berührte mit zwei Fingern seine Kehle. Kein Pulsschlag.
Rasch lief er hinüber zum Wäschehof. Das grüne Tor war nicht abgesperrt. Im Hof standen einige Mistkübel. Sie waren bis zum Rand gefüllt. Der Gestank, der vor allem der vollen braunen Bio-Müll-Tonne entwich, war unerträglich. Josef überlegte es sich anders. Er fasste den Toten unter den Armen und schleppte ihn zum Schloss. Es war Mitternacht und keine Menschenseele weit und breit.
Josef und seine Frau Mama hatten keine direkten Nachbarn. Einige leerstehende Wohnungen über den Prunkräumen wurden aus Risikogründen seit vielen Jahren nicht mehr vermietet.
In seinem Atelier, wie er seine Werkstatt im Gangzimmer neuerdings nannte, machte er sich sogleich an die Arbeit. Er hievte den leblosen Körper auf seine Werkbank und zerlegte ihn fachmännisch mit Beil und Säge in passende Teile. Das Geräusch der splitternden Knochen wurde vom Prasseln des Regens und dem ständigen Donnergrollen übertönt.
Der große braune Kachelofen im Salon war vom Gang aus beheizbar. Obwohl es kaum abgekühlt hatte, die Temperaturen um die zwanzig Grad lagen, begann Josef einzuheizen. Zuletzt stopfte er auch noch die Kleider des kleinen Mannes in den Ofen.
Da seine Mutter sowieso andauernd fror – kein Wunder, bestand sie doch nur mehr aus Haut und Knochen –, würde sie sich über die Hitze sicher nicht beschweren. Er jedoch schwitzte fürchterlich. Schlimmer als unter der Hitze litt er allerdings unter dem schrecklichen Gestank.
Josef riss alle Fenster auf. Ihm war es egal, wenn es hereinregnete.
Gegen zwei Uhr morgens entschloss er sich zu nachtwandeln, so wie in seiner Jugend, wenn er seine schnarchende Mutter neben sich nicht länger ertragen konnte.
Bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr hatte Josef neben seiner Mutter im Ehebett geschlafen. Erst nach dem Tod seiner Großmama war er, trotz heftiger Proteste seiner Frau Mama, in den Salon gewechselt. Seither schlief er im Bett der Omama.
Vom verwinkelten Korridor vor seiner Wohnung führte eine schmale Dienstbotentreppe hinunter ins Napoleonzimmer. Dieser Raum war das frühere Schlafgemach von Maria Theresia und ihrem Gatten Kaiser Franz Stephan gewesen. Aber das Bett war unbequem und heute viel zu kurz für ihn. Selbst der kleingewachsene Napoleon hatte sich schon über die elenden Betten des Schlosses beschwert, als er hier 1809 sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte.
Josef verwarf den Gedanken an Schlaf und nahm seine früheren nächtlichen Streifzüge durch die Prunkräume der Habsburger wieder auf.
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren das Schloss und der Park eine einzige große Spielwiese für ihn gewesen. Er hatte überall gespielt, auf den Schutthalden im Ehrenhof, am Dachboden, im Keller und in den Prunkräumen, die damals allerdings weniger prunkvoll ausgesehen hatten.
Josef hielt sich nicht lange im Napoleonzimmer auf, sondern ging hinüber in das ehemalige Audienzzimmer von Franz Stephan. Nach seinem Tod hatte Maria Theresia es zu einer Gedächtnisstätte für ihn umgestalten lassen.
Seit seiner Kindheit betrachtete Josef das Vieux-Laque-Zimmer, das mit wertvollen schwarz-goldenen Lacktafeln aus den kaiserlichen Hofwerkstätten in Peking ausgeschmückt war, ebenfalls als sein Reich. Schon im zarten Alter von dreizehn Jahren zog er sich oft hierher zurück und hielt Zwiesprache mit den Porträts von Kaiser Franz Stephan und seinen älteren Söhnen Joseph und Leopold. Hatten nicht auch sie unter der Weiberwirtschaft am Hofe gelitten, mindestens ebenso wie er unter der Herrschaft seiner Frau Mama?
Das Witwenzimmer Maria Theresias suchte er in dieser stürmischen Nacht nicht mehr auf. Von Frauen erwartete er sich keinen Trost.
Josef war von seinen Eltern nach Kaiser Franz JosephI. genannt worden, allerdings nicht mit »ph«. Er war im Schloss geboren. Eine Hausgeburt anno 1948.
Sein Vater war bei der Landung der Alliierten in der Normandie schwer verwundet worden. In einem französischen Lazarett flickte man den jungen österreichischen Leutnant notdürftig zusammen. Doch seine Lunge war kaputt. Nach seiner Heimkehr zeugte er mit einer Krankenschwester in Lainz, die ihn aufopferungsvoll gepflegt hatte, einen Sohn. Auf dem Sterbebett gab er ihr das Jawort. Er verschied kurz vor Josefs Geburt.
Die Wohnung hatte Josefs Großvater gehört. Der stramme Max, wie der große, fesche Bursche am Hof genannt wurde, war der erste Chauffeur des Kaisers gewesen. Kaiser Franz JosephI. hatte für neumodische Erfindungen wie den Markus-Wagen nicht viel übriggehabt. Dennoch hatte er sich irgendwann dazu herabgelassen, in ein Automobil zu steigen. Kurz nach diesem denkwürdigen Ereignis hatte der junge Chauffeur eine Dienstwohnung in einem der Richtung Hietzing liegenden Nebengebäude des Schlosses bekommen. In diesem dicht verbauten Trakt befanden sich hauptsächlich Stallungen und Wagenremisen. Im Obergeschoß war das Stallpersonal untergebracht. Dem strammen Max, damals alleinstehend, wurde eine Einzimmerwohnung in der Nähe des Wäschehofs zugewiesen. Dort, wo früher die Wäschermädel täglich die ganze Weiß- und Buntwäsche des Hauses Habsburg gewaschen hatten. Kurz vor dem Tod des alten Kaisers heiratete Max eines der blutjungen Wäschermädel, eine fesche und resche Person, die wusste, was sie wollte. Bald schon war ein Kind unterwegs. Josefs Vater.
Die schwangere Edeltraud drängte ihren Mann, den Kaiser bei einer ihrer Ausfahrten um eine geräumigere Wohnung zu bitten. Da im Mezzanin des Hauptgebäudes einige Wohnungen, die früher den Bediensteten der Kammer zur Verfügung standen, frei waren, bekamen der kaiserliche Chauffeur und seine junge, schwangere Frau 1916 eine große Wohnung über dem Blauen chinesischen Salon, dem Vieux-Laque- und dem Napoleonzimmer zugewiesen. Eine der letzten guten Taten des Kaisers. Noch im selben Jahr erlag er, mitten im Ersten Weltkrieg, den er mitangezettelt hatte, einer Lungenentzündung.
Da es sich bei der Wohnung des Chauffeurs um eine Naturalwohnung handelte, ging sie nach seinem Tod anstandslos an seine Witwe über. Jahrelang zahlte Josefs Großmutter nur einen minimalen Friedenszins für die riesigen Räume im Mezzanin.
Der Einbau des Mezzaningeschoßes zwischen der Nobeletage und dem zweiten Stock war schon zu Maria Theresias Zeiten sehr umstritten gewesen, da es sich um einen massiven Eingriff in die Substanz des Schlosses gehandelt hatte. Zu Lebzeiten der gebärfreudigen Kaiserin herrschte jedoch Platzmangel im Schloss. Es wurden dringend neue Räumlichkeiten für die zahlreichen Sprösslinge Maria Theresias und für die Unterbringung des ebenfalls wachsenden Hofstaates benötigt.
Großmama Edeltraud ließ ihre Schwiegertochter und ihren Enkel bei sich wohnen. Sie liebte ihren Enkel so sehr, wie sie ihre Schwiegertochter hasste. Der Bub geriet von Anfang an zwischen die Fronten der beiden streitlustigen Frauen. Bis heute erinnerte er sich mit Schaudern an die lautstarken Auseinandersetzungen. Seine Mutter glaubte den Ton angeben zu können, weil sie mit ihrem Gehalt als Krankenschwester für den Lebensunterhalt der kleinen Familie aufkam. Großmamas Witwenrente hätte niemals ausgereicht. Andererseits lief die Wohnung auf den Namen der Witwe des kaiserlichen Chauffeurs, und sie drohte ständig damit, ihre Schwiegertochter hinauszuwerfen. Josef versprach sie hingegen öfters, dass er nach ihrem Tod die Wohnung bekommen würde. Als sie nach einem Schlaganfall bettlägrig war und nicht mehr sprechen konnte, sorgte Josefs Frau Mama dafür, dass sie als alleinige Hauptmieterin in den Mietvertrag eingesetzt wurde.
Heute war Josefs Mutter achtundachtzig und selbst bettlägrig. Letztes Frühjahr begannen ihre Beine hin und wieder zu versagen. Er hatte ihr einen Rollator besorgt. Sie hatte sich geweigert, ihn zu benützen. Ein Rollstuhl musste angeschafft werden. Monatelang hatte Josef seine Mutter täglich hinauf zur Gloriette und wieder hinunter geschoben. Das hatte ihn körperlich fit gehalten.
Mittlerweile konnte seine Frau Mama das Bett nicht mehr verlassen. Josef kümmerte sich weiterhin rührend um sie. Saß täglich stundenlang bei ihr und erzählte ihr, was sich im und rund ums Schloss abspielte.
Als er ihr von den Ereignissen des gestrigen Abends berichtete, ließ er ein paar unappetitliche Details und seinen nächtlichen Streifzug durch die Prunkräume aus.
Ja, Mama. Ich weiß, was du sagen willst. Du hast Recht, Mama. Es war leichtsinnig von mir.
Nein, Mama. Ich habe mir die Finger nicht schmutzig gemacht.
Ja, ich hatte meine medizinischen Handschuhe dabei.
Josef hatte immer hautfarbene Silikonhandschuhe in seinen Hosentaschen. Seine Frau Mama hatte von Anfang an darauf bestanden, dass er bei seiner Arbeit Schutzhandschuhe trug. Sie hatte schreckliche Angst vor ansteckenden Krankheiten. Und Tiere waren nun eben berüchtigte Überträger von schweren Krankheiten: Tollwut, Vogelgrippe, Pest …
Die Pest ist längst ausgestorben, hatte Josef einmal zu sagen gewagt und an ihre Vernunft appelliert. Jedes Wort war sinnlos gewesen. Seine Mutter hatte nie auf ihn gehört.
Ja, Mama, ich bin ziemlich nass geworden. Was für ein schreckliches Unwetter!
Nein, ich habe mich nicht erkältet, Mama.
Du meinst, weil ich geniest habe? Vielleicht sollte ich doch lieber ein Aspirin C nehmen?
Josef war ein Hypochonder. Seine Mutter hatte ihn von klein auf mit Medikamenten vollgestopft.
Ich weiß, Mama, dass ich dein einziger Sohn bin und dass du mich nicht verlieren willst.
Verzeih, dass ich dir widerspreche, verehrte Frau Mama. Es stimmt nicht, dass du mich allein großgezogen hast. Ich erinnere mich kaum an dich, wenn ich an meine Kindheit denke, sondern nur an Großmama. Es hieß immer, du seist in der Arbeit.
Ja, wir haben das Ehebett miteinander geteilt. Aber wenn du dich zu Bett begabst, schlief ich meist längst. Du warst außerdem nur selten zu Hause. Sie treibt sich wieder herum, hat Großmama dann behauptet. Ich habe zwar nicht genau verstanden, was sie meinte, habe aber nie gewagt nachzufragen, weil sie bei diesen Worten sehr böse dreinschaute.
Josef hatte seine Großmama mehr geliebt als seine Mutter, aber er hatte sich vor ihr fast ebenso sehr gefürchtet wie vor seiner Frau Mama.
Nein, Mama, natürlich will ich damit nicht behaupten, dass du Männergeschichten gehabt hast. Ich glaube dir, dass es nach dem Tod von Papa nur einen Mann in deinem Leben gegeben hat, und das war ich.
Das Gespräch mit seiner Frau Mama hatte ihn sehr ermüdet. Außerdem steckten ihm die Ereignisse der vergangenen Nacht in den Knochen. Er legte sich nachmittags auf die Chaiselongue im Salon und versuchte ein Nickerchen zu halten. Konnte jedoch keinen Schlaf finden. Erinnerungen an seine Kindheit tauchten auf.
Schönbrunn war früher ein richtiges Dorf gewesen, mit einer Greißlerei, einer Apotheke, einigen Handwerksbetrieben und vielen gemütlichen Wirtshäusern. Auch heute lebten noch an die fünfhundert Menschen hier. Seit gestern einer weniger, dachte Josef.