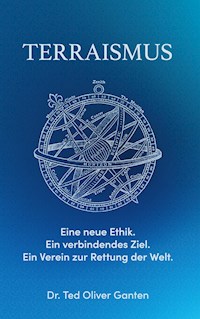
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir leben in der besten aller bisherigen Welten. Noch. Denn wenn wir so weitermachen werden wir der Erfolgsgeschichte des Homo Sapiens und vielleicht auch unserem Planeten schon bald ein Ende setzen. Deshalb ist es jetzt Zeit für einen Neustart. Einen Neustart, der unser Weltbild auf den Kopf stellt. Weil es für das Überleben der Menschheit entscheidend ist, nicht mehr den Menschen in den Mittelpunkt des Denkens zu stellen, sondern unseren Planeten. Es gilt eine neue Ethik zu entwickeln, die den Erhalt der Erde als Lebensraum für alle bestehenden und künftigen Lebensformen in das Zentrum stellt. Ein solcher Perspektivwechsel wird nur geschehen, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, das über den Planetenerhalt hinaus geht. Ein Ziel, das uns inspiriert, einen Menschheitstraum, der uns beflügelt und dazu bringt, unser Bestes zu geben. Und schließlich braucht es zur Verfolgung dieses Menschheitstraumes eine Organisation, die mehr Effizienz, Kontinuität und Identifikationspotenzial bietet als Nationalstaaten oder Staatenverbünde. Das Buch "Terraismus" gibt dazu konkrete Lösungsvorschläge. Es ist weder eine wissenschaftliche Abhandlung noch ein philosophischer Diskurs. Es ist ein Aufruf zu Handeln. Es will hinterfragt, weitergedacht und umgesetzt werden - von Menschen, die die zerstörerischen Potenziale des Homo Sapiens erkennen, aber sich entschließen, ihren Blick auf die Möglichkeiten zu richten. Menschen, die die den Fortschritt nicht aufhalten, sondern gestalten möchten. Sind Sie dabei?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Warum gibt es dieses Buch – und warum nicht?
1 Ist der Homo sapiens noch zu retten?
1.1 Was schiefläuft
1.2 Wie es weitergeht
1.2.1 Krieg
1.2.2 Homo deus
1.3 Was wir ändern können
1.4 Gut und Böse neu erfinden
1.4.1 Perspektivwechsel
1.4.2 Verrücktes Ziel
1.4.3 Terraismus
1.5 Warum Utopielosigkeit utopisch ist
1.6 Der Weg ist nicht das Ziel
1.6.1 Collective Actions
1.6.2 Asgardia
1.6.3 Der Weg
2 Wie viel Vereinsmeierei verträgt der Verein?
2.1 Präsident*in
2.2 Ältestenrat
2.3 Vollversammlung
3 Welche Aufgaben helfen, nicht aufzugeben?
3.1 Mission Planetenerhalt
3.1.1 Gremium für Bildung
3.1.2 Gremium für Bevölkerungskontrolle
3.1.3 Gremium für Umweltschutz-Tech
3.1.4 Gremium für Collective Action
3.2 Mission für den ethischen Umgang mit Fortschritt
3.2.1 Gremium für Cyborg-Technologie
3.2.2 Gremium für genetisch veränderte Wesen
3.2.3 Gremium für lebensverlängernde Maßnahmen
3.2.4 Gremium für Künstliche Intelligenz
3.2.5 Gremium für Wege zum Glück
3.3 Mission Besiedlung des Weltalls
4 Wie kommunizieren »Terraisten«?
5 Wer zahlt, schafft an. Wirklich?
5.1 Rechte für Personen
5.2 Rechte für Organisationen
5.3 Rechte für Staaten
6 Epilog: 100 Seiten heiße Luft?
Prolog
Dieses Buch wurde geschrieben, bevor Trump, Corona und Afghanistan die Unfähigkeit der Nationalstaaten und ihrer Verbünde gezeigt haben, mit Krisen sinnvoll umzugehen. Es wurde geschrieben, bevor Elon Musk mit SpaceX und Virgin Galactic den Weltraumflug kommerzialisiert haben.
Trump hat mit seinem Schlachtruf »America First« eine Renaissance des staatlichen Egoismus ausgelöst. Er hat ihn wieder hoffähig gemacht. Selbstverständlich haben Staaten wie China und Russland noch nie einen anderen Ansatz verfolgt. Es lässt sich auch gut argumentieren, dass auch die USA vor dem trumpischen Zeitalter immer sehr rigoros ihre eigenen Interessen verfolgt haben, militärisch und auch gegen internationales Recht, an dessen Entstehung sie mitgewirkt hatten. Dennoch macht es etwas mit uns, wenn die Nation, die viele internationale Themen besetzt hat, klar sagt: »Weltfrieden ist uns ab jetzt egal. Wir kümmern uns um unsere Leute und nur noch unsere eigenen Interessen.« Sprachen es und zogen ihr Militär aus Syrien ab, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Sprachen es und destabilisierten mit einem einseitigen Handelskrieg die Welt. Natürlich muss man sagen, dass es höchste Zeit war und ist, den eingeschwungenen Zustand des Welthandels zu hinterfragen. Eine Allianz im Vorfeld hätte vielleicht geholfen und ein diplomatischerer Tonfall hätte vielleicht die Chance auf eine Einigung erhöht. Das System Nationalstaat ist jedoch seitdem toxischer als je zuvor.
Corona hat uns dann einen weiteren Schuss vor den Bug gesetzt. Die Nationalstaaten haben ihre Grenzen wieder dichtgemacht und sich auf ihr eigenes Heil konzentriert, rücksichtslos und blind sowohl für die wirtschaftlichen Zusammenhänge als auch für das Wohl und Wehe anderer Menschen auf diesem Planeten. Muss man dafür nach Russland, China und auf die USA schauen? Nein. Selbst Deutschland hat zeitweise die Ausfuhr von Masken und weiterer Schutzkleidung in andere europäische Länder verboten, und das in einer Zeit, in der unsere italienischen Freunde unter der ersten Welle litten. Europäische Solidarität wurde erst nach und nach von Brüssel aus wieder in die Gemeinschaft gepumpt. Dankenswerterweise. Aus Brüssel kam mit COVAX auch die einzige Initiative, mit der ein bisschen internationale Solidarität gezeigt wurde. Sie scheiterte mehr oder weniger und wird hoffentlich jetzt ernsthaft wiederbelebt, in Zeiten, in denen die Durchimpfung in den Industriestaaten auf höchstem Niveau ist und die Gefahr von Corona-Varianten für die reichen Länder aus den ärmeren Ländern kommt. Das wäre zwar nicht selbstlos, aber immerhin der richtige Weg. In der Zwischenzeit überboten sich die reichen Länder der Welt und trieben die Preise für Impfdosen in schwindelerregende Höhen. Noch heute ist in vielen ärmeren Ländern Impfschutz noch nicht einmal für das medizinische Personal vorhanden.
Das Abzugsdesaster in Afghanistan ist geschichtlich gesehen sicherlich nur eine Randnotiz, zu wenige westliche Soldaten und Diplomaten sind am Ende gestorben. Die Ereignisse haben aber die hässliche Fratze des »humanitären« Engagements der Staatengemeinschaft und der »westlichen Welt« gezeigt. Nach den Engländern und Russen war dies die dritte Besetzung des Landes. Man stütze das dem Westen und dem Handel aufgeschlossene Regime, statte es mit Waffen aus und unterrichte Menschen in deren Gebrauch – ein solches Vorgehen zielt auf Krieg und Vernichtung ab, nicht auf Frieden. Es wurde nie der Dialog mit den Taliban gesucht. Es wurde nicht einmal versucht zu verstehen, warum es in Afghanistan zu einer solchen Radikalisierung großer Bevölkerungsschichten gekommen war. Es wurde nicht der demokratische Wille des Volkes zu unterstützen versucht, sondern es wurden unsere Werte und vor allem unsere Interessen auf fremdem Boden verteidigt. Wenn das die humanitärste Form des Engagements der westlichen, liberalen Demokratien ist, muss man sich fragen, ob wir sie wollen.
Diese drei Entwicklungen der letzten Jahre sind nur symptomatisch für die Grenzen, die Gefährlichkeit und die Engstirnigkeit einer von Staaten ausgehenden Interessenverfolgung. Es wird höchste Zeit für ein Korrektiv. Zum Beispiel einen »terraistischen« Verein, wie er hier vorgeschlagen wird. Insofern ist dieses Buch aktueller als jemals zuvor.
Teil des Terraismus ist die Idee, die Besiedlung des Weltraumes als planetenweite, verbindende Vision zu nutzen. Das mag auf den ersten Blick schräg klingen und scheint vom Wesentlichen – nämlich der Rettung unseres Planeten – abzulenken. Das stimmt aber nicht. Denn die Planetenrettung hängt nicht nur vom notwendigen ökologischen Umbau unserer Gesellschaft, sondern auch von der Erhaltung des Friedens ab. Einer der potenziellen Streitpunkte zwischen den großen Nationen wird in naher Zukunft die Besiedlung des Mondes sein. Diese könnte durch Rohstoffgewinnung getrieben sein, noch wahrscheinlicher ist die technologische, strategische und militärische Bedeutung einer Basis auf unserem Trabanten. Ein Wettlauf der Nationen darum könnte fatal enden.
Des Weiteren ist es eine einfache psychologische Tatsache, dass sich schlichte Überlebensnotwendigkeiten als Vision nicht eignen. Wenn wir ein gemeinsames, verbindendes Ziel haben wollen, so kann dies nicht darin bestehen, dass die Industrienationen etwas abgeben, wie Geld, Nahrung und Bedeutung. Denn solange viele Menschen in den reichen Nationen morgens aufwachen und genug von allem haben, wird es sie nicht zu einer richtigen Entscheidung treiben. Der Traum von der gemeinsamen Weltraumbesiedlung hat dagegen das Potenzial, die Perspektive auf unseren Planeten zu verändern. Die Verwirklichung des Traums setzt einen langfristig intakten Planeten voraus. Die Idee, diese atemberaubende Aufgabe gemeinsam zu verwirklichen, wird dann hoffentlich auch zu einer persönlich erfahrbaren Solidarität führen.
Schließlich soll das Ziel der Besiedlung des Weltraums durch eine privatrechtliche Allianz, den terraistischen Verein, verfolgt werden. SpaceX und Virgin Galactic zeigen, dass der Weltraum tatsächlich privaten Unternehmungen offensteht, da die USA und die NASA selbst nicht mehr über die entsprechende Technologie verfügen. Russland hat sich öffentlich beschwert, dass ihre Raketentechnologie durch den Preiswettbewerb aus dem Markt gedrängt wird. Ich halte das für ein gutes Zeichen. Man stelle sich vor, was ein Zusammenschluss führender Technologieunternehmen weltweit bewirken könnte. Es lässt sich erahnen, dass so ein Zusammenwirken durch Effizienz und Zielgerichtetheit einzelstaatlichen Vormachtansprüchen friedlich entgegentreten kann.
Durch die Konzentrierung von Kapital und wirtschaftlicher Macht bei Einzelnen wird es aber wichtiger denn je sein, dass solche Unternehmungen nicht im luftleeren Raum hängen. Sie brauchen eine verbindende rechtliche Plattform, auf der man langfristig zusammenwirken kann. Sie brauchen aber insbesondere eine starke ethische Grundlage, wie sie zum Beispiel der hier vorgestellte Terraismus etabliert.
Insofern wiederhole ich mich: Die Realität der letzten drei Jahre zeigt, dass dieses Buch aktueller ist als jemals zuvor.
Schließlich und zu guter Letzt wurde dieses Buch im letzten Jahr von Susanne Gold mit 52 digitalen Grafiken »emotionalisiert«. Dies geschah im Rahmen der Veröffentlichung des Textes im Blog »Utopiensammlerin.com«. Dem Utopiensammlerin e. V. und dem dahinterstehenden Künstler*innen-»Collec.tiff« gebührt mein aufrichtiger Dank.
Warum gibt es dieses Buch – und warum nicht?
Alles begann mit dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren. Die Erde gibt es seit ungefähr 4,5 Milliarden Jahren und vor 3,5 Milliarden Jahren kam das Leben auf unseren Planeten. Die frühesten Vorfahren des Menschen entwickelten sich vor etwa 7 Millionen Jahren und der Homo sapiens, der sich gegen all die anderen Menschenrassen durchgesetzt hat, ist immerhin auch schon 200 000 Jahre alt. So, wie wir Menschen derzeit leben und lieben – und von denen manche sich/uns für göttlich halten –, werden wir nur eine Momentaufnahme in der langen Kette der Evolution sein. Wir entwickeln uns kontinuierlich, wenn auch in sehr kleinen Schritten, weiter zu etwas Neuem. Hoffentlich.
Und so geht es weiter: Wenn wir die Erde nicht in kleine Stücke sprengen und im Weltall verteilen, wird sich die Evolution trotz des zerstörerischen Gebarens des Homo sapiens fortsetzen. Eines Tages wahrscheinlich ohne ihn. Schon weil wir selbst Umweltbedingungen schaffen, in denen wir nicht mehr leben können. Aber immerhin – der Funke des Lebens wird wahrscheinlich weitergetragen. Das ist tröstlich. Doch bei allem Trost, der in diesem Gedanken liegt: Das derzeitige Leben kann so viel Spaß machen und ich sehe im Menschen so große Potenziale, dass ich mich gerne persönlich für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Homo sapiens einsetze. Das muss man nicht so sehen. Ich habe ein gewisses Maß an Verständnis für die Ansicht, dass es dem Planenten ohne uns besser ginge. Wer sich aber meiner Meinung anschließt, wird nicht umhinkommen festzustellen, dass wir etwas anders machen müssen. Es ist sonst höchst unwahrscheinlich, dass es die nächsten 10 000 Jahre mit dem Homo sapiens und seinen Nachfolgern weitergeht.
Was wir anders machen müssen? Ich habe nicht die Lösung, aber ich will dazu beitragen. Mit dem Planetarischen Manifest zeige ich einen Weg auf, der unterstützend eine gute Zukunft ermöglichen kann. Der Charme dabei ist, dass wir mit der Umsetzung des Planetarischen Manifests schon morgen anfangen können und damit sehr wahrscheinlich zumindest einige Entwicklungen sinnvoll in die richtige Richtung lenken. Ich will nicht detailliert auf die Probleme und Herausforderungen eingehen, denen wir uns stellen müssen. Mit Katastrophen, Dramen und Leid werden wir schon genug jeden Tag über alle Medienkanäle versorgt. Vielmehr ist mein Ansatz lösungsorientiert. Trotzdem muss ich meinen Ausführungen einige Grundannahmen voranstellen, wie sich die Dinge wahrscheinlich mittelfristig entwickeln werden. Diese Grundannahmen sind weit verbreiteter Konsens und werden hier ohne Diskussion unterstellt. Zeitliche Varianzen von ein paar Jahrzehnten oder prozentuale Abweichungen bei den einzelnen Kausalketten und Zukunftsszenarien sind erstens nicht abschließend zu klären und zweitens nicht wesentlich für die Schlussfolgerungen. In welchem Maße eine Umsetzung der hier dargelegten Ideen und ethischen Grundprinzipien über Bewusstseinsbildung in die Politik und andere Bereiche hineinwirkt, muss die Zeit zeigen. Die in diesem Manifest entwickelten Ideen haben zwar nicht einmal andeutungsweise das Potenzial, alle Probleme der Welt zu lösen, doch wie wir alle wissen, kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in China einen Wirbelsturm in den USA auslösen. Wenn dieses Manifest so ein Flügelschlag ist, hoffe ich, dadurch Rückenwind für den Fortbestand des Homo sapiens und seine positive Weiterentwicklung zu erreichen.
Zwei Lesergruppen könnten vom Planetarischen Manifest enttäuscht sein. Zum einen diejenigen, die eine wissenschaftliche Abhandlung und eine umfassende Vertiefung der philosophischen Landschaft, Theoreme und Geschichte erwarten. Das würde den Rahmen sprengen und ist nicht Ziel der Darstellung, außerdem wäre ich auch nicht der Richtige hierfür. Der Fokus liegt hier vielmehr auf einem pragmatischen Vorschlag zur Adressierung von Herausforderungen. Zum anderen werden jene enttäuscht sein, die sich vielleicht bereits am Ende des Manifests eine konkrete Mitwirkungsmöglichkeit wünschen oder eine klare Roadmap für dessen Umsetzung. Auch das ist nicht mein Plan. Eine Idee will diskutiert sein, bevor sie umgesetzt wird. Sie muss einen Reifegrad erlangen und Resonanz hervorrufen, die einen fruchtbaren Boden für den weiteren Prozess bereiten. Am Ende des Manifests gibt es einige Überlegungen, wie sich die hier dargelegten Ideen in die Realität umsetzen lassen oder ließen. Es gibt aber viele Wege dafür. Diese Seiten sind hoffentlich ein Samen, nicht der Baum und schon gar nicht die Frucht.
1 Ist der Homo sapiens noch zu retten?
Zunächst gilt es, gemeinsam die ersten Pfeiler in den weichen Boden der Realität zu setzen: Was sind unsere größten Probleme? Wie werden sich die Technologie und die Menschheit weiterentwickeln? Was davon ist beeinflussbar, so dass wir darauf unsere Energie konzentrieren können? Und wie sollen wir in dieser neuen Welt Gut und Böse voneinander unterscheiden? Oder reichen uns die Gesetze des Marktes, die zehn Gebote und der kategorische Imperativ Kants? Erst nachdem diese Themen zumindest dargestellt worden sind, stelle ich die Idee vor, einen Weg, der uns bei der Gestaltung der großen Herausforderungen der Zukunft unterstützen kann.
1.1 Was schiefläuft
Wachstum und Ressourcen: Heute sind wir 7+ Milliarden Menschen und werden täglich mehr. Die Prognosen sprechen von 10 Milliarden bis 2055. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Energie steigt weiter an und die Ressourcen an Energie, Rohstoffen, Essen und Wasser sind begrenzt. Natürlich kann man die Meinung vertreten, wir hätten in erster Linie ein Verteilungsproblem. Derzeit noch. Aber die Projektionen für die nächsten hundert Jahre sehen nicht rosig aus. Denn neben der Anzahl der Menschen wird sich auch der Pro-Kopf-Verbrauch an Energie multiplizieren. Und als Bewohner*in der Industrienationen lässt sich schlecht argumentieren, die anderen Menschen hätten kein Recht auf einen vergleichbaren Ressourcenverbrauch. Es bleibt ein irritierendes Konzept, dass reiner Zufall und die juristische Erfindung des Eigentums darüber bestimmen, wann, wie und warum wir die Millionen Jahre alten Ressourcen unseres Planeten verwerten. Der Kampf ums Wasser hat längst begonnen, die Luft beginnen wir gerade erst als Ressource zu entdecken. Noch leben wir in einer Welt des Überflusses. Das wird sich ändern.
Krieg und Frieden: Wir sind eine aggressive Spezies. Obwohl uns die letzten siebzig Jahre, zumindest in so großen Teilen der Welt wie noch nie zuvor, einen stabilen Frieden geschenkt haben, geht der Trend derzeit wieder in eine kritische Richtung. Wirtschaftlicher Protektionismus, wie er aktuell von vielen wortgewaltigen oder zumindest lauten Staatsoberhäuptern betrieben wird, ist der Vorbote des Nationalismus. Die UN verlieren an Unterstützung. Die EU kämpft mit dem ersten Austritt. Die Berechtigung der supranationalen Zusammenschlüsse inklusive der NATO wird öffentlich angezweifelt. Diese Destabilisierung, wenn auch oft aus vordergründig berechtigten wirtschaftlichen Gründen, gefährdet mittelfristig den Frieden. Die mangelnde Wertschätzung, die dem Thema Frieden derzeit zukommt, ist ironischerweise die Kehrseite des tatsächlichen Vorhandenseins des Friedens. Ein Großteil der heutigen Generation kennt nichts anderes und hält Frieden für selbstverständlich.
Glückssuche und Religion: Eine Polarisierung findet auch im religiösen Umfeld statt. In den westlichen Industrienationen lösen sich Weltanschauungen in einer gewissen Interessenlosigkeit auf. Konsum ist aus der Asche der Religion als Daseinsberechtigung aufgestiegen. Andeutungsweise spirituell bleibt die Suche nach der Steigerung des individuellen Glücks, wie sie in unzähligen Kursen und Workshops von Yoga und Meditation bis NLP angeboten wird. Das meine ich nicht abwertend. Einige dieser spirituellen Pfade sind in eine Weltanschauung eingebettet und werden auch so gelebt. In den meisten Fällen werden diese Angebote jedoch nicht wegen ihrer ethischen Komponente angenommen, sondern weil sie einem »guttun«. Auch das ist nicht falsch. Die Suche nach individueller Glückoptimierung ist evolutionär angelegt, aber sie hilft nicht bei der Suche nach einem gesellschaftlichen Konsens und bildet kein grenzüberschreitendes, gemeinsames ethisches Grundverständnis.





























