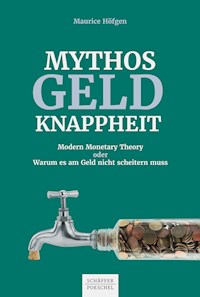14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die große Angst vor der Geldentwertung – und was die Politik tun muss Tanken, Heizen, Einkaufen – alles ist teurer geworden, die Inflationsrate ist auf Rekordhoch. Müssen wir uns in Zukunft noch mehr Sorgen um unser Geld machen? Wird das Leben unbezahlbar? Wirtschaftsanalyst Maurice Höfgen beschäftigt sich tagein tagaus mit der Lage und warnt vor Panik, denn die aktuellen Mondpreise sind eine Folge des Krieges in der Ukraine und der Corona-Pandemie. Die Ampel muss aber dennoch handeln, damit der Alltag wieder bezahlbar wird. Trifft sie die falschen Entscheidungen, kann auf den Preisschock eine Wirtschaftskrise folgen. »Teuer!« ist eine scharfe Analyse, die zeigt, wie man die aktuelle Nachrichtenlage richtig deutet – und Missverständnisse über Inflation aufklärt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Die große Angst vor der Geldentwertung – und was die Politik tun muss
Tanken, Heizen, Einkaufen – alles ist teurer geworden, die Inflationsrate ist auf Rekordhoch. Müssen wir uns in Zukunft noch mehr Sorgen um unser Geld machen? Wird das Leben unbezahlbar? Maurice Höfgen warnt vor Panik, denn die aktuellen Mondpreise sind eine Folge des Krieges in der Ukraine und der Corona-Pandemie. Die Ampel muss aber dennoch handeln, damit der Alltag wieder bezahlbar wird. Trifft sie die falschen Entscheidungen, kann auf den Preisschock eine Wirtschaftskrise folgen.
›Teuer!‹ ist eine scharfe Analyse, die zeigt, wie man die aktuelle Nachrichtenlage richtig deutet – und Missverständnisse über Inflation aufklärt.
»Maurice Höfgen ist einer der wenigen Ökonomen in Deutschland, die beim Thema Inflation auf der Höhe der Zeit sind, und monetaristische Dogmen glaubhaft widerlegen können.«Prof. Heiner Flassbeck
»Höfgen ist immer brandaktuell, meinungsstark und kontrovers: eine erfrischende, spannende Stimme in der wirtschaftspolitischen Debatte.«Prof. Achim Truger
Maurice Höfgen
TEUER!
DIE WAHRHEIT ÜBER INFLATION, IHRE PROFITEURE UND DAS VERSAGEN DER POLITIK
Für die Inflationsverlierer und diejenigen,die Politik für die Verlierer machen wollen.
Inhalt
EINLEITUNG: Sie ist wieder da!
1WENN DIE WIRTSCHAFT FIEBERT – und der Alltag teurer wird
2GASMANGEL STATT GELDSCHWEMME – Woher kommt die Inflation?
3ANGST ALS GESCHÄFTSMODELL – Wie mit Inflation Stimmung gemacht wird
4ENERGIERIESEN GEGEN VERBRAUCHER – Inflation als Verteilungskonflikt
5GELÄHMTE ZENTRALBANK, GEFESSELTE MINISTER – Wer kann die Inflation bekämpfen?
AUSBLICK: Werden wir sie wieder los?
DANK
ANMERKUNGEN
Einleitung: Sie ist wieder da!
Jahrelang war sie weg, keiner hat sie wirklich vermisst, doch 2022 redeten alle über sie. Das ist auch richtig so, denn sie geht uns alle etwas an. Die Rede ist von der Inflation. Einkaufen, heizen, duschen: Der Alltag ist teurer geworden, viel teurer. Viele Menschen sind gezwungen zu verzichten. Die einen auf den Sommerurlaub und Biogurken, die anderen auf warme Wohnräume und volle Kühlschränke. Kein Wunder also, dass die Inflation laut Umfragen wieder zu den größten Sorgen der Deutschen zählt – neben dem schrecklichen Krieg in der Ukraine.
2022 musste mehr als jeder Zweite jeden Cent seines Monatseinkommens verwenden, um den Alltag zu wuppen. Sparen? Nicht mehr möglich. Sich etwas gönnen? Nur mit schlechtem Gewissen. In Deutschland hat jeder Dritte schon vorher kaum nennenswerte Ersparnisse gehabt. Keinen Puffer, auf den man in Krisenzeiten zurückgreifen kann, wenn der Liter Benzin und das Paket Butter plötzlich mehr als zwei Euro kosten; wenn der neue Strom- und Gasvertrag um ein Vielfaches teurer wird; wenn der Betrieb stockt und man in Kurzarbeit ein Drittel seines Gehaltes verliert. Schon vor der Krise war jeder zehnte Erwachsene in Deutschland überschuldet, konnte also seine laufenden Rechnungen nicht mehr begleichen. Mehr als eine Million Menschen hatten schon vorher Energieschulden, konnten also ihre Strom- oder Heizrechnungen nicht bezahlen. In Hunderttausenden Fällen wurde der Strom abgesperrt. Ein Stapel offener Rechnungen und Mahnungsbriefe, rote Zahlen auf dem Kontoauszug und dann noch Mathelernen mit den Kindern – im Dunkeln. Schon die wirtschaftliche Verwüstungsspur der Corona-Pandemie hat die Armuts- und Überschuldungszahlen 2021 in neue Höhen getrieben. Die Pandemie und ihre Folgen waren noch nicht überwunden, da kam die Inflation zur Unzeit.
Doch vor der Inflation sind wir längst nicht alle gleich. Sie ist kein schwarzes Loch, in das unser aller Geld eingesaugt wird und dann für immer verloren ist. Denn nicht alle werden zwangsläufig ärmer, wenn die Inflationsrate steigt. Das wird häufig übersehen, wenn die Statistiker die neuen Zahlen verkünden. Inflation passiert nicht, Inflation wird gemacht – von Firmen, von Gewerkschaften, vom Staat, von uns allen. Und zwar dann, wenn wir uns darum streiten, wer wie viel vom Kuchen bekommt. Der Kuchen ist unser Wohlstand. In der Marktwirtschaft gilt: Wer mehr Geld hat, kann sich ein größeres Stück vom Kuchen kaufen. Deshalb streiten wir uns alle permanent um Geld. Darum, wie viel wir verdienen, zu welchen Preisen wir kaufen und verkaufen, wie viele Steuern wir zahlen, wer wie viel vom Staat bekommt und so weiter. Das ist völlig normal und gehört zur Marktwirtschaft wie der Topf zum Deckel. Der Streit um den Kuchen ist ein Verteilungskonflikt mit Gewinnern und Verlierern. Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer, Firmen gegen Verbraucher, Staat gegen Privatwirtschaft, Exporteure gegen Importeure. Wer sein Einkommen erhöht, kann ein größeres Stück vom Kuchen ergattern, wer das nicht schafft, muss mit weniger auskommen. Wenn Preise verändert werden, gibt es immer jemanden, der mehr verdient, und jemanden, der mehr bezahlt.
Etwa, wenn Autofahrer an der Tankstelle plötzlich mehr für den Liter Benzin hinlegen müssen. Der Autofahrer zahlt mehr, die Tankstelle verdient mehr. Das ist schlecht für den Autofahrer und gut für die Tankstelle – logisch. Meistens geht der Konflikt aber weiter. Die Tankstelle muss vielleicht auch mehr an den Ölgroßhändler zahlen. Und der Großhändler an die Raffinerie. Und die Raffinerie an den, der das Erdöl fördert. Wer genau Gewinner und Verlierer ist, lässt sich deshalb nicht immer auf den ersten Blick feststellen. In unserem Beispiel sind es die Ölförderer, weil sie das Öl weiterhin günstig aus dem Boden holen, aber teurer verkaufen konnten. Ihr Kuchenstück wird größer, das der Verbraucher kleiner.
Ein anderes Beispiel: Bäcker Lutze erhöht die Preise für seine hellen, runden Brötchen, weil seine Angestellten eine Gehaltserhöhung bekommen haben und die Gaspreise gestiegen sind, seit Putin seine Gaskrake Gazprom im Wirtschaftskrieg gegen Deutschland einsetzt. Oma Erna muss jetzt 50 statt 30 Cent pro Brötchen zahlen. Hier wird eines der einfachsten, aber auch wichtigsten ökonomischen Gesetze deutlich: Die Ausgaben des einen sind immer die Einnahmen eines anderen. Wenn Oma Erna 50 Cent fürs Brötchen zahlt, nimmt Bäcker Lutze 50 Cent ein. Wenn es am Tag vorher noch 30 Cent waren, ist das gut für Bäcker Lutze und schlecht für Oma Erna. Schon allein aus diesem Grund kann Inflation nicht dazu führen, dass alle ärmer werden. Das wäre unlogisch. Für einen Konflikt braucht es mindestens zwei Parteien. Nicht alle können gleichzeitig und gegeneinander ihre Interessen durchsetzen, auch das verbietet die Logik. Die spannende Frage, wer den Streit um den Kuchen gewinnt und wer dabei verliert, hat außerdem viel mit Macht zu tun. Macht über Preise, Macht über den Markt und Machteinfluss auf die Politik. Darauf kommen wir in Kapitel 4 noch zu sprechen.
Wenn keiner der Streithähne im Gerangel um das größere Stück vom Kuchen nachgeben will, entsteht daraus eine Spirale, die sich immer abwechselnd durch steigende Preise und steigende Löhne stetig selbst befeuert. Diese Spirale meinen Ökonomen, wenn sie von »Inflation« sprechen. Sie, die Spirale, lässt die Preise nämlich dauerhaft und auf breiter Front steigen. Dauerhaft. Und auf breiter Front. Nicht einmalig, nicht nur in gewissen Bereichen. Sie hat auch einen Namen: Lohn-Preis-Spirale. Der eignet sich nicht für skandalträchtige Schlagzeilen, trotzdem wird das Phänomen gefürchtet. Von der Politik und von den Zentralbanken. Beide müssen nämlich dafür sorgen, dass die Lohn-Preis-Spirale idealerweise gar nicht erst entsteht. Und wenn doch, dass sie schnell endet. Politik und Zentralbank spielen Streitschlichter, wenn man so will.
NICHT JEDER PREISANSTIEG IST INFLATION
Ich habe den Begriff »Inflation« bis hierhin also falsch benutzt. Und zwar als Synonym für »gestiegene Preise«. So passiert es auch in Zeitungen, Talkshows, Bundestagsreden und den sozialen Medien. Nur geht dabei eben vieles durcheinander.
Wenn das neue iPhone teurer ist als das alte oder das Schokocroissant von heute auf morgen mehr kostet, sind das Preisanstiege, aber das bedeutet noch lange nicht, dass die Inflation steigt. Das gilt auch, wenn der Ölpreis sich erhöht und Tanken teurer wird. Der Ölpreis ändert sich ohnehin von Tag zu Tag, weil an der Börse ein stabiles Angebot auf schwankende Nachfrage trifft und den Preis Achterbahn fahren lässt. Die Statistiker, die die Inflationsrate bestimmen, kennen das Problem. Denn messen können sie selbstverständlich nur konkrete Ereignisse, also wenn Firmen ihre Waren mit neuen Preisschildern versehen oder Börsenkurse sich ändern. Diese Schwankungen und gestiegenen Preise bildet dann die Inflationsrate ab. Aber darüber, ob die Preisanstiege dauerhaft sind und damit die Definition von »Inflation« erfüllen, sagt die Inflationsrate gar nichts aus. Wenn der Staat Maßnahmen wie einen Tankrabatt oder eine Mehrwertsteuersenkung umsetzt, fällt die Inflationsrate dementsprechend bei der Einführung und steigt bei der Beendigung wieder an. Das staatlich verursachte Auf und Ab der Inflationsrate ist aber keine Inflation im eigentlichen Sinne.
Genauso verhält es sich, wenn Gas teurer wird, weil Russland nicht mehr liefert und es noch keine Alternativen zum Putin-Gas gibt. Die Gasknappheit hat 2022 einen wahren Preisschock ausgelöst. Sprunghaft stieg der Gaspreis in neue Höhen, als der russische Präsident völkerrechtswidrig in die Ukraine einmarschieren ließ. Eine »Inflation« war das allein aber (noch) nicht. Denn für einen dauerhaften Preisanstieg hätten Gas und ganz viele weitere Güter immer teurer und teurer werden müssen – ohne einen Weg zurück zu alten, günstigen Preisen. Das war aber nicht der Fall. Schon zwischen Kriegsbeginn und dem endgültigen Abdrehen der Nord-Stream-Pipeline im September 2022 war der Gaspreis immer wieder gefallen. Wer im Oktober an der Börse Gas bestellte, das 2023 bzw. zwei oder drei Jahre später geliefert werden sollte, zahlte deutlich weniger als für eine Lieferung im darauffolgenden Monat. An der Börse rechneten Käufer und Verkäufer also damit, dass die Knappheit beim Gas in den nächsten Jahren nicht mehr so akut sein würde wie im Oktober 2022. Das bedeutet, dass der Gaspreis in Zukunft wahrscheinlich wieder fällt und damit alles wieder günstiger wird, was mit viel Gas produziert wird, zum Beispiel Fensterglas, Dünger oder Brötchen. Vom Gaspreis selbst geht also keine sich selbst verstärkende Dynamik aus, die die Inflationsrate Jahr für Jahr neu antreibt.
Wenn wir genug Gas aus anderen Ländern bekommen, kann der Putin-Preisschock nach und nach wieder verschwinden. Zumindest zum größten Teil. Nach und nach, weil die hohen Börsenpreise erst mit einer gewissen Verzögerung bei den Versorgern ankommen und mit noch mehr Verzögerung dann auf der Nebenkostenabrechnung der Haushalte abgebildet werden. Auch wer günstige Verträge mit langen Laufzeiten abgeschlossen hat, kann sich also vor Preisanstiegen schützen. Was beim Gehalt im Arbeitsvertrag von Nachteil ist, weil das in der Regel nicht von heute auf morgen angepasst werden kann, ist beim Vertrag mit dem Gasversorger von Vorteil.
Warum verschwindet der Preisschock nur zum großen Teil und nicht vollständig? Weil Flüssiggas aus den USA, Aserbaidschan, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Algerien teurer sein wird als das günstige Erdgas aus den Gazprom-Pipelines. Und obendrein auch schlechter für Umwelt und Klima.
Die Gewinner der hohen Energiepreise sitzen übrigens meist im Ausland. In Saudi-Arabien, Katar, den USA, Norwegen – und Russland. Bis zu Putins Lieferstopp und der Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines hat Gazprom mit der Förderung von Erdgas Rekordgewinne verbucht. Allein im ersten Halbjahr 2022 verdiente der Konzern fast 42 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2021 waren es nur rund 27,5 Milliarden Euro. Noch beeindruckender sind nur die Zahlen vom weltweit größten Ölförderer, Saudi Aramco. Der saudische Staatskonzern hatte kaum höhere Förderkosten als 2021, konnte aber 2022 mit den gestiegenen Börsenpreisen jeden geförderten Liter Öl zu deutlich höheren Preisen verkaufen. Der Gewinn verdoppelte sich daraufhin im ersten Halbjahr nahezu – auf satte 88 Milliarden Dollar. Während der größte deutsche Importeur von Putin-Gas Uniper fast pleiteging und vom Staat gerettet werden musste, legten Ölraffinerien die höheren Rohölpreise auf die Tankstellen und die wiederum auf die Autofahrer um. Die Autofahrer wurden zu den Verlierern. An der Zapfsäule konnten sie nichts dagegen machen, mit niemandem die Preise verhandeln. Wohl aber bei ihrem Arbeitgeber mehr Gehalt oder von der Politik mehr Entlastungen fordern. So löste der Energiepreisschock die Sorge um eine inflationäre Lohn-Preis-Spirale aus, und eine bundesweite Debatte um Entlastungsmaßnahmen der Politik begann.
STREITSCHLICHTER GESUCHT
In der Debatte wurden alte ökonomische Glaubenssätze infrage gestellt, plötzlich riefen selbst bis ins Mark überzeugte Liberale nach staatlichen Eingriffen. So etwa der Präsident der Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger, auf einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz und der Präsidentin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi. Anlass war die vom Kanzler ins Leben gerufene konzertierte Aktion gegen steigende Preise, bei der sich die Teilnehmer darauf einigten, die Preise für Strom und Gas zu deckeln. Den Arbeitgebern sei bewusst, dass man sich hierbei von »marktwirtschaftlichen Prinzipien« trenne, so Dulger, »aber in der jetzigen Situation müssen wir das Notwendige und Mögliche tun, damit das Land weiter stabil bleibt«.1
Dieser Satz ging in der Presse damals etwas unter, war aber eine echte Zäsur. Dass der Staat dem Markt Preise vorschreibt, war bis dato nämlich verpönt. Man erinnere sich an den Aufschrei der Arbeitgeber, als 2015 der Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde eingeführt wurde. Der Vorgänger von Arbeitgeberpräsident Dulger, Ingo Kramer, bekämpfte die Einführung des Mindestlohns mit harten Bandagen. Seine Überzeugung: »Gemeinsam wissen wir [die Tarifpartner] am besten, was betrieblich machbar ist und was nicht. Politiker sind da verdammt weit weg.«2 Im Klartext: Der Markt regele das schon, der Staat solle sich raushalten. Dulgers Forderung nach staatlichen Eingriffen in die Strom- und Gaspreise war deshalb bemerkenswert. Der Satz gehört in das Museum deutscher Wirtschaftsgeschichte.
Der Staat war bei dem Preisschock 2022 ohnehin viel gefragt. Aus allen politischen Ecken kamen Forderungen, die von ihm verlangten, Geld auszugeben, Steuern zu senken oder Spielregeln zu verändern. Für ein 9-Euro-Ticket, für mehr Kindergeld, für schwimmende LNG-Terminals, für die Übernahme von Uniper oder den treuhänderischen Staatseinstieg bei Rosneft, für den Tankrabatt, für Umsatzsteuersenkungen, für die Abschaffung der EEG-Umlage, für vollere Gasspeicher, für schnelleren Windkraft-Ausbau, für die Bepreisung von CO2-Emissionen und so weiter. Mit der Aufzählung ließen sich mehrere Seiten füllen. Kurzum: Der Staat hat verdammt viel gemacht. Nicht alles allein wegen steigender Preise, sondern auch wegen der Folgen von Putins Überfall auf die Ukraine und des daraus resultierenden Wirtschaftskriegs zwischen Russland und dem Westen. Und wegen der Gefahr, dass Deutschland das Gas ausgehen könnte.
Krisen sind ein Fenster in die Schaltzentrale der Wirtschaft. Wer Wirtschafts- oder Finanzminister ist, sitzt dort an langen Hebeln. Gerade wenn es um Preise geht, wird der Einfluss des Staates häufig unterschätzt. Ein Fehler! Denn es gibt keinen anderen Akteur, der einen größeren Einfluss nehmen könnte. Manche Hebel sind für jedermann sofort erkennbar, etwa wenn der Staat mit einem Tankrabatt die Preise an der Zapfsäule senkt oder die EEG-Umlage von der Stromrechnung streicht. Da sieht man die Veränderung eben schwarz auf weiß. Andere Hebel erkennt man nicht sofort. Etwa wenn die politischen Spielregeln so ausgestaltet sind, dass eine Handvoll großer Mineralölkonzerne den deutschen Ölmarkt dominieren und dadurch mitten in der Krise die Preise anheben kann, um Rekordgewinne einzufahren – und das Kartellamt seinem Job als Schiedsrichter nicht gerecht wird. Hier nimmt der Staat, anders als beim Tankrabatt, nur indirekt Einfluss auf die Preise, eben über Wettbewerbsgesetze und das Kartellamt. Oder wenn Kohleausstieg und Investitionsstau bei Erneuerbarer Energie dazu führen, dass auch in der Krise noch das knappe, teure Gas für die Stromerzeugung gebraucht wird und damit die Strompreise in ungeahnte Höhen katapultiert werden. Auch hier: ein deutlicher, aber indirekter Einfluss. Oder wenn die Erhebung der Mehrwertsteuer jeden Preisanstieg noch zusätzlich verstärkt, weil die Steuer immer am Ende prozentual auf den Produktpreis aufgeschlagen wird und dadurch in Euro gerechnet steigt. 7 Prozent Steuer auf 2,50 Euro pro Paket Butter sind eben mehr als 7 Prozent auf 1,80 Euro.
Finanzminister Christian Lindner will endlich wieder ein Tempolimit in der Schaltzentrale etablieren. Natürlich nicht für Autobahnen, nichts läge ihm ferner, sondern für Staatsschulden. Immer und immer wieder betonte er in der Inflationsdebatte, dass neue Staatsschulden wie Benzin auf explodierende Preise wirkten. Die Schuldenbremse wiederum sei deshalb eine Inflationsbremse. Anders gesagt: Christian Lindner will den Preisschock wegsparen. Dafür nimmt er sogar in Kauf, dass Jobs verloren und Firmen pleitegehen. »Natürlich ist Inflationsbekämpfung immer verbunden mit einer befristeten wirtschaftlichen Abkühlung. Aber das ist eben der Preis, diese Inflation zu stoppen«, so Lindner in der »Tagesschau«.3 Das ist ein schlechter Plan. Und einer, der zeigt, wie wichtig die richtige Diagnose ist. Christian Lindner unterscheidet nicht zwischen Preisschock und Inflation.
Ein staatliches Sparprogramm kann vielleicht helfen, wenn die Wirtschaft brummt und überhitzt, wenn die Auftragsbücher überall gut gefüllt sind, Vollbeschäftigung herrscht, jeder Beschäftigte mehrere Jobs zur Auswahl hat und Gewerkschaften auf breiter Front massive Lohnsteigerungen durchboxen. Das ist nämlich die klassische Inflation, bei der die Firmen mit dem Produzieren kaum hinterherkommen und die Löhne die Preise treiben. Lindners Sparplan würde eine solche Wirtschaft ausbremsen und damit Druck von Preisen und Löhnen nehmen. Es gibt nur ein Problem: In dieser Situation waren und sind wir nicht.
Denn spätestens im Herbst 2022 kippte die Stimmung, nahezu alle Wirtschaftsinstitute schlugen Alarm: Deutschland rollt auf eine Krise zu! Die Auftragseingänge in der Industrie waren gesunken, die Konsumstimmung war auf einem Rekordtief, die Umsätze im Einzelhandel waren zurückgegangen – alle Zeichen standen auf Wirtschaftskrise. Kein Wunder, denn die deutsche Wirtschaft erlebte einen »Sandwichschock«. Von der einen Seite drückten die steigenden Energiekosten und die Sorge vor einem Gasmangel, was die Produktionskosten nach oben trieb und langfristige Planungen auf den Kopf stellte; von der anderen Seite drohte die Nachfrage einzubrechen, weil die Verbraucher ihre Kaufkraft zunehmend an der Tankstelle, beim Versorger und im Supermarkt lassen mussten. Anders gesagt: Steigende Kosten trafen auf sinkende Nachfrage. Eine Albtraum-Kombination für Firmen.
Die Entlastungspakete der Ampel waren deshalb nicht nur wichtig, um die Folgen der Krise bei den Ärmsten abzufedern, sondern auch, um den Sandwichschock für die Wirtschaft zu dämpfen. Die Entlastungen haben Kosten gesenkt und die Nachfrage gerettet. Beides war extrem wichtig, um Unternehmen davor zu bewahren, vom Sandwichschock erdrückt zu werden und eine mögliche Pleitewelle zu verhindern.
Wenn der Staat in so einer Situation auch noch mithilfe einer Sparpolitik auf die Bremse steigt, wird es nur noch schlimmer. Eine unkontrollierte Pleitewelle, ausgelöst, weil dem Friseur, dem Bäcker und dem Kinobetreiber die Kunden wegbrechen, ist keine Erfolg versprechende Strategie fürs Gassparen. Klar, theoretisch kann man sagen: Wenn Läden dichtmachen, wird dort immerhin kein Wasser, kein Strom und keine sonstige Energie verbraucht. Der Friseurbetrieb zum Beispiel ist aber nun wahrlich kein Energiefresser. Ähnlich wie viele andere Dienstleister auch nicht. Wenn diese Läden verschwinden, wird es leer und dunkel in den Innenstädten. Für die Kunden bricht die Nahversorgung weg, für die Angestellten Job und Einkommen, für den Eigentümer die wirtschaftliche Existenz, für den Vermieter das Mieteinkommen, für die Wirtschaft als Ganzes ein kleines Stückchen Wohlstand, für alle Betroffenen ein großes Stückchen Vertrauen in die Politik. Und das ist erst recht problematisch, nachdem die Corona-Krise bereits eine ungerechte Schneise der Verwüstung bei Dienstleistern, bei kleinen Selbstständigen und bei Malochern mit bescheidenem Einkommen hinterlassen hat. Gas hingegen wird nicht in nennenswertem Umfang gespart. Die Kosten sind groß, der Nutzen klein.
KÖNNEN DIE TECHNOKRATEN ES RICHTEN?
Große Kosten, kleiner Nutzen – das gilt auch für die Strategie, die Zentralbanken seit dem Sommer 2022 verfolgen. Die Europäische Zentralbank (EU), die Bank of England (Großbritannien) und die Federal Reserve (USA) liefern sich einen Wettlauf darum, wer die Zinsen am schnellsten anheben kann. Alle drei sind nämlich für stabile Preise zuständig. So sehen es die für die Zentralbank gemachten Gesetze vor. Die meisten Ökonomen und Politiker sind bis heute überzeugt, dass das eine gute Idee ist und die Zentralbanken also die richtigen Werkzeuge gegen die Inflation haben.
Dabei wirken die Zentralbanken seit Jahren so, als seien sie mit ihrer Aufgabe heillos überfordert, allen voran die europäische. Nach der Eurokrise rund ums Jahr 2010 versuchte sie alles, um die Wirtschaft in Gang zu bringen und die Inflationsrate auf das erklärte Ziel von 2 Prozent zu hieven. Sie senkte die Zinsen bis auf null, berechnete den Banken sogar Minuszinsen für ihre Einlagen bei der Zentralbank und kaufte Staatsanleihen in Billionenhöhe. Mit anderen Worten: Sie ging all in, sie tat alles, was in ihrer Macht stand – und scheiterte. Schließlich lag die Inflationsrate ab 2012 fast immer deutlich unter der Zielmarke von 2 Prozent, wie die Grafik unten zeigt. 2015, 2016 und 2020 kratzte die Rate sogar an der Nullprozentgrenze zur Deflation. Warum, dazu werden wir noch kommen.
Inflationsrate in der Eurozone
Heute ist die Aufgabe eine andere, ungleich schwierigere, nämlich, die Inflationsrate zu senken, statt sie zu erhöhen. Der Plan der Zentralbank ist dabei folgender: Geld »teuer machen«. Denn wenn die Zentralbank die Zinsen anhebt, müssen Banken Kredite »teurer machen«, verlangen also auch höhere Zinsen von ihren Kunden. Teurere Kredite aber erschweren Firmen, ihre geplanten Investitionen zu finanzieren. Die Anschaffung neuer Maschinen, der Bau von neuen Produktionshallen und solche Investitionen, die mit niedrigen Finanzierungskosten gerechnet wurden, müssen dann erst einmal verschoben werden. Weil sie sich nicht mehr rechnen oder zu riskant sind, wenn die Wirtschaft stottert. Eigentlich alle Investitionen, die nicht gerade unvermeidlich sind, werden somit erschwert. Und damit eben auch Investitionen in effizientere und grünere Energieversorgung, obwohl es genau die angesichts von Energie- und Klimakrise dringender denn je bräuchte.
Auch der Staat muss nach Zinserhöhungen der Zentralbank mehr Zinsen zahlen, wenn er Anleihen verkauft. Das führt wegen der Schuldenbremse zu Spardruck, denn sie begrenzt, wie viel mehr der Staat ausgeben darf, als er über Steuern einnimmt. Als Folge legt die Regierung vielleicht geplante öffentliche Investitionen auf Eis oder kürzt Sozialleistungen, um Geld einzusparen und die Schuldenbremse einzuhalten.
Ob bei den Firmen oder beim Staat, die Zentralbank will mit der Erhöhung der Zinsen bewirken, dass weniger Geld ausgegeben wird. In der Wirtschaft sorgt das nicht für Hochstimmung. Denn wenn gespart und weniger investiert wird, laufen die Geschäfte schlechter, Menschen verlieren ihren Job und ihr Einkommen, die Wirtschaft wird ausgebremst. Dieses Ausbremsen wiederum soll Firmen dazu bringen, ihre Preise zu senken, und Gewerkschaften davon abhalten, höhere Löhne zu fordern. Im Grunde wirkt das so ähnlich wie Lindners Sparplan, beides zielt darauf ab, die Nachfrage zu dämpfen, würgt aber gleichzeitig die Wirtschaft unkontrolliert ab. Auch hier stellt sich die Frage: Wie soll knappes Gas, Preistreiber Nr. 1, dadurch günstiger werden?
Darauf hat die Zentralbank keine vernünftige Antwort. Joachim Nagel, Präsident der Bundesbank, der für Deutschland im Entscheidungsgremium der Europäischen Zentralbank (EZB) sitzt, sieht das selbst ein, wenn er sagt: »Wir haben einen Energiepreisschock, an dessen Wirkung wir kurzfristig nicht viel ändern können.«4 Bei der EZB hofft man derweil auf Küchenpsychologie. Wenn nur alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer der EZB zutrauen, dass die Inflationsrate mithilfe hoher Zinsen fällt, werden sie auf hohe Lohnsteigerungen und Preisanpassungen verzichten, so die Hoffnung. Mehr zu dieser Prophezeiung, die sich selbst erfüllen soll, später. Es zeigt sich jedenfalls – so viel sei schon jetzt verraten –, dass die Zentralbank mit ihrer Aufgabe überfordert ist. Sie hat lediglich den Zinshammer in ihrem Werkzeugköfferchen und nutzt ihn, um eben irgendwas gemacht zu haben. Doch der Aktionismus hat ungemütliche Nebenwirkungen. Für die Firmen, die deshalb pleitegehen; für die Malocher, die deshalb ihren Job verlieren und in (Energie-)Armut rutschen; für die Häuslebauer, die Probleme mit ihrer Anschlussfinanzierung bekommen; und für die Banken, bei denen Kredite ausfallen. Die Nebenwirkungen redet Nagel klein. Das sei eben eine »Durststrecke«, die es zu überwinden gelte.5 Am Ende seien stabile Preise wichtiger, ein kurzzeitiger Wirtschaftseinbruch kann in Kauf genommen werden, so Nagels Überzeugung. Am Ende droht das Szenario Operation gelungen, Patient tot.
Am Rande: Im selben Interview, in dem Nagel zu Protokoll gibt, dass die EZB gegen den Energiepreisschock machtlos sei, aber trotzdem die Zinsen anhebe, wird er von den SZ-Journalisten gefragt, ob er zu Hause und in seinem Büro noch heize oder im Winter einen dicken Pulli tragen werde. Nagel beteuert, zu Hause sparsam zu heizen und auch im Bundesbank-Gebäude das Thermometer maximal auf 19 Grad zu stellen. »Ein dicker Pulli liegt bisher noch nicht in meinem Büro. Den werde ich mir aber demnächst mitbringen«, fügt er hinzu. Die Botschaft: Ich bin einer von euch. Das ist aus zwei Gründen zynisch. Erstens, weil er als Präsident der Bundesbank 484 762,78 Euro im Jahr verdient.6 Der Preisschock geht an ihm komplett vorbei, höhere Zahlen auf seiner Nebenkostenabrechnung müssen ihn schlicht nicht interessieren. Und zweitens, weil er dafür verantwortlich ist, dass Tausende Menschen durch die Zinserhöhungen ihren Job verlieren. »Wir werden vorübergehend sicher einen Anstieg der Arbeitslosigkeit sehen«, gesteht er selbst im Interview, als ginge es nur um Zahlen, nicht um Existenzen und Abstiegsangst. In dem Licht betrachtet ist seine Botschaft heuchlerisch – erst recht, wenn man bedenkt, dass er auf Vorschlag der Sozialdemokraten zum Präsidenten ernannt wurde.
Ohnehin ist das, was eine Zentralbank darstellt, macht und machen kann, sehr weit weg von denen, die Deutschland mit ihrer täglichen harten Arbeit am Laufen halten. Dass die Zentralbank mit höheren Zinsen für mehr Arbeitslose und weniger Lohnzuwachs sorgen will, ist den wenigsten bewusst. Selbst denen, die sich politisch interessieren, abends die »Tagesschau« einschalten und beim Pendeln zur Arbeit die Nachrichten im Radio verfolgen. Aber es ist ein Problem, dass sich die Technokraten in den Streit um die Verteilung des Kuchens mächtig einmischen. Die Zinserhöhungen werden zum Nachteil derer umgesetzt, die den Preisschock mit kleinem Geldbeutel zu wuppen haben.
MIT MYTHEN AUFRÄUMEN
Schnell wird klar: Im Vergleich zu einer klassischen Inflation ist der Energiepreisschock verdammt kompliziert für die Politik. Aus Reflex zu den alten Hebeln zu greifen, kann gefährlich werden, etwa wenn Christian Lindner mit Sparmaßnahmen oder die Zentralbank mit Zinserhöhungen riskieren, die Wirtschaft auf Talfahrt zu schicken. Vielleicht wird es Zeit, einzusehen, dass die EZB seit zehn Jahren mit ihrer Aufgabe überfordert ist? Vielleicht sollte man überlegen, ihr die Verantwortung für die Inflationsrate abzunehmen, und sie lieber der Politik übergeben? Schließlich haben Finanz-, Wirtschafts- und Arbeitsministerien viel mehr Einfluss auf die Wirtschaft als die Zentralbank.
Wenn es kompliziert wird für die Politik, haben »Vereinfacher« und Scharlatane Konjunktur. So war es während der Hochphase der Corona-Pandemie, so ist es auch beim Thema Inflation. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten Crashpropheten, die seit Jahren davor warnen, dass Niedrigzinsen, Gelddrucken und Schuldenmachen die Wirtschaft kollabieren lasse und mühsam Erspartes vernichtet werde. Irgendwann. Nicht selten bieten die Propheten eigene Finanzprodukte und Vermögensberatungen an – gerne auch Provision bringende Werbelinks zu Kryptobörsen – und werden dabei blind für ihren eigenen Interessenkonflikt. Der besteht darin, dass Gruselgeschichten über Finanzcrashs die Leute dazu bewegen, die Fonds und Beratungen der Crashpropheten zu kaufen. Oder auch dazu, bei Bitcoin oder anderen Krypto-»Währungen« einzusteigen, die die Crashpropheten hypen – und damit deren Kurse in die Höhe treiben. Angst sells ist das Motto. Wem finanzieller Verbraucherschutz am Herzen liegt, dem stellen sich die Nackenhaare auf.
Außerdem nutzen die Crashpropheten die Krise als Beleg für ihre Untergangsvorhersagen. »Seht nur, wir haben es euch immer gesagt, irgendwann kommt der Crash.« Zweistellige Inflationsraten seien jetzt die Quittung für zu viel Gelddrucken und zu viele Schulden. Dass es eine Corona-Pandemie und einen Krieg brauchte, um die Inflationsrate zweistellig werden zu lassen, spielt keine Rolle. Wenn überhaupt, sei das nur der Tropfen, der das Schuldenfass zum Überlaufen gebracht habe. Schuld sei der Staat, so viel sei sicher. Vor solchen Vereinfachern, die Angst und Crash als Geschäftsmodell betreiben, sei an dieser Stelle eindringlich gewarnt.
Mit zu viel Geld, das in Umlauf gebracht wird, oder zu vielen Staatsschulden haben weder Preisschock noch Inflation wirklich etwas zu tun, wie wir noch sehen werden. Im Gegenteil: Gegen den Energiepreisschock würde es sogar helfen, wenn der Staat mehr Geld ausgäbe. Um Entlastungen zu zahlen, LNG-Terminals zu bauen (was auch bereits getan wird), Solarpaneele zu installieren und die Nutzung der Windkraft auszubauen (hier herrscht noch Nachholbedarf). Das machte Deutschland nämlich unabhängiger von teurer fossiler Energie – und senkte die Preise.
Schon dieser erste Blick auf die Themen, die wir im Laufe des Buches näher betrachten werden, zeigt: Inflation ist komplex. Wir werden viele Steine umdrehen müssen, um sie zu verstehen. Und wir kommen nicht umhin, uns vielen, teilweise weit verbreiteten Missverständnissen zu stellen. Ich kann versprechen, dass jeder, der das Buch gelesen hat, danach in Talkshows zum Thema mitdiskutieren könnte und in Zukunft weder leeren Floskeln des Finanzministers noch Crashpropheten im Internet auf den Leim gehen wird.
1
Wenn die Wirtschaft fiebert – und der Alltag teurer wird
Über Inflation wird oft gesprochen, als wäre sie eine Krankheit. Das Symptom: Die Preise steigen wie Fieber bei einer Grippe. Um aber die Ursache herauszufinden, braucht es die richtige Diagnose. Schließlich behandelt man – wie wir mittlerweile alle wissen – eine Corona-Infektion auch nicht wie eine Wintergrippe. Der Arzt benötigt die richtige Diagnose, um die richtige Medizin verschreiben und eine Therapie anordnen zu können. Die Politik braucht ebenfalls die richtige Diagnose, um die Inflation einzudämmen – und sie am besten in Zukunft zu verhindern.
Die Profis vom Statistischen Bundesamt setzen jeden Monat das Fieberthermometer an und messen die Temperatur, also die Inflationsrate. Ist diese erhöht, hat die Wirtschaft Fieber. Was die Ursache ist, lässt sich daran allerdings noch nicht ablesen.
FIEBERMESSEN, ABER KOMPLIZIERT
Im Vergleich zum wirklichen Fiebermessen ist der Job der Statistiker leider sehr viel komplizierter. Sie messen an jedem Monatsende das Preisniveau und vergleichen es mit dem Wert des vorangegangenen Jahres. Eine Inflationsrate von 10 Prozent bedeutet, dass die Preise heute 10 Prozent höher sind als vor einem Jahr. Die Komplikationen fangen jedoch schon bei der Frage an, was »das Preisniveau« eigentlich ist. Denn dahinter steckt die abstrakte Idee, alle Preise, die es am Tag der Messung in ganz Deutschland gibt, in einem Wert abzubilden. Beobachten oder ablesen lässt sich »das Preisniveau« natürlich nicht. Außerdem können die Statistiker gar nicht alle Preise kennen. Wenn Bäcker Lutze neue Preisschilder an die Rosinenschnecken macht, bekommen die Statistiker das selbstverständlich gar nicht mit.
Das Preisniveau muss dennoch irgendwie berechnet werden. Genau das machen die Statistiker mit dem sogenannten Verbraucherpreisindex, kurz VPI. Der soll die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen messen, die in Deutschland verbraucht werden. Dafür legen die Statistiker einen Warenkorb fest, der 650 Güterarten umfasst. Darin enthalten sind Lebensmittel, Kleidung, Möbel, Tickets für Kino und ÖPNV, Bücher, Mieten, Kraftstoffe, Heizkosten, Strom und so weiter. Alle Güter werden dann noch einmal so gewichtet, dass sie den Verbrauch eines durchschnittlichen Haushalts in Deutschland abbilden. Dafür machen die Statistischen Landesämter alle fünf Jahre die sogenannte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Rund 60 000 Teilnehmer zeichnen einige Monate lang freiwillig ihre Einnahmen und Ausgaben auf. Daraus kann anschließend errechnet werden, wie viel deutsche Haushalte im Schnitt wofür ausgeben. Ausgaben für Nahrungsmittel machen zum Beispiel in der aktuellen Gewichtung knapp 10 Prozent aus, Tabak und Alkohol 4 Prozent, Kleidung 5 Prozent, Verkehr 7 Prozent, Möbel und Haushaltsgeräte 5 Prozent, Bildung 9 Prozent, Gesundheit 5 Prozent, Kultur 11 Prozent, Restaurants und Hotels 5 Prozent, Mieten 20 Prozent und Energie rund 13 Prozent.
Für die Messung werden jeden Monat von den Statistikämtern mehr als 300 000 Einzelpreise erhoben, manche einfach aus dem Internet, andere aber auch aufwendig vor Ort in ausgewählten Geschäften. Heraus kommt ein Index, der sich mit alten Messungen vergleichen lässt. Die Differenz zum Vorjahr ist die Inflationsrate.