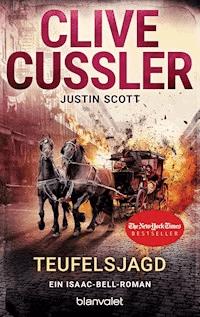
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Isaac-Bell-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Das organisierte Verbrechen hat einen neuen Gegner – Isaac Bell.
1906: In New York City terrorisiert die Schwarze Hand, eine Bande italienischer Krimineller, die Geschäftsleute. Kidnapping, Erpressung und Raub – und gerne auch der Einsatz von reichlich Dynamit – sind ihre Mittel. Da verbünden sich ihre Opfer und heuern Isaac Bell von der Van-Dorn-Agency an, um die Schwarze Hand zu bekämpfen. Bell versammelt eine Einheit harter Männer um sich und durchstreift die Stadt nach Spuren der Hintermänner. Doch die zählen zu den mächtigsten Männern der USA …
Die besten historischen Actionromane! Verpassen Sie keinen Fall des brillanten Ermittlers Isaac Bell. Jeder Roman ist einzeln lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Autoren
Seit Clive Cussler 1973 seinen ersten Helden Dirk Pitt erfand, ist er auch auf der deutschen Spiegel-Bestsellerliste ein Dauergast. 1979 gründete er die reale NUMA, um das maritime Erbe durch die Entdeckung, Erforschung und Konservierung von Schiffswracks zu bewahren. Er lebt in der Wüste von Arizona und in den Bergen Colorados.
Justin Scott ist ein Bestsellerautor von Thrillern, Krimis und historischen Romanen. Er wurde für seine Krimis bereits mehrmals für den renommierten Edgar-Allan-Poe-Preis nominiert. Er lebt mit seiner Frau Amber in Connecticut, USA.
Liste der lieferbaren Isaac-Bell-Romane:
1. Höllenjagd
2. Sabotage
3. Blutnetz
4. Todesrennen
5. Meeresdonner
6. Die Gnadenlosen
7. Unbestechlich
8. Der Attentäter
9. Teufelsjagd
Clive Cussler& Justin Scott
TEUFELSJAGD
Ein Isaac-Bell-Roman
Deutsch von Michael Kubiak
Handelnde Personen
1895
Antonio Branco Sizilianischer Immigrant »Spitzhacken- und Schaufelmann«.
Der Padrone Arbeitsvermittler und Subunternehmer, Antonio Brancos Boss.
Isaac Bell, Doug, Andy, Larry, Jack, Ron College-Studienanfänger, Kommilitonen.
Mary Clark Studentin in Miss Porter’s School.
Eddie »Kansas City« Edwards Van-Dorn-Detektiv.
1906
White Hand
Maria Vella Giuseppe Vellas zwölfjährige Tochter.
Giuseppe Vella New Yorker Bauunternehmer, spezialisiert auf Tiefbauprojekte.
David LaCava Bankier in Little Italy, Inhaber der Banco LaCava.
Sante Russo Giuseppe Vellas Vorarbeiter und Sprengmeister.
Black Hand
Antonio Branco Wohlhabender Lebensmittelgroßhändler, Lieferant und Versorger der beim Bau des Catskill Aqueduct beschäftigten Arbeiter.
Charlie Salata Anführer einer italienischen Straßenbande, Erpresser der Black Hand.
Vito Rizzo Leutnant der Salata Gang.
Ernesto Leone ein Geldfälscher.
Roberto Ferri ein Schmuggler.
Francesca Kennedy ein Auftragsmörder.
Irische Gangster
Ed Hunt, Tommy McBean Cousins, ehemalige Angehörige der Gopher Gang, Gründer der West Side Wallopers.
Van Dorn Detective Agency
Joseph Van Dorn Gründer und Chefermittler, der »Boss« oder der »Alte«.
Isaac Bell Van Dorns Spitzenkraft, Gründer der Black Hand Squad.
Wally Kisley, Mack Fulton Sprengstoffexperte und Geldschrankspezialist; Partner, als »Weber & Fields« bekannt – ein seinerzeit populäres Komikerduo.
Harry Warren Geburtsname Salvatore Guaragna, Chef der New York Gang Squad.
Archibald Angell Abbott IV. Blaublütiger New Yorker, Princeton-Absolvent, ehemaliger Schauspieler, Boxer, Isaac Bells bester Freund.
Aloysius »Wish« Clarke Wegen Trunksucht suspendiert.
Eddie »Kansas City« Edwards Eisenbahnspezialist.
Bronson Detektiv in der San-Francisco-Filiale.
Grady Forrer Chef der Recherche-Abteilung, New Yorker Filiale.
Scudder Smith Ehemaliger Zeitungsreporter, kennt sich in Prostitution und Halbwelt bestens aus.
Eddie Tobin Detektiv in Ausbildung.
Richie Cirillo Detektiv in Ausbildung, minderjährig.
Helen Mills Praktikantin bei Van Dorn, Isaac Bells Protegé, Bryn-Mawr-College-Studentin, Tochter von Brigadegeneral Gary Tannenbaum Mills der U. S. Army.
Freunde von Isaac Bell
Marion Morgan seine Verlobte.
Enrico Caruso weltberühmter Operntenor.
Luisa Tetrazzini Koloratursopranistin, die »Florence Nightingale«, ein aufgehender Stern am Opernhimmel.
Tammany Hall
Boss Fryer »Honest Jim« Fryer, politisches Schwergewicht in New York City.
Brandon Finn Boss Fryers Handlanger.
»Rose Bloom« Brandon Finns Geliebte.
Alderman James Martin Mitglied des »Boodle Board«.
»Kid Kelly« Ghiottone ehemaliger Bantamgewichtsboxer, Salooninhaber, Gefolgsmann der Tammany Hall Society in Little Italy.
Plutokraten
J. B. Culp Wall-Street-Magnat, Hudson-Valley-Aristokrat, Erbe von Dampfschiff- und Eisenbahngesellschaften, Gründer des exklusiven Herrenclubs Cherry Grove Society.
Daphne Culp J. B. Culps Ehefrau.
Brewster Claypool J. B. Culps Rechtsanwalt.
Warren D. Nichols Bankier, Philantrop, Mitglied der Cherry Grove Society.
Lee, Barry Preisboxer, J. B. Culps Leibwächter und Sparringspartner.
Polizisten
Captain Mike Coligney Vorsteher des Tenderloin Precinct des NYPD.
Lieutenant Joe Petrosino Gründer der Italian Squad des NYPD.
Chris Lynch Agent der Falschgeld-Abteilung des Secret Service.
Rob Rosenwald Spürhund des Bezirksstaatsanwalts von New York.
Commissioner Bingham neuer Chef des NYPD, leitete seine Umstrukturierung ein.
Sheriff von Orange County
Cherry Grove Bordell
Nick Sayers Inhaber.
Jenny Angestellte.
The White House
Theodore Roosevelt »Teddy«, »TR«, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Held des Spanisch-Amerikanischen Kriegs, ehemaliger Gouverneur des Staates New York, ehemaliger Polizeipräsident von New York City.
Chef der Secret-Service-Schutztruppe des Präsidenten
Catskill Aqueduct
Dave Davidson Bediensteter der Contractors’ Protective Association, zuständig für die Organisation der Arbeitslager.
Bauunternehmer
Irischer Vorarbeiter und Baustellenleiter
Prolog
Mord und StudentenulkNew Haven, 1895
Ein italienischer Spitzhacken- und Schaufelmann stand bis zur Brust in einem Graben und blickte auf ein Paar maßgefertigter Schuhe und schwarzer Baumwollhosenbeine, nur wenige Zentimeter von seinem Gesicht entfernt. Amerikanische Studenten – offenbar aus reichen Elternhäusern – trugen einen Erdhaufen in der Nähe ab und siebten sandiges rötliches Erdreich durch ihre Finger.
Der irische Baustellenleiter saß entspannt unter einem Sonnenschirm auf einem Stuhl und drohte dem Italiener mit der Faust.
»Beweg dich gefälligst, fauler Spaghettifresser!«
Die Studenten achteten nicht darauf. Anlässlich einer außerplanmäßig anberaumten Exkursion von der regulären Geologie-Vorlesung befreit, suchten sie in dem frisch ausgehobenen Erdreich nach Spuren triassischen Gesteins, das von Gletschern im Hochland oberhalb der New-Haven-Senke abgeschliffen wurde. Sie genossen es, diesen ersten warmen Frühlingstag im Freien zu verbringen, und Italiener, die mit Spitzhacke und Schaufel tiefe Erdlöcher gruben und Gräben anlegten, waren ein ebenso selbstverständlicher Anblick wie die rotgesichtigen irischen Vorarbeiter mit Melonen auf den Köpfen.
Aber der Padrone der Italiener – so nannten die Immigranten den Arbeitsvermittler, dem sie einen erheblichen Teil ihres täglichen Arbeitslohns als Provision zahlen mussten – registrierte das kurze Intermezzo. Der Padrone war ein extravagant gekleideter und parfümierter Neapolitaner, der wachsam auf seinen Profit achtete. Er winkte dem Arbeiter, der gerade eine Pause eingelegt hatte, um seine einheimischen Mitgrabenden zu beobachten – dies war ein junger Sizilianer, der sich Antonio Branco nannte.
Antonio Branco sprang mühelos aus der Grube auf die Grasnarbe. Seine Kleider rochen durchdringend nach Schweiß, und nur wenig unterschied ihn von den anderen, die in dem Graben schufteten. Er gehörte zu den Hilfsarbeitern, hatte eine schmuddelige Mütze auf dem Kopf, wobei sein Gesicht ein wenig attraktiver und markanter sein mochte als die der meisten anderen, außerdem wirkte er von Statur größer und breiter in den Schultern. Und dennoch hatte er etwas an sich, das ihn von den anderen unterschied. Er machte einen zu selbstsicheren Eindruck, entschied der Padrone.
»Du lässt mich vor dem Vorarbeiter schlecht aussehen.«
»Seit wann geben Sie etwas auf die Meinung eines Micks?«
»Dafür behalte ich die Hälfte deines Lohns ein. Geh zurück an die Arbeit.«
Brancos Miene verhärtete sich. Als er jedoch nichts anderes tat, als in den Graben hinabzuspringen und seine Schaufel aufzuheben, wusste der Padrone, dass er seinen Mann richtig eingeschätzt hatte. In Italien behielten die Carabinieri Kriminelle unter strengster Kontrolle. Als Flüchtiger, der es geschafft hatte, sich der Überwachung zu entziehen und in die Freiheit Amerikas zu entkommen, konnte sich Antonio Branco nicht dagegen wehren, wenn ihm der Arbeitslohn gekürzt wurde.
Der letzte der fünf College-Frischlinge schloss die Tür und sperrte die Kakophonie aus Klavier- und Banjo-Geklimper, Klamaukgeschrei und sonstigem Lärm in den Fluren und Zimmern des Studentenwohnheims Vanderbilt Hall aus. Dann versammelten sie sich um einen hochgewachsenen, spindeldürren Klassenkameraden und lauschten gebannt seinem Plan, den Mädchen in Miss Porter’s School in Farmington, vierzig Meilen landeinwärts, einen Besuch abzustatten. An diesem Abend. Sofort.
Sie wussten nur wenig von ihm. Er kam aus Boston, seine Familie bildete eine Dynastie aus Bankiers und Harvard-Absolventen. Dass er sich in Yale eingeschrieben hatte, ließ auf eine rebellische Ader schließen. Er hatte stets ein Lächeln um die Lippen und dabei einen festen, klaren Blick, und offenbar hatte er an alles gedacht – eine Landkarte, eine Waltham-Eisenbahneruhr, die um höchstens dreißig Sekunden pro Tag von der genauen Zeit abwich, sowie einen speziellen, für den dienstlichen Gebrauch erstellten Fahrplan, in dem Fahrtzeiten und Streckenbelegungen aller Güter- und Personenzüge der Eisenbahnlinie verzeichnet waren.
»Was ist, wenn uns die Mädchen gar nicht sehen wollen?«, fragte Jack, ein ständiger Bedenkenträger.
»Wie könnten sie einem Yale-Mann in einem Sonderzug widerstehen?«, fragte Andy.
»In einem gestohlenen Sonderzug«, sagte Ron.
»In einem ausgeborgten Sonderzug«, korrigierte ihn Larry. »Es ist ja nicht so, dass wir ihn behalten wollen. Außerdem ist es kein vollständiger Zug, sondern bloß eine Lokomotive.«
Doug stellte die Frage, die jedem in der Gruppe auf der Zunge brannte. »Weißt du überhaupt, wie man eine Lokomotive bedient?«
»Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.«
Isaac Bell verstaute Karte, Uhr und Fahrplan in einer Schultertasche, die bereits mehrere Paar Arbeitshandschuhe, eine Blendlaterne und eine dicke Ausgabe von Grimshaws Locomotive Catechism enthielt. Doug, Ron, Andy, Jack und Larry folgten ihm dichtauf, als er durch die Tür hinausschlüpfte.
Little Italy, das italienische Viertel New Havens, war direkt neben dem Eisenbahndepot entstanden. Die Dampfpfeifen der Lokomotiven und die Warnglocken der Rangierloks intonierten gerade ihre allnächtliche Serenade, der Kohlenrauch süßte den Gestank, der aus den Kaminen der Gummifabrik aufstieg und sich über den Dächern der Mietskasernen ausbreitete, und in diesem Augenblick trat der Padrone aus seinem Lieblingsrestaurant auf die Straße.
Vom Wein leicht berauscht, blieb er mit dem Gefühl eines gefüllten Magens für einen Moment stehen und säuberte seine Zähne mit einem vergoldeten Zahnstocher. Dann schlug er den Heimweg ein, schlenderte durch die Wooster Street und beantwortete das unterwürfige Buona Sera, Padrone der Leute in den Hauseingängen und auf dem Bürgersteig mit einem gelegentlich herablassenden Kopfnicken. Er hatte die Pension, in der er residierte, schon fast erreicht, als er Antonio Branco im Schatten einer durchgebrannten Straßenlaterne erblickte. Der Sizilianer lehnte am Laternenmast und war gerade damit beschäftigt, mit einem Taschenmesser einen Bleistift anzuspitzen.
Der Padrone lachte spöttisch. »Wozu braucht ein Prolet, der nicht lesen kann, einen Bleistift?«
»Ich lerne.«
»Stupidaggine!«
Brancos Augen glitzerten, als er den Blick nach rechts und links schweifen ließ. Ein Polizist näherte sich auf seinem Streifengang. Um ihm Zeit zu lassen vorbeizugehen, holte Branco eine amerikanische Zeitung aus seiner Jackentasche und las eine Schlagzeile laut vor. »Unfall in Wasserstollen. Bauleiter getötet.«
Der Padrone kicherte belustigt. »Dann lies doch mal das Kleingedruckte.«
Branco fuhr umständlich mit dem Bleistift unter den Textzeilen entlang. Er tat so, als habe er Mühe, die langen Worte zu lesen, und übersprang die vielen kurzen. »Bauleiter Jake … Stratton … tödlich verletzt … als Bridgeport Wasserstollen einbrach. Er hinterlässt Ehefrau Katherine und Kinder Paul und Abigail. Vier italienische Arbeiter kamen ebenfalls zu Tode.«
Der Polizist bog um die Ecke und geriet außer Sicht. Die Bürgersteige hatten sich geleert, und die wenigen Passanten, die es eilig hatten, nach Hause zu kommen, kümmerten sich um ihre eigenen Angelegenheiten und achteten nicht auf ihre Umgebung. Branco rammte den Bleistift durch die Wange des Padrone.
Der Padrone schlug die Hände vors Gesicht, wodurch sein Brustkorb ungeschützt war.
Branco stieß zu. Sein Taschenmesser hatte eine kurze Klinge, deutlich kürzer als die zehn Zentimeter, die gesetzlich erlaubt waren. Aber der Griff, aus dem sie herausragte, war fast genauso schmal wie die Klinge selbst. Während der Stahl zwischen den Rippenknochen eindrang, legte Branco die Handfläche auf den Messergriff und drückte mit aller Kraft dagegen. Der schlanke Griff schob die Klinge noch tiefer in die Wunde hinein und trieb den nadelspitzen Stahl wie ein Stilett tief ins Herz des Padrone.
Branco nahm dem Sterbenden Geldbörse, Ringe und seinen goldenen Zahnstocher ab und rannte zum Gleisgewirr des Eisenbahndepots, wo er zwischen den Zügen untertauchte.
Lokomotive 106 seufzte und schnaufte wie ein schlafender Mastiff. Es war eine American Standard 4-4-0 mit vier Vorlaufrädern und vier hohen Antriebsrädern, die Isaac Bell bis zu den Schultern reichten. Als schwarze Silhouette vor dem von den Lichtern der Stadt erhellten dunstigen Himmel auf dem Schotterbett des Bahndamms thronend, in dessen Schatten die Collegestudenten kauerten, erschien sie geradezu gigantisch.
Bell hatte sie während der gesamten vorangegangenen Woche im Visier gehabt und jede ihrer Bewegungen beobachtet. Jeden Abend rollte sie zur Bekohlungsanlage und zum Wassertank, wo ihr Tender aufgefüllt wurde. Dann räumten die Eisenbahnarbeiter die Asche aus der Feuerbüchse, häuften frische Kohle auf, um die Dampferzeugung am nächsten Morgen zu beschleunigen, und parkten die Lokomotive auf einem Nebengleis am nördlichen Ende des Depots. An diesem Abend stand die 106 wie üblich in der richtigen Fahrtrichtung nach Norden zur Canal Line, die direkt nach Farmington verlief.
Bell wies Doug an, das Gleis entlangzurennen, um die Weiche zu stellen. Doug war Mitglied des Footballteams, stark, intelligent, schnell und damit genau der Richtige, um die Weiche zu schließen, die das Nebengleis mit dem Hauptgleis verband. »Sobald wir durchgefahren sind, öffne die Weiche wieder.«
»Weshalb?«
»Falls das Fehlen der Lok bemerkt wird, wissen sie nicht, wohin wir gefahren sind.«
»Du wärst ein erstklassiger Krimineller, Isaac.«
»Das ist auf jeden Fall besser, als geschnappt zu werden. Sobald du die Weiche geöffnet hast, nimm die Beine in die Hand, damit du uns einholst … Andy, du zündest die Lampen an … O. K., Leute. Auf geht’s. Los, los.«
Bell bildete die Vorhut und eilte nahezu lautlos und langbeinig über Schienen, Schwellen und Schotter. Die anderen Jungen folgten in geduckter Haltung. Die Angehörigen der Eisenbahnpolizei waren für ihr brutales Vorgehen berüchtigt, würden es jedoch wahrscheinlich nicht wagen, den Söhnen amerikanischer Wirtschafts- und Industriemagnaten auch nur ein Härchen zu krümmen. Aber sollten sie bei diesem Wahnsinnsunternehmen erwischt werden, würde der Yale-Kaplan ihre Relegation anordnen, was bedeutete, dass sie das College verlassen müssten und nach Hause zu ihren Eltern geschickt würden.
Doug sprintete vor der Lokomotive her, kniete sich neben die Weiche und legte die Hände um den schweren Hebel. Andy, dessen Vater ihn hinter den Bühnen seiner Varieté-Theater die Scheinwerfer hatte bedienen lassen, kletterte auf den Kuhfänger und zündete den Acetylenscheinwerfer an der Stirnseite der Lokomotive an, deren matter Lichtschein das Gleis erhellte. Dann sprang er auf den Bahndamm hinunter, rannte zur Rückseite des Tenders und zündete dort eine rote Laterne an.
Isaac Bell turnte die Leiter in den Führerstand hinauf. Er zog ein Paar Handschuhe aus seiner Schultertasche an, reichte Ron ein zweites Paar und deutete auf die Feuerungsklappe. »Die musst du öffnen und Kohlen hineinschaufeln.«
Ein Hitzeschwall schlug ihnen entgegen.
»Verteil die Kohle, damit das Feuer nicht erstickt wird.«
Im orangefarbenen Lichtschein der Kohlenglut in der Feuerbüchse suchte Bell die Kontrollen, deren Illustrationen im Handbuch für Lokomotivführer er sich eingeprägt hatte. Dann zählte er seine Begleiter durch. Alle drängten sich im Führerhaus – bis auf Doug, der an der Weiche wartete.
Bell schob den Steuerhebel nach vorn, löste die Druckluftbremsen und öffnete das Regelventil, um Dampf in die Zylinder einströmen zu lassen. Unter seinen Händen erwachte der Stahlkoloss zitternd zum Leben. Gerade noch rechtzeitig fiel ihm ein, das Dampfventil wieder so weit zu schließen, dass die Lokomotive keinen ruckartigen Satz vorwärts machte.
Seine Kommilitonen stießen Freudenrufe aus und klopften ihm anerkennend auf die Schultern. Die Lokomotive rollte los.
»Stopp!«
Der Bahnpolizist war ein Berg von einem Mann mit einer Blendlaterne an seinem Gürtel und einem Schlagstock in der Faust, der einen Meter lang war. Er bewegte sich erstaunlich schnell, um Antonio Branco gegen die Seitenwand des Güterwagens zu nageln, unter dem er sich verstecken wollte, als der Schwellen-Cop ihn dabei überraschte. Damit ihn das grelle Licht nicht blendete, kniff Branco ein Auge zu einem schmalen Schlitz zusammen und schloss das andere vollständig.
»Wie vielen Spaghettifressern muss ich die Arme brechen, bis die Botschaft in euren Schädeln ankommt?«, brüllte der Bahnpolizist. »Keine Schwarzfahrten. Verschwinde aus dem Depot, und hier ist ein kleines Geschenk, damit du immer an mich denkst.«
Der Schlagstock sauste mit einer Wucht auf seinen Arm hinunter, die Knochen brechen sollte.
Branco drehte sich dem Schwung entgegen, krümmte sich und rettete seinen Arm auf Kosten eines brutalen Schlags auf sein linkes Knie. Während er nach vorn einknickte, zückte er sein Taschenmesser, öffnete es mit einer tausendfach geübten Bewegung, stieß es nach oben und schlitzte das Gesicht des Polizisten vom Kinn bis zur Stirn auf.
Der Mann stieß einen heiseren Schrei aus, während Blut in seine Augen strömte, ließ den Schlagstock fallen und presste beide Hände auf sein zerfleischtes Gesicht. Branco flüchtete stolpernd in die Dunkelheit. Sein Knie brannte, als ob es in flüssiges Blei eingetaucht sei. Sich Schritt für Schritt vorwärtskämpfend, humpelte er zu dem leeren und verlassenen nördlichen Ende des Depots und damit fort von den Lichtern und den Bahnpolizisten, die durch die Schreie sicherlich angelockt würden. Er sah eine rollende Lokomotive. Kein Rangierfahrzeug, sondern eine große Lok mit einer roten Signallaterne an der Rückwand des Tenders. Sie rollte in Richtung der Hauptstrecke. Es war vollkommen egal, wohin sie fuhr – Hartford, Springfield, Boston –, auf jeden Fall verließ sie New Haven. Vor Schmerzen würgend, als ob er sich jeden Moment übergeben müsste, stolperte er so schnell er konnte hinter ihr her, holte sie ein und schwang sich auf die Kupplung an der Rückseite des Tenders. Er spürte, wie die Räder über eine Weiche rumpelten und die Lokomotive nach und nach Tempo aufnahm.
Branco hatte gelernt, dass in Amerika Güterzügen keine Grenzen gesetzt waren. Das Land war riesengroß – dreißig Mal größer als Italien –, aber Tausende Meilen miteinander verflochtener Eisenbahnlinien ließen die Entfernungen schrumpfen. Jemand, der die Eisenbahnen benutzte, konnte in städtischen Little-Italy-Slums oder in Arbeiterbarackendörfern untertauchen. Die Polizei bekam nichts davon mit. Im Gegensatz zu den Carabinieri, die für die gesamte Nation zuständig waren, wussten amerikanische Cops nur über das Bescheid, was in ihrem jeweiligen eigenen Dienstbereich geschah.
Plötzlich zischten Bremsen. Die Räder rutschten kreischend über Stahl, und die Lokomotive hielt an.
Branco hörte jemanden durch die Dunkelheit rennen. Er rutschte von der Kupplung auf die Schwellen hinunter, schlängelte sich unter den Tender und zückte sein Messer. Ein Mann rannte an ihm vorbei. Schuhsohlen klirrten auf Eisensprossen, als er ins Führerhaus hinaufkletterte. Die Bremsen zischten abermals, diesmal jedoch, als sie gelöst wurden, und die Lokomotive setzte sich ruckend wieder in Bewegung. Mittlerweile hatte sich Antonio Branco in eine Nische im Fahrgestell gezwängt, und New Haven blieb hinter ihm zurück.
»Mehr Kohle, Ron! Doug, reich Ron eine Schaufel vom Tender. Larry, Jack, helft Doug!«
»Es gibt keine Schaufeln mehr, Isaac.«
»Dann nimm die Hände.«
Geschwindigkeit war das Wichtigste. Wenn Isaac Bell den Fahrplan für die Nacht richtig verstanden hatte, verkehrte auf der gesamten Strecke nach halb elf Uhr abends kein Zug mehr. Aber der Fahrplan warnte vor Wartungszügen und Schottertransporten, die möglicherweise auf den Gleisen unterwegs waren. Je weniger Zeit er sich auf der eingleisigen Strecke befand, desto besser. Bei sechzig Meilen in der Stunde würde er Farmington in vierzig Minuten erreichen. Er sah auf die Uhr. Fünf Minuten hatte er verloren, als er die Lokomotive wegen Doug angehalten hatte. Und der Geschwindigkeitsmesser zeigte nur vierzig Meilen in der Stunde an.
»Mehr Kohle!«
Die Jungen bildeten eine Kette und reichten Kohlen vom Tender nach vorn in den Führerstand. Ron schaufelte sie daraufhin ins Feuer. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, dann jedoch, langsam, aber stetig, nahm der Dampfdruck zu, und der Zeiger des Geschwindigkeitsmessers kroch Stück für Stück weiter, bis er verkündete, dass die Lokomotive mit sechzig Meilen in der Stunde über das Gleis rumpelte. Sobald der Zug dieses Tempo erreicht hatte und – da er keine schweren Wagen ziehen musste – auch hielt, konnte Isaac den Regler in Reiseposition ziehen und seinen erschöpften, rußgeschwärzten und verschwitzten Heizern eine Pause gönnen. Sie nutzten sie, um die Blasen in ihren bislang von schwerer körperlicher Arbeit verschonten Handflächen zu pflegen.
»Was ist das dort vor uns?«
Andy hatte den Kopf aus dem Seitenfenster geschoben, um einen Blick auf das Gleis zu werfen. Bell lehnte sich neben ihm hinaus und gewahrte in der Dunkelheit einen einzelnen matten Lichtpunkt in der Ferne. Er warf einen Blick auf die Uhr und zog seine Landkarte zu Rate. »Das ist die Station Mount Carmel.« Achteinhalb Meilen von New Haven entfernt. Zweiunddreißig Meilen lagen noch vor ihnen. Zu ihrem Glück war das Bahnhofsgebäude dunkel. Der Fahrdienstleiter, der sicherlich umgehend telegrafiert hätte, dass eine einzelne Lokomotive die Strecke unsicher machte, lag schlafend in seinem Bett.
Andy bat um die Erlaubnis, die Dampfpfeife zu betätigen. Bell verbot es ihm. Laut kreischend wie ein Schwarm Banshees durch die Nacht zu rasen – wenn auch nur eine kurze Strecke – wäre ihrem Plan, möglichst unbemerkt Connecticut zu durchqueren, keinesfalls förderlich.
Das Glück blieb ihnen hold, als die 106 die Kleinstadtbahnhöfe in Cheshire, Plantsville und Southington passierte – alle drei waren dunkel und schliefen. Aber die nächste Station war Plainville. Der in Fettschrift gedruckte Ortsname deutete an, dass ein großes Rangier-Depot vor ihnen lag, und tatsächlich: Als die 106 nach einer langgestreckten Kurve auf die Stadt zurollte, sah Bell, dass Bahnsteig und Bahnhofsgebäude hell erleuchtet waren.
Eisenbahner bevölkerten die Plattform, und er befürchtete sogar, dass sich Arbeiter auf den Gleisen aufhielten. Er griff nach dem Hebel, der die Luftdruckbremsen auslöste. Dann sah er, dass am Signalmast eine weiße Lampe brannte – laut dem Lokomotiven-Handbuch gab sie das reguläre Fahrtsignal.
»Andy, jetzt darfst du pfeifen.«
Andy zog an der Schnur, die vom Dach des Führerstands herabhing. Dampf strömte mit einem ohrenbetäubenden Geheul durch das Ventil aus. Männer auf der Plattform wichen erschrocken von der Bahnsteigkante zurück und verfolgten mit offenem Mund, wie die 106 mit sechzig Sachen durch den Bahnhof Plainville donnerte.
Bell erhob die Stimme, damit ihn alle trotz des Lärms verstehen konnten.
»Das Spiel ist aus!«
Die Jungen machten ihrer Enttäuschung mit einem kollektiven Seufzer Luft. »Was sollen wir jetzt tun, Isaac?«
»Wir biegen in Farmington ins Depot ab und machen uns zu Miss Porter’s querfeldein auf den Weg.«
Bell zeigte ihnen den Weg auf seiner Landkarte. Dann verteilte er Fahrkarten für eine einfache Fahrt von Plainville nach New Haven. »Und morgen früh geht es zurück zur Schule.«
»Ich sehe da Lichter vor uns!«, rief Andy, der aus dem Fenster schaute. Bell drosselte die Dampfzufuhr, die Lokomotive wurde langsamer, und er brachte sie mit einem behutsamen Bremsmanöver vollständig zum Stehen.
»Doug, da vorn ist deine Weiche. Beeil dich, sie wissen, dass wir kommen. Andy, Licht aus!«
Andy löschte den Scheinwerfer, und Doug rannte neben dem Gleis voraus, um die Weiche umzustellen und die Lokomotive ins Depot zu lenken, das sich bis zu den ersten Lichtern von Farmington erstreckte. Eine Stille trat ein, die nach dem Stampfen der Kolben beinahe gespenstisch erschien.
»Wartet«, warnte Bell flüsternd. Er hörte das Knirschen von Stiefeln auf Schotter. Dann nahm er im gedämpften Licht der Sterne eine Bewegung wahr.
»Jemand kommt in unsere Richtung!«, sagten Ron und Larry gleichzeitig.
»Wartet«, wiederholte Bell und lauschte angestrengt. »Er bewegt sich in die andere Richtung.« Er gewahrte eine Gestalt, die sich im Laufschritt von der Lokomotive entfernte. »Nur ein harmloser Tramp.«
»Polizei!« Eine Laterne kam schwankend auf sie zu.
Bell sah einen Polizisten durch einen Lichtkegel stolpern. Ein Nachthemd hing halb aus seiner Hose heraus, und er bemühte sich, Hosenträger über die Schultern zu schieben, während er rannte. »Stopp! Stehen bleiben!«
Eine Gestalt huschte durch denselben Lichtkegel, in dem Bell den Bahnpolizisten gesehen hatte.
Die schwankende Laterne änderte die Richtung und folgte dem zweiten Mann.
»Er jagt den Hobo.«
»Nichts wie weg, Leute. Das ist unsere Chance.«
Die Jungen suchten Schutz in der Dunkelheit. Bell blickte zurück. Der Tramp hatte eine seltsame Art zu rennen. Sein rechter Fuß schwang bei jedem Schritt zur Seite und erinnerte Bell an ein Pferd, das im Trab mit einem Huf seitlich ausschlug.
Ein zweiter Wachmann näherte sich im Laufschritt vom Bahnhofsgebäude. Er blies in eine Alarmpfeife und rannte hinter Bells Schulkameraden her. Bells Gewissen meldete sich. Er machte sich klar, dass es seine Schuld war, dass sie in diesem Depot gestrandet waren. Also rannte er so schnell er konnte hinter ihnen her, bis er zwischen sie und den Wachmann gelangte. Als dieser ihn bemerkte, machte Bell kehrt und rannte in die entgegengesetzte Richtung. Der Trick funktionierte. Der Polizist galoppierte hinter ihm her, und die anderen Jungen verschwanden in Richtung Stadt.
Während Bell auf eine Ansammlung von Frachthäusern und Bekohlungsstationen zusteuerte, hielt er sein Tempo, um seinen Vorsprung nach und nach zu vergrößern. Er lief im Zickzackkurs an den langgestreckten Frachthallen vorbei und nutzte sie als Deckung, um ungesehen zu einer Baumgruppe zu sprinten. Dort versteckte er sich und wartete. Der Frühling war noch zu jung, als dass die Äste und Zweige schon ausgeschlagen hätten. Kein Laub schirmte das helle Licht der Sterne ab, das von seinen Händen reflektiert wurde. Er ließ die Tasche von der Schulter rutschen und stellte sie zwischen die Füße, schlug den Kragen seiner Jacke um sein Gesicht hoch und versteckte die Hände in den Hosentaschen.
Er hörte Schritte. Dann mühsames Atmen. Der Tramp humpelte zwischen die Bäume. Er entdeckte Bell, griff in die Jackentasche und holte blitzartig ein Messer hervor, dessen Klinge im Sternenlicht kurz aufblitzte. Sollte er davonrennen?, überlegte Bell. Nein, entschied er. Auf keinen Fall durfte er dem Messer den Rücken zuwenden. Er hob die Tasche hoch, um das Messer abzuwehren, und ballte eine Hand zur Faust.
Während sie sich in einer Distanz von höchstens drei Metern gegenüberstanden, belauerten sie sich wortlos. Das Gesicht des Hobo war dunkel und unter dem Schirm seiner Mütze kaum zu erkennen. Seine Augen glitzerten wie die eines in die Enge getriebenen Raubtiers. Arme und Beine und der gesamte Körper waren so angespannt wie eine Spiralfeder. Isaac Bell spürte seinen eigenen Körper, jeder Muskel vibrierte.
Die Wachmänner bliesen in ihre Trillerpfeifen. Sie hatten sich zusammengetan, waren weit entfernt und suchten in der falschen Richtung. Der Hobo atmete keuchend. Sein Blick sprang zwischen Bell und den Alarmpfeifen hin und her.
Bell ließ die Schultertasche sinken und öffnete die Faust. Sein Instinkt hatte ihn das Richtige tun lassen. Der Tramp schob das Messer zurück in die Jackentasche und lehnte sich erschöpft an einen Baumstamm.
Bell flüsterte: »Ich zuerst.«
Er schlüpfte zwischen den Bäumen hindurch und entfernte sich.
Als er aus der Deckung eines Heuschobers zum Eisenbahndepot blickte, bemerkte er einen Schatten, der durch den Lichtkreis einer einsamen Lampe zwischen den Frachtlagern huschte. Der Hobo machte sich in der anderen Richtung aus dem Staub.
Jack, ihr notorischer Bedenkenträger, hatte sich gründlich getäuscht.
Als Bells Schulkameraden Kieselsteine gegen die Mauer des Wohnheims der Old Girls von Miss Porter’s School in der Main Street warfen, rissen die Mädchen sofort die Fenster auf und lehnten sich flüsternd und ausgelassen kichernd hinaus. Wer seid ihr? Wo wohnt ihr? Wie seid ihr mitten in der Nacht hierhergekommen?
Während die Jungen noch durch die nächtliche Landschaft stolperten, hatten sie schon entschieden, dass es für ihre Zukunft wohl am besten sei, nicht zu erwähnen, dass sie eine Lokomotive entführt hatten. Also einigten sie sich auf die Version, dass sie einen Sonderzug gemietet hätten, und Miss Porters Schülerinnen waren tief beeindruckt. »Nur um uns zu besuchen?«
»Es war jeden Penny wert«, versicherten Larry und Doug einstimmig.
Plötzlich bog ein hübsches blondes Mädchen in einem weißen wehenden Gewand um die Gebäudeecke und kam über die Wiese auf sie zu.
»Ihr solltet lieber verschwinden. Die Hausmutter hat Miller alarmiert.«
»Wer ist Miller?«
»Der Konstabler.«
Die Yale-Studenten traten eilig den Rückzug an – mit Ausnahme von Bell, der in das Licht trat, das aus dem Fenster drang, und mit einer eleganten Geste seine Mütze zog. »Guten Abend, Mary Clark. Ich freu mich riesig, dich wiederzusehen.«
»Isaac!«
Sie hatten sich einen Monat zuvor während eines gemeinsamen Schulausflugs kennengelernt.
»Was treibst du denn hier?«
»Du bist noch blonder und schöner, als ich in Erinnerung hatte.«
»Da kommt Miller schon. Verschwinde, du Idiot!«
Isaac Bell beugte sich galant über ihre Hand und rannte in die Dunkelheit. Die unvergessliche Miss Mary Clark rief ihm nach: »Ich werde Miller sagen, ihr wärt Studenten von der Harvard.«
Zwei Tage später betrat er das Büro des Bahnhofsvorstehers in New Haven und verkündete: »Ich bin Isaac Bell. Student im ersten Jahr an der Yale. Auf dem Campus gibt es Gerüchte, dass Detektive Ermittlungen wegen der Lokomotive 106 anstellen.«
»Was ist damit?«
»Ich bin derjenige, der sie ausgeliehen hat.«
»Setz dich dorthin! Rühr dich nicht vom Fleck. Die Polizei wird gleich da sein.«
Es dauerte eine Stunde, bis ein frühzeitig ergrauter Detective in einem Nadelstreifenanzug erschien. Er wurde von einem Mann mit massiger Gestalt begleitet, dessen Kopf mit einem Verband umwickelt war, der bis auf ein wütend funkelndes Auge sein gesamtes Gesicht bedeckte. Das Auge musterte Bell prüfend.
»Das ist kein Itaker«, murmelte der Mann unter dem Verband. »Ich hab euch doch gesagt, es war ein Spaghettifresser.«
»Er erzählt, dass er die 106 gestohlen hat.«
»Es interessiert mich nicht die Bohne, ob er einen ganzen verdammten Zug geklaut hat. Er ist auf keinen Fall der italienische Kanake, der mich aufgeschlitzt hat.«
Der grauhaarige Detektiv geleitete den großen Mann hinaus. Zwanzig Minuten später kehrte er zurück. Er setzte sich zu Bell und stellte sich als Detective Eddie Edwards vor. Dann holte er ein Notizbuch aus einer Jackentasche und schrieb in akkurater Handschrift mit, während er Bells Geschichte aufmerksam lauschte. Drei Mal verlangte er von Bell, sie zu wiederholen. Schließlich fragte er: »Hast du den Itaker gesehen, der dem Bahnpolizisten das Gesicht zerschnitten hat?«
»Nicht in New Haven, aber da war jemand im Depot in Farmington.« Bell schilderte ihm die Begegnung mit dem Hobo mit dem seltsam humpelnden Gang. »Er könnte unter dem Tender versteckt mitgefahren sein.«
»Ich gebe das an die Bahnpolizei weiter. Aber er dürfte es mittlerweile längst bis Boston geschafft haben.« Edwards trug diese neue Information in sein Notizbuch ein und klappte es zu.
Bell machte ein betretenes Gesicht. »Ich fände es schlimm, wenn ich einem Kriminellen zur Flucht verholfen hätte.«
»Jemand, der diesen Bahnpolizisten ausschalten konnte, war ganz sicher nicht darauf angewiesen, dass du ihm dabei hilfst, seinen Verfolgern durch die Lappen zu gehen. Komm, mein Junge, ich bringe dich zur Schule zurück.«
»Sie lassen mich also laufen?«
»Wie durch ein Wunder hat es bei deiner abenteuerlichen Nummer keine Toten oder Verletzten gegeben, und es wurde auch nichts beschädigt. Also hat die New Haven Railroad auch kein Interesse, dem Sohn eines Bostoner Bankiers, bei dem sie vielleicht irgendwann einen Kredit aufnehmen muss, Schwierigkeiten zu machen.«
»Woher wissen Sie, dass mein Vater Bankier ist?«
»Ich habe einem Kollegen in Boston telegrafiert.«
Sie gingen die Chapel Street hinauf, wobei Bell Detective Eddie Edwards’ Fragen nach Sehenswürdigkeiten in New Haven und Umgebung beantwortete. In Höhe der Green Street meinte Edwards: »Sag mal, ganz unter unter uns, wie viele Kumpels hast du gebraucht, um diese Sache durchzuziehen?«
»Ich hab’s allein getan«, sagte Bell.
Eddie Edwards musterte den jungen Studenten prüfend. Bell erwiderte den fragenden Blick. Edwards faszinierte ihn. Dieser Detective war im Gegensatz zu dem bedauernswerten Eisenbahnpolizisten, dessen Gesicht zersäbelt worden war, geradezu elegant gekleidet. Und er war ein menschliches Chamäleon mit seinem lässigen, freundlichen Umgangston, der einen scharfen analysierenden Blick und einen noch schärferen, wachsamen Verstand kaschierte. Er war deutlich jünger, als sein volles, fast weißes Haar vermuten ließ. Bell fragte sich, wo er seine Waffe haben mochte. In einem Schulterhalfter, vermutete er. Aber davon war nichts zu sehen.
»Schwer zu glauben, dass du das allein geschafft hast«, sagte Edwards nachdenklich. »Aber ich habe großen Respekt vor jedem, der für seine Freunde einsteht.«
»Um ehrlich zu sein«, sagte Bell, »selbst wenn mich Freunde begleitet hätten, wäre es ganz allein meine Idee gewesen.« Er zeigte dem Detective seine Landkarten, die Waltham-Uhr und den Fahrplan. »Kennen Sie Grimshaws Lokomotiven-Handbuch?«
»Gute Antwort, Junge. Und die Beweise lieferst du gleich mit. Und wechselst geschickt das Thema, mit nur einer einzigen Frage. Du wärst ein ganz schön ausgebuffter Gauner.«
»Könnte ich auch ein ausgebuffter Detektiv sein?«
Ein Lächeln spielte um Edwards’ Lippen, während er ernst und mit Nachdruck erwiderte: »Detektive helfen den Menschen, sie vergreifen sich nicht an ihrem Eigentum.«
»Mr. Edwards, sagten Sie nicht vorhin, dass Sie nicht bei der Eisenbahn angestellt sind?«
»Die Eisenbahnlinien rufen uns immer zu Hilfe, wenn es darum geht, besonders gerissene Übeltäter zu überführen.«
»Und für wen arbeiten Sie?«
Edwards straffte die Schultern und richtete sich zu seiner vollen Größe auf.
»Ich bin ein Van-Dorn-Detektiv.«
ELF JAHRE SPÄTER 1906
Buch ICaptain Coligneys
TEEKRÄNZCHEN
1
Little Sicily, New York CityElizabeth Street, zwischen Prince und Houston,der »Black Hand Block«
Die Black Hand hielt die zwölfjährige Maria Vella in einem Taubenschlag auf dem Dach eines Mietshauses in der Elizabeth Street gefangen. Die Gangster befreiten sie von dem Knebel, damit sie nicht erstickte. Nicht einmal ein so reicher Bauunternehmer wie ihr Vater würde für ein totes Mädchen Lösegeld zahlen, meinten sie und lachten, als hätten sie einen besonders guten Witz gemacht. Aber wenn sie es doch wagen sollte, um Hilfe zu rufen, meinten sie, dann würden sie sie schlagen. Nach einem brutalen Ruck an einem ihrer glänzenden Zöpfe quollen Tränen aus ihren Augen.
Sie versuchte das rasende Hämmern ihres Herzens zu bremsen, indem sie die Vögel beobachtete, immer in der Hoffnung, dass ihr friedlicher Anblick sie beruhigte. Sie gurrten leise, als ob sie sich miteinander unterhielten, unbeeindruckt vom Lärm des sichtlich heruntergekommenen Stadtviertels. Dabei ließen sie sich durch das Stimmengewirr und die lauten Rufe auf der Straße, das Gedudel einer Drehorgel und das Rattern und Surren der Nähmaschinen im Haus unter ihnen nicht stören. Dank der Spalten in einer Bretterwand, durch die Licht und Luft hereindrang, konnte sie erkennen, dass der Taubenschlag dicht neben der hohen Brüstung stand, die das Dach einrahmte. Gab es auf der anderen Seite dieser Brüstung jemanden, der ihr helfen könnte? Sie flüsterte ein Ave-Maria, um sich Mut zu machen.
»… Santa Maria, Madre di Dio,prega per noi peccatori,adesso e nell’ora della nostra morte …«
Sie schob einen Vogel aus dem Weg, kletterte auf seinen Nistkasten und stieg auf den nächsten, bis sie auf ein Mietshaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite blicken konnte, unter dessen Fenstern frisch gewaschene Wäsche zum Trocknen aufgehängt worden war. Sie kletterte höher und drückte den Kopf gegen die Decke, sodass ein Abschnitt des Bürgersteigs vier Stockwerke unter ihr in ihr Blickfeld geriet. Dort wimmelte es von Einwanderern. Fliegende Händler, Straßenkinder, Frauen, die in den zahlreichen Geschäften einkauften – nicht einer von ihnen konnte ihr helfen. Das alles waren Sizilianer, aus Europa übergesiedelte Arbeiter und Bauern, bettelarm, die sich vor den Obrigkeiten ihrer neuen Heimat mindestens genauso fürchteten, wie sie selbst vor ihren Entführern Angst hatte.
Sie klammerte sich an den beruhigenden Anblick von Menschen, die ihrem friedlichen Alltag nachgingen, einer Hausfrau, die mit einem frisch geschlachteten Huhn aus dem Metzgerladen kam, Arbeitern, die Wein und Bier trinkend auf der Eingangstreppe des Kips Bay Saloon saßen. Ein Lieferwagen ratterte vorbei, rot und grün lackiert und mit dem Namen des Inhabers – Branco’s Grocery – in großen goldenen Lettern auf den Seitenflächen. Antonio Branco hatte die Baufirma von Marias Vater beauftragt, unter seinem Warenlager in der Prince Street einen zusätzlichen Keller anzulegen. So nah und doch so unerreichbar weit entfernt, tastete sich der Wagen an den Schubkarren vorbei und verschwand außer Sicht.
Plötzlich entstand auf dem Bürgersteig eine Bewegung, und die Passanten zerstreuten sich. Ein irischer Polizist mit einem Helm auf dem Kopf und in blauer Uniform, deren Messingknöpfe auf Hochglanz poliert waren, näherte sich. In einer Hand hielt er einen Gummiknüppel, mit dem er spielerisch gegen seinen Oberschenkel klopfte. Maria schöpfte Hoffnung. Aber wenn sie jetzt schrie, würden ihre Hilferufe tatsächlich laut genug durch die Spalten des Holzverschlags dringen, ehe die Entführer erschienen und sie zum Schweigen brachten? Sie fand nicht den Mut, ihr Glück zu versuchen. Der Polizist marschierte vorbei. Die Bewohner des Viertels füllten den freien Raum, der sich um ihn herum gebildet hatte.
Ein hochgewachsener Mann erschien aus dem Eingang des Kips Bay Saloon.
Er war gertenschlank und trug eine Arbeiterkluft, darüber einen schäbigen Mantel und auf dem Kopf eine Schiebermütze. Er blickte über die Straße und an dem Mietshaus hoch. Jetzt fixierte er die Dachbrüstung. Für eine Sekunde hatte Maria das Gefühl, als blickte er ihr direkt in die Augen. Aber woher sollte er wissen, dass sie in dem Taubenschlag eingesperrt war? Er nahm die Mütze ab, als gebe er jemandem ein Zeichen. In diesem Augenblick stieg die Sonne über eine Dachkante, und ein Lichtstrahl wurde von seinem goldblonden Haarschopf reflektiert.
Er trat vom Bürgersteig auf die Fahrbahn und war nicht mehr zu sehen.
Der stiernackige Sizilianer, der dicht hinter der Eingangstür postiert war, blockierte die Vorhalle und den Flur des Mietshauses. Ein Totschläger flog auf sein Gesicht zu. Er wich ihm aus und geriet mitten in die Bahn einer Faust, die in seiner Magengrube landete und ihn mit einem lautlosen Seufzer zusammenklappen ließ. Der Totschläger – ein mit Bleischrot gefüllter Lederbeutel – landete mit einem dumpfen Knall auf dem Knochen hinter seinem Ohr, und er sackte zu Boden.
Am oberen Ende von vier dunklen, engen Treppenfluchten bewachte ein anderer Sizilianer die Leiter, die aufs Dach führte. Er grapschte sich eine Pistole aus seinem Gürtel. Eine Messerklinge blitzte auf. Er erstarrte, den Mund vor Schmerz und Erstaunen weit aufgerissen, und starrte auf das Wurfmesser, das aus seiner Hand ragte. Der Totschläger beendete die Begegnung, ehe er auch nur einen Schrei ausstoßen konnte.
Der Kidnapper auf dem Dach hörte das Knarren der Leiter. Er riss bereits die Tür des Taubenschlags auf, als der Totschläger mit der Geschwindigkeit und Wucht des perfekten Strikeout-Balls eines Spitzenpitchers gegen seinen Hinterkopf krachte. Stark und unaufhaltsam wie ein wilder Eber stürmte er in den Holzverschlag und ergriff das kleine Mädchen. Sein Stilett glitzerte, dann drückte die nadelscharfe Spitze gegen die Kehle seiner Gefangenen. »Ich stoße zu.«
Der hochgewachsene goldblonde Mann blieb stocksteif stehen, beide Hände leer. Verschreckt und gelähmt vor Angst konnte Maria in diesem Augenblick nichts anderes denken, als dass er einen buschigen Schnurrbart hatte, den sie vor ein paar Minuten, als er den Saloon verließ, nicht gesehen hatte. Er war so makellos getrimmt, als ob der Mann soeben beim Friseur gewesen wäre.
Er nannte ihren Namen mit einer tiefen, volltönenden Stimme.
Dann sagte er: »Schließ ganz fest die Augen.«
Sie vertraute ihm und kniff die Augen zu, so fest sie konnte. Sie hörte, wie der Mann, der sie festhielt und brutal gegen seine Brust drückte, abermals drohend rief: »Ich töte sie!« Sie spürte, wie das Messer ihre Haut ritzte. Eine Pistole knallte wie eine Kanone. Dann spritzte ihr eine heiße Flüssigkeit ins Gesicht. Der Kidnapper ließ sie los und sackte nach hinten. Sie wurde von einem starken Arm aufgefangen und aus dem Taubenschlag hinausgetragen.
»Das war sehr tapfer von dir, wie du die Augen zugemacht hast, kleine Lady. Du kannst sie wieder öffnen.« Sie fühlte, wie das Herz des Mannes schlug. Es pochte so heftig, als ob er eine weite Strecke gerannt wäre oder genauso große Angst gehabt hätte wie sie. »Du kannst sie wieder aufmachen«, wiederholte er leise. »Alles ist okay.«
Sie standen auf dem offenen Dach. Er wischte ihr Gesicht mit einem Taschentuch ab, und die Tauben schwangen sich in einen Himmel hinauf, der niemals so blau sein würde wie seine Augen.
»Wer sind Sie?«
»Isaac Bell. Von der Van Dorn Detective Agency.«
2
»Es ist das bedeutendste und umfangreichste technische Projekt der Geschichte. Haben Sie irgendeine Vorstellung, was es kosten wird, Branco?«
»Ich habe in einer Zeitung etwas von einhundert Millionen Dollar gelesen, Mr. Davidson.«
Davidson, der für die Arbeitslager zuständige Aufseher der Contractors’ Protective Organisation, lachte schallend. »Am Ende, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, wird das Water Supply Board einhundertfünfundsiebzig Millionen ausgegeben haben. Das sind zwanzig Millionen mehr, als der Panamakanal gekostet hat.«
Ein kalter Wind und ein klarer Himmel verhießen einen frühen Wintereinbruch in den Catskill Mountains. Aber die Morgensonne war hell und warm. Die Männer aus der Stadt hatten die Mäntel geöffnet und standen nebeneinander auf einem Gerüst über der ersten Stufe eines riesigen Staudamms hoch über einem Fluss. Auf der Baustelle wimmelte es von Arbeitern, aber dröhnende Löffelbagger und Schwerlastkräne garantierten, dass niemand sie belauschen konnte, während sie ihre privaten Nebengeschäfte verhandelten.
Der Oberaufseher hakte die Daumen in seine Westentaschen. »Sauberes Wasser für sieben Millionen Menschen.« Er pumpte seine Brust und seinen Bauch auf und blickte triumphierend zu der weit entfernten City von New York, als würde er einhundert Meilen des Catskill Aqueducts mit seinen eigenen Händen graben. »Allein dank der Schwerkraft wird Wasser aus den Catskills aus einem Wasserkran einer Küche im fünften Stock fließen können.«
»Ein Riesenvorhaben«, sagte Branco.
»Wir müssen den Bau fertigstellen, ehe das Wasser knapp wird. Einwanderer drängen scharenweise in die Stadt und saufen den Croton leer.«
Das hinter ihnen liegende Tal glich einer vom Wind umtosten Staubschüssel – meilenweit gerodete Farmen und geschleifte Dörfer, Kirchen, Scheunen, Häuser und entwurzelte Bäume – die am Ende, wenn der Damm errichtet war und der Fluss sie gefüllt hatte, als Ashokan Reservoir der größte Stausee der Welt wäre. Unten strömte der Esopus River ungehindert durch Rohre mit knapp drei Metern Durchmesser, bis man den Damm schließen würde. Vor den Männern lag die Route des Catskill Aqueducts – einhundert Meilen Wasserleitung mit einem größeren Umfang als Eisenbahntunnel –, die sie in Gräben verlegen, unter Flüssen hindurchführen und durch Berge hindurch sprengen würden.
»Doppelt so lang wie die großen Aquädukte des Römischen Reichs.«
Antonio Branco hatte die englische Sprache bereits als Kind erlernt. Aber wenn es für ihn nützlich war, konnte er so tun, als beherrschte er sie nur bruchstückhaft. »Iste eine große Loch in Erde«, kommentierte er mit dem varietébühnenhaften italienischen Akzent, den der Amerikaner von einen dummen Einwanderer, der nach Strich und Faden geschröpft werden sollte, erwartete.
Er hatte bereits ein beträchtliches Schmiergeld für diesen Ausflug hierher bezahlt, um mit dem Oberaufseher zusammenzutreffen. Nachdem er abermals bezahlt hatte, diesmal mit seiner Würde, stellte er sich vor, die Weste des Mannes einen Zentimeter über seiner Uhrkette aufzuschlitzen. Zuzustoßen und wieder herauszuziehen. Die Leiche würde zwanzig Meter tief abstürzen, würde durch Stromschnellen mitgerissen werden und wäre am Ende so übel zugerichtet, dass kein amtlicher Leichenbeschauer eine mikroskopisch kleine Einstichwunde entdecken könnte.
Tod durch Herzschlag.
Aber nicht an diesem Vormittag. Hier ging es um viel, er durfte die günstige Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Sklaven hatten die römischen Aquädukte erbaut. New Yorker benutzten dazu Löffelbagger, Dynamit und Druckluft – und Tausende italienischer Arbeiter. Tausende Bäuche, die gefüllt werden mussten.
»Sie müssen verstehen, Branco, Sie haben Ihr Angebot zu spät vorgelegt. Die Verträge zur Belieferung der firmeneigenen Kaufläden waren bereits unterzeichnet.«
»Wie ich gehört, gab es noch in letzte Minute Schwierigkeiten.«
»Schwierigkeiten? Das kann man wohl sagen, dass es Schwierigkeiten gab! Dem verdammten Narren wurde in einem Freudenhaus die Kehle aufgeschlitzt.«
Branco bekreuzigte sich. »Ich bieten also meine Dienste erneut an, die italienischen Arbeiter mit Lebensmitteln aus Heimat zu versorgen.«
»Wenn Sie den Vertrag ergattern könnten, wie würden Sie liefern? New York ist weit entfernt.«
»Ich liefern auf dem Hudson River. Mit Dampfer der Albany Night Line nach Kingston. Und von Kingston mit Ulster & Delaware Railroad zum Arbeitslager in Brown’s Station.«
»Hm … Yeah, ich denke das wäre eine Möglichkeit, wie Sie es versuchen könnten. Aber warum transportieren Sie die Ware nicht in einem Frachter von New York direkt zum Dock der Ulster & Delaware?«
»Mit einem Frachter würde klappen«, sagte Branco in einem unverbindlichen Tonfall, als ob ihn dieses Thema nicht mehr interessiere.
»So wollte es nämlich der Knabe tun, der getötet wurde. Er meinte, ein Frachter könnte unterwegs am Storm King Mountain anlegen und Makkaroni für die Arbeiter im Siphon ausladen. Eine Menge Italiener graben sich dort unter dem Fluss hindurch. Mindestens genauso viele malochen im Siphon auf der anderen Seite. Abends kann man sie hören, wenn sie auf ihren Mandolinen und Ziehharmonikas musizieren.«
»Noch ein Zwischenstopp lässt sich auch am Breakneck Mountain einlegen«, sagte Branco. »Gute Idee.«
»Ich kenne jemanden, der einen Frachter besitzt«, meinte Davidson beiläufig.
Antonio Brancos Pulsschlag beschleunigte sich. Ihre Verhandlungen, um die größte Baustelle in Amerika mit Lebensmitteln zu versorgen, hatten begonnen.
Ein Pflasterstein flog klirrend durch das Fenster, und Glasscherben ergossen sich auf Maria Vellas Bettdecke. Ihre Mutter platzte schreiend in das Zimmer hinein. Ihr Vater drängte sich dicht hinter ihr durch die Tür, zog sie aus dem Bett, drückte sie an sich und versuchte gleichzeitig, ihre Mutter zu beruhigen. Maria fing seinen Blick auf. Dann deutete sie stumm und am ganzen Leib zitternd auf den Stein, der auf dem Teppich lag und in ein Stück Papier und eine Schnur eingewickelt war. Giuseppe Vella öffnete den Knoten der Schnur und strich das Papier glatt. Darauf befanden sich eine grobe Zeichnung von einem Dolch, der einen Totenkopf durchbohrte, und außerdem die Silhouette einer schwarzen Hand.
Vella las das Geschriebene, gleichermaßen vor Wut und vor Angst zitternd. Die Schweine wagten es, seinem armen Mädchen zu drohen:
»Liebes Kind bestell deinem Vater Lösegeld muss gezahlt werden. Du bist gesund nach Hause gekommen wie versprochen. Sag deinem Vater, er Mann von Ehre.«
Der Rest war an ihn selbst gerichtet:
»Nimm dich in Acht, Vater der Kleinen. Glaube nicht, dass wir tot sind. Wir meinen es ernst. Unter der Brooklyn Bridge an der South Street. Zehntausend. PLUS zusätzlich eintausend für Schäden, die du hinterlassen hast. Halte nur den Mund. Deine Kleine ist sicher zu Hause. Wenn du kein Geld bringst, nehmen wir uns deine Baustelle vor.«
»Sie verlangen noch immer das Lösegeld«, sagte er zu seiner Frau.
»Bezahl es«, erwiderte sie schluchzend. »Bezahl, oder sie werden uns niemals in Ruhe lassen.«
»Nein!«
Seine Frau bekam einen hysterischen Anfall. Hilflos sah Giuseppe Vella seine Tochter an.
Das Mädchen sagte: »Geh zu Signore Bell.«
»Mr. Bell«, verbesserte er sie. Er fühlte sich machtlos, und das machte ihn rasend. Er wollte die Van Dorn Detective Agency engagieren, damit sie ihn und seine Familie schützte. Aber Außenstehende hineinzuziehen und um Hilfe zu bitten war riskant. »Du bist Amerikanerin. Sprich Amerikanisch. Mr. Bell. Nicht Signore.«
Das Kind zuckte bei seinem lauten Tonfall zusammen. Er erinnerte sich an seinen eigenen Vater, der ein wahrer Tyrann im Hause gewesen war, und dann senkte er schuldbewusst den Kopf. Er war zu modern, zu amerikanisch, um ein Kind einzuschüchtern. »Es tut mir leid, Maria. Mach dir keine Sorgen. Ich werde Mr. Bell aufsuchen.«
3
Von dem Tag an, an dem John Jacob Astor IV das fünfzehnstöckige Beaux-Arts-Gebäude an der Ecke 42nd Street und Broadway eröffnete, war das Knickerbocker Hotel ein Riesenerfolg. Der große Enrico Caruso machte es zu seiner Dauerresidenz, da er dort nur drei kurze Blocks vom Metropolitan Opera House entfernt war, wie auch die Koloratursopranistin Luisa Tetrazzini, die »Florence Nightingale«, die den Chefkoch des Knickerbocker zu einem neuen Makkaronigericht inspirierte, das er Tacchini alla Tetrazzini nannte.
Vor beiden Ereignissen, Monate vor der offiziellen Eröffnung, war Joseph Van Dorn mit der New Yorker Filiale seiner Privatdetektei in eine luxuriöse Suite im ersten Stock am Ende der prunkvollen Treppe eingezogen. Er handelte einen Mietnachlass aus, indem er in Gestalt von Hausdetektiven für den Schutz des Hotels sorgte. Van Dorn vertrat die Theorie, die sich bereits in seinem nationalen Hauptbüro im Palmer House in Chicago und in seiner Filiale im New Willard Hotel in Washington, D.C., als erfolgreich erwiesen hatte, dass sich nämlich aufwändig gestaltete Büroräume dadurch bezahlt machten, dass sie seinen Klienten signalisierten, dass sie für die hohen Honorare, die er verlangte, auch besondere Leistungen erwarten konnten. Ein Hintereingang, erreichbar durch die Küche und eine Hintertreppe, blieb für solche Klienten reserviert, die die meistbesuchte Hotellobby der Stadt meiden wollten, wenn sie die Büros aufsuchten, um delikate private Angelegenheiten zu besprechen, oder für Informanten, die laufende Ermittlungen unterstützten, sowie für verdeckte Ermittler.
Diesen Eingang benutzte Giuseppe Vella, als er Isaac Bell aufsuchte.
Der hochgewachsene Detektiv begrüßte den italienischen Bauunternehmer herzlich im Empfangsbereich der Detektei. Er erkundigte sich, wie es Maria und ihrer Mutter ging und verweigerte abermals die Annahme einer zusätzlichen Belohnung neben dem von Van Dorn festgesetzten Honorar. Freundlich, aber mit Nachdruck erklärte er: »Sie haben Ihre Rechnung termingerecht bezahlt und dürfen sich daher als ein besonders geschätzter Klient betrachten.«
Bell geleitete den Italiener in die geschäftige Schaltzentrale des Büros, den Bereitschaftsraum der Detektive, die einem modernen Wall-Street-Unternehmen ähnelte und mit Kerzentelefonen, Sprechrohren, klappernden Schreibmaschinen, einem Diktiergerät und einer Stenografiermaschine ausgestattet war. Eine Morsetaste verband die Filiale mittels einer Privatleitung mit Chicago, mit Außenbüros im ganzen Land und auch mit Washington, wo der Boss die meiste Zeit damit verbrachte, sich um Regierungsaufträge zu bemühen.
Bell okkupierte einen freien Schreibtisch, besorgte einen Stuhl für Vella und untersuchte den Erpresserbrief der Black Hand. Unbeholfen formulierte Drohungen waren mit groben Zeichnungen auf einem Bogen Schreibpapier von bester Qualität illustriert worden.
Vella sagte: »Der Brief war mit einer Schnur um den Stein gewickelt, den sie durchs Fenster geworfen haben.«
»Haben Sie die Schnur mitgebracht?«
Vella zog ein Stück Metzgergarn aus der Tasche.
Bell sagte: »Ich werde mich sofort um diese Angelegenheit kümmern und mich darüber mit Mr. Van Dorn beraten.«
»Ich habe Angst um meine Familie.«
»Nachdem wir telefoniert haben, habe ich Männer in die 13th Street geschickt, um Ihr Haus zu bewachen.«
Bell versprach, Vella noch am gleichen Nachmittag auf seiner augenblicklichen Baustelle, einem Aushub für die neue Kirche Mariä Verkündigung in der 128th Street in Harlem, anzurufen. »Übrigens, sollten Sie bemerken, dass Sie beschattet werden, wird es nur dieser Detektiv dort drüben sein.« Er lenkte Vellas Blick auf einen Mann im Bereitschaftsraum. »Archie Abbott wird Sie im Auge behalten.«
Der elegant gekleidete rothaarige Detektiv Abbott sah für Vella wie ein Fifth-Avenue-Dandy aus, bis er automatische Pistolen in zwei Schulterhalftern verstaute, seine Taschen mit Reservemagazinen vollstopfte, einen Totschläger einsteckte und seinen mit einem goldenen Knauf verzierten Gehstock mit einer Schrotpatrone lud.
Isaac Bell brachte den Black-Hand-Brief in Joseph Van Dorns persönliches Büro. Es befand sich in einem Eckzimmer mit einem Rosenholzschreibtisch im Art-Nouveau-Stil, bequemen Ledersesseln, einem ungehinderten Blick auf die Bürgersteige vor den Hoteleingängen und einem Türspion, um Besucher im Empfangsbereich zu inspizieren.
Van Dorn war ein Ire Mitte vierzig, mit beginnender Glatze, gewölbtem Brustkorb und ausgeprägter Leibesfülle, dichtem hellrotem Backenbart, Schnäuzer und der von einer rauen Schale getarnten durchaus liebenswürdigen Ausstrahlung eines wohlhabenden Geschäftsmannes, der schon früh in seinem Leben vom Erfolg verwöhnt wurde. Überaus ehrgeizig, besaß er die Fähigkeit, sein Glück auszukosten, eine Fähigkeit, die Bell bei Fremden und Bekannten bisher eher selten angetroffen hatte. Er hatte außerdem die Gabe, andere Menschen für sich zu gewinnen und Freundschaften zu schließen, was für seine Detektei von großem Vorteil war. Sein herzliches Auftreten kaschierte ein präzise und bärenfallenschnell schaltendes Gehirn und ein erstaunlich zuverlässiges Gedächtnis für die Gesichter und Gewohnheiten von Kriminellen, deren Existenz er als einen persönlichen Affront betrachtete.
»Ich freue mich über jeden Auftrag«, sagte Van Dorn. »Aber weshalb wendet sich Mr. Vella mit seinen Problemen nicht an Joe Petrosinos Italian Squad?«
Detective Joe Petrosino von der New York Police, ein zäher Veteran mit zwanzig Dienstjahren und einer Verhaftungs- und Verurteilungsbilanz, um die ihn das gesamte Department beneidete, hatte erst vor kurzem von Commissioner Bingham die Genehmigung erhalten, eine Spezialeinheit von Ermittlern aufzustellen, die die italienische Sprache beherrschten, um den Kampf gegen das Verbrechen in den von sizilianischen, neapolitanischen und kalabresischen Einwanderern bewohnten Stadtvierteln zu intensivieren.
»Vielleicht weiß Mr. Vella, dass im gesamten New York Police Department nur fünfzehn Italiener Dienst tun.«
»Petrosino ist für seinen Job wie geschaffen«, gab ihm Van Dorn recht. »Diese Black-Hand-Plage gerät zusehends außer Kontrolle.« Er deutete auf einen Stapel Zeitungsausschnitte, die Isaac Bell von der Recherche-Abteilung für den Boss hatte zusammentragen lassen. »Obststände zu sprengen, Schubkarren anzuzünden und arme unwissende Immigranten zu terrorisieren, das sind noch die geringsten Vergehen. Mittlerweile haben sie italienische Bankiers und Geschäftsleute im Visier. Wir werden wohl niemals erfahren, wie viele reiche Eltern ihre Kinder in aller Stille freigekauft haben, aber ich wette, dass es genug sein dürften, um Kidnapping zu einem lukrativen Geschäftszweig zu machen.«
Bell reichte Van Dorn den Black-Hand-Brief über den Schreibtisch.
Van Dorns Wangen röteten sich, als Zorn in ihm hochloderte. »Sie haben sich tatsächlich an das kleine Mädchen gewandt! Was muss das für ein Abschaum sein, dass sie einem Kind derart Angst machen!«
»Sehen Sie sich das Papier an.«
Van Dorn rieb mit den Fingern darüber. »Spitzenqualität. Bütten, handgeschöpft. Holzfrei, kein Zellstoff.«
»Kommt Ihnen das nicht bekannt vor?«
»Der gleiche Sprachstil wie bei dem ersten Erpressungsschreiben, wenn ich mich richtig erinnere.«
»Sonst noch etwas?«
»Erstklassiges Schreibpapier.« Er hielt den Briefbogen gegen das Licht. »Ich frage mich, woher sie es haben. Man sollte sich mal das Wasserzeichen ansehen.«
»Ich habe der Recherche-Abteilung bereits entsprechende Anweisungen gegeben.«
»Jetzt bedrohen sie also sein Unternehmen.«
»Auf einer Baustelle einen ›Unfall‹ herbeizuführen ist nicht schwierig.«
»Es sei denn, es ist ein Täuschungsmanöver, während sie versuchen, sich seine Tochter ein zweites Mal zu holen.«
»Wenn sie das tun«, sagte Bell, »bekommen sie es mit Harry Warrens Gang Squad zu tun. Harry hat die gesamte 13th Street unter Kontrolle.«
Im Anflug eines Lächelns entblößte Van Dorn seine Zähne. »Gut … Aber wie lange kann ich es mir leisten, Harrys Leute von den Banden abzuziehen. Die ›Gophers‹ und die ›Wallopers‹ laufen Amok, und die Italiener werden von Tag zu Tag dreister.«
»Eine spezialisierte Van Dorn Black Hand Squad«, sagte Bell, »würde Ihren Bandenexperten wieder ermöglichen, sich auf die Straßengangs zu konzentrieren.«
»Ich lasse es mir durch den Kopf gehen«, sagte Van Dorn.
»Wir könnten um einiges wirkungsvoller gegen die Black Hand vorgehen.«
»Ich sagte, dass ich darüber nachdenken werde.«
Isaac Bell wandte sich von der U-Bahn-Station 125th Street in Richtung Innenstadt und marschierte durch ein schnell wachsendes junges Stadtviertel, in dem neu erbaute Krankenhäuser, Apartmentblocks, Mietshäuser, Theater, Schulen und Pfarreien die Scheunen und Baracken Harlems verdrängten. Er war einen Block von der 128th Street entfernt und näherte sich gerade einem hohen zerklüfteten Schutthügel, der neben Giuseppe Vellas Baugrube für das Fundament der Kirche Mariä Verkündigung aufragte, als die Erde unter seinen Füßen erbebte.
Er hörte eine gewaltige Explosion. Der Bürgersteig kräuselte sich wie eine von Wellen bewegte Wasserfläche. Ein Kirchturm geriet ins Schwanken. Nonnen flüchteten in Panik aus dem Gebäude, und die Klinkerfahrbahn der Convent Avenue wogte bereits wie ein Ozean.
Erst im vorangegangenen Frühjahr hatte Bell das Große Erdbeben in San Francisco überstanden, als er mitten in der Nacht plötzlich aus dem Schlaf gerissen worden war und miterleben musste, wie Wohnzimmer und Klavier seiner Verlobten auf die Straße hinabstürzten. Jetzt, hier in Manhattan, geriet er innerhalb von wenigen Monaten in sein zweites Erdbeben. Etwa dreißig Meter Straße lösten sich vor seinen Augen auf. Dann flogen Ziegelsteine in die Luft, von gigantischen Trinkwassergeysiren bis zu den Dächern der Häuserzeilen emporgeschleudert.
Es war kein Erdbeben, sondern eine Springflut.
Innerhalb von Sekunden füllte ein Fluss die Convent Avenue.
Es konnte sich nur um eine Quelle handeln, aus der diese reißenden Fluten stammten. Der nördlich in Westchester gelegene Croton-Stausee versorgte das Central Park Reservoir in New York City über unterirdische Hauptleitungen. Die Explosion in Giuseppe Vellas Baugrube – eine durch falsche Berechnung oder Sabotage zur Zündung gebrachte riesige Dynamit-»Überladung« – hatte die Leitungen aufgesprengt. In diesem Augenblick erschien die von den Planern des Catskill Aqueduct prophezeite Wasserknappheit vollkommen unglaubwürdig.
Eine Wasserwand brach aus der Convent Avenue hervor und raste durch die Häuserschlucht, zertrümmerte Parterrefenster und schwemmte Männer, Frauen und Pferde um die Häuserecken und in die Nebenstraßen. Die Geschwindigkeit war erschreckend. Sie war schneller als ein Expresszug. Hatte Isaac Bell im letzten Moment noch den Lenker eines Lastfuhrwerks, das von der eisigen Flut überspült wurde, von seinem Kutschbock herunter und in eine trügerische Sicherheit ziehen können, so wurde er in der nächsten Sekunde selbst erfasst und in die 127th Street gerissen. Mühsam kämpfte er sich an die Oberfläche und schwamm auf einem schäumenden Wellenkamm, der reihenweise Baracken hinwegfegte, den ganzen Block entlang bis zur Amsterdam Avenue.
Dort stürzten die Wassermassen bergab und folgten dem abfallenden Gelände nach Süden. Bell arbeitete sich aus dem Strom heraus, bekam einen Laternenpfahl zu fassen und zog sich daran hoch. Feuerwehrleute aus einer Feuerwache in der Nähe wateten in die Flut, um Menschen herauszuziehen und aufs Trockene zu bringen.
Bell rief: »Wo sind die Wassersperren?«
»In der Amsterdam oben an der 135th.«
Bell sprintete die Amsterdam Avenue hinauf, als ginge es um sein Leben.
Fünfhundert Meter oberhalb des Lecks in der Hauptleitung gelangte er zu einem wuchtigen neoromanischen Ziegel- und Granitbauwerk. In den Türsturz über den Eisentüren waren die Lettern WATERDEPARTMENT eingraviert. Seinen Dimensionen nach zu urteilen musste dieses Gebäude der Hauptverteilungspunkt für die Wasserreservoire in Westchester sein. Er stürmte hinein. Tonnenweise strömte Croton-Wasser aus einem tief unter dem Gebäude liegenden Sammelgewölbe in gusseiserne Rohre mit mehr als einem Meter Durchmesser. Die Rohre waren mit großen Rädern für die Absperrventile versehen, mit denen der Zufluss zu den Hauptleitungen reguliert wurde, die sieben Blocks weiter südlich geborsten waren.
Bell entdeckte einen Mann, der sich an den Rädern abmühte. Er kletterte im Eiltempo eine stählerne Leiter hinab und traf auf einen erschöpften Techniker mittleren Alters, der gerade verzweifelt versuchte, alle vier Absperrklappen gleichzeitig zu schließen. Mühsam rang er nach Luft und sah aus, als stünde er dicht vor einem Herzinfarkt. »Ich weiß nicht, was meinem Helfer zugestoßen ist. Er kommt nie zu spät und hat bisher nicht einen einzigen Tag gefehlt.«
»Zeigen Sie mir, wie ich helfen kann!«
»Ich kann die Sperren nicht allein schließen. Dazu sind zwei Mann nötig.«





























