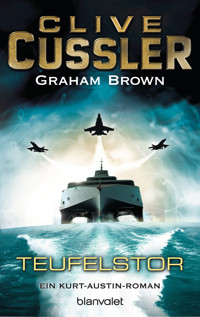
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Kurt-Austin-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Kurt Austin untersucht mit seinem Team zwei mysteriöse Vorfälle im Atlantik. Zwei Schiffe sind ohne Grund in Flammen aufgegangen. Als Austin erkennt, dass der ebenso größenwahnsinnge wie skrupellose afrikanische Diktator Djemma Garand dahinter steckt, ist es längst zu spät. Denn die Vernichtung der Schiffe war nur ein Test, mit dem Garand sich von der Macht seiner neuen Waffe überzeugen wollte. Nun soll sie auf das wahre Ziel gerichtet werden – Washington D. C.!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
& Graham Brown
Teufelstor
Roman
Aus dem Englischen von Michael Kubiak
Prolog
Santa Maria Airport, Azoren, 1951
Es war eine kalte, feuchte Nacht. Hudson Wallace stand auf der Rampe vor dem Flughafengebäude. Seine Lederjacke bot ihm nur unzureichenden Schutz vor der Kälte, während eine Kombination aus Nieselregen und Nebel den Flughafen und die gesamte umliegende Insel einhüllte.
Ihm gegenüber funkelten einige blaue Lampen der Rollbahnbefeuerung in der nächtlichen Stille und trugen wenig dazu bei, der Szenerie einen Hauch von Wärme zu spenden, während über ihm ein weißer Lichtstrahl durch den Nebel wanderte, dem nur wenige Sekunden später ein grünes Aufblitzen des sich langsam und stetig drehenden Flughafenleuchtfeuers folgte.
Wallace bezweifelte, dass da oben jemand war, der es hätte sehen können, jedenfalls nicht bei dieser dichten und niedrigen Wolkendecke. Aber Gott möge ihm helfen, wenn tatsächlich einer da oben herumirrte. Berge säumten den Flughafen auf drei Seiten, und dabei war die Insel selbst doch nur ein winziger Fleck mitten im dunklen Atlantik. Sogar im Jahr 1951 war es nicht leicht, einen solchen Punkt zu orten. Und falls es dennoch jemanden gab, der Santa Maria in dieser Milchsuppe finden konnte, dann, so vermutete Wallace, hätte er längst die Bergspitzen gerammt, ehe er im Regen die Rollbahnbeleuchtung erkennen konnte.
Die Insel zu erreichen war allerdings nur die eine Sache. Sie wieder zu verlassen war noch einmal etwas ganz anderes. Ungeachtet des Wetters wollte Wallace aufbrechen und konnte es tatsächlich kaum erwarten, endlich zu starten. Aus Gründen, die er nur zu gut kannte, war ein weiterer Aufenthalt höchst unsicher. Trotz dieser Tatsache und obgleich er Pilot und Eigner der Lockheed Constellation war, die auf dem Vorfeld parkte, hatte er nicht das letzte Wort.
Da er kaum etwas anderes zu tun hatte, als Ausschau zu halten und zu warten, angelte sich Wallace ein silbernes Etui aus seiner Manteltasche. Er nahm eine Dunhill-Zigarette heraus und klemmte sie sich zwischen die Lippen. Indem er die »No Smoking«-Schilder ignorierte, die alle fünf Meter an den Wänden angebracht waren, hielt er sich mit gewölbter Hand ein Zippo-Feuerzeug dicht vors Gesicht und zündete die Dunhill an.
Er befand sich einhundert Meter vom nächsten Flugzeug oder Tankanschluss entfernt, und der gesamte Flughafen war triefnass. Er schätzte also, dass die Chancen, hier ein Problem zu verursachen, ungefähr bei null lagen. Und die Chancen, dass sich jemand die Mühe machte und das warme, trockene Flughafengebäude verließ und herauskam, um sich zu beschweren? Er vermutete, dass sie sogar noch um einiges geringer waren.
Nach einem tiefen, genussvollen Zug atmete Wallace aus.
Die grau-violette Rauchwolke zerfaserte, als hinter ihm die Tür zum Terminal geöffnet wurde.
Ein Mann in schlecht sitzender Kleidung kam heraus. Sein rundes Gesicht wurde von einem braunen Hut halb versteckt. Seine Jacke und Hose waren aus einem rauen Wollstoff geschneidert und erinnerten an ausrangierte Ausrüstungsteile aus dem Winterkatalog der Roten Armee. Dünne, fingerlose Handschuhe vervollständigten die Erscheinung eines bäuerlichen Fluggastes, aber Wallace wusste, dass es sich anders verhielt. Dieser Mann, sein Passagier, würde schon sehr bald reich sein. Das hieß, wenn er lebend in Amerika ankäme.
»Wird das Wetter aufklaren?«, fragte der Mann.
Ein weiterer Zug an der Dunhill. Noch eine Rauchwolke aus Wallace’ Mund, ehe er antwortete.
»Nein«, sagte er deprimiert. »Heute nicht. Vielleicht nicht mal in der kommenden Woche.«
Hudson Wallace’ Passagier war ein Russe namens Tarasow. Er war aus der Sowjetunion geflüchtet. Sein Gepäck bestand aus zwei Stahlkoffern, die so schwer waren, als seien sie mit Steinen gefüllt. Beide waren abgeschlossen und standen angekettet in Wallace’ Flugzeug.
Wallace war nicht darüber aufgeklärt worden, was sich in diesen Koffern befand, doch die neu gegründete Central Intelligence Agency zahlte ihm ein kleines Vermögen, um sie und Tarasow in die Vereinigten Staaten zu schaffen. Er vermutete, dass sie dem Russen noch viel mehr zahlten, damit er die Seiten wechselte und die Koffer mitbrachte.
So weit, so gut. Ein amerikanischer Agent hatte es geschafft, Tarasow nach Jugoslawien zu schleusen, in ein anderes kommunistisches Land. Aber unter Tito hatte man dort für Stalin nur wenig übrig. Dank eines beträchtlichen Schmiergelds hatte Hudson Wallace’ Maschine in Sarajewo landen und kurz darauf wieder starten können, bevor jemand neugierige Fragen stellte.
Seitdem reisten sie nach Westen, aber die Nachricht hatte sich trotzdem verbreitet, und ein Anschlag auf das Leben des Mannes hatte dafür gesorgt, dass Tarasow jetzt humpelte und in seinem Bein eine Kugel steckte.
Hudson Wallace’ Befehle lauteten, ihn so schnell wie möglich in die USA zu bringen und unterwegs nicht aufzufallen, aber sie hatten ihm keine spezielle Route vorgeschrieben. Das war auch gut so, denn Wallace wäre ihr sowieso nicht gefolgt.
Bisher hatte er alle größeren europäischen Städte gemieden, war stattdessen zu den Azoren geflogen, wo er auftanken und zu einem Nonstop-Flug in die Vereinigten Staaten starten konnte. Es war ein guter Plan, aber er hatte nicht mit dem Wetter oder mit Tarasows Flugangst gerechnet.
»Früher oder später werden sie uns finden«, sagte Wallace zu seinem Passagier. »Sie haben überall Agenten, zumindest in jedem Hafen und auf jedem größeren Airport.«
»Aber Sie meinten doch, dieser Ort hier sei abgelegen und sicher.«
»Ja«, sagte Wallace. »Aber wenn sie uns an keinem der Orte aufstöbern, die auf dem Weg liegen, dann werden sie woanders nachschauen. Wahrscheinlich haben sie das längst getan.«
Hudson Wallace zog wieder an seiner Zigarette. Er war sich nicht sicher, ob die Russen die Azoren überprüfen würden. Aber zwei Amerikaner und ein Ausländer, die mit einem internationalen Linienflugzeug landeten – und dann drei Tage auf dem Flugfeld warteten, ohne mit jemandem ein Wort zu wechseln –, waren durchaus etwas, das Misstrauen erwecken konnte.
»Irgendwann müssen Sie sich entscheiden, wovor Sie mehr Angst haben«, sagte er und deutete mit einem Kopfnicken auf das Flugzeug, das ein wenig abseits im Nieselregen stand. »Vor einer kleinen Turbulenz oder vor einem Messer im Bauch.«
Tarasow blickte zu dem aufgewühlten Himmel hinauf. Er zuckte die Achseln und hielt die Hände mit den Handflächen nach oben hoch wie jemand, der der Welt demonstrieren will, dass er kein Geld hat. »Aber so können wir nicht fliegen«, sagte er.
»Landen«, stellte Wallace klar. »So können wir nicht landen.« Er machte eine Handbewegung wie ein Flugzeug, das im Sinkflug ist und seine Nase zur Landung hochzieht.
»Aber wir können verdammt noch mal starten«, fuhr er fort und hob wieder die Hand. »Und dann können wir Kurs nach Westen nehmen. Dort gibt es keine Berge. Sondern nichts als den Ozean … und die Freiheit.«
Tarasow schüttelte den Kopf, aber Wallace konnte erkennen, wie seine Entschlossenheit allmählich ins Wanken geriet.
»Ich habe mir das Wetter in New York angesehen«, sagte er und log abermals. Natürlich hatte er das nicht getan, da er nicht wollte, dass irgendjemand von seinem Flugziel erfuhr. »Für die nächsten achtundvierzig Stunden ist klarer Himmel angesagt, aber danach …«
Offenbar verstand Tarasow.
»Entweder starten wir jetzt, oder wir hängen hier für eine Woche fest.«
Seinem Passagier schien keine der beiden Möglichkeiten zu gefallen. Er sah zu Boden und dann zu der großen silbernen Constellation mit ihren vier wuchtigen Kolbenmotoren und ihren schlanken dreifachen Seitenleitwerken hinüber. Er starrte in den Regen und in die nächtliche Dunkelheit dahinter.
»Können Sie uns hinbringen?«
Hudson Wallace schnippte die Zigarette auf den Boden und zertrat sie mit seinem Stiefel. Jetzt hatte er den Russen genau da, wo er ihn haben wollte. »Ich kann uns hinbringen«, sagte er.
Tarasow nickte zögernd.
Wallace blickte zum Flugzeug und machte eine kreisende Bewegung mit der Hand. Das scharfe Rattern des Anlassers erklang, während schwarzer Qualm aus dem Auspuff von Motor Nummer drei wallte. Die Kerzen zündeten, und der große Sternmotor kam in Schwung. Schon nach einem kurzen Moment rotierte der große Propeller mit fünfzehnhundert Umdrehungen pro Minute und schleuderte regengeschwängerte Luft hinter die Maschine. Sekunden später sprang Motor Nummer eins an.
Wallace hatte gehofft, ihren Passagier zu dem Flug überreden zu können. Er hatte Charlie Simpkins, seinen Kopiloten, im Flugzeug zurückgelassen, damit er es startbereit hielt.
»Kommen Sie«, sagte Wallace.
Tarasow atmete tief durch und löste sich von der Tür. Er ging auf das wartende Flugzeug zu. Nachdem er die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte, erklang ein Schuss. Er hallte über die nasse Rollbahn, und Tarasow stolperte vorwärts, krümmte den Rücken und drehte sich nach rechts.
»Nein!«, brüllte Wallace.
Er legte einen Schritt zu, packte Tarasow, hielt den Mann auf den Füßen und schob ihn weiter in Richtung Flugzeug. Ein weiterer Schuss erklang. Diesmal ging die Kugel daneben und prallte rechts von ihnen singend vom Zement der Piste ab.
Tarasow taumelte.
»Kommen Sie schon!«, rief Wallace und versuchte ihn hochzuziehen.
Die nächste Kugel traf Wallace selbst, erwischte ihn in der Schulter und warf ihn herum. Er stürzte und rollte über den Erdboden. Die Kugel hatte ihn nach vorn gestoßen, als hätte jemand von oben auf ihn gezielt. Er vermutete, dass der Schuss auf dem Dach des Terminals abgefeuert worden war.
Sich vor Schmerzen krümmend zog Wallace einen .45er Colt aus seinem Schulterhalfter. Er wirbelte herum, zielte auf das Dach des Gebäudes und feuerte in die vermutete Richtung des Scharfschützen.
Nachdem er viermal abgedrückt hatte, glaubte Wallace eine Gestalt zu sehen, die hinter der Dachkante des Terminals in Deckung ging. Er jagte einen weiteren Schuss in diese Richtung, dann packte er Tarasow wieder, zerrte ihn rückwärtsgehend zum Flugzeug und zog ihn dabei wie einen Schlitten hinter sich her, bis sie die Treppe in der Nähe der Nase des Flugzeugs erreichten.
»Stehen Sie auf«, rief Wallace und versuchte den Mann hochzuhieven.
»Ich … kann nicht«, erwiderte Tarasow.
»Ich helfe Ihnen«, sagte der Pilot. »Sie müssen nur …«
Während er Tarasow auf die Füße half, fiel ein weiterer Schuss, und der Mann stürzte mit dem Gesicht zuerst zu Boden.
Wallace duckte sich hinter die Treppe und rief zur offenen Tür des Flugzeugs hinauf.
»Charlie!«
Keine Antwort.
»Charlie! Wie sieht’s aus?«
»Wir können jederzeit starten!«, rief eine Stimme zurück.
Wallace hörte, wie der letzte Motor anlief. Er packte Tarasow und drehte ihn um. Der Körper des Mannes war so schlaff wie der einer Stoffpuppe. Der letzte Schuss hatte ihn im Genick getroffen. Seine Augen starrten blicklos in den nächtlichen Himmel.
»Verdammt«, stieß Wallace hervor.
Die Hälfte der Mission war gescheitert, aber sie hatten immer noch die Stahlkoffer und was immer sich in ihnen befinden mochte. Obgleich die CIA eine geheime Organisation war, verfügte sie gewiss über Büros und hatte auch eine Adresse. Falls es sein musste, würde Wallace sie suchen und an die Tür klopfen, bis ihn jemand einließ und bezahlte.
Er wandte sich um und schoss wieder auf den Terminal. In diesem Moment bemerkte er die Scheinwerfer zweier Wagen, die vom Ende des Vorfelds auf ihn zurasten. Er gab sich keinen Augenblick lang der Illusion hin, dass es irgendwelche Hilfstruppen waren.
Also stürmte er die Treppe hinauf und tauchte mit einem Satz durch die Tür, während eine Kugel von der glatten Außenhaut der Constellation abprallte.
»Starten!«, brüllte er.
»Was ist mit unserem Passagier?«
»Für ihn ist es zu spät.«
Während der Kopilot die Gashebel nach vorn schob, knallte Wallace die Tür zu und drückte den Verschlusshebel nach unten, während sich die Maschine in Bewegung setzte. Über dem Dröhnen der Motoren hörte er das Klirren von berstendem Glas.
Er fuhr herum und sah Charlie Simpkins zusammengesunken über der Mittelkonsole hängen, aufrecht gehalten durch seinen Sicherheitsgurt.
»Charlie?«
Das Flugzeug rollte bereits, als Wallace nach vorn rannte. Er tauchte mit einem Hechtsprung ins Cockpit, während ihn eine nächste Kugel traf und kurz danach eine weitere.
Er blieb auf dem Boden liegen und stieß die Gashebel weiter vorwärts. Die Motoren heulten auf. Dann kroch er geduckt unter den Pilotensitz und betätigte das rechte Seitenruder. Das große Flugzeug gewann an Schwung, bewegte sich schwerfällig über die Piste, nahm jedoch Tempo auf und drehte sich.
Ein Gewehrschuss traf die Metallwand hinter ihm, dann schlugen die nächsten beiden Projektile ein. Wallace schätzte, dass die Maschine weit genug herumgeschwenkt war und sich mittlerweile vom Terminal entfernte. Er richtete sich auf, turnte in seinen Sessel und lenkte das Flugzeug auf die Rollbahn hinaus.
Jetzt blieb ihm nichts weiter übrig, als zu starten. Aufs Vorfeld zurückzukehren wäre zu unsicher. Das Flugzeug bewegte sich in die richtige Richtung, und Wallace wartete nicht ab, bis er vom Tower die Starterlaubnis erhielt. Er rammte die Gashebel bis zum Anschlag nach vorn, und schon beschleunigte das schwere Flugzeug .
Für ein oder zwei Sekunden hörte er, wie Kugeln die Außenhaut des Flugzeugs durchschlugen, aber nun befand er sich schnell außer Schussweite, raste die Piste hinunter und näherte sich der Startgeschwindigkeit.
Bei den herrschenden schlechten Sichtverhältnissen und dem geborstenen Fenster auf der linken Seite hatte Wallace Mühe, die roten Warnlichter am Ende der Startbahn zu erkennen. Sie kamen ihm rasend schnell entgegen.
Er senkte die Krügerklappen um fünf Grad und wartete, bis das Ende der Asphaltdecke nur noch einhundert Meter entfernt war, ehe er den Steuerknüppel nach hinten zog. Die Connie richtete die Nase auf, zögerte eine lange, quälende Sekunde und sprang dann vom Ende der Piste ab, wobei ihre Räder durch das hohe Gras peitschten, das auf die Rollbahn folgte.
Während des Steigflugs und eines weiten Bogens nach Westen fuhr Wallace das Fahrwerk ein und streckte dann die Hand nach seinem Kopiloten aus.
»Charlie?«, sagte er und rüttelte ihn. »Charlie?«
Simpkins reagierte nicht. Wallace überprüfte seinen Puls, fand jedoch keinen.
»Verdammt«, murmelte er.
Ein weiteres Opfer. Schon während des Kriegs vor fünf Jahren hatte Wallace zu viele Freunde verloren, aber dafür hatte es jedes Mal einen triftigen Grund gegeben. In diesem Fall war er nicht so sicher. Was immer sich in diesen Koffern befinden mochte, er hoffte, dass es das Leben zweier Männer wert war.
Er schob Simpkins in seinen Sitz zurück und konzentrierte sich aufs Fliegen. Der Seitenwind war heftig, die Turbulenzen waren noch schlimmer, und auf eine Wand aus grauem Nebel zu starren, während er durch die Wolken aufstieg, war verwirrend und gefährlich.
Ohne den Horizont oder etwas anderes, um die Lage des Flugzeugs visuell beurteilen zu können, war den Reaktionen des Körpers nicht zu trauen. Schon viele Piloten hatten ihre Maschinen unter solchen Bedingungen mit der Nase voran in den Erdboden gelenkt. Und dabei angenommen, sie würden genau geradeaus und waagerecht fliegen.
Viele andere hatten perfekt waagerecht fliegende Maschinen überzogen und ins Trudeln gebracht, weil ihre Körper ihnen anzeigten, dass sie sich drehten und abstürzten. Es war genauso, als sei man betrunken und fühlte, dass sich das Bett unter einem bewegt. Zwar wusste man, dass es nicht möglich war und auch nicht geschah, aber man konnte die Empfindung dennoch nicht unterdrücken.
Um das zu vermeiden, hielt Wallace den Blick gesenkt und auf die Instrumente gerichtet, um sicherzugehen, dass die Tragflächen der Maschine waagerecht in der Luft lagen. Er hielt den Steigflug bei sicheren fünfundvierzig Grad Neigung.
In zweitausend Fuß Höhe und drei Meilen vom Flughafen entfernt verschlechterte sich das Wetter. Turbulenzen schüttelten das Flugzeug durch, und heftige Auf- und Abwinde drohten es auseinanderzureißen. Regen peitschte gegen die Windschutzscheibe und die Metallwände ringsum. Der einhundertfünfzig Stundenmeilen schnelle Luftschraubenstrahl bewirkte, dass der größte Teil des Regens nicht durch das zerschmetterte Eckfenster hereindrang, und doch wurde ein feuchter Nebel ins Cockpit geweht. Der ständige Lärm erinnerte an einen rasenden Güterzug.
Aufgrund der Einschusslöcher und des zerbrochenen Fensters konnte Wallace den Innendruck der Kabine nicht erhöhen, aber er war immer noch in der Lage, bis auf vierzehntausend Fuß oder vielleicht sogar noch höher zu steigen, ohne dass die Kälte seine Funktionsfähigkeit zu sehr beeinträchtigte. Er griff hinter seinen Sitz und berührte eine mit reinem Sauerstoff gefüllte grüne Stahlflasche. Die würde er in größerer Höhe brauchen.
Eine weitere Turbulenz schüttelte die Maschine durch, aber mit eingefahrenem Fahrwerk und mit der vollen Kraft aller vier Motoren war Wallace guten Mutes, sich durch das Unwetter kämpfen zu können.
Die Constellation war eins der fortschrittlichsten Flugzeuge ihrer Zeit. Konstruiert von Lockheed und mit Unterstützung durch den weltberühmten Aviator Howard Hughes hatte sie eine Reisegeschwindigkeit von 350 Knoten und eine Reichweite von dreitausend Meilen, ohne nachtanken zu müssen. Hätten sie Tarasow ein wenig weiter westlich abholen können, wäre Wallace ohne Zwischenlandung nach Neufundland oder nach Boston geflogen.
Er wandte den Kopf, um seinen Kurs zu überprüfen. Er hielt sich weiter nördlich als beabsichtigt. Also korrigierte er die Flugrichtung und spürte einen Anflug von Benommenheit. Er legte die Maschine in die Waagerechte, als gleichzeitig eine Warnlampe zu blinken begann.
Der Generator in Motor Nummer 1 war im Begriff, sich zu verabschieden, und der Motor lief extrem unrund. Einen kurzen Moment später fiel Motor Nummer 2 aus, und das Hauptwarnlicht flammte auf.
Wallace versuchte sich zu konzentrieren. Ihm war schwindlig, und er schwankte, als stünde er unter Drogen. Er fasste sich an die Schulter, wo ihn die Kugel getroffen hatte. Die Wunde schmerzte heftig, aber er konnte nicht feststellen, wie stark sie blutete.
Auf der Instrumententafel vor ihm geriet der künstliche Horizont – ein Instrument, das Piloten benutzen, um die Tragflächen waagerecht zu halten – ins Taumeln. Desgleichen der Kursanzeiger daneben.
Irgendwie hörte das Flugzeug gleichzeitig mit Wallace’ Körper auf zu funktionieren.
Wallace blickte zu dem alten Kompass hoch, dem altertümlichen Instrument, das die letzte Rettung des Piloten war, falls die gesamte Mechanik der Maschine ausfiel. Er zeigte ihm, dass er sich in einer scharfen Linkskurve befand. Er versuchte noch, das Flugzeug auf geraden Kurs zu ziehen, aber er hatte sich schon zu weit in die andere Richtung gedreht. Eine Alarmsirene warnte vor einem Strömungsabriss, weil seine Fluggeschwindigkeit gefährlich abgenommen hatte, und kaum eine Sekunde später leuchteten überall auf dem Armaturenbrett Warnlampen auf. Fast alles, was blinken konnte, flackerte jetzt hektisch. Die Alarmsirene heulte. Ein durchdringender Hupton warnte vor einer Fehlfunktion des Fahrwerks.
Ein Blitz zuckte in nächster Nähe auf und blendete ihn. Er fragte sich, ob er das Flugzeug getroffen hatte.
Dann griff er nach dem Mikrofon des Funkgeräts und schaltete auf eine Kurzwellenfrequenz, die die CIA ihm genannt hatte, und begann zu senden.
»Mayday, Mayday, Mayday«, sagte er. »Hier ist …«
Das Flugzeug ruckte nach rechts und dann nach links. Erneut zuckte ein Blitz und erzeugte einen Millionen Volt starken Funken unmittelbar vor seinen Augen. Er spürte den Stromschlag durch das Funkgerät und ließ das Mikrofon wie eine heiße Kartoffel fallen. Es baumelte neben der Instrumententafel an seiner Schnur.
Wallace griff danach. Doch er verfehlte es. Er beugte sich weiter vor, versuchte es erneut, streckte sich und erfasste es mit den Fingerspitzen. Er zog es an sich, um wieder zu senden.
Und dann schaute er gerade noch rechtzeitig hoch, um zu sehen, wie die Wolken verschwanden und die schwarzen Fluten des Atlantik den Horizont füllten und sich auf ihn zuwälzten.
1
Genf, Schweiz, 19. Januar 2011
Alexander Cochrane ging durch die stillen Straßen von Genf. Es war ein mondloser Winterabend und bereits nach Mitternacht. Schneeflocken schwebten vom Himmel und legten sich auf die zehn Zentimeter dicke Decke, die tagsüber schon gefallen war. Es wehte kein nennenswerter Wind, die Nacht war still und friedlich.
Cochrane zog seine Strickmütze tiefer, verkroch sich in seinen dicken Wollmantel und schob die Hände tief in die Manteltaschen. Die Schweiz im Januar. Eigentlich war es völlig normal, dass es schneite, das tat es häufig. Doch Cochrane wurde jedes Mal davon überrascht.
Der Grund dafür war, dass Cochrane seine Tage einhundert Meter unter der Erdoberfläche in den Tunnels und im Kontrollraum eines riesigen Teilchenbeschleunigers verbrachte, der unter dem Namen Large Hadron Collider oder kurz LHC bekannt war. Der LHC wurde von der Europäischen Organisation für Kernforschung betrieben, auch bekannt unter dem Akronym CERN – nach den Initialen des französischen Namens der Einrichtung (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire).
Die Temperatur in Kontrollraum des LHC betrug beständig genau 20 Grad Celsius, die Beleuchtung war konstant, und die Hintergrundgeräusche bestanden aus einem gleichförmigen Summen von Generatoren und pulsierender Energie. Ein paar Stunden, die man dort unten verbrachte, fühlten sich nicht anders an als ein paar Tage oder ein paar Wochen. Es war, als würde die Zeit nicht verstreichen.
Aber natürlich tat sie das, und es verblüffte Cochrane sehr oft, wie verändert die Welt bei seiner Rückkehr zur Oberfläche erschien. Er hatte das Gebäude an diesem Morgen unter blauem Himmel und einer hellen, wenn auch fern und unwirklich erscheinenden Sonne betreten. Nun wölbte sich über ihm eine dicke, schwere und tief hängende Wolkendecke, die von unten von dem orangefarbenen Schein der Lichter Genfs erhellt wurde. Und ringsum lag eine zehn Zentimeter hohe Schneedecke, die zwölf Stunden zuvor noch nicht existiert hatte.
Cochrane wanderte durch diese weiße Szenerie zum Bahnhof. Die hohen Tiere des CERN – die Physiker und anderen Wissenschaftler – kamen und gingen in Dienstfahrzeugen mitsamt Chauffeuren und geheizten Sitzen, die vom CERN zur Verfügung gestellt wurden.
Cochrane war kein Physiker oder Teilchen-Theoretiker oder auch nur in einem anderen dieser Fachbereiche tätig. Natürlich konnte er eine fundierte Ausbildung vorweisen. Er hatte ein Diplom in Elektrodynamik, zwanzig Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Energieübertragung und wurde gut bezahlt. Aber seinen hervorragenden Ruf verdankte das CERN den Physikern und allen anderen, die nach den kleinsten Bausteinen des Universums suchten. Für sie war Cochrane nicht mehr als ein hoch bezahlter Techniker. Sie waren bedeutender als er. Sogar die Maschine, an der er arbeitete, war bedeutender als er. Tatsächlich war sie bedeutender als alles andere.
Der Large Hadron Collider war die größte wissenschaftliche Apparatur der Welt. Seine Tunnel waren siebenundzwanzig Kilometer lang und verliefen in einem Kreis, der bis über die französische Grenze reichte. Cochrane war an der Konstruktion und am Bau der supraleitenden Magnete, die die in die Tunnel geschossenen Teilchen beschleunigten, beteiligt gewesen. Und als Angestellter des CERN war es seine Aufgabe, sie funktionsfähig zu erhalten.
Um den LHC in Betrieb zu setzen, war eine unglaubliche Menge an Energie nötig, die im Wesentlichen von den Magneten verbraucht wurde. Nachdem sie auf –271 Grad Celsius heruntergekühlt wurden, konnten sie Protonen fast bis auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Die Teilchen waren im LHC so schnell unterwegs, dass sie die siebenundzwanzig Kilometer des kreisförmigen Tunnels in einer einzigen Sekunde elftausendmal durcheilten.
Das einzige Problem für Cochrane war, dass das Versagen eines einzigen Magneten die gesamte Anlage für Tage oder sogar Wochen stilllegen konnte. Richtig wütend war er vor ein paar Monaten gewesen, als ein Subunternehmer eine minderwertige Leiterplatte eingebaut hatte, die auch sofort durchgebrannt war. Selbst jetzt noch überstieg es Cochranes Vorstellungsvermögen, dass eine Zehn-Milliarden-Dollar-Maschine nur darum den Dienst quittieren musste, weil jemand ein paar Euros hatte einsparen wollen.
Es hatte drei Wochen gedauert, um den Schaden zu reparieren, wobei ihm jeden Tag irgendwelche Vorgesetzten im Nacken saßen. Irgendwie schob man ihm die Schuld zu. Andererseits war es immer seine Schuld.
Auch wenn jetzt alles reibungslos vonstattenging, betrachteten die Physiker und die CERN-Leitung die Magneten als das schwache Glied im System. Infolgedessen wurde Cochrane an der kurzen Leine gehalten und wohnte praktisch in der Forschungsanlage.
Für einen Moment loderte die Wut darüber in ihm hoch, doch dann zuckte er nur die Achseln. Schon bald müsste sich jemand anders mit diesem Problem herumschlagen.
Cochrane stapfte weiter durch den Schnee zum Bahnhof. In gewissem Maß war der Schnee ein zusätzlicher Vorteil. Spuren waren darin zu erkennen. Und er wollte, dass heute Spuren zurückblieben.
Er stieg zum Bahnsteig hoch. In fünf Minuten sollte der nächste Zug einfahren. Er war pünktlich. Der Bahnsteig war leer. In fünf Minuten oder weniger wäre er unterwegs in ein neues Leben, ein Leben, das, da war er sich sicher, um einiges lohnender wäre als sein augenblickliches.
Eine Stimme rief seinen Namen. »Alex?«
Er wandte sich um und ließ den Blick über die Plattform schweifen. An deren Ende war ein Mann die Treppe heraufgestiegen und kam unter den Halogenlampen auf ihn zu.
»Ich dachte mir schon, dass Sie es sind«, sagte der Mann, während er sich näherte.
Cochrane erkannte ihn. Es war Philippe Revoir, der stellvertretende Sicherheitschef des LHC. Cochranes Kehle war plötzlich wie zugeschnürt. Er hoffte, dass nichts schiefgegangen war. Nicht heute. Nicht an diesem Abend.
Cochrane holte sein Mobiltelefon hervor und vergewisserte sich, dass er nicht zurückbeordert worden war. Keine Nachrichten. Keine Anrufe. Was zum Teufel hatte Revoir hier zu suchen?
»Philippe«, sagte Cochrane so freundlich er konnte. »Ich dachte, Sie bereiteten den morgigen Durchlauf vor.«
»Wir haben unsere Arbeit getan«, erwiderte Revoir. »Den Rest kann die Nachtschicht erledigen.«
Cochrane verspürte eine plötzliche Unruhe. Trotz der Kälte begann er zu schwitzen. Er spürte, dass Revoirs Erscheinen kein Zufall war. Hatten sie irgendetwas herausgefunden? Wussten sie über ihn Bescheid?
»Warten Sie auf einen Zug?«, fragte er.
»Natürlich«, antwortete der Sicherheitschef. »Wer fährt schon selbst bei so einem Wetter?«
Wer bei so einem Wetter Auto fährt? Zehn Zentimeter Schnee sind ein normaler Wintertag in Genf. Jeder fährt bei diesem Wetter.
Während Revoir näher kam, rasten Cochranes Gedanken. Alles, was er mit Sicherheit wusste, war, dass er nicht zulassen konnte, dass der stellvertretende Sicherheitschef mit ihm fuhr. Nicht hier und nicht jetzt.
Er dachte daran, zum LHC zurückzukehren und sich darauf herauszureden, dass er etwas vergessen habe. Er sah auf die Uhr. Dazu reichte die Zeit nicht mehr. Er kam sich wie in einer Falle vor.
»Ich leiste Ihnen Gesellschaft«, sagte Revoir und holte einen Flachmann hervor. »Wir können etwas trinken.«
Cochrane blickte auf die Gleise. Er hörte bereits den Zug kommen. In der Ferne sah er das helle Leuchten seiner Scheinwerfer.
»Ich, hm … ich …«, begann Cochrane.
Ehe er den Satz beenden konnte, hörte er Schritte hinter sich. Jemand kam die Treppe herauf. Er drehte sich um und sah zwei Männer. Sie trugen dunkle Mäntel, beide waren trotz des winterlichen Wetters offen.
Eine Sekunde lang vermutete Cochrane, dass dies Philippes Männer waren, Angehörige der Wachmannschaft oder gar der Polizei, aber Revoirs Gesichtsausdruck sagte etwas anderes. Der stellvertretende Sicherheitschef studierte sie misstrauisch, und die Erfahrung eines Lebens, das im Wesentlichen aus der Bewertung von Gefahren und potentiellen Bedrohungen bestanden hatte, sagte ihm, was Cochrane längst wusste, nämlich dass diese Männer Schwierigkeiten bedeuteten.
Cochrane versuchte nachzudenken, wollte eine Lösung finden, um zu vermeiden, was geschehen würde. Aber seine Gedanken waren zähflüssig wie erkaltete Melasse. Ehe er etwas sagen konnte, hatten die Männer plötzlich Waffen in den Händen. Kurzläufige halbautomatische Pistolen. Eine zielte auf Cochrane, die andere auf Philippe Revoir.
»Haben Sie geglaubt, dass wir Ihnen trauen?«, fragte der erste der beiden Männer Cochrane.
»Was soll das?«, fragte Revoir.
»Halten Sie die Klappe«, sagte der zweite Mann und stieß den Lauf seiner Pistole in Revoirs Richtung.
Der Anführer der beiden Gangster packte Cochrane an der Schulter und zog ihn dicht an sich heran. Allmählich geriet die Situation außer Kontrolle.
»Sie kommen mit uns«, sagte der Anführer. »Wir sorgen dafür, dass Sie an der richtigen Haltestelle aussteigen.«
Während der zweite Mann lachte und zu Cochrane hinsah, griff Revoir an und rammte dem Mann ein Knie in den Unterleib.
Cochrane wusste nicht, was er tun sollte, aber als der Anführer sich umdrehte, um zu schießen, ergriff er dessen Arm und stieß ihn nach oben. Die Pistole ging los, und der Knall hallte durch die Dunkelheit.
Da Cochrane kaum eine andere Wahl hatte, als zu kämpfen, stieß er den größeren Mann um und rollte mit ihm über den Bahnsteig.
Ein Faustschlag ins Gesicht betäubte ihn halb. Ein heftiger Ellbogenstoß in die Rippen warf ihn zur Seite.
Während er sich aufrichtete, sah er, wie Revoir dem zweiten Gangster einen Kopfstoß verpasste. Nachdem er ihn außer Gefecht gesetzt hatte, wirbelte Revoir herum und stürzte sich auf den Anführer, der soeben Cochrane von sich abgeworfen hatte. Sie kämpften um die Pistole und deckten sich gegenseitig mit mehreren harten Treffern ein.
Ein Donnern wurde im Hintergrund laut, als der herannahende Zug knapp einen halben Kilometer vor dem Bahnhof durch eine Kurve rollte. Cochrane konnte bereits die Bremsen quietschen hören, während die Stahlräder näher kamen.
»Alex!«, brüllte Revoir.
Der Angreifer hatte Revoir herumgeworfen und bemühte sich jetzt, die Pistole auf dessen Kopf zu richten. Der alte Sicherheitsexperte drückte den Arm mit der Pistole mit aller Kraft von sich weg, dann zog er ihn mit einem heftigen Ruck an sich, eine Aktion, mit der er seinen Gegner anscheinend völlig überrumpelte.
Er grub dem Mann die Zähne in die Hand, worauf der Gangster den Arm reflexartig zurückriss. Die Pistole löste sich aus seinem Griff und landete neben Cochrane im Schnee.
»Erschießen Sie ihn!«, brüllte Revoir, umklammerte den Angreifer und versuchte, ihn still zu halten.
Das Geräusch des Zuges dröhnte in Cochranes Ohren. Sein Herz hämmerte in der Brust, während er die Pistole aufhob.
»Erschießen Sie ihn!«, wiederholte Revoir.
Cochrane schaute auf die Gleise, er hatte nur noch Sekunden. Er musste sich entscheiden. Er zielte auf den Angreifer. Dann senkte er den Arm und drückte ab.
Philippe Revoirs Kopf flog nach hinten, und Blut spritzte auf den schneebedeckten Bahnsteig.
Revoir war tot, und der Angreifer im grauen Mantel vergeudete keine Zeit, zerrte ihn zurück in den Schatten und wuchtete ihn hinter eine Bank, während der herannahende Zug eine Baumreihe am Ende des Bahnhofs passierte.
Mit einem Gefühl, als müsse er sich jeden Moment übergeben, schob Cochrane die Pistole in seinen Hosenbund und bedeckte sie mit dem Oberhemd.
»Sie hätten sich zurückhalten sollen«, sagte Cochrane.
»Konnten wir nicht«, erwiderte sein Angreifer. »Diese Möglichkeit war nicht vorgesehen.«
Der Zug rollte in den Bahnhof, wirbelte Schnee auf und erzeugte einen heftigen Wind.
»Es sollte wie eine Entführung aussehen«, rief Cochrane über den Lärm hinweg.
»Das wird es auch«, sagte der Mann. Er holte mit der Rechten aus, traf Cochrane seitlich am Kopf, schlug ihn zu Boden und versetzte ihm einen Tritt in die Rippen.
Der Zug hielt neben ihnen an, während beide Angreifer Cochrane hochzogen und ihn rückwärtsgehend zur Treppe schleiften.
Cochrane war benommen, während sie ihn wegschafften, völlig desorientiert und verwirrt. Er hörte zwei Schüsse und einige laute Rufe von Passagieren, die aus dem fast leeren Zug stiegen.
Das Nächste, das er mitbekam, war, dass er auf dem Rücksitz einer Limousine lag und aus dem Fenster starrte, während sie durch die Straßen und den wirbelnden Schnee rasten.
2
Ostatlantik, 14. Juni 2012
Die Fluten des Ostatlantik wiegten sich in einer leichten Dünung, während die Kinjara Maru nach Norden in Richtung Gibraltar und auf die Einfahrt ins Mittelmeer zudampfte. Das Schiff fuhr mit acht Knoten, etwa der Hälfte seiner Höchstgeschwindigkeit – was jedoch das wirtschaftlichste Tempo im Hinblick auf den Treibstoffverbrauch war.
Kapitän Heinrich Nordegrun stand auf der klimatisierten Kommandobrücke und betrachtete den Radarschirm. Keine Schlechtwetterfront und nur wenig Schiffsverkehr.
Vor ihnen befanden sich keine Schiffe, und lediglich ein einziges lag hinter ihnen, zehn Meilen weit entfernt. Es war ein VLCC, ein Very Large Crude Carrier, oder Supertanker, wie diese Schiffe allgemein genannt wurden. VLCCs waren die größten betriebenen Schiffe, größer noch als amerikanische Flugzeugträger, zu groß für eine Durchfahrt durch den Panama- oder den Suezkanal und oft schwerer als 500 000 Tonnen, wenn sie voll beladen waren. Allerdings musste das Schiff hinter ihnen, gemessen an seiner Geschwindigkeit, leer sein.
Nordegrun hatte zuvor versucht, den Tanker zu grüßen. Er wusste gern, wer sonst noch da draußen war, vor allem in solchen fragwürdigen Gewässern. Hier, vor der Küste Westafrikas, waren die Verhältnisse zwar nicht so riskant wie auf der anderen Seite des Kontinents vor Somalia. Aber trotzdem war es nützlich, andere Schiffe anzurufen und herauszufinden, was sie wussten oder gehört hatten. Dieses Schiff hatte nicht geantwortet, aber das war eigentlich keine echte Überraschung. Einige Mannschaften redeten gern, andere nicht.
Während er den Tanker aus seinem Bewusstsein verdrängte, schaute Nordegrun durchs Fenster auf den Ozean, der vor ihm lag. Das freie Wasser und die ruhige Nacht verhießen eine ungestörte Weiterfahrt.
»Bringen Sie uns auf zwölf Knoten«, sagte er.
Der Steuermann, ein Filipino namens Isagani Talan, antwortete: »Aye, Sir.«
Mit der Handelsmarine auf den Weltmeeren sah es mittlerweile so aus, dass Nordegrun, ein Norweger, ein auf den Bahamas registriertes und in Südkorea gebautes Schiff lenkte, das einer japanischen Firma gehörte und eine Mannschaft hatte, die vorwiegend aus Filipinos bestand. Um die Weltläufigkeit ihrer Reise abzurunden, beförderten sie eine afrikanische Fracht aus Mineralien, die für eine Fabrik in China bestimmt war.
Ein Außenseiter hätte es wahrscheinlich für Wahnsinn gehalten, aber das Einzige, was wirklich zählte, war, dass die direkt Beteiligten ihren Job beherrschten. Nordegrun fuhr seit zwei Jahren mit Talan zur See und vertraute ihm bedingungslos.
Die Vibration des Schiffes veränderte sich, als die Maschinen auf die Anweisung reagierten. Nordegrun schaltete vom Radarschirm auf einen Monitor um, der sich vor ihm befand. Er lag und ruhte auf einem Sockel wie auf einem traditionellen Kartentisch, und doch war es ein moderner HD-Touchscreen. Er lieferte zurzeit ein Bild von den Gewässern in ihrer Umgebung sowie die Positionsdaten seines Schiffes mitsamt Angaben über ihren Kurs und ihre Geschwindigkeit.
Auf den ersten Blick schien alles in Ordnung zu sein, aber indem er auf den Bildschirm tippte, konnte sich Nordegrun einen genaueren Überblick verschaffen und stellte fest, dass eine südliche Meeresströmung sie um etwa fünfhundert Meter vom Kurs abgelenkt hatte.
Nichts Besorgniserregendes, dachte Nordegrun, aber wenn Perfektion möglich war, warum sollte man sich dann nicht darum bemühen?
»Zwei Grad nach Backbord«, sagte er.
Talans Position auf der Kommandobrücke befand sich vor Nordegrun an der Steuerkonsole des Schiffes. Die Konsole selbst hatte nichts mehr mit den Steuerständen gemein, wie sie auf Schiffen bisher üblich gewesen waren. Verschwunden waren das große Speichenrad und der Anblick eines Mannes, der daran drehte, um den Kurs zu ändern. Verschwunden war der Maschinentelegraph mit seinem schweren Messinghebel, mit dessen Hilfe dem Maschinenraum die Anweisungen zum Ändern der Geschwindigkeit mitgeteilt wurden.
Stattdessen saß Talan auf einem hohen podestartigen Sessel vor einem Computerbildschirm. Das Rad war nun ein kleiner stählerner Knauf, der Gashebel hatte die Größe eines Automobilschaltknüppels.
Als Talan die entsprechenden Änderungen vornahm, wurden elektronische Signale zu den Ruderlenksystemen und den Maschinen im Heck des Schiffes gesandt. Die Kurskorrektur war derart geringfügig, dass sie sich weder physisch noch visuell bemerkbar machte, aber der Kapitän konnte sie auf dem Bildschirm genau verfolgen. Es dauerte einige Minuten, aber dann befand sich das Schiff wieder auf seinem richtigen Kurs und hatte seine neue Geschwindigkeit erreicht.
Zufrieden blickte Nordegrun auf.
»Halten Sie uns auf diesem Weg«, sagte er. »Da sie uns all diese tolle Technik zur Verfügung stellen, sollten wir sie auch benutzen.«
»Ja, Sir«, sagte Talan.
Nachdem das Schiff wieder auf Kurs lag, warf Nordegrun einen Blick auf die Uhr. Es war kurz nach zweiundzwanzig Uhr Ortszeit, die dritte Wache hatte soeben übernommen. Überzeugt, dass das Schiff in guten Händen war, blickte er zu dem wachhabenden Offizier hinüber.
»Sie gehört Ihnen«, sagte er.
Nordegrun machte Anstalten, die Kommandobrücke zu verlassen, und schaute ein letztes Mal nach dem Tanker, der ihnen folgte. Er hatte die Kursänderung der Kinjara Maru mitgemacht und seltsamerweise ebenfalls auf 12 Knoten beschleunigt.
»Affen äffen alles nach«, murmelte er, während er zur Tür ging.
Als er durch die Tür trat und sich nach achtern wandte, sah Nordegrun in die Dunkelheit. Er konnte die Beleuchtung auf dem Schiff, das ihnen folgte, erkennen. Ein seltsames Licht, dachte er. Die Lampen waren bläulich weiß so wie die Hochleistungsscheinwerfer moderner Luxuslimousinen.
So etwas hatte er noch nie bei einem Schiff gesehen, auch nicht aus der Ferne. Was er dagegen kannte, war der übliche gelbliche oder rein weiße Lichtschein, den weiße Glühbirnen oder Leuchtstofflampen erzeugten. Aber vor einigen Jahren hatte auch noch niemand daran gedacht, dass ein Schiff von einem Computer gesteuert werden würde.
Er betrat den Treppengang und schloss das Schott hinter sich. Während er die Stufen zu seinem Quartier hinunterstieg, war Nordegrun voller Elan. Im Gegensatz zu früheren Generationen von Seeleuten durften er und seine Offiziere ihre Familien an Bord mitnehmen. Nordegruns Ehefrau, mit der er seit zwei Jahren verheiratet war, begleitete ihn das erste Mal auf See. Sie würde bis Kairo bei ihm bleiben, dann von Bord gehen und nach Hause zurückfliegen, während die Kinjara Maru den Suezkanal passierte.
Es würde eine schöne Woche werden, dachte er, ein Urlaub, ohne einen einzigen Tag frei nehmen zu müssen. Wenn er sich beeilte, traf er sie vielleicht noch in der Schiffsmesse.
Als er das Unterdeck erreichte, wurde die Treppenbeleuchtung trübe. Er schaute hoch. Die Drähte in der Glühlampe über der Tür sahen aus, als würden sie jeden Moment durchbrennen. Weiter oben begannen die Leuchtstofflampen unregelmäßig zu flackern.
Sie brannten nach einer Sekunde wieder normal, aber Nordegrun hatte keinen Zweifel, dass es irgendein Problem mit den Generatoren gab. Missgelaunt machte er kehrt, um die Treppe wieder hinaufzusteigen.
Die Lampen verdunkelten sich abermals, dann hellten sie sich wieder auf, bis sie blendend weiß leuchteten. Die Leuchtstoffröhren gaben seltsame Geräusche von sich, zerplatzten dann gleichzeitig und regneten in Form winziger Splitter auf ihn herab. Die Glühbirne an der Wand explodierte mit einem leisen Knall, blitzte bläulich weiß auf und ließ die Treppe in schwarzer Dunkelheit versinken.
Nordegrun hielt sich am Geländer fest, geschockt und überrascht zugleich. So etwas hatte er noch nie gesehen. Er spürte, wie sich das Schiff auf die Seite legte, als vollführe es eine scharfe Wende. Ohne auch nur die geringste Idee zu haben, was da los sein mochte, rannte er die dunkle Treppe hinauf und in Richtung Bug und Kommandobrücke. Überall im Schiff zersprangen Lampen und Leuchtstoffröhren.
Nordegrun spürte einen heftig stechenden Schmerz in seinem Hals und Unterkiefer. Sicher nur Stress, dachte er, die typische Kampf-oder-Flucht-Reaktion, während irgendetwas mit dem Schiff geschah.
Er stürmte auf die Brücke. »Was zum Teufel ist hier los?«, rief er.
Weder Talan noch der wachhabende Offizier antworteten. Talan brüllte ins Interkom. Der OOD kämpfte mit dem Computer und hämmerte Override-Befehle in die Tastatur, während sich das Schiff weiter drehte.
Nordegrun sah flüchtig, dass das Ruder vollständig nach Backbord eingeschlagen war. Einen kurzen Moment später flackerte der Bildschirm auf und leerte sich. Funken sprühten aus einem anderen Gerät, während die Schmerzen in Nordegruns Kopf schlagartig schlimmer wurden.
Fast im gleichen Moment sackte der wachhabende Offizier zu Boden, hielt sich den Kopf und stöhnte vor Schmerzen.
»Talan!«, rief Nordegrun. »Verschwinden Sie nach unten. Gehen Sie zu meiner Frau.«
Der Steuermann zögerte.
»Sofort!«
Talan verließ seinen Posten. Nordegrun griff nach dem Mikrofon des Funkgeräts und versuchte zu senden. Er drückte auf die Sprechtaste, aber das Gerät gab ein schrilles Pfeifen von sich. Nordegrun streckte die Hand nach einem anderen Gerät aus, hatte jedoch plötzlich das Gefühl, seine Brust brenne lichterloh.
Er blickte nach unten und gewahrte, dass die Knöpfe seiner Jacke rot glühend waren. Er griff nach einem und zog daran, versengte sich jedoch die Hand. Der Lärm in seinem Kopf steigerte sich zu einem Crescendo, dann stürzte Nordegrun zu Boden. Sogar mit geschlossenen Augen sah er Sterne und Lichtblitze, als drücke ihm jemand mit den Daumen die Augen in den Kopf.
Nach einem Knall in seinem Kopf rann Blut aus seiner Nase. Irgendetwas in seinen Nebenhöhlen war geplatzt.
Nordegrun schlug die Augen auf und sah, dass sich die Kommandobrücke mit wallendem Rauch gefüllt hatte. Auf allen vieren kroch er zur Tür. Mit blutüberströmtem Gesicht stieß er das Schott auf und gelangte teilweise nach draußen. Gleichzeitig steigerte sich der Schmerz in seinem Kopf zu einem Schrei.
Er sank aufs Deck, das Gesicht nach achtern gerichtet. Hinter ihm zuckten elektrische Funken zwischen der Reling und dem Decksaufbau hin und her. Weiter draußen erkannte er das Schiff mit den seltsamen Lichtern immer noch in ihrem Kielwasser. Es war nach wie vor zehn Meilen entfernt, erstrahlte aber jetzt ein Dutzend Mal heller, als wäre es in Elmsfeuer eingehüllt.
Nordegruns Geist war derart weggetreten, dass er nichts anderes tun konnte, als dieses Schauspiel tatenlos zu betrachten. Und dann versteifte sich sein Körper in einem krampfartigen Anfall, begleitet von einem Schmerz, der seine Vorstellungskraft bei weitem übertraf. Nordegrun brüllte los, als Flammen aus seiner Haut schlugen.
3
Ostatlantik, 15. Juni
Als der Tag über dem Atlantik graute, stand Kurt Austin am Bug des NUMA-Schiffes Argo und wischte sich mit einem Handtuch den Schweiß vom Gesicht. Er hatte soeben fünfzig Laufrunden auf dem Hauptdeck beendet. Nur weil das Deck nicht um das gesamte Schiff herum verlief, war er gezwungen gewesen, den Decksaufbau am Ende jeder Runde zu betreten, zwei Treppen hoch zu rennen, den Heckspiegel zu überqueren, dann zwei Treppen hinab zu laufen, den Decksaufbau wieder zu verlassen und die nächste Runde zu beginnen.
Es wäre viel einfacher gewesen, den Fitnessraum aufzusuchen, die Tretmühle für fünf Meilen zu bearbeiten und dann auf den StairMaster zu steigen, aber sie waren auf See, und für Austin war die See immer gleichbedeutend mit Freiheit gewesen: mit der Freiheit umherzustreifen und die Welt zu erforschen, mit der Freiheit von Verkehr und Smog und den zuweilen klaustrophobischen Bedingungen eines modernen Stadtlebens. Hier draußen – mit der Verheißung des heraufdämmernden Tages am Horizont – würde er sich für die Dauer seines Frühsportprogramms niemals in einen engen fensterlosen Raum einschließen, selbst wenn dieser über eine Klimaanlage verfügte.
Bekleidet mit einer schwarzen Trainingshose und einem verwaschenen grauen T-Shirt mit dem NUMA-Logo auf der Brust fühlte sich Austin so gut wie schon seit langem nicht mehr. Er war knapp über eins achtzig groß, breitschultrig und hatte lockiges silbergraues Haar, das je nach Lichteinfall gelegentlich platinweiß schimmerte. Er hielt die Farbe seiner Augen für eine Blauschattierung, aber offensichtlich war der Farbton ungewöhnlich, da schon viele Menschen – vor allem die Frauen in seinem Leben – vergeblich versucht hatten, ihm einen Namen zu geben.
Da er auf seinen vierzigsten Geburtstag zuging, hatte sich Austin für eine Wiederaufnahme intensiver sportlicher Betätigung entschieden. Er war schon immer gut in Form gewesen. Das forderte eine Karriere in der Navy und eine mehrjährige Tätigkeit bei einem geheimen Bergungsteam der CIA. Aber da die Zehnerziffer seiner Alterszahl demnächst eine vier sein würde, war Austin entschlossen, sich in die beste Form seines Lebens zu bringen, eine bessere als mit dreißig, eine bessere sogar als mit zwanzig.
Zehn Pfund leichter als noch vor einem Jahr, in dem er im Kraftraum mehr Eisen gehoben, gestemmt und geschwungen hatte als je zuvor, fühlte er die Kraft durch seinen Körper strömen wie damals in seiner Jugend, als er noch geglaubt hatte, alles schaffen zu können.
Es war auch nötig. Eine Tätigkeit bei der NUMA war mit vielfältigen körperlichen Anstrengungen verbunden. Neben der regulären kraftraubenden Arbeit bei jeder Bergungsoperation war er beinahe regelmäßig verprügelt, beschossen und halb ertränkt worden. Nach einer Weile wurde er der ständigen Blessuren überdrüssig. Ein Jahr zuvor hatte er ernsthaft darüber nachgedacht, ein ständig offenes Angebot anzunehmen und für seinen Vater zu arbeiten, der ein eigenes angesehenes Bergungsunternehmen besaß. Aber das hätte ihm das Gefühl vermittelt, dass sein Handeln von jemand anderem bestimmt werden würde. Und wenn es etwas gab, wozu sich Kurt Austin niemals hinreißen ließ, dann dazu, anderen Vorgaben als seinen eigenen zu folgen.
Er blickte zum Horizont, dessen Farbe von einem dunklen Indigo in ein blassgraues Blau überging. Das Licht nahm zu, obwohl sich die Sonne erst noch zeigen musste. Er streckte und reckte sich und drehte sich dann in den Hüften, um seine Rückenmuskulatur zu lockern. Dabei fiel ihm an Steuerbord etwas ins Auge: ein dünner Rauchfaden, der sich in den Himmel kräuselte.
Er hatte ihn nicht gesehen, während er sein Lauftraining absolvierte. Die Dunkelheit hatte ihn verborgen, aber der Rauch war eindeutig keine Illusion.
Er kniff die Augen zusammen, um mehr erkennen zu können, doch im ungewissen Halbdunkel des erwachenden Tages konnte er die Rauchquelle nicht identifizieren. Er warf einen letzten prüfenden Blick auf die Erscheinung und ging dann zur Treppe.
Austin betrat die Kommandobrücke und traf dort auf Kapitän Robert Haynes, den Kommandanten der Argo, der zusammen mit dem wachhabenden Offizier den Kurs zu den Azoren berechnete, wo das NUMA-Team an einem X-Prize-ähnlichen Rennen teilnehmen würde, um das schnellste Zwei-Mann-U-Boot der Welt zu ermitteln.
Die Operation war ganz und gar Routine. Es war ein reiner Forschungsauftrag, mit dem Austin und sein Partner, Joe Zavala, für die schwere Arbeit belohnt wurden, die sie während der letzten Bergungsmissionen geleistet hatten. Joe Zavala befand sich bereits auf Santa Maria Island, traf die nötigen Vorbereitungen und, wie Austin vermutete, schloss Freundschaften, vor allem mit der Damenwelt. Kurt Austin freute sich auf ihr Wiedersehen, aber ehe der Kurzurlaub beginnen konnte, mussten sie noch einen kleinen Umweg machen.
Haynes schaute nicht für eine Sekunde von seinen Seekarten hoch. »Haben Sie meine Decks lange genug zweckentfremdet?«, fragte er.
»Erst einmal«, erwiderte Austin. »Aber wir müssen den Kurs auf eins-neun-null ändern.«
Der Kapitän schaute kurz hoch und dann wieder auf den Kartentisch. »Ich habe Sie gewarnt, Kurt, wenn Ihnen etwas über die Reling fällt, werden Sie schwimmen müssen, sollten Sie es zurückhaben wollen.«
Austin lächelte kurz, aber die Situation war ernst.
»Querab an Steuerbord ist eine Rauchwolke«, sagte Austin. »Bei irgendjemandem brennt es, und ich glaube nicht, dass sie ein Grillfest feiern.«
Der Kapitän richtete sich auf, und das Lächeln war aus seinem Gesicht verschwunden. Ein Feuer auf See ist eine hochgefährliche Angelegenheit. Schiffe sind mit Rohren und Leitungen vollgestopft, in denen brennbare Flüssigkeiten wie Treibstoff und Hydrauliköl fließen. Sehr oft transportieren sie außerdem noch eine hochexplosive Fracht wie Erdöl, Erdgas, Steinkohle und Chemikalien, gelegentlich sogar Metalle wie Magnesium und Aluminium, die leicht entflammbar sind. Und im Gegensatz zu einem Feuer an Land gibt es keinen sicheren Zufluchtsort, an den man sich retten kann, es sei denn man greift zur letzten Möglichkeit im Kapitänshandbuch und gibt das Schiff auf.
Kurt Austin wusste das genauso gut wie jeder andere Mann auf der Argo. Kapitän Haynes zögerte nicht oder versuchte auch nur, die Richtigkeit von Kurt Austins Einschätzung zu überprüfen. Er wandte sich an den Steuermann.
»Bringen Sie uns hin«, sagte er. »Neuer Kurs eins-neun-null. Und zwar mit Höchstgeschwindigkeit.«
Während der Steuermann den Befehl ausführte, schnappte sich der Kapitän ein Fernglas und ging auf die Steuerbordseite der Brückennock hinaus. Kurt Austin folgte ihm.
Die Argo war ziemlich nah am Äquator, und in diesen Breiten kam das Tageslicht sehr schnell. So konnte Kurt Austin den Qualm mittlerweile sogar ohne Fernglas deutlich erkennen. Dick und dunkel stieg er als eine schlanke, senkrechte Säule in den Himmel, wurde mit zunehmender Höhe nur unwesentlich dünner und trieb leicht nach Osten.
»Es sieht nach einem Frachtschiff aus«, sagte Kapitän Haynes.
Er reichte Austin das Fernglas.
Austin richtete es auf das Schiff. Es war mittelgroß, kein Containerschiff, sondern ein Massengutfrachter. Anscheinend trieb er steuerlos dahin.
»Das ist Qualm von brennendem Öl«, sagte Austin. »Das gesamte Schiff ist darin eingehüllt, aber achtern ist er am dichtesten.«
»Ein Feuer im Maschinenraum«, sagte Haynes. »Oder ein Problem mit einem der Bunker.«
Kurt Austin vermutete das Gleiche.
»Haben Sie irgendwelche Notrufe aufgefangen?«
Kapitän Haynes schüttelte den Kopf. »Nichts. Nur das übliche Funkgeplapper.«
Kurt Austin fragte sich, ob das Feuer die elektrische Anlage zerstört hatte. Aber selbst für einen solchen Fall besaßen die meisten Schiffe Sicherheitssysteme, und jedes Schiff von dieser Größe hätte mehrere tragbare Sende- und Empfangsgeräte, einen automatischen Notrufsender und sogar Funkgeräte in den Hauptrettungsbooten besessen. Von einem über einhundertfünfzig Meter langen Schiff, das brannte und führerlos dahintrieb, nichts zu hören war so gut wie unmöglich.
Mittlerweile hatte die Argo ihre Wende abgeschlossen und hielt direkt auf das angeschlagene Schiff zu. Ihre Geschwindigkeit nahm stetig zu, und Kurt Austin spürte ein Vibrieren unter den Füßen, als sie durch die Wellen pflügte. Bei ruhiger See schaffte die Argo dreißig Knoten. Kurt Austin schätzte die Entfernung auf knapp über fünf Meilen und damit deutlich geringer, als er zuerst angenommen hatte. Das war gut.
Aber zehn Minuten später, als er das Fernglas auf die Decksaufbauten richtete und die Vergrößerung steigerte, sah er mehrere Dinge, die alles andere als gut waren.
Flammen schlugen aus verschiedenen Luken auf dem Oberdeck, was bedeutete, dass das gesamte Schiff brannte und nicht nur der Maschinenraum. Das Schiff hatte deutliche Schlagseite nach Backbord sowie einen abgesenkten Bug, was darauf hindeutete, dass es nicht nur brannte, sondern auch Wasser aufnahm. Das Schlimmste schien ihm jedoch, dass sich Männer auf den Decks befanden, die etwas zur Reling schleiften.
Zuerst tippte Kurt Austin auf einen verletzten Mannschaftsangehörigen, doch dann ließen sie die Person los und einfach aufs Deck fallen. Der Mann taumelte, als sei er gestoßen worden, dann raffte er sich auf und rannte los. Er machte einige Schritte, stürzte plötzlich und schlug mit dem Gesicht auf.
Kurt Austin riss das Fernglas nach rechts, um sich zu vergewissern. Er konnte deutlich einen Mann erkennen, der ein Sturmgewehr in der Armbeuge hielt. Lautlos blitzte die Mündung auf. Ein Feuerstoß, dann ein zweiter.
Kurt Austin blickte wieder zu dem Mann hin, der gestürzt war. Er lag nun völlig regungslos bäuchlings auf dem Deck.
Piraten, dachte Kurt Austin. Bewaffnete Geiselnehmer. Das Frachtschiff steckte in größeren Schwierigkeiten, als er anfangs vermutet hatte.
Kurt Austin ließ das Fernglas sinken, als ihm bewusst wurde, dass viel mehr als nur eine Rettungsaktion auf sie wartete.
»Käpt’n«, sagte er. »Unsere Probleme haben sich soeben verzigfacht.«
4
An Bord der Kinjara Maru kämpfte Kristi Nordegrun mit der Dunkelheit. In ihren Ohren erklang ein seltsames Geräusch, und ihr Kopf pochte, als hätte sie den ganzen Abend getrunken. Sie lag auf dem Fußboden, die Gliedmaßen steif und vollkommen verrenkt.
Sosehr sie sich den Kopf zerbrach, sie konnte sich nicht einmal erinnern, wie sie hierhergekommen war, geschweige denn, was geschehen sein mochte. Dem tauben Gefühl in ihren Beinen nach zu urteilen befand sie sich schon längere Zeit in dieser Position.
Da sie noch nicht richtig stehen konnte, stützte sie sich an der Wand ab und kämpfte mit Gleichgewichtsstörungen.
Sie befand sich im tiefsten Bereich der Mannschaftsquartiere, mehrere Etagen unter dem Oberdeck und etwa in der Schiffsmitte. Hierher war sie gekommen, weil sich auf dieser Etage die Messe befand und sie mit ihrem Mann ein spätes Abendessen einnehmen wollte, ehe sie zu Bett gingen. Sie sah sich suchend um, fand ihn aber nicht. Das machte ihr Sorgen.
Wenn sie einige Zeit ohnmächtig gewesen war, hätte ihr Mann sie sicherlich gefunden. Andererseits, wenn sich das Schiff in Schwierigkeiten befand, musste er in erster Linie seine Aufgaben als Kapitän erfüllen.
Kristi nahm Brandgeruch wahr. Sie konnte sich an keine Explosion erinnern, aber es stand außer Zweifel, dass das Schiff brannte. Sie erinnerte sich, dass ihr Mann erzählt hatte, es gebe auf den Weltmeeren einige Gebiete, die von Terroristen mit Minen verseucht würden. Aber darüber machte er sich während dieser Reise anscheinend keine Sorgen.
Sie versuchte noch einmal aufzustehen, kippte jedoch zur Seite und stieß einen Tisch um, auf dem einige Getränkedosen standen. In der Dunkelheit hörte sie ein seltsames Geräusch, das an rollende Murmeln erinnerte.
Das Geräusch entfernte sich von ihr, dauerte jedoch an, bis es mit einem mehrmaligen dumpfen Klappern abbrach. In diesem Augenblick begriff Kristi, was geschehen war: Die Dosen waren von ihr weggerollt, waren schneller geworden, bis sie vom Querschott gestoppt wurden.
Sie befand sich ganz offensichtlich nicht im Gleichgewicht, aber das traf auch auf den Fußboden zu. Das Schiff lag schräg, hatte Schlagseite. Sie geriet in Panik. Sie wusste jetzt, dass das Schiff sank.
Sie kroch zur Wand, prallte dagegen und folgte ihr bis zur Tür. Sie drückte dagegen. Die Tür gab ein paar Zentimeter nach, stieß dann gegen etwas Weiches. Sie verstärkte den Druck, stemmte sich mit der Schulter dagegen und schob sie ein paar Zentimeter weiter auf. Als sie versuchte, sich durch den Spalt zu zwängen, erkannte sie, dass die Tür von dem Körper eines Mannes, der dagegen lehnte, blockiert wurde.
Sie stemmte sich erneut gegen die Tür, und der Mann bewegte sich schwach, rollte sich dann herum und stöhnte.
»Wer sind Sie?«, fragte Kristi. »Sind Sie verletzt?«
»Mrs Nordegrun«, presste der Mann mühsam hervor.
Sie erkannte die Stimme, die zu einem der Mannschaftsmitglieder ihres Mannes gehörte, zu jemandem, der auf der Kommandobrücke arbeitete. Ein netter Mann von den Philippinen, der, wie ihr Mann einmal gesagt hatte, sicherlich demnächst ein guter Offizier wäre.
»Mr Talan?«
Er richtete sich auf. »Ja«, antwortete er. »Sind Sie okay?«
»Ich kann nicht gerade stehen«, erwiderte sie. »Ich glaube, wir sinken.«
»Irgendetwas ist passiert«, sagte er. »Wir müssen zusehen, dass wir das Schiff verlassen.«
»Was ist mit meinem Mann?«
»Er ist auf der Brücke«, sagte Talan. »Er hat mich weggeschickt, um Sie zu holen. Schaffen Sie es bis zur Treppe?«
»Ich denke schon«, antwortete sie. »Selbst wenn ich kriechen muss.«
»Das ist auch besser«, sagte er, fand ihre Hand und lenkte sie in die richtige Richtung.
»Ja«, pflichtete sie ihm bei. »Wir müssen möglichst unterhalb des Qualms bleiben.«
Ehe sie geheiratet hatte, war Kristi Sanitäterin gewesen und hatte dann als Krankenschwester im Rettungsdienst gearbeitet. Sie war bei schweren Unfällen und Großbränden und sogar nach dem Einsturz eines Hochhauses eingesetzt worden. Trotz ihrer Angst und Verwirrung sorgten ihre Ausbildung und Erfahrung dafür, dass sie sich ein wenig beruhigte.
Zusammen krochen sie über den Fußboden. Nach knapp zwanzig Metern stießen sie auf ein weiteres Mannschaftsmitglied, doch sie konnten den Mann nicht wecken.
Kristi befürchtete das Schlimmste, aber sie musste sich vergewissern. Sie tastete nach dem Puls des Mannes.
»Er ist tot.«
»Wie?«, fragte Talan.
Sie wusste es nicht. Sie konnte keinerlei Spuren an ihm feststellen, und sein Hals schien unversehrt zu sein.
»Vielleicht die Dämpfe?«
Der Qualm schien hier dichter zu sein, aber keinesfalls so dicht, um eine tödliche Wirkung zu entfalten.
Kristi legte die Hand des Toten zurück auf seine Brust, dann krochen sie und Talan weiter. Sie erreichten den Treppenschacht und stießen die Tür auf. Zu Kristis Erleichterung war der Qualm dort bei weitem nicht mehr so dicht. Außerdem konnte sie stehen, indem sie sich am Geländer festhielt.
Als sie mit dem Aufstieg begannen, fiel von oben ein schmaler Lichtstrahl auf sie. Im Laufgang brannten einige Notlampen, während andere erloschen waren. Kristi vermutete anfangs, dass das Licht von den Notlampen im Treppenschacht herrührte, aber es war irgendwie seltsam. Das Licht war weißer, natürlich, und es schien gelegentlich nachzulassen und kurz darauf wieder heller zu werden.
Zwei Etagen höher war eine Tür mit einer Scheibe aus Temperglas als Fenster zu erkennen. Kristi vermutete, dass das Licht dort seinen Ursprung hatte, aber das erschien ihr nicht ganz logisch. Es war dunkel gewesen, als sie die Schiffsmesse aufgesucht hatte. Wie konnte es jetzt taghell sein?
Sie wusste, dass es eine andere Erklärung geben musste. Sie stieg weiter und bemühte sich, dicht hinter Talan zu bleiben. Als sie den obersten Absatz erreichten, drang von draußen Tageslicht herein, das ab und zu von Rauchschwaden eingetrübt wurde.
»Es ist Morgen«, sagte sie völlig entgeistert.
»Wir müssen mehrere Stunden lang bewusstlos gewesen sein«, stellte Talan fest.
»Und hat uns niemand gesucht?«, fragte sie, während die möglichen Begründungen dafür Angst in ihr aufflackern ließen.
Es erschien unmöglich, dass so viel Zeit verstrichen sein oder dass sich niemand in all diesen Stunden für ihr Schicksal interessiert haben sollte. Aber auf Grund dessen, was sie jetzt sehen konnte, schien es doch zuzutreffen.
Sie machte einen Schritt vorwärts und verlor beinahe das Gleichgewicht. Talan fing sie auf und lehnte sie an das nächste Schott.
»Nicht so hastig«, sagte er.
»Alles in Ordnung«, murmelte sie.
Talan ließ sie los, ging zur Tür und berührte sie vorsichtig, als rechne er damit, dass sie heiß war. Kristi bemerkte, dass die Glasscheibe gewölbt und verfärbt war wie geschmolzenes Wachs.
»Es ist okay«, sagte er. »Hier ist kein Feuer mehr.«
Er drückte gegen die Tür, die sich quietschend öffnete.
Dann trat er hinaus und winkte Kristi, ihm zu folgen. Sie kam ebenfalls heraus und hielt sich an der Reling fest.
Während Talan zum Bug schaute und versuchte, sich einen Eindruck vom Zustand des Schiffes zu verschaffen, tauchte ein Mann aus den wallenden Rauchschwaden auf. Er war hochgewachsen, breitschultrig und schwarz gekleidet. Kristi konnte sich nicht erinnern, dass die Mannschaft solche Kleidung getragen hatte.
Der Mann wandte sich zu ihnen um, und sie erkannte, dass er eine Maschinenpistole in der Hand hatte.
Zischend atmete sie aus. Und rein instinktiv stieß Talan sie zu Boden, als Maschinenpistolenfeuer erklang. Sie musste hilflos zusehen, wie seine Brust von Kugeln durchlöchert wurde. Er kippte nach hinten über die Reling und stürzte ins Meer.
Kristi warf sich zur Tür herum und zog daran, doch ehe sie sie öffnen konnte, hatte sie der Mann, der aus dem Qualm aufgetaucht war, erreicht. Er schloss die Tür mit dem kraftvollen Tritt eines Fußes, der mit einem schweren Stiefel bewehrt ist.
»Nein, das darfst du nicht, Schätzchen«, sagte er knurrend. »Du kommst mit mir.«
Kristin versuchte sich von ihm wegzuschlängeln, doch er streckte eine Pranke aus, packte sie am Kragen und hievte sie auf die Füße.
Kurt Austin stand auf der Brückennock der Argo, während sie durchs Wasser pflügte. Mit 30 Knoten schob der Bug aus dem Ozean zwei hohe Wellen schäumender Gischt in den Wind. Wasserwände breiteten sich aus, fielen herab und bedeckten die Fluten mit einem Schaumteppich, der schnell zurückblieb.
Austin studierte den angeschlagenen Frachter durchs Fernglas. Er hatte Männer gesehen, die von Luke zu Luke gingen und Granaten oder andere Sprengmittel hineinwarfen.
»Das ist verdammt seltsam«, sagte Austin. »Es sieht so aus, als wollten sie das Schiff absichtlich versenken.«
»Bei Piraten weiß man nie, woran man ist«, sagte Kapitän Haynes.
»Das ist richtig«, stimmte Austin zu, »aber meistens haben sie es doch auf Geld abgesehen. Auf Lösegeld oder die Möglichkeit, die gekaperte Ware auf dem schwarzen Markt zu verkaufen. Doch das schafft man wohl kaum, wenn man das Schiff auf den Meeresgrund schickt.«
»Das ist nicht ganz falsch«, räumte Kapitän Haynes ein. »Vielleicht nehmen sie nur die Mannschaft gefangen.«
Kurt Austin nahm das Schiff wieder unter die Lupe. Die Mannschaftsquartiere befanden sich an dessen Heck. Der Aufbau – den einige Seeleute als »Kastell« bezeichneten – stand mit seinen fünf Stockwerken wie ein Apartmenthaus auf dem Deck.
Mit seiner Höhe bot er einen stolzen Anblick, doch das flache Vorschiff ragte nur noch knapp aus dem Wasser, und die Bugspitze war höchstens dreißig Zentimeter davon entfernt, überspült zu werden. Viel mehr konnte er durch das Feuer und den Rauch nicht erkennen.
»Ich habe gesehen, wie sie zumindest einen armen Teufel erschossen haben«, sagte er. »Vielleicht hatten sie einen wichtigen Passagier an Bord, und die restlichen Leute waren entbehrlich. So oder so bezweifle ich, dass sie kapitulieren.«
»Wir haben drei Boote einsatzbereit«, meinte Haynes zu ihm. »Das schnelle Boot und unsere beiden Beiboote. Wollen Sie mitkommen?«
Kurt Austin ließ das Fernglas sinken. »Sie haben doch wohl nicht angenommen, dass ich hier herumstehen und untätig zuschauen würde.«
»Dann gehen Sie runter in die Waffenkammer«, sagte der Kapitän. »Sie sind gerade dabei, eine Entermannschaft auszurüsten.«
An Bord der Kinjara Maru zerrte der massige Anführer der »Piraten«-Bande Kristi Nordegrun über das Oberdeck. Man kannte ihn unter dem Namen Andras, aber seine Männer nannten ihn manchmal »The Knife«, weil geschärfte Klingen seine Lieblingswaffen waren.
»Warum tun Sie das?«, fragte sie. »Wo ist mein Mann?«
»Ihr Mann?«, sagte er.
»Er ist der Kapitän des Schiffes.«
Andras schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Schätzchen, du kannst dich wieder als Single betrachten.«
Nach diesen Worten stürzte sie sich auf ihn und schlug ihm mit den Händen ins Gesicht. Sie hätte ebenso gut eine Steinmauer attackieren können. Er schüttelte den Schlag ab, warf sie aufs Deck und zückte eines seiner Lieblingsspielzeuge: ein Springmesser mit einer dreizehn Zentimeter langen Titanklinge. Er ließ die Klinge einrasten und richtete die Spitze auf seine Gefangene.
Sie wich zurück.
»Wenn du mich ärgerst, machst du damit Bekanntschaft«, sagte er. »Verstanden?«
Langsam nickte sie. In ihren Augen flackerte die nackte Angst.
In Wahrheit hatte Andras nicht die Absicht, sie mit dem Messer zu verletzen, denn unversehrt brächte sie ihm einen höheren Gewinn ein, aber das brauchte sie nicht unbedingt zu wissen.





























