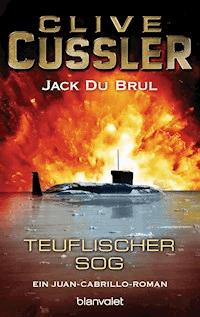
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Juan-Cabrillo-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Ein amerikanischer Satellit mit waffenfähigem Plutonium stürzt mitten in den argentinischen Dschungel ab. Juan Cabrillo und das Team der Oregon werden mit höchster Priorität beauftragt, ihn sicherzustellen. Auch ein argentinischer General setzt alles daran, den Satelliten in seine Finger zu kriegen. Doch als Cabrillo und sein Team das Plutonium endlich bergen können, erkennen sie, dass die Verschwörung noch viel weiter reicht. Denn der Satellit wurde abgeschossen – von einem Waffensystem, wie es nur die Chinesen besitzen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
& Jack Du Brul
Teuflischer Sog
Roman
Aus dem Englischen von Michael Kubiak
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Silent Sea« bei Putnam, New York.
1. Auflage
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © 2010 by Sandecker, RLLLP
All rights reserved by the Proprietor throughout the world
By arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176-0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Redaktion: Jörn Rauser
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-15202-4
www.blanvalet.de
The fair breeze blew, the white foam flew,The furrow followed free;We were the first that ever burstInto that SILENT SEA.
– The Rime of the Ancient Mariner,SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Der Wind bläst gut, weiß schäumt die FlutWir furchen rasch die WogenWir waren sicher die ersten Schiffer,die diese See durchzogen.
– Der alte MatroseSAMUEL TAYLOR COLERIDGE
7. Dezember 1941Pine IslandWashington State
Ein goldener Schatten sprang über das Dollbord des kleinen Bootes, als dessen Bug auf dem steinigen Strand aufsetzte. Der Golden Retriever platschte ins Wasser und pflügte durch die Wellen, wobei er seinen Schweif wie eine Siegesfahne hochreckte. Als er dann wieder auf trockenem Boden stand, schüttelte er sich, so dass die Wassertropfen aus seinem Fell flogen: wie Diamantsplitter durch die kühle, frische Luft. Dann blickte er zum Boot zurück. Der Hund bellte ein Seemöwenpaar an, das in einiger Entfernung auf dem Strand spazieren ging. Erschrocken ergriffen die Vögel die Flucht. Da ihre Gefährten viel zu langsam folgten, rannte die Rassehündin zu einer Baumgruppe in der Nähe. Ihr Gebell wurde immer leiser, bis es von dem Wald völlig verschluckt wurde, der den größten Teil der etwa zweieinhalb Quadratkilometer großen Insel bedeckte, die ungefähr eine Ruderstunde vor dem Festland lag.
»Amelia«, rief Jimmy Ronish, der jüngste der fünf Brüder im Boot, den Hund.
»Ihr wird schon nichts passieren«, sagte Nick, zog die Ruder ein und nahm die Bootsleine in die Hand. Er war der älteste der Ronish-Jungen.
Vollendet koordinierte er seinen Sprung mit der Brandung und landete auf dem kiesbedeckten Strand, als sich eine Welle zurückzog. Drei lange Schritte später befand er sich oberhalb der Flutlinie aus Strandgut und teilweise getrocknetem Seetang und schlang die Leine um einen Balken Treibholz, der von der Sonne und dem Salzwasser gebleicht und mit zahllosen eingeschnitzten Initialen schraffiert war. Kräftig zerrte er an der Leine, um das vierzehn Fuß lange Boot auf festen Boden zu hieven. Dann band er es fest.
»Beeilt euch«, ermahnte Nick Ronish seine jüngeren Brüder. »In fünf Stunden ist Ebbetiefststand, und wir haben noch eine Menge zu tun.«
Während die Lufttemperatur um diese späte Jahreszeit noch einigermaßen angenehm war, hatte sich der Nordpazifik bereits empfindlich abgekühlt und zwang sie, ihre Ausrüstung im Rhythmus der vom Strand ablaufenden Wellen zu entladen. Eines der schwersten Ausrüstungsteile war ein einhundert Meter langes Hanfseil, das sich Ron und Don, die Zwillinge, gemeinsam auf die Schultern laden mussten, um es bis zum Strand zu schaffen. Jimmy war für den Rucksack mit ihrer Verpflegung zuständig, und da er erst neun Jahre alt war, hatte seine schmächtige Gestalt an dieser Last schwer zu tragen.
Die vier älteren Jungen – Nick, neunzehn Jahre alt, Ron und Don ein Jahr jünger, und Kevin, nur elf Monate nach ihnen geboren – hätten mit ihren schlaffen, flachsblonden Haaren und ihren blassblauen Augen auch Vierlinge sein können. Obwohl sie bereits an der Schwelle zum Mannesalter standen, hatten sie sich die überschäumende Energie ihrer Jugend erhalten. Jimmy hingegen wirkte für sein Alter eher klein, mit dunklem Haar und braunen Augen. Seine Brüder hänselten ihn, indem sie meinten, er sehe wie Mr. Greenfield aus, der Gemüsehändler des Städtchens. Und auch wenn Jimmy nicht genau wusste, was das bedeutete, wusste er doch sofort, dass es ihm nicht gefiel. Er vergötterte seine älteren Brüder und hasste alles, was ihn von ihnen unterschied.
Ihre Familie besaß die kleine Insel vor der Küste – und das schon so lange, wie die Erinnerung ihres Großvaters zurückreichte. Es war ein Ort, an dem jede Generation Jungen – denn seit 1862 hatte die Familie Ronish keinen weiblichen Nachwuchs mehr hervorgebracht – mit Abenteuern ausgefüllte Sommerferien verlebt hatte. Es fiel ihnen leicht, sich vorzustellen, sie wären allesamt Huck Finns und auf dem Mississippi gestrandet – oder Tom Sawyers und damit beschäftigt, das weitläufige Höhlensystem der Insel zu erforschen. Außerdem ging von Pine Island allein schon wegen des Schachts eine ganz besondere Faszination aus.
Mütter hatten ihren Jungen stets verboten, in der Nähe des Schachts zu spielen, seit Abe Ronish, Großonkel des gegenwärtigen Ronish-Nachwuchses, im Jahr 1887 hineingestürzt war und dabei den Tod gefunden hatte. Das Verbot wurde selbstverständlich ignoriert, sobald es ausgesprochen worden war.
Seine eigentliche Anziehungskraft verdankte die Insel aber einer örtlichen Legende, die zu berichten wusste, dass ein gewisser Pierre Devereaux, einer der erfolgreichsten Kaperer, die jemals die Karibik unsicher gemacht hatten, einen Teil seiner Beute auf dieser hoch im Norden liegenden Insel versteckt haben sollte. Und zwar allein aus dem Grund, sein Schiff während einer hartnäckigen Verfolgung durch ein Fregattengeschwader, das ihn um Kap Horn herum und an der süd- und nordamerikanischen Küste entlangjagte, leichter zu machen. Untermauert wurde die Legende durch die Entdeckung einer kleinen Pyramide von Kanonenkugeln in einer der Höhlen der Insel – und außerdem durch die Tatsache, dass der quadratische Schacht mit roh behauenen Holzbalken abgestützt wurde.
Die Kanonenkugeln waren zwar längst verschwunden und wurden mittlerweile als Mythos betrachtet, doch die Existenz der Balkenverschalung rund um das rätselhafte Loch in der steinigen Erde war ja nicht zu leugnen.
»Meine Schuhe sind nass geworden«, beklagte sich Jimmy.
Ungehalten fuhr Nick zu seinem jüngsten Bruder herum und schimpfte: »Verdammt noch mal, Jimmy, ich hab dir doch gesagt, wenn ich dich nur einmal meckern höre, bleibst du beim Boot.«
»Ich hab ja gar nicht gemeckert«, erwiderte der Junge und bemühte sich, nicht wehleidig zu klingen. »Ich hab es doch nur gesagt.« Er schüttelte ein paar Wassertropfen von seinem nassen Fuß, um zu zeigen, dass es ihm nichts ausmachte. Drohend musterte ihn Nick mit eisigem Blick und konzentrierte sich wieder auf ihr Vorhaben.
Pine Island hatte die Umrisse eines Valentinstag-Herzens, das aus dem eisigen Pazifik aufgestiegen war. Der einzige Strandabschnitt befand sich dort, wo sich die beiden oberen Wölbungen trafen. Die restliche Insel war mit Klippen umgürtet, die so uneinnehmbar wie Burgmauern erschienen, oder sie wurde von unter Wasser liegenden Felsen geschützt, die wie Perlen auf einer Schnur aussahen und den Boden auch des stabilsten Bootes aufschlitzen konnten. Nur eine Handvoll Tiere war auf der Insel heimisch, vorwiegend Eichhörnchen und Mäuse, die von Stürmen auf das Eiland verschlagen worden waren, sowie Seevögel, die sich auf den hochgewachsenen Kiefern ausruhten und in den Wellen nach Beute Ausschau hielten.
Eine einzige Straße teilte die Insel. Sie war vor zwanzig Jahren von einer anderen Generation Ronish-Männer mühsam aus dem Wald gehackt worden. Mit benzingetriebenen Pumpen bewaffnet, waren sie der Insel zu Leibe gerückt, um den Schacht trockenzulegen. Allerdings hatten sie schließlich feststellen müssen, dass ihnen kein Erfolg beschieden war. Ganz gleich wie viele Pumpen sie auch betrieben oder wie viel Wasser sie aus der Tiefe zutage förderten, der Schacht lief immer wieder voll. Eine gründliche Suche nach dem unterirdischen Gang, der ihn mit dem Meer verband, führte zu keinem Ergebnis. Man überlegte, in der Nähe des Schachtes einen Kofferdamm um die Öffnung der Bucht aufzuschütten, da man glaubte, dass es logischerweise keinen anderen Zufluss geben konnte. Doch die Männer entschieden, dass sich ein solcher Aufwand nicht lohne.
Nun waren Nick und seine Brüder an der Reihe. Und jener hatte etwas herausgefunden, auf das seine Onkel und sein Vater bislang nicht gekommen waren. Als nämlich Pierre Devereaux den Schacht damals ausgehoben hatte, um dort seinen Schatz zu verstecken, dürfte ihm als einzige Pumpe die von Hand zu bedienende Bilgenpumpe seines Schiffes zur Verfügung gestanden haben. Auf Grund ihrer geringen Leistung hatten die Piraten den Schacht mit ihrer Ausrüstung aber niemals trockenlegen können, wenn nicht einmal drei Zehn-PS-Pumpen es geschafft hatten.
Eine Erklärung für die besonderen Verhältnisse in dem Schacht musste also woanders zu finden sein.
Nick wusste von den Geschichten, die seine Onkel erzählten, dass sie ihren Versuch, in den Schacht vorzudringen, im Hochsommer unternommen hatten. Als er einen alten Almanach zu Rate zog, sah er, dass sich die Männer für ihr Unterfangen eine Periode mit besonders hohem Ebbestand ausgesucht hatten. Er wusste jedoch, dass er und seine Brüder – um einige Aussicht auf Erfolg zu haben – ihren Versuch, den Grund des Schachtes zu erreichen, zu dem gleichen Zeitpunkt im Jahr starten müssten, an dem Devereaux den Schacht gegraben hatte: und zwar wenn die Ebbephasen den niedrigsten Stand hatten. Das würde in diesem Jahr am siebten Dezember um kurz nach zwei Uhr der Fall sein.
Die älteren Brüder hatten ihr Projekt, das Geheimnis des Schachtes zu lüften, bereits seit dem Frühsommer geplant. Indem sie alle möglichen Jobs annahmen, hatten sie genug Geld zusammengekratzt, um eine geeignete Ausrüstung zu kaufen, und zwar als Erstes eine mit Benzin betriebene Zweiwegpumpe, dann das Seil und Grubenhelme mit Batterielampen. Sie hatten mit dem Seil und einem gefüllten Eimer so lange trainiert, bis ihre Arme und Schultern in der Lage gewesen waren, ohne zu ermüden stundenlang arbeiten zu können. Und sie hatten sich sogar Brillen gebastelt, mit denen sie unter Wasser sehen konnten, falls es nötig sein sollte.
Jimmy war eigentlich nur deshalb mitgenommen worden, weil er sie darüber reden gehört und ihnen gedroht hatte, alles ihren Eltern zu erzählen, falls sie ihn nicht mitmachen ließen.
Plötzlich entstand rechts von ihnen ein Tumult. Ein ganzer Schwarm Vögel schwang sich explosionsartig mit heftigem Flattern und lautem Gezwitscher in den blauen Himmel. Amelia, ihre Golden-Retriever-Hündin, kam zwischen den Bäumen hervorgestürmt, bellte heftig und ließ ihren Schweif wie den Taktstock des Teufels hin und her schwingen. Sie jagte hinter einer Möwe her, die dicht über dem Boden dahinflatterte, und blieb dann verwundert stehen, als der Vogel in die Luft schoss. Ihre Zunge hing aus der Schnauze, und Geifer troff von ihrem dunklen Zahnfleisch herab.
»Amelia! Komm!«, rief Jimmy mit seiner hohen Stimme. Die Hündin rannte an seine Seite und warf ihn in ihrer Ausgelassenheit beinahe um.
»Krabbe, nimm das«, sagte Nick und reichte Jimmy die Grubenhelme und ihre Behälter mit schweren Bleibatterien.
Die Pumpe war der schwerste Ausrüstungsgegenstand. Nick hatte eine Schlinge mit zwei Tragbalken konstruiert, wie er es in den sonntäglichen Matineevorstellungen im Kino gesehen hatte, wenn Eingeborene den Filmhelden in ihr Lager schleppten. Die Tragbalken hatten sie sich von einer Baustelle geholt. Nun legten die vier Jungen sie sich auf die Schultern und hievten die Maschine aus dem Ruderboot heraus. Erst schwang sie hin und her, dann kam sie zur Ruhe. Und nun machten sie sich auf den ersten Marsch über die Insel: Der würde knapp anderthalb Kilometer lang sein.
Sie brauchten eine Dreiviertelstunde, um ihre gesamte Ausrüstung über die Insel zu schaffen. Der Schacht befand sich auf einem Felsvorsprung über einer seichten Bucht, die – aus der Luft betrachtet – den einzigen Makel darstellte, der die ansonsten vollendete Herzform der Insel störte. Die Wellen rollten schäumend gegen die Küste, doch bei dem ruhigen, schönen Wetter schaffte es nur gelegentlich eine Gischtflocke, die steilen Felsen zu überwinden und in der Nähe des Schachtes zu landen.
»Kevin«, sagte Nick, nach ihrem zweiten Marsch zum Boot und wieder zurück auf die Klippe ein wenig außer Atem, »geh mit Jimmy Holz holen – für ein Feuer. Und möglichst kein Treibholz, denn das verbrennt zu schnell.«
Ehe sein Auftrag ausgeführt werden konnte, lockte ihre natürliche Neugier alle fünf Ronish-Brüder für einen kurzen Blick näher an den Schacht heran.
Der vertikale Schacht hatte eine Seitenlänge von etwa zwei Metern und war absolut quadratisch. So tief ihre Augen reichten, war er mit Holzbalken ausgeschlagen, die vom Alter gedunkelt waren – es war Eichenholz, das auf dem Festland zurechtgeschnitten und auf die Insel transportiert worden sein musste. Kalte, feuchte Luft stieg aus der Tiefe auf und ließ ihnen eine Art unheimlicher Liebkosung zuteilwerden, die ihre Begeisterung für einen kurzen Augenblick dämpfte. Fast war es so, als machte der Schacht mühsame, geräuschvolle Atemzüge, und man brauchte nicht allzu viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass sie von den Geistern der Männer herrührten, die bei dem Versuch umgekommen waren, dem Schoß der Erde seine Geheimnisse zu entreißen.
Ein verrostetes Eisengitter war über die Schachtöffnung gedeckt worden, damit niemand hineinstürzte. Es war mit Ketten verankert, die an eisernen Bolzen befestigt waren, die man in den Fels gebohrt hatte. Sie hatten den Schlüssel zu dem Vorhängeschloss in der Schreibtischschublade ihres Vaters gefunden, unter der Mauser, die in ihrem Futteral lag. Er hatte diese Waffe während des Ersten Weltkriegs erbeutet. Einen kurzen Moment lang fürchtete Nick, der Schlüssel würde im Schloss abbrechen, doch schließlich drehte er sich, und der Bügel klappte mit einem Klicken auf.
»Na los, holt endlich das Feuerholz«, befahl er, und seine jüngsten Brüder rannten mit einer heiser kläffenden Amelia davon.
Mit Hilfe der Zwillinge hob Nick das schwere Gitter von der Schachtöffnung herunter und stellte es beiseite. Als Nächstes musste ein Holzgerüst über dem Schacht errichtet werden, so dass das Seil von einem Flaschenzugsystem herab und direkt in das Loch hineinhing. Dann konnten zwei Jungen einen dritten leicht daran herunterlassen und wieder heraufziehen. Dazu verwendeten die Jungen die Tragebalken sowie einige Eisenstifte, die in vorgebohrte Löcher passten. Die unteren Enden der Balken wurden direkt in die Eichenbalken genagelt, die den Schacht im oberen Teil abstützten. Trotz seines Alters war das Holz immer noch hart genug, um für einige verbogene Nägel zu sorgen.
Nick übernahm die wichtige Aufgabe, die Knoten zu binden, die buchstäblich über Leben und Tod entschieden, während Don, der mechanisch versierteste der Jungen, so lange an der Pumpe hantierte, bis sie gleichmäßig brummend lief.
Als alles einsatzbereit war, hatten Kevin und Jim zehn Meter vom Schacht entfernt ein Feuer angezündet und genügend Holz zusammengetragen, um es zwei Stunden lang in Gang zu halten. Sie versammelten sich darum, verzehrten die Sandwiches, die sie vor ihrem Aufbruch eingepackt hatten, und tranken dazu aus Feldflaschen ihren gesüßten Eistee.
»Der Trick besteht darin, die Ebbe genau abzupassen«, sagte Nick mit einem Mund voller Fleischwurstsandwich. »Zehn Minuten vor und nach ihrem niedrigsten Stand – das ist alles, was wir an Zeit zur Verfügung haben, ehe der Schacht wieder schneller vollläuft, als unsere Pumpe ihn leeren kann. Als sie es damals, 1921, versuchten, konnten sie den Wasserspiegel nur bis auf sechzig Meter runterdrücken. Aber sie wussten auf Grund ihrer Messungen, dass sich der Schachtgrund in etwa achtzig Metern Tiefe befand. Da wir uns auf einem Felsvorsprung befinden, vermute ich, dass sich die Sohle des Schachtes etwa fünf Meter unter der tiefsten Ebbemarke befindet. Wir sollten es also eigentlich schaffen, den Wasserzufluss zu finden und zu verschließen. Die restliche Arbeit kann man dann der Pumpe überlassen.«
»Ich wette, da unten steht eine riesige Kiste voll mit Gold«, sagte Jimmy mit großen Augen, als sähe er sie schon vor sich.
»Vergiss nicht«, erwiderte Don, »dass der Schacht sicherlich an die einhundertmal mit Greifhaken abgesucht wurde und niemals irgendjemand etwas heraufgezogen hat.«
»Dann sind es eben lose Golddublonen«, beharrte Jimmy, »in Säcken, die längst verfault sind.«
Nick stand auf und wischte sich ein paar Brotkrümel aus dem Schoß. »In einer halben Stunde wissen wir es genau.«
Er zog sich Gummistiefel an, die bis zu den Oberschenkeln reichten, und hängte sich die Batterietasche für seinen Grubenhelm über die Schulter, bevor er in eine Öljacke schlüpfte und den Elektrodraht am Kragen herauszog. Dann schwang er sich den zweiten Gerätesack über die Schulter.
Ron ließ einen Korkschwimmer an einer Schnur hinab, die alle drei Meter mit einer Markierung versehen war. »Sechzig Meter«, verkündete er, als die Schnur schlaff wurde.
Nick schlängelte sich in ein Gurtgeschirr und befestigte es an der Schlinge am Ende ihres dicken Seils. »Lasst den Pumpenschlauch herab, aber schaltet die Pumpe noch nicht ein. Ich geh runter.«
Ruckartig zog er an dem Seil, um die Flaschenzugbremse zu testen. Sie stoppte sofort. »Okay, Leute, wir haben das den ganzen Sommer lang trainiert. Kein Herumalbern mehr, ja?«
»Wir sind bereit«, meldete Ron Ronish. Sein Zwillingsbruder nickte bestätigend.
»Jimmy, ich will, dass du einen Abstand von mindestens drei Metern zum Schacht einhältst. Ist das klar? Wenn ich erst mal unten bin, gibt es ohnehin nichts mehr zu sehen.«
»Ich komme ganz bestimmt nicht näher ran. Versprochen.«
Nick wusste, wie wenig man sich auf das Wort seines jüngsten Bruders verlassen konnte, so dass Kevin, als er ihm einen vielsagenden Blick schickte, den Daumen nach oben stieß. Er würde dafür sorgen, dass Jimmy ihnen nicht ins Gehege käme.
»Fünfundsechzig Meter«, sagte Ron, nachdem er wieder nach seinem Schwimmer geschaut hatte.
Nick grinste. »Wir sind bereits am tiefsten Punkt, der bisher erreicht wurde, und brauchten keinen Finger krumm zu machen.« Er tippte gegen seine Schläfe. »Man muss nur ein wenig nachdenken.«
Ohne einen weiteren Kommentar verließ er den Rand des Schachts und baumelte jetzt über seiner Öffnung. Sein Körper drehte sich, als das leicht verwickelte Seil belastet wurde und sich gerade zog. Schließlich kam Nicks Körper zur Ruhe. Falls er so etwas wie Angst hatte, so war dies seiner Miene nicht anzusehen. Dafür wirkte sie ganz starr vor Konzentration. Er nickte den Zwillingen zu, und sie zogen ein wenig an der Leine, um die Bremse zu lösen, und ließen dann ein Stück Seil über die Rollen des Flaschenzugs gleiten. Nick sank ein paar Zentimeter ab.
»Okay, noch einen Test.«
Die Jungen zogen wieder, während die Bremse griff und hielt.
»Und jetzt zieht«, befahl Nick, und seine Brüder hievten ihn mühelos die gleiche Anzahl Zentimeter wieder hoch.
»Kein Problem, Nick«, meinte Don. »Ich hab dir doch gesagt, dass dieses Ding idiotensicher ist. Verdammt, ich wette, sogar Jimmy könnte dich von unten heraufziehen.«
»Vielen Dank, darauf verzichte ich gerne.« Nick machte zwei tiefe Atemzüge und sagte: »Na schön. Diesmal richtig.«
Mit gleichmäßigen, kontrollierten Bewegungen erlaubten die Zwillinge der Schwerkraft, Nick langsam in die Tiefe zu ziehen. Er rief ihnen zu anzuhalten, als er etwa drei Meter tief in den Schacht eingetaucht war. Bei dieser Entfernung voneinander konnten sie sich noch durch Worte verständigen. Für später aber, wenn Nick sich dann der Schachtsohle näherte, hatten sie eine Reihe spezieller Zugsignale an der Schwimmerschnur vereinbart.
»Was ist los?«, rief Don nach unten.
»Hier sind Initialen in die Eichenbalken eingeschnitzt. ALR.«
»Sicherlich Onkel Albert«, sagte Don. »Ich glaube, sein zweiter Vorname ist Lewis.«
»Daneben ist Dads JGR und dann noch TMD.«
»Das wird wohl Mr. Davis sein. Er hatte ihnen doch geholfen, als sie versuchten, bis auf den Grund vorzustoßen.«
»Okay, dann lasst mich weiter runter.«
Bei etwa fünfzehn Metern, wo die Holzverschalung aufhörte und nacktem Fels Platz machte, schaltete Nick seine Helmlampe ein. Das Gestein sah völlig natürlich aus. Als wäre der Schacht vor Millionen von Jahren gleichzeitig mit der Insel entstanden. Außerdem war er feucht genug, so dass schleimiger grüner Schimmel darauf gedeihen konnte, obgleich sich dieser Bereich noch weit über der Flutlinie befand. Er richtete den Lichtstrahl an seinen herabhängenden Beinen vorbei in die Tiefe. Nach wenigen Metern wurde er unter seinen Füßen vom Abgrund verschluckt. Ein ständiger Luftzug wehte an Nicks Gesicht vorbei, und er musste unwillkürlich frösteln.
Es ging weiter abwärts, immer tiefer in die Erde hinein, mit keinem anderen Halt als einem Seil und dem Vertrauen zu seinen Brüdern. Als er einmal hochblickte, war der Himmel nur noch ein kleiner quadratischer Fleck über ihm. Die Schachtwände rückten zwar nicht auf ihn zu, aber er konnte doch ihre Nähe spüren. Er versuchte, nicht daran zu denken. Plötzlich gewahrte er unter sich einen Reflex, und während er tiefer sank, erkannte er, dass er die Flutmarke erreicht hatte. Das Gestein war immer noch feucht. Nach seiner Schätzung befand er sich ungefähr fünfzig bis fünfundfünfzig Meter unter der Erdoberfläche. Es gab noch immer keine Anzeichen dafür, dass Wasser aus dem Ozean bis in den Schacht gelangen konnte. Aber er rechnete auch nicht damit, etwas Derartiges zu sehen, ehe er die Siebzig-Meter-Marke erreicht hätte.
Drei Meter tiefer glaubte er, etwas hören zu können – ein unendlich leises Plätschern von Wasser. Zweimal zog er an der Schwimmerschnur, um seinen Brüdern mitzuteilen, sie sollten seinen Abstieg verlangsamen. Sie reagierten sofort, und seine Sinkgeschwindigkeit halbierte sich. Das Geräusch von Wasser, das in den Schacht einströmte, wurde lauter. Nick starrte in die Dunkelheit und versuchte, etwas zu erkennen, während Wasser von den Schachtwänden tropfte und wie Regen auf seinen Helm pladderte. Gelegentlich traf ihn ein Tropfen wie eine Eisnadel im Nacken.
Da!
Er wartete noch einige Sekunden, um einen weiteren halben Meter abzusinken, erst dann zog er ruckartig an der Schnur.
Er hing frei vor einem etwa postkartengroßen Spalt im soliden Fels. Er konnte nicht abschätzen, wie viel Wasser durch die Öffnung hereinströmte – gewiss nicht genug, um alle Pumpen, die sein Vater und seine Onkel damals hierhergebracht hatten, zur Wirkungslosigkeit zu verdammen – daher entschied er, dass mindestens eine weitere Verbindung mit dem Pazifik existieren musste. Vorsichtig holte er eine Handvoll Werg aus seiner Gerätetasche, stopfte es so tief es ging in den Spalt und hielt es in der eisigen Strömung an Ort und Stelle fest. Als das Meerwasser die Wergfasern benetzte, begannen sie aufzuquellen, bis der Wasserstrom zu einem Rinnsal schrumpfte und schließlich ganz versiegte.
Der Wergpfropfen würde nicht lange halten, wenn die Flut wieder einsetzte, deshalb blieb ihm äußerst wenig Zeit, wenn er erst einmal auf dem Grund des Schachtes angelangt war.
Nick zog wieder an der Schnur, und sein Abstieg ging weiter, vorbei an vereinzelten Muschelkolonien, die am Fels klebten. Ein fauliger Geruch lag in der Luft. Er verstopfte zwei weitere, etwa genauso große Risse im Gestein, und als der dritte verschlossen war, konnte er kein Wasser mehr in den Schacht eindringen hören. Er zog viermal an der Schnur, und einen Augenblick später blähte sich der schlaffe Schlauch, der an der Pumpe hing, auf, als er anfing, den Schacht leerzusaugen.
Sekunden später erschien auch schon die Wasseroberfläche unter ihm. Er gab mit der Schnur ein Zeichen, seinen Abstieg zu stoppen, und holte sein eigenes Senkblei aus der Tasche seiner Öljacke. Er ließ es ins Wasser hinunter und brummte zufrieden, als er sah, dass das Wasser im Schacht nur noch etwa fünf Meter hoch stand. Da der Schacht in dieser Tiefe gut einen halben Meter enger war, schätzte er, dass ihn die Pumpe innerhalb von zehn Minuten bis auf einen Meter Wasserhöhe geleert haben dürfte.
Er konnte die Wasseroberfläche unter sich sinken sehen, indem er sich am Auftauchen von Unregelmäßigkeiten in der Schachtwand orientierte, und erkannte, dass er sich verschätzt hatte. Die Pumpe arbeitete viel schneller, als er …
Etwas auf seiner linken Seite fiel ihm ins Auge. Während der Wasserspiegel sank, tauchte dort eine Nische auf. Sie schien gut einen halben Meter tief und genauso breit zu sein, und er konnte auf Anhieb erkennen, dass sie nicht natürlichen Ursprungs war. Er sah, wo sich Hämmer und Meißel ins brüchige Gestein gegraben hatten. Sein Herz klopfte bis zum Hals. Hier war ein weiterer eindeutiger Beweis, dass sich jemand in dem Schacht zu schaffen gemacht hatte. Es war allerdings keinesfalls ein Beweis dafür, dass dies auch das Versteck von Pierre Devereaux’ Schatz war, aber für den Neunzehnjährigen lag dies eigentlich klar auf der Hand.
Mittlerweile war auch genügend Wasser aus dem Schacht herausgepumpt worden, so dass Nick den Abfall sehen konnte, der einen Weg bis auf den Grund des Schachtes gefunden hatte. Es war vorwiegend Treibholz, das durch die unterirdischen Kanäle in den Schacht gesogen worden war, wie auch kleine Äste und Zweige, die durch das Gitter gefallen sein mochten. Es waren aber auch einige Balken darunter, die offenbar in den Schacht gelangt waren, ehe man das Gitter darübergedeckt hatte. Er konnte sich vorstellen, wie sein Vater und seine Onkel einige davon einfach hineingeworfen hatten, wohl aus Enttäuschung darüber, das Geheimnis nicht gelöst zu haben.
Die Pumpe an der Erdoberfläche verrichtete weiter ihre Arbeit und hatte keine Schwierigkeiten, die Rinnsale, die durch seine Wergpfropfen sickerten, in Schach zu halten. Neben ihm wurde die künstlich geschaffene Nische ständig größer. Einer Intuition folgend ließ er sich von seinen Brüdern noch ein Stück weiter hinab und verlagerte sein Gewicht, um am Ende des Seils eine Pendelbewegung zu starten. Als er weit genug ausschwang und sich der Nische näherte, streckte er ein Bein aus und tastete mit dem Fuß herum. Sein Schuh fand unter ein paar Zentimetern Wasser festen Halt. Er ließ sich zurückschwingen, warf sich dann in die Öffnung und landete sicher auf beiden Füßen. Er gab seinen Brüdern ein Zeichen, das Seil still zu halten, und löste es von seinem Gurtgeschirr.
Nick Ronish stand nicht mehr als einen knappen Meter über der Sohle der Schatzgrube. Er konnte fast spüren, dass die Beute zum Greifen nahe war.
Das letzte Hindernis waren die Holztrümmer, die den Boden des Schachtes in einem unentwirrbaren Durcheinander bedeckten. Sie müssten erst noch einiges davon wegräumen, um den Boden darunter nach Goldmünzen absuchen zu können. Er wusste, dass die Arbeit schneller vonstattengehen würde, wenn sie zu zweit hier unten wären. Daher band er ein paar Äste an das Seil und signalisierte seinen Brüdern, sie sollten es zuerst hochziehen und dann einen von ihnen daran in den Schacht herablassen. Kevin und der andere Zwilling könnten den Flaschenzug bedienen, und – falls es nötig sein sollte – könnte Jimmy ihnen sicherlich helfen.
Er lachte verhalten, als das triefnasse Holzbündel über seinem Kopf in der Dunkelheit verschwand. Wahrscheinlich könnten sie das Seil an Amelias Halsband befestigen und den verrückten Hund das Holz heraufziehen lassen.
Er blieb in der Nische und drückte sich mit dem Rücken gegen den Fels – für den Fall, dass einer der Äste aus der Seilschlinge herausrutschte. Nach einer Fallhöhe von mehr als sechzig Metern würde es sicher schon ausreichen, dass er nur gestreift wurde, um in ernste Schwierigkeiten zu kommen.
Drei Minuten später machte sich ein freudig erregter Don keine zehn Meter über Nicks Kopf mit der Frage bemerkbar: »Schon was gefunden?«
»Allen möglichen Abfall«, antwortete Nick. »Wir müssen einiges davon beiseiteschaffen. Aber sieh mal, wo ich stehe. Das da wurde in den Fels geschlagen.«
»Von Piraten?«
»Von wem sonst?«
»Verdammt! Wir werden steinreich.«
Da sie wussten, dass der Gezeitenwechsel schon in Kürze einsetzen würde, arbeiteten die beiden Jungen wie die Wilden und rissen das Gewirr von miteinander verhakten Ästen auseinander. Nick nahm sein Klettergeschirr ab und benutzte es, um mindestens zweihundert Pfund mit Wasser getränkte Äste und Balken zusammenzubinden. Er und Don warteten in der Nische darauf, dass das Seil wieder heruntergelassen wurde. Ron und Ken arbeiteten ebenfalls wie besessen. Innerhalb von nur vier Minuten öffneten sie das Geschirr, wuchteten das Holzbündel zur Seite und schickten das Seil wieder in die Tiefe.
Nick und Don wiederholten den Vorgang noch zweimal. Es war gleichgültig, ob sie genügend Abfall entfernt hatten. Die Zeit wurde knapp. Sie ließen das Seil auf einem Baumstumpf, der aus dem Wasser ragte, liegen und sprangen aus der Nische auf den Holzhaufen hinunter. Das Holz gab unter ihrem Gewicht schaukelnd nach. Nick streckte sich auf einem besonders dicken Balken aus, griff mit einer Hand ins eisige Wasser und berührte glatten Stein. Es war der Boden des Schachtes.
Im Gegensatz zu seinen Brüdern hatte er den Geschichten von dem Piratenschatz, der in dem Schacht versteckt sein sollte, nicht so richtig geglaubt. Jedenfalls bis er die künstlich geschaffene Felsnische gesehen hatte. Nun war er sich nicht mehr sicher, was er glauben sollte. Als er das Unternehmen begonnen hatte, hätte es ihm völlig gereicht, bis auf den Grund des Schachtes vorzudringen und sich gegenüber den Generationen von Vorfahren, die es ebenso versucht, es jedoch nicht geschafft hatten, als geschickter zu beweisen. Aber jetzt?
Er streckte den Arm aus, beschrieb einen weiteren Bogen und versuchte, in dem weichen Morast irgendetwas zu ertasten. In seiner Nähe tat Don das Gleiche. Bis zur Schulter war sein Arm zwischen einigen Ästen vergraben. Er presste die Lippen vor Konzentration zusammen, so dass sie einen dünnen Strich bildeten. Nick ertastete etwas Rundes und Flaches. Er holte es aus dem Schlamm und wischte mit dem Daumen den klebrigen Schmutz weg, bevor er seinen Fund aus dem Wasser hob.
Von dem erwarteten Goldglanz war nichts zu sehen. Es war nichts anderes als eine alte verrostete Dichtungsscheibe. Er versuchte sein Glück an einer anderen Stelle, wo er und sein Bruder ebenfalls einiges von dem Abfall entfernt hatten. Tastend identifizierte er Zweige und halb vermodertes Laub, aber wenn er auf etwas stieß, das er nicht auf Anhieb einordnen konnte, zog er es aus dem Wasser. Er gab ein erschrockenes Knurren von sich, als er in die leeren Augenhöhlen eines Tierschädels starrte – das musste ein Fuchs gewesen sein, vermutete er.
Hoch über ihnen nahm der Druck hinter einem der Wergpfropfen ständig zu, so dass Wasser durch das dichte Fasergeflecht drang. Was als Rinnsal begonnen hatte, steigerte sich schnell zu einem dicken Schwall, als der Pfropfen mit genügend Wucht aus dem Loch herausschoss, um gegen die gegenüberliegende Schachtwand zu prallen. Seewasser ergoss sich in einem soliden Strahl in den Schacht und wand und schlängelte sich dabei wie ein unter Spannung stehendes Stromkabel.
»Das war’s«, übertönte Nicks Stimme das Rauschen. »Wir müssen hier raus!«
»Noch eine Sekunde«, erwiderte Don, der fast mit dem gesamten Oberkörper ins Wasser eingetaucht war, während er weiter den Boden abtastete.
Nick legte seinen Klettergürtel an und blickte alarmiert hinüber, als Don einen seltsamen Keuchlaut von sich gab. »Don?«
Etwas hatte sich verschoben. Noch vor einer Sekunde hatte Don auf einem Baumstamm gelegen, und jetzt klebte er plötzlich an der gegenüberliegenden Schachtwand und hatte ein Astende des Baums vor der Brust.
»Nick!«, rief er mit halb erstickter Stimme.
Nick durchquerte den Schacht, um seinem Bruder zu helfen. Seine heftige Bewegung musste den gesamten Holzhaufen erschüttert haben, denn Don schrie plötzlich auf. Der Stamm vor seiner Brust rutschte ein Stück tiefer, und im Licht der Grubenlampe konnte Nick auf der Jacke seines Bruders einen dunklen Fleck erkennen, der zusehends größer wurde.
Wasser hämmerte von oben auf sie herab, schlimmer als ein sommerlicher Wolkenbruch.
»Halt durch, kleiner Bruder«, sagte Nick und packte einen Baumast. Er glaubte spüren zu können, wie das Holz seltsam vibrierte, als wäre das versteckte Ende unter Wasser mit irgendeiner Maschine verbunden.
Ganz gleich wie er sich anstrengte, den Baumstamm aus dem Wasser zu ziehen, er hatte sich unter der Wasseroberfläche untrennbar mit irgendetwas verhakt. Unbarmherzig drückte er immer heftiger gegen Dons Brust.
Don stieß einen Schmerzensschrei aus. Nick schrie ebenfalls aus Angst und Hilflosigkeit. Er wusste nicht, was er tun sollte, und suchte verzweifelt nach irgendeiner Möglichkeit, den Ast aus dem Körper seines Bruders herauszuziehen.
»Halt noch einen Moment durch, Don«, sagte Nick, und dabei mischten sich Tränen mit dem Salzwasser, das über sein Gesicht strömte.
Wieder rief Don seinen Namen, aber nur schwach, denn mindestens vier Zentimeter Holz hatten sich in seine Brust gebohrt. Nick reichte ihm seine Hand, die Don ergriff, aber die Kraft, die Angst und Schmerz ihm verliehen, begann nachzulassen. Seine Finger erschlafften.
»Donny!«, rief Nick.
Don öffnete den Mund. Nick sollte nie erfahren, welches die letzten Worte seines Bruders hätten sein sollen. Blut quoll zwischen Don Ronish’ bleichen Lippen hervor. Der erste Schwall ging in einen ständigen Strom über, der sich im Meerwasserregen rosig färbte und ihm über Hals und Brust rann.
Nick warf den Kopf in den Nacken und brüllte. Es war ein Urschrei, der von den Schachtwänden widerhallte, und er wäre für immer an der Seite seines Bruders geblieben, wenn der zweite Wergpfropfen nicht nachgegeben und sich die Wassermenge nicht verdoppelt hätte, die nun in den Schacht rauschte.
Er hantierte in dem Wasserfall mit dem Seil herum und hängte sein Geschirr in die Schlinge ein. Er hasste, was er zu tun im Begriff war, aber er hatte keine andere Wahl. Also zog er an der Senkbleischnur. Seine anderen Brüder wussten offenbar, dass etwas nicht in Ordnung war, denn sie holten ihn sofort nach oben. Nick hielt den Lichtstrahl seiner Lampe auf Don gerichtet, bis der leblose Körper nur noch ein bleiches Schemen in der Tiefe war. Und dann war er ganz verschwunden.
Don Ronish’ Gedenkgottesdienst fand am darauffolgenden Donnerstag statt. Die Welt hatte sich in den Stunden, in denen die fünf Brüder Forscher und Entdecker gespielt hatten, dramatisch verändert. Die Japaner hatten Pearl Harbour bombardiert, und die Vereinigten Staaten befanden sich jetzt im Krieg. Nur die Navy verfügte über die geeignete Tauchausrüstung, die nötig war, um Dons Leichnam zu bergen. Doch die Bitte seiner Eltern war auf taube Ohren gestoßen. Sein Sarg blieb leer.
Seit der schrecklichen Nachricht hatte ihre Mutter nicht mehr gesprochen, und sie musste sich während des gesamten Gottesdienstes an ihren Vater lehnen, um nicht in Ohnmacht zu fallen. Als der Gottesdienst dann beendet war, befahl er den drei Ältesten, an Ort und Stelle zu bleiben, und brachte ihre Mutter und Jimmy zu ihrem Wagen, einem alten Hudson, den sie gebraucht gekauft hatten. Er aber kehrte zum Grab zurück, mindestens zehn Jahre älter, als er noch am Sonntagmorgen gewesen war. Er sagte nichts, blickte nur von einem Sohn zum nächsten, die Augen gerötet. Dann griff er in die Jacketttasche des einzigen Anzugs, den er besaß – er hatte in diesem Anzug geheiratet und ihn auch zur Beerdigung seiner Eltern getragen. Drei Bögen Papier hielt er in der Hand. Er reichte jedem seiner Söhne einen und wartete mit dem für Kevin einen kurzen Moment. Dann drückte er einen Kuss darauf, ehe er das Papier seinem Sohn in die Hand gab.
Es waren Geburtsurkunden. Die, die er Kevin gegeben hatte, gehörte Don, der achtzehn Jahre alt gewesen und daher geeignet war, sich zum Militär zu melden.
»Es ist wegen eurer Ma. Sie kann es heute noch nicht begreifen. Macht unserer Familie Ehre, vielleicht wird euch dann verziehen werden.«
Er machte auf dem Absatz kehrt und ging davon. Dabei hingen seine mageren Schultern herab, als läge eine Last auf ihnen, die schwerer war, als sein Körper sie je hätte tragen können.
Und so begaben sich die drei Jungen zum nächsten Rekrutierungsbüro, sämtliche Gedanken an jugendliche Unbeschwertheit durch die Erinnerung an den leeren Sarg ihres Bruders ausgelöscht. Und durch die Hölle des Krieges, die auf sie wartete.
1
An der Grenze zwischen Argentinien und ParaguayGegenwart
Juan Cabrillo hätte niemals gedacht, dass er irgendwann einmal einer Herausforderung begegnen würde, der er lieber ausgewichen wäre, als sich ihr zu stellen. Vor dieser aber wäre er am liebsten davongelaufen.
Nicht dass er es offen zeigte.
Er setzte eine undurchdringliche Miene auf – seine blauen Augen blickten ruhig und gelassen, sein Gesichtsausdruck war neutral –, doch er war froh, dass sein bester Freund und Stellvertreter, Max Hanley, nicht dabei war. Max hätte Cabrillos Besorgnis sofort wahrgenommen.
Sechzig Kilometer stromabwärts von seinem augenblicklichen Standort an dem teebraunen Fluss entfernt erstreckte sich eine der am strengsten bewachten Grenzen der Welt – lediglich übertroffen von der EMZ zwischen Süd- und Nordkorea. Es war ein verdammtes Pech, dass das Objekt, das ihn und seine handverlesene Truppe in diesen abgelegenen Dschungel geführt hatte, auf der anderen Seite der Grenze gelandet war. Wäre es in Paraguay aufgeschlagen, hätte sich die Affäre mit ein paar Telefongesprächen zwischen Diplomaten und einer ansehnlichen Geldzuwendung, getarnt als Wirtschaftshilfe, auf der Stelle regeln lassen.
Aber das war eben nicht der Fall. Was sie suchten, war in Argentinien gelandet. Und hätte sich der Vorfall achtzehn Monate früher ereignet, wäre er mühelos aus der Welt geschafft worden. Doch vor anderthalb Jahren hatte nach dem zweiten Zusammenbruch des argentinischen Peso eine Generalsjunta unter Führung von Generalissimo Ernesto Corazón gewaltsam die Macht übernommen. Geheimdienstexperten waren überzeugt, dass der Putsch von langer Hand vorbereitet worden war. Die Währungskrise diente ihnen lediglich als Vorwand, um die legitime Regierung abzusetzen und die Kontrolle zu übernehmen.
Die hochrangigen Vertreter der Zivilregierung wurden vor Scheingerichten wegen wirtschaftlichen Missmanagements – das als Staatsverbrechen gewertet wurde – angeklagt und verurteilt. Die Glücklichen wurden hingerichtet, und der Rest, der weniger Glück hatte, wanderte in Zwangsarbeitslager, die in den Anden oder tief im Amazonasdschungel lagen. Jeder Versuch, etwas über ihr Schicksal zu erfahren, hatte willkürliche Verhaftungen zur Folge. Die Presse wurde verstaatlicht, und Journalisten, die sich nicht an die Parteilinie hielten, kamen ins Gefängnis. Gewerkschaften wurden verboten, und Protestversammlungen hatte man mit Waffengewalt zerstreut.
Diejenigen, die während der chaotischen Anfangstage des Putsches fliehen konnten – vorwiegend waren dies reiche Familien gewesen, die bereit waren, alles zurückzulassen –, berichteten, dass das, was nun im Land geschah, die Schrecken der Militärregierungen der 1960er und -70er Jahre als geradezu harmlos erscheinen ließ.
Argentinien hatte sich innerhalb von sechs Wochen von einer blühenden Demokratie in einen echten Polizeistaat verwandelt. Die Vereinten Nationen hatten zwar mit einem verbalen Säbelrasseln reagiert und mit umfangreichen Sanktionen gedroht, aber am Ende hatten sie sich auf eine abgemilderte Resolution geeinigt, mit der die wiederholten Menschenrechtsverletzungen verurteilt wurden. Wie in solchen Fällen üblich, wurde die Resolution jedoch von der herrschenden Junta geflissentlich ignoriert.
Seitdem hatte die Militärregierung ihre Kontrollmaßnahmen verschärft. Zuletzt hatte man damit begonnen, umfangreiche Truppenverbände an den Grenzen nach Bolivien, Paraguay, Uruguay und Brasilien sowie entlang der Passstraßen nach Chile zusammenzuziehen. Eine Wehrpflicht wurde eingeführt, so dass der Regierung eine Armee zur Verfügung stand, die so groß war wie die Streitkräfte aller anderen südamerikanischen Länder zusammengenommen. Brasilien, das traditionsgemäß die Position als führende Regionalmacht für sich beanspruchte, hatte seine Grenzen ebenso verstärkt, und es war für beide Seiten nicht unüblich, sich gelegentlich heftige Artilleriegefechte zu liefern.
Dies stellte im Großen und Ganzen den machtpolitischen Albtraum dar, in den hinein Juan Cabrillo seine Leute führte, um etwas in Ordnung zu bringen, das ursprünglich von der NASA vermasselt worden war.
Die Corporation beobachtete gerade die Lage in der Gegend, als der Anruf einging. Man war soeben dabei, im Zuge der Tarnung, hinter der man sich verbarg, in Santos, Brasilien, dem verkehrsreichsten Hafen Südamerikas, eine Ladung gestohlener Pkw aus Europa zu löschen. Ihr Schiff, die Oregon, stand in dem Ruf, ein Trampfrachter mit keiner festen Route und einer Mannschaft zu sein, die nur wenige Fragen stellte. Es wäre ein großer Zufall, wenn die brasilianische Polizei während der nächsten Monate eine Reihe von Tipps über den Verbleib der Wagen erhielte. Während der Überfahrt hatte Cabrillo veranlasst, dass sein Techniker-Team GPS-Peilsender in den für den grauen Markt bestimmten Automobilen versteckte. Es war nicht allzu wahrscheinlich, dass die Wagen ihren ursprünglichen Eigentümern zurückgegeben würden, doch der Schmugglerring würde auf jeden Fall auffliegen und auseinanderbrechen.
Eine Diebesorganisation darzustellen gehörte zum Job der Corporation, sich tatsächlich an einem kriminellen Unternehmen zu beteiligen, jedoch nicht.
Der Ausleger des mittleren vorderen Derrickkrans schwenkte ein letztes Mal über den Laderaum. Im Lichtschein der wenigen Lampen auf dem Pier, die in diesem wenig benutzten Teil des Hafens noch funktionierten, schimmerte eine Reihe exotischer Wagen wie seltene Juwelen. Ferraris, Maseratis und Audi R8 standen bereit, um auf drei Sattelschlepper verladen zu werden, die bereits mit laufenden Motoren warteten. Ein Zollbeamter stand in der Nähe, die Tasche ein wenig ausgebeult von dem Briefumschlag voller Fünfhunderteuroscheine.
Auf ein Zeichen von Mannschaftsmitgliedern hin spannte der Motor des Krans im Laderaum das Seil, und ein hellorangefarbener Lamborghini Gallardo tauchte auf. Er sah so schnittig aus, als sei er bereits mit Autobahngeschwindigkeit unterwegs. Cabrillo wusste von seinem Kontaktmann in Rotterdam, wo die Fahrzeuge verladen worden waren, dass dieser besondere Wagen einem italienischen Grafen in der Nähe von Turin gestohlen worden war und der Graf ihn von einem betrügerischen Händler gekauft hatte, der später behauptete, er sei ihm aus seinem Ausstellungsraum gestohlen worden.
Max Hanley knurrte beim Anblick des Lambos in dem matten Licht leise. »Ein wirklich schönes Stück, aber was soll diese grässliche Farbe?«
»Über Geschmack lässt sich nicht streiten, mein Freund«, sagte Juan, führte mit einer Hand eine kreisende Bewegung über seinem Kopf aus, um dem Kranführer anzuzeigen, er könne nun den letzten Wagen auf den Pier herablassen. Ein Hafenlotse würde ihnen in Kürze beim Auslaufen behilflich sein.
Der Luxuswagen wurde auf dem zerbröckelnden Zementpier abgesetzt. Angehörige der Schmugglerbande lösten das Krangeschirr und achteten darauf, dass die Stahlkabel nichts zerkratzten. Obwohl es, wie Juan zugeben musste, eine wirklich hässliche Lackwahl war.
Der dritte Mann, der auf der Außenbrücke des alten Frachters stand, hatte sich als Angel vorgestellt. Er war Mitte zwanzig, bekleidet mit einer Hose aus einem Material, das wie Quecksilber glänzte, sowie einem weißen Oberhemd, das er nicht in die Hose gestopft hatte. Er war so dünn, dass die Umrisse einer automatischen Pistole, die auf dem Rücken in seinem Hosenbund steckte, deutlich zu sehen waren.
Aber vielleicht war das auch gewollt.
Andererseits machte sich Juan wegen eines möglichen Doppelspiels keine großen Sorgen. Die Schmuggelei war ein Gewerbe, das auf Vertrauen basierte, und nur eine einzige dumme Aktion Angels hätte garantiert zur Folge, dass er nie wieder ein solches Geschäft abschließen würde.
»Okay, Capitão, das war’s«, sagte Angel und gab seinen Männern mit einem Pfiff ein Zeichen.
Einer von ihnen holte eine Reisetasche aus dem Führerhaus einer Zugmaschine und kam damit zur Gangway, während seine Kumpane begannen, die gestohlenen Wagen auf die Sattelschlepper zu laden. Ein Mannschaftsangehöriger nahm den Schmuggler an der Reling in Empfang und geleitete ihn die beiden verrosteten Treppen zur Brücke hinauf. Juan kam mit den anderen von draußen herein. Die einzige Beleuchtung rührte von dem altmodischen Radarschirm her, der allem einen ungesunden grünen Schimmer verlieh.
Cabrillo sorgte für ein wenig mehr Licht, während der Brasilianer die Tasche auf den Kartentisch stellte. Angels Haarpomade glänzte ebenso wie seine Hose.
»Der vereinbarte Preis betrug zweihunderttausend Dollar«, sagte Angel, während er die zerschlissene Reisetasche öffnete. Dieser Betrag würde noch nicht einmal ausreichen, um einen einzigen Ferrari neu zu kaufen. »Es wäre mehr gewesen, wenn Sie sich bereit erklärt hätten, drei von den Schlitten nach Buenos Aires zu liefern.«
»Vergessen Sie’s«, erwiderte Juan. »Diesen Ort will ich mit meinem Schiff nicht mal von weitem sehen. Und viel Glück bei Ihrer Suche nach einem Kapitän, der Ihnen den Gefallen tut. Verdammt, niemand würde eine gewöhnliche Fracht nach BA bringen, geschweige denn eine Ladung gestohlener Autos.«
Als Cabrillo eine Bewegung machte, stieß er mit dem Schienbein gegen den Tisch. Das Geräusch war ein unnatürliches Knacken. Angel musterte ihn wachsam, während sich seine Hand unter seinem Hemd in Richtung Pistole bewegte.
Juan machte eine beschwichtigende Geste und bückte sich, um sein Hosenbein hochzuziehen. Etwa fünf Zentimeter unter dem Knie war der Unterschenkel durch eine Hightech-Prothese ersetzt worden, die wie eine Requisite aus den Terminator-Filmen aussah. »Berufsrisiko.«
Der Brasilianer zuckte die Achseln.
Das Geld war in Bündel von jeweils zehntausend Dollar gepackt. Juan teilte die Bündel und gab Max eine Hälfte. Während der nächsten Minuten stellte das leise Rascheln der Banknoten, die durchgeblättert wurden, das einzige Geräusch auf der Kommandobrücke dar. Sämtliche Hundertdollarscheine schienen echt zu sein.
Juan streckte die Hand aus. »Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Angel.«
»Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, Capitão. Ich wünsche Ihnen eine sichere …« Ein lautes Quäken aus dem Deckenlautsprecher übertönte den Rest seines Satzes. Eine kaum verständliche Stimme rief den Kapitän nach unten in die Kantine.
»Bitte, entschuldigen Sie mich«, sagte Cabrillo und wandte sich dann an Max. »Falls ich nicht zurück sein sollte, wenn der Hafenlotse erscheint, steuerst du das Schiff.«
Über eine Innentreppe begab er sich zum Mannschaftsdeck hinunter. Die Innenräume des alten Trampfrachters wirkten genauso heruntergekommen wie sein Rumpf. Die Wände hatten seit Jahrzehnten keine frische Farbe mehr gesehen, und im Staub auf dem Fußboden waren Streifen zu erkennen, wo irgendein Mannschaftsangehöriger in fernerer Vergangenheit den halbherzigen Versuch unternommen hatte, mit einem Schrubber für ein wenig Sauberkeit zu sorgen. In der Kantine war es nur wenig heller als im dämmrigen Laufgang. An den Wänden hingen wahllos verteilt billige Reiseposter. An einer Wand befand sich eine Informationstafel, vollgeheftet mit ungelesenen Notizzetteln, die alle möglichen Botschaften verkündeten, angefangen mit Gitarrenstunden, die von einem Matrosen angeboten wurden, der das Schiff schon vor über zehn Jahren verlassen hatte, bis hin zu einem Hinweis, dass Hongkong ab 1. Juli 1997 wieder unter chinesischer Kontrolle stünde.
In der angrenzenden Küche hingen fingerdicke Stalaktiten verhärteten Bratfetts vom Ventilatorengitter über dem Kochherd herab.
Cabrillo durchquerte den leerstehenden Raum, und als er sich der hinteren Wand näherte, öffnete sich eine vollendet getarnte Tür. Linda Ross stand in dem gediegen eingerichteten Flur gleich dahinter. Sie bekleidete den Posten des stellvertretenden Einsatzleiters der Corporation und stand damit hinter Juan und Max an dritter Stelle der Unternehmenshierarchie. Sie erinnerte an eine niedliche Elfe, hatte eine kleine Stupsnase und eine Vorliebe für wechselnde Haarfarben. Zurzeit war ihr Haar jettschwarz und kräuselte sich in verspielten Locken bis auf ihre Schultern.
Linda war eine Navy-Veteranin und hatte sowohl auf einem Lenkwaffenkreuzer gedient als auch im Pentagon Stabsaufgaben wahrgenommen. Daher verfügte sie über eine ganze Reihe besonderer Fertigkeiten, die sie für ihren Job zur idealen Besetzung machten.
»Was ist los?«, fragte Juan, als sie ihm folgte. Für jeden seiner Schritte musste sie zwei machen.
»Overholt ist am Telefon. Klingt, als wäre es dringend.«
»Lang klingt immer dringend«, sagte Juan und nahm einen Satz falscher Zähne und ein paar Baumwollpolster aus dem Mund, die Teil seiner Verkleidung waren. Unter seinem zerknautschten Uniformhemd trug er einen Fettanzug und auf dem Kopf eine Perücke aus grau meliertem Haar. »Ich glaube, es ist seine Prostata.«
Langston Overholt IV war ein altgedienter CIA-Mann, der schon lange genug im Geschäft war, um ganz genau zu wissen, wo all die Leichen – sowohl im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinn – begraben waren. Daher hatte ihn nach jahrelangen vergeblichen Versuchen, ihn in den Ruhestand abzuschieben, eine Reihe von Direktoren, die aus Gründen des politischen Proporzes ernannt worden waren, als Berater in Langley geduldet. Außerdem war er Cabrillos Boss gewesen, als dieser noch als aktiver Agent tätig gewesen war. Und als Juan die Agency verließ, hatte ihm Overholt in vielerlei Hinsicht geholfen, die Corporation zu gründen.
Viele der heikelsten Aufträge, die die Corporation später übernommen hatte, waren von Overholt gekommen. Und die beachtlichen Honorare, die sie dafür eingenommen hatte, wurden aus schwarzen Kassen und über dunkle Kanäle gezahlt, die so tief im verwaltungstechnischen Gefüge vergraben waren, dass die Rechnungsprüfer, die nach ihnen suchten, sich im Andenken an die alten Goldgräber Kaliforniens die 49er nannten.
Sie kamen zu Cabrillos Kabine. Er hielt kurz inne, bevor er die Tür öffnete. »Sag den Leuten im Operationszentrum Bescheid, sie sollen sich bereithalten. Der Lotse müsste bald hier sein.«
Während das Steuerhaus mehrere Decks über ihnen einen funktionstüchtigen Eindruck machte, war es für Schiffsinspektionen und Lotsen nicht mehr als Augenwischerei. Die Kontrollen für Ruder und Antrieb waren per Computer mit dem Hightech-Operationszentrum verbunden, der eigentlichen Schaltzentrale des Schiffes. Sämtliche Abtriebs- und Manövrieranweisungen wurden von dort gegeben, und ebenfalls von dort wurde das gesamte Arsenal tödlicher Waffen gesteuert, die überall auf der heruntergekommen wirkenden Schute versteckt waren.
Die Oregon mochte als Holzfrachter angefangen und Baumstämme an der amerikanischen Westküste entlang bis nach Japan transportiert haben, doch nachdem Juans Team von Schiffsarchitekten und -technikern mit ihr fertig war, stellte sie eins der höchstentwickelten Schiffe dar, die Informationen sammelten und Geheimoperationen ausführten, das jemals konstruiert und gebaut worden war.
»Wird sofort gemacht, Chef«, sagte Linda und entfernte sich mit schnellen Schritten den Gang hinunter.
Nach einem ziemlich haarigen Duell mit einem libyschen Kriegsschiff einige Monate zuvor war es notwendig gewesen, das Schiff zwecks umfangreicher Reparaturen in ein Trockendock zu bringen. Nicht weniger als dreißig Artilleriegranaten hatten seine Panzerung durchdrungen. Juan konnte das unmöglich seinem Schiff ankreiden. Schließlich waren die Granaten aus nächster Nähe abgefeuert worden. Immerhin hatte er die Gelegenheit genutzt, seine Kabine umzugestalten.
All die teure Holztäfelung war entfernt worden, und zwar sowohl durch die libyschen Kanonen als auch durch die Schiffsschreiner. Die Wände hatte man nun mit einem stuckähnlichen Material beschichtet, das keine Risse bildete, wenn sich das Schiff bog. Die Türdurchgänge wurden ebenfalls modifiziert und mit Rundbögen versehen. Dann waren einige ebenfalls gewölbte Raumteiler eingebaut worden und verliehen der knapp siebzig Quadratmeter großen Kabine eine heimelige Atmosphäre. Mit ihrem betont arabischen Dekor sahen die Räume wie das Innere von Rick’s Café Américain in Casablanca aus, Juans Lieblingsfilm.
Er warf die Perücke auf seinen Schreibtisch und angelte sich den Hörer seines altmodischen Bakelittelefons.
»Lang, Juan am Apparat. Wie fühlst du dich?«
»Apoplektisch.«
»Das ist doch dein Normalzustand. Was gibt’s denn?«
»Verrate mir zuerst einmal, wo du gerade bist.«
»In Santos, Brasilien. Das ist die Hafenstadt von São Paulo, falls du nichts damit anfangen kannst.«
»Gott sei Dank, dann bist du ja ganz in der Nähe«, sagte Overholt mit einem erleichterten Seufzer. »Und nur damit du es weißt, ich habe in den sechziger Jahren den Israelis geholfen, in Santos einen Nazikriegsverbrecher zu schnappen.«
»Touché. Aber – um was geht es denn nun?« Aus Overholts Tonfall konnte Juan heraushören, dass er etwas Großes für ihn hatte, und er spürte bereits die ersten Adrenalinschübe in seinen Adern.
»Vor sechs Stunden wurde von Vandenberg aus ein Satellit mit einer Delta-III-Rakete gestartet, um in einen erdnahen Polar-Orbit gebracht zu werden.«
Dieser eine Satz reichte Cabrillo schon, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Rakete irgendwo über Südamerika abgestürzt war, da Polarstarts von der kalifornischen Luftwaffenbasis stets nach Süden gehen. Er ahnte auch, dass der Satellit mit hoch entwickelter Spionagetechnik bestückt sein musste, von der man nicht wusste, ob sie verbrannt war oder nicht, und dass die Rakete höchstwahrscheinlich in Argentinien aufgeschlagen war, da Lang sich an die besten verdeckt arbeitenden Agenten gewandt hatte, die er kannte.
»Die Techniker wissen noch nicht, was schiefgegangen ist«, fuhr Overholt fort. »Aber das ist ohnehin nicht unser Problem.«
»Unser Problem«, sagte Juan, »ist, dass die Rakete in Argentinien abgestürzt ist.«
»Du sagst es. Etwa einhundertfünfzig Kilometer südlich der paraguayischen Grenze in einem der dichtesten Dschungelgebiete des Amazonasbeckens. Und es besteht die große Chance, dass die Argentinier längst Bescheid wissen, weil wir jedes Land auf dem errechneten Kurs gewarnt haben, dass es von der Rakete überflogen werde.«
»Ich dachte, wir hätten seit dem Putsch keine diplomatischen Beziehungen mehr mit denen.«
»Wir haben noch immer gewisse Kanäle, um solche Informationen weiterzugeben.«
»Ich weiß, worum du uns bitten willst, aber sei doch vernünftig. Der Schrott dürfte über ein paar tausend Quadratkilometer Dschungel verstreut sein, in dem nicht einmal unsere Spionagesatelliten etwas erkennen können. Erwartest du ernsthaft von uns, dass wir deine Nadel im Heuhaufen finden?«
»Das tue ich, denn jetzt kommt der Knaller. Der spezielle Teil der Nadel, die wir suchen, sendet schwache Gammastrahlen aus.«
Juan ließ diese Informationen einige Sekunden lang in sein Bewusstsein sacken und meinte schließlich: »Plutonium.«
»Die einzige zuverlässige Energiequelle, die wir für diesen besonderen Vogel zur Verfügung hatten. Die Eierköpfe der NASA haben es mit jeder halbwegs vorstellbaren Alternative versucht, doch am Ende lief es darauf hinaus, eine winzige Menge Plutonium einzusetzen und die bei der Strahlung erzeugte Wärme zum Betreiben der Satellitensysteme zu benutzen. Positiv zu vermerken ist, dass sie den Sicherheitsbehälter derart aufwendig konstruiert haben, dass er praktisch unzerstörbar ist. Er würde noch nicht einmal bemerken, wenn die Rakete, die ihn transportiert, um ihn herum explodiert.
Wie du dir sicher denken kannst, möchte die Administration auf keinen Fall, dass bekannt wird, wir hätten einen Satelliten auf die Reise geschickt, der möglicherweise eine ganz beträchtliche Fläche eines der ursprünglichsten Lebensräume der Erde verstrahlen könnte. Die andere Sorge ist, dass das Plutonium nicht in argentinische Hände fallen darf. Wir haben nämlich den Verdacht, dass sie die Arbeit an ihrem Kernwaffenprogramm wieder aufgenommen haben. Der Satellit hatte zwar nicht allzu viel von dem Zeug an Bord – ein paar Gramm, wurde mir erklärt –, aber es hat wenig Sinn, ihnen bei ihrem Marsch zur Bombe auch nur im Mindesten behilflich zu sein.«
»Wissen die Argies denn nichts von dem Plutonium?«, fragte Juan und benutzte den Spitznamen für Argentinier, den er von einem Falklandkriegsveteranen aufgeschnappt hatte.
»Gott sei Dank, nein. Aber jeder, dem die richtige Ausrüstung zur Verfügung steht, wird schwache radioaktive Strahlung auffangen. Und bevor du fragst«, sagte er in Erwartung des nächsten Kommentars, »die Intensität ist ungefährlich, vorausgesetzt, du befolgst einige Sicherheitsvorschriften.«
Das sollte gar nicht Cabrillos nächste Frage gewesen sein. Er wusste, dass Plutonium nicht gefährlich war, es sei denn, man verschluckte es oder atmete es ein. Dann erst wäre es eines der tödlichsten Gifte, die die Menschheit kannte.
»Ich wollte eigentlich nur fragen, ob wir irgendwelche Unterstützung erhalten.«
»Nichts dergleichen. Ein Team ist bereits mit Exemplaren der jüngsten Generation von Gammastrahlendetektoren nach Paraguay unterwegs, aber das ist in etwa alles an Hilfe, womit du rechnen kannst. Der DCI und der Vorsitzende der Joint Chiefs waren nötig, um den Präsidenten davon zu überzeugen, dass wir euch wenigstens dieses wenige an Hilfe zuteilwerden lassen. Ich bin sicher, du kannst begreifen, dass er gewisse Hemmungen hat, wenn es darum geht, hochsensible internationale Situationen zu meistern. Er hat ja auch das Debakel in Libyen vor einigen Monaten noch nicht richtig verarbeitet.«
»Debakel?« Juan klang beleidigt. »Wir haben der Außenministerin das Leben gerettet und dafür gesorgt, dass der Friedensgipfel stattfinden konnte.«
»Und beinahe einen Krieg vom Zaun gebrochen, als ihr euch mit einer ihrer Lenkwaffenfregatten angelegt habt. Diese Sache hier muss jedenfalls ultraleise über die Bühne gehen. Schleicht euch rein, findet das Plutonium, und schleicht euch am besten gleich wieder raus. Und zwar ohne irgendwelches Feuerwerk.«
Cabrillo und Overholt wussten beide, dass Juan dies nicht versprechen konnte, daher bat er stattdessen um Details über den genauen Ort, wo die Rakete explodiert war, und über die Bahn ihres Absturzes zur Erde. Er nahm eine kabellose Tastatur und eine Maus von einem Tablett unter der Schreibtischplatte, wodurch ein Funkimpuls ausgelöst wurde, der einen Flachbildschirm aus der Schreibtischplatte hochfahren ließ. Overholt schickte per E-Mail Bilder und Zielgebietskoordinaten. Die Bilder waren wertlos und zeigten nichts außer einer dichten Wolkendecke, doch die NASA hatte ein etwa dreizehn Quadratkilometer großes Suchgebiet bestimmt, das sich mit einer systematischen Suche durchaus bewältigen ließ, vorausgesetzt das Gelände bereitete ihnen keine größeren Probleme. Overholt wollte von Cabrillo wissen, ob er schon irgendeine Idee habe, wie sie unbemerkt auf argentinisches Territorium vordringen wollten.
»Ich möchte mir zuerst einige topographische Karten ansehen, bevor ich diese Frage beantworten kann. Spontan fällt mir dazu natürlich ein Hubschrauber ein, aber da die Argentinier ihre militärische Präsenz an der nördlichen Grenze zurzeit aufstocken, wird das wohl nicht möglich sein. In ein oder zwei Tagen dürfte ich mir sicherlich etwas ausgedacht haben und bis zum Wochenende so weit sein, es auch auszuführen.«
»Ach ja, eine Sache noch«, sagte Overholt so beiläufig, dass sich Cabrillo sofort anspannte. »Ihr habt zweiundsiebzig Stunden Zeit, um die Energieeinheit zu bergen.«
Juan konnte es nicht glauben. »Drei Tage? Das ist unmöglich.«
»Nach zweiundsiebzig Stunden will der Präsident auspacken. Na ja, zumindest teilweise. Er wird wohl nichts von dem Plutonium verlauten lassen, aber er ist bereit, die Argentinier um ihre Mithilfe bei der Bergung von, ich zitiere, empfindlichem wissenschaftlichem Gerät zu bitten.«
»Und wenn sie nein sagen und selbst danach suchen wollen?«
»Bestenfalls stehen wir ziemlich dumm da, und schlimmstenfalls erscheinen wir in den Augen der Welt sträflich nachlässig. Außerdem überlassen wir Generalissimo Corazón eine hübsche Portion waffenfähiges Plutonium zum Spielen.«
»Lang, gib mir sechs Stunden. Ich melde mich dann wieder bei dir und sage dir, ob wir bereit – verdammt – ob wir in der Lage sind, uns an deinem Spiel zu beteiligen.«
»Danke, Juan.«
Cabrillo rief Overholt nach einer dreistündigen Strategiekonferenz mit seinen Abteilungsleitern an und stand zwölf Stunden später mit seinem Team am Ufer eines paraguayischen Flusses, bereit und im Begriff, in Gott weiß was vorzustoßen.
2
Wilson/George-ForschungsstationAntarktische Halbinsel
Das Stammpersonal der Winterbesatzung konnte den herannahenden Frühling bereits in den Knochen spüren. Nicht dass sich das Wetter wesentlich gebessert hatte. Die Temperatur stieg nur selten höher als zwanzig Grad minus, und der eisige Wind wehte ständig. Es war die wachsende Zahl von Kreuzchen auf dem großen Kalender im Gemeinschaftsraum, die die verstreichenden Tage markierten und ihre Lebensgeister nach einem langen Winter beflügelten, in dessen Verlauf sie die Sonne seit dem vergangenen März nicht mehr gesehen hatten.
Nur ein paar Forschungsstationen bleiben auf dem unwirtlichsten Kontinent der Welt während des ganzen Jahres geöffnet und in Betrieb, und sie sind gewöhnlich viel größer als die Wilson/George-Forschungsstation, die von einem Zusammenschluss amerikanischer Universitäten und einem Stipendium der National Science Foundation unterhalten wird. Selbst bei vollständiger Besatzung während der Sommermonate ab September bot die Gruppierung vorgefertigter Kuppelbauten auf Stelzen, die man ins Eis und in den Fels getrieben hatte, nicht mehr als vierzig Seelen Platz.
Auf Grund der Geldsummen, die in die Erforschung der Ursachen für die globale Erderwärmung gesteckt wurden, entschloss man sich, die Station das ganze Jahr über offen und erreichbar zu halten. Dies war der erste Versuch in dieser Richtung gewesen – und er war in jeder Hinsicht erfolgreich verlaufen. Die Bauwerke hatten den schlimmsten Stürmen, die die Antarktis gegen sie hatte entfesseln können, standgehalten, und die Bewohner waren die meiste Zeit über sehr gut miteinander ausgekommen. Einer von ihnen, Bill Harris, war ein Astronaut der NASA und studierte als Vorbereitung auf eine bemannte Marsexpedition die Auswirkungen der vollständigen Isolation auf das menschliche Sozialverhalten.
WeeGee, wie das Team sein Zuhause während der letzten sechs Monate nannte, sah aus, als käme es direkt aus einem futuristischen Skizzenbuch. Es stand nicht weit von einer tiefen Bucht am Ufer der Bellingshausen-See in der Mitte der Halbinsel, die wie ein gefrorener Finger auf Südamerika deutete. Bei Sonnenschein hätte man lediglich ein Fernglas gebraucht, um von den Bergspitzen hinter der Basis den südlichen Ozean sehen zu können.
Fünf Rundbauten waren um ein zentrales Gebäude herum angeordnet worden, das die Kantine und den Gemeinschaftsraum enthielt. Die Rundbauten waren durch hoch gelegene Laufgänge untereinander verbunden, die dergestalt konstruiert waren, dass sie dem Druck des Windes elastisch nachgaben und zu schaukeln begannen. An Tagen mit besonders schlechtem Wetter bewegten sich die Leute mit den schwächsten Mägen nur kriechend durch die Laufgänge. Die Rundbauten enthielten Laboreinrichtungen, Materiallager und schlafsaalähnliche Räume, in deren Zellen während des Sommers jeweils vier Personen schliefen. Alle Gebäude waren in der Sicherheitsfarbe Rot gehalten. Mit ihren dunklen Platten in den gewölbten Decken und zahlreichen Wandflächen erinnerte die gesamte Anlage an eine Gruppe von Schachbrett-Silos.
Ein gutes Stück entfernt und über einen sorgfältig mit Seilen gesicherten Pfad zu erreichen, stand ein Wellblechgebäude, das als Garage für ihre Schneemobile und die Schneekatzen diente. Wegen des schlechten Wetters im Winter hatten sie die arktischen Fahrzeuge nur selten benutzen können. Das Gebäude wurde mit Restwärme aus der Basis beheizt, damit die Temperatur nicht unter zehn Grad minus sank und die Motoren nicht beschädigt wurden.
Der größte Teil ihrer meteorologischen Messgeräte konnte aus der Ferne überwacht und abgelesen werden, so dass es für die Mannschaft während der sonnenlosen Tage nur wenig zu tun gab. Bill Harris hatte sein NASA-Studium, zwei von ihnen nutzten die Zeit, um ihre Doktorarbeiten abzuschließen, und einer arbeitete an einem Roman.
Nur Andy Gangle schien nichts zu haben, um seine Freizeit damit auszufüllen. Als er auf die Station gekommen war, hatte der achtundzwanzigjährige PostDoc von der Penn State University den Start von Wetterballons stets aufmerksam überwacht und die Wetterentwicklung gewissenhaft beobachtet. Aber es dauerte gar nicht lange, bis sein Interesse am örtlichen Temperaturverlauf erlahmte. Er nahm immer noch seine Pflichten wahr, verbrachte jedoch sehr viel Zeit draußen in der Garage oder unternahm, wenn das Wetter es erlaubte, lange einsame Märsche hinunter zum Strand, um Proben zu sammeln, wobei niemand wusste, wovon eigentlich.
Und auf Grund der strengen Wahrung der Privatsphäre, die nötig war, um zu verhindern, dass die Angehörigen einer in strenger Isolation lebenden Gruppe einander auf die Nerven gingen, wurde er von allen in Ruhe gelassen. Bei den wenigen Gelegenheiten, da über ihn gesprochen wurde, äußerte niemand den Verdacht, dass er gerade im Begriff schien zu entwickeln, was die Gehirnschlosser als Isolationssyndrom beschrieben, vom Team jedoch scherzhaft Glotzaugen-Trip genannt wurde. In seiner schlimmsten Form konnte jemand in Verbindung mit einem psychotischen Schub unter Wahnvorstellungen leiden. Ein paar Jahre zuvor hatte ein dänischer Wissenschaftler seine Zehen verloren, als er seine Forschungsstation in nacktem Zustand verlassen und auf der Nordseite der Halbinsel umhergeirrt war. Angeblich befand er sich noch immer in Kopenhagen in einer Nervenheilanstalt.
Nein, man kam darin überein, dass Andy nicht auf dem Glotzaugen-Trip war. Er war lediglich ein unfreundlicher Einzelgänger, dem die anderen nur zu gerne aus dem Weg gingen.





























