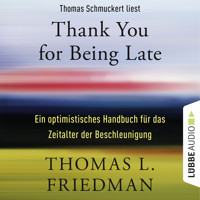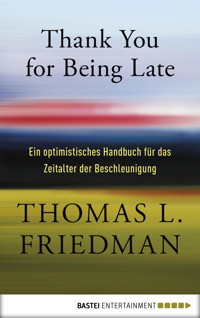
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zehn Jahre Smartphone haben eine neue Ära eingeläutet: Alles verändert sich, und zwar rasend schnell. Das schwindelerregende Tempo der Neuerungen löst bei manch einem ein Gefühl der Unsicherheit und Skepsis aus. Thomas L. Friedman lädt seine Leser ein, einen Moment innezuhalten und die Triebfedern der radikalen Umwälzungen zu betrachten: Technologie, Klimawandel und Vernetzung. Mit seinem neuen Buch bietet er optimistisch und gut verständlich Orientierung für unsere Zeit und zeigt, was eine erfolgreiche Zukunft möglich macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
INHALT
ÜBER DIESES BUCH
Zehn Jahre Smartphone haben eine neue Ära eingeläutet: Alles verändert sich, und zwar rasend schnell. Das schwindelerregende Tempo der Neuerungen löst bei manch einem ein Gefühl der Unsicherheit und Skepsis aus. Thomas L. Friedman lädt seine Leser ein, einen Moment innezuhalten und die Triebfedern der radikalen Umwälzungen zu betrachten: Technologie, Klimawandel und Vernetzung. Mit seinem neuen Buch bietet er optimistisch und gut verständlich Orientierung für unsere Zeit und zeigt, was eine erfolgreiche Zukunft möglich macht.
ÜBER DEN AUTOR
DER SPIEGEL bezeichnete Thomas L. Friedman als den »wahrscheinlich [...] einflussreichste[n] Journalist[en] der Welt [...]«. Der US-Amerikaner schreibt seit mehr als zwanzig Jahren zweimal wöchentlich eine Kolumne für die NEW YORK TIMES. Seine journalistischen Arbeiten wurden schon dreifach mit dem renommierten Pulitzer-Preis bedacht und auch seine Bücher erfreuen sich großer Erfolge. Bisher sind sechs Titel erschienen, von denen insbesondere zwei auch in Deutschland sehr erfolgreich waren: »Die Welt ist flach« und »Was zu tun ist« (beide bei Suhrkamp erschienen), schafften es beide auf die Bestsellerliste. In den USA gilt Friedman geradezu als Marke auf dem Sachbuch-Markt. Dies spiegelt sich sehr schön in der Covergestaltung der Originalausgaben seines neuen Buches wieder: hier darf sein Name mindestens genauso groß wie der Titel erscheinen. Zu seinen inhaltlichen Schwerpunkten zählen Globalisierung, gesellschaftliche Auswirkungen von Informations- und Telekommunikationstechnologien, Umweltschutz und Nahost-Politik. Sein neues Werk bringt all diese Themen zusammen.
THOMAS L. FRIEDMAN
Thank You for Being Late
Ein optimistisches Handbuch für dasZeitalter der Beschleunigung
Aus dem amerikanischen Englischvon Dr. Jürgen Neubauer
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Thank You for Being Late. An Optimist’s Guide to Thriving in the Age of Accelerations«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2016 by Thomas L. Friedman
Published by Farrar, Straus and Giroux
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Matthias Auer, Bodmann-Ludwigshafen
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Unter Verwendung eines Motivs von © getty-images/Studio Parris Wakefield
Und der Gestaltung von Jonathan D. Lippincott
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-5443-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Dies ist mein siebtes und, wer weiß, vielleicht mein letztes Buch. Seit Von Beirut nach Jerusalem, das 1989 erschien, besaß ich das große Glück, dass mich eine Gruppe von Freunden auf meinem Weg begleitet hat, die ihr Wissen mit mir teilten und auf vielfältige Weise meine Arbeit förderten. Über viele Jahre, Artikel und Bücher hinweg haben sie mir großzügig geholfen, mein Denken zu entwickeln. Deshalb möchte ich ihnen dieses Buch widmen: Nahum Barnea, Stephen P. Cohen, Larry Diamond, John Doerr, Yaron Ezrahi, Jonathan Galassi, Ken Greer, Hal Harvey, Andy Karsner, Amory Lovins, Glenn Prickett, Michael Mandelbaum, Craig Mundie, Michael Sandel und Dov Seidman. Ihre intellektuelle Feuerkraft ist beeindruckend, ihre Großzügigkeit außergewöhnlich und ihre Freundschaft ein Segen.
TEIL 1
NACHDENKEN
Kapitel 1
DANKE, DASS SIE ZU SPÄT KOMMEN
Jeder wird aus anderen Gründen Journalist, und viele von denen, die den Beruf ergreifen, haben idealistische Motive. Es gibt investigative und Gonzo-Journalisten, Nachrichten-Reporter und Welterklärer. Ich habe mich immer zu Letzteren gezählt und bin Journalist geworden, weil ich komplexe Zusammenhänge in eine einfache Sprache übersetzen wollte.
Es ist mir eine große Befriedigung, komplizierte Sachverhalte so aufzuschlüsseln, dass ich sie selbst verstehe und anderen verständlich machen kann – egal, ob es um den Nahen Osten, die Umwelt, die Globalisierung oder Politik geht. Demokratie kann nur funktionieren, wenn die Wähler wissen, wie die Welt funktioniert, denn nur so können sie intelligente politische Entscheidungen treffen. Und nur so sind sie gegen Demagogen, Ideologen und Verschwörungstheoretiker gefeit, die sie im besten Fall verwirren und im schlimmsten bewusst in die Irre führen. Während des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfs des Jahres 2016 fühlte ich mich oft an die Worte von Marie Curie erinnert: »Man muss vor nichts im Leben Angst haben, man muss es nur verstehen. Die Zeit ist gekommen, um mehr zu verstehen und weniger Angst zu haben.«
Es ist allerdings kein Wunder, dass sich heute so viele Menschen desorientiert und verunsichert fühlen. In diesem Buch zeige ich, warum wir heute an einem Wendepunkt stehen, wie ihn die Menschheit nicht mehr erlebt hat, seit der Mainzer Kaufmannssohn Johannes Gutenberg den Buchdruck erfand und damit der Renaissance und der Reformation den Weg bereitete. Die drei mächtigsten Kräfte auf unserem Planeten – Technik, Globalisierung und Klimawandel – nehmen heute gleichzeitig rasant an Fahrt auf. Daher befinden sich gegenwärtig Gesellschaft, Arbeit und Politik im Umbruch und müssen neu gestaltet werden.
Wenn sich so viele Lebensbereiche gleichzeitig so radikal verändern, wie wir dies heute erleben, dann ist es kein Wunder, dass sich so viele Menschen überfordert fühlen. Wie John E. Kelly III., Senior Vice President der IBM-Forschungsabteilung für künstliche Intelligenz, sagt: »Wir Menschen leben in einer linearen Welt, für uns sind Entfernung, Zeit und Geschwindigkeit lineare Größen. Die Technik entwickelt sich jedoch exponentiell. Aber exponentielle Veränderungen erleben wir im Alltag nur als Autofahrer, wenn wir Gas geben oder scharf bremsen. In solchen Momenten fühlen wir uns dann verunsichert und unwohl.« Natürlich kann man es auch als berauschend empfinden, in sechs Sekunden von null auf hundert zu beschleunigen. Aber eine lange Fahrt würden wir nicht so machen wollen. Doch genau auf so einer Reise befinden wir uns gerade, so Kelly: »Viele Menschen haben heute das Gefühl, in einem dauernden Zustand der Beschleunigung zu leben.«
In Zeiten wie diesen ist es notwendig, innezuhalten und nachzudenken, statt in Panik zu verfallen und die Flucht zu ergreifen. Das ist kein Luxus und auch keine Ablenkung, sondern es hilft uns, die Welt besser zu verstehen und besser mit ihr umzugehen.
Warum? »Wenn man bei einer Maschine die Pause-Taste drückt, hält sie an. Aber wenn man bei uns Menschen die Pause-Taste drückt, dann fangen wir an«, meint mein Freund Dov Seidman, Gründer und CEO des internationalen Beratungsunternehmens LRN. »Wir denken nach, wir überprüfen unsere Annahmen, wir loten unsere Möglichkeiten neu aus, und vor allem treten wir in Kontakt mit unseren tiefsten Überzeugungen. In diesen Momenten können wir anfangen, uns einen neuen und besseren Weg vorzustellen. Allerdings kommt es darauf an, was wir mit dieser Pause anfangen. Keiner hat es besser gesagt als Ralph Waldo Emerson: ›In jedem Moment der Stille höre ich den Ruf.‹«
Und genau das möchte ich mit diesem Buch: Die Pause-Taste drücken, dem Karussell entkommen, auf dem ich zweimal die Woche als Kommentator der New York Times jahrelang mitgefahren bin, und intensiver über diesen historischen Moment nachdenken, der meiner Ansicht nach ein radikaler Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit ist.
Ich erinnere mich nicht mehr genau, wann ich gegenüber dieser Hetze meine innere Unabhängigkeit erklärt habe, aber es muss irgendwann Anfang 2015 gewesen sein. Es war ein zufälliger Moment. Zum Frühstück gehe ich gern in ein Café in der Nähe des Washingtoner Büros der New York Times, um mich dort mit Freunden zu treffen oder Politiker, Experten oder Diplomaten zu interviewen. Auf diese Weise nutze ich schon das Frühstück als Lernchance und verschwende meine Zeit nicht, indem ich alleine esse. Aber weil der morgendliche Berufsverkehr in Washington immer ein Glücksspiel ist, kommen meine Gesprächspartner oft zehn, fünfzehn oder zwanzig Minuten später als verabredet. Das ist ihnen meist peinlich, und sie stammeln Entschuldigungen wie: »Die U-Bahn ist stecken geblieben«, »Die Autobahn war dicht«, »Mein Wecker hat nicht geklingelt« oder »Meine Tochter ist krank« …
Bei einer dieser Gelegenheiten wurde mir klar, dass mir die Verspätung meiner Frühstücksgäste nicht das Geringste ausmacht. Also sagte ich: »Kein Problem. Bitte, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Im Gegenteil, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie zu spät kommen!«
Diese Verspätung habe mir Zeit für mich selbst geschenkt, erklärte ich. Ich hatte ein paar Minuten »gefunden«, um einfach nur dazusitzen und nachzudenken. Ich hatte dem Pärchen am Nebentisch gelauscht (faszinierend!) und die Leute in der Lobby beobachtet (urkomisch!). Und vor allem hatte ich in dieser Pause einige Gedanken verknüpft, mit denen ich mich schon seit Tagen herumschlug. Deswegen wollte ich gar keine Entschuldigung, im Gegenteil: »Danke, dass Sie zu spät gekommen sind!«
Beim ersten Mal ist mir diese Antwort noch einfach so herausgerutscht, ohne dass ich groß darüber nachgedacht hätte. Aber nach einem weiteren Erlebnis dieser Art bemerkte ich, wie gut es sich anfühlte, diese wenigen Augenblicke freier, unverplanter Zeit zu haben – und zwar nicht nur für mich! Mir war auch klar, warum. Wie so viele andere fühlte ich mich allmählich überfordert und erschöpft vom rasanten Tempo der Veränderungen. Ich musste mir (und meinen Gästen) die Erlaubnis geben, langsam zu machen und mit meinen Gedanken allein zu sein, ohne sie tweeten, fotografieren oder mit irgendjemandem teilen zu müssen. Wenn ich meinen Gästen versicherte, dass ihre Verspätung kein Problem sei, dann sahen sie mich zunächst fragend an, bis ihnen ein Licht aufging, und sie erwiderten: »Ja, ich weiß, was Sie meinen … ›Danke, dass Sie zu spät gekommen sind.‹ Aber gern doch!«
In seinem ernüchternden Buch Sabbath beobachtete der Geistliche und Buchautor Wayne Muller, wie oft jemand zu ihm sagt: »Ich habe so viel zu tun.« Muller schreibt: »Das sagen wir mit großem Stolz, als sei unsere Erschöpfung eine Trophäe und unsere Belastbarkeit der Ausweis wahrer Charakterstärke … Keine Zeit zu haben für unsere Freunde und Familie, keine Zeit zu haben für den Sonnenuntergang (oder auch nur zu wissen, ob die Sonne schon untergegangen ist), ohne einen einzigen achtsamen Atemzug von Aufgabe zu Aufgaben zu hetzen, das ist zum Inbegriff eines erfolgreichen Lebens geworden.«
Ich würde lieber lernen innezuhalten. Wie der Schriftsteller Leon Wieseltier einmal zu mir sagte: Technokraten wollen uns einreden, Geduld und Achtsamkeit seien nur deshalb zu Tugenden erhoben worden, weil wir früher gar keine andere Wahl hatten: Wir mussten länger auf Dinge warten, weil unser Modem zu langsam war, weil wir keine schnelle Internetverbindung hatten oder weil wir noch nicht das neueste iPhone besaßen. »Und weil die Technik das Warten abgeschafft hat, behaupten sie, dass wir keine Geduld mehr brauchen«, meinte Wieseltier. »Aber früher wusste man, dass in der Geduld die Weisheit liegt. Geduld ist nicht nur die Abwesenheit von Geschwindigkeit, sondern bedeutet die Möglichkeit zur Reflexion.« Wir bringen heute mehr Information und Wissen hervor denn je, »aber Wissen taugt nur etwas, wenn wir darüber nachdenken können«.
Und nicht nur unser Wissen profitiert von unseren Momenten des Innehaltens. Wir sind auch eher imstande, Vertrauen zu fassen und »tiefere Beziehungen zu anderen Menschen zu knüpfen«, ergänzt Seidman. »Unsere Fähigkeit, echte Beziehungen herzustellen – zu lieben, zu verstehen, zu hoffen, zu vertrauen und auf Grundlage gemeinsamer Werte in Gemeinschaft zu leben –, ist vielleicht die menschlichste aller Fähigkeiten. Sie ist das, was uns am stärksten von Tieren und Maschinen unterscheidet. Nicht alles wird besser, wenn es schneller wird, und nicht alles lässt sich beschleunigen. Ich bin dazu geschaffen, mir Gedanken über meine Enkel zu machen. Ich bin kein Gepard.«
Daher ist es vermutlich kein Zufall, dass der zündende Funke für dieses Buch ein Moment des Innehaltens war – eine Zufallsbegegnung ausgerechnet in einem Parkhaus und meine Entscheidung, nicht wie üblich davonzurasen, sondern mich auf einen fremden Menschen einzulassen, der mich mit einer ungewöhnlichen Bitte ansprach.
Der Parkhauskassierer
Es war Anfang Oktober 2014. Ich war mit dem Auto von meinem Haus im Vorort Bethesda ins Stadtzentrum von Washington D. C. gefahren und hatte in der öffentlichen Tiefgarage unter dem Hyatt Regency Hotel geparkt, wo ich mich mit einem Freund zum Frühstück verabredet hatte. Auf dem Rückweg hielt ich vor der Schranke und reichte dem Kassierer den Parkschein. Ehe der Mann das Ticket ansah, blickte er mich an.
»Ich kenne Sie«, sagte der grau melierte Herr mit fremdländischem Akzent und lächelte mich freundlich an.
»Freut mich«, erwiderte ich kurz angebunden.
»Ich lese Ihre Kommentarspalte«, fuhr er fort.
»Freut mich«, wiederholte ich ungeduldig.
»Ich bin nicht immer Ihrer Meinung«, fügte er hinzu.
»Das ist gut so«, antwortete ich. »Das heißt, dass Sie immer nachprüfen.«
Nachdem wir noch ein paar Nettigkeiten ausgetauscht hatten, gab er mir mein Wechselgeld, und auf dem Weg nach draußen dachte ich: »Ist doch wirklich schön zu wissen, dass der Mann im Parkhaus meine Artikel liest.«
In diesem Parkhaus stelle ich etwa einmal pro Woche mein Auto ab, um mit der U-Bahn in die Washingtoner Innenstadt zu fahren. Eine gute Woche später war es wieder so weit. Als ich auf dem Nachhauseweg aus der Tiefgarage fuhr, saß derselbe Mann an der Schranke.
Ehe er mir das Wechselgeld reichte, sagte er: »Mr. Friedman, ich bin auch Autor. Ich habe meinen eigenen Blog. Wollen Sie sich den mal ansehen?«
»Und wie finde ich ihn?«, fragte ich. Er kritzelte eine Adresse auf ein Zettelchen und reichte es mir zusammen mit dem Wechselgeld. »Odanabi.com« stand da.
Ich war neugierig und wollte zumindest einen kurzen Blick darauf werfen. Aber auf dem Nachhauseweg wurde ich nachdenklich. »Unglaublich! Der Parkhauswärter ist mein Konkurrent! Er hat seinen eigenen Blog! Er ist Journalist! Was geht hier vor?«
Zu Hause sah ich mir seine Website an. Die Artikel waren auf Englisch und beschäftigten sich mit der Politik und Wirtschaft seines Heimatlandes Äthiopien. Unter anderem ging es um die Beziehungen zwischen den verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppierungen, die undemokratische Politik der Regierung und die Aktivitäten der Weltbank in Afrika. Der Blog war gut gemacht, und der Autor entpuppte sich als überzeugter Demokrat. Sein Englisch war gut, wenngleich nicht perfekt. Aber da ich mich nur am Rande für Äthiopien interessierte, verbrachte ich nicht allzu viel Zeit auf der Seite.
Im Laufe der nächsten Woche musste ich allerdings immer wieder an den Mann denken. Wie hatte er zu bloggen begonnen? Was sagte das über unsere Welt aus, dass dieser offensichtlich gebildete Mensch tagsüber in einem Parkhaus arbeitete und nachts mit seinem Blog an einer weltumspannenden Debatte teilnahm und die Menschheit über Dinge informierte, die ihn bewegten?
Ich wollte innehalten und mehr über diesen Mann in Erfahrung bringen. Da ich seine E-Mail-Adresse nicht hatte, beschloss ich, jeden Tag mit der U-Bahn ins Büro zu fahren und mein Auto vorher in der Tiefgarage abzustellen, in der Hoffnung, dass ich ihn so wiedersehen würde.
Während der ersten Tage hatte ich Pech, doch eines frühen Morgens sah ich ihn an der Schranke sitzen. Ich stieg aus und winkte ihm zu.
»Hey, ich bin’s, Mr. Friedman!«, rief ich ihm zu. »Könnten Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben? Ich würde mich gern mit Ihnen unterhalten!«
Er kramte einen Zettel heraus und notierte seine Adresse. Sein Name war Ayele Z. Bojia. Noch am selben Abend schrieb ich ihm eine Mail und bat ihn, mir ein wenig über sich und seinen Blog zu erzählen. Ich schrieb ihm, ich plane ein Buch über den Journalismus im 21. Jahrhundert und wolle wissen, wie andere Menschen zum Bloggen oder Schreiben gekommen seien.
Am 1. November 2014 antwortete er mir. »Mit dem Bloggen habe ich angefangen, als ich meinen ersten Artikel auf Odanabi.com geschrieben habe … Mein Beweggrund ist, dass es in meiner Heimat Äthiopien eine Menge Themen gibt, die mich beschäftigen und zu denen ich gern meine persönliche Sicht darstellen möchte. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich nicht sofort auf Ihre Mail antworten kann, weil ich während der Arbeit schreiben muss. Ayele.«
Am 3. November schrieb ich ihm eine weitere Nachricht: »Was haben Sie in Äthiopien gemacht, ehe Sie hierhergekommen sind? Welche Themen interessieren Sie besonders? Keine Eile. Danke, Tom.«
Noch am selben Tag schrieb er mir zurück: »Es freut mich, dass das Interesse gegenseitig ist. Sie wollen wissen, was mich am meisten bewegt, und ich will wissen, wie ich mit meinen Themen am besten mein Publikum und eine breitere Öffentlichkeit erreichen kann.«
Worauf ich postwendend antwortete: »Ayele, wir sollten uns treffen!« Ich würde ihm verraten, wie man einen Meinungsartikel schrieb, und er würde mir seine Geschichte erzählen. Er stimmte sofort zu, und wir verabredeten uns. Zwei Wochen später kehrte ich von meinem Büro im Zentrum der Hauptstadt unweit des Weißen Hauses zurück, Bojia kam von seinem Parkhaus herauf, und wir trafen uns in einem Café der Kette Peet’s Coffee & Tea in der Nähe der Tiefgarage. An einem Tischchen am Fenster erzählten wir uns, wie wir Journalisten geworden waren, während wir an der Köstlichkeit des Hauses nippten.
Bojia, der damals 63 Jahre alt war, hatte an der Haile-Selassie-Universität von Addis Abeba Wirtschaftswissenschaften studiert. Er ist orthodoxer Christ und Angehöriger der Oromo, der größten ethnischen Gruppe Äthiopiens mit eigener Sprache. Schon als Student sei er Oromo-Aktivist gewesen und für die Kultur und politischen Ziele seines Volkes im Zusammenhang eines demokratischen Äthiopiens eingetreten. Damit habe er allerdings den Zorn des Regimes auf sich gezogen, weshalb er 2004 ins Exil gehen musste.
Die äthiopische Politik werde von Extremen beherrscht, fügte Bojia hinzu: »Es gibt keine Mitte, die für Vernunft offen wäre.« Was ihn an den Vereinigten Staaten beeindruckte und was er nach Äthiopien bringen wollte, war, »dass die Menschen für ihre Rechte eintreten, aber dass sie sich auch die Meinung des anderen anhören«. (Vielleicht muss man aus einem sehr zerrissenen Land kommen und in einer Tiefgarage arbeiten, um die Vereinigten Staaten als Land zu sehen, in dem sich die Menschen über Gräben hinweg die Hand reichen. Aber sein Optimismus gefiel mir.)
»Wissen Sie, wie viele Leser Sie haben?«, fragte ich.
»Das schwankt und hängt vom Thema ab, aber ich habe meine Stammleserschaft«, sagte er. Seine Besucherstatistiken zeigten, dass sein Publikum aus etwa dreißig Ländern kam. Dann fügte er hinzu: »Wenn Sie mir irgendwie helfen könnten, meine Seite zu verbessern, wäre ich Ihnen sehr dankbar.« Der Job in der Tiefgarage diene nur dazu, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. – »Meine Energie gehört meiner Website.«
Ich versprach ihm zu helfen, so gut ich konnte. Wer konnte schon einem Parkhauswächter widerstehen, der seine Besucherstatistiken kannte? Aber ich musste ihn doch fragen: »Wie ist das für Sie, tagsüber im Parkhaus zu arbeiten und nachts als Blog-Aktivist Leser in dreißig Ländern zu erreichen?«
»Ich habe das Gefühl, ein bisschen Einfluss zu besitzen«, antwortete er, ohne zu zögern. »Ich habe viel Zeit verschwendet, weil ich meine Artikel erst an andere Websites verschickt habe. Wenn ich mich gleich auf meinen Blog konzentriert hätte, dann hätte ich heute ein größeres Publikum. Das Schreiben verschafft mir große Befriedigung. Ich tue etwas Positives, das meinem Land hilft.«
Etwas erhellen und bewegen
In den Wochen darauf schrieb ich Bojia zwei E-Mails, in denen ich ihm erklärte, wie ich beim Verfassen einer Kolumne vorging. Danach trafen wir uns noch einmal im Café, um sicherzustellen, dass er verstand, worauf ich hinauswollte. Keine Ahnung, wie viel ihm das gebracht hat, aber ich habe eine ganze Menge gelernt – viel mehr, als ich erwartete.
Schon die Begegnung mit Bojias Welt öffnete mir die Augen. Noch zehn Jahre zuvor hätten wir beide kaum etwas gemeinsam gehabt, und jetzt waren wir so etwas wie Kollegen. Beide versuchten wir, unseren Lesern Themen zu vermitteln, die uns am Herzen lagen, an einer weltumspannenden Debatte teilzunehmen und die Welt ein wenig in unserem Sinne zu beeinflussen. Außerdem waren wir Teil einer umfassenderen Entwicklung. »Nie zuvor waren mehr Menschen in der Lage, Geschichte zu machen, über die Geschichte zu berichten oder die Geschichte zu verstärken«, meint Dov Seidman. »Um Geschichte zu machen, brauchte man früher eine Armee, und um darüber zu berichten eine Zeitung oder ein Fernsehstudio. Heute kann jeder eine Bewegung anstoßen. Heute kann man mit einem einfachen Tastendruck Geschichte machen.«
Und genau das tat Bojia. Künstler und Schriftsteller mussten schon immer Nebenbeschäftigungen nachgehen. Neu ist, wie viele Menschen sich heute als Künstler und Schriftsteller betätigen können, wie viele Leute sie mit ihren Arbeiten ansprechen bzw. wie schnell sie die Weltöffentlichkeit erreichen können, wenn sie etwas zu sagen haben, und wie wenig das kostet.
Um mein Versprechen einzuhalten, musste ich mir mehr Gedanken über mein Handwerk machen als je zuvor. Ich schreibe seit gut zwanzig Jahren Kommentare und war zuvor siebzehn Jahre lang Reporter gewesen, doch unsere Begegnung zwang mich, innezuhalten und den Unterschied zwischen einem Bericht und einem Meinungsbeitrag in Worte zu fassen und zu erläutern, wie Letzterer funktioniert.
In meinen beiden Mails erklärte ich Bojia, dass es keine Formel für einen Kommentar gebe, dass man es nicht in einem Kurs lernen könne und dass jeder Autor anders vorgehe. Trotzdem könne ich ihm ein paar allgemeine Hinweise geben. Für einen Reporter geht es darum, Tatsachen zutage zu fördern, Sichtbares zu erklären und Verborgenes zu enthüllen. Das jeweilige Ergebnis ist nicht absehbar. Die Aufgabe des Reporters besteht darin, furchtlos und unparteiisch zu informieren. Eine klassische Nachrichtenmeldung kann gewaltigen Einfluss haben, doch das hängt immer damit zusammen, inwieweit sie informiert, erklärt oder etwas aufdeckt.
Anders Meinungsartikel. Als Kommentator oder Blogger wie Bojia will man nicht nur informieren, sondern beeinflussen und Reaktionen provozieren. Man will eine bestimmte Sichtweise so überzeugend darstellen, dass die Leser ein Thema anders und neu wahrnehmen.
»Deshalb geht es mir in meinen Kommentaren immer darum, etwas zu erhellen oder zu bewegen«, erklärte ich Bojia. Jeder Meinungsbeitrag und jeder Blogartikel muss den Lesern entweder ein Licht aufstecken und ein Thema neu ausleuchten, oder er muss Gefühle wecken und eine Verhaltensänderung bewirken. Idealerweise leistet er beides.
Aber wie schafft man das als Autor? Woher kommen die Meinungen? Hier würde vermutlich jeder eine andere Antwort geben. Meine Kurzfassung wäre, dass die Idee für einen Meinungsartikel tausend Ursachen haben kann: eine überraschende Schlagzeile, die einfache Geste eines wildfremden Menschen, die bewegende Rede einer Führungspersönlichkeit, die naive Frage eines Kindes, die Grausamkeit eines Amokläufers, das bewegende Schicksal eines Flüchtlings. Alles kann zum Stoff werden, mit dem sich Leser aufklären oder bewegen lassen.
Allgemeiner gesprochen ist das Verfassen eines Kommentars ein Akt der Alchemie, denn man muss ihn selbst aus dem Hut zaubern. Anders als eine Nachricht schreibt sich ein Meinungsbeitrag nicht von selbst – er muss von Grund auf erschaffen werden.
Zu diesem alchemistischen Akt gehören drei Zutaten. Erstens die Werte, Prioritäten und Zielsetzungen des Autors. Zweitens eine persönliche Erklärung dafür, wie die großen Kräfte, das enorme Räderwerk der Welt, die Ereignisse prägen. Und drittens eine Vorstellung davon, wie Menschen und die Kultur allgemein reagieren (oder nicht), wenn diese großen Kräfte auf sie wirken.
Wenn ich von den Werten, Prioritäten und Zielsetzungen des Autors spreche, dann meine ich damit die Dinge, an denen mir am meisten gelegen ist und die ich gern verwirklicht sehen würde. Diese Werte helfen bei der Auswahl von Themen, die eine Meinung wert sind, und sie prägen diese Meinung. Für einen Kommentator ist es vollkommen in Ordnung, seine Meinung zu ändern – aber man muss eine haben, man kann nicht für alles und nichts stehen oder nur für wohlfeile und unangreifbare Positionen. Der Verfasser von Meinungsbeiträgen muss von einem Wertesystem ausgehen, aus dem sich ergibt, was zu unterstützen und was abzulehnen ist. Sind Sie Kapitalist, Kommunist, Anarchist, Keynesianer, Konservativer, Liberaler, Neoliberaler oder Marxist?
Mit dem enormen Räderwerk der Welt meine ich das, was ich gern »die Maschine« nenne (mit einer Verbeugung vor dem legendären Hedgefund-Manager Ray Dalio, der die Wirtschaft als »Maschine« bezeichnet). Autoren von Meinungsartikeln brauchen eine umfassende Arbeitshypothese, die erklärt, wie diese Maschine funktioniert, denn ihr Ziel besteht ja darin, diese Maschine im Sinne ihrer eigenen Werte zu beeinflussen. Wer keine Theorie darüber hat, wie die Maschine funktioniert, bewegt sie entweder in eine Richtung, die gar nicht den eigenen Werten entspricht, oder er bewegt sie gar nicht.
Und wenn ich von Menschen und Kultur spreche, dann meine ich damit, wie verschiedene Menschen und Kulturen von der Maschine beeinflusst werden und wie sie mit ihren Reaktionen umgekehrt auf die Maschine zurückwirken. Letztlich geht es in Meinungsartikeln immer um Menschen und um die verrückten Dinge, die sie sagen, tun, hassen, lieben und erhoffen. Ich stütze mich in meinen Beiträgen gern auf Daten und Fakten, aber Sie sollten eines nie vergessen: Auch ein Gespräch mit einem anderen Menschen ist eine Tatsache. Die meisten Leser finden in der Regel Meinungsbeiträge, in denen es um Menschen geht und nicht um Zahlen. Vergessen Sie nicht, dass der größte Bestseller aller Zeiten eine Sammlung von Geschichten über Menschen ist: die Bibel.
Ich erklärte Bojia, die wirkungsvollsten Meinungsartikel entstünden aus der richtigen Mischung dieser drei Zutaten. Ohne Werte, die darüber informieren, für was man steht, bleiben sie leblos. Dov Seidman erinnert mich gern an einen Spruch aus dem Talmud: »Worte, die aus dem Herzen kommen, berühren andere Herzen.« Und Worte, die nicht aus dem Herzen kommen, berühren niemanden. Um das Mitgefühl der Leser zu wecken, muss man selbst mitfühlen. Aber auch ohne Position gegenüber den größten Kräften, die unsere Welt prägen, bleibt ein Meinungsartikel wirkungslos. Natürlich ist unsere Sicht der Maschine nicht unfehlbar und in Stein gemeißelt. Sie bleibt immer im Fluss und verändert sich durch neue Informationen und mit den Veränderungen der Welt. Aber es ist schwer, andere Menschen von etwas zu überzeugen, wenn man ihnen keinen überzeugenden Zusammenhang präsentiert – warum diese Handlung jenes Ergebnis zeitigt, weil die Maschine so und so funktioniert. Und schließlich funktioniert ein Meinungsartikel nur, wenn er von echten Menschen handelt und von ihnen inspiriert ist. Er darf kein Plädoyer für abstrakte Prinzipien sein.
Ihre Werte, Ihre Sicht der Maschine und Ihr Verständnis ihres Zusammenspiels mit Menschen und Kulturen ergeben zusammen eine Weltsicht, in deren Horizont Sie zu allen möglichen Situationen Stellung beziehen können. So wie Datenexperten Algorithmen benötigen, um hinter den unstrukturierten Daten die entscheidenden Muster zu erkennen, benötigt ein Kommentator eine Weltsicht, um etwas zu erhellen oder zu bewegen.
Aber um diese Weltsicht frisch zu halten, muss man fortwährend dazulernen, meinte ich zu Bojia. – Heute mehr denn je. Wer in dieser sich ständig verändernden Welt auf Formeln und Schablonen zurückgreift, ist verloren. Vielmehr ist eine grenzenlose Neugierde nötig sowie die Bereitschaft, mit Blick auf die verschiedensten Disziplinen nach Erklärungen für das Funktionieren der Maschine zu suchen. Lin Wells von der National Defense University in Washington, D. C. bezeichnet diesen strategischen Ansatz, der auch diesem Buch zugrunde liegt, als »dezidiert gesamtheitlich und allumfassend«. Das bedeutet, bei der Analyse so viele relevante Menschen, Prozesse, Fachgebiete, Organisationen und Techniken wie möglich einzubeziehen – Faktoren, die oft getrennt voneinander betrachtet oder gar nicht mit einbezogen werden. So lassen sich zum Beispiel die Veränderungen der heutigen Weltpolitik nur verstehen, wenn man die Entwicklungen in der Computertechnologie, der Telekommunikation, der Umwelt, der Globalisierung und der Demografie zusammennimmt. Nur so erhält man ein umfassendes Bild.
Dies sind die wesentlichen Lektionen, die ich Bojia in meinen Mails und unseren Gesprächen vermittelte. Aber ich muss Ihnen etwas gestehen, das ich auch ihm am Ende unseres letzten Treffens gestand: Ich hatte mir noch nie so eingehende Gedanken über mein Handwerk und einen guten Meinungsartikel gemacht, ehe unsere Zufallsbegegnung mir den Anstoß dazu gab. Wenn ich nicht innegehalten und mit ihm gesprochen hätte, dann hätte ich mir nie Gedanken darüber gemacht, mit welchem Handwerkszeug ich mir in dieser Zeit der rasanten Veränderungen die Welt erkläre.
Nach unseren Begegnungen ratterte es in meinem Gehirn. Ich stellte mir dieselben Fragen, die ich auch Bojia gestellt hatte: Was sind meine Werte? Woher kommen sie? Wie funktioniert die Maschine heute? Was weiß ich über die Auswirkungen der Maschine auf verschiedene Menschen und Kulturen und über deren Reaktionen?
Dann habe ich innegehalten, um über diese Fragen Rechenschaft abzulegen. Meine Antwort ist der Rest dieses Buches.
Teil 2 handelt von der Maschine, also von den Kräften, die meiner Ansicht nach heute die Welt bewegen. So viel vorab: Die Maschine wird von der Technologie, der Globalisierung und dem Klimawandel angetrieben, die ineinandergreifen und gleichzeitig an Fahrt aufnehmen.
Und in Teil 3 geht es um die Frage, wie diese beschleunigenden Kräfte auf Menschen und Kulturen wirken. Also darum, wie sie Arbeit, Politik, ethische Entscheidungen und Gemeinschaften verändern, bis hin zu der Kleinstadt in Minnesota, in der ich aufgewachsen bin und die mein Wertesystem geprägt hat.
Dieses Buch ist also nichts anderes als ein langer Kommentar über die Welt von heute. Es will die entscheidenden Kräfte benennen, die heute den Umbruch in aller Welt antreiben. Es will erklären, wie sich dieser Umbruch auf Menschen und Kulturen auswirkt. Und es will die Werte und Reaktionen benennen, mit deren Hilfe diese Kräfte gewissermaßen so gemanagt werden können, dass sie meiner Ansicht nach den meisten Menschen an den meisten Orten am meisten nutzen und am wenigsten schaden.
Man weiß nie, was passiert, wenn man sich die Zeit nimmt, um mit einem anderen Menschen zu sprechen. Bojia bekam einen Anstoß für seinen Blog, und ich bekam einen Anstoß zu diesem Buch. Verstehen Sie es als optimistische Anleitung zum Erfolg und Widerstand in diesem Zeitalter der Beschleunigung, vermutlich einem der großen Wendepunkte in der Geschichte der Menschheit.
Als Journalist staune ich immer wieder, dass man beim zweiten Blick auf eine Geschichte oder einen historischen Moment oft Dinge entdeckt, die man auf den ersten Blick vollkommen übersehen hat. Als ich mit der Arbeit an diesem Buch begann, wurde mir sofort klar, dass die technische Revolution, die die Maschine heute antreibt, in ein Jahr fällt, in dem auf den ersten Blick recht wenig los gewesen zu sein schien – das Jahr 2007.
Was bitte schön soll denn schon 2007 passiert sein?
TEIL 2
BESCHLEUNIGEN
Kapitel 2
WAS ZUM TEUFEL IST 2007 PASSIERT?
John Doerr, der legendäre Kapitalgeber von Netscape, Google und Amazon, erinnert sich nicht mehr an das genaue Datum. Er weiß nur noch, dass es kurz vor dem 9. Januar 2007 war, dem Tag, an dem Steve Jobs auf der Bühne des Moscone Center in San Francisco offiziell verkündete, dass Apple das Mobiltelefon neu erfunden habe. Doch Doerr wird nie den Moment vergessen, in dem er dieses Telefon zum ersten Mal sah. Mit seinem Freund und Nachbarn Jobs saß er auf der Tribüne des Sportplatzes einer Schule ihres Wohnorts Palo Alto und sah sich ein Fußballspiel an, an dem auch Jobs’ Tochter teilnahm. Das Spiel zog sich in die Länge, als Jobs plötzlich sagte, er wolle Doerr etwas zeigen.
»Steve hat in die Hosentasche gegriffen und sein erstes iPhone herausgezogen«, erzählt mir Doerr. »Dann hat er zu mir gesagt: ›Dieses Gerät hätte fast das ganze Unternehmen zerstört. Es war das Schwierigste, was wir je gemacht haben.‹ Ich habe ihn gefragt, was daran so besonders sei. Er hat mir erklärt, dass es fünf verschiedene Frequenzen unterstütze, so und so viel Rechenleistung, Arbeitsspeicher und Flashspeicher habe. Ich hatte noch nie gehört, dass jemand so viel Speicher in so einem kleinen Gerät unterbrachte. Außerdem besaß es keine Knöpfe, alles würde mit Software gesteuert. Er hat gesagt: ›Dieses Gerät ist der beste Mediaplayer, das beste Telefon und der beste Internetzugang – alles in einem.‹«
Doerr bot sofort an, einen Fonds aufzulegen, um die Entwicklung von Anwendungen durch Drittanbieter zu fördern, doch daran war Jobs zu diesem Zeitpunkt noch nicht interessiert. Er wollte nicht, dass andere ihre Finger in sein elegantes Telefon steckten. Apple würde sämtliche Anwendungen selbst schreiben. Ein Jahr später änderte er allerdings seine Meinung; der Fonds wurde aufgelegt, und eine ganze App-Branche schoss aus dem Boden. Der Moment, in dem Steve Jobs das iPhone präsentierte, erwies sich als entscheidender Wendepunkt in der Geschichte der Technik – und der Welt. Nicht nur beim Wein gibt es ausgezeichnete Jahrgänge, sondern auch in der Technik, und 2007 war definitiv ein ganz besonderer.
Aber nicht nur weil das iPhone auf den Markt kam – um das Jahr 2007 herum trat auch noch eine ganze Reihe weiterer Unternehmen auf den Plan. Sie und ihre Erfindungen veränderten die Art und Weise, wie Menschen und Maschinen kommunizieren, kooperieren, gestalten und denken. Ein Unternehmen namens Hadoop sorgte dafür, dass 2007 die Speicherkapazität explodierte und »Big Data« für alle möglich wurde. Im selben Jahr wurde GitHub gegründet, das mit seiner gleichnamigen Open-Source-Plattform ganz neue Möglichkeiten der kollektiven Software-Entwicklung eröffnete und dazu beitrug, dass Software »die Welt frisst«, wie Netscape-Gründer Marc Andreessen es einmal ausdrückte. Am 26. September 2006 wurde Facebook, das bis dahin nur Nutzern an Schulen und Universitäten offenstand, für alle zugänglich und trat seinen weltweiten Siegeszug an. Im Jahr 2007 wurde ein Mikroblog-Anbieter namens Twitter, der Teil eines größeren Start-ups gewesen war, als eigene Plattform geöffnet. Im selben Jahr wurde auch die Petitionsplattform change.org gegründet.
Ebenfalls im Jahr 2007 brachte Google sein offenes Betriebssystem Android auf den Markt, das zur weltweiten Verbreitung von Smartphones beitrug und eine Alternative zu Apples iOS darstellte. Im selben Jahr investierte die Telefongesellschaft AT&T, in den Vereinigten Staaten Exklusivanbieter des iPhones, in den Ausbau ihres Mobilfunknetzwerks; nach Angaben des Unternehmens wuchs das Datenaufkommen in seinem Netz zwischen Januar 2007 und Dezember 2014 um mehr als 100000 Prozent. (Ja, Sie haben richtig gelesen.)
Im selben Jahr brachte Amazon sein Lesegerät Kindle auf den Markt und stieß die E-Book-Revolution an. In einer Wohnung in San Francisco wurde Airbnb erfunden. Und Ende 2006 erreichte das Internet die kritische Schwelle von einer Milliarde Nutzern weltweit.
Als wäre das noch nicht genug, begannen im Jahr 2007 David Ferrucci und sein Team in einem IBM-Forschungszentrum nördlich von New York City mit der Entwicklung eines intelligenten Computerprogramms namens Watson, eines Systems mit dem Ziel, gesprochene Sprache verstehen und auf Fragen antworten zu können.
Ebenfalls 2007 baute Intel erstmals nicht auf Silizium basierende Halbleiter in seine Mikrochips ein. Das war ein wichtiger technischer Schritt: Damals ging die Sorge um, dass das Mooresche Gesetz, demzufolge Mikrochips etwa alle zwei Jahre ihre Leistung verdoppeln, seine Gültigkeit verlieren würde. Doch mit dieser Neuerung konnte die exponentielle Leistungssteigerung der Computer fortgesetzt werden. Am 27. Januar 2007 schrieb der für das Silicon Valley zuständige Reporter John Markoff in der New York Times: »Intel, der größte Mikrochip-Hersteller der Welt, hat den Grundbaustein des Informationszeitalters runderneuert und den Weg für eine neue Generation schnellerer und energieeffizienterer Prozessoren bereitet. Wissenschaftler des Unternehmens beschrieben diesen Schritt als bedeutendste Materialneuerung seit der Entwicklung des modernen integrierten Schaltkreises vor mehr als vier Jahrzehnten.«
Aus den genannten Gründen war das Jahr 2007 auch der »Beginn der Ökostrom-Revolution«, wie Andy Karsner es nannte, der zwischen 2006 und 2008 im Energieministerium der Vereinigten Staaten für erneuerbare Energien zuständig war. »Das Jahr 2007 war die Initialzündung für das exponentielle Wachstum bei Solarenergie, Wind, Biotreibstoff, LED-Beleuchtung, energieeffizienten Gebäuden und Elektroautos.«
Und schließlich begann 2007 auch die dramatische Verbilligung der DNA-Sequenzierung, weil die Biotech-Branche neue Verfahren entwickelte und dabei die neuen, leistungsfähigen Rechner zum Einsatz bringen konnte. Das führte zu einer Wende in der Gentechnik und zur »raschen Entwicklung von neuen Sequenzierungsverfahren, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben«, so die staatliche Internetseite Genome.gov. Die Sequenzierung des ersten menschlichen Genoms, die im Jahr 2001 vermeldet wurde, kostete noch 100 Millionen Dollar. Doch am 30. September 2015 berichtete Popular Science: »Gestern gab das Gentechnik-Unternehmen Veritas Genetics bekannt, dass ein Meilenstein erreicht sei: Teilnehmer eines begrenzten, aber stetig wachsenden Programms können ihr gesamtes Genom für nur 1000 Dollar sequenzieren lassen.«
Wie die folgenden Grafiken zeigen, markiert das Jahr 2007 für viele Technologien einen Wendepunkt.
Die technische Entwicklung erfolgte schon immer in Sprüngen. In der Computerbranche entwickeln sich alle Elemente – Prozessoren, Software, Speicher, Netze und Sensoren – im Block weiter. Wenn ihre Leistung einen gewissen Punkt erreicht, verschmelzen sie zu einer Plattform, die ein ganz neues Leistungsniveau ermöglicht, und dieses wird dann zur neuen Norm. Auf dem Weg vom Großrechner über PC und Laptop zum Smartphone war jede Generation von Geräten einfacher zu bedienen als die vorige. Um an den ersten Großrechnern arbeiten zu können, brauchte man ein Informatikstudium, aber die Smartphones von heute können selbst Kinder und Analphabeten bedienen.
Preis der Genomsequenzierung
Quelle: National Human Genome Research Institute
Zahl der Patentanmeldungen in der Biotechnologie, 1963-2014
Quelle: U.S. Patent and Trademark Office
Zuwächse bei der Solarenergie
Quelle: Paula Mints, Solar Services Program
Von all den technischen Entwicklungssprüngen der Geschichte war der des Jahres 2007 sicherlich einer der größten. Er eröffnete völlig neue Möglichkeiten der Vernetzung, Zusammenarbeit und Entwicklung in allen Bereichen des Lebens, der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung. Plötzlich gab es so viele neue Dinge, die sich digitalisieren ließen, so viel neuer Speicherplatz für all diese Daten, so viele neue Programme zur Auswertung dieser Daten und so viele neue Nutzer (vom Großkonzern bis zum Kleinbauern in Indien), die über ihre Smartphones auf diese Erkenntnisse zugreifen und zu ihnen beitragen konnten.
Genau diese Technologien sind heute der stärkste Motor der Maschine. Mit rasantem Tempo ist sie über uns hereingebrochen. Im Jahr 2004 schrieb ich ein Buch über etwas, das ich damals für die zentrale Antriebskraft der Maschine hielt, und schilderte, wie das Internet immer mehr Menschen die Möglichkeit gebe, sich zu vernetzen, zu konkurrieren und zu kooperieren. Das Buch hieß Die Welt ist flach: Eine kurze Geschichte des 21. Jahrhunderts. Die erste Ausgabe erschien 2005, im Jahr darauf folgte eine aktualisierte Fassung 2.0 und 2007 die Version 3.0. Dabei beließ ich es in der Annahme, dass ich damit eine solide Grundlage geschaffen hatte, von der ich als Journalist eine Weile lang zehren könnte.
Doch wie sehr hatte ich mich getäuscht! Im Nachhinein erwies sich 2007 als ein ganz schlechtes Jahr, um mit dem Denken aufzuhören. Das musste ich feststellen, als ich mich 2010 hinsetzte, um zusammen mit Michael Mandelbaum das Buch That Used to Be Us: How America Fell Behind in the World It Invented and How We Can Come Back zu schreiben. Als wir mit der Arbeit an dem Buch anfingen, zog ich als Allererstes die erste Ausgabe von Die Welt ist flach aus dem Regal, um mich daran zu erinnern, was ich 2004 gedacht hatte. Ich schlug das Register auf und stellte erstaunt fest, dass Facebook fehlte. Ganz recht – als ich 2004 die Erde zu einer Scheibe erklärte, dachte noch niemand an Facebook, Twitter war noch Vogelgezwitscher, die Wolke befand sich noch immer am Himmel, 4G war die Nummer eines Parkplatzes in meiner Tiefgarage, Anwendungen bekam man in der Kurklinik, LinkedIn war kaum bekannt, Big Data hätte als Name für einen Rapper durchgehen können, und Skype sah für die meisten Menschen aus wie ein Rechtschreibfehler. Diese Technologien betraten die Bühne erst nach der Veröffentlichung von Die Welt ist flach – und die meisten im Jahr 2007.
Also begann ich einige Jahre später mit dem ernsthaften Versuch, mein Verständnis der Maschine auf den neuesten Stand zu bringen. Ein entscheidender Anstoß war das Buch The Second Machine Age: Wie die nächste digitale Revolution unser aller Leben verändern wird der beiden Wirtschaftswissenschaftler Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee. Das erste Maschinenzeitalter war die Industrielle Revolution, die auf die Erfindung der Dampfmaschine im 18. Jahrhundert folgte. Damals ging es »um Energieerzeugung und darum, die menschliche Muskelkraft zu steigern«, so McAfee in einem Interview. »Jede neue Erfindung erzeugte mehr Energie. Aber alle erforderten menschliche Entscheidungen.« Deshalb machten die Erfindungen dieser Zeit die menschliche Kontrolle und Arbeit »wertvoller und wichtiger«.
Arbeit und Maschinen ergänzten sich also, vereinfacht gesagt. Anders im zweiten Maschinenzeitalter, wie Brynjolfsson erläutert: »Wir automatisieren immer mehr kognitive Aufgaben und immer mehr Kontrollsysteme, die darüber entscheiden, wie wir unsere Energie einsetzen. Heute treffen intelligente Maschinen oft bessere Entscheidungen als Menschen.« Das heißt, die Maschine ergänzt den Menschen nicht mehr, sondern sie ersetzt ihn.
Die wichtigste Antriebsfeder dieser Entwicklung war nach Ansicht der beiden Wirtschaftswissenschaftler das exponentielle Wachstum der Computerleistung, das im Mooreschen Gesetz zum Ausdruck kommt. Diese Theorie wurde erstmals 1965 von Intel-Mitgründer Gordon Moore aufgestellt und besagt, dass sich die Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit von Mikroprozessoren bei etwa gleichbleibenden Kosten jedes Jahr verdopple. Später korrigierte Moore den Zeitraum auf zwei Jahre, und dieses Gesetz hat sich inzwischen seit mehr als fünfzig Jahren gehalten.
Um anschaulich zu machen, was dieses exponentielle Wachstum bedeutet, bemühten Brynjolfsson und McAfee die berühmte Sage vom König, der so beeindruckt vom Schachspiel war, dass er seinem Erfinder eine Belohnung anbot. Der Mann sagte, er wolle lediglich genug Reis, um seine Familie zu ernähren. Der König erwiderte: »So sei es. Wie viel willst du?« Der Mann bat den König, ein Reiskorn auf das erste Feld des Schachbretts zu legen, zwei auf das nächste, vier auf das übernächste – auf jedes Feld immer doppelt so viel wie auf dem vorhergehenden. Der König stimmte zu, weil ihm nicht klar war, dass 63 Verdoppelungen in Folge eine unvorstellbar große Zahl ergeben, nämlich ungefähr 18 Trillionen Reiskörner. So wirkt exponentielles Wachstum! Wenn etwas über fünfzig Jahre hinweg alle zwei Jahre verdoppelt wird, dann kommt man irgendwann auf extrem große Zahlen, und es passieren ein paar abgefahrene Sachen, die man in dieser Form noch nie gesehen hat.
Nach Ansicht von Brynjolfsson und McAfee erreicht das Mooresche Gesetz gerade die zweite Hälfte des Schachbretts, wo die Prozessoren so groß und schnell werden, dass wir allmählich Dinge erleben, die sich auch qualitativ von allem bisher Dagewesenen unterscheiden: zum Beispiel selbstfahrende Autos oder denkende Computer, die jeden Menschen im Schach, bei der Quizshow Jeopardy! oder dem 2500 Jahre alten Brettspiel Go schlagen, das gemeinhin als noch komplizierter als Schach gilt. Das passiert, »wenn nicht nur die Veränderungen beschleunigen, sondern auch deren Beschleunigung«, erklärte McAfee. »Und wir stehen erst ganz am Anfang!«
Das heißt, zum einen stehe ich mit meiner Beschreibung der Maschine von heute auf den Schultern von Brynjolfsson und McAfee und ihrer Erkenntnis, dass die vom Mooreschen Gesetz beschriebene Beschleunigung die Technik verändert hat. Aber ich glaube andererseits auch, dass die Maschine gegenwärtig noch komplizierter ist. Was daran liegt, dass nicht nur die Technik in der zweiten Hälfte des Schachbretts angelangt ist, sondern auch zwei andere gewaltige Kräfte: der Markt und Mutter Natur.
Unter »Markt« verstehe ich die Beschleunigung der Globalisierung. Das heißt, die globalen Ströme von Waren, Geld, Krediten, sozialen Netzen und Vernetzung ganz allgemein binden Märkte, Medien, Zentralbanken, Unternehmen, Universitäten, Gemeinschaften und Menschen enger zusammen als je zuvor. Aber mit dem daraus resultierenden Informations- und Wissensstrom wird nicht nur die Vernetzung größer, sondern auch die wechselseitige Abhängigkeit: Jeder, wo immer er auch sein mag, bekommt die Folgen der Handlungen jedes anderen, egal wo auf der Welt, stärker zu spüren.
Und mit »Mutter Natur« meine ich schließlich den Klimawandel, das Bevölkerungswachstum und den Verlust der Artenvielfalt – alles Entwicklungen, die sich mittlerweile ebenfalls in der zweiten Hälfte des Schachbretts abspielen und rasant an Fahrt aufnehmen.
Auch hier stehe ich übrigens auf den Schultern von anderen. Der Begriff »Zeitalter der Beschleunigung« geht auf Grafiken von Wissenschaftlern um den Klimaforscher Will Steffen von der Australian National University in Canberra zurück. Diese Grafiken erschienen ursprünglich im Jahr 2004 in einem Buch mit dem Titel Global Change and the Earth System und zeigen, wie sich die Veränderungen in den Bereichen Technik, Gesellschaft und Umwelt zwischen 1750 und 2000 (und vor allem seit 1950) beschleunigen und gegenseitig aufschaukeln. Dieselben Wissenschaftler prägten auch den Begriff »Große Beschleunigung«, um die umfassende und vernetzte Natur dieser Umwälzungen zu beschreiben, die gleichzeitig den gesamten Globus erfassen und die menschliche und biologisch-physische Landschaft des Systems Erde verändern. Eine aktualisierte Version dieser Grafiken erschien am 2. März 2015 in der Fachzeitschrift Anthropocene Review: Sie dokumentierten noch einmal eine weitere Beschleunigung. (Die Grafiken finden Sie in diesem Buch auf den Seiten 185 und 186.)
Craig Mundie, Entwickler von Supercomputern und früherer Chefstratege von Microsoft, beschreibt diesen Moment in einfachen physikalischen Begriffen: »Die mathematische Definition der Geschwindigkeit ist die erste Ableitung, und die Beschleunigung ist die zweite Ableitung. Das heißt, die Geschwindigkeit nimmt zu oder ab in Abhängigkeit von der Beschleunigung. Aber in der Welt von heute scheint sogar die Beschleunigung zu beschleunigen. Das heißt, wir erleben nicht nur eine Beschleunigung der Veränderungen, sondern eine beschleunigte Beschleunigung der Veränderungen … Wenn die Veränderungen so rasch aufeinanderfolgen, dass wir uns nicht mehr darauf einstellen können, wird uns schnell schwindelig.«
Genau das erleben wir heute. Dov Seidman fügt hinzu: »Die Welt verändert sich nicht nur rasant, sie verformt sich und funktioniert anders, und zwar in vielen Bereichen gleichzeitig. Diese Verformung erfolgt so schnell, dass wir mit der Anpassung von uns selbst, unserer Führung, unseren Institutionen, unserer Gesellschaft und unseren ethischen Optionen nicht mehr nachkommen.«
In der Tat tut sich eine immer tiefere Kluft auf zwischen der Beschleunigung der Veränderungen einerseits und unserer Fähigkeit andererseits, unser Schul-, Ausbildungs- und Führungswesen, unsere sozialen Sicherungssysteme und Gesetze so anzupassen, dass wir das Beste aus diesen Veränderungen machen und das Schlimmste verhindern. Wie wir noch sehen werden, ist diese Diskrepanz die zentrale Ursache für viele politische und gesellschaftliche Turbulenzen in aller Welt. Es ist dies vermutlich die größte Herausforderung für die Politik der Gegenwart.
Astro Tellers Kurve
Die einleuchtendste grafische Darstellung dieses Phänomens zeichnete mir Eric »Astro« Teller, Chef des Entwicklungslabors Google X, wo unter anderem das autonom fahrende Auto des Suchmaschinenkonzerns entwickelt wird. Passenderweise ist Tellers offizieller Titel bei Google X »Kapitän der Mondschüsse«. Stellen Sie sich einen Mann vor, der jeden Morgen zur Arbeit kommt, mit seinen Kollegen auf den Mond zielt und das, was andere als Science-Fiction bezeichnen würden, in Produkte und Dienstleistungen verwandelt, die unsere Lebens- und Arbeitswelt umkrempeln. Sein Großvater väterlicherseits war der Physiker Edward Teller, der »Vater der Wasserstoffbombe«, und sein Großvater mütterlicherseits war der Wirtschaftsnobelpreisträger Gérard Debreu. Gute Gene, könnte man sagen. Wir treffen uns in einem Konferenzraum des Gebäudes von Google X, das früher einmal ein Einkaufszentrum war. Teller kommt auf Rollschuhen, auf denen er von einem seiner vielen Termine zum anderen saust.
Ohne Umschweife erläutert er mir, wie die Kombination aus dem Mooreschen Gesetz und dem beschleunigten Ideenaustausch Veränderungen mit einem Tempo bewirke, das die Anpassungsfähigkeit des Menschen auf eine harte Probe stelle.
Er zückt einen kleinen gelben Notizblock und sagt: »Stellen Sie sich eine Grafik mit zwei Kurven vor.« Dann zeichnet er ein Koordinatensystem und schreibt an die y-Achse »Geschwindigkeit der Veränderungen« und an die x-Achse »Zeit«. Dann zeichnet er seine erste Kurve ein – eine Exponentialkurve, die flach beginnt, langsam immer steiler wird, bis sie schließlich rechts in die Höhe schießt. »Diese Linie stellt den wissenschaftlichen Fortschritt dar«, erklärt er mir. Zuerst verläuft die Entwicklung langsam, doch wenn neue Erfindungen auf älteren aufbauen, steigt sie schneller an, um schließlich steil in die Höhe zu schießen.
Was könnte sich auf dieser Kurve befinden? Zum Beispiel Erfindungen wie das Drucken mit beweglichen Lettern, der Telegraf, die Schreibmaschine, das Telexgerät, der Großrechner, der PC, das Internet, der Laptop, das Mobiltelefon, der Suchalgorithmus, mobile Anwendungen, Big Data, virtuelle Realität, die Sequenzierung des menschlichen Genoms, künstliche Intelligenz und das fahrerlose Auto.
Vor tausend Jahren stieg diese Kurve so langsam an, dass Jahrhunderte vergehen mussten, ehe sich die Welt spürbar verändert hatte. So wurde zum Beispiel der Langbogen im 12. Jahrhundert erfunden, aber zum militärischen Einsatz kam er erst Mitte des 13. Jahrhunderts. Für die Europäer unterschied sich die Welt des 12. Jahrhunderts nicht spürbar von der des 11. Jahrhunderts. Und Neuerungen in den großen Städten brauchten eine Ewigkeit, um in die Provinz vorzudringen, ganz zu schweigen von anderen Weltregionen.
Aber etwa um 1900 habe dieser Prozess der technischen und wissenschaftlichen Veränderungen an Fahrt aufgenommen, so Teller, und die Kurve sei steiler angestiegen. »Das liegt daran, dass jede Generation von Erfindungen auf der vorhergehender Erfindungen aufbaut. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brauchte die Technik vielleicht nur noch zwanzig oder dreißig Jahre für einen Schritt, der sich wie eine unangenehme Umwälzung anfühlte. Denken Sie an die Erfindung des Autos oder des Flugzeugs.«
Schließlich schoss die Kurve nach oben und mit dem Zusammentreffen von mobilen Geräten, Breitbandinternet und Cloud Computing (worauf ich gleich noch eingehen werde) aus der Grafik hinaus. Plötzlich hatten viel mehr Menschen Zugang zu den Instrumenten, die für Innovationen nötig waren, und die Veränderungen wurden schneller und billiger.
»Heute, im Jahr 2016, wird das Zeitfenster so klein, dass zwischen dem Zeitpunkt der Erfindung bis zu einer schmerzlich spürbaren Veränderung der Welt nur noch fünf bis sieben Jahre vergehen.«
Wie fühlt sich dieser Prozess an? In meinem Buch Globalisierung verstehen hatte ich eine Anekdote des Wirtschaftswissenschaftlers Lawrence Summers wiedergegeben, die wunderbar auf den Punkt brachte, woher wir kommen und wohin wir gehen. 1988 arbeitete Summers als Wahlkampfhelfer des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Michael Dukakis und wurde nach Chicago geschickt, um dort eine Rede zu halten. Ein Wagen holte ihn vom Flughafen ab, um ihn zu der Veranstaltung zu bringen, und als er einstieg, entdeckte er im Rücksitz ein Telefon. »Das fand ich damals so cool, dass ich sofort meine Frau anrief, um ihr zu sagen, dass ich in einem Auto mit Telefon sitze«, erzählte Summers. Danach rief er noch ein paar andere Leute an, die ihm gerade einfielen, und sie waren genauso begeistert wie er.
Neun Jahre später war Summers stellvertretender Finanzminister. Auf einer Reise an die Elfenbeinküste sollte er in einem Dorf im Hinterland ein von den Vereinigten Staaten finanziertes Gesundheitsprojekt einweihen, in dessen Rahmen die erste Trinkwasserquelle für das Ballungszentrum Abidjan erschlossen worden war. Der Moment, der ihm besonders im Gedächtnis haften blieb, war jedoch der, als er auf dem Rückweg in ein Kanu stieg und ein ivorischer Beamter ihm ein Handy reichte mit den Worten: »Washington hat eine Frage an Sie.« Neun Jahre nachdem er damit geprahlt hatte, dass er in einem Wagen mit Autotelefon fahre, saß er an der Elfenbeinküste in einem Kanu und nahm gelassen einen Anruf vom anderen Ende der Welt entgegen. Die Veränderungen hatten sich nicht nur beschleunigt, sondern globalisiert.
Die zweite Kurve
So weit der wissenschaftliche und technische Fortschritt. Aber damit ist Tellers Grafik noch nicht fertig. Er hat mir zwei Kurven versprochen, und nun zeichnet er die zweite ein, eine gerade Linie, die vor vielen Jahrhunderten deutlich oberhalb der des technischen Fortschritts angesiedelt war, aber seither so langsam angestiegen ist, dass man es kaum bemerkt.
»Die gute Nachricht ist, dass es eine konkurrierende Kurve gibt«, erklärt Teller dazu. »Das ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Menschheit – der Einzelne und die ganze Gesellschaft – an Veränderungen in ihrer Umwelt anpasst.« Diese Veränderungen können technischer Natur sein (zum Beispiel der mobile Internetzugang), aber es kann sich auch um geophysische Veränderungen handeln (zum Beispiel Erderwärmung oder -abkühlung) oder um gesellschaftliche Veränderungen (zum Beispiel die Einführung der Ehe für alle). »Viele Umwälzungen sind von der Gesellschaft ausgegangen, und wir haben uns angepasst. Einige waren mehr oder weniger unangenehm, aber wir haben uns mit ihnen arrangiert.«
Die gute Nachricht ist tatsächlich, dass wir im Laufe der Jahrhunderte bei der Anpassung ein wenig Tempo zugelegt haben, dank der besseren Bildung und des Zugangs zu Wissen. »Die Geschwindigkeit, mit der wir uns anpassen, ist größer geworden. Vor tausend Jahren hätten wir vermutlich zwei oder drei Generationen gebraucht, um uns an etwas Neues zu gewöhnen.« Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war dazu nur noch eine Generation nötig. »Heute sind wir so anpassungsfähig, dass wir vielleicht nur noch fünfzehn Jahre brauchen.«
Leider könnte das immer noch nicht ausreichen, meint Teller. Die immer raschere Abfolge von wissenschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Neuerungen könnte die Anpassungsfähigkeit von Menschen und Gesellschaften überfordern. Damit setzt Teller einen dicken Punkt auf die rasant ansteigende Technologiekurve, kurz hinter ihrem Schnittpunkt mit der Anpassungskurve.
Dann schreibt er »Wir sind hier« neben den Punkt. Und so sieht die Grafik aus:
Der Punkt, so Teller, stehe für eine wichtige Tatsache: Die Menschheit habe sich zwar stetig an Veränderungen angepasst, doch inzwischen erfolge der technische Wandel so rasant, dass die meisten Menschen nicht mehr in der Lage seien, alle aufzunehmen. Viele von uns hielten nicht mehr Schritt.
»Das weckt Ängste«, meint Teller. »Und es verhindert, dass wir die neuen Technologien voll ausschöpfen. In den Jahrzehnten nach Erfindung des Verbrennungsmotors und vor der Überflutung der Straßen mit Autos vom Fließband wurden ganz allmählich Verkehrsregeln aufgestellt und umgesetzt. Viele dieser Regeln gelten bis heute, und im Laufe eines Jahrhunderts hatten wir genug Zeit, um die Gesetze an neue Erfindungen wie Autobahnen anzupassen. Doch die neuen wissenschaftlichen Entwicklungen verursachen erdbebenartige Veränderungen in der Straßennutzung – die Gesetzgeber kommen nicht hinterher, Technologieunternehmen leiden unter veralteten und oft sinnlosen Regeln, und die Öffentlichkeit ist verunsichert. Das Smartphone hat Uber möglich gemacht, aber ehe die Welt weiß, wie sie damit umgehen soll, haben fahrerlose Autos die neuen Regeln schon wieder überholt.«
Das ist ein echtes Problem. Wenn schnell »richtig schnell« wird, dann bedeutet langsame Anpassung, dass wir richtig langsam sind – und die Orientierung verlieren. Das ist so, als stünden wir alle auf einem Rollsteig am Flughafen, der sich mit etwa zehn Kilometern pro Stunde bewegt, und würden plötzlich auf fünfzig Kilometer pro Stunde beschleunigt. Das kann einen ziemlich aus dem Gleichgewicht bringen.
Wenn sich die technische Grundlage einer Gesellschaft nun alle fünf bis sieben Jahre erneuere, wir aber zehn bis fünfzehn Jahre benötigten, um uns daran zu gewöhnen, so Teller, dann »erleben wir alle einen Kontrollverlust, weil wir uns nicht so schnell an die Welt anpassen können, wie sie sich verändert. Bis wir uns an etwas gewöhnt haben, gibt es aber schon wieder etwas Neues, an das wir uns gewöhnen müssen.«
Das kann einen ganz schön schwindelig machen, denn wir hören von Entwicklungen wie roboterassistierter Chirurgie, Genomchirurgie, Klonen oder künstlicher Intelligenz, aber wir haben keine Ahnung, wohin uns das alles führen soll.
»Auch ist niemand in der Lage, sich auf mehr als einem dieser Gebiete wirklich gut auszukennen. Die Summe des menschlichen Wissens übersteigt bei Weitem die Lernfähigkeit eines einzelnen Menschen. Aber selbst Experten können nicht vorhersehen, wie ihr Gebiet in einem Jahrzehnt oder einem Jahrhundert aussehen wird«, meint Teller. »Ohne ein klares Wissen um das künftige Potenzial oder künftige unbeabsichtigte Auswirkungen neuer Technologien jedoch ist es fast unmöglich, Gesetze so zu gestalten, dass sie Fortschritt zulassen und uns vor sämtlichen Nebenwirkungen schützen.«
Wenn es also stimmt, dass wir heute zehn bis fünfzehn Jahre brauchen, um eine neue Technologie zu verstehen und neue Gesetze und Regeln zum Schutz der Gesellschaft zu erlassen, wie schützen wir uns dann, wenn eine neue Technologie innerhalb von fünf bis sieben Jahren gekommen und schon wieder gegangen ist? Das ist in vielerlei Hinsicht ein Problem.
Als Beispiel für ein System, das für eine langsamere Welt gemacht wurde, fällt Teller das Patentwesen ein. Üblicherweise sieht das Patentrecht so aus: »Wir geben dir für zwanzig Jahre ein Monopol auf deine Idee, und wenn das Patent erlischt, ist die Information frei verfügbar.« Aber was, wenn die Technologie nach vier oder fünf Jahren schon wieder überholt ist und es gleichzeitig vier oder fünf Jahre dauert, bis ein Patent vergeben wird? »Damit verlieren Patente in der Welt der Technologie an Bedeutung.«
Eine weitere große Herausforderung ist die Bildung. Wir gehen zwölf Jahre lang zur Schule, und dann ist Schluss. Aber wenn die Veränderungen so rasant aufeinanderfolgen, bleiben wir nur dann bis zum Rentenalter für den Arbeitsmarkt interessant, wenn wir unser ganzes Leben lang lernen. Wenn man sich die amerikanischen Präsidentschaftswahlen des Jahres 2016 ansieht, dann wird klar, »dass sehr viele Menschen nicht gedacht haben, dass sie ein Leben lang lernen müssten, als sie mit zwanzig auf den Arbeitsmarkt kamen«, so Teller. Und das erklärt einen Teil ihrer Unzufriedenheit.
All das deutet darauf hin, »dass unsere gesellschaftlichen Strukturen nicht in der Lage sind, mit den Veränderungen Schritt zu halten«, konstatiert er. Es fühlt sich dauernd so an, als würden wir den Entwicklungen hinterherhecheln. Was also sollen wir tun? Wir wollen weder den Fortschritt bremsen noch auf dessen gesetzliche Überwachung verzichten. Nach Ansicht von Teller besteht die einzige Möglichkeit darin, »die Gesellschaft anpassungsfähiger zu machen«. Nur auf diese Weise lässt sich die verbreitete Angst vor der Technologie bannen.
»Wir können uns entweder dem Fortschritt in den Weg stellen oder erkennen, dass die Menschheit vor einer neuen Aufgabe steht: Wir müssen unsere gesellschaftlichen Instrumente und Institutionen so umbauen, dass wir Schritt halten können. Die erste Option – die Verlangsamung des Fortschritts – wäre die einfachste Antwort auf unser Unbehagen. Doch die Menschheit steht vor katastrophalen Umweltproblemen, die sie sich selbst eingebrockt hat, und wenn wir den Kopf in den Sand stecken, dann geht das nicht gut aus. Die meisten Lösungen für die großen Probleme der Welt werden aus dem technischen Fortschritt kommen.«
Wenn wir in der Lage wären, »unsere Anpassungsfähigkeit nur ein bisschen zu steigern, dann könnte das ein gewaltiger Schritt sein«, meint Teller. Er deutet auf die Grafik mit den beiden Kurven und zeichnet eine gestrichelte Linie, die von der Anpassungskurve ausgeht und ein bisschen steiler ansteigt. Diese Linie steht für schnelleres Lernen und trifft daher erst an einem höheren Punkt auf die Techniklinie.
Die Verbesserung der Anpassungsfähigkeit hänge zu 90 Prozent von einer Optimierung des Lernens ab, so Teller, also der Anwendung des technischen Wandels auf unsere kulturellen und gesellschaftlichen Strukturen. Staatliche Einrichtungen, ob das Patentamt, das sich in den letzten Jahren spürbar an die neuen Herausforderungen angepasst hat, oder jede andere Behörde, müssen flexibler werden und so aufgestellt sein, dass sie schnell experimentieren und aus Fehlern lernen können. Statt mit dem Anspruch aufzutreten, dass eine neue Regel jahrzehntelang gültig sein müsse, sollte immer wieder überprüft werden, inwieweit sie der Gesellschaft noch dient. Universitäten experimentieren inzwischen damit, ihre Lehrpläne schneller zu ändern und bestimmten Kursen ein Verfallsdatum zu geben, um mit dem Wandel Schritt zu halten. Einen ähnlichen Ansatz sollten auch Gesetzgeber verfolgen. Sie müssen genauso fortschrittlich sein wie die Erfinder und mit der Geschwindigkeit des Mooreschen Gesetzes agieren.
»Innovation ist ein Kreislauf aus Experimentieren, Lernen, Anwendung des Wissens und Bewertung von Erfolgen und Misserfolgen«, ist Teller überzeugt. »Und wenn am Ende ein Misserfolg steht, dann geht der Kreislauf eben wieder von vorne los.« Ein Motto von Google X lautet: »Schnell scheitern.« Seinen Mitarbeitern sagt Teller: »Es ist mir egal, welche Fortschritte ihr diesen Monat macht. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass ihr schneller besser werdet – wie können wir denselben Fehler in der halben Zeit und zum halben Preis machen?«
Was wir mit den immer schnelleren Innovationszyklen und der immer kürzeren Lern- und Anpassungszeit erleben, »ist nicht mehr die gelegentliche Destabilisierung von früher, sondern ein Zustand dauerhafter Destabilisierung«, so Teller. Die Zeiten der statischen Stabilität seien jedenfalls vorüber. Was nicht heiße, dass wir keine neue Stabilität erreichen könnten, »aber das muss eine dynamische Stabilität sein. In bestimmten Zuständen, zum Beispiel beim Radfahren, kann man nicht stehen bleiben; im Gegenteil, wenn wir in Bewegung sind, ist es einfacher, das Gleichgewicht zu halten. Das ist nicht unser natürlicher Zustand. Doch die Menschheit muss lernen, in diesem Zustand zu leben.«
Wir müssen alle lernen, in einem Zustand des Radfahrens zu leben.
Wenn das passiert, »dann werden wir wieder gelassen sein, doch dazu müssen wir umlernen. Heute bereiten wir unsere Kinder noch nicht auf die dynamische Stabilität vor.«
Das müssen wir jedoch, und noch vieles mehr, wenn künftige Generationen in Wohlstand und Stabilität leben sollen. In den folgenden vier Kapiteln geht es um die Beschleunigungen des Mooreschen Gesetzes, des Marktes und der Natur, die heute die Maschine kennzeichnen. Wenn wir die dynamische Stabilität erreichen wollen, von der Teller spricht, dann müssen wir verstehen, wie diese Kräfte unsere Welt verändern und warum sie etwa um das Jahr 2007 besonders dynamisch wurden.
Kapitel 3
DAS MOORESCHE GESETZ
Wenn Menschen vernetzt sind, verändert sich ihr Leben. Wenn alles vernetzt ist, verändert sich das Leben an sich.
Motto des Unternehmens Qualcomm
Es ist für das menschliche Gehirn nicht einfach zu begreifen, was exponentielles Wachstum bedeutet – welche Dimensionen ganz schnell erreicht werden, wenn sich etwas jedes Jahr verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Deshalb greift Intel-Chef Brian Krzanich gern zu einem Beispiel, wenn er die Auswirkungen des Mooreschen Gesetzes erläutern und verdeutlichen will, was es heißt, dass sich die Leistung von Computern über ein halbes Jahrhundert hinweg alle zwei Jahre verdoppelt: Wenn man den ersten Mikroprozessor von Intel, den 4004 aus dem Jahr 1971, mit dem aktuellen Prozessor, dem Intel Core der sechsten Generation vergleicht, dann ist das neue Modell 3500-mal so leistungsstark, kostet aber nur ein Sechzigtausendstel und verbraucht ein Neunzigtausendstel an Energie.
Um es noch anschaulicher zu machen, vergleicht er den Prozessor gern mit einem VW Käfer Baujahr 1971: Wenn der sich nach dem Mooreschen Gesetz entwickelt hätte, dann käme er heute auf eine Spitzengeschwindigkeit von 450000 Kilometer pro Stunde, könnte mit einer einzigen Tankfüllung 30 Millionen Kilometer weit fahren und würde 3 Cent kosten.