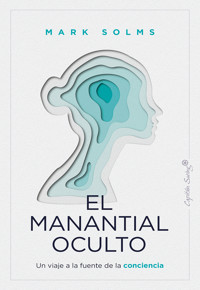34,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 34,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Geheimnis des Bewusstseins liegt in unseren Emotionen »Wahrhaft bahnbrechend« Eric Kandel, Nobelpreisträger Solms, einer der kühnsten Denker der zeitgenössischen Neurowissenschaften, widmet sich zeitlebens der Erforschung des menschlichen Bewusstseins. Für Wissenschaftler erschien es bislang ein unlösbares Problem zu verstehen, warum wir ein subjektives Selbst empfinden können und wie es im Gehirn entsteht. Der Autor nimmt die Leser:innen mit auf eine außergewöhnliche Reise von den Anfängen der Neuropsychologie und der Psychoanalyse bis hin zu den neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaften. Solms hat sich in die elementare Physik des Lebens vorgewagt und ist zu einer erstaunlichen Antwort gelangt. Er stellt eine aufschlussreiche neue Theorie des Bewusstseins vor, die Emotionen in den Mittelpunkt rückt. »Faszinierend, umfassend und ergreifend.« The Guardian »Faszinierend ... Solms ist einer der wenigen Wissenschaftler, die dieses wichtige Gebiet voranbringen.« Times Higher Education »Herausragend ... Solms leistet mit diesem kühnen, gründlichen, gelegentlich aufwühlenden und wahnsinnig ehrgeizigen Buch einen wertvollen Dienst.« Literary Review »Ein brillanter … Schritt, sich der ältesten Frage überhaupt - der geheimnisvollen Beziehung von Körper und Geist - auf neue Weise zu nähern.« Oliver Sacks »Dies ist eine Pflichtlektüre.« Susie Orbach, Britische Psychoanalytikerin und erfolgreiche Autorin »Ein beachtliches Buch. Es wird alles verändern.« Brian Eno, Musiker (Roxy Music) und Musiktheoretiker »Seine Ideen sehen für mich sehr nach der Zukunft aus.« Siri Hustvedt, amerikanische Erfolgsautorin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 656
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mark Solms
The Hidden Spring
Warum wir fühlen, was wir sind
Aus dem Englischen übersetzt von Elisabeth Vorspohl
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Hidden Spring: A Journey to the Source of Consciousness« bei Profile Books, London
Copyright © 2021 by Mark Solms
All Rights Reserved
Für die deutsche Ausgabe
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Weiß-Freiburg GmbH, Freiburg
unter Verwendung einer Abbildung von KaterinaHol/Shutterstock
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Kempten
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN 978-3-608-98514-6
E-Book ISBN 978-3-608-12182-7
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20631-9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Einführung
Kapitel 1
Der Stoff, aus dem Träume sind
Kapitel 2
Vor und nach Freud
Kapitel 3
Der kortikale Trugschluss
Kapitel 4
Was wird erlebt?
Kapitel 5
Gefühle
Kapitel 6
Die Quelle
Kapitel 7
Das Prinzip der freien Energie
Kapitel 8
Eine prädiktive Hierarchie
Kapitel 9
Warum und wie Bewusstsein auftaucht
Kapitel 10
Zurück zum Kortex
Kapitel 11
Das schwierige Problem
Kapitel 12
Künstliches Bewusstsein entwickeln
Postskript
Anhang: Arousal und Information
Dank
Anmerkungen
1. Der Stoff, aus dem Träume sind
2. Vor und nach Freud
3. Der kortikale Trugschluss
4. Was wird erlebt?
5. Gefühle
6. Die Quelle
7. Das Prinzip der freien Energie
8. Eine prädiktive Hierarchie
9. Warum und wie Bewusstsein auftaucht
10. Zurück zum Kortex
11. Das schwierige Problem
12. Künstliches Bewusstsein entwickeln
Postskript
Literatur
Abbildungsverzeichnis
Personen- und Sachregister
Im Gedenken an Jaak Panksepp
(1943–2017)
Er hat das uralte Rätsel gelöst und war ein weiser Mann.
Einführung
Als Kind hat mich eine seltsame Frage umgetrieben: Wie könnte die Welt ausgesehen haben, als es noch kein Bewusstsein gab? Eine solche Welt muss einst existiert haben, doch wie können wir sie uns vorstellen – die Welt, wie sie gewesen ist, als so etwas wie Vorstellungskraft(1) allererst auftauchte?
Um besser zu verstehen, was ich meine, versuchen Sie einmal, sich eine Welt vorzustellen, in der es keinen Sonnenaufgang geben kann. Die Erde hat sich schon immer um die Sonne gedreht, aber diese geht nur unter dem Blickwinkel ihres Beobachters über dem Horizont auf. Der Sonnenaufgang ist ein inhärent perspektivischer Vorgang und wird für alle Zeiten an Erfahrung gebunden bleiben.
Diese unvermeidliche Perspektiveneinnahme(1) macht es für uns so schwierig, Bewusstsein zu begreifen. Wenn wir es versuchen, müssen wir uns aus unserer Subjektivität lösen, um die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, und nicht so, wie sie uns erscheinen. Aber wie ist das möglich? Wie können wir uns unserem Selbst entziehen?
Als junger Mann habe ich mir mein Bewusstsein(1) ganz naiv als eine Blase vorgestellt, die mich umgibt: Ihre Inhalte waren die beweglichen Bilder, die Geräusche und all die anderen Phänomene des Erlebens. Jenseits der Blase vermutete ich unendliche Finsternis, eine Symphonie aus reinen Quantitäten, aufeinander einwirkenden Kräften, Energien und dergleichen: die eigentliche Realität »da draußen«, die mein Bewusstsein in den qualitativen Formen repräsentiert, die es ihnen geben muss.
Die Unmöglichkeit solcher Vorstellungen – die Unmöglichkeit, Realität ohne Repräsentationen zu repräsentieren – vermittelt einen Eindruck von der Größenordnung der Aufgaben, die ich in diesem Buch behandle. All die Jahre später versuche ich abermals, den Schleier zu lüften und einen Blick auf den tatsächlichen Mechanismus des Bewusstseins zu erhaschen.
Das Buch, das Sie in Händen halten, ist also unweigerlich subjektiv. Ja, es ist sogar subjektiver, als das Paradoxon, das ich soeben beschrieben habe, es verlangt. Um es Ihnen zu erleichtern, meine Perspektive einzunehmen, habe ich beschlossen, einen Teil meiner eigenen Lebensgeschichte zu schildern. Fortschritte meiner wissenschaftlichen Überlegungen zum Bewusstsein haben sich oft aus Entwicklungen in meinem persönlichen Leben und meiner klinischen Arbeit ergeben, und obwohl ich glaube, dass meine Schlussfolgerungen für sich allein stehen, begreift man sie leichter, wenn man weiß, wie ich zu ihnen gelangt bin. Einige meiner Entdeckungen – zum Beispiel die Gehirnmechanismen des Träumens(1) – verdanke ich weitgehend dem Zufall. Einige meiner beruflichen Entscheidungen – zum Beispiel der Entschluss, meine neurowissenschaftliche Laufbahn um einen Exkurs zu erweitern und eine Ausbildung zum Psychoanalytiker zu machen – haben sich weit mehr gelohnt, als ich es je erhofft hätte. Ich werde erklären, wie es dazu kam.
Der größte Glückstreffer, von dem mein Bemühen, Bewusstsein zu verstehen, profitiert hat, war zweifellos die Brillanz meiner Kollegen. Ich hatte insbesondere das große Glück, mit dem mittlerweile leider verstorbenen Jaak Panksepp(1) zusammenarbeiten zu können, einem Neurowissenschaftler, der den Ursprung und die Macht der Gefühle besser als jeder andere verstanden hat. So gut wie alles, was ich heute über das Gehirn zu wissen glaube, ist von seinen Einsichten beeinflusst.
Seit einigen Jahren arbeite ich mit Karl Friston(1) zusammen, den neben zahlreichen weiteren herausragenden Eigenschaften auch auszeichnet, dass er tatsächlich der einflussreichste lebende Neurowissenschaftler der Welt ist. Es war Friston, der die tiefsten Fundamente für die Theorie, die ich in diesem Buch entfalten werde, gelegt hat. Bekannt geworden ist er vor allem durch seine Reduzierung der Gehirnfunktionen(1)(1) (aller Art) auf eine basale physikalische Notwendigkeit, nämlich die Minimierung der sogenannten freien Energie. Ich erkläre das Konzept im siebten Kapitel und weise vorab lediglich darauf hin, dass sich die Theorie, die Friston und ich ausgearbeitet haben, mit meinem Projekt, bewusstes Erleben(1) zu verstehen, verbindet, und zwar so eng, dass man sie tatsächlich als Freie-Energie-Theorie(1) des Bewusstseins bezeichnen kann. Genau das ist sie.
Die Aufgabe, unser Fühlen, unser bewusstes Erleben zu erklären, ist eine dermaßen große Herausforderung, dass man sie heute ehrfurchtsvoll als »das schwierige Problem« bezeichnet. Manchmal verlieren die Frage wie auch die Antwort an Interesse, sobald ein Rätsel gelöst ist. Ich überlasse es Ihnen, zu beurteilen, ob die Überlegungen, die ich ausbreite, neues Licht auf das schwierige Problem werfen können. Ganz gleich, wie Ihr Urteil ausfällt – ich bin zuversichtlich, dass sie Ihnen helfen werden, sich selbst in einem neuen Licht zu sehen, und insoweit sollten sie so lange interessant bleiben, bis sie durch andere ersetzt werden. In einem tiefen Sinn sind Sie Ihr Bewusstsein, und deshalb scheint die Erwartung gerechtfertigt, dass eine Theorie des Bewusstseins in Grundzügen erklärt, weshalb Sie so fühlen, wie Sie es tun. Sie sollte erklären, warum Sie so sind, wie Sie sind, und vielleicht sogar, wie Sie darauf Einfluss nehmen können.
Dieses letzte Thema würde den Rahmen dieses Buches zugegebenermaßen sprengen. Die Theorie aber ist ihm gewachsen. Meine Erklärung des Bewusstseins führt die Elementarphysik des Lebens, die jüngsten Fortschritte der computergestützten und der affektiven Neurowissenschaft und die Feinheiten des subjektiven Erlebens, die traditionell von der Psychoanalyse erforscht werden, in einer einzigen Geschichte zusammen. Mit anderen Worten: Das Licht, das von dieser Theorie ausstrahlt, sollte für Sie nutzbar sein.
Ich habe mein Leben lang daran gearbeitet. Jahrzehnte sind mittlerweile vergangen, und noch immer frage ich mich, wie die Welt ausgesehen haben mag, bevor jemand in ihr lebte und sie betrachten konnte. Heute weiß ich mehr als damals und stelle mir vor, dass das Leben in einem jener hydrothermalen Schlote seinen Ursprung nahm. Die einzelligen Organismen, die dort entstanden, hatten sicherlich kein Bewusstsein, aber ihre Überlebenschancen müssen von ihrer Umgebung beeinflusst worden sein. Man kann sich unschwer vorstellen, dass diese einfachen Organismen auf die biologische »Güte« der Sonnenenergie reagiert haben. Und von dort ist es nur ein kleiner Schritt, sich komplexere Geschöpfe vorzustellen, die aktiv nach Energiequellen suchten und schließlich die Fähigkeit erwarben, die Erfolgsaussichten alternativer Handlung(1)en abzuwägen.
Meiner Ansicht nach ist Bewusstsein aus dem Erleben solcher Organismen hervorgegangen. Sind die Hitze bei Tag und die Kälte bei Nacht für diese ersten lebenden Geschöpfe irgendwie »gewesen«? Die physiologischen Wertigkeiten ihrer Tag-Nacht-Erfahrungen(1) waren die Vorläufer des ersten Sonnenaufgangs.
Viele Philosophen und Wissenschaftler sind noch immer der Meinung, dass Gefühle keinen physischen Zweck erfüllen. Ich sehe meine Aufgabe in diesem Buch darin, Sie von der Plausibilität einer alternativen Interpretation zu überzeugen. Das heißt, ich möchte Sie davon überzeugen, dass Gefühle(1) ein Teil der Natur sind, dass sie sich von anderen natürlichen Phänomenen nicht grundlegend unterscheiden und dass sie innerhalb der kausalen Matrix der Dinge etwas tun. Bewusstsein hat, wie ich zeigen werde, mit Fühlen zu tun, und beim Fühlen geht es darum, wie gut oder schlecht es um Ihr Leben gerade bestellt ist. Unser Bewusstsein hilft uns, es besser zu machen.
Das »schwierige Problem« des Bewusstseins ist mutmaßlich das größte ungelöste Rätsel der modernen Neurowissenschaft, wenn nicht der Wissenschaft überhaupt. Die in diesem Buch vorgestellte Lösung weicht radikal von herkömmlichen Ansätzen ab. Weil der zerebrale Kortex(1) der Sitz der Intelligenz ist, denkt nahezu jeder, er sei auch der Sitz des Bewusstseins. Dem widerspreche ich; Bewusstsein ist ungleich primitiver. Es hat seinen Ursprung in einem Teil des Gehirns, den wir Menschen mit Fischen teilen. Dies ist die »verborgene Quelle«, auf die der Buchtitel »The Hidden Spring« abhebt.
Man darf Bewusstsein nicht mit Intelligenz(2) verwechseln. Es ist ohne Weiteres möglich, Schmerz zu empfinden, ohne dass dieser mit Gedanken über die mögliche Schmerzursache einhergeht. In ähnlicher Weise erfordert das Verlangen zu essen – ein Hungergefühl – kein intellektuelles Begreifen der Erfordernisse des Lebens. Bewusstsein in seiner elementaren Form, als rohes Fühlen, ist eine verblüffend einfache Funktion.
Drei andere namhafte Neurowissenschaftler haben diesen Zugang gewählt: Jaak Panksepp(2), Antonio Damasio(1) und Björn Merker(1). Panksepp hat den Weg gebahnt. Er war ebenso wie Merker und anders als Damasio und ich selbst Tierforscher. Viele Leserinnen und Leser werden über die Erkenntnisse aus der Tierforschung(1), die ich hier schildere, entsetzt sein, und zwar gerade deshalb, weil sie zeigen, dass manche Tiere fühlen wie wir. Alle Säugetiere empfinden Schmerz, Furcht, Trennungspanik(1), Kummer und so weiter. Ironischerweise lassen Panksepps eigene Untersuchungen diesbezüglich keinerlei Zweifel. Trösten kann nur, dass seine Ergebnisse es unmöglich gemacht haben, diese Art Forschung in gewohnter Weise fortzusetzen.
Ich habe den Kontakt zu Panksepp(3), Damasio(2) und Merker(2) gesucht, weil sie ebenso wie ich glauben, dass der Neurowissenschaft unserer Zeit ein klarer Fokus auf die verkörperlichte Natur gelebter Erfahrung fehlt. (1)Uns verbindet, dass wir, manchmal ohne uns dessen bewusst zu sein, auf den Grundlagen aufgebaut haben, die Freud einst für eine wissenschaftliche Psychologie geschaffen – aber nicht weiter ausgearbeitet – hat, die den Gefühlen gegenüber der Kognition(1) Vorrang gibt (kognitive Prozesse sind weitgehend unbewusst). Dies ist der zweite Punkt, in dem dieses Buch radikal vom herkömmlichen Verständnis abweicht. Es kehrt zu Freuds Entwurf einer Psychologie von 1895 zurück – und versucht, sein Projekt zu vollenden. Wie alle seine Zeitgenossen hielt Freud das Bewusstsein freilich für eine Funktion des Kortex.
Der dritte Punkt, in dem dieses Buch einen eigenen Weg einschlägt, betrifft die Frage, ob Bewusstsein künstlich geschaffen werden kann. Ja, Bewusstsein(1) ist herstellbar. Diese Schlussfolgerung ist mitsamt ihren tiefgreifenden metaphysischen Implikationen das Resultat meiner gemeinsamen Arbeit mit Karl Friston. Im Unterschied zu Panksepp, Damasio und Merker ist Friston Experte für computergestützte Neurowissenschaft. Als solcher ist er davon überzeugt, dass Bewusstsein letztlich auf die Gesetze der Physik(1) reduziert werden kann (überraschenderweise war auch Freud dieser Überzeugung). Doch selbst Friston hat psychische weitgehend mit kortikalen Funktionen gleichgesetzt, bevor wir unsere Zusammenarbeit aufnahmen. Dieses Buch vertieft seinen statistisch-mechanistischen Bezugsrahmen bis hinunter in die primitivsten Bereiche des Hirnstamms …
Diese drei Abweichungen machen das schwierige Problem weniger schwierig. Dieses Buch erklärt, warum.
Mark Solms
Chailey, East Sussex
März 2020
Kapitel 1
Der Stoff, aus dem Träume sind
Ich wurde an der (2)Skeleton Coast Namibias, einer ehemaligen deutschen Kolonie, geboren. Mein Vater leitete dort die Consolidated Diamond Mines, ein kleines Unternehmen in südafrikanischem Besitz. De Beers, die Dachgesellschaft, hatte ein virtuelles Land im Land aufgebaut, das als Sperrgebiet bezeichnet wurde. Die ausgedehnten Schwemmlandminen erstreckten sich von den Sanddünen der Wüste Namib bis hinunter zum Grund des Atlantiks, mehrere Kilometer ins Meer hinein.
Dies war die ganz besondere Landschaft, die meine Phantasie prägte. Mein um zwei Jahre älterer Bruder Lee und ich spielten als Kinder mit unseren Schaufelbaggern und Kipplastern »Diamantmine«. Im Garten bauten wir die Meisterwerke der Ingenieurskunst nach, die wir an der Seite unseres Vaters bestaunten, wenn er uns mit hinaus zu den Tagebaubetrieben nahm. (Wir waren natürlich zu klein, um über die weniger bewundernswerten Aspekte seiner Branche Bescheid zu wissen.)
Eines Tages im Jahr 1965, ich war vier Jahre alt, fuhren meine Eltern wie so oft mit uns in den Cormorant Yachting Club. Sie gingen segeln, während ich mit Lee im Clubhaus spielte. Als sich der frühmorgendliche Dunst mit steigender Hitze lichtete, verließ ich das kühle Innere des dreistöckigen Clubhauses und lief hinunter zum Ufer, watete durch das flache Wasser und beobachtete die winzigen, silbrig-glänzenden Fischlein, die vor meinen Füßen davonstoben. Derweil kletterte mein Bruder mit einigen Freunden von der Rückseite des Gebäudes aus aufs Dach.
Was dann folgte, habe ich in Form dreier Schnappschüsse in Erinnerung. Zuerst ein Geräusch wie beim Zerbersten einer Wassermelone. Danach das Bild meines Bruders Lee, der auf dem Boden liegend über sein schmerzendes Bein jammert. Und schließlich meine Tante und mein Onkel, die mir erklären, dass sie sich um meine Schwester und mich kümmern würden, weil meine Eltern Lee ins Krankenhaus bringen müssten. Das Fragment mit dem schmerzenden Bein ist zweifellos konfabuliert: Aus der Krankenakte geht hervor, dass mein Bruder das Bewusstsein verlor, als er auf dem Betonboden aufschlug.
Weil Lee im örtlichen Krankenhaus nicht angemessen behandelt werden konnte, wurde er per Hubschrauber nach Kapstadt ins 800 Kilometer entfernte Groote Schuur Hospital gebracht. Die neurochirurgische Abteilung befand sich damals in einem imposanten, im kapholländischen Stil errichteten Gebäude – demselben, in dem ich heute als Neuropsychologe arbeite. Lee hatte einen Schädelbruch und eine intrakraniale Blutung erlitten. Wenn solche Hämatome sich vergrößern, werden sie lebensbedrohlich und erfordern sofortige chirurgische Maßnahmen. Mein Bruder hatte Glück: Sein Hämatom löste sich im Laufe der nächsten Tage auf, und schließlich wurde er aus der Klinik entlassen.
Abgesehen davon, dass er nach dem Unfall einen Helm tragen musste, um seinen frakturierten Schädel zu schützen, sah Lee nicht anders aus als vorher. Als Mensch aber war er völlig verändert. Ich fand es geradezu unheimlich, ihn so zu erleben.
Die auffälligste Veränderung bestand zweifellos darin, dass seine Entwicklung rückläufig war. Er hatte, wenn auch nur vorübergehend, die Kontrolle über den Stuhlgang verloren. Noch verstörender aber war für mich, dass er anders zu denken schien als vor dem Unfall. Es fühlte sich an, als sei Lee gleichzeitig da und nicht da. An viele unserer gemeinsamen Spiele schien er keine Erinnerung mehr zu haben. Unser Diamantminenspiel beschränkte sich nun aufs Graben von Löchern. All die phantasievollen und symbolischen Elemente sagten ihm nichts mehr. Er war nicht mehr Lee.
Lee, gerade erst eingeschult, wurde nicht in die zweite Klasse versetzt. Meine intensivsten Erinnerungen an jene frühe Zeit nach dem Unfall betreffen meinen inneren Kampf, mit dem Widerspruch fertigzuwerden, dass mein Bruder genauso aussah wie vorher, aber nicht mehr er selbst war. Ich verstand nicht, wohin der Lee von einst entschwunden war.
Im Laufe der folgenden Jahre entwickelte ich eine Depression(1). Ich weiß noch, dass ich drei Jahre nach dem Unfall nicht mehr die Kraft fand, mir morgens die Schuhe anzuziehen und zur Schule zu gehen. Ich sah keinen Sinn mehr darin. Wenn unser ganzes Wesen, unser eigentliches Sein, vom Funktionieren unseres Gehirns abhängt, was sollte dann aus mir werden, wenn mit dem Rest meines Körpers auch mein Gehirn stürbe? Wenn Lees ganzes Wesen auf ein körperliches Organ reduzierbar war, dann musste es sich mit meinem Wesen genauso verhalten. Das bedeutete, dass ich – mein fühlendes, empfindendes Wesen – nur für eine relativ kurze Zeitdauer existieren würde. Danach würde ich verschwinden.
Dieses Problem hat mich während meiner gesamten wissenschaftlichen Karriere beschäftigt. Ich wollte begreifen, was mit meinem Bruder geschehen war und was irgendwann mit uns allen geschieht. Ich musste verstehen, auf was unsere Existenz als erlebende, wahrnehmende Subjekte, biologisch betrachtet, hinausläuft. Kurzum: Ich musste verstehen, was Bewusstsein ist. So wurde ich Neurowissenschaftler.
Auch rückblickend bin ich überzeugt, dass ich keinen direkteren Weg zu den Antworten, die ich suchte, hätte einschlagen können.
Die Frage, was das Bewusstsein ist, ist vermutlich eines der schwierigsten Probleme der Wissenschaft. Sie ist von Belang, weil wir unser Bewusstsein sind, aber sie ist umstritten, weil zwei Rätsel seit Jahrhunderten einer Lösung harren. Das erste betrifft die Frage, wie sich Geist oder Psyche und Körper zueinander verhalten – oder, für die materialistisch Gesinnten (also für fast alle Neurowissenschaftler) formuliert: wie das Gehirn Geist erzeugt. Dies ist das sogenannte »Geist-Körper-(1)« oder auch »Leib-Seele-Problem(1)«. Wie bringt Ihr physisches Gehirn Ihr phänomenales Erleben hervor? Gleichermaßen verwirrend ist die Frage, wie das nicht-physische Bewusstsein den physischen Körper zu kontrollieren vermag.
Philosophen haben dieses Problem an die von ihnen so genannte »Metaphysik(1)« delegiert und damit nichts anderes gesagt, als dass sie der Meinung sind, es handele sich um ein wissenschaftlich nicht zu lösendes Rätsel. Aber warum? Weil Wissenschaft auf empirischen Methoden beruht, und »empirisch« bedeutet: »aus sensorischer Wahrnehmung(1) gewonnen«. Unser Geist oder unsere Psyche sind der sensorischen Beobachtung nicht zugänglich. Wir können sie weder sehen noch anfassen; sie sind unsichtbar und nicht greifbar, Subjekt, nicht Objekt.
Die Frage, was wir von außen über unseren Geist erfahren können – und sei es lediglich, um zu entscheiden, ob es einen Geist oder eine Psyche überhaupt gibt –, ist das zweite Rätsel. Es wird als »das Problem anderer Psychen« bezeichnet. Einfach formuliert: Wenn Psychen subjektiv sind, dann können Sie nur Ihre eigene Psyche beobachten. Doch wie lässt sich dann entscheiden, ob andere Menschen (oder andere Lebewesen oder Maschinen) ebenfalls eine Psyche besitzen? Ganz zu schweigen von der Frage, ob es womöglich objektive Gesetze gibt, denen unsere Geistestätigkeit oder unser psychisches Funktionieren gehorcht.
Das vergangene Jahrhundert hat im Wesentlichen drei wissenschaftliche Antworten auf diese Fragen hervorgebracht. Naturwissenschaft beruht auf Experimenten. Dabei kommt uns zugute, dass die experimentelle Methode nicht nach einer »letzten Antwort« strebt, sondern nach der Vermutung mit dem höchsten Wahrscheinlichkeitswert. Ausgehend von unseren Beobachtungen(1) versuchen wir, plausible Erklärungen für die beobachteten Phänomene zu finden. Mit anderen Worten: Wir formulieren Hypothesen, auf deren Basis wir dann Vorhersagen in folgender (1)Form treffen: »Wenn Hypothese X korrekt ist, dann sollte Y passieren, wenn ich Z tue« (wobei eine begründete Aussicht besteht, dass Y unter einer anderen Hypothese nicht geschehen wird). So sieht das Experiment aus. Sollte Y nicht eintreten, zieht man den Schluss, dass X falsch ist, und revidiert die Hypothese im Einklang mit den neuen Beobachtungen. Daraufhin beginnt der experimentelle Prozess aufs Neue, bis er falsifizierbare Vorhersagen generiert, die sich bestätigen lassen. An diesem Punkt gilt die Hypothese vorläufig als korrekt, nämlich so lange, bis weitere Beobachtungen ihr widersprechen. Das heißt, dass wir in den Naturwissenschaften keine Gewissheiten erwarten, sondern uns lediglich weniger Ungewissheit erhoffen.[1]
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann die als »Behaviorismus(1)« bezeichnete psychologische Schule, die experimentelle Methode systematisch zur Untersuchung der menschlichen Psyche einzusetzen. Ihre Vertreter wollten ausschließlich mit empirisch beobachtbaren Vorgängen arbeiten und auf alles »mentalistische« Reden über Ideen und Überzeugungen, Gefühle und Wünsche verzichten. Als Forschungsfeld betrachteten sie allein die sichtbaren und greifbaren Reaktionen ihrer Probanden auf objektive Stimuli. Subjektive Berichte über innere Vorgänge interessierten sie nicht im Geringsten. In ihren Augen war die Psyche eine »Black Box(1)«, über die sich nach ihrer Ansicht nicht mehr in Erfahrung bringen ließ als das, was als Input(1) in sie hinein- und als Output(1) aus ihr herausgelangte.
Warum vertraten die Behavioristen diesen extremen Standpunkt? Zum Teil war ihre Einstellung natürlich darauf zurückzuführen, dass sie das Problem der anderen Psychen umgehen wollten. Sie hofften, ihre Theorien für die der Psychologie inhärenten Zweifel philosophischer Art unangreifbar zu machen, indem sie jeder Diskussion über Geist und Psyche von vornherein einen Riegel vorschoben. Letztlich schlossen sie damit die Psyche aus der Psychologie aus.
Man könnte dies als einen hohen Preis betrachten. Der Behaviorismus betrat die Bühne jedoch als eine durchaus revolutionäre Lehre. Seine Vertreterinnen und Vertreter suchten nicht nach epistemologischer Reinheit um ihrer selbst willen, sondern wollten auch die psychologische Schule entthronen, die seit Beginn des Jahrhunderts über die Wissenschaft von Geist und Psyche herrschte, nämlich die freudianische Psychoanalyse. Weil er sozusagen »von innen heraus« ein Modell des psychischen Apparates entwickeln wollte, hatte Sigmund Freud(1) die kuriosen Eigenschaften introspektiver Zeugnisse aufs gründlichste untersucht, und die daraus erwachsenen Ideen und Überlegungen gaben der Behandlung wie auch der Forschung ein halbes Jahrhundert lang die Richtung vor. Damit verbunden entstanden psychoanalytische Gesellschaften und Institute, die Experten ausbildeten und führenden Geistesgrößen als Wirkungsfelder dienten. Für die Behavioristen aber waren Freuds Theorien allesamt Luftschlösser, errichtet auf den flüchtigen Fundamenten der Subjektivität. Freud hatte sich kopfüber in das Problem der anderen Psychen gestürzt, und die gesamte Psychologie war ihm gefolgt. Nun schickten die Behavioristen sich an, sie auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen.
Ungeachtet ihres strengen Programms gelang es ihnen, (1)kausale Beziehungen zwischen bestimmten Arten psychischer Stimuli und Reaktionen abzuleiten. Und nicht nur das: Sie konnten auch die Inputs(2) manipulieren, um vorhersagbare Veränderungen der Output(2)s herbeizuführen. Auf diese Weise entdeckten sie einige der Grundgesetze des Lernens(1). Wenn man zum Beispiel den Auslösereiz eines unwillkürlichen Verhaltens wiederholt mit einem künstlichen Stimulus verknüpft, kann dieser künstliche Reiz schließlich die gleiche unwillkürliche Reaktion triggern wie der angeborene Stimulus. Wenn man etwa (bei Tieren, die wie der Hund auf den Anblick von Futter mit Speichelfluss reagieren) den Anblick von Futter wiederholt mit dem Erklingen eines Glöckchens verknüpft, vermag schließlich allein der Klang des Glöckchens den Speichelfluss anzuregen. Man bezeichnet dies als »klassische Konditionierung(1)«. Ein anderes Beispiel: Wenn man ein willkürliches Verhalten wiederholt belohnt, wird es häufiger ausgeführt, bestraft man es, lässt es nach. Erhält also ein Hund Streicheleinheiten, wenn er Besucher anspringt, wird er umso häufiger und lebhafter springen; gibt man ihm aber einen Klaps, wenn er springt, lässt das Verhalten nach. Dies ist eine »operante Konditionierung(1)« – auch bekannt als »Effektgesetz(1)«.
Solche Entdeckungen waren durchaus bemerkenswert, zeigten sie doch, dass genauso wie alles andere auch der Geist Naturgesetzen gehorcht. Aber damit hat es nicht sein Bewenden, zumal selbst das Lernen nicht lediglich von äußeren Stimuli, sondern darüber hinaus von weiteren Faktoren beeinflusst wird. Stellen Sie sich einmal vor, im Stillen zu denken: »Sobald ich diese Seite gelesen habe, werde ich mir einen Tee machen.« Denken(1) dieser Art übt ununterbrochen Einfluss auf Ihr Verhalten aus. Gleichwohl erkannten die Behavioristen solche introspektiven Berichte nicht als wissenschaftliche Daten an, weil Gedanken sich der äußeren Beobachtung entziehen. Infolgedessen blieb ihnen verborgen, was Sie bewogen hat, sich eine Tasse Tee aufzubrühen.
Der große Neurologe Jean-Martin Charcot(1) hat einst gesagt: »La théorie, c’est bon, mais ça n’empêche pas d’exister«[2] – »Theorie ist gut, aber sie hält die klinischen Tatsachen nicht davon ab zu existieren«. Weil innere mentale Vorgänge eindeutig existieren und das Verhalten kausal beeinflussen, wurde der behavioristische Standpunkt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von einer anderen Schule verdrängt. Diese bezeichnete sich als »Kognitionspsychologie(1)« oder »kognitive Psychologie« und nahm für sich in Anspruch, innere psychische Vorgänge erklären zu können.
Angestoßen wurde die kognitive Revolution vom Siegeszug der Computer. Die Behavioristen hatten psychische Prozesse als unerforschliche »Black Box(2)« betrachtet und deshalb ausschließlich Inputs und Output(3)s untersucht. Computer aber sind keineswegs undurchschaubar. Ohne ein gründliches Verständnis ihrer inneren Funktionsweise hätten wir sie gar nicht erfinden können. Indem die Psychologen sich anschickten, die Psyche zu untersuchen, als sei diese ein Computer, hielten sie es für aussichtsreich, Modelle der intrapsychisch ablaufenden(1)Informationsverarbeitung formulieren zu können. Diese Modelle wurden sodann mithilfe künstlich simulierter psychischer Prozesse in Kombination mit Verhaltensexperimenten getestet.
Was ist Informationsverarbeitung? Ich werde später sehr viel mehr darüber sagen, doch zunächst ist hier vor allem interessant, dass sie mit ganz verschiedenartigen physikalischen Equipments durchgeführt werden kann. Dies wirft ein neues Licht auf die physische Natur des Geistes und legt die Vermutung nahe, dass unser Geist (konstruiert als informationsverarbeitend) gar keine Struktur ist, sondern eine Funktion. So gesehen, werden die geistigen oder psychischen »Software-Funktionen« von den »Hardware-Strukturen(1)« des Gehirns erfüllt, aber die gleichen Funktionen können ebenso gut von anderen Substraten, zum Beispiel von Computern, ausgeführt werden. Mithin erfüllen sowohl Gehirne als auch Computer (1)Gedächtnisfunktionen (sie kodieren und speichern Information), Wahrnehmungsfunktionen(1)(sie klassifizieren Muster eingehender (1)Information, indem sie diese mit bereits gespeicherter Information vergleichen) und Exekutivfunktionen (sie treffen Entscheidungen bezüglich der Reaktion auf solche Information).(1)
Dies ist die Stärke des »funktionalistischen« Ansatzes, wie man ihn heute bezeichnet, aber zugleich auch seine Schwäche. Wenn ein und dieselben Funktionen von Computern erfüllt werden können, die vermutlich keine fühlenden Wesen sind, dann müssen wir uns fragen, ob es gerechtfertigt ist, Geist und Psyche auf reine Informationsverarbeitung(2) zu reduzieren. Schließlich verfügt sogar Ihr Handy über Gedächtnis-, Wahrnehmungs- und Exekutivfunktionen(2).
Die dritte bedeutende wissenschaftliche Reaktion auf die Leib-Seele-Metaphysik(2) entwickelte sich parallel zur Kognitionspsychologie, (2)ließ diese aber gegen Ende des 20. Jahrhunderts in den Hintergrund treten. Die Rede ist von einer Forschungsrichtung, die unter der allgemeinen Bezeichnung »kognitive Neurowissenschaften(1)« bekannt wurde und deren Hauptgegenstand die Hardware des Geistes ist. Die kognitiven Neurowissenschaften entstanden dank der Entwicklung mannigfaltiger physiologischer Techniken, die es uns ermöglicht haben, die Dynamik des lebenden Gehirns unmittelbar zu beobachten.
Zu Zeiten des Behaviorismus(2) stand den Neurophysiologen lediglich eine einzige solche Technik zur Verfügung: Sie konnten die elektrische Aktivität des Gehirns von der äußeren Schädeloberfläche aus mithilfe eines Elektroenzephalogramms (EEG(1)) aufzeichnen. Heute verfügen wir über zahlreiche weitere Technologien, zum Beispiel die funktionelle Magnetresonanztomografie(1) (fMRT), mit der wir die hämodynamische Aktivität in unterschiedlichen Regionen des Gehirns messen können, während es spezifische mentale Aufgaben löst, sowie die Positronen-Emissions-Tomografie (PET)(1), mit der sich die unterschiedliche Stoffwechselaktivität einzelner Neurotransmittersysteme messen lässt. Dies ermöglicht uns, exakt zu identifizieren, durch welche Hirnprozesse unsere unterschiedlichen psychischen Zustände erzeugt werden. Mit der Diffusions-Tensor-Traktografie(1) können wir zudem die detaillierte funktionelle und anatomische Konnektivität zwischen diesen unterschiedlichen Hirnregionen visualisieren. Die Optogenetik(1) wiederum macht neuronale Schaltkreise sichtbar und ermöglicht uns, diese zu aktivieren, so dass individuelle Erinnerungsspuren aufleuchten, während Probanden kognitive Aufgaben lösen, und von uns identifiziert werden können.
Diese Techniken machen das innere Funktionieren des psychischen Organs deutlich sichtbar – und lassen die wildesten empiristischen Träume(1) der Behavioristen Wirklichkeit werden, ohne aber den Bereich der Psychologie auf Reize und Reaktionen zu reduzieren.
Der Stand der Neuropsychologie in den 1980er Jahren erklärt, weshalb den Behavioristen ein solch saumloser Übergang von der Lerntheorie zur kognitiven Neurowissenschaft gelingen konnte. Man hätte die Neuropsychologie jener Zeit ebenso gut als Neurobehaviorismus bezeichnen können. Je mehr ich damals in den Anfängen meines Studiums über Funktionen wie das Kurzzeitgedächtnis, das man als »Zwischenspeicher« betrachtete, der Erinnerungen im Bewusstsein aufbewahrt, lernte, desto klarer wurde mir, dass meine Dozenten über etwas anderes sprachen als das, wofür ich mich eingeschrieben hatte. Sie hielten Vorträge über die funktionellen Werkzeuge der Psyche statt über die Psyche selbst. Ich war bestürzt.
Der Neurologe Oliver Sacks(1) hat die Situation, in die ich hineingeraten war, in seinem Buch Der Tag, an dem mein Bein fortging treffend beschrieben:
Es ist das Ziel der Neuropsychologie(1) wie auch der klassischen Neurologie, vollkommen objektiv zu sein, und eben darauf basieren auch ihre großen Erfolge und ihre Fortschritte. Aber ein lebendes Wesen und insbesondere ein Mensch ist vor allem aktiv – ein Subjekt, nicht ein Objekt. Ebendieses Subjekt, das lebendige »Ich«, ist es, das ausgeschlossen wird. Die Neuropsychologie ist eine bewundernswerte Wissenschaft, aber sie schließt die Psyche, die Erfahrung, das aktive, lebendige »Ich« aus.[3]
Die Formulierung: »Die Neuropsychologie ist eine bewundernswerte Wissenschaft, aber sie schließt die Psyche […] aus« bringt meine Enttäuschung auf den Punkt. Nachdem ich Oliver Sacks’ Buch gelesen hatte, nahm ich einen Briefwechsel mit ihm auf, den wir bis zu seinem Tod im Jahr 2015 fortgesetzt haben. Ich fühlte mich davon angezogen, dass er die subjektiven Berichte seiner Patienten so ernst nahm. Dies war schon in seinem 1970 erschienen Buch Migräne deutlich geworden und mehr noch in seinem außergewöhnlichen Werk Bewußtseinsdämmerungen von 1973. Im zweiten Buch schildert er ungemein detailliert die klinischen Reisen einer Gruppe chronisch kranker »akinetisch(1)(1)-stummer« Patientinnen und Patienten mit Encephalitis lethargica(1)(1). Diese Krankheit war auch unter der Bezeichnung »Schlafkrankheit« bekannt, obwohl die Betroffenen nicht wirklich schliefen. Sie waren vielmehr antriebslos und zeigten keinerlei spontane Initiative. Sacks konnte sie »aufwecken«, indem er ihnen L-Dopa verabreichte, ein Medikament, das die Dopaminverfügbarkeit verbessert. Doch schon bald nachdem ihre aktive Handlungsfähigkeit(1) wiederhergestellt war, verhielten sie sich wie getrieben, wurden manisch und schließlich psychotisch. Kurz nachdem ich Der Tag, an dem mein Bein fortging gelesen hatte, in dem Sacks(2) sein eigenes subjektives Erleben einer Erkrankung des Nervensystems beschreibt, veröffentlichte er Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte (1987 [1985]) – eine Sammlung von Fallgeschichten, die unter dem Blickwinkel eines neurologischen Patienten Einblick in neuropsychologische Störungen gewähren. Durch diesen Patienten wurde Sacks berühmt.
Seine Krankengeschichten hatten keinerlei Ähnlichkeit mit meinen Lehrbüchern, in denen psychische Funktionen(1) zerlegt und zergliedert wurden wie die Funktionen von Körperorganen. Zum Beispiel erfuhr ich, dass die Sprache im Broca-Areal(1)(1) des linken Frontallappens produziert wird, das Wernicke-Areal wiederum, das wenige Zentimeter weiter hinten im Schläfenlappen liegt, für das Sprachverständnis(1)(1) zuständig ist und dass unsere Fähigkeit zu wiederholen, was jemand zu uns gesagt hat, durch den Fasciculus arcuatus(1) vermittelt wird, eine bogenförmige Leitungsbahn, die diese beiden Areale miteinander verbindet. Ich erfuhr auch, dass Erinnerungen vom Hippocampus(1)(1) kodiert, im Neokortex(1) gespeichert und durch frontal-limbische Mechanismen abgerufen werden.
Gibt es also zwischen dem Gehirn und dem Magen oder der Lunge tatsächlich keinen Unterschied? Ganz offensichtlich zeichnet es sich dadurch aus, dass es irgendwie ist, ein Gehirn zu sein. Dies trifft auf keinen anderen Körperteil zu. Die Empfindungen(1), die wir in anderen Körperorganen lokalisieren, werden von diesen selbst nicht empfunden; die in ihnen entstehenden Nervenimpulse werden für uns erst wahrnehmbar, wenn sie das Gehirn erreichen. Diese unverwechselbare Eigenschaft des Hirngewebes – die Fähigkeit, etwas zu spüren, zu fühlen und zu denken – hat einen Grund. Sie muss eine Funktion erfüllen. Und wenn es sich so verhält – wenn subjektives Erleben(1) kausale Auswirkungen auf das Verhalten hat, wie es offenbar der Fall ist, wenn wir spontan beschließen, eine Tasse Tee aufzubrühen –, dann sind wir auf dem Holzweg, wenn wir sie aus unseren wissenschaftlichen Erklärungen ausschließen. Ebendies aber ist in den 1980er Jahren passiert. Meine Dozenten haben kein Wort darüber verloren, wie es ist, Sprache(1) zu verstehen oder sich an etwas zu erinnern, geschweige denn, warum es sich überhaupt nach etwas anfühlt.
Diejenigen, die der subjektiven Perspektive Rechnung trugen, wurden von den »richtigen« Neurowissenschaftlern nicht ernst genommen. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie viele Menschen heute wissen, dass Sacks’ Veröffentlichungen von den meisten seiner Kollegen belächelt wurden. Ein Kommentator ging so weit, ihn als den Mann zu bezeichnen, »der seine Patienten mit einer literarischen Karriere verwechselte«. Ihm haben diese Dinge schwer zugesetzt. Wie kann man das innere Leben der Menschen beschreiben, ohne ihre Geschichten zu erzählen? So klagte auch Freud bereits ein Jahrhundert zuvor mit Blick auf seine eigenen Krankengeschichten:
[…] es berührt mich selbst noch eigentümlich, daß die Krankengeschichten, die ich schreibe, wie Novellen zu lesen sind, und daß sie sozusagen des ernsten Gepräges der Wissenschaftlichkeit entbehren. Ich muß mich damit trösten, daß für dieses Ergebnis die Natur des Gegenstandes offenbar eher verantwortlich zu machen ist als meine Vorliebe […][4]
Sacks war über das Zitat, das ich ihm schickte, begeistert.[5] Als ich selbst diese Zeilen zum ersten Mal las, begriff ich, dass ich nicht der Einzige war, der sich der Neuropsychologie in der Hoffnung zugewandt hatte, zu erfahren, wie das Gehirn Subjektivität(1) erzeugt. Sehr rasch wird man eines Besseren belehrt und ermahnt, solche vermeintlich unergründlichen Fragen nicht weiter zu verfolgen – es wäre »nicht gut für Ihre Karriere«. Und so vergessen die meisten Studentinnen und Studenten der Neurowissenschaft nach und nach, warum sie das Fach ursprünglich gewählt haben, und identifizieren sich mit dem Dogma des Kognitivismus(1), für den sich das Gehirn nicht vom Mobiltelefon unterscheidet.
Der einzige Aspekt des Bewusstseins, der in den 1980er Jahren überhaupt als wissenschaftliches Thema anerkannt wurde, war der Hirnmechanismus, der Wachzustand und Schlaf steuert, anders formuliert: Der »Grad« des Bewusstseins galt als seriöses Thema, nicht jedoch seine »Inhalte«. Folglich beschloss ich, meine Dissertation über einen Aspekt des Schlafes zu schreiben, genauer: über den subjektiven Aspekt des Schlafes, nämlich die Hirnmechanismen des Träumens. Schließlich ist das Träumen nichts anderes als ein paradoxes Eindringen des Bewusstseins (»Wachzustand(1)«) in den Schlaf. Erstaunlicherweise wies die einschlägige Literatur eine erhebliche Lücke auf: Niemand hatte je systematisch beschrieben, wie sich Läsionen verschiedener Hirnregionen auf das Träumen auswirken. Diese Aufgabe nahm ich nun in Angriff.
Was die Erforschung des Träumens so schwierig macht, ist der subjektive Charakter des Geschehens. Psychische Phänomene können grundsätzlich nur introspektiv durch einen einzigen Beobachter betrachtet und anderen Menschen einzig indirekt, verbal, geschildert werden. Mit unseren Träumen aber verhält es sich noch problematischer, denn über sie lässt sich nur retrospektiv sprechen, sobald der Träumer aufgewacht ist – und jeder weiß, wie fehlbar die Erinnerungen an unsere Träume(1) sind. Welcher Art sind diese »Daten« überhaupt?[6] All diese Unwägbarkeiten hatten zur Folge, dass Träume seit der Mitte des 20. Jahrhunderts eine gewichtige Rolle beim Übergang vom Behaviorismus zu jenem Forschungsfeld gespielt haben, aus dem schließlich die kognitive Neurowissenschaft hervorging.
Das Elektroenzephalogramm (EEG)(2) wurde in der Schlafforschung erstmals Anfang der 1950er Jahre von den Neurophysiologen Eugene Aderinsky(1) und Nathaniel Kleitman(1) eingesetzt. Die beiden Wissenschaftler vertraten die These, dass der Grad der Hirnaktivität sinkt, sobald wir einschlafen, und beim Aufwachen wieder ansteigt. Deshalb sagten sie voraus, dass die Amplitude unserer Gehirnwellen (eines der Dinge, die der Elektroenzephalograf misst) steigt und ihre Frequenz (die gleichfalls gemessen wird) sinkt, wenn wir einschlafen – und dass genau das Gegenteil passiert, sobald wir wieder aufwachen (siehe Abb. 10, S. 121).
Wenn das Gehirn in den heute so genannten Tiefschlaf(1) fällt, passiert genau das, was Aserinsky und Kleitman vorhergesagt haben. Ihre Hypothese wurde also bestätigt. Überraschend aber ist, was daran anschließend geschieht: Innerhalb von neunzig Minuten nach dem Einschlafen (und fortan regelmäßig etwa alle neunzig Minuten) beschleunigen sich die Gehirnwellen wieder, und zwar fast bis zum Grad des Wachzustandes, obwohl die Probanden, deren Hirnaktivität aufgezeichnet wird, weiterschlafen.[7] Aserinsky und Kleitmann bezeichneten diese merkwürdigen Zustände der Hirnaktivierung als »paradoxen Schlaf(1)« – die Paradoxie besteht darin, dass das Gehirn bei physiologischem Arousal weiterhin tief schläft.
In diesem merkwürdigen Zustand geschehen noch weitere Dinge. Zu beobachten sind sehr schnelle Augenbewegungen (aus diesem Grund wurde der paradoxe Schlaf(2) später als »rapid eye movement sleep(1)« oder REM-Schlaf bezeichnet), während der Körper vom Hals abwärts vorübergehend in völliger Bewegungslosigkeit verharrt. Gleichzeitig vollziehen sich drastische autonome Veränderungen, zum Beispiel eine Reduzierung der Kontrolle der Kernkörpertemperatur und eine Verstärkung der Durchblutung der Genitalien, die beim Mann zu sichtbaren Erektionen führt. Wie die Wissenschaft es geschafft hat, all dies bis 1953 zu übersehen, ist unfassbar!
Auf der Grundlage dieser Beobachtungen formulierten Aserinsky(1) und Kleitman(2) die keineswegs abwegige Hypothese, dass der REM-Schlaf die physiologische Grundlage jenes psychologischen Zustands sei, den wir als Träumen bezeichnen. Folgerichtig sagten sie voraus, dass Probanden beim Wecken aus dem REM-Schlaf Traumberichte abliefern könnten, beim Wecken aus dem Tiefschlaf(2) (non-REM-Schlaf(1)) jedoch nicht. Gemeinsam mit einem Schlafforscher, der auf den unglücklichen Namen William Dement(1) hörte, konnten sie ihre Vorhersage testen und bestätigen: Während ihre Probanden in annähernd achtzig Prozent der Fälle beim Wecken aus dem REM-Schlaf Träume schilderten, war dies bei noch nicht einmal zehn Prozent der Probanden möglich, die aus dem non-REM-Schlaf geweckt wurden. Fortan setzte man den REM-Schlaf mit dem Träumen(1) in eins.[8] Hervorragende Neuigkeiten! Das Feld musste sich mit dem Träumen nicht länger abgeben, denn man hatte nun einen objektiven Marker an der Hand, der es Neurowissenschaftlern ermöglichte, eine ordentliche Wissenschaft zu betreiben, ohne sich mit den methodologischen Schwierigkeiten herumschlagen zu müssen, mit denen die retrospektiven, individuellen mündlichen Berichte über flüchtige subjektive Erfahrungen sie konfrontierten.
Ein weiterer Grund, dankbar zu sein, hing damit zusammen, dass Träume für die Entwicklung der Psychoanalyse eine so wichtige Rolle gespielt hatten. Auch darum musste man sich nicht länger scheren. Anders als die Vertreter der Leib-Seele-Metaphysik(3), die die Wissenschaft von der Psyche in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägten, hatten die Psychoanalytiker nie gezögert, introspektive Berichte als Daten zu behandeln, im Gegenteil. Berichte, die durch »freies Assoziieren(1)« (unstrukturiertes Fließen des Bewusstseinsstroms) zustande gekommen waren, bildeten die wichtigsten Daten der Traumforschung(1). Mit dieser Methode war Freud(2) zu dem Schluss gelangt, dass der »latente« Inhalt der Träume (die zugrundeliegende Geschichte, die er aus den freien Assoziationen der Träumenden erschloss) trotz aller Ungereimtheiten ihres »manifesten« Inhalts als eine kohärente psychische Funktion, nämlich als Wunscherfüllung(1), dient.
Freud zufolge ist Träumen das, was geschieht, wenn die biologischen Bedürfnisse, die unser Verhalten im Wachzustand erzeugen, während des Schlafs keiner Hemmung mehr unterliegen. Träume sind Versuche, diese Bedürfnisse, die ihre Anforderungen auch dann, wenn wir schlafen, geltend machen, zu befriedigen. Aber die Träume tun dies auf eine halluzinatorische Weise und ermöglichen es uns dadurch weiterzuschlafen (statt aufzuwachen und unsere Triebe zu befriedigen). Weil Halluzinationen(1) ein wesentliches Merkmal psychischer Erkrankungen sind, benutzte Freud diese Theorie in seinem bahnbrechenden Buch Die Traumdeutung (1900), um in groben Zügen ein Modell zu entwerfen, wie die Psyche als Ganze in Gesundheit und Krankheit funktioniert.
»Die Psychoanalyse gründet sich auf die Traumanalyse«, schrieb Freud.[9] Weil Träume aber empirisch ungemein schwierig zu untersuchen sind, schlossen die Behavioristen sie, wie wir gesehen haben, aus der wissenschaftlichen Forschung aus. Damit nicht genug, hielt man das gesamte Theoriegebäude, das Freud auf den Träumen errichtet hatte, für nicht besser als sein Fundament. So bezeichnete der große Wissenschaftsphilosoph Karl Popper(1) die psychoanalytische Theorie als »pseudowissenschaftlich«, weil sie keine experimentell falsifizierbaren Vorhersagen liefere.[10] Wie können wir die Hypothese widerlegen, dass Träume die von Freud rückgeschlossenen latenten Wünsche zum Ausdruck bringen? Wenn solche Wünsche im manifesten (berichteten) Traum gar nicht auftauchen müssen, kann jeder Traum so gedeutet werden, dass er den Anforderungen der Theorie entspricht. Daher war es nicht überraschend, dass die Träume fallengelassen wurden wie eine heiße Kartoffel, als die Entdeckung des REM-Schlafs(2) es den Neurowissenschaftlern ermöglichte, sich statt auf den flüchtigen Stoff der Traumberichte auf deren konkrete physiologische Korrelate zu konzentrieren.
Die Entdeckung des REM-Schlafs(3) in den 1950er Jahren gab den Startschuss zu einem Wettrennen um die Identifizierung seiner neurologischen Grundlage, weil die Erhellung der REM-Schlaf-Funktion den objektiven Mechanismus der Träume(2) aufzudecken und gleichzeitig die Psychiatrie der damaligen Zeit auf ein angeseheneres wissenschaftliches Fundament zu stellen versprach. (Erleichtert wurde diese Forschung dadurch, dass der REM-Schlaf bei allen Säugetieren auftritt.) 1965 ging Michel Jouvet(1) aus dem Wettrennen als Sieger hervor. In einer Reihe chirurgischer Experimente an Katzen hatte er nachgewiesen, dass der REM-Schlaf(4) nicht durch das Vorderhirn erzeugt wird (den Kortex, also den oberen Teil des Gehirns, der bei Menschen von so beeindruckender Größe ist und u. a. deshalb als Organ der Psyche angesehen wird), sondern durch den Hirnstamm(1), eine vermeintlich wesentlich bescheidenere Struktur außerordentlich alten evolutionären Ursprungs.[11] Zu diesem Schluss gelangte Jouvet(2) aufgrund seiner Beobachtung, dass Schnitte durch die Neuralachse der Katze erst dann zum Verlust des REM-Schlafs führten, wenn sie die Ebene einer »tieferen« Hirnstammstruktur erreichten, die man als Pons(1) bezeichnet (siehe Abb. 1).[12]
Abb. 1 Das Bild links zeigt eine mediale Ansicht des Gehirns (Schnitt durch die Mitte), das rechte zeigt eine laterale Ansicht (Seitenansicht). Die Abbildung zeigt den Kortex (schwarz) und den Hirnstamm (weiß). Gekennzeichnet sind lediglich die Hirnstammkerne(1), die für die Kontrolle des REM-Schlafs(5) vermutlich wichtig sind, nämlich das mesopontine Tegmentum(1), der dorsale Raphe-Kern(1) und der Locus-coeruleus-Komplex(1). (1)Gezeigt sind ferner der Sitz der Kerne des basalen Vorderhirns (unterhalb des Kortex) sowie der Hypothalamus, dessen Relevanz später klar werden wird.
Die Details zu klären, blieb Jouvets Schüler Allan Hobson(1) überlassen. Er identifizierte exakt, welche pontinen Neuronen REM-Schlaf(6) und infolgedessen Träume erzeugen. Mitte der 1970er Jahre wusste man, dass der gesamte Schlaf-Wach-Zyklus(1) – einschließlich all der oben geschilderten Phänomene des REM-Schlafs sowie jener der unterschiedlichen Phasen des non-REM-Schlafs(2) – von nur wenigen miteinander interagierenden Kernen des Hirnstamms orchestriert wird[13] und dass die Neuronen, die den REM-Schlaf kontrollieren, einem einfachen An-aus-Schalter ähneln. Die einschaltenden Neuronen liegen im mesopontinen Tegmentum(2) (siehe Abb. 1). Sie setzen im gesamten Vorderhirn Azetylcholin(1) frei. Diese neurochemische Substanz wirkt stimulierend: Sie steigert den »Grad« des Bewusstseins(1) (und wird zum Beispiel auch durch Nikotin angeregt, das Ihnen hilft, sich zu konzentrieren). Die Neuronen des Hirnstamms(2), die den REM-Schlaf(7)ausschalten, liegen tiefer im Pons(2) in einem aus dem dorsalen Raphe-Kern(2) und dem Nucleus locus coeruleus(2)(2) bestehenden Komplex (siehe Abb. 1). Sie setzen Serotonin(1) bzw. Noradrenalin(1) frei. Ebenso wie Azetylcholin(2) modulieren diese neurochemischen Substanzen verschiedene Aspekte des Bewusstseinsgrades.
Hobson(2) kombinierte diese Entdeckungen mit der Tatsache, dass der REM-Schlaf automatisch, einem Uhrwerk gleich, etwa alle neunzig Minuten ein- und wieder ausgeschaltet wird, und zog die unausweichliche Schlussfolgerung: »Die primäre Motivationskraft des Träumens ist nicht psychologischer, sondern physiologischer Art, weil Zeitpunkt und Dauer des Traumschlafs(1) weitgehend konstant sind, was eine vorprogrammierte, neural determinierte Genese vermuten lässt.«[14]
Weil der REM-Schlaf(8) im cholinergen Hirnstamm(3) entsteht, einem alten und tiefen Bereich des Hirns weit entfernt vom majestätischen Kortex, in dem sich wahrscheinlich das gesamte Geschehen der menschlichen Psychologie abspielt, fügte Hobson hinzu, dass das Träumen unmöglich durch Wünsche motiviert sein könne, sondern »motivational neutral« sei.[15] Seiner Meinung nach lag Freud mit der Auffassung, dass den Träumen latente Wünsche zugrunde liegen, völlig falsch. Die Bedeutung, die Freud in Träumen(1)(1) zu erkennen glaubte, war in ihnen genauso wenig enthalten wie in Tintenklecksen. Sie wurde auf sie projiziert; sie war dem Traum nicht inhärent. Unter dem wissenschaftlichen Blickwinkel Hobsons betrachtet, leistete die Traumdeutung nicht mehr als das Lesen im Kaffeesatz.
Weil die gesamte Psychoanalyse auf der Methode gründete, mit deren Hilfe Freud(3) Träume erforschte, konnte man das Theoriegebäude, das er auf diese Weise errichtet hatte, samt und sonders ad acta legen. Nachdem Hobson mit der Vorstellung, Träume könnten eine Bedeutung in sich bergen, gründlich aufgeräumt hatte, stand es der Psychiatrie frei, ihre traditionelle Abhängigkeit(1) von introspektiven Berichten zu überwinden und sich stattdessen auf objektive neurowissenschaftliche (insbesondere neurochemische) Forschungs- und Behandlungsmethoden zu stützen. War es in den 1950er Jahren beinahe unmöglich gewesen, als Nicht-Psychoanalytiker auf einen Lehrstuhl für Psychiatrie an führenden US-amerikanischen Universitäten berufen zu werden, trifft heute das Gegenteil zu: Es ist beinahe unmöglich, Professor für Psychiatrie zu werden, wenn Sie Psychoanalytiker sind.
Damals hat mich all dies nicht sonderlich berührt. Ich hielt die Frage, auf die sich meine Forschungen im Zusammenhang mit meiner Dissertation konzentrierte, für klar und überschaubar und zog überhaupt nicht in Betracht, dass sie irgendetwas mit den Auseinandersetzungen über das freudianische und das behavioristische Erbe zu tun haben könnte. Ich wollte lediglich eines wissen: Wie wirken sich Läsionen in verschiedenen Bereichen des Vorderhirns und seines Kortex auf das tatsächliche Traumerleben(1) aus? Wenn das Vorderhirn, psychologisch gesehen, der Ort des Geschehens war, dann musste es irgendeinen Beitrag zum Träumen leisten.
Die Abteilung für Neurochirurgie der Universität Witwatersrand hatte Stationen in zwei Lehrkrankenhäusern, dem Baragwanath Hospital und dem Johannesburg General Hospital. Baragwanath, ein weitläufiges ehemaliges Militärkrankenhaus in der »nicht-europäischen« Township Soweto, war auf dem Höhepunkt der Apartheidpolitik in Südafrika ein Meer des Elends. Das Johannesburg General Hospital hingegen, eine Universitätsklinik höchsten Niveaus und für »Europäer« reserviert, war ein Monument des Rassismus. Die neurochirurgische Abteilung hatte auch Betten in der Brain and Spine Rehabilitation Unit des Edenvale General Hospital, einem alten Kolonialbau außerhalb Johannesburgs. Ab 1985 habe ich an allen drei Orten gearbeitet und Jahr für Jahr Hunderte Patienten untersucht. 361 von ihnen habe ich in die Forschung für meine Dissertation einbezogen, die sich über die nächsten fünf Jahre erstreckt.
Nachdem ich gelernt hatte, Elektroenzephalografen und ähnliche Techniken zu benutzen und die für die verschiedenen Schlafphasen typischen Hirnwellen zu erkennen, konnte ich Menschen während des REM-Schlafs(9)(3), in dem die Wahrscheinlichkeit, dass sie träumten, am höchsten war, wecken. Ich konnte neurologische Patienten am Krankenbett nach Veränderungen ihrer Träume fragen und diese Gespräche über Tage, Wochen und Monate mit ihnen fortführen. Auf diese Weise untersuchte ich, ob der Inhalt ihrer Träume durch lokalisierte Schädigungen unterschiedlicher Bereiche des Gehirns systematisch beeinflusst wurde. Der zweifelhaften Reputation der Träume zum Trotz nahm ich an, dass es glaubwürdig sei, wenn Patienten mit Läsionen desselben Hirnbereichs dieselbe inhaltliche Veränderung ihrer Träume schilderten. Diese Methode wird als »kliniko-anatomische Korrelation(1)« bezeichnet: Indem man die psychischen Fähigkeiten von Patientinnen und Patienten klinisch untersucht, stellt man fest, wie sich eine psychische Funktion durch Schädigung einer Hirnregion verändert hat; sodann korreliert man diese Veränderung mit dem Ort der Läsion und erhält so Hinweise auf die Funktion der verletzten Hirnstruktur. Auf dieser Grundlage lassen sich dann überprüfbare Hypothesen formulieren. Schon Jahrzehnte zuvor hatte man mit dieser Methode alle wesentlichen kognitiven Funktionen wie Wahrnehmung, Erinnerung und Sprache systematisch untersucht, nicht aber das Träumen.
Anfangs war mir ein wenig mulmig zumute bei der Vorstellung, mit schwerkranken Menschen über ihre Träume zu sprechen. Viele von ihnen standen vor lebensgefährlichen Hirnoperationen oder hatten den Eingriff gerade erst hinter sich, so dass ich fürchtete, sie könnten meine Fragen für albern halten. Zu meiner Überraschung aber hatten meine Patientinnen und Patienten nichts dagegen, mir die Veränderungen zu schildern, die ihre neurologischen Probleme für ihr psychisches Leben mit sich brachten.
Als ich mit meinen Untersuchungen begann, lagen mehrere veröffentlichte Fallberichte vor, in denen dieselben Auswirkungen, die man bei Versuchstieren beobachtet hatte, für Menschen beschrieben wurden: Der REM-Schlaf(10)(3) ging durch Schädigungen des mesopontinen Tegmentums verloren (siehe Abb. 1). Erstaunlicherweise hatte sich aber niemand die Mühe gemacht zu fragen, ob und wie sich die Träume dieser Patienten verändert hatten – ein klareres Beispiel dafür, wie sich das Vorurteil in der Neurowissenschaft gegen subjektive Daten behaupten kann, gibt es kaum.[16]
Ich erwartete, im Zuge meiner Untersuchungen das Offensichtliche zu beobachten, nämlich dass Patienten mit Verletzungen des visuellen Kortex non-visuelle Träume(1) träumen würden, Patienten mit Schädigungen der Sprachzentren nonverbale Träume(1), Patienten mit Verletzungen des somatosensorischen und des motorischen Kortex hemiplegische Träume usw. Das entspräche dem kleinen Einmaleins der Hirn-Verhalten-Korrelation, und ich wollte es nachweisen. Es ist mir gelungen.[17]
Zu meinem Erstaunen aber fand ich neben all dem Offensichtlichen, das ich beobachtete, heraus, dass auch Patienten mit Verletzungen jener Hirnregion, die den REM-Schlaf erzeugt, weiterhin träumten. Zudem hatten Patienten, die wirklich gar nicht mehr träumten, Verletzungen in einem ganz anderen Bereich des Gehirns erlitten. Träumen und REM-Schlaf waren demnach sogenannte »doppelt dissoziierbare« Phänomene(11)(1)[18]: miteinander korreliert (zumeist gleichzeitig auftretend), aber nicht identisch.[19]
Beinahe fünfzig Jahre lang hatten Hirnforscher, die auf dem Gebiet der Schlafwissenschaft tätig waren, Korrelation mit Identität verwechselt. Sobald sie nachgewiesen hatten, dass der REM-Schlaf(12)(4) mit Träumen einhergeht, zogen sie eiligst die Schlussfolgerung, beides gleichsetzen zu können, und scherten sich nicht länger um die lästige subjektive Seite der Korrelation. Mit ganz wenigen Ausnahmen erforschten sie fortan lediglich den REM-Schlaf, und zwar überwiegend an Versuchstieren, die ohnehin keine introspektiven Aussagen machen können. Der Fehler kam erst ans Licht, als ich begann, meinem neurowissenschaftlichen Interesse am Traumerleben(1)neurologischer Patienten nachzugehen.
Als ich in den 1990er Jahren erstmals berichtete, dass das Träumen durch Verletzungen eines Hirnbereichs verloren gehe, der mit der für den REM-Schlaf zuständigen Region nicht identisch ist, legte ich großen Wert darauf zu betonen, dass sich dieser kritische Bereich nicht im Hirnstamm befindet.[20] Ich wollte den geistig-psychischen Charakter des Träumens herausstreichen, und wir alle wissen, dass geistig-psychische Funktionen(2) im Kortex lokalisiert sind.
Tatsächlich entdeckte ich zwei Bereiche, deren Schädigung zum Verlust des Träumens bei Erhalt des REM-Schlafs führt. Der erste ist der Kortex im unteren Parietalläppchen (siehe Abb. 2). Dieser Fund war keine Überraschung, denn der Parietallappen(1) spielt für das Kurzzeitgedächtnis(1) eine wichtige Rolle. Wenn eine Patientin Gedächtnisinhalte nicht im Bewusstseinsspeicher bewahren kann, wie soll sie dann einen Traum erleben können? Ungleich interessanter war die zweite Hirnregion, nämlich die weiße Substanz(1) des ventromesialen Quadranten der Frontallappen(1), die den frontalen Kortex mit verschiedenen subkortikalen Strukturen verbindet. Mit diesem Fund war nicht zu rechnen gewesen; die Funktionen dieser Hirnregion weisen auf den ersten Blick keinerlei Verbindung mit dem manifesten Traumerleben auf, und dennoch muss sie einen entscheidenden Beitrag zum Traumgeschehen leisten, weil ihre Verletzung zuverlässig zu einem Totalausfall des Träumens führt.
Abb. 2 Die beiden Areale, deren Verletzung zum Ausfall des Träumens führt, nämlich die ventromesiale weiße Substanz des Frontallappen(2)(2)s (links) und des inferioren Scheitellappens(1) des Kortex (rechts) sind in dieser Abbildung schattiert eingezeichnet. Zu sehen sind auch das ventro-tegmentale Areal des Hirnstamms sowie die davon ausgehenden wichtigen Faserbahnen. Wohlgemerkt: Die Läsionsstelle im ventromesialen Frontallappen zieht diese subkortikalen Leitungsbahnen(1) in Mitleidenschaft, die nicht innerhalb, sondern unterhalb des Kortex verlaufen. Ein Hauptzielort dieser Leitungsbahnen ist der ebenfalls eingezeichnete Nucleus accumbens.
Ich sage »zuverlässig«, obwohl ich nur neun Fälle dokumentiert habe, in denen Patienten nach Läsionen der Frontallappen(3)(1) nicht länger träumten (sowie 44 Fälle mit Läsionen des unteren Parietalläppchens). Solche Verletzungen sind in der gewöhnlichen klinischen Praxis extrem selten. Die Korrelation ist dennoch zuverlässig. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die weiße Substanz(3) im ventromesialen Frontallappen chirurgisch in Tausenden von Fällen mit einer Technik ins Visier genommen, die man als modifizierte präfrontale Leukotomie bezeichnete. In jener Zeit des neurochirurgischen Übereifers entdeckten die Psychiater, dass schwerwiegende psychische Erkrankungen durch eine vollständige chirurgische Zerstörung der Präfrontallappen(1) (bezeichnet als Frontallobotomie(1)) gemildert werden konnten; sie stellten allerdings auch fest, dass dieses radikale Verfahren zahlreiche »Nebenwirkungen«, wie sie es euphemistisch ausdrückten, mit sich brachte. Deshalb reduzierten sie das Ausmaß der Läsion und versuchten, den kleinsten Teil der Frontallappen zu identifizieren, dessen Abtrennung vom übrigen Gehirn die erwünschten Resultate liefern würde. Walter Freeman(1)s und James Watts’(1) modifiziertes Verfahren war die Antwort. Durchgeführt wurde es mit einem speziell entwickelten winzigen, surrenden Instrument, dem Leukotom, das durch die Augenhöhle eingeführt wurde, um die weiße Substanz im ventromesialen Quadranten der Frontallappen zu zerstören (präfrontale Leukotomie(1)). Dieser Bereich deckte sich exakt mit demjenigen, in dem meine neun Patienten Schädigungen erlitten hatten.
Ich holte also die alte psychochirurgische Literatur wieder hervor, um zu schauen, ob sie meine eigenen Beobachtungen bestätigte.[21] Nicht ohne Grund hoffte ich, dass die Behandler der klassischen Leukotomiepatienten diese im Anschluss an die Operationen auch nach ihren Träumen befragt hatten, denn von den damaligen Psychiatern wurden Träume schließlich noch ernst genommen. Und tatsächlich – ich hatte mich nicht getäuscht. Jene Ärzte dokumentierten drei wichtige psychologische Konsequenzen der präfrontalen Leukotomie. Erstens reduzierte der Eingriff positive psychotische Symptome (Halluzinationen(2) und Wahnvorstellungen(1)). Zweitens schwächte er die Motivation. Drittens führte er zum Verlust des Träumens. Einer jener frühen psychochirurgischen Experten vermutete sogar, dass postoperatives Träumen in diesen Fällen auf eine schlechte Prognose verweise.[22]
Dieser Punkt brachte mich auf die richtige Spur. Ich musste herausfinden, welcher der zahlreichen neuralen Schaltkreise im ventromesialen Quadranten der Stirnlappen(4) mit höchster Wahrscheinlichkeit für den Verlust des Träumens verantwortlich war. Gleichzeitig war dies auch ein erster Hinweis darauf, weshalb wir den Schuldigen in dieser unerwarteten Hirnregion finden würden. Was sind Träume anderes als Halluzinationen(3) und Wahnvorstellungen(2)? Aus ebendiesem Grund war das fortgesetzte Träumen nach einer Leukotomie als schlechtes prognostisches Zeichen anzusehen.
Die neurochirurgische Behandlung von Halluzinationen(4) fiel in Ungnade, aber nicht aus ethischen Gründen, sondern weil in den 1950er Jahren Medikamente auf den Markt kamen, mit denen sich bei niedrigerer Morbiditäts- und Mortalitätsrate gleichwertige therapeutische Resultate erzielen ließen. Ebenso wie heutige moderne Antipsychotika blockierten diese sogenannten »Neuroleptika(1)« den Neurotransmitter Dopamin an den Synapsen eines Hirnschaltkreises, der als mesokortikal-mesolimbisches(1) Dopaminsystem bezeichnet wird (siehe Abb. 2). Weil dieser Schaltkreis bei der Präfrontalleukotomie durchtrennt wird, so wie er bei meinen neun Patienten durch natürliche Läsionen durchtrennt worden war, stellte ich die These auf, dass er das System sei, das die Träume erzeugt.
Weitere Experimente haben meine These bestätigt. Zuvor schon hatte man nachgewiesen, dass eine pharmakologische Stimulierung dieses Kreislaufs die Frequenz, Länge und Intensität der Träume ohne entsprechende Auswirkungen auf den REM-Schlaf erhöht.[23] Bei dem fraglichen Medikament handelte es sich um Levodopa(1), die gleiche Substanz, die Oliver Sacks benutzt hatte, um seine post-enzephalitischen Patienten »aufzuwecken«. Neurologen, die Dopaminstimulantien zur Behandlung des Morbus Parkinson(1) verschreiben, wissen seit langem, dass sie sorgfältig darauf achten müssen, ihre Patienten nicht, wie es Sacks passierte, in eine Psychose zu treiben. Das Einsetzen ungewöhnlich lebhafter Träume ist häufig das erste Anzeichen dieser Nebenwirkung.[24] Entscheidend war die Beobachtung, dass die Neuronen, die diesen Schaltkreis bilden (die Zellkörper im ventrotegmentalen Areal), während des Traumschlafs(2) mit maximaler Frequenz feuern[25] und gleichzeitig maximale Mengen an Dopamin an ihre Zielregion im Nukleus accumbens liefern (siehe Abb. 2).[26] Deshalb erkennt man heute weithin an, dass das Träumen unabhängig vom REM-Schlaf auftreten kann und der mesokortiko-mesolimbische Dopamin-Schaltkreis(2) tatsächlich die maßgebliche Antriebskraft des Träumens(1) ist.[27]
Bei Verletzungen der cholinergen Leitungsbahnen(1) im ventromesialen Quadranten der Frontallappen (die in den Kernen des basalen Vorderhirns entspringen) passiert genau das Gegenteil dessen, was bei Läsionen der dopaminergen Leitungsbahnen eintritt: Die Patienten träumen nicht weniger, sondern mehr. Hobson(3) hatte behauptet, Azetylcholin(3) sei der motivational neutrale Traumerzeuger, aber die medikamentöse Blockierung von Azetylcholin hat die gleichen Folgen wie die Verletzung seiner Leitungsbahnen. Heute weiß man, dass anticholinerge Medikamente – Azetylcholinblocker(1) – exzessives Träumen verursachen.[28] Mit anderen Worten: Die Blockierung des neuralen Systems, das Hobson(4) als Antriebskraft des Träumens betrachtete, bewirkt genau das Gegenteil dessen, was seine Theorie vorhersagte.
Rasch wurde klar, dass die Neurowissenschaft Freud Abbitte leisten musste. Wenn es einen Bereich des Gehirns gibt, der für »Wünsche« zuständig sein könnte, dann ist es der alles andere als motivational neutrale mesolimbisch-mesokortikale Dopamin-Schaltkreis(3). Edmund Rolls(1) (und viele andere) bezeichnen ihn als »Belohnungs«-System(1).[29] Kent Berridge(1) spricht vom »Wollen-System« [›wanting‹ system].(1) Jaak Panksepp charakterisiert ihn als SEEKING-System(1) und betont insbesondere dessen Funktion der Nahrungssuche.[30] Ebendieser Hirnschaltkreis ist für das »energischste Explorations- und Suchverhalten verantwortlich, das ein Tier überhaupt zeigen kann«.[31] Und er ist der Schaltkreis, der auch das Träumen erzeugt.[32]
Hobson war nicht eben begeistert. Er lud mich ein, meine Ergebnisse seiner Forschungsgruppe in der neurophysiologischen Abteilung der Harvard University vorzustellen. Zunächst erkannte er sie an und veröffentlichte eine wohlwollende Besprechung des Buches, das ich 1997 zu dem Thema veröffentlicht hatte. Er wies darauf hin, dass meine kliniko-anatomischen Beobachtungen bis ins letzte Detail durch Allen Brauns(1) bildgebende Untersuchungen bestätigt würden (siehe Abb. 3, S. 42).[33] Als ihm dann aber klar wurde, dass diese Entwicklungen womöglich eine im Großen und Ganzen freudianische Auffassung des Träumens rechtfertigen könnten, schrieb er mir, dass er nur dann bereit sei, meine Ergebnisse öffentlich zu bestätigen, wenn ich nicht behaupten würde, dass sie zugunsten Freuds sprächen. So viel zur vermeintlichen Objektivität der Neuropsychologie.
Meine Entdeckung betraf indes noch einen weiteren, sehr überraschenden Aspekt. Als mir auffiel, dass sich die Neuronen, die diesen Schaltkreis antreiben, im Hirnstamm(4) befinden (ebenso wie diejenigen des Schaltkreises, der den REM-Schlaf erzeugt), widmete ich dieser Beobachtung zunächst keine besondere Aufmerksamkeit. Ich wollte, wie gesagt, den psychischen Charakter des Träumens betonen. Allen Braun(2), der oben erwähnte Neurowissenschaftler, wies mich höflich darauf hin, dass ich etwas übersehen hatte. Im Kontext meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Hobson über die Frage, welche Hirnschaltkreise den Traumprozess erzeugen (dopaminerge oder cholinerge), schrieb Braun:
Merkwürdig ist, dass Solms, nachdem er nachzuweisen versucht hat, dass Vorderhirnstrukturen(1) eine kritische Rolle im Traumsystem spielen müssen, am Ende die Auffassung vertritt, dass es die dopaminergen Afferenzen zu diesen Regionen seien, die [Träume(1)(5) erzeugen] – womit er den Impulsgeber des Träumens in den Hirnstamm zurückverlegt.[34]
Braun zog den Schluss: »Für mich klingt es, als könnten diese Herren hier auf einen gemeinsamen Nenner kommen.«[35] In den 1990er Jahren nahm ich ebenso wie die gesamte Neuropsychologie an, dass sich das psychische Geschehen samt und sonders im Kortex abspiele, und so konzentrierte ich mich auf die Tatsache, dass sich die Bereiche der weißen Substanz, die mich interessierten, in den Frontallappen(5) befanden, in denen meine neun Patienten Läsionen erlitten hatten. Aber sämtliche Kerne des Hirnstamms senden lange Axone hinauf ins Vorderhirn (siehe Abb. 2, S. 32). Die Zellkörper dieser Neuronen befinden sich im Hirnstamm, wenngleich ihre ausgehenden Fasern (die Axone) im Kortex enden. Dies unterstreicht die entscheidende (1)(1)Arousalfunktion dieser Hirnstammkerne(2), die in ihrer Gesamtheit als retikuläres Aktivierungssystem(1) bezeichnet werden. Diese aktivierenden Leitungsbahnen waren bei meinen neun Patienten und zuvor bei den Hunderten dokumentierter nicht-träumender Leukotomie-Patienten verletzt worden.
Unter anderem aufgrund von Brauns Kommentaren zu den Implikationen meiner Entdeckung lenkte ich meine Aufmerksamkeit ab 1999 auf die übrigen Arousalsysteme des Hirnstamms. Die interessanteste Arbeit auf diesem Gebiet stammt von Jaak Panksepp,(4) der in seinem enzyklopädischen Werk Affective Neuroscience (1998) bewundernswert detailliert ein breites Spektrum an Belegen für seine Ansicht aufführt, dass diese vermeintlich geistlosen, lediglich für den »Grad« des Bewusstseins(2) verantwortlichen Systeme einen »Inhalt« eigener Art erzeugen.
Dies sollte sich als hochbedeutsam erweisen.
Kapitel 2
Vor und nach Freud
1987 traf ich eine weitere (4)Entscheidung, die mich in Konflikt mit meinem Feld brachte. Ich beschloss, eine Ausbildung zum Psychoanalytiker zu machen.[1] Die sich abzeichnenden Ergebnisse meiner Traumforschung hatten mich davon überzeugt, dass subjektive Berichte eine maßgebliche Rolle in der Neuropsychologie spielen müssen und dass das Fach aufgrund seiner feindseligen Einstellung gegenüber Freud auf mehr als nur einen Holzweg geraten war.
Endgültig überzeugt hat mich ein Seminar Jean-Pierre de la Portes(1), eines Professors für Vergleichende Literaturwissenschaft, das ich Mitte der 1980er Jahre an der University of the Witwatersrand besuchte. Eines der Seminarthemen war Freuds Werk Die Traumdeutung, für das ich mich im Zusammenhang mit meiner Doktorarbeit interessierte. Damals war ich, wie fast jeder, skeptisch, was Freud betraf. Schon im Grundstudium hatte man mir vermittelt, dass die Psychoanalyse eine »Pseudowissenschaft« sei. In den sogenannten harten Wissenschaften gab es niemanden, der sie noch ernst nahm, und wahrscheinlich fand das Seminar aus ebendiesem Grund in einem geisteswissenschaftlichen Fachbereich statt. Ich hatte mich zur Teilnahme entschlossen, weil Freud bereit gewesen war, über den Inhalt von Träumen, das Thema meiner Studien, zu sprechen.
De la Porte erklärte, dass man die theoretischen Schlussfolgerungen Freuds nicht verstehen könne, ohne zunächst ein noch früher, nämlich 1895 entstandenes Manuskript zu »verdauen«, das erst 1950, elf Jahre nach seinem Tod, veröffentlicht worden war. Dieses Manuskript trägt den Titel »Entwurf einer Psychologie«.[2] Freud versuchte hier, seine frühen Erkenntnisse über die Psyche auf eine neurowissenschaftliche Grundlage zu stellen.
Damit trat er in die Fußstapfen seines berühmten Lehrers, des Physiologen Ernst Brücke(1), eines Gründungsmitglieds der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin. Deren Aufgabe hatte Emil du Bois-Reymond(1) 1842 wie folgt formuliert:
Brücke und ich haben uns verschworen, die Wahrheit geltend zu machen, daß im Organismus keine anderen Kräfte wirksam sind, als die gemeinen physikalisch-chemischen; daß, wo diese bislang nicht zur Erklärung ausreichen, mittels der physikalisch-mathematischen Methode entweder nach ihrer Art und Weise der Wirksamkeit im konkreten Fall gesucht werden muß, oder daß neue Kräfte angenommen werden müssen, welche, von gleicher Dignität mit den physikalisch-chemischen, der Materie inhärent, stets auf nur abstoßende oder anziehende Componenten zurückzuführen sind.[3]
Johannes Müller(1)