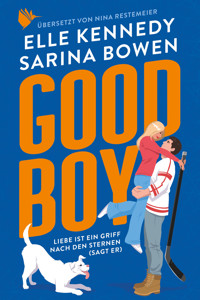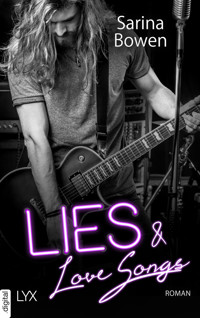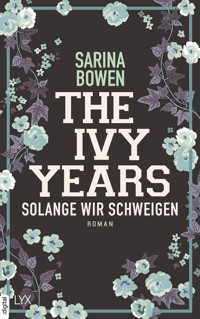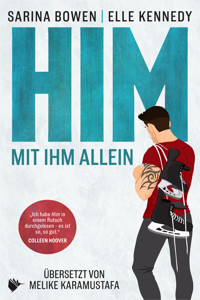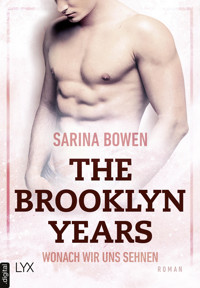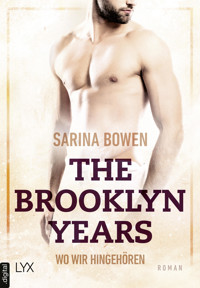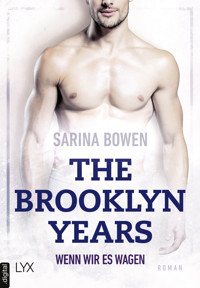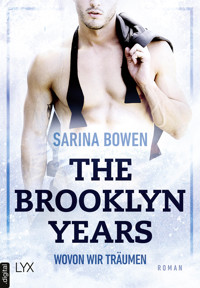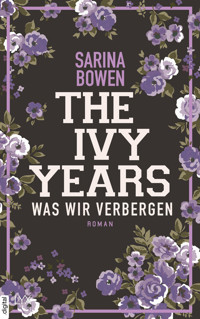
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ivy-Years-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wie lange kannst du ein Geheimnis verbergen, bevor es deine Liebe für immer zerstört?
Direkt bei ihrer ersten Begegnung am Harkness College spüren Scarlet Crowley und Bridger McCaulley die starke Anziehung, die zwischen ihnen herrscht. Jeder Blick, jede flüchtige Berührung lässt ihre Herzen höher schlagen - und es fällt ihnen immer schwerer, einander zu widerstehen. Dabei haben Scarlet und Bridger gute Gründe, sich dem anderen nicht vollkommen zu öffnen. Denn sie verbergen beide ein Geheimnis, das nicht nur ihr bisheriges Leben am College, sondern vor allem auch ihre gemeinsame Zukunft zerstören könnte ...
"Sarina Bowen schreibt New Adult, wie es besser nicht sein könnte!" Tammara Webber
Band 2 der Ivy-Years-Reihe von USA-Today-Bestseller-Autorin Sarina Bowen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchTEIL EINS123456 7 8 910 11 TEIL ZWEI12 13 14 1516 17 18 1920DREI MONATE SPÄTER21 Die AutorinImpressumSARINA BOWEN
The Ivy Years
Was wir verbergen
Roman
Ins Deutsche übertragen von Ralf Schmitz
Zu diesem Buch
Als Scarlet Crowley ihr erstes Semester am Harkness College beginnt, hat sie nur einen Wunsch: ihre schlimme Vergangenheit hinter sich lassen und weit weg von zu Hause neu anfangen. Ein Wunsch, der noch stärker wird, als sie Bridger McCaulley begegnet, der sie vom ersten Augenblick an in seinen Bann zieht. Doch was Scarlet nicht weiß: Bridger verbirgt selbst ein Geheimnis. Er versteckt seine kleine Schwester Lucy im Wohnheim, um die er sich liebevoll kümmert, seit er sie von ihrer drogensüchtigen Mutter wegholte. Sollte Lucy entdeckt werden, steht nicht nur sein Abschluss am College auf dem Spiel, er könnte auch seine Schwester an die Jugendfürsorge – und damit für immer – verlieren. Und das will er auf keinen Fall zulassen. Aber wie lange können Scarlet und Bridger die Wahrheit voreinander verbergen, ohne dass diese Geheimnisse ihre Liebe zerstören?
TEIL EINS
»Ach nein, wenn sie das Zeichen auch verbirgt, die Qual im Herzen wird sie ja doch nicht los.«
– Nathaniel Hawthorne: Der scharlachrote Buchstabe
1
Die Aufgabe einer Torhüterin
Scarlet
In der Sekunde, in der ich den Garagentoröffner summen hörte, setzte ich mich in Bewegung. Ich musste nicht erst aus dem Fenster sehen, um mich davon zu überzeugen, dass meine Eltern wegfuhren. Wenn der Rasen vor dem Haus von drei neuen Vans belagert wird, öffnet man das Garagentor nicht einfach so zum Spaß. Die Nachrichtensender hatten im letzten Jahr Tausende Fotos vom Innenleben unserer Garage geschossen. Es hätte sich ja etwas Berichtenswertes darin befinden können.
Aber jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, sich damit zu befassen.
Kaum hörte ich das Auto meiner Eltern auf der Straße Fahrt aufnehmen, riss ich auch schon meine Schranktür auf und holte die längst gepackten Reisetaschen und den Bücherkarton heraus. Dann trug ich die Sachen nach und nach zur Haustür. Als Nächstes lief ich noch mal nach oben, nahm den Abschiedsbrief aus der Schreibtischschublade und legte ihn mitten aufs Bett.
Liebe Mom, lieber Dad,
ich habe mich mit meinem Einzugstag vertan. Es fängt schon am dritten an. Ich muss los, rufe Euch aber heute Abend an. Das Durcheinander tut mir leid. Hab Euch lieb, S.
Meine Nachricht enthielt so viele Halbwahrheiten, dass es schon nicht mehr lustig war. Aber so lief es nun mal in der Casa Ellison. Wir verbogen die Wahrheit nach Bedarf. Ich hatte es mein ganzes Leben so gehalten, auch wenn ich siebzehn Jahre gebraucht hatte, um herauszufinden, wie weit die Täuschungen tatsächlich gingen.
Als Letztes trug ich Jordan nach unten – meine Gitarre. Ohne Jordan wäre ich niemals irgendwo hingegangen.
Danach rannte ich ein weiteres Mal nach oben und flitzte in mein Zimmer. Allerdings nicht aus Sentimentalität. Das Zimmer war schön – geräumig und mit Möbeln aus Ahornholz eingerichtet –, hatte sich im letzten Jahr für mich jedoch in eine Gefängniszelle verwandelt. Ich betrat es deshalb noch einmal, weil ich meine Hockeyausrüstung in den begehbaren Kleiderschrank befördern musste. Schlittschuhe, Torhüterschläger, Polster. Ich versteckte alles in der Hoffnung, dass meine Mutter die Sachen vorläufig nicht fand. Die Entscheidungen, die ich in den vergangenen Wochen getroffen hatte, hatten sie sowieso schon an den Rand eines Nervenzusammenbruchs getrieben. Je länger ich den Streit darüber, dass ich nicht mehr Eishockey spielen wollte, hinauszögern konnte, desto besser.
Ich machte die Schranktür zu, ging zum Fenster und warf einen Blick durch die Lamellen der Jalousie. Auf dem Rasen hatten sich drei Kamerateams aufgebaut. Was nicht erlaubt war. Sie hätten unser Grundstück gar nicht erst betreten dürfen. Leider setzte die Polizei in der Stadt diese Regel nicht durch. Nicht für meine Familie. Ich war mir nicht mal sicher, ob die Feuerwehr ausrücken würde, wenn unser Haus in Flammen stand.
Die Reporter vor dem Haus unterhielten sich vermutlich über Sport, das Wetter oder irgendetwas anderes, solange es nichts zu berichten gab. Einer mischte Spielkarten, was bedeutete, dass sie sich gleich für eine Pokerpartie auf ihren Klappstühlen niederlassen würden.
Perfekt.
Ich lief zum letzten Mal die Treppe hinunter und öffnete die Tür zur Garage. Der Leibwächter meines Vaters hatte die Tür wie immer nach dessen Abfahrt wieder zugemacht. So war dieses Ekelpaket wenigstens zu irgendetwas nutze. Meine Eltern nannten ihn »unseren Fahrer«, aber das war nur eine weitere Schönfärberei. Keiner wollte über den wahren Grund seines Hierseins sprechen. Aber ein Mann, dem Kindesmissbrauch in zahlreichen Fällen vorgeworfen wurde, ließ sich natürlich gerne den Rücken von einem ehemaligen Scharfschützen freihalten, wenn er mal aus dem Haus ging.
Hastig warf ich mein Zeug ins Auto und schloss so behutsam wie möglich die Türen. Als ich am Steuer saß, gönnte ich mir einen Moment, um mich davon zu überzeugen, dass ich auch alles dabeihatte.
Da war meine Handtasche, in der mein nagelneuer Führerschein steckte. Und da mein Gepäck. Daneben lag Jordan. Keine Hockeyausrüstung.
Gut.
Ich ließ den Motor an und betätigte den Garagentoröffner. Man hatte mir beigebracht, dass es ein Verbrechen war, einen Wagen zu starten, ohne ihn vorher warmlaufen zu lassen. Aber die Lage war ernst und duldete keinen Aufschub. Der noble deutsche Motor würde mir dieses eine Mal verzeihen müssen, da ich dringend das Überraschungsmoment nutzen wollte.
Kaum war der SUV unter dem sich noch immer hebenden Garagentor hindurchgeglitten, schoss ich rückwärts die Auffahrt hinunter. Dummerweise versperrten mir die Übertragungswagen die Sicht auf die Straße. Daher musste ich kurz anhalten, um mich zu vergewissern, dass ich freie Fahrt hatte.
Die Kameraleute erhoben sich unsicher von ihren Klappstühlen. Sie hatten eben erst den Wagen meines Vaters gesehen. Für den Fall, dass es später am Tag irgendwas über ihn zu berichten gab, hatten sie seine Abfahrt vorsichtshalber auf Film gebannt. Ich war indes kein Thema, schon gar nicht am Labor-Day-Wochenende und am allerwenigsten allein. Ein kurzer Blick bestätigte mir, dass sich keiner auf seine Kamera stürzte. Yesss!
Vorsichtig setzte ich weiter zurück – jetzt mit einem Übertragungswagen zusammenzustoßen hätte mir meinen Abgang bestimmt nicht erleichtert – und rollte langsam die Straße hinunter.
Mit rasendem Herzen fuhr ich an den Häusern unserer ordentlichen Universitätsstadt in New Hampshire vorbei. Die Flucht war mir gelungen. Ein ganzes Jahr lang hatte ich auf diesen Moment gewartet. Indem ich mich heimlich davonmachte, konnte ich den von meiner Mutter vor laufenden Kameras tränenreich inszenierten Abschied der perfekten Tochter aufs College vermeiden. Ich hatte die Schnauze voll von aufgezwungenen gestellten Fototerminen. Außerdem ersparte mir der heimliche Abflug den Abschied von meinem Vater. Wir hatten es schon vor den jüngsten Skandalen nicht leicht miteinander gehabt. Ich hatte in ihm immer ein Relikt des vergangenen Jahrhunderts gesehen – streng, viel zu beschäftigt, um sich für meine Belange zu interessieren, es sei denn, ich stand auf Schlittschuhen. (Zu beschäftigt war er inzwischen nicht mehr, aber immer noch streng.) Unser Verhältnis war immer eher kühl gewesen, jetzt aber herrschten geradezu antarktische Temperaturen zwischen uns. Der frühere Workaholic hing mittlerweile den ganzen Tag in einem Lehnstuhl in seinem Arbeitszimmer ab. Ich setzte schon lange keinen Fuß mehr in dieses Zimmer, in dem die Atmosphäre mit angestautem Zorn und Schweigen aufgeladen war. Manchmal jedoch warf ich ihm verstohlene Blicke zu und fragte mich, ob er all das, was man ihm vorwarf, tatsächlich getan hatte. Und warum. Und wie ich so lange mit ihm unter einem Dach hatte leben können, ohne etwas zu bemerken.
Mein Herz war voller hässlicher Fragen. Doch selbst wenn ich sie gestellt hätte, hätte ich mich nicht darauf verlassen können, von irgendjemandem in meiner Familie eine ehrliche Antwort darauf zu bekommen.
Ich beschleunigte und fuhr über Nebenstraßen Richtung Highway 91. Shannon Ellison ließ Sterling, New Hampshire, im Rückspiel immer kleiner werden, damit anderthalb Stunden später Scarlet Crowley in Harkness, Connecticut, aus ihrem Auto steigen konnte.
»Scarlet Crowley«, murmelte ich leise vor mich hin. Ich musste mir angewöhnen, auf meinen neuen Namen zu reagieren. Was sich zuerst sicher seltsam anfühlen würde. Wenn ich es mir recht überlegte, allerdings nicht mal halb so seltsam, wie das Eishockeyspielen an den Nagel zu hängen. Hockey war mein Leben gewesen. Seit meinem elften Lebensjahr hatte ich im Tor gestanden und so viele Stunden zwischen den Pfosten verbracht, dass ich sogar noch im Schlaf Torschüsse verhinderte.
Die Aufgabe einer Torhüterin besteht nicht allein darin, sich auf den Puck zu werfen. Sie muss die gesamte Eisfläche im Auge behalten. Beobachten, welche Richtung das Drama auf dem Feld nimmt, bevor der Puck auf das Netz zugeflogen kommt. Ich hatte mir beigebracht, die jeweilige Spielerin mit dem Puck vor dem Schläger an ihrer Schulterhaltung einzuschätzen, sodass ich voraussehen konnte, wer passte und wer einen Torschuss wagte. Ich behielt den Überblick, wie Schachspieler es taten, wenn sie sich auf mehrere Züge im Voraus und alle möglichen Folgen gefasst machten.
Meine Schule hatte die letzten drei Meisterschaften des Bundesstaats gewonnen. In Folge. Im heimischen Wohnzimmer zeugte eine Reihe Trophäen von meinen Fähigkeiten im Tor. Und bis vor einem Jahr hatte ich die Auszeichnungen für verdient gehalten. Aber wie sich zeigte, war ich nicht mal annähernd so toll, wie ich immer geglaubt hatte.
Es ist die Aufgabe der Torhüterin, Lücken in der Verteidigung vorherzusehen. Im Leben allerdings hatte ich in dieser Hinsicht komplett versagt. Als die abstoßenden Geschichten über meinen Vater unser Familienleben zu vergiften begannen, war ich vollkommen unvorbereitet gewesen. Die Widerwärtigkeit traf mich wie ein mit voller Wucht geschlagener Puck vor die Brust, riss mich von den Füßen und verschlug mir den Atem.
Mein früheres Leben war aus und vorbei. Ich hatte ein Jahr Zeit gehabt, mich daran zu gewöhnen, die Phasen des Schocks und der Verleugnung lagen hinter mir. Nun gab es nur noch Plan B. Er war nicht perfekt, aber einen anderen hatte ich nicht.
Zwei Stunden später stand ich auf einem gepflasterten Gehweg in einem wunderschönen Hof. Es fiel mir jedoch nicht leicht, die gotische Architektur und den makellos gemähten Rasen zu bewundern, während mein Herz in der Brust Geschwindigkeitsrekorde im Klopfen brach. Wahrscheinlich waren alle Studienanfänger so nervös wie ich und fürchteten, sich zu verlaufen oder ihre Mitbewohner nicht zu finden. Meine größte Angst galt allerdings etwas anderem. Wurde ich im Studiensekretariat unter dem richtigen Namen geführt? Und was zum Henker sollte ich machen, wenn nicht?
Als ich am Anfang der Schlange stand, wartete ich, während eine gut gelaunte Sekretärin den Stapel mit dem Studentenverzeichnis durchging. Während sie nachsah, sang sie meinen nagelneuen Namen vor sich hin. »Scarlet Crowley. Scarlet Crowley. Scarlet Crowley.«
Mir brach der Schweiß aus.
Als sie zum Anfang des Alphabets kam, wo sie mich hätte finden müssen, blätterte sie bis zur allerletzten Seite zurück, über der Ergänzungen und Änderungen stand.
»Ah, da sind Sie ja«, rief sie strahlend. Dann gab sie mir einen Beleg, mit dem ich mir meinen Studentenausweis ausstellen lassen konnte. »Sie waren verloren gegangen, wurden aber wiedergefunden.«
Ich hoffte, sie hatte recht.
Mit meinem glänzenden neuen Ausweis samt frisch eingeprägtem neuen Namen machte ich mich auf den Weg zur Vanderberg Hall, Eingang A. Das Schloss klickte beruhigend, als ich den Ausweis über den Scanner hielt. Entschlossen packte ich meine Reisetasche und stieg die alten ausgetretenen Marmorstufen in den zweiten Stock hinauf.
Auf jeder Etage gab es zwei Zimmer und dazwischen eine Tür, die ins Badezimmer führte. Meinen Schlüssel musste ich nicht probieren, da die Tür zu Zimmer 31 weit offen stand.
Als ich hineinspähte, sah ich zwei Mädchen, die sich über die gegenüberliegenden Enden eines hellroten Teppichs beugten.
»Hi!«
Die zwei Köpfe hoben sich so synchron, als würden sie zu einem Körper gehören. Die folgenden Sekunden gehörten ihrer unverfrorenen Musterung meinerseits. Eine der beiden hatte umwerfend blondes Haar, während die andere einen spitz zulaufenden braunen Pferdeschwanz zur Schau trug.
»Hi, ich bin Katie!«, riefen beide wie aus einem Mund.
Ihre Namen würde ich jedenfalls nicht vergessen. Ein Pluspunkt für mich.
»Hi, ich heiße Scarlet«, antwortete ich und rollte meine Riesenreisetasche ins Zimmer.
Pferdeschwanz-Katie legte den Kopf schief und sah mich fragend an. »Sollte unsere Dritte nicht jemand namens Shannon sein?«
»Es gab eine Änderung«, erklärte ich. »Shannon kommt nicht.« Weil ich sie zu Hause gelassen habe.
»Oh.« Blondinen-Katie riss überrascht die Augen auf. »Und woher kommst du, Scarlet?«
»Miami Beach.«
Zeitansage: Ich war noch keine halbe Minute im Zimmer und hatte ihnen, je nach Zählweise, bereits zwei oder drei Lügen aufgetischt. Jede einzelne von der faustdicken Sorte.
Ich musste noch dreimal zum Parkplatz runter, ehe ich mit Sack und Pack eingezogen war. Die beiden Katies boten mir keine Hilfe an. Stattdessen dekorierten sie ihre Schreibtische mit Fotos von daheim und versuchten herauszufinden, welche der Studienanfängerpartys besonders vielversprechend sein könnten. Doch ich war viel zu froh, endlich hier zu sein, um mir von ihrer Gleichgültigkeit die Laune verderben zu lassen.
Zimmer 31 befand sich in einem fantastischen u-förmigen Altbau. Den Katies und mir war ein Dreier-Apartment mit einem winzigen Zimmer für Pferdeschwanz-Katie und einem etwas größeren für Blondinen-Katie und mich zugewiesen worden. Außerdem gab es noch einen holzgetäfelten Gemeinschaftsraum mit einer gemütlichen breiten Fensterbank mit Ausblick auf den Hof.
Ganz schön cool.
»Wir brauchen ein Sofa, am besten noch gestern«, bemerkte Blondinen-Katie. »Draußen kann man gebrauchte kaufen.«
»Okay, ich bin dabei«, stimmte ich zu. Ms Übereifrig höchstpersönlich. Aber nach dem einsamen Jahr ohne Freunde, das hinter mir lag, wollte ich wieder ein ganz normales Mädchen werden. Viel brauchte es dazu nicht, ich wollte weder beliebt noch etwas Besonderes sein. Ich wollte einfach nur dazugehören. Und wenn ich dafür in einer Tour lügen musste.
»Lasst uns die Sofas auf dem Weg zum Speisesaal anschauen«, schlug Blondinen-Katie vor.
»Super Idee.« Ich nickte begeistert.
Eine Stunde darauf folgte ich den Katies aus unserem Wohnheim zum Turner House.
Das Harkness College war in zwölf Häuser aufgeteilt. Ein bisschen wie Hogwarts, nur ohne die Hüte. Sämtliche Studienanfänger, die in unserem Teil von Vanderberg wohnten, waren Turner House zugeteilt worden, trotzdem würden wir erst im nächsten Jahr dorthin umziehen. Vorläufig waren wir wie alle Anfänger am Fresh Court untergebracht.
Ich fuhr mit meinem Ausweis über den Scanner am Eingang zum Turner House und erntete ein weiteres befriedigendes Klicken. Ich konnte meine Freude kaum verbergen, als Pferdeschwanz-Katie uns die entriegelte Eingangstür aufhielt.
Scarlet Crowley ist drin, Leute! Meine Flucht ist gelungen.
Der Turner-Speisesaal war auf imposante Weise altmodisch. Es gab eine zwei Stockwerke hohe Gewölbedecke, bleiverglaste Fenster mit Fensterbänken aus Marmor sowie an einem Ende einen riesigen offenen Kamin. Ich folgte den Katies in den Küchenbereich, wo wir uns einen Überblick über die diversen Menüangebote und Selbstbedienungstheken verschafften.
»Okay, das war nicht sooo schrecklich schwer«, bemerkte Blondinen-Katie, nachdem wir drei Plätze an einem Tisch ergattert hatten.
»Der Speisesaal in meinem Internat war nicht so schön«, stellte Pferdeschwanz-Katie fest. »Außerdem hat es da immer nach Mortadella gerochen.«
»Eklig.« Die andere Katie nickte mitfühlend. »Wo warst du auf der Schule, Scarlet?«
»Ich bin zu Hause unterrichtet worden«, log ich.
Ich hatte den ganzen Sommer Zeit gehabt, mir eine neue Lebensgeschichte auszudenken. Natürlich hätte ich mir auch eine Schule in Miami aussuchen können, aber damit wäre ich das Risiko eingegangen, irgendwann auf jemanden zu stoßen, der sie tatsächlich besucht hatte. Und das wäre wirklich peinlich gewesen.
»Wow.« Pferdeschwanz-Katie sah mich bewundernd an. »Dabei wirkst du so normal.«
Ich musste lachen. Wenn sie gewusst hätte, was sie da sagte.
In der Nacht wachte ich nach Luft schnappend auf. Einen Moment lang wusste ich nicht, wo ich mich befand. Das Zimmer war mir fremd. Und der Traum klebte noch an mir.
Derselbe Traum, den ich schon das ganze Jahr lang immer wieder hatte. Ich spielte darin Hockey. Klar. Was an sich noch kein Albtraum war. Doch dann sauste ich in dem Traum über die Linie und dem Puck hinterher. Die Menge feuerte mich an, den Puck vom Netz wegzudreschen. Doch das Ding sauste weiter vor mir her und verschwand in einem schwarzen Loch. Während die Stimmen ringsum immer lauter drängten, starrte ich in das finstere, Furcht einflößende Loch und schreckte davor zurück, den Puck daraus hervorzuholen. Irgendetwas tief in mir hielt mich davon ab.
Und an dem Punkt wachte ich jedes Mal schweißgebadet auf.
Schwach, oder? Man sollte meinen, mein Unterbewusstsein könnte sich etwas Besseres einfallen lassen. Kettensägen, Zombies oder Vampire. Stattdessen immer wieder derselbe Traum.
Ich wälzte mich in meinem schmalen Schlafsaalbett herum und hörte Blondinen-Katie beim Schnarchen zu. Ich hatte mich von den Katies zu einer Fassbier-Party jenseits des Campus mitschleifen lassen, wo ich ein warmes Bier aus einem Pappbecher getrunken und mich angemessen zu der viel zu lauten Musik im Takt gewiegt hatte. Der tiefere Sinn der Party hatte sich mir nicht wirklich erschlossen, bis die Katies auf dem Heimweg mehrere Dutzend Nummern zusammenzählten, die neu in ihren Handys gespeichert waren.
»Und dieser tätowierte Lacrossespieler. Gott, war der süß!«, hatte die blonde Katie geschwärmt.
»Ich hab gehört, der hat ein Piercing. Untenrum!«
Sie waren von einem Lachkrampf in den nächsten ausgebrochen.
Die Katies entpuppten sich als die Sorte Mädchen, die sich »auskannten«. Sie wussten, wie der Footballquarterback hieß und in welche Verbindung er eingetreten war. Sie kannten die Namen der Gebäude auf dem ganzen Campus und hatten bereits herausgefunden, wo Geheimtreffen abgehalten wurden, nämlich in merkwürdigen fensterlosen Granitgemäuern. (»Man sagt ›Gruft‹ dazu«, hatte Blondinen-Katie bedeutungsschwanger hervorgehoben.) Außerdem stellte sich bald heraus, dass die beiden Katies viel mehr miteinander gemeinsam hatten als mit mir. Beide liebten Sephora. Beide hatten auf der Highschool Feldhockey gespielt. Und sie standen beide auf Maroon 5. LOL und OMG und WTF!
Ich war nicht eifersüchtig. Das eigentlich nicht. (Feldhockey? Bitte!) Doch mir war deutlich bewusst, dass das vergangene Jahr einen Keil zwischen mich und den Rest der Welt getrieben hatte. Eine Tatsache, an der nicht mal eine komplett neue Identität etwas ändern konnte. Ein Jahr hatte ausgereicht, um mich in einen Zaungast zu verwandeln, der am Spielfeldrand stand, zuschaute und nachdachte. Davor war ich ein Mensch der Tat und eine Draufgängerin gewesen. Viel mehr wie eine der Katies. Also, genau genommen ja eine Shannon, aber von der gleichen Art.
Zum Spaß stellte ich mir vor, wie es wäre, den Katies die Wahrheit über mich zu erzählen. Was dann wohl aus ihren vorwitzigen Mienen werden würde?
Also, Katies, ich bin gar nicht aus Miami, auch wenn wir in den Ferien immer dahingefahren sind. In Wahrheit komme ich aus New Hampshire, wo mein Vater ein berühmter Hockeyspieler und Trainer war. Er hat den Stanley Cup gewonnen, bevor ich geboren wurde. Als ich klein war, hat er die Verteidigung der Bruins trainiert, und als ich in den Kindergarten kam, hat er einen Trainerjob an einem College angenommen.
Wenn sie keine totalen Eishockey-Vollpfosten waren, würden die Katies in Anbetracht der vielen scharfen Sportskanonen, die ich im Laufe der Zeit bestimmt (und tatsächlich) kennengelernt hatte, in diesem Moment noch immer strahlen wie Weihnachtsbäume.
Außerdem hat mein Vater eine Wohltätigkeitsorganisation ins Leben gerufen, die es Kindern aus benachteiligten Familien in New England ermöglicht, kostenfrei Hockey zu trainieren. Echt großzügig, oder? Besonders weil mein Vater immer schon ein hyperaggressives Arschloch war. Aber wenn man Eishockey spielt, zahlt sich das aus. Egal. Alles lief wie geschmiert für ihn – und mich –, bis vor einem Jahr, als ein Jugendlicher aus der Nachbarstadt auf die Idee kam, sich umzubringen.
Sobald ich das laut aussprach, würden die Katies besorgt die Stirn runzeln – egal ob sie die großen überregionalen Zeitungen lasen oder nicht.
Der Junge – er hieß Chad – hinterließ einen Abschiedsbrief, in dem er aller Welt mitteilte, dass mein Vater ihn, als er zwölf gewesen war, wiederholt missbraucht hatte.
Und das war die Stelle in meiner Geschichte, an der jede Katie, die etwas auf sich hielt, schreiend davonlaufen würde. Die zaghafte Annäherung an mich würde diesen rabenschwarzen Punkt nicht überstehen. Es wäre den beiden egal, dass ich, wie alle anderen auch, erst aus der New York Times von den angeblichen Vergehen meines Vaters erfahren hatte.
Ich hatte im vergangenen Jahr etwas über schlechte Nachrichten gelernt. Sie kamen nicht plötzlich wie schlechte Nachrichten im Film. Es begann nicht mit einem Anruf um Mitternacht oder damit, dass es zur Essenszeit an die Tür klopfte. Im richtigen Leben trafen einen schlechte Nachrichten der übelsten Sorte wie in Zeitlupe. Der Anruf um Mitternacht war lediglich die Vorschau auf kommende Ereignisse. Gefolgt von zuerst einem, dann zwei Übertragungswagen vor dem Haus. Bis schließlich zehn dort standen. Und wenn sie mal verschwanden, dann nur für eine kurze Atempause. Weil sich früher oder später drei weitere Jungen mit ähnlichen Geschichten meldeten. Womit das Ganze in die nächste Runde ging.
Als ich behauptet hatte, zu Hause unterrichtet worden zu sein, hatte ich mir beinahe gewünscht, die Wahrheit zu sagen. Zuletzt hatte ich noch genau eine Freundin gehabt. Nur ein Mensch hielt zu mir, als die ganze Stadt mir den Rücken kehrte. Es spielte keine Rolle, dass nicht ich diejenige war, die eines Verbrechens beschuldigt wurde. Trotzdem wollte außer meiner Freundin Annie niemand mehr neben mir sitzen. Ich war ein Jahr lang auf keine Party oder zu irgendeinem anderen Event eingeladen worden, weil ich ein Paria, eine Ausgestoßene war. Zwei Wochen, nachdem die Mannschaft mich zu ihrer Kapitänin gemacht hatte, wurde ich wieder abgewählt. Selbst unser Trainer begann, die jüngeren Torhüterinnen zu bevorzugen. (Außer wir verloren. Dann hatte er plötzlich kein Problem mehr damit, mich einzusetzen.)
Die öffentliche Meinung über meinen Vater war seit fast einem Jahr katastrophal. Er war verhaftet und wegen des schlimmsten Verbrechens angeklagt worden, das ein Mann begehen konnte. Dass ich keine Ahnung gehabt hatte, was vor sich ging, war irrelevant. Ich wusste immer noch nicht genau, was passiert war. Aber ich war das Produkt eines kranken Mannes und einer kranken Familie. Und jeder in der Stadt, der mich anständig behandelte, lief Gefahr, selbst dem Pesthauch ausgesetzt zu werden.
Es war also nicht verwunderlich, dass ich in diesem Sommer eine Namensänderung beantragt hatte. Und nachdem ich die nötigen Papiere beisammengehabt hatte, hatte ich das Studentensekretariat des Harkness College angerufen und meine neuen Daten durchgegeben.
Shannon war Geschichte – und Scarlet geboren.
Ich hoffte, sie konnte mich retten. Allerdings war es jederzeit möglich, dass jemand mich erkannte und outete. Daran konnte ich nicht das Geringste ändern, es sei denn, ich würde auf irgendeine grottenschlechte Verkleidung verfallen. Zum Glück gab es auf dem Harkness nur einen Typ von meiner alten Highschool. Andrew Baschnagel war allerdings zwei Jahre älter als ich, und ich kannte ihn nicht besonders gut, mal davon abgesehen, dass ich mich an ihn als einen ziemlichen Streber erinnerte. Da am College fünftausend Studenten eingeschrieben waren und ich mich vorher nie ernsthaft mit Andrew unterhalten hatte, schätzte ich das Risiko, dass er mich bemerkte, als nicht allzu groß ein. Was blieb mir auch anderes übrig?
Scarlet Crowley war weder bei Facebook noch bei Twitter angemeldet. Und wer meinen neuen Namen googelte, fand nur sehr wenig. (Zum Glück. Ich hatte es versäumt, mich vor meinem Namenswechsel davon zu überzeugen.) Offenbar gab es eine Mrs Scarlet Crowley, die an einer Realschule in Oklahoma in der achten Algebra unterrichtete. Ihre Schüler schienen sie in Anbetracht ihrer Tweets aus dem Unterricht nicht allzu sehr zu mögen. Aber bitte, wofür würdet ihr euch entscheiden, wenn ihr euch aussuchen könntet, für eine alte Schachtel von Lehrerin, die gelegentlich unangekündigte Tests schreiben ließ, oder für die Tochter des übelsten mutmaßlichen Kinderschänders des Landes gehalten zu werden?
Ich würde jederzeit die Mathelehrerin wählen.
2
Stalker
Scarlet
Okay, College. Packen wir’s an!
Es war ein gutes Gefühl, durch die Septembersonne zu meiner allerersten Vorlesung zu stiefeln. Dem langen Labor-Day-Wochenende sei Dank war der erste Unterrichtstag ein Dienstag, also steuerte ich den Hörsaal an, in dem Statistik 105 gelehrt wurde. Der Kurs war im Hauptfach für das medizinische Vorstudium verpflichtend, und ich hatte ein bisschen Angst davor.
Ich stellte meinen Rucksack neben einem freien Platz auf den Boden ab und ließ den Blick über die nach und nach eintrudelnden Studenten schweifen. Als könnte mir diese Musterung darüber Aufschluss geben, ob ich schlau genug sein würde, der Vorlesung zu folgen. Waren genauso nervös dreinblickende Studienanfänger dabei wie ich? Oder waren sie alle abgebrühte Mathecracks?
Das Ergebnis meiner Suche war wenig ermutigend. Ich entdeckte jede Menge magere Jünglinge mit zerzausten Haaren, aber weit und breit keine Katie.
Meine Umschau endete abrupt, als ein Paar breiter Schultern zwei Reihen vor mir meine Aufmerksamkeit erregte. Die Schultern gehörten zu einem außerordentlich hübschen Kerl mit einem dichten dunkelroten Haarschopf. Während ich ihn noch bewunderte, drehte er den Kopf in meine Richtung und ertappte mich in flagranti. Viel zu spät senkte ich den Blick auf den Notizblock vor mir.
Zum Glück begann der Professor im selben Augenblick seine Vorlesung. Alle wandten sich nach vorne, wo sich der dünne Mann in dem steifen weißen Hemd kurz vorstellte, bevor er sofort in die Materie einstieg.
»Wir werden heute ohne große Umschweife mit den Begriffen ›Prognose‹ und ›Schlussfolgerung‹ beginnen. Also los!«
Ich schrieb eifrig mit, bis meine Knöchel weiß hervortraten. Eine halbe Stunde später wusste ich sicher, dass Statistik nur mit einem Becher Kaffee auszuhalten war. Als der Professor das nächste Schaubild auf das Whiteboard malte, wanderte mein Blick wie von selbst wieder zu dem einzigen interessanten Menschen im Hörsaal.
Sein Haar hatte einen schönen warmen Farbton – wie dunkler Karamell mit einer Prise Cayennepfeffer. Er wirkte kräftig, dabei aber nicht untersetzt wie die meisten halslosen Footballspieler. Seine Brust schien wie dafür gemacht, den Kopf daran zu lehnen.
Ich hatte gerade alle Hände voll damit zu tun, seine Oberarmmuskeln zu bestaunen, als er sich umsah und unsere Blicke sich zum zweiten Mal trafen.
Uff. Schon wieder erwischt. Wie demütigend.
Für den Rest der Stunde sah ich niemand anderen mehr an als den Professor. Und kaum dass er die Stunde beendet hatte, schnappte ich mir meine Sachen und rannte aus dem Hörsaal. Mein nächster Kurs – Musiktheorie – fand drei Häuser weiter statt, und mir blieben nur ein paar Minuten, um den richtigen Raum zu finden.
Doch der Hörsaal schien nicht dort zu sein, wo ich ihn vermutet hatte. Ich fischte den Übersichtsplan aus meiner Tasche und fühlte mich genau wie die bescheuerte Studienanfängerin, die ich ganz offensichtlich war. Nachdem ich mich neu orientiert hatte, schlug ich die nun hoffentlich richtige Richtung ein. Und tatsächlich, da war der Hörsaal. Jemand war sogar so nett, mir die Tür aufzuhalten.
»Danke«, japste ich.
»Kein Thema.« Da die tiefe Stimme ein wenig belustigt klang, hob ich den Blick.
Es war er, der heiße Typ mit den kastanienbraunen Haaren. Er grinste mich an. Ich gönnte mir den Bruchteil einer Sekunde, um die Sommersprossen auf seiner Nase zu bewundern, bevor ich an ihm vorbei in den Hörsaal flitzte.
Dieses Mal setzte ich mich ganz nach vorne, wo ich nicht in Versuchung geraten konnte, ihn anzustarren.
Bridger
Ich kam gut durch die ersten zwanzig Minuten Musiktheorie. Der Professor erklärte zuerst, wie Schallwellen das Trommelfell in Schwingungen versetzen. Ich hatte mich immer schon für Naturwissenschaften interessiert, und der Lehrstoff war einfacher als der in den Chemiegrundkursen, die ich belegt hatte. Also los!
Doch dann nahm die Vorlesung eine unvermutete Wendung. »Wenn Klänge sich zu Musik formen und zum Beispiel eine Moll-Tonart gespielt wird, reagieren Hörer häufig mit Schwermut«, erklärte der Professor, bevor er zu einer Anlage hinüberging und drei Minuten aus Mozarts Requiem laufen ließ.
Die Musik begann leise, verhalten, doch als sie anschwoll, ließen die Schallwellen unsere Holzpulte und die Bleiglasfenster vibrieren, bis sich mir die Nackenhaare sträubten.
»Schließen Sie die Augen«, wies uns der Professor an.
Ich gehorchte und ließ mich von den Geigen und den Stimmen des Chors überwältigen. Die Stimmung des Stücks war düster und dramatisch. Man konnte sich ihrer Wirkung unmöglich entziehen. Mein Herz nahm jeden Ton auf. Ich fühlte mich von einem Musikstück hingerissen, das zum ersten Mal vor über zweihundert Jahren aufgeführt worden war. Hätte ich diesen Kurs vor einem Jahr besucht, hätte mich die Musik womöglich noch nicht so berührt. Doch inzwischen lag eine schwere Zeit hinter mir. Wäre mein Leben ein Film, dann wäre der Soundtrack des Jahres in einer unheilvollen Tonart komponiert worden. Und ich konnte nichts daran ändern. Meine Rolle sah vor, mir alles reinzuziehen und dabei nicht aus den Augen zu verlieren, wo es langging.
Als die Musik zu Ende war, begann der Professor, über Tempo und Rhythmus zu reden. Ich schrieb mit und versuchte, die ungewohnten Begriffe zu verdauen. Ich hatte nie etwas für klassische Musik übriggehabt. Aber anders hatte ich die Lücken in meinem Stundenplan nicht füllen können, und um meinen Abschluss zu machen, brauchte ich noch ein paar Kurse in Kunst und Literatur. Harkness war in der Hinsicht sehr genau – man verlangte dort mehr von mir, als nur ein Streber in Naturwissenschaften zu sein. Und ein Eishockeyspieler.
Ein ehemaliger Eishockeyspieler.
Ende der Woche würden meine Mannschaftskollegen ihre Kufen wetzen und sich auf dem Eis zurückmelden. Sie würden ihren Abschlag trainieren und sich darüber streiten, welche Sorte Pizza sie hinterher bestellen sollten. Und ich? Ich würde mich von Ramen-Nudeln ernähren und mich mit den Tabellen herumschlagen, die ich angelegt hatte, um den Überblick über mein mörderisches Pensum nicht zu verlieren. Das Jahr verhieß ein Gebirge aus Kursen, Teilzeitjobs und Lernen zu werden. Und aus Kinderbetreuung. Und Geheimnissen. Es gab unzählige Möglichkeiten zu scheitern und unterzugehen. Ich konnte meinen Job verlieren oder krank werden. Meine Mutter konnte Probleme mit dem Gesetz bekommen. Die Liste war kilometerlang. Und selbst wenn nichts davon geschah, war ich längst nicht unverwundbar. Das College konnte hinter mein Geheimnis kommen – ein fünfundsechzig Pfund schweres Geheimnis mit roten Haaren – und mich vor die Tür setzen. Obwohl ich also in einem prächtigen alten Hörsaal in der staubigen Stille einer der ältesten Lehranstalten der USA saß, war ich bis zum Anschlag gespannt.
Ein paar Reihen vor mir saß eine Kommilitonin, die ich in Statistik dabei erwischt hatte, wie sie mich musterte. Sie stützte den Kopf in die Hand, sodass ihr glänzendes Haar auf eine Seite fiel und die sahnige Haut an ihrem Hals entblößte. Hätte ich direkt hinter ihr gesessen, wäre ich versucht gewesen zu prüfen, wie zart ihre Haut wirklich war. Sie kritzelte Notizen auf den Block vor ihr, als hinge ihr Leben davon ab. Angesichts des Eifers, den sie bereits zu Semesterbeginn an den Tag legte, musste sie eine Studienanfängerin sein. Keine Frage.
Letztes Jahr um diese Zeit hätte ich die Erstsemestlerinnen noch so gierig gemustert wie ein üppiges Frühstücksbüffet und mich gefragt, welche ich zuerst probieren sollte. Meine Mannschaftskollegen hatten mich immer mit der Frage aufgezogen, wer »Bridgers Typ« sei. Die Pointe lautete: »Alles, was atmet.«
Man konnte sagen, was man wollte, aber es gab einen Grund, warum ich so eine hedonistische, na ja, männliche Schlampe gewesen war, um es deutlich zu sagen. In gewisser Hinsicht wusste ich damals schon, wohin meine Reise gehen würde. Was nicht heißen soll, dass ich vorhergesehen hätte, was genau passieren würde. Nur dass ich wusste, dass es mit mir bergab gehen würde – und dass meine Mutter eine einfache Fahrt in die Hölle gebucht hatte. Im letzten Jahr hatte ich zum letzten Mal die Möglichkeit gehabt, es sorglos krachen zu lassen. Ich habe die Gelegenheit beim Schopf gepackt und hinterher keinen Augenblick bereut.
Deswegen mochte man mir die eingehende Musterung des Mädchens zwei Reihen vor mir also bitte nachsehen. Denn mehr als ein Blick dann und wann war für mich nicht mehr drin.
Nach der Vorlesung lief ich zu der frisch renovierten Mensa, um mir ein Sandwich zu kaufen und ein wenig zu lesen. Nur Studienanfänger und Überflieger begannen, schon am ersten Vorlesungstag ernsthaft zu lernen. Aber weil dieses Jahr das Schwierigste meines Lebens werden würde, musste ich, damit alles gut ausging, meine bisherigen Gewohnheiten ändern.
Ich setzte mich an den letzten freien Tisch. Doch ehe ich die Nase in mein Buch stecken konnte, sah ich, wie sich die Schönheit aus dem Kurs heute Vormittag auf der Suche nach einem Platz einen Weg durch die Menge bahnte. Wie alle Erstsemester schaute sie wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Außerdem lugte der Übersichtsplan aus ihrer Tasche.
Als sie in meine Richtung blickte, beugte ich mich so weit wie möglich runter, öffnete meinen Rucksack und zog das Musiktheorielehrbuch heraus. Dann zählte ich bis zehn und sah gerade noch, dass sie auf meinen Tisch zuhielt, den sie vermutlich für unbesetzt hielt.
Na, das hatte ja super geklappt.
Als ich mich aufrichtete, blieb sie ein, zwei Meter vor mir wie angewurzelt stehen. Ihr Hals lief knallrot an, und sie blinzelte nervös, während sie sich offensichtlich überlegte, was sie jetzt tun sollte. Ihre Miene schien geradezu zu schreien: Verdammt! Schon wieder der!
»Setz dich ruhig«, sagte ich mit einem Glucksen, legte Buch und Sandwich auf den Tisch und deutete auf den unbesetzten Stuhl mir gegenüber.
Noch immer unsicher und ohne ein Wort zu sagen, stellte sie einen Plastikbehälter mit einem Fertigsalat darin und eine Cola light auf den Tisch.
»Ich beiße nicht«, fügte ich hinzu. »Außer du bist ein Roggenbrotsandwich mit Geflügel, Krautsalat und Russian Dressing.«
Als sie sich auf den Stuhl fallen ließ, standen ihre Wangen genauso in Flammen wie ihr Hals. »Ich schwöre, ich bin keine Stalkerin.«
Grinsend packte ich mein Sandwich aus. »Kein Scheiß. Stalker sehen auch nicht so verschreckt aus, wenn sie ihrem Opfer über den Weg laufen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Es ist nur … Ach, egal. Komischer Zufall.«
»Also …«, sagte ich und biss von meinem Sandwich ab. Sie sah süß aus mit ihren rosigen Wangen. Ich fragte mich, was ich noch sagen konnte, damit die Verlegenheit nicht so schnell wieder verschwand.
»Also …« Sie nahm ihre Gabel.
»Willst du weiter zu Statistik und Musik gehen?«
»Wahrscheinlich«, antwortete sie. »Aber einer von den beiden Kursen macht mir bestimmt Spaß, während der andere mich garantiert umbringen wird.«
Ihre Augen waren von einem interessanten Haselnussbraun. Sie war zwar keine Granate, aber irgendwie echt anziehend. Ihr Gesicht verriet eine größere Ernsthaftigkeit, als sie die Mädchen besaßen, auf die ich sonst abfuhr. Aber sie stand ihr gut. Nicht, dass ich sie abcheckte oder so. Wozu auch?
Sie trank den ersten Schluck ihrer Cola und leckte sich flüchtig über die Lippen. Als ich ihre rosige Zunge aufblitzen sah, vergaß ich für eine Sekunde, worüber wir gerade gesprochen hatten.
Kurse. Ja, richtig.
»Geht mir genauso.«
»Statistik ist nicht einfach, aber ich brauche den Kurs für das medizinische Vorstudium. Da dachte ich, ich bringe es möglichst schnell hinter mich.«
»Aha.« Ich sah sie lächelnd an. »Dann bist du also neu hier. Und, wie läuft es bisher?«
»Na ja, ist ja mein erster Tag. Aber ich sag dir Bescheid, sobald ich mehr weiß.«
»Deine Mitbewohner sind okay?«
Sie schnitt eine Grimasse. »Könnte wahrscheinlich schlimmer sein.«
»Sei optimistisch. In zwei Jahren kriegst du ein Einzelzimmer.«
»Da freue ich mich jetzt schon drauf.« Sie stocherte in ihrem Salat. »Und, willst du weiter beide Kurse besuchen?«
»Klar. Statistik ist ein Kinderspiel. Ich bin bloß noch nicht richtig drin. Bei Musiktheorie bin ich mir nicht so sicher. Ich brauche einen Dienstags- und einen Donnerstagskurs auf dem Stundenplan. Musiktheorie erschien mir einfach. Aber wenn ich an die ganzen Intervalle und Halbtöne denke … Als hätte der Prof vergessen, wie man Englisch spricht.«
»Äh, echt jetzt?« Sie lehnte sich zurück, wobei ihr Oberteil ein Stück hochrutschte. Ich versuchte, nicht auf den Streifen nackter Haut an ihrer Taille zu starren. »Wie kann man Statistik kapieren, aber Musik nicht?«
»Ich fürchte, Musik gehört zu den Dingen, die man für sich nur kaputt macht, wenn man sich zu stark damit auseinandersetzt. Wie Astronomie. Ich hab früher total gerne in die Sterne geguckt. Aber heute muss ich mich immer fragen, ob ich einen Roten Zwerg oder einen Weißen Riesen sehe.«
»Das wird dir mit Musik nicht passieren«, erwiderte sie. »Du wirst nicht plötzlich deinen Lieblingssong hören und denken: Der wäre in C-Moll aber viel besser. Eher umgekehrt. Du wirst Dinge heraushören, die dir vorher entgangen sind. Und verstehen, warum der Tonartwechsel im Mittelteil ganz bestimmte Gefühle bei einem auslöst.«
»Schon okay. Aber manche Dinge sind einfach schön, auch ohne dass man sie versteht.«
Als sie lächelte, war die Wirkung unglaublich. Es verwandelte sie von ganz hübsch in atemberaubend. »Okay. Schön. Ohne dass man sie versteht … wie die Kunst?«
»Ja. Oder wie den weiblichen Körper.« Ich grinste abwartend.
Und schon bekam sie wieder rote Wangen. Sie schluckte. »Okay. Aber ist das alles nicht noch schöner, wenn man es versteht?«
»Darüber muss ich erst nachdenken, Stalker.«
Sie verdrehte die Augen. »Nenn mich bitte nicht so.«
»Muss ich aber. Weil du mir bisher nicht verraten hast, wie du heißt.«
Das Rot ihrer Wangen wurde noch dunkler. »Stimmt. Scarlet.«
Scarlet. Scharlachrot. Wie ihr Gesicht.
Ich schüttelte ihr über den Tisch hinweg die Hand. Wenigstens konnte ich vorgeben, ein Gentleman zu sein. »Freut mich, dich kennenzulernen, Scarlet. Ich heiße Bridger.«
»Bridger …« Sie runzelte die Stirn. »Spielst du Eishockey?«
»Kann sein. Früher mal.« Ihre Frage überraschte mich. Immerhin war ich ja nicht der Star der Mannschaft gewesen oder so. »Wieso? Stehst du auf Eishockey?«
Ihre Miene wirkte von einer Sekunde auf die andere verschlossen. »Kann sein. Früher mal«, echote sie. »Hockey war in letzter Zeit nicht nett zu mir.«
Ich nahm mein Sandwich. »Soll das heißen, dass ein Spieler in letzter Zeit nicht nett zu dir war?«
Sie sah mich mit einem komischen Lächeln an. »So was in der Art.«
»Na schön. Hör zu, was hältst du von einer Abmachung? Du schmeißt mir einen Rettungsring zu, wenn ich im musiktheoretischen Fachchinesisch ersaufe, und wenn du Hilfe in Statistik brauchst, sehe ich zu, was ich für dich tun kann.«
Wieder erhellte dieses Mörderlächeln ihr Gesicht. »Abgemacht, Bridger. Allerdings glaube ich, dass mir dieser Handel mehr bringen wird als dir.« Sichtlich zufrieden spießte sie eine Olive auf ihre Gabel.
Von diesem Moment an wurde Scarlet immer lockerer. Ich erzählte ihr ein bisschen was von mir. Natürlich nur von den guten Sachen. Dass ich College-Junior war, und parallel meinen Bachelor samt Master in Biologie machen wollte. »Ich wollte eigentlich Medizin studieren, allerdings weiß ich nicht, ob ich nach dem Examen noch wechseln kann.« Die unschönen Gründe dafür behielt ich für mich. »Aber ich hoffe, mit dem Master finde ich einen guten Job.«
»Hört sich nach einer schlauen Strategie an.«
»Abwarten. Die vielen Kurse bringen mich um.«
Danach erzählte mir Scarlet, dass sie aus Miami Beach stammte, wo ich noch nie gewesen war. Und natürlich wollte sie wissen, woher ich kam.
»Aus dem sonnigen Harkness, Connecticut.«
»Netter Schulweg«, antwortete sie trocken.
»Schon. Ab und zu lassen sie einen auch mal weg. Ansonsten sitze ich anscheinend lebenslänglich hier.« Du lieber Himmel, ich hörte mich schon an wie eine Heulsuse. Dabei war ich froh, am Harkness College eingeschrieben zu sein. Die meisten aus der Stadt schafften es nicht mal, einen Platz bei einer der Besichtigungstouren zu ergattern.
Mit einem Piepsen erinnerte mich meine Uhr daran, dass ich Lucy von der Schule abholen musste.
»Die Pflicht ruft«, sagte ich und knüllte die Sandwichverpackung zusammen. »Sehen wir uns Donnerstag in der Vorlesung?«
Scarlet schenkte mir ein Lächeln – strahlend wie die Sonne, die über dem Meer aufgeht. »Ich werde dort sein.«
Damit hatte ich etwas, worauf ich mich freuen konnte.
»Super. Bis dann.« Ich raffte mein Zeug zusammen und lief aus der Mensa.
3
Mir ist nichts entgangen
Scarlet
Ich brachte die erste Woche ohne größere Katastrophen hinter mich. Ich prägte mir ein, wann der Speisesaal geöffnet hatte, und verschaffte mir einen Überblick über die verschiedenen Bibliotheken. Ich fand heraus, dass die anderen neun Teilnehmer meines Einführungskurses Italienisch nett waren, der Lehrer aber ein Arsch war. In dem Seminar wurde nur Italienisch gesprochen, Englisch war strengstens untersagt. Wann immer irgendwem unbedacht ein nicht-italienisches Wort herausrutschte, ließ der graduierte Kursleiter ein Knurren vom Stapel.
»Das … ups.« Das zierliche Mädchen mit den dicken Brillengläsern auf der gegenüberliegenden Seite des Seminartisches schlug sich die Hand vor den Mund.
»En italiano!«, blaffte Eduardo.
Ich zwinkerte dem verängstigten Mädchen aufmunternd zu, womit ich mir einen finsteren Blick von Eduardo einhandelte.
Meinetwegen, Alter. Ein Jahr lang hatte ich den geballten Groll meiner kompletten Heimatstadt zu spüren bekommen. Nur zu, tu dir keinen Zwang an. Mich schreckt so schnell nichts.
Am Donnerstagabend lernte ich noch eine weitere Collegeregel – jedoch auf die harte Tour. Ich hatte eine Stunde in der Bibliothek gesessen, um meine Statistiknotizen durchzugehen. Als ich in unser Zimmer zurückkehrte, stieß ich, ohne mir etwas dabei zu denken, die Schlafzimmertür auf.
Mein Gehirn brauchte eine Weile, um zu verarbeiten, was ich dort sah: jemanden auf allen vieren. Auf Katies Bett. Aber der breite nackte Hintern passte irgendwie nicht. War ich im falschen Zimmer? Nein. Aber diese Arschbacken konnten unmöglich zu der gertenschlanken blonden Katie gehören. Und, Moment mal, waren das Haare an dem Hintern?
Im selben Augenblick fuhren nicht einer, nein, zwei Köpfe zu mir herum.
Und endlich kapierte mein Verstand, was los war. Hastig machte ich auf dem Absatz kehrt und schlug die Tür hinter mir zu.
Da ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte, ging ich zu unserer Fensterbank hinüber und ließ meine Büchertasche fallen. Während ich nach draußen auf den Campus blickte, hörte ich zwei Geräusche. Zum einen das Klatschen dicker Regentropfen gegen unsere antiken Fensterscheiben. Der Himmel verdunkelte sich zusehends, und dann begann es, in Strömen zu gießen. Und unter das Rauschen mischte sich das zweite Geräusch. Ein rhythmisches Grunzen, wie von jemandem, der kurz davor war …
Hilfe! Panisch riss ich das Fenster auf und ließ das Prasseln und den frischen Geruch des Regens in unser Zimmer strömen. Obwohl nicht ich das Mädchen im Schlafzimmer war, überkam mich ein unerklärlicher Anflug von Scham. Ich war kein Kind mehr, also sollte mich der Gedanke an Kommilitoninnen, die Sex hatten, eigentlich nicht abstoßen. Trotzdem war ich irgendwie aufgewühlt. Wie eine Tochter, die ihre Eltern im Schlafzimmer erwischt. Gott sei Dank war mir so was nie passiert.
Ich musste an etwas anderes denken, und zwar schleunigst. Draußen schüttete es inzwischen wie aus Eimern, rauszugehen kam also nicht infrage. Stattdessen stopfte ich mir Ohrstöpsel rein und rief eine Playlist mit Gitarrensoli auf, die ich hatte lernen wollen. Dabei gab ich mir alle Mühe, nicht an Blondinen-Katie und Borstenarsch zu denken, die es nebenan miteinander trieben.
In gewisser Weise war ich vermutlich abgebrühter als die meisten anderen Studienanfänger. Ich hatte im letzten Jahr mehr über kriminelle Unzucht gelesen, als es einem einzelnen Menschen guttun konnte. Aber die scheinbar normalen sexuellen Aktivitäten Neunzehnjähriger waren mir trotzdem ein Rätsel. Zu Hause hatten wir nie über Sex geredet. Wir kamen aus New England. Wir sprachen über Sport und das Wetter. Klar wusste ich, wie das mit der Fortpflanzung funktioniert. Aus dem Biounterricht und aus Artikeln in der Cosmopolitan, die ich beim Friseur las, waren mir die technischen Abläufe nicht fremd. Aber mir fehlten die Zusammenhänge. Und, schlimmer noch, ich schämte mich meiner Neugier. Wenn man während des letzten Schuljahrs von seinen Mitschülern geächtet wurde, hatte man leider keine Gelegenheit, Grundlagenforschung zu betreiben. Während andere Mädchen in meinem Alter die erste Liebe und ihre erste Beziehung erlebt hatten, hatte ich alleine in meinem Zimmer gesessen und auf Jordan gespielt. Meine Gitarre war nicht zufällig nach einem Jungen benannt. Jordan kam einem Freund so nah, wie es aller Wahrscheinlichkeit nach möglich war. Wie gerne hätte ich ihn jetzt bei mir gehabt, doch leider war er gerade nicht in Reichweite, weil ich ihn unter meinem Bett aufbewahrte, das nur ein kleines Stück von …
Bäh.
Als sich eine Stunde später die Schlafzimmertür öffnete, tat ich so, als wäre ich ganz in meine Musik versunken.
Blondinen-Katie begleitete ihren Gast auf den Gang und kam dann in unseren Gemeinschaftsraum zurückgeschlendert. Sie pflanzte sich auf die Fensterbank und warf mir einen finsteren Bick zu. »Hast du meine Fahne nicht gesehen?«
Ich zog die Ohrstöpsel raus und richtete den Blick auf unsere Schlafzimmertür. Tatsache, am Türgriff baumelte ein knallrotes Halstuch. Deshalb hing das da! Und ich hatte gedacht, sie hätte es aus Versehen dortgelassen.
»Sorry. Das ist mir entgangen.«
Sie kicherte. »Oh, mir ist dafür nichts entgangen.« Damit kehrte sie in unser Zimmer zurück und ließ mich mit glühend heißem Gesicht sitzen.
Später am Abend sprachen die beiden Katies über eine anscheinend ziemlich formale Einladung zu einer Party in einem Verbindungsheim, die sie sich auf keinen Fall entgehen lassen wollten. Allerdings gab es ein Problem – sie brauchten neue Strumpfhosen, wussten aber nicht, wie sie zur Mall kommen sollten.
Auf dem Parkplatz auf der anderen Straßenseite, der mich dreihundert Dollar pro Monat kostete, stand mein Auto. Aber ich hatte keine Lust, die beiden zu fahren.