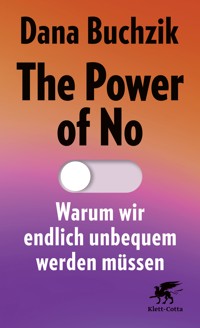
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nein zu sagen, ist der erste Schritt zur Freiheit Wir reden mehr als je zuvor über Bedürfnisse und persönliche Grenzen – in unserer Konfliktkultur ist davon jedoch nichts zu spüren: Die einen suchen ständig Streit, die anderen vermeiden jede offene Aussprache. Kommunikationsexpertin Dana Buchzik plädiert für eine neue Art des Neinsagens und erklärt, wie wir aus den Extremen des Totschweigens und der eskalierenden Diskussionen ausbrechen können. Grenzen sind unser aller Lebensthema. Manche können wir leichter setzen, andere schwerer. Vielleicht wischen wir bei der Weihnachtsfeier unbeeindruckt die Hand des angetrunkenen Kollegen von unserer Schulter, erstarren aber, wenn die Großmutter am Kaffeetisch AfD-Parolen wiederkäut. Oft gehen wir also über unsere Grenzen hinweg; die schwelenden Konflikte, Frust und Unzufriedenheit bleiben. Eine Veränderung wird nur durch Begegnung und das – zu Unrecht – unliebsame Konfliktgespräch möglich. Es ist das soziale Bindemittel, um gesunde Beziehungen und ein Miteinander auf Augenhöhe zu ermöglichen: ob privat, beruflich oder als demokratische Gesellschaft. Auf Basis soziologischer, psychologischer und kulturwissenschaftlicher Forschung erklärt Dana Buchzik, warum wir endlich unbequem werden müssen, und liefert kluge Strategien, wie wir souverän und verantwortungsvoll Nein sagen können. »Ein hervorragender Leitfaden für alle, die ihre eigenen Bedürfnisse in den Fokus rücken wollen.« Raul Krauthausen »Für alle, die ehrlich über ihre eigenen Grenzen nachdenken möchten – und wirklich ins Gespräch kommen wollen.« Franzi von Kempis
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dana Buchzik
The Power of No
Warum wir endlich unbequem werden müssen
Klett-Cotta
Disclaimer: Dieses Buch bildet vor allem die Cisgender-Welt ab, erzählt also mehrheitlich von Menschen, deren Geschlechtsidentität mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Das liegt daran, dass zu diesen Menschen derzeit die meisten wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Gaeb & Eggers.
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: © Rothfos & Gabler, Hamburg
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-96640-4
E-Book ISBN 978-3-608-12407-1
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
VORWORT
Warum dieses Buch?
TEIL I
Ein Nein ist der erste Schritt zur Freiheit
KAPITEL 1
Warum es so f*cking schwer ist, Nein zu sagen
Grenzen bedeuten für jeden von uns etwas anderes
Warum Sie zu oft
Ja
sagen – und was das Patriarchat damit zu tun hat
People Pleasing: der Wolf im Fürsorge-Schafspelz
Toxic Positivity: Empathiefreiheit als Machtmittel (und Milliardengeschäft)
PRAXISTEIL
: Grenzverletzungen frühzeitig erkennen
Was tun, wenn Sie selbst eine Grenze überschritten haben?
Wie Sie Manipulation entlarven
Der Autoritäts-Trick
Der Kaputte-Schallplatte-Trick
Der Schuld-und-Scham-Trick
Drei Hacks, um im Alltag konsequenter für sich einzustehen
Nutzen Sie Ihre emotionale Zoom-Funktion
Bauen Sie aus Ihren Werten eine Schutzmauer
Verbünden Sie sich mit Ihrem Körper
Abgrenzen für Eilige: schnelle Antworten auf Grenzverletzungen
KAPITEL 2
In schlechten, aber nicht in guten Zeiten? Schieflagen im Familien- und Freundeskreis
Von wegen naturgegeben: eine kurze Geschichte der Familie
Konservativ versus links-grün-versifft? Entgleisende politische Diskussionen im Familienkreis
Die Grenzen des Sagbaren: Wie ehrlich dürfen wir sein?
Respekt oder Selbstaufgabe: Was schulden wir unseren Eltern?
PRAXISTEIL:
Gelingende Beziehungsarbeit in (Wahl-)Verwandtschaften
Auf Augenhöhe über Politik diskutieren
Schritt 1: Bestandsaufnahme
Schritt 2: Zielsetzung
Schritt 3: Motivation
Schritt 4: gute Fragen
Schritt 5: Zweifel zugeben
Schritt 6: Empathie
Schritt 7: Hausordnung
Wenn streitende Eltern versuchen, ihre Kinder zu manipulieren
Wie Sie passive Aggression aushebeln können
Wie Sie eine Kontaktpause fair kommunizieren können
Abgrenzen für Eilige: schnelle Hacks für den Familienalltag
Auch unsere Freundschaften brauchen Beziehungsarbeit
Frenemies: Risiken und Nebenwirkungen ambivalenter Freundschaften
Das Einbahnstraßen-Dilemma
Eine Freundschaft aufkündigen: ja oder nein?
Abgrenzen für Eilige: raus aus platonischen Einbahnstraßen
KAPITEL 3
Das ultimative Versprechen? Über Liebe und Grenzenlosigkeit
Ein Plädoyer gegen Datingtipps
Wie der Glaube an schicksalhafte Liebe mit Partnerschaftsgewalt zusammenhängt
Von Bindungstypen und Projektionen
Polyamorie: des Kaisers neue Kleider?
Schopenhauer und die Stachelschweine: Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz
Von Wurstbroten und Apokalyptischen Reitern: Wie Streiten (nicht) funktioniert
Trennungen oder: Was finale Grenzen mit uns machen
PRAXISTEIL:
Vernünftig lieben!
Warum Sie beim Dating nicht (nur) auf Ihr Bauchgefühl hören sollten
Gehen oder bleiben? Wie Sie sich fair trennen
Auf Augenhöhe streiten: drei richtig gute Hacks
Schritt 1: Erwartungen und Verhaltensmuster reflektieren.
Schritt 2: Gemeinsam planen statt einsam explodieren.
Schritt 3: Das bisherige Verhaltensmuster zum gemeinsamen Feind erklären.
Wie Sie sich fair trennen
Schritt 1: Verstehen.
Schritt 2: Benennen.
Schritt 3: Planen und konsequent bleiben.
Wie Sie Liebeskummer überstehen
Abgrenzen für Eilige: schnelle Hacks für den Alltag
KAPITEL 4
Erotischer Analphabetismus: Warum wir unsere sexuelle Sprachlosigkeit überwinden müssen
Fehlende (feministische) Aufklärung in Schule und Elternhaus
Mainstream-Pornos als Reproduktion patriarchaler Machtverhältnisse
Weibliche Lust funktioniert anders (als Sie denken)
Was, wenn eine(r) nicht will?
Das Schlimmste mitdenken: sexualisierte Gewalt und ihre Folgen
PRAXISTEIL
: Mit guter Kommunikation zu richtig gutem Sex
KAPITEL 5
Leistungsbereitschaft oder Selbstausbeutung? Arbeit und Grenzen
Billige versus teure Bitten
Wenn wieder mal ein Thomas befördert wird: Warum Frauen im Job immer noch systematisch übergangen werden
Problemcode CHEF: Was Macht mit Menschen macht
Die hohe Kunst des Feedbacks
»Das bisschen Haushalt?«: die Folgen ungleich verteilter Care-Arbeit
PRAXISTEIL
: Klar, aber herzlich. Im Job für sich einstehen
Der Bedürftige
Der Ideenklauer
Der Kontrolletti
Der Passiv-Aggressive
Der Tratscher
Schnelle Antworten auf sexistische Klassiker und übergriffige Kommentare
Inbox is at capacity? Zwei effektive E-Mail-Hacks
1. Killen Sie Füllsätze.
2. Wahren Sie Zuständigkeitsgrenzen.
Strategien für eine bessere Work-Life-Balance
Strategie 1: Bewusste Zäsur
Strategie 2: Ihr persönliches Anti-Stress-Programm
Strategie 3: Konsequenz dank Shitlist
TEIL II
Bei Fakten gibt es keine Kompromisse. Warum wir politisch anders kommunizieren müssen als privat
Zwischen moralischem Totalschaden und Heilsversprechen: Wie Kommunikation mit Projektionen überfrachtet wird
KAPITEL 6
Das Ende der Meinungsfreiheit – jetzt aber wirklich?
Warum Menschen Parteien wählen, die ihnen schaden werden
Antifeminismus: der Kitt radikaler Bewegungen
Wie demokratische Parteien und Medien die AfD stärken
Wokeism und linke Identitätspolitik: Empowerment oder Exklusionskultur?
Debatte zum Nahostkonflikt: Spielwiese radikaler Akteure
PRAXISTEIL:
Effektiv über Politik reden
Wie emotionale Intelligenz vor Fake News schützt
Der ultimative Gesprächshack: emotionale Gebrauchsanleitungen
Vier fiese Tricks Ihres Gehirns, die Sie kennen sollten
Trick 1: Der Freund-Feind-Reflex
Trick 2: Auch die Gegenbeweise sprechen für mich!
Trick 3: Kurz und catchy? Wird schon stimmen!
Trick 4: Unseriös sind immer die anderen!
Wie Sie nachhaltig überzeugen – und dabei nicht die Nerven verlieren
Stärke 1: Kognitive Empathie
Strategie 2: Platz für Zweifel
Stärke 3: Werte statt Fakten
Stärke 4: Emotionsregulation
Abgrenzen für Eilige: schnelle Hacks für den Alltag
KAPITEL 7
Cui bono? Entgrenzung und Social Media
Wie sich weiße Männer Meinungsfreiheit vorstellen: Willkommen im Internet!
Grenzverwischung als Geschäftsmodell: Influencer und
parasoziale Beziehungen
Algospeak
:
Inszenierung eines Sprachtabus
Immer noch Neuland? Von Plattformskandalen und zahnloser Politik
Empfehlungsalgorithmen: David oder Goliath?
Warum Online-Gegenrede nicht funktioniert und was wirklich hilft
Cancel Culture: Beschämung als Machtmittel
PRAXISTEIL:
Kein Herz für Bots. Selbstschutz im Netz
Schnellcheck: Behalten Sie Ihre Werte im Blick?
Abgrenzen für Eilige: gute Antworten auf Trollkommentare
KAPITEL 8
Ein Nein darf nicht für Täterschutz missbraucht werden
NACHWORT
Wie wir es aushalten, unbequem zu sein
Anmerkungen
VORWORT Warum dieses Buch?
KAPITEL 1 Warum es so f*cking schwer ist, Nein zu sagen
KAPITEL 2 In schlechten, aber nicht in guten Zeiten? Schieflagen im Familien- und Freundeskreis
KAPITEL 3 Das ultimative Versprechen? Über Liebe und Grenzenlosigkeit
KAPITEL 4 Erotischer Analphabetismus: Warum wir unsere sexuelle Sprachlosigkeit überwinden müssen
KAPITEL 5 Leistungsbereitschaft oder Selbstausbeutung? Arbeit und Grenzen
TEIL II Zwischen moralischem Totalschaden und Heilsversprechen
KAPITEL 6 Das Ende der Meinungsfreiheit – jetzt aber wirklich?
KAPITEL 7 Cui bono? Entgrenzung und Social Media
KAPITEL 8 Ein Nein darf nicht für Täterschutz missbraucht werden
NACHWORT Wie wir es aushalten, unbequem zu sein
Sachregister
Personenregister
Danksagung
VORWORT
Warum dieses Buch?
Das Aufwachsen in einer Sekte in einem Satz: Unser Gott hatte die Antworten auf alle Fragen, und jede Antwort hatte die Form einer Kaufentscheidung. Gesundheit, Glück und Reichtum. Alles nur eine Frage des richtigen Produkts, des richtigen Persönlichkeitsentfaltungskurses, des richtigen Investments. Wer alles richtig machte und trotzdem starb, der musste im vorherigen Leben gesündigt haben. Und es starben einige, denn wer sich medizinische oder psychologische Hilfe suchte, musste mit sozialen Sanktionen rechnen. Also hielten sie durch und hofften so lange das Beste, bis es zu spät war.
So wie in jeder radikalen Gruppe hatten auch in »meiner« Sekte persönliche Bedürfnisse und Grenzen keinen Platz. Alles musste dem vermeintlich heiligen Ziel untergeordnet werden, vom Berufsleben über das soziale Umfeld bis hin zu den intimsten Gedanken. Für Frauen gab es in der Sekte zwei Rollen: Mutter oder Nonne. Wir sollten unsichtbar und bedürfnislos sein. Auffälliges Make-up oder Schmuck, ein tiefer Ausschnitt, Röcke, die oberhalb der Knie endeten oder bei einer Sektenfeier öffentlich das Wort erheben: Tabubrüche, von denen sich frau niemals erholen würde. Sichtbarkeit war Männern vorbehalten. Nur sie konnten Macher und Retter sein. Ihre Macht durfte unter keinen Umständen hinterfragt werden. Streng hierarchische Strukturen und mittelalterliche(1) Rollenbilder fördern vor allem eins: Gewalt. Meine Sekte war keine Ausnahme. Als Kind und Jugendliche wurde ich emotional, körperlich und sexuell missbraucht. Wenn das Rettung war, wollte ich lieber nicht gerettet werden. Als junge Erwachsene schaffte ich den Ausstieg – und stand ratlos vor einer Welt, die ich nicht kannte. Alles war Reizüberflutung: riesige Kinoleinwände, laute Musik, penetrante Werbung. Ich konnte mich nicht abgrenzen. Als Studentin wurde es nicht wegen Partys zum Monatsende knapp, sondern weil ich nicht Nein sagen konnte, wenn mich jemand auf der Straße nach Geld fragte. Als Berufseinsteigerin habe ich ständig umsonst gearbeitet, weil ich glaubte, noch nicht gut genug zu sein, und weil ich dem Narrativ auf den Leim ging, dass es im Kulturbetrieb so laufe und das Budget leider zu knapp sei – außer für die mehrheitlich männlichen Personen in den Führungsetagen. Als ich das erste Mal einen Verlagschef fragte, ob er denn angesichts des krisenhaften Budgets auch bei seinem eigenen Gehalt einspare oder nur bei den Löhnen der Volontärinnen, war ich 30. Als ich das erste Mal bei einem Vorstellungsgespräch einem Bundestagsabgeordneten erklärte, dass und warum sein letzter Gesetzesentwurf scheiße war (ich bekam den Job), war ich Mitte 30. Seitdem, scheint mir, bin ich in Sachen Abgrenzung aus dem Gröbsten raus.
Gesunde Grenzen sind unser aller Lebensthema. Die Psychologin Nedra Glover Tawwab(1) unterscheidet sechs Arten von Grenzen: zeitliche, emotionale, intellektuelle, materielle, körperliche und sexuelle.[1] Manche Grenzen können wir leichter setzen, andere schwerer: Vielleicht wischen Sie bei der Weihnachtsfeier unbeeindruckt die Hand Ihres angetrunkenen Kollegen von Ihrer Schulter, erstarren aber, wenn die Chefin im Berufsalltag ständig hinter Ihnen auftaucht und auf Ihrem Computerbildschirm E-Mails mitliest oder Ihr gerade geöffnetes Dokument kommentiert. Vielleicht können Sie gut Nein sagen, wenn eine Freundin zum dritten Mal diese Woche das gleiche Beziehungsdrama durchdiskutieren will, können sich aber nicht entziehen, wenn Sie die ältere Nachbarin in Klatschgespräche verwickelt. Vielleicht boxen Sie souverän Gehaltserhöhungen durch, schaffen es aber nicht, im Kaufhaus etwas umzutauschen.
Für manche Menschen hingegen bedeuten alle Formen der Abgrenzung harte Arbeit. Vielleicht, weil sie ein ausgeprägtes Helfersyndrom haben. Vielleicht, weil ihnen noch Klarheit fehlt, wohin genau sie im Leben wollen. Vielleicht, weil eine Traumatisierung(1) ihren inneren Kompass korrumpiert hat. So wurde mir als Kind nicht beigebracht, was gesunde Grenzen sind und dass ich ein Recht darauf habe, Nein zu sagen. Deswegen musste ich mir dieses Wissen selbst aneignen, mit der Hilfe von Büchern, Coaching, geliebten Menschen und Therapie. Heute weiß ich, dass Grenzen- und Bedürfnislosigkeit nur von jenen gefordert wird, die manipulieren und ausbeuten wollen. Dass ich in gesunden Beziehungen weder mir noch anderen einen Gefallen tue, wenn ich nicht auf mich achte. Und dass klare Kommunikation beruflich wie privat ein Miteinander auf Augenhöhe ermöglicht, in dem ich wirklich ich selbst sein kann. Es hat lange gedauert, aber es hat sich gelohnt. Was ich gelernt habe, möchte ich jetzt weitergeben, in der Hoffnung, dass Ihnen dieses Buch Abkürzungen bietet, auf dem bisweilen steinigen Weg für sich selbst einzustehen – und in dieser Aufrichtigkeit anderen wirklich zu begegnen.
TEIL I
Ein Nein ist der erste Schritt zur Freiheit
KAPITEL 1
Warum es so f*cking schwer ist, Nein zu sagen
Wir leben in einer Zeit, in der vermutlich mehr als je zuvor über Bedürfnisse, Safe Spaces und zwischenmenschliche Grenzen gesprochen wird. Gleichzeitig scheint unsere Diskussions- und Konfliktkultur an vielen Stellen nicht besser zu sein als in den 1950er Jahren: Probleme in der Familie, in Partner- und Freundschaften werden oft über Jahre totgeschwiegen, bis sich so viel Frust und Wut angestaut hat, dass es zum Eklat kommt: Weil der Zeitpunkt verpasst wurde, ruhig und souverän Grenzen zu setzen, drohen nun schwere Verletzungen oder sogar Kontaktabbruch. Bei Menschen, die uns nicht wirklich nahestehen – der Onkel mit AfD-Slogans im WhatsApp-Status, die Impfgegnercousine oder die Bekannte, deren Instagram-Profilbild jetzt ein Hamas(1)-Dreieck ist –, machen wir uns erst recht nicht die Mühe, ein ruhiges Gespräch zu führen. Stattdessen setzen wir die Meinung unseres Gegenübers mit der Person gleich und sprechen gleich dem ganzen Menschen unseren Respekt ab: »Der ist eh nicht mehr zu helfen.« – »Mit so einem rede ich nicht.«
Sei es Totschweigen oder ein dramatischer Streit inklusive Kontaktabbruch: Mit solchen Strategien vermeiden wir eine Begegnung auf Augenhöhe. Aktuelle Studien zeigen, dass unser Blick auf Konfliktgespräche derart negativ verzerrt ist, dass wir genau vor den Unterhaltungen flüchten wollen, die unseren Beziehungen guttun würden.[1] Erst wenn wir sie doch wagen, stellen wir fest, dass unsere Ängste unbegründet waren: Wir werden nicht verurteilt, nicht weniger geliebt, nicht aus unserer Gruppe ausgeschlossen – zumindest dann nicht, wenn unsere Beziehung keine toxische ist. Wer uns ausnutzen oder kleinhalten will, könnte natürlich versuchen, unsere persönlichen Grenzen als ungerechtfertigte Willkür oder Freiheitseinschränkung darzustellen. Tatsächlich aber sind wir erst frei, wenn wir nicht permanent Angst haben oder uns verteidigen müssen. Gesunde Grenzen sind kein Kontrollinstrument, sondern ein soziales Bindemittel. Statt unser Gegenüber zu infantilisieren und zu unterstellen, dass er oder sie angeblich keine ehrliche Ansage verkraftet, ist ein klares Nein ein Ausdruck von Respekt und Vertrauen in unser Gegenüber, ein erwachsenes Gespräch führen zu können. Ob in individuellen Beziehungen oder als demokratische Gesellschaft: Erst auf Augenhöhe sind wir stark.
Grenzen bedeuten für jeden von uns etwas anderes
Reisen wir durch die Geschichte des Wortes »Grenze«, finden wir unterschiedlichste Bedeutungen: Der lateinische Begriff »confinium« etwa stand für den Übergang von Tag zu Nacht oder von Leben zu Tod, aber auch für die Freifläche, auf der ein Pflug gewendet wurde. »Regio« beschrieb eine Grenzlinie, aber auch den Wirkungskreis, in dem ein Richterspruch galt. »Terminus« bezeichnete sowohl zeitliche Beschränkungen als auch Grenzsteine – und die Gottheit, die über ebendiese Grenzsteine wachte: Zu Ehren ihres Gottes Terminus feierten die alten Römer am 23. Februar das Terminalienfest. Im Deutschen hingegen gab es wenig sprachliche Vielfalt: Die »Grenze« hatte im 16. Jahrhundert Premiere – in der pragmatischen Festlegung von (und Konflikten wegen) Besitztümern. Ab dem 17. und 18. Jahrhundert erweiterte sich der Bedeutungshorizont der Grenze dank der modernen Wissenschaften stetig:[2] Denken wir etwa an physikalische Grenzflächen, die Phasengrenze in der Chemie oder den mathematischen Grenzwert einer Funktion, aber auch an Immanuel Kants(1) philosophische Reflexionen über die Beschränkungen der Vernunft.
Der Ausdruck »Setting boundaries«, also die kommunikative, zwischenmenschliche Grenzziehung, gewann um 1980 an Bedeutung[3] – zeitgleich zur Globalisierung mit ihrem impliziten Versprechen, dass Ländergrenzen fortan weniger wichtig wären.[4] Tatsächlich aber hat die Globalisierung eine Form der Grenze hervorgebracht, die »selektiv auf bestimmte Gruppen reagiert«,[5] wie Sozialwissenschaftlerin Julia Schulze Wessel(1) festhält: Je nach Herkunftsland und finanziellen Privilegien können manche Menschen Staatsgrenzen passieren, ohne groß darüber nachzudenken, während andere bei und nach einem Grenzübertritt Diskriminierung und körperliche Gewalt bis zur Lebensgefahr befürchten müssen.[6] Der Soziologe Steffen Mau(1) sieht die Staatsgrenzen unserer Zeit als »Ungleichheitsgeneratoren«:[7] Sie sind nicht mehr rein physische Barrieren, die für alle gleichermaßen gelten, sondern sie schließen gezielt von der Politik »unerwünschte« Personen aus.[8] Auch innerhalb eines Landes hat die Überschreitung abstrakter Grenzen unterschiedliche Konsequenzen, je nachdem, wer sie begeht: Während in Deutschland beispielsweise gegen Menschen mit prekären Lebensumständen überdurchschnittlich oft ermittelt wird und härtere Strafen verhängt werden, finden und nutzen die Anwälte und Steuerberater der Reichen jedes nur denkbare Schlupfloch für ihre Mandanten, um Offshoring, also Auslandsverlagerungen, zu ermöglichen.[9] Laut Berechnungen des Ökonomen Gabriel Zucman(1) kosten Steueroasen Deutschland jedes Jahr 17 Milliarden Euro.[10]
Zoomen wir aus der politischen in die private Sphäre, zeigt sich, dass wir auch hier Grenzverletzungen unterschiedlich »sanktionieren« – oder bestimmtes Verhalten überhaupt erst als Verletzung wahrnehmen: Es wird unserer Großmutter vermutlich egal sein, wenn sich ihre Nachbarin vegan ernährt und den mit Ei und Milch gebackenen Kuchen höflich ablehnt; tut es aber der Enkel beim Weihnachtsbesuch, könnte sie das als persönliche Zurückweisung missinterpretieren. Spült unsere beste Freundin Geschirr, während sie mit uns telefoniert, ist das vermutlich keine große Sache; tut es die Mutter, von der wir uns schon länger ungesehen fühlen, könnte das Gluckern und Klappern zum Streit führen. Verpassen wir dem besten Freund einen scherzhaften Seitenhieb, wird er darauf anders reagieren, als wenn eine fremde Person dies tun würde.
Unsere Grenzen gelten also nicht für alle Menschen gleichermaßen, sondern sie hängen von unserem Verhältnis zu unserem Gegenüber, von unserer Biografie (eine traumatisierte Person etwa hat andere Sicherheitsbedürfnisse als eine nichttraumatisierte) und von unserer kulturellen Prägung ab. In Deutschland beispielsweise wird eine extrovertierte Person, die klar kommuniziert, was sie (nicht) will, meist positiv wahrgenommen: Sie gilt als offen, gesellig und kontaktfreudig. In Süd- und Südostasien hingegen würde das gleiche Verhalten eher negativ interpretiert: Die Person gälte als wenig kompromissbereit, wenn nicht gar als egozentrisch oder unsozial.[11] Weltweit unterscheidet sich, wie nah wir Kollegen oder Freunden kommen: In Argentinien, Peru und Bulgarien stehen Menschen einander näher und berühren sich öfter; in Ungarn, Saudi-Arabien und der Türkei hingegen wird viel Distanz gewahrt.[12] Diese wenigen Beispiele zeigen: Unsere Grenzen entstehen aus unserer ganz persönlichen Geschichte heraus – und vor dem Hintergrund der Gesellschaft und der Kultur, in der wir leben. In ihnen verschränken sich politische, kulturelle, soziale, ökonomische und gesundheitliche Faktoren. Wir können nicht wissen, was unser Gegenüber verletzt und was er oder sie braucht, um sich sicher zu fühlen. Um respektvoll miteinander umzugehen, müssen wir sowohl unsere eigenen Grenzen kennen als auch Zeit und Neugier mitbringen, um die Grenzen unseres Gegenübers zu verstehen.
Warum Sie zu oft Ja sagen – und was das Patriarchat(1) damit zu tun hat
Ob Bibel oder romantische Komödie, ob Superheldencomic oder griechische Philosophie: Wir sind seit jeher von der Erzählung umgeben, dass der gute Mensch ein selbstloser ist. Dass er eigene Bedürfnisse zurückstellt, um die Familie, den Partner oder gleich die ganze Welt zu retten. Zugespitzt formuliert: Es ist kulturell in uns eingeschrieben, unsere Grenzen zu ignorieren. Unbewusst wissen wir genau, dass wir für Selbstaufopferung belohnt werden, während Abgrenzung hohe soziale Folgekosten haben kann. Die Sprachwissenschaft zeigt, dass wir ein Nein langsamer aussprechen als ein Ja.[13] Jemanden zurückzuweisen, kann Erschöpfung und sogar Ängste auslösen.[14]
Vielleicht bewundern wir als Gesellschaft gerade deswegen Machtpolitiker, schwerreiche Unternehmer und andere schillernde Figuren, die sich weniger mit Kooperationsbereitschaft, sondern eher mit Eigensinn oder gar Rücksichtslosigkeit ihren Weg gebahnt haben: Weil wir wissen, wie viel harte Arbeit hinter einem einzigen Nein stecken kann. Dass unter diesen gefeierten Einzelkämpfern nur wenige Frauen sind, ist kein Zufall: Frauen werden traditionell fürs Neinsagen härter sanktioniert und für ein Ja seltener belohnt. Das zeigt sich beruflich wie privat: Weltweit kümmern sich beispielsweise erwachsene Töchter deutlich mehr als erwachsene Söhne um ihre Eltern.[15] Gibt es nur Söhne in der Familie, wird die Pflege der Eltern eher aufgeteilt. Gibt es eine Tochter, dürfen Sie jetzt raten, welches der Geschwister die Arbeit allein übernimmt …[16] Von Frauen wird nach wie vor mehr Care-Arbeit(1) erwartet als von Männern. Sei es bei der Versorgung von Kranken, bei der Kinderbetreuung, in Liebes- und Familienbeziehungen oder im guten alten Haushalt. Einen möglichen Grund für diese Stagnation könnte das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) liefern, eine Befragung, die seit 1984 jährlich erhoben wird: Hier zeigt sich, dass Männer deutlich weniger kooperationsbereit sind als Frauen. Psychologisch gesprochen, sind sie weniger verträglich.[17] Aber gerade die verträglichen Menschen, kommentiert Linguistin und Emotionscoach Carlotta Welding(1),
die nicht primär in den Kategorien von Sieg und Niederlage funktionieren, sind für soziale Gemeinschaften unabdingbar; sie sind es, die nachfragen, Hilfe anbieten, trösten und Geburtstagskarten schreiben. Sie sind für gute Stimmung zuständig, für Zusammengehörigkeitsgefühl, für Verlässlichkeit und Loyalität.[18]
Was bei alldem verloren gehen kann: Ein Gefühl für die eigenen Grenzen und die Loyalität zu sich selbst.
Im Berufsleben werden Frauen sehr viel öfter für Aufgaben eingespannt, die sie auf der Karriereleiter nicht weiterbringen:[19] Sie organisieren Betriebsausflüge und Weihnachtsfeiern, bereiten Meetings vor und nach, übersetzen »nebenher« Reden des Chefs oder erklären in ihrer ersten Arbeitswoche dem Kollegen, der seit fünf Jahren im Betrieb arbeitet, wie der Anrufbeantworter seines Telefons funktioniert. Männer, die von dieser freiwilligen Arbeit profitieren, sind überzeugt, dass Frauen solche Aufgaben gerne übernehmen – sonst hätten sie es ja wohl nicht gemacht?!
Weiße Männer befördern sich gegenseitig, etwa in die Vorstände börsennotierter Unternehmen; man spricht hier auch vom Thomas-Kreislauf(1).[20] Frauen hingegen werden regelmäßig bei Beförderungen übergangen und verdienen für ihre Arbeit weniger als Männer; sobald sie beruflich stärker für sich eintreten und auf ihre Leistungen hinweisen, werden sie als arrogant abgelehnt.[21] Frauen sind oft aus den informellen Boys Clubs (gemeinsames Essen, Sport treiben oder Feiern) ausgeschlossen;[22] fragen sie von sich aus nach einem Feierabendbier, wird das im Zweifelsfall als Flirtversuch interpretiert. Verhalten sich Frauen bei der Arbeit nicht hilfsbereit, leidet ihr Ruf; Männer hingegen haben kaum negative Reaktionen zu befürchten.[23] Frauen können sich also nicht einfach wie Männer benehmen, um sich beruflich besser durchzusetzen. Das gleiche Verhalten hat unterschiedliche Konsequenzen.
»Frauen sind das häufiger unterbrochene Geschlecht«, halten die Sprachwissenschaftler Adrienne Hancock(1) and Benjamin Rubin(1) fest. Sie konnten in einer Studie zeigen, dass Männer mehr als doppelt so oft Frauen ins Wort fallen, als es umgekehrt der Fall ist.[24] Als Taylor Swift(1) bei den MTV Video Music Awards im Jahr 2009 den Preis für das beste weibliche Video bekam, unterbrach Kanye West(1) ihre Dankesrede und mansplainte(1), dass eigentlich Beyoncé(1) den Preis verdient hätte; Jahre später unterstellte er in seinem Song Famous, Swifts(2) Berühmtheit sei nur ihm zu verdanken.[25] Als sich 2017 der damalige Generalstaatsanwalt Jeff Sessions(1) wegen russischer Kontakte während Trumps(1) Wahlkampf rechtfertigen sollte, wurde nur die damalige Senatorin Kamala Harris(1) bei ihrer Befragung unterbrochen, nicht aber ihr männlicher Kollege.[26] Obwohl Anwälte schweigen sollen, sobald Richter sprechen, fallen Anwälte Richterinnen ins Wort – sogar am Supreme Court, dem höchsten Gericht der USA.[27] Wenn selbst Frauen in Machtpositionen von Männern derart respektlos behandelt werden – wie soll es da der großen Mehrheit ergehen, die sehr viel weniger Privilegien hat?
António Guterres(1), seit 2017 Generalsekretär der Vereinten Nationen, warnte im Jahr 2023 davor, dass angesichts der langsamen Entwicklung – und der zahlreichen Rückschritte – echte Geschlechtergerechtigkeit erst in 300 Jahren erreicht werden könnte.[28] In Deutschland ist es nicht einmal hundert Jahre her, dass Frauen kein eigenes Konto eröffnen und nicht selbst entscheiden durften, ob sie berufstätig sein möchten oder nicht. Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit 1997 strafbar.[29](1)Ein einziges Land der Welt maßt sich nicht an, Entscheidungen über den Körper von Frauen zu treffen und Abtreibungen zu reglementieren: Kanada. In knapp zwei Dutzend Staaten ist Abtreibung sogar dann verboten, wenn der Mutter Lebensgefahr droht oder die Schwangerschaft durch Vergewaltigung entstanden ist.[30]
In 80 Ländern der Welt glaubt auch heute noch über ein Viertel der Menschen, es sei gerechtfertigt, wenn ein Mann »seine« Frau schlägt.[31] In Deutschland denkt jeder Vierte, dass Frauen oft übertreiben, wenn sie sexualisierte Gewalt schildern, weil sie angeblich nach Vorteilen gieren.[32] Bei Gewalttaten werden immer wieder die Opfer von Gewalt beschuldigt, dass sie angeblich die Gefahr hätten voraussehen oder »einfach« mehr Grenzen aufzeigen müssen.[33] Jeden Tag werden mehr als 140 Frauen und Mädchen in Deutschland Opfer von Sexualstraftaten. Alle drei Minuten durchlebt eine Frau oder ein Mädchen häusliche Gewalt. Fast jeden Tag gibt es einen Femizid, es wird also beinahe täglich eine Frau von einem misogynen Mann ermordet – einfach nur, »weil« sie eine Frau ist.[34]
Obwohl in Deutschland die Istanbul-Konvention(1) gilt, es also knapp 21 000 Plätze[35] in Frauenhäusern geben müsste, existieren nur rund 7700.[36] Strafrechtsprofessorin Elisa Hoven(1) hat analysiert, dass sich deutsche Gerichte selbst bei schwerwiegenden Sexualdelikten nur am unteren Ende des Strafrahmens orientieren.[37] Eine Beziehung zwischen Opfer und Täter wird von manchen Gerichten nach wie vor als strafmildernd ausgelegt – »als träfe den Mann weniger Schuld, wenn es die eigene Partnerin ist, die er vergewaltigt«, kommentiert Journalistin Sophie Garbe(1).[38] Und als würden Studien nicht seit Jahren aufzeigen, dass Männer meist von Fremden (Männern) ermordet werden, Frauen und Mädchen hingegen – und zwar in allen Regionen der Welt – mehrheitlich von Partnern oder Angehörigen.[39]
Das Private ist politisch – dieser Satz trifft auch und gerade auf das Thema Grenzen zu. Als weiblich sozialisierte Personen wachsen wir in einer Welt auf, in der unsere Körper permanent kommentiert und sehr viel stärker reglementiert werden, als es bei Männern der Fall ist. In der wir an vielen Stellen schlechtere Chancen haben, beruflich erfolgreich zu sein. Und, wohl am schmerzlichsten: In der unser Zuhause der gefährlichste Ort für uns sein kann. Vielen von uns wurde nie vermittelt, dass wir ein Recht auf Grenzen haben. Wenn wir erst mit jahre- oder gar jahrzehntelanger Verspätung lernen, wie gesunde Abgrenzung funktioniert, bedeutet das eine Anstrengung, die andere weder kennen noch nachvollziehen können: Über Grenzenlosigkeit müssen wir nämlich nicht nachdenken, wenn sie längst zur Routine geworden ist. Den Drang zum ungesunden Verhalten aber frühzeitig zu erkennen und sich bewusst für ein anderes Verhalten zu entscheiden, kostet emotionale Ressourcen – Veränderung schmerzt, auch wenn es die richtige ist. Die gute Nachricht lautet: Wir haben die Zeit auf unserer Seite. Erstens fallen uns sowohl Selbstmitgefühl als auch Selbstkontrolle immer leichter, je älter wir werden.[40] Zweitens können nicht nur ungesunde Verhaltensmuster zur Routine werden, sondern auch gesunde: Im Durchschnitt brauchen wir 66 Tage, um eine neue Gewohnheit in uns zu verankern.[41] Etwas mehr als zwei Monate im Vergleich zu langjähriger Quälerei: Kein schlechter Deal.
People Pleasing(1): der Wolf im Fürsorge-Schafspelz
Die Pop-Psychologie hat zum Ende des 20. Jahrhunderts das Konzept People Pleasing (2)geprägt. Der Drang, es anderen immer recht zu machen, galt nun als weibliches Zwangs- und Suchtverhalten. Es wurde als Erklärung für die Wahl toxischer Beziehungspartner herangezogen und mit Übergewicht in Verbindung gebracht.[42] Anders gesagt: Ein neuer Markt war geschaffen, mit People Pleasing (3)als dem nächsten weiblichen »Makel«, der nach Behebung schrie. Weil People Pleasing(4) keine echte Diagnose ist, fanden sich sowohl die schnappatmigen Problembeschreibungen als auch die vermeintlichen Lösungen am gleichen Ort: in Ratgebern und Coaching-Angeboten. Über die Jahre hat sich die dramatische Erzählung stetig erweitert: Exzessives People Pleasing(5), sogenanntes Fawning (oft als Bambi-Reflex übersetzt), gilt nun sogar als Beleg für frühkindlichen Missbrauch und Trauma(1).[43] Solche Schubladisierungen greifen gleichzeitig zu weit und zu kurz: Frauen werden traditionell zu mehr Verträglichkeit erzogen. Sie erfahren Belohnung, wenn sie bescheiden sind, sich anpassen, statt zu widersprechen, und bei Streitigkeiten vermitteln. Schon im Kleinkindalter nähern sich Mädchen ihrer Mutter an, wenn sich diese bedrohlich verhält, und versuchen, liebevoll zu deeskalieren;[44] Jungen hingegen fallen in einen Fight-oder-Flight-Modus, haben also einen stärkeren Selbstschutzreflex.[45] Jungen schätzen auch schon früh ihre Fähigkeiten höher ein als Mädchen – dieser Effekt zeigt sich weltweit und bleibt im Erwachsenenalter bestehen.[46]
Frauen sind generell enger an Bezugspersonen gebunden und investieren mehr in ihre Beziehungen.[47] Je größer bei einer Bitte der Nutzen für ihr Gegenüber ist, desto schlechter können sie Nein sagen.[48] Sie fühlen sich häufiger schuldig und entschuldigen sich öfter als Männer.[49]Tut mir leid, dass ich deine E-Mail nicht sofort beantwortet habe! Entschuldige, aber könntest du deine Unterlagen heute eine Stunde früher abholen? Sorry, ich habe dieses Wochenende keine Zeit! … Dieses exzessive Entschuldigen kann einen Teufelskreis einläuten: Wenn Menschen wegen Lappalien um Verzeihung bitten oder sogar für Fehler, die sie nicht begangen haben (denken wir an den Klassiker, sich zu entschuldigen, wenn jemand anderes uns anrempelt), signalisieren sie sich – und auch anderen – unbewusst, dass sie tatsächlich etwas falsch gemacht hätten.
Es ist wichtig, um solche Prägungen zu wissen, damit wir Teufelskreise schneller erkennen und durchbrechen können. Dabei ist es weder nötig noch sinnvoll, zusätzlich Trauma, Sucht oder Zwang zu unterstellen. Solche dramatischen Selbstdiagnosen können Angst und Hilflosigkeit auslösen – und uns davon abhalten, Verantwortung für unser Verhalten zu übernehmen. Denn People Pleasing(6) bedeutet, immer wieder aufs Neue den Moment zu verpassen, in dem sich eine Unstimmigkeit noch konstruktiv lösen lässt. In dem man noch ruhig genug ist, um klar und respektvoll zu formulieren, was die eigenen Bedürfnisse und Grenzen sind. Stattdessen halten People Pleaser wichtige Informationen zurück – über sich selbst und über ihren Blick auf die gemeinsame Beziehung. Indem sie nicht authentisch kommunizieren, nehmen sie ihrem Gegenüber die Chance auf echte Verbindung und ihrer Beziehung die Chance auf Wachstum.
»Die Wurzel des chronischen People Pleasing(7) ist nicht Fürsorge«, schreibt der Psychologe Adam Grant(1). »Es ist der Drang nach Anerkennung.«[50] In gesunden Beziehungen aber gibt es weder Anerkennung noch Respekt dafür, unehrlich zu sein. Das Ziel, bloß niemanden zu verärgern, wird ja ohnehin nicht erreicht: Irgendwann haben People Pleaser so viel Frustration und Wut aufgestaut, dass sich die Gefühle unkontrolliert entladen und es zum Konflikt – vielleicht sogar mit anschließendem Kontaktabbruch – kommt. Für das Gegenüber bedeutet das meist eine Eskalation aus dem Nichts: Er versteht nicht, wo diese starken Gefühle herkommen, weil er ja bislang systematisch von ihnen ausgeschlossen wurde. So kann Vertrauen nachhaltig erschüttert werden.
Die Psychologin Vanessa Patrick(1) glaubt, die Selbstbezeichnung als People Pleaser sei »eine Ausrede, um nichts verändern zu müssen und den Menschen grollen zu dürfen, zu denen man Ja sagt.«[51] Sie geht sogar noch einen Schritt weiter: Indem wir uns als People Pleaser labeln, halten wir uns davon ab, aus Fehlern zu lernen. Denn wenn wir beziehungsschädigendes Verhalten als empathisch und rücksichtsvoll deklarieren, signalisieren wir unserem Gehirn, dass wir einfach genauso weitermachen sollten wie bisher.[52]
Toxic Positivity: Empathiefreiheit als Machtmittel (und Milliardengeschäft)
Wer Scheinlösungen verkauft, kann damit viel Geld verdienen. Der Psychologe Martin Seligman(1) etwa ist mit Positiver Psychologie(1) weltberühmt geworden. Positive Psychologie sieht positives Denken als Schlüssel zu psychischer Gesundheit und Glück. Sie will durch »positive Interventionen« individuelle »Charakterstärken« wie Optimismus, Tatendrang oder die Fähigkeit zur emotionalen Selbstregulation fördern. Dass solche Stärken aufgrund äußerer Einflüsse wie Gewalterfahrung, Krankheit oder Armut entweder massiv eingeschränkt oder vielleicht gar nicht entwickelt werden können, wird größtenteils ausgeblendet. Zynisch gesprochen: Wer kein gutes Leben führt, der hat in den Augen der Positiven Psychologie eben keinen starken Charakter …[53]
Seligman(2) war zuvor eher mit fragwürdigen Experimenten aufgefallen: Er hatte Hunde traumatisiert(2). Die Versuchstiere wurden immer wieder elektrischen Schocks ausgesetzt, ohne fliehen oder sich wehren zu können; einige wurden zusätzlich medikamentös gelähmt. Das Resultat: Als sich sehr viel später doch eine Chance zur Flucht bot, ergriffen die gebrochenen Tiere sie nicht mehr. Seligman(3) taufte das erlernte Hilflosigkeit[54](1) und sah in Positiver Psychologie(2) ein wirksames Gegengift: Sie sollte Depressionen und Ängste lindern und – wir sind hier immerhin im Kapitalismus! – die Performance steigern. Um diese ambitionierte Behauptung zu untermauern, wurden in einem teuren Experiment Teenager in Positiver Psychologie(3) unterrichtet. Leider waren die Schüler später weder weniger ängstlich oder weniger depressiv, noch war ihr Charakter »gestärkt« worden, noch nahmen sie häufiger an außerschulischen Aktivitäten teil.[55]
Die Ergebnisse des Experiments wurden nie vollständig veröffentlicht, aber Konservative und Großkonzerne waren auch ohne Belege begeistert: Seligman(4) wurde unter anderem von der ultrakonservativen John Templeton Foundation gefördert, die für ihre Unterstützung von Klimaleugnern in der Kritik steht,[56] und von Firmen wie Coca-Cola: Positive Psychologie(4) war ein verheißungsvolles Versprechen von mehr Produktivität, ohne dabei konsequent höhere Löhne zahlen zu müssen.[57] Armut sieht Seligman(5) übrigens mehrheitlich als »Problem der Selbstbeherrschung, der Würde und des Selbstwertgefühls«.[58]
Die Optimistinnen, Extrovertierten, Gesunden, Reichen und Erfolgreichen hatten nun den gleichen Anspruch auf und Bedarf an Beachtung durch die Psychologie wie die Verzweifelten, Isolierten, Depressiven, Kranken, Armen oder Gescheiterten,
schreiben die Soziologin Eva Illouz(1) und der Psychologe Edgar Cabanas(1).
Ging es bei Letzteren lediglich um eine Abwendung von seelischem Elend, so konnte (und musste) sich nun ausnahmslos jede(r) einer Expertin bedienen, um unter deren Anleitung zum besten Teil seines oder ihres Selbst zu finden.[59]
Diese Verschiebung der Zielgruppe machte Positive Psychologie(5) zum Milliardengeschäft – und psychologisches Vokabular zum selbstverständlichen Bestandteil der Alltagskommunikation. Letzteres könnte man als Fortschritt sehen (#endthestigma und so); tatsächlich aber wird an vielen Stellen Leid relativiert.
Zum einen verwässern Selbstdiagnostiker psychologische Definitionen (und Realitäten) bis zur Unkenntlichkeit: Manche Menschen bezeichnen sich ernsthaft als getriggert, wenn sie sich über einen Instagram-Beitrag ärgern, oder als depressiv, wenn sie sonntags verkatert auf der Couch liegen, oder sie attestieren sich selbst ADHS, weil sie jedes Mal ihre Milch auf dem Herd anbrennen lassen. Therapeuten sprechen hier von Katastrophisierung(1): Jemand bildet sich ein Problem ein, das er nicht hat, oder glaubt, ein bestehendes Problem sei sehr viel schwerwiegender, als es tatsächlich ist.[60] In den sozialen Medien finden sich immer wieder Personen, die sich einfach im Alleingang, ohne jede medizinische oder psychologische Expertise, eine schwerwiegende Krankheit oder gar Behinderung »diagnostiziert« haben und sich öffentlich als »Betroffene« inszenieren, die »Aufklärungsarbeit« leisten wollen. Sie nehmen den Menschen Raum, die nachweislich erkrankt und im Alltag massiv eingeschränkt sind.[61] Interessanterweise schreiben sich Selbstdiagnostiker vor allem Erkrankungen zu, die in der Mehrheitsgesellschaft entweder mit Spezialbegabungen assoziiert sind (wie Autismus) oder Mitgefühl auslösen (wie PTBS, Depression oder Ängste) – nicht aber sozial stigmatisierte Störungen wie Narzissmus(1), Borderline(1) oder histrionische Persönlichkeitsstörung(1) (übertriebene Emotionalität und Profilierungsdrang). Hier zeigt sich, wie viel Kapitalismus im Selbstdiagnostik-Trend steckt: Sogar in der selbstdiagnostizierten Schwäche möchte man brillant, also prinzipiell leistungsstark, sein. So ergibt es auf traurige Weise Sinn, dass sich auch um den Trend zur Selbstdiagnose eine, wenngleich viel kleinere, Industrie rankt: Von Psychologen und Psychiatern, die Selbstzahlern gewünschte Diagnosen stellen, bis hin zu »Coaches für Neurodivergenz«, die eigentlich Grundschullehrer, Literaturwissenschaftler oder Personalreferenten sind, sich aber dank einer »Fortbildung« in Reiki oder holotropem Atmen für hochkomplexe klinische Diagnostik qualifiziert fühlen.
Zum anderen werden in unserer Gesellschaft nur die funktionalen Kranken gefeiert. Die Autorin, die trotz Depression einen Bestseller nach dem nächsten schreibt und nebenbei im Fernsehen Karriere macht. Der Profisportler, der trotz Angststörung Goldmedaillen gewinnt. Die Influencerin, die trotz ADHS sechsstellig verdient. Der Schwerstkranke, der immer gute Laune verbreitet und »Dankbarkeit für die kleinen Dinge« zeigt. Wer da nicht mithalten kann, schämt sich gleich doppelt – oder wird von anderen beschämt: Andere mit der gleichen Diagnose kriegen das doch auch hin?! Reiß dich doch einfach mal zusammen!
Positivität wird toxisch, wenn sie den Kampf gegen (vermeintlich) negative Gefühle als moralische Pflicht propagiert.[62]Toxische Positivität(1) wird in vielen Sekten und auch in Teilen der christlichen Kirchen als Machtmittel genutzt – und in autoritären Regimen: Es gibt zu denken, dass ausgerechnet die Vereinigten Arabischen Emirate ein Glücksministerium eingerichtet haben und auch in Russland über ein solches diskutiert wurde.[63] Schon in Huxleys(1)Schöner neuer Welt wird ein despotischer Staat beschrieben, der nicht etwa das Unrecht, sondern nur die negativen Gefühle eliminieren will. Um es mit Adorno und Horkheimer zu sagen: »Vergnügtsein heißt Einverstandensein.«[64]
Nicht zuletzt passt toxische Positivität(2) perfekt in unsere kapitalistische Leistungsgesellschaft: Ihnen wurde Krebs diagnostiziert? Das kann nur gut gehen, wenn Sie positiv denken! Rechtsradikale Trolle bedrohen Sie und Ihre Familie? Da müssen Sie sich halt ein dickeres Fell zulegen! Die globale Finanzkrise hat Sie Ihr Eigenheim und Ihre Altersvorsorge gekostet? Da müssen Sie wohl an Ihrem Mindset arbeiten, um ein echter Gewinner zu werden! Ihre große Liebe hat Sie verlassen? Da müssen Sie wohl erst mal lernen, sich selbst zu lieben! So lassen sich Gesundheit, finanzielle Stabilität und sogar körperliche Unversehrtheit zum Statussymbol deklarieren, zum Ausdruck einer angeblichen Eigenleistung – und nicht etwa als Ausdruck von Privilegien. Frei nach Christian Lindner(1): »Probleme sind nur dornige Chancen«[65] – und wenn der Markt oder die Performer-Psyche ein Problem nicht lösen, kann natürlich nur das Individuum schuld sein und niemals das System. Toxische Positivität(3) ist eine Grenzverletzung im »Ich mein’s ja nur gut«-Deckmantel: Sie fordert bedingungslose Zustimmung und predigt eine bessere Welt, nimmt dabei aber bewusst das Leid anderer in Kauf.
PRAXISTEIL: Grenzverletzungen frühzeitig erkennen
Viele von uns nehmen Grenzverletzungen erst wahr, wenn unsere Psyche oder unser Körper Alarm schlagen: Wut oder Traurigkeit, Scham oder Ekel, Übelkeit oder ein verkrampfter Kiefer. Vielleicht registrieren wir noch, dass uns gerade etwas entgleitet, aber es ist zu spät: Wir werden entweder sprachlos oder richtig laut. Machen uns klein oder zetteln einen Streit an, bei dem alle Beteiligten verlieren werden. »Herz und Emotionen rasen«, so fasste es eine Leserin bei Instagram zusammen. Das Treffen beschäftigt uns noch lange, nachdem es vorbei ist; wir sind ungeduldig und gereizt. Die Erinnerung an die Situation löst vielleicht Wochen oder gar Jahre später noch Zorn oder ein Gefühl von Ohnmacht aus.
Um es mit Kommunikationsberaterin Franzi von Kempis(1) zu sagen: Wir kennen oft nur unsere roten Linien und nicht die orangefarbenen.[66] Das kann hohe emotionale Folgekosten bedeuten. Um handlungsfähig zu bleiben, müssen wir auch die Wahrnehmung früher Warnzeichen trainieren. Dabei sind zwei Strategien besonders wichtig: Achtsamkeit und Faktenüberprüfung.
Online finden sich mittlerweile zahllose Apps, Bücher und Kurse zum Thema Achtsamkeit. Ein Klassiker ist der Body Scan: Nehmen Sie sich idealerweise einmal täglich Zeit, Ihren Körper bewusst wahrzunehmen, vom großen Zeh bis zum Kopf. Wo spüren Sie Verkrampfungen, wo Weichheit? Wo Kälte, wo Wärme?[67] Achten Sie auf wiederkehrende Muster: Zwickt bei Stress häufig der Nacken? Oder eher der Bauch? Werden Sie zappelig? Bekommen Sie Kopfschmerzen? Je besser Sie Ihren Körper kennen, desto sensibler sind Sie für seine ersten Warnsignale. Versuchen Sie, direkt zu intervenieren, wenn Sie Anspannung bemerken: Legen Sie beispielsweise eine Hand auf Ihren Bauch, konzentrieren sich auf Ihren Atem und spüren nach, wie Ihre Bauchdecke sich hebt und senkt. Falls das in einer sozialen Situation nicht ohne Weiteres möglich ist: Versuchen Sie, etwas länger aus- als einzuatmen.
Körperreaktionen und starke Gefühle sind wichtige Hinweisgeber. Wir müssen sie ernst nehmen – und überprüfen, wo genau das Problem liegt: Weisen sie uns beispielsweise darauf hin, dass wir von unserem Gegenüber invalidiert werden? Der Begriff »Invalidierung« stammt von der Psychologin Marsha Linehan(1). Sie beschreibt damit zwischenmenschliche Situationen, in denen wir fehlender Empathie(1) bis hin zu missbräuchlichem Verhalten ausgesetzt sind, etwa indem unser Gegenüber uns ignoriert, wichtige Erfahrungen unseres Lebens relativiert oder leugnet oder uns insgesamt ungerecht behandelt. Linehan(2) erklärt auch, dass Invalidierung in manchen Situationen hilfreich sein kann: Nämlich dann, wenn wir falschliegen und unsere Haltung oder Wahrnehmung der Situation nicht angemessen ist.[68]
Ein Beispiel aus meiner Kommunikationsberatung: Eine erwachsene Tochter war fuchsteufelswild, weil ihr im Ausland lebender Vater bei einem Deutschlandbesuch nicht sofort angerufen hatte, um ein Treffen zu vereinbaren. Ich fragte, ob es nicht möglich sein könnte, dass der Vater Rücksicht nehmen wollte – die Tochter hatte gerade ihr drittes Kind auf die Welt gebracht und ihr Schlafrhythmus war entsprechend aus den Fugen. Oder ob er sich generell nicht aufdrängen, sondern ihr den Raum lassen wollte, sich von sich aus zu melden, wenn sie das Bedürfnis nach einem Treffen hatte. Die Tochter aber hatte für sich die Regel aufgestellt, dass sich der Vater immer zuerst melden musste; alles andere erschien ihr als Beweis für Lieblosigkeit. Bloß: Diese Regel ist nicht universell gültig, sodass alle Menschen sie kennen würden. Deswegen wäre die Tochter in der Pflicht gewesen, diese Regel (besser: diese Erwartung) ihrem Vater zu kommunizieren. Stattdessen ging sie davon aus, dass er sie auf magische Weise von allein kennen müsste – und schuf so die perfekte Voraussetzung für Verletzungen und Missverständnisse. Als ihr Vater ein paar Tage später anrief, begrüßte sie ihn mit einem Wutanfall.
»Manchmal behandeln wir Gefühle so, als wären sie Fakten«, schreibt Marsha Linehan(3): »Je stärker die Emotionen sind, desto mehr glauben wir, dass sie auf Tatsachen beruhen.«[69] Unsere Wahrnehmung ist aber keine objektive Wahrheit, sondern wird durch viele Faktoren beeinflusst. Durch frühere Erfahrungen mit anderen Menschen etwa, die dafür sorgen, dass wir bei manchen Begriffen oder Verhaltensweisen wütend oder ängstlich werden, obwohl unser aktuelles Gegenüber etwas ganz anderes damit meint.[70] Oder durch ganz banale Aspekte wie Erschöpfung, Hunger oder Dehydrierung. Oder durch Influencer und Online-Coaches, die entwicklungspsychologische Konzepte wie die Bindungstheorie nicht verstehen (wollen) und daraus pauschale und gefährliche Ratschläge ableiten: Menschen werden nur noch in gut für deine Entwicklung versus zutiefst toxisch eingeteilt. Wer nicht jede Kleinigkeit validiert und feiert, sondern auch mal nachfragt, widerspricht oder einfach eine schlechte Phase hat, muss vermeintlich sofort aus dem eigenen Leben entfernt werden: Das kleinste Gefühl von Irritation oder Missmut gilt als objektiver Beweis für schwerwiegende Vergehen. Dabei bringt es jede zwischenmenschliche Beziehung mit sich, dass unsere Bedürfnisse auch einmal (oder phasenweise auch länger) nicht erfüllt werden. Problematisch wird es erst, wenn das Ungleichgewicht dauerhaft besteht und ein Klärungsgespräch und damit auch die Aussicht auf Veränderung verweigert wird. Auch wenn manche Influencer etwas anderes in die Kamera flöten mögen, ein Kontaktabbruch sollte in einer Freundschaft oder Beziehung immer die letzte Option sein und nicht die erste.[71] Wenn wir von uns wissen, dass wir oft mit starken Gefühlen reagieren, kann es hilfreich sein, wiederkehrende Konfliktsituationen mit guten (und schonungslos ehrlichen) Freunden oder im Rahmen einer Psychotherapie zu reflektieren. So stellen wir sicher, dass wir weder uns noch anderen Unrecht tun, und können neue Wege finden, um überschießende Gefühle zu regulieren. Denn Invalidierung schmerzt oft selbst dann, wenn unser Gegenüber die Fakten auf seiner Seite hat.[72]
Was tun, wenn Sie selbst eine Grenze überschritten haben?
Seit einigen Jahren ist sie in den sozialen Medien in aller Munde: die Nonpology.[73](1) Bei einer Nicht-Entschuldigung übernimmt eine Person (oder ein Unternehmen) nicht wirklich Verantwortung für das eigene Fehlverhalten, sondern relativiert es oder schiebt die Schuld den Umständen oder anderen Personen zu. Klassische Nonpologies(2) klingen beispielsweise so: »Es tut mir leid, wenn du dich jetzt angegriffen fühlst.« – »Fehler passieren jedem.« – »Ich hab’s nur gut gemeint! Sorry, dass du das falsch verstanden hast!«– »Tut mir ja leid, aber du hast mich auch provoziert!«
Nonpologies(3) können Konfliktsituationen nicht entschärfen. Meist machen sie alles nur schlimmer. Eine richtig gute Entschuldigung besteht aus fünf Schritten. Erstens: Dem Gegenüber zuhören und seinen Gefühlen Raum geben.[74] Zweitens: Fehlverhalten eingestehen und Verantwortung übernehmen. Drittens: Nicht rechtfertigen, sondern erklären, wie es zum Fehlverhalten gekommen ist. Viertens: Reue ausdrücken, ohne dabei im Selbstmitleid zu zerfließen, und konkrete Schritte ankündigen, um diesen Fehler nicht zu wiederholen. Fünftens: Entschädigung anbieten.[75] Auch hier geht es nicht um uns, sondern um unser Gegenüber. Kaufen Sie nicht impulsiv etwas oder schreiben einen pathetischen Brief, sondern fragen Sie die Person, deren Grenzen Sie verletzt haben, was sie sich jetzt von Ihnen wünscht.[76]
Psychologische Studien zeigen, dass eine aufrichtige Entschuldigung bei unserem Gegenüber Blutdruck und Herzfrequenz senkt und angespannte Gesichtsmuskeln entkrampft. Sie fördert Empathie(2) und erhöht so die Wahrscheinlichkeit, dass die betroffene Person verzeihen kann.[77]
Wie Sie Manipulation(1) entlarven
Das Wichtigste zuerst: Wir alle manipulieren andere Menschen. Der Psychologe James Tedeschi(1) hat Manipulation(2) nicht nur als normal eingeordnet, sondern sogar als Ausdruck sozialer Kompetenz.[78] Wie bei so vielem im Leben macht die Dosis das Gift: Wenn jemand einen Raum betritt und lautstark seufzt, dass es ja wirklich sehr heiß sei, statt jemanden direkt anzusprechen und zu bitten, dass er oder sie ein Fenster öffnet, bedeutet das streng genommen eine Manipulation, aber sie ist derart geringfügig, dass sie niemanden länger beschäftigen oder gar belasten wird.[79] Wenn hingegen jemand beruflich wie privat immer wieder versucht, nur den eigenen Willen durchzusetzen, ist das ein ernsthaftes Problem.[80] Rainer Sachse(1), Psychologe und Begründer der Klärungsorientierten Psychotherapie, sieht bei Manipulation(3) alle Beteiligten in einer aktiven Rolle:
Sie funktioniert nur, wenn der Manipulator einen Schlüssel (die manipulative Strategie(4)) hat; aber sie funktioniert auch nur dann, wenn der Manipulierte ein dazu passendes Schlüsselloch aufweist, sich also manipulieren lässt! Also sollten Sie sich hier zwei Fragen stellen: Wodurch werde ich manipulierbar (was ist mein »Schlüsselloch«)? Und: Wie kann ich meine Manipulierbarkeit verringern?[81]
Manche Menschen sind anfälliger für Manipulation(5) als andere. Für diese Menschen bedeutet es härtere Arbeit, sich gegen Einflussnahme zu wehren.
Grundsätzlich aber gilt, dass Manipulation(6) funktioniert, weil sie unsere Gefühle aktiviert, bevor wir es überhaupt bemerken. Deswegen wird so viel Geld in Marketingforschung investiert: Wir bestellen im Kino dieses ganz bestimmte Eis oder greifen im Supermarkt nach diesem ganz bestimmten Waschmittel, weil sich das wie ein authentisches Bedürfnis anfühlt. In dem Moment aber, in dem uns die Einflussnahme bewusst wird, schwindet ihre Macht. Zu den klassischen Tricks manipulativer Personen gehören Autorität, kaputte Schallplatte sowie das gezielte Auslösen von Schuld und Scham:
Der Autoritäts-Trick
Autoritäts-Trickser werten sich selbst (oder ihre Produkte) künstlich auf, um uns unbewusst zur Kooperation zu zwingen.[82] Bevor Werbung strenger reguliert wurde, warben beispielsweise Tabakfirmen mit angeblichen ärztlichen Erkenntnissen zur Verträglichkeit von Zigaretten oder behaupteten kurzerhand, dass Ärzte »ihre« Marke rauchen würden. Die Firma Ferrero ließ einen weißbekittelten Mann vor einer Kulisse, die an eine Hausarztpraxis erinnert, Nutella – also einen überwiegend aus Zucker und Palmöl bestehenden Aufstrich – als Lieferant »unentbehrlicher Lebensbausteine« preisen.[83] Sektenführer und Scharlatane schmücken sich gern mit falschen Studienabschlüssen oder einem Heiligenschein: Mal ist es das frühere Dasein als Kaiser, Pharao oder Martin Luther King, mal sind es Jesus-Erscheinungen, mal direkt die Jesus-Reinkarnation. Autoritätseffekte lassen sich durch inszenierten Zeitdruck[84] zusätzlich verstärken: Dieses beliebte Produkt gibt es nur noch heute im Angebot! Nur noch eine Stunde! Nur noch drei Plätze sind frei, um zu lernen, wie man Krypto-Milliardär, Pick-Up Artist oder erleuchtet wird!
Auch im privaten und beruflichen Alltag können wir Autoritätstrickser an ihrer Dringlichkeitsinszenierung erkennen. Antworten wir nicht binnen Minuten auf ihre Nachrichten, kommt schon eine Armada von Frage- und Ausrufezeichen hinterher – wenn sie nicht direkt zum Hörer greifen oder vor der Tür stehen. Im privaten Kontext wird ein Autoritätstrickser vermutlich Forderungen stellen, sobald Sie sein Gast sind, sei es zu Hause oder in einem Restaurant; im beruflichen Kontext wird er Sie wahrscheinlich in sein Büro beordern und sich großspurig vor Ihnen aufbauen, um Autorität und Dominanz auszustrahlen.[85] Akut ist ihr Anliegen eigentlich nie, aber Autoritätstrickser sind sehr gut darin, Sie das Gegenteil glauben zu lassen. Denn je dringlicher uns etwas erscheint, desto mehr Wichtigkeit messen wir sowohl dem Anliegen als auch der Person dahinter zu und desto stärker wird der gefühlte Druck, Ja zu sagen, uns kleinzumachen und unsere eigenen Themen zurückzustellen.
Der Kaputte-Schallplatte-Trick
Die Schwägerin, der Sie gestern via WhatsApp abgesagt haben und die trotzdem vor der Tür steht und Kaffee trinken will: »Och, hatte ich nicht gesehen! Und wenn ich schon mal da bin …« Der Kollege, dessen Arbeit Sie ständig übernehmen, weil er auch nach zwei Jahren im Betrieb »leider noch nicht ganz verstanden« hat, wie sein Aufgabenbereich aussieht. Die Schwiegermutter, der Sie dreimal erklärt haben, dass Sie dieses Wochenende nicht 500 Kilometer fahren können, weil Ihr Kind krank ist und es im Haus einen Wasserschaden gibt, und deren einzige Reaktion darin besteht, zu fragen: »Aber warum könnt ihr denn nicht wenigstens kurz vorbeikommen?« Ziehen wir eine Grenze, tun Kaputte-Schallplatte-Trickser so, als hätten sie uns nicht gehört oder nicht richtig verstanden oder als hätten wir uns unklar ausgedrückt. Sie setzen also darauf, dass wir irgendwann mürbe werden und einknicken. Die Strategie der kaputten Schallplatte ist leicht durchschaubar; deswegen dauert es meist nicht lange, bis sich Menschen ausgenutzt fühlen und versuchen, auf Abstand zu gehen. Diese Distanzierung wiederum sorgt dafür, dass Trickser ihren Einsatz erhöhen, um ihren Willen durchzusetzen.
Der Schuld-und-Scham-Trick
Fortgeschrittene Trickser ziehen bei uns die emotionalen Daumenschrauben an. Sie erzählen uns ausschweifende Geschichten darüber, welche Widrigkeiten sie von ihrer Arbeit oder vom Einhalten ihrer Versprechen abhalten. Der Plot dieser Geschichten ist unterschiedlich, das Finale aber immer gleich: »Ohne Sie schaffe ich die Deadline auf keinen Fall!« – »Ich habe doch sonst keinen, mit dem ich reden kann!« Solche dramatischen Äußerungen aktivieren soziale Ängste, die wir seit Jahrtausenden mitschleppen: Einen Menschen in Not lässt »man« nicht hängen![86] Wer nicht zuverlässig ist, gefährdet nämlich das Wohl der Gemeinschaft und muss soziale Sanktionen bis hin zum Ausschluss fürchten.[87]
Sollten Sie tatsächlich einmal nicht sofort springen, werden Schuld-und-Scham-Trickser alles daran setzen, damit Sie es bereuen: Sei es durch direkte Vorwürfe (»Da habe ich dich einmal um etwas gebeten!« – »Gute Freundschaft sieht für mich echt anders aus!« – »Ich bin noch nie so enttäuscht worden!«) oder durch Ignorieren und zeitweiligen Kontaktabbruch. Die beiden letzteren Strategien verunsichern das Gegenüber nachweislich und schwächen sein Selbstwertgefühl.[88] Wer solche Methoden gezielt einsetzt, will Kooperation um jeden Preis erzwingen.
Der sogenannte Spotlight-Effekt(1) spielt Schuld-und-Scham-Tricksern in die Hände. Diese kognitive Verzerrung lässt uns glauben, dass wir vom direkten Umfeld stärker wahrgenommen und bewertet werden, als es tatsächlich der Fall ist.[89] Deswegen sagen wir in Gruppensituationen zu einer sozialen Bitte eher Ja: Wir fühlen uns beobachtet und entsprechend unter Druck, zu kooperieren. Bei Männern lässt der Effekt nach, sobald eine soziale Bitte in einem Einzelgespräch geäußert wird: Sie empfinden dann weniger Gefühle von Verpflichtung oder gar Schuld. Bei Frauen aber bleiben die negativen Gefühle in jeder Gesprächssituation bestehen – und damit die Wahrscheinlichkeit, dass sie Ja sagen werden, auch wenn ein Nein dringend geboten wäre.[90] Frauen sind mit anderen gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert als Männer.[91] Ihre Körper und ihr Verhalten werden öfter und harscher bewertet. Dieser permanente Gruppendruck wirkt auch dann, wenn sich Frauen gerade in einem 1:1-Gespräch befinden. Das Gemeine ist – und das gilt für uns alle: Wenn wir Ja sagen, obwohl wir Nein meinen, fühlen wir uns sogar noch schlechter, als wenn wir ehrlich gewesen wären und abgelehnt hätten! Wir sind frustriert, gestresst und empfinden Hilflosigkeit und sogar Schuld.[92] Ein Teil von uns weiß nur zu gut, dass unsere Zusage einen Preis haben wird: sei es für unsere mentale Gesundheit, unsere Beziehung, unsere Freundschaften oder unser Familienleben. Umso wichtiger also, Manipulatoren rechtzeitig zu entlarven und das gefühlte Rampenlicht auf unser Gegenüber zu lenken.
Drei Hacks, um im Alltag konsequenter für sich einzustehen
Nutzen Sie Ihre emotionale Zoom-Funktion
Unser Bauchgefühl ist oft kein guter Ratgeber. Es fordert Pommes mit viel Mayo, obwohl wir eigentlich wissen, dass unsere Cholesterinwerte schlecht sind; es will ein viertes Glas Wein, obwohl wir wissen, dass wir dann unserem Ex weinerliche Nachrichten schicken werden; es plädiert dafür, Onkel Erwin mit Faktenchecks zu fluten, wenn er auf Telegram postet, der 34-fach verurteilte Straftäter Donald Trump sei der Messias – obwohl wir wissen, dass diese Strategie die letzten zehn Male zu einer Eskalation geführt hat. Schaffen wir es aber, in solchen Momenten nicht auf unser gegenwärtiges, sondern unser künftiges Ich zu hören, spüren wir auch die Belohnung, die uns erwarten wird, wenn wir jetzt das Richtige tun.[93] Künstliche Intelligenz(1) kann dabei Starthilfe leisten: Lassen Sie mithilfe einer kostenlosen Bildbearbeitungs-App Fotos von sich künstlich altern. Noch intensiver wirkt ein Deepfake-Video Ihres Zukunfts-Ichs; auch dafür gibt es kostenfreie Software und Plattformen im Netz. Ist Ihnen das zu gruselig, stellen Sie sich entweder eine ältere Version Ihrer selbst vor – Wie ist Ihre Körperhaltung? Wie kleiden Sie sich? Wie klingt Ihre Stimme? Wie fest ist Ihr Blick?[94] – oder eine vollkommen andere Person. Wie würde sich dieser fremde Mensch in Ihrer Situation fühlen? Was würden Sie ihm raten?[95] Psychologische Experimente zeigen, dass wir bessere Entscheidungen treffen, wenn wir zuvor jemand anderem zum gleichen Thema einen Rat gegeben haben.[96] Wir können also selbst zu dem Vorbild werden, das wir gerade dringend brauchen. Alle genannten Strategien funktionieren nach dem gleichen Prinzip: Sie zoomen aus dem gegenwärtigen Moment heraus – und damit auch aus etwaigen überschießenden Gefühlen. Dieser Abstand hilft Ihnen, klarer zu sehen und die Entscheidung zu treffen, die Ihnen wirklich dient.
Bauen Sie aus Ihren Werten eine Schutzmauer
Wenn wir unser Gegenüber nicht vor den Kopf stoßen wollen, formulieren wir unsere Grenzen oft nicht eindeutig genug. Auch wenn sich diese Strategie höflich oder rücksichtsvoll anfühlen mag: Sie schadet. Bei einem Gegenüber, das es gut mit uns meint, lösen wir Verwirrung oder Kränkung aus, wenn wir nicht ehrlich sagen, was wir wollen und was nicht. Bei einem Gegenüber, das uns ausnutzen will, signalisiert unser Reden um den heißen Brei, dass wir unsere Grenzen nicht ernst nehmen – und es entsprechend okay ist, wenn andere es auch nicht tun.
Um eine Grenze zu ziehen und gleichzeitig Ihre Beziehungen zu schützen, eignet sich eine andere Strategie deutlich besser: Legen Sie Regeln fest, die im Einklang mit Ihren Werten stehen. Das bietet gleich mehrere Vorteile: Erstens fühlen Sie sich deutlich sicherer, wenn Sie für Ihre Grenze wirklich gute Gründe anbieten können, die über die aktuelle Situation hinausreichen und Sie als gesamte Person betreffen. Zweitens erinnern Sie sich mit klaren Formulierungen daran, dass Sie die Kontrolle über Ihre Entscheidungen haben. Drittens signalisieren Sie Ihrem Gegenüber, dass die Grenze nichts mit ihm persönlich zu tun hat. So lassen sich ungewollte Kränkungen vermeiden – und Sie werden deutlich seltener mit Widerstand konfrontiert.[97]
Im Beruflichen könnte eine wertebasierte Grenze beispielsweise so aussehen: »Ich habe die Regel, dass ich keine neuen Projekte annehme, bevor ich die aktuellen zu einem guten Abschluss gebracht habe«[98] oder »Ich habe die Regel, jeden Abend mit meiner Familie zu essen und meine Kinder ins Bett zu bringen, deshalb gehe ich immer um 18 Uhr nach Hause«. Im Privaten könnte eine wertebasierte Grenze lauten: »Ich habe die Regel, nach der Arbeitswoche erst meine Akkus aufzuladen, bevor ich Verabredungen zusage« oder »Ich habe die Regel, nicht mehr als zwei Bier zu trinken.«
Verbünden Sie sich mit Ihrem Körper
Im Durchschnitt braucht es 66 Tage, bis aus einem neuen Verhalten eine Gewohnheit geworden ist.[99]





























