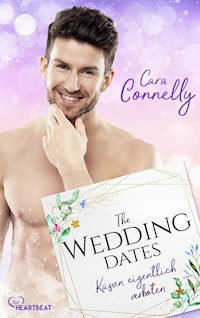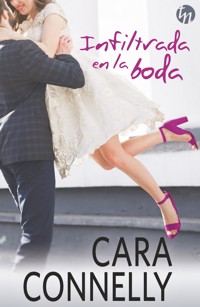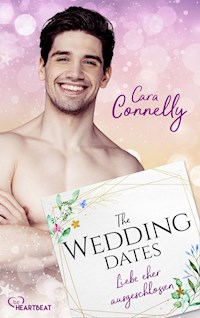
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Save the Date
- Sprache: Deutsch
Maddie St. Clair ist fassungslos, als sich ihr neuer Mandant als der arrogante - und verdammt attraktive - Millionär Adam LeCroix entpuppt. Vor fünf Jahren setzte die Anwältin alles daran, ihn wegen eines Kunstraubs hinter Gitter zu bringen, und nun erwartet ausgerechnet er, dass sie ihn in einem Versicherungsfall vertritt. Leider bleibt Maddie keine Wahl, wenn sie ihren Job behalten will, und so gibt sie zähneknirschend nach - fest entschlossen, Adam das Leben zur Hölle zu machen. Allerdings ahnt Maddie nicht, dass Adam schon seinen nächsten großen Coup plant: die Eroberung ihres Herzens ...
»Eine komplexe, fesselnde und gefühlvolle Liebesgeschichte, die in jeder Hinsicht über-zeugt.« Romantic Times
Cara Connellys Save-the-Date-Reihe - nie haben sich Gegensätze heißer angezogen!
The Wedding Dates - Fast gar nicht verliebt
The Wedding Dates - Küssen eigentlich verboten
The Wedding Dates - Liebe eher ausgeschlossen
The Wedding Dates - Bis auf weiteres verliebt
The Wedding Dates - Beinah gar kein Herzklopfen
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Über die Autorin
Alle Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Hat es Dir gefallen?
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:
be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Maddie St. Clair ist fassungslos, als sich ihr neuer Mandant als der arrogante – und verdammt attraktive – Millionär Adam LeCroix entpuppt. Vor fünf Jahren setzte die Anwältin alles daran, ihn wegen eines Kunstraubs hinter Gitter zu bringen, und nun erwartet ausgerechnet er, dass sie ihn in einem Versicherungsfall vertritt. Leider bleibt Maddie keine Wahl, wenn sie ihren Job behalten will, und so gibt sie zähneknirschend nach – fest entschlossen, Adam das Leben zur Hölle zu machen. Allerdings ahnt Maddie nicht, dass Adam schon seinen nächsten großen Coup plant: die Eroberung ihres Herzens …
CARA CONNELLY
The Wedding Dates
LIEBE EHER AUSGESCHLOSSEN
Aus dem amerikanischen Englisch von Anne-Marie Wachs
Für meine Eltern
1
Sechstausendachthundert Dollar und neunundachtzig Cent.
Maddie ließ die Kostenübersicht auf ihren Schreibtisch gleiten, wo sie wie ein welkes Blatt zwischen ihren Armen liegen blieb. Sie stützte den Kopf auf ihre Hände.
Lucille, ihre reizende, unbekümmerte, künstlerisch begabte Schwester, wollte für ein Semester nach Italien, um die großen Meister zu studieren.
Verdammt noch mal, wer wollte das nicht! Das Problem war bloß, dass die Gebühren für Lucys Privatcollege Maddies Budget ohnehin schon bis an die Grenze des Möglichen belasteten. Um die zusätzlichen Kosten für ein Auslandssemester aufzubringen, würde Maddie ihre knappen Rücklagen für Notfälle angreifen müssen – besser gesagt, sie vollkommen aufbrauchen.
Trotzdem, nach allem, was sie beide durchgemacht hatten, war Lucys unbekümmerte Art eigentlich ein kleines Wunder. Wenn es für dieses Wunder nötig war, länger am Schreibtisch zu schuften, würde Maddie das schon irgendwie hinbekommen.
Es klopfte energisch an ihre Bürotür. Dieses Stakkato konnte nur Adrianna Marchand ankündigen. Maddie schob rasch eine Akte über die Kostenübersicht, während Adrianna bereits ins Zimmer marschierte.
»Madeline. Besprechungsraum Süd. Jetzt gleich.« Adrianna musterte kurz Maddies Frisur und Make-up sowie die ärmellose Bluse. »In voller Montur.«
Maddie schüttelte den Kopf. »Nehmen Sie Randall. Ich habe in zwei Stunden einen Gerichtstermin und bin mit dem Fall noch nicht durch.« Versicherungsrecht gehörte zwar zu den langweiligsten juristischen Fachgebieten überhaupt, aber es war auch höchst komplex, und Maddie ertrank förmlich in solchen Fällen. Sie wies auf die Kartons, die sich auf ihrem Couchtisch stapelten, und die rund hundert Fallakten, die auf ihrem Ledersofa aneinandergereiht standen. »Sie haben wohl vergessen, dass Sie mir die ganzen Fälle von Vicky aufs Auge gedrückt haben, nachdem Sie sie grundlos entlassen haben.«
Adriannas Miene wurde frostig. »In dieser Kanzlei ist niemand unkündbar.«
Maddie blitzte sie an. Sie dachte nicht daran, sich ihre Angst anmerken zu lassen, doch insgeheim war ihr nur zu bewusst, dass sie gegen Adrianna nicht ankam. Deren Blick könnte selbst die Hölle in eine Eiswüste verwandeln. Außerdem gehörte sie zu den Gründungspartnern der Kanzlei Marchand, Riley & White und konnte Maddie jederzeit hinauswerfen, falls diese zu heftig konterte.
»Also gut, was soll’s.« Sie streifte die flauschigen Slipper ab und stieg in die roten Jimmy Choos, die unter ihrem Schreibtisch standen, nahm die Jacke ihres schwarzseidenen Armani-Kostüms von der Stuhllehne und schob die Hände durch die Ärmel. Dann streckte sie die Arme von sich. »Volle Montur. Zufrieden?«
»Frischen Sie Ihr Make-up auf.«
Maddie verdrehte die Augen, kramte die Puderdose aus der Handtasche, strich kurz mit dem Pinsel über ihre blassen Wangen und legte etwas Lipgloss auf. Dann fuhr sie mit den Fingern durch ihr rötlich blondes Haar und zupfte es zurecht. Sie trug es kurz und stachlig, um größer zu wirken, denn mit ihren zierlichen ein Meter fünfzig war sie der reine Winzling.
Adrianna nickte kurz, dann war sie auch schon wieder draußen und fegte mit flottem Schritt den mit Teppich ausgelegten Korridor entlang. »Geben Sie Gas. Wir haben Ihren neuen Mandanten schon viel zu lange warten lassen.«
Maddie musste sich beeilen, um mit ihr Schritt zu halten. »Meinen neuen Mandanten? Weil ich noch nicht genug zu tun habe?«
»Er hat extra nach Ihnen gefragt. Offenbar kennen Sie sich.«
»Und wie heißt er?«
»Er will Sie überraschen.« Adriannas trockener Ton ließ keinen Zweifel daran, dass sie es ernst meinte.
Bevor Maddie auf diese lächerliche Auskunft antworten konnte, hatte Adrianna schon höflich an die Tür des Konferenzraums geklopft und die Tür vorsichtig geöffnet.
Der Raum war für Besprechungen in großer Runde mit wichtigen Mandanten gedacht und sollte vor allem eindrucksvoll wirken: Orientteppiche bedeckten den Parkettboden, und an den Wänden hingen Landschaftsgemälde von renommierten Künstlern. Am stärksten bestimmte jedoch der lange Tisch aus Kirschholz die Atmosphäre, auf Hochglanz poliert und von eleganten Ledersesseln umgeben. Er stand für Zuverlässigkeit, Professionalität und Erfolg.
Vertrauen Sie uns nur all Ihre Probleme an, besagte der Tisch. Wir werden sie ohne viel Aufhebens lösen.
Und falls der Tisch und der Raum einmal nicht ausreichen sollten, um einen potenziellen Mandanten von den Qualitäten der Kanzlei Marchand, Riley & White zu überzeugen, die Eine-Million-Dollar-Aussicht durch die zwölf Meter breite Glasfront auf die Skyline von Manhattan schaffte es garantiert. Ein solcher Erfolgsbeweis war unwiderlegbar.
Maddies neuer Mandant stand vor dieser Fensterfront, mit dem Rücken zur Tür, eine Hand in der Tasche seiner teuren maßgeschneiderten Hose. Mit der anderen Hand drückte er ein elegantes Handy ans Ohr.
Maddie konnte hören, wie helles Frauenlachen aus dem Telefon drang. Der Mann antwortete in fließendem Italienisch. Nicht dass Maddie irgendein Wort verstanden hätte. Ihr Italienisch reichte gerade einmal aus, um in Little Italy ein Risotto zu bestellen. Aber sie war einmal für kurze Zeit mit einem verdammt gut aussehenden italienischen Kellner liiert gewesen und erkannte den Rhythmus der Sprache wieder. Er ließ sie an hitzigen Sex denken.
Als sie sich räusperte, um sich bemerkbar zu machen, trug ihr das nur einen frostigen Blick von Adrianna ein. Der Mann ignorierte sie völlig. Maddie verschränkte die Arme und taxierte ihn beleidigt von Kopf bis Fuß.
Er war groß, über ein Meter fünfundachtzig, und schätzungsweise fünfundachtzig Kilo schwer. Er hatte breite Schultern und schmale Hüften und die Haltung eines Athleten, elegant und völlig lässig, als stünde er nicht im sechzigsten Stock nur zehn Zentimeter von der dünnen Luft über der Fifth Avenue entfernt.
Er hatte zwar behauptet, sie zu kennen, doch das wenige, was sie von seinem Gesicht in der spiegelnden Glasscheibe sah, konnte Maddie nicht zuordnen. Auch nicht das seidig glänzende schwarze Haar, das ihm bis über den Kragen reichte, zu lang für die Wall Street, zu kurz für einen italienischen Fußballspieler.
Seine Kleidung, seine Bewegungen, seine schamlose Arroganz – all das drückte Wohlstand, Selbstbewusstsein und hohe Ansprüche aus.
Er musste sich getäuscht haben. Typen wie ihn kannte sie einfach nicht. Und da er offenbar davon ausging, seine Zeit sei kostbarer als ihre, legte sie auch keinen Wert darauf.
Sie beherrschte sich, solange sie konnte, trat von einem Fuß auf den anderen und biss sich auf die Zunge. Aber als die tickende Standuhr in der Ecke anzeigte, dass bereits fünf lange Minuten verstrichen waren, riss Maddie der Geduldsfaden. Sie senkte die Arme und griff nach dem Türknauf. »Ich habe für so einen Scheißdreck keine Zeit.«
Adrianna packte sie am Arm. »Schön brav sein, Madeline«, stieß sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Warum sollte ich? Oder Sie?« Normalerweise zeigte Adrianna bei unhöflichem Verhalten null Toleranz. Warum ließ sie sich von diesem Typen so einen Mist gefallen?
Maddie warf dem Unbekannten einen vorwurfsvollen Blick zu und sagte, ohne die Stimme zu senken: »Der Typ kennt mich nicht. Sonst wüsste er nämlich, dass ich hier nicht herumstehe und meine Zeit vertrödele, während er mit seiner Freundin flirtet.«
»Oh doch, das tun Sie«, zischte Adrianna. Sie ließ Maddies Arm los und schaute ihr fest in die Augen. »Sie werden sogar Kopfstand machen, wenn er das will. Er könnte der Kanzlei Millionen einbringen.«
In diesem Moment beschloss der Mann, sein Telefongespräch zu beenden. Beiläufig und ohne jede Eile steckte er sein Handy in die Hosentasche. Dann drehte er sich um.
Maddie stand das Herz still. Ihre Lippen wurden zu Eis.
Adrianna wollte etwas sagen, aber er kam ihr zuvor. Er sprach mit leichtem europäischem Akzent und in einem Tonfall, der seinen Worten die Schärfe nahm. »Vielen Dank, Adrianna. Lassen Sie uns jetzt allein.«
Adrianna nickte stumm, ging hinaus und schloss lautlos die Tür.
Sofort richtete er seine ganze Aufmerksamkeit auf Maddie. Sein Blick wirkte kühl und ein wenig herablassend, war aber scharf wie ein Laserstrahl. Eben hatte sie sich noch wie erfroren gefühlt; jetzt begann ihr Blut zu kochen. Es pochte ihr in den Schläfen, und sein Hämmern erzählte von aufgestauter Wut, von Enttäuschung und Empörung über eine große Ungerechtigkeit.
»Sie Dreckskerl«, fauchte sie, »wie können Sie es wagen zu behaupten, wir seien Bekannte?«
Er schmunzelte. Es war ein trügerisch einnehmendes Lächeln, das leichtfertige Menschen davon ablenken sollte, wie intensiv blau seine Augen waren und wie durchdringend scharf sie blickten, eine Tatsache, an der sie sonst womöglich erkannt hätten, was für ein niederträchtiger Schurke er war.
»Ms St. Clair.« Aus seinem Mund klang ihr Name ein wenig exotisch. »Sie werden doch sicherlich nicht abstreiten wollen, dass wir uns kennen.«
»Oh ja, Adam LeCroix, ich kenne Sie. Ich weiß, dass Sie für mindestens zehn Jahre nach Leavenworth gehören.«
Er lächelte noch ein wenig breiter, nicht mehr charmant, sondern amüsiert. »Und ich kenne Sie. Ich weiß, dass Sie erstklassige Arbeit geleistet hätten, wenn Sie es geschafft hätten, mich vor Gericht zu zerren.« Er zuckte kaum merklich mit den Schultern. »Aber wir beide wissen auch, dass mich keine Jury je schuldig gesprochen hätte.«
»Immer noch genauso unverfroren«, fauchte sie. »Und so verdammt schuldig.«
Adam unterdrückte ein Lachen. Madeline St. Clair mochte klein genug sein, um in seine Tasche zu passen, aber sie hatte mehr Stehvermögen als ein Ringkämpfer von neunzig Kilo.
Als er sie vor fünf Jahren zum letzten Mal gesehen hatte, war sie eine angriffslustige junge Anwältin im Büro des Bundesstaatsanwalts für den Bezirk Östliches New York gewesen und hatte Gift und Galle gespuckt, während ihr damaliger Chef – der nach Höherem strebte – Adam die Hand geschüttelt und sich dafür entschuldigt hatte, dass man die Ermittlungen gegen ihn überhaupt so weit verfolgt hatte.
Adam hatte den Großmütigen gespielt und mit ernster Miene genickt. Er hatte ein paar Binsenweisheiten über öffentliche Bedienstete zum Besten gegeben, die ja nur ihre Pflicht taten, hatte kurz den Fernsehkameras zugewinkt und war in seine Limousine gestiegen.
Wo er eine Sechstausend-Dollar-Flasche Dom Perignon köpfte und mit sich selbst darauf anstieß, dass er gerade noch einmal davongekommen war.
Dass man ihn beinahe geschnappt hätte, war seine eigene Schuld gewesen. Er war tatsächlich unverfroren gewesen. Er hatte einen Fehler begangen, was ihm selten passierte, einen winzig kleinen Fehler zwar, doch Madeline hatte ihn als Ansatzpunkt benutzt, um in seinem Leben herumzustochern, bis sie es fast geschafft hätte, ihn für den Diebstahl der Dame in Rot hinter Gitter zu bringen.
Dieses Meisterwerk von Renoir, erst vor Kurzem wiederentdeckt, war bei Sotheby’s an einen russischen Waffenhändler verkauft worden, einen besseren Gangster, der zynischerweise glaubte, mit einem so sensationellen Beweis von gutem Geschmack könnte er davon ablenken, wie viel Blut an seinen Milliarden klebte.
Adam fand das unerträglich und ließ das Gemälde mitgehen. Nicht aus Gewinnsucht. Er besaß seine eigenen Milliarden. Sondern weil große Kunst heilig war und man sie nicht wie einen Lappen dazu benutzen durfte, sich die Hände abzuwischen, die man sich durch Geschäfte mit dem Tod schmutzig gemacht hatte.
Adam hatte das Meisterwerk lediglich davor bewahrt, derart missbraucht zu werden.
Es war nicht das erste Mal gewesen, dass er große Kunstwerke aus unsauberen Händen befreit hatte, und sicherlich auch nicht das letzte Mal. Sich selbst gegenüber bezeichnete er das als seine Berufung, aber er musste auch zugeben, dass es ihm verdammt viel Spaß machte. Die besten und teuersten Sicherheitssysteme zu überlisten war eine intellektuelle Herausforderung, gegen die das Führen seiner eigenen Firmen einfach nicht mithalten konnte. Das notwendige körperliche Training bewirkte außerdem, dass er fit war wie ein Navy SEAL. Und der zugehörige Adrenalinschub, na ja, der war einfach nicht zu überbieten. Nicht einmal durch Sex. Keine Frau hatte ihn jemals so intensiv erregt oder so uneingeschränkt und allumfassend gefordert.
Diesmal lagen die Dinge jedoch genau umgekehrt. Eines seiner eigenen Gemälde – der Monet, den er am meisten liebte – war aus seiner Villa in Portofino gestohlen worden.
Allein der Gedanke daran brachte ihn schon in Rage.
Klar, eines Tages würde er das Bild wiederfinden, daran zweifelte er keinen Moment. Er verfügte über die nötigen Ressourcen, sowohl was Geld als auch was Menschen betraf. Er war geduldig. Er gab nie auf. Irgendwann würde er den Dreckskerl in die Finger bekommen, der in sein Haus – sein Heiligtum – eingedrungen war, und dann würde der für seine Dreistigkeit bezahlen.
Aber erst einmal gab es Dringenderes zu erledigen. Seine Versicherung Hawthorne Mutual sträubte sich, ihm die vierundvierzig Millionen für den Monet auszuzahlen.
Vierundvierzig Millionen waren eine Menge Geld, sogar für ihn. Doch was ihn wirklich ärgerte, war der Grund, den die Versicherungsgesellschaft für ihr Zögern nannte. Der Diebstahl müsse erst genauer untersucht werden, hieß es, weil Adam damals beim Diebstahl des Renoir ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten sei.
Kurz und gut, an den Verzögerungsversuchen von Hawthorne war Madeline schuld. Sie hatte Adams Ruf geschädigt und Zweifel an seiner Integrität geweckt. Ihretwegen galt einer der reichsten Männer der Welt nun als suspekt.
Dass sie richtiggelegen hatte, war dabei nebensächlich.
Da sie ganz offensichtlich schon mit den Hufen scharrte, tat er weiterhin so, als hätte er den ganzen Tag Zeit. Er schlenderte ans andere Ende des Raums, wo ein Ledersofa und ein paar Clubsessel um einen Couchtisch gruppiert standen. Hier saßen vermutlich die Partner und ihre Mandanten nach den Besprechungen noch bei Scotch und Zigarren beisammen, während die angestellten Anwälte – Leute wie Madeline – in ihre Büros zurückeilten und die eigentliche Arbeit erledigten.
Er setzte sich aufs Sofa, goss sich aus einer Karaffe aus Waterford-Kristall einen Scotch ein und lehnte sich bequem zurück. Einen Arm legte er ausgebreitet auf die Rücklehne, die andere Hand ließ er lässig über die Seitenlehne hängen, das Whiskyglas locker zwischen den Fingern.
Ihre stahlgrauen Augen wurden schmal. »Was wollen Sie, LeCroix? Weshalb sind Sie hier?«
Er trank in aller Ruhe von seinem Scotch und genoss den Anblick ihrer wütend geröteten Wangen. Im Büro des Bundesstaatsanwalts hatte man sie den Pitbull genannt. Es freute ihn zu sehen, dass sie seitdem nichts von ihrem Feuer eingebüßt hatte.
Während sie so dastand und innerlich kochte, musste er daran denken, wie sehr die Heftigkeit ihrer Gefühle ihn immer angetörnt hatte. Wiesehr sie ihn angetörnt hatte. Was eigentlich erstaunlich war. Normalerweise bevorzugte er Frauen, an denen etwas dran war, und Madeline war schließlich nur ein Hänfling.
Damals hatte er es sich damit erklärt, dass es ihr um ein Haar gelungen wäre, ihn zur Strecke zu bringen. Das musste man schließlich bewundern.
Aber er spürte diese Anziehungskraft auch jetzt. Irgendetwas an diesen argwöhnisch blickenden Augen und diesem angespannten Körper ging ihm unter die Haut. Plötzlich blitzte ein Bild in ihm auf – sie rittlings auf ihm, ihre Hände auf seiner Brust, ihr Blick voller Leidenschaft. Ob sie im Bett auch so heißblütig war wie im Gerichtssaal?
Leider würde er das nie herausfinden. Weil er im Begriff war, sie für den Rest ihres Lebens gegen sich aufzubringen.
Mit bewusster Nonchalance schlug er ein Bein über das andere, während sie an jedem Zentimeter ihrer ein Meter fünfzig vor Wut bebte.
»Hawthorne Mutual hält die Versicherungssumme für den Monet zurück.« Er machte sich nicht die Mühe, das Gemälde zu beschreiben; sie würde sich schon daran erinnern. Vor fünf Jahren hatte sie ihn gezwungen, eine Inventurliste seiner Kunstsammlung vorzulegen. Das hatte er auch getan – zumindest für den rechtmäßig erworbenen Teil seiner Sammlung.
»Der Monet ist gestohlen worden?« Sie lächelte zum ersten Mal. Eigentlich war es eher ein hämisches Grinsen.
Er schnippte ein paar nicht vorhandene Fusseln von seinem Knie. »Offenbar ist selbst mein Sicherheitssystem nicht unüberwindlich.« Und wenn das nicht schmerzte …
Sie lachte laut auf. »Früher oder später rächt sich eben alles, LeCroix. Bei Ihrer Vergangenheit wird Hawthorne niemals zahlen. Wie hoch war das Bild versichert? Vierundvierzig Millionen?« Sie grinste schadenfroh. Die Ironie der Geschichte gefiel ihr offenbar sehr. »Das wird die Gerichte auf Jahre beschäftigen.«
Er ließ sie das Triumphgefühl eine Weile auskosten. Dann schlug er zu.
»Und Sie«, sagte er knapp. »Sie wird es auch beschäftigen. Weil Sie mich vertreten werden. Egal wie lange die Sache dauert.«
Sie zuckte zurück, als hätte er ihr tatsächlich einen Kinnhaken versetzt. Er schlug gleich noch einmal zu und gab ihr den Rest.
»Von jetzt an arbeiten Sie für mich, Madeline.«
2
Maddie warf die Tür so heftig zu, dass ihr gerahmtes Diplom von der Wand fiel und das Glas in tausend Stücke zerbrach. Es war ihr egal. Sie ließ sich auf den Schreibtischstuhl fallen, starrte auf die Tür und wartete.
Fünf Sekunden später kam Adrianna hereingestürmt. Auf hundertachtzig. Sie stützte die Fäuste auf Maddies Schreibtisch und feuerte aus allen Rohren. »Kriegen Sie verdammt noch mal Ihren Arsch hoch, gehen Sie sofort wieder in den Konferenzraum und bringen Sie auf der Stelle in Ordnung, was immer Sie da angerichtet haben. Adam LeCroix ist der wichtigste Mandant, den wir in dieser Kanzlei jemals hatten.«
»Er ist ein Krimineller«, gab Maddie zurück. »Er sollte hinter Gittern in einer winzigen Zelle sitzen, statt in Manhattan herumzustolzieren und sich einzubilden, er könnte jeden kaufen. Er könnte mich kaufen!« Sie wies mit dem Finger Richtung Konferenzraum. »Er kann mich mal. Lieber verhungere ich, als dass ich für ihn arbeite.«
»Dann verhungern Sie eben!« Adrianna richtete sich zu voller Größe auf und atmete einmal tief durch. »Sie sind gefeuert.«
»Gut!« Maddie öffnete ihre Aktentasche und kippte ihre Notizblöcke auf den Tisch. Dann füllte sie die Tasche mit ihren persönlichen Sachen. Ein Foto von Lucy in Talar und Barett, mit einem strahlenden Lächeln auf dem Gesicht. Noch ein Foto von Lucy, aufgenommen an ihrem ersten Tag am College, wie sie aus dem Fenster des Studentenwohnheims winkte. Und noch einmal Lucy, bei ihrer kleinen Einzelausstellung, staunend und voller Erwartung.
Maddie hielt inne. Ihr Blick fiel auf die Kostenaufstellung, die unter Johnson vs. Jones hervorschaute. Wenn sie ihren Job verlor, musste Lucy auf das Semester in Italien verzichten. Verdammt, sie würde auf das gesamte Studium verzichten müssen, es sei denn, das arme Kind nahm auch so einen mörderischen Ausbildungskredit auf wie den, der Maddie bis heute belastete. Solche Schulden raubten einem jede Freiheit, sie bedeuteten den Tod aller Träume. Sie führten dazu, dass man Leuten wie Adrianna Marchand ausgeliefert war. Und wie Adam LeCroix.
Sie musste sich fügen, es blieb ihr keine andere Wahl. Wie ein in die Enge getriebenes Kaninchen blickte sie Adrianna an. Die lächelte wie der böse Wolf.
»Ich wusste doch, dass Sie wieder zur Vernunft kommen.« Adrianna beugte sich über Maddies Schreibtisch und drückte auf den Knopf der Gegensprechanlage. »Randall, kommen Sie mal her.«
»Sofort, Ma’am!« In Rekordzeit stand er im Büro. Er war vom Schicksal mit rotem Haar und Sommersprossen gestraft worden und errötete wie eine Jungfrau, als Adrianna ihren Raubtierblick auf ihn richtete.
»Hier, nehmen Sie das.« Sie schob die Unterlagen zu Johnson vs. Jones zu einem Stapel zusammen und drückte ihn Randall in die Hände. »Richter Bernam erwartet Sie in zwei Stunden im Gericht, um über einen Vergleich zu verhandeln. Enttäuschen Sie mich nicht.«
Randall wurde ganz blass. »Aber …«
Adrianna blickte ihn scharf an.
»Keine Sorge«, sagte Maddie mitfühlend, »das ist nur pro forma. Der Kläger will keinen Vergleich.«
Randalls Erleichterung war nur von vorübergehender Dauer, denn Adrianna zeigte auf die Kartons auf dem Couchtisch und die vielen Fallakten auf der Couch. »Die sind auch für Sie. Nehmen Sie alles mit raus.«
Randall war eben erst eingestellt worden und hatte von allen Mitarbeitern am wenigsten zu tun. Naiv wie er war, hatte er bisher angenommen, die Abende und die Wochenenden gehörten ihm. Jetzt spiegelte seine Miene wachsendes Entsetzen. Normalerweise hätte Maddie Mitleid mit ihm empfunden, doch sie war viel zu sehr mit ihrem eigenen Schreckgespenst beschäftigt: Adam LeCroix, Milliardär, Unternehmer, internationaler Playboy. Kunstdieb der ganz besonderen Art.
Sie musste schwer schlucken. Es war eine bittere Niederlage.
Vor fünf Jahren wäre es ihr beinahe gelungen, ihn festzunageln. Ihre Beweisführung beruhte zwar auf Indizien, aber wenn man ihr erlaubt hätte, den Fall vor Gericht zu bringen, hätte sie auch gewonnen. Sie hätte die Jury davon überzeugt, dass LeCroix nicht nur schlau genug war, um das hochmoderne computergestützte Sicherheitssystem von Sotheby’s zu überlisten, sondern auch sportlich genug, um wie Spiderman die Wände hochzuklettern, sich an den bewaffneten Wachen vorbeizuschleichen und keine vier Minuten später mit der zusammengerollten Dame in Rot wieder zu verschwinden.
Aber ihr Chef war viel zu feige, um sich mit LeCroix anzulegen. Er hatte ein Auge auf einen Senatorenposten geworfen und wollte nicht riskieren, mit einer Niederlage in einem aufsehenerregenden Prozess auf der Titelseite der New York Times zu landen. Also hatte Maddie mit ansehen müssen, wie LeCroix aus ihrem Büro hinausspazierte, noch einmal den Nutten von den Medien zuwinkte, die ihn allesamt wie einen Star verehrten, und dann in seiner schwarzen Stretchlimousine davonfuhr.
Das war schlimm genug gewesen. Aber das hier … das war ein Albtraum. Sie war diesem Mann völlig ausgeliefert. Ausgeschlossen, dass sie ihre Stelle bei Marchand, Riley & White aufgab und sofort eine ähnlich gut bezahlte fand. Nicht bei der momentanen Wirtschaftslage.
Sie fröstelte. Seit sie bei ihrem tyrannischen Vater ausgezogen war, hatte sie sich nicht mehr so wehrlos gefühlt. Damals hatte sie sich geschworen, sich nie wieder von einem Mann beherrschen zu lassen, aber jetzt hatte LeCroix sie in der Hand. Und er war ein echter Teufel. Falls er je etwas über ihre Kindheit erfuhr, würde er auch ihre persönlichen Dämonen noch als Waffe gegen sie benutzen.
Ihren Abscheu darüber, für ihn arbeiten zu müssen, konnte sie nicht vor ihm verbergen, und das wollte sie auch gar nicht, aber er durfte auf keinen Fall merken, wie viel es sie wirklich kostete.
Adam hatte ein weiteres Telefongespräch beendet und schaute auf die Uhr. Sechs Minuten. Inzwischen dürfte Madeline kapituliert haben und dabei sein, sich mit ihrer Niederlage abzufinden. Vermutlich gürtete sie gerade ihre Lenden – die Vorstellung entlockte ihm ein Lächeln – für die Rückkehr in den Konferenzraum und die tiefe Entschuldigung, die Adrianna Marchand, der alte Drache, garantiert von ihr verlangt hatte.
Sein Lächeln wurde zum Grinsen. Den Tag würde er nie erleben. Madeline mochte mit dem Rücken zur Wand stehen, aber entschuldigen würde sie sich bestimmt nicht.
Das wollte er auch gar nicht. Er wollte seine vierundvierzig Millionen. Und er wollte erleben, wie der arrogante Direktor von Hawthorne – Jonathan Edward Kennedy Hawthorne IV. – blass wurde, weil Adam zusammen mit der Anwältin aufkreuzte, die damals gegen ihn ermittelt hatte.
Hawthorne glaubte fälschlicherweise, er könnte Adam ausbremsen, nur weil sein Urgroßvater oder wer auch immer mit der Mayflower herübergekommen war und das gegründet hatte, was inzwischen zur ältesten, unflexibelsten und hochnäsigsten Versicherungsgesellschaft ganz Amerikas geworden war. Er dachte, Adam würde vor Angst zittern, wenn er andeutete, man könne ja die alten Gerüchte über die Dame in Rot wieder in Umlauf bringen.
Wohl kaum. Wenn Hawthornes schmierige Anwälte ihre Hausaufgaben gemacht hätten, wüssten sie, dass Adam sich einen Dreck um schlechte Publicity scherte. Es interessierte ihn nicht, was die Medien und die Öffentlichkeit dachten und was die Post als Nächstes auf Seite sechs über ihn berichten würde.
Wichtig war ihm nur, dass er nicht beschissen wurde. Von niemandem. Und ganz sicher nicht von irgend so einem blaublütigen Typen, der glaubte, sein Geld wäre mehr wert als Adams, bloß weil er schon ein bisschen länger reich war.
Auf jeden Fall würde Hawthorne eine ganz schöne Überraschung erleben. Er käme bestimmt nie auf die Idee, dass ausgerechnet Madeline Adam vertreten könnte. Nicht nachdem sie bekanntermaßen alles getan hatte, um ihn vor Gericht zu bringen. Die Geschichte war damals von Medien aus aller Welt ausgeschlachtet worden, sie hatten eine sensationelle Story daraus gemacht: die aufstrebende Staatsanwältin, die hartnäckig versuchte, den Selfmade-Milliardär vor Gericht zu zerren. Schlagzeile: Pitbull gegen Piranha.
Allein schon ihr Name auf seiner Gehaltsliste würde jedes Argument von Hawthorne entkräften, das dem Motto Einmal ein Dieb, immer ein Dieb folgte. Und falls Hawthorne sich einen anderen Grund einfallen ließ, Adam das Geld vorzuenthalten, würde er Madeline eben auf ihn loslassen. Gegen den Pitbull hätte Hawthorne nicht die geringste Chance.
Adams Grinsen wurde noch breiter. Und das Sahnehäubchen war, dass Madeline den ganzen Vorgang von Anfang bis Ende hassen würde. Er hätte sich beim besten Willen keine süßere Rache erträumen können.
Als ihm die Idee letzte Woche gekommen war, hatte er sich noch gefragt, wie er es schaffen sollte, Madeline für sich einzuspannen. Diese Frau besaß mehr Integrität als jeder andere Mensch, den er kannte. Ein paar schnelle und nicht ganz saubere Recherchen zu ihren Finanzen hatten jedoch ihre Achillesferse bloßgelegt – ihre Schwester Lucille. Sechzig Prozent von Madelines Einkommen gingen für den Unterhalt der Schwester drauf. Unterbringung, Verpflegung, Kleidung, Reisekosten und vor allem die schwindelerregend hohen Studiengebühren der Rhode Island School of Design. Das Mädchen erhielt zwar einen kleinen Zuschuss, hatte aber keinerlei Darlehen aufgenommen. Für alles kam Madeline auf.
Sie konnte es sich buchstäblich nicht leisten, ihren Job zu verlieren.
Danach hatte er nur noch ihre durchtriebene Chefin einfangen müssen, mit ein paar vagen Versprechungen über zukünftige Geschäfte, die natürlich von Madelines Bereitschaft zur Zusammenarbeit abhingen. Schon hatte er Madeline genau da gehabt, wo er sie haben wollte.
Die Tür des Konferenzraums öffnete sich, und der Pitbull persönlich trat ein. Über die Schulter hinweg knurrte sie jemanden an, der sich hinter ihr im Flur befand, dann knallte sie die Tür zu und stapfte quer durch den großen Raum auf ihn zu. Eine kleine Stange Dynamit, die jeden Moment explodieren konnte.
Adam musste erneut grinsen. Er hatte schon immer gern Dinge in die Luft gejagt.
Sie baute sich vor ihm auf, dicht genug, dass sie trotz ihrer nicht eben eindrucksvollen Größe auf ihn herabblickte, und sagte genau ein Wort.
»Warum?«
Er hob die Brauen. Und gab keinen Zentimeter Boden nach.
»Warum was?«
»Warum ich? Es wäre dumm, von mir zu erwarten, dass ich in der Monet-Sache auf Ihrer Seite bin. Und dumm sind Sie nun wirklich nicht.« Sie verschränkte die Arme. »Das heißt, Sie ziehen mich da hinein, um sich zu rächen. Das Ganze ist fünf Jahre her, und die einzige Folge, die der Diebstahl der Dame in Rot für Sie hatte, war, dass Ihre Fans bei den Medien Ihnen noch mehr Aufmerksamkeit gewidmet haben. Warum setzen Sie die vierundvierzig Millionen Dollar von der Versicherung aufs Spiel, indem Sie mich in die Sache hineinziehen? Warum zum Teufel suchen Sie sich nicht einen Anwalt, der tatsächlich glaubt, dass Sie Ihren Monet nicht selbst gestohlen haben, und lassen mich in Frieden?«
Adam ließ die Eiswürfel in seinem Scotch kreisen. Als er sich diesen unausweichlichen Moment im Voraus ausgemalt hatte, war er davon ausgegangen, dass er ihren Angriff mit einer raschen Zusammenfassung ihrer prekären Finanzlage abwehren würde, gefolgt von einem kräftigen Tritt in den Hintern, damit sie von nun an parierte. Aber jetzt war ihm nicht danach. Mit diesem feurigen Blick gefiel sie ihm viel besser.
Zu seiner eigenen Überraschung musste er zugeben, dass ihm nicht ganz wohl dabei war, ihre Schwester als Waffe gegen sie zu benutzen. Vielleicht hatte er ja eine Schwäche für liebende Geschwister – obwohl er das nie vermutet hätte, schließlich besaß er selbst keine. Wahrscheinlich gewann da eher sein Geschäftssinn die Oberhand. Bei der Auseinandersetzung mit Hawthorne würde ihre Streitlust schließlich ein Aktivposten sein. Also durfte er ihren Kampfgeist nicht brechen.
Aber er musste ihr deutlich zeigen, wer hier der Chef war.
»Setzen Sie sich«, sagte er in neutralem Tonfall, der nicht herausfordernd wirkte, aber auch keinen Widerspruch zuließ. Zugleich blickte er zu einem der Sessel. Ein klares Signal, dass sie sich hinsetzen musste, wenn sie wollte, dass er sie weiterhin ansah.
Nachdem sie fünf Sekunden gezögert hatte, nur um ihm zu zeigen, dass sie sich hinsetzte, weil sie es wollte, nicht etwa weil er es angeordnet hatte, ließ sie sich in dem Ledersessel nieder. Das Polster sank kaum unter ihr ein; sie konnte nicht viel mehr als vierzig Kilo wiegen.
Sie hatte die Kostümjacke in ihrem Büro gelassen, und unter ihrem ärmellosen Top zeichneten sich Brüste ab, die perfekt zu ihren sonstigen Proportionen passten. Nicht dass er direkt hingeschaut hätte; sein Blick war auf ihr Gesicht gerichtet, aber aus dem Augenwinkel konnte er deutlich sehen, wie sich ihre Brüste mit jedem zornigen Atemzug hoben und senkten.
»Hören Sie zu, LeCroix …«
»Adam«, unterbrach er sie. »Meine engen Berater nennen mich beim Vornamen. Ich finde, so redet es sich offener.« Er lächelte kaum merklich. »Obwohl Sie offenbar kein Problem damit haben, Ihrem Chef die Meinung zu sagen.«
»Sie sind nicht mein Chef. Ich arbeite für Marchand, Riley & White. Sie sind mein Mandant. Ich bin« – sie brachte es kaum über die Lippen – »Ihre Anwältin. Sie bezahlen mich nicht. Das tut die Kanzlei. Ich bin Ihnen auch nicht unterstellt. Ich vertrete Sie. Das ist alles.«
Er neigte den Kopf und lächelte erneut, diesmal verständnisvoll. »Vielleicht hat sich Adrianna nicht deutlich genug ausgedrückt. Es stimmt, Sie stehen nicht direkt auf meiner Gehaltsliste. Aber eins muss Ihnen klar sein. Sie arbeiten für mich. Sie unterstehen mir. Ich bin Ihr einziger Mandant. Und mein Wunsch ist Ihnen Befehl.«
Sie sprang auf, und er hätte beinahe gelacht. Mit dem letzten Satz hatte er tatsächlich übertrieben. Aber das forderte sie ja geradezu heraus.
»Sie können sich Ihre Wünsche sonst wohin …«
Er schnitt ihr wieder das Wort ab. »Sie haben sicher eine Menge origineller und faszinierender Vorschläge, was ich mit meinen Wünschen machen kann, aber dafür bezahle ich Sie nicht. Ich bezahle Sie für Ihre Zeit, Ihre Anstrengungen und Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Und mit ungeteilt meine ich sieben Tage die Woche, rund um die Uhr.«
Sie riss die Augen auf. »Ich habe auch noch ein Privatleben.«
»Wirklich?« Er sagte es bewusst unverschämt.
Ihre Wangen glühten.
Jetzt hätte er ihr verraten können, was er über sie wusste. Dass nicht nur ihre Finanzen im Keller waren, sondern auch ihr Liebesleben. Aber warum hätte er ihr auf die Nase binden sollen, dass seine privaten Ermittler ihr Leben von vorne bis hinten durchleuchtet hatten. Diese Bombe wollte er sich für später aufheben.
Trotzdem, es wunderte ihn, dass es da offenbar gar keine Liebesgeschichten gab, weder jetzt noch früher. Seine Ermittler hatten ihre gesamte Vergangenheit bis hin zu ihrer Studentenzeit am Boston College durchforscht und waren auf keine Beziehung gestoßen, die länger als ein Wochenende gedauert hätte. Zugegeben, man musste ein tapferer Mann sein, um sich vor ihr auszuziehen – ein falscher Blick, und sie würde einem die Eier abreißen – dennoch hatte es über die Jahre Interessenten genug gegeben. Dass nie etwas daraus geworden war, lag nur an Madeline.
Ihr Erröten verriet Adam, dass mehr dahintersteckte. Er würde schon noch herausbekommen, was es war. Fürs Erste hatte er jedoch genügend Druckmittel in der Hand.
»Holen Sie Ihre Sachen«, sagte er. »Ich bringe Sie nach Hause.«
»Ich finde den Weg schon alleine. Und zwar dann, wenn es mir passt.
Ohne ihre Worte zu beachten, stellte er sein Glas auf den Tisch und holte das Handy hervor. »Fredo, bring den Wagen. Wir sind in fünf Minuten unten.«
»Ich fahre nicht mit!«
Er steckte das Handy ein, richtete sich zu seiner vollen Größe von eins achtundachtzig auf und sah zu, wie sie den Kopf in den Nacken legte, um ihn wütend anfunkeln zu können.
Dann verzog er den Mund zu einem Lächeln, das eine einzige Drohung war. »In fünf Minuten, Madeline. Mit Ihren Sachen oder ohne. Das bleibt Ihnen überlassen.«
Und er ging an ihr vorbei aus dem Zimmer.
3
Die Limousine stand am Straßenrand, und ihre Tür war so weit geöffnet wie das Tor zur Hölle.
Ein gut aussehender Mann im dunklen Anzug kam auf Madeline zu, um ihr die Aktentasche abzunehmen. »Hallo, Ms St. Clair. Ich bin Fredo.«
»Hallo, Fredo. Sie können mich Maddie nennen.« Sie ließ ihren Blick gerade so lange auf ihm ruhen, dass es Interesse signalisierte. Gleich darauf hätte sie sich dafür ohrfeigen können. Dies war der Fahrer, Bodyguard und Vertraute von LeCroix und damit wirklich der Letzte, mit dem sie ins Bett wollte.
Na ja, das stimmte nicht so ganz. Der Letzte war LeCroix. Die Frauen warfen sich ihm ja nur so an den Hals; er musste schon Hunderte gehabt haben, wenn nicht mehr. Sie würde jedoch nicht dazugehören.
Oh ja, sie konnte durchaus nachvollziehen, dass andere Frauen ihn attraktiv fanden. Der Mann sah aus wie ein Gott.
Aber er war ein Teufel. Und außerdem hatte er nicht das geringste Interesse an ihr gezeigt. Weder vor fünf Jahren noch heute. Auch als sie sich jetzt bückte, um einzusteigen, würdigte er sie keines Blickes. Er saß bereits auf der Rückbank, mit Blick in Fahrtrichtung, den aufgeklappten Laptop rechts neben sich. Links waren Papiere ausgebreitet.
Sie setzte sich ihm gegenüber und musterte die Innenausstattung. Natürlich das Feinste vom Feinsten. Butterweiche Ledersitze, versenkte Leuchten, eine gut bestückte Bar mit Kühlschrank. Alles überraschend dezent. Da LeCroix normalerweise ständig protzte, musste sie sich an diesen Anblick erst einmal gewöhnen.
Während der Fahrer die Limousine in den Verkehrsstrom lenkte, sagte LeCroix nüchtern: »Wenn Sie nicht mehr zu bieten haben, muss ich Ihre Dienste wohl doch nicht in Anspruch nehmen.«
Völlig perplex warf Maddie einen prüfenden Blick auf ihr Kostüm und schaute dann zu ihrer Aktentasche. Sie konnte keinen Makel feststellen. Ihr Äußeres passte genau zu dem, was sie war: eine gut bezahlte Anwältin.
Beleidigt warf sie LeCroix einen finsteren Blick zu.
Er schaute aus dem Fenster. »Nein, ich werde es mir nicht noch mal überlegen.« Er tippte an sein Bluetooth-Headset.
Sie spürte, wie sie errötete. Er hatte überhaupt nicht mit ihr gesprochen. So unwichtig war sie für ihn.
Wie um das zu bestätigen, ignorierte er sie weiterhin und tippte auf seinem Laptop herum. Während sie dasaß und grübelte.
Das Problem – zumindest das dringendste Problem – war, dass er nicht merken sollte, wo sie wohnte.
Bevor sie die Verantwortung für Lucy übernommen hatte, hatte sie sich eine schöne Wohnung in Park Slope geleistet, einer angesagten Wohngegend in Brooklyn. Dort hatte sie viele der Ladeninhaber, Studenten und Künstler gekannt, die ihre Nachbarn waren. Jetzt lebte sie zwar immer noch in Brooklyn, aber nicht mehr in Park Slope oder Williamsburg oder einer anderen schicken Gegend.
Vielmehr wohnte sie in einem winzigen Appartement in einem Problemviertel, das nicht einmal einen eigenen Namen hatte und dessen einziger Pluspunkt darin bestand, dass man es mit der U-Bahn gut erreichte.
»Hören Sie«, sagte Maddie und versuchte, sich ihre Nervosität nicht anmerken zu lassen. »Ich muss noch ein paar Besorgungen machen. Sagen Sie Fredo, er soll mich bei Macy’s absetzen.«
LeCroix schaute nicht einmal hoch. »Zum Einkaufen haben wir keine Zeit. In eineinhalb Stunden heben wir ab.«
Fast wäre sie von der Rückbank aufgesprungen. »Heben wir ab? Mit dem Flugzeug?«
»Raketen habe ich noch nicht. Obwohl ich darauf hinarbeite.« Er sah sie an. »Haben Sie etwa Flugangst?«
Ja, und was für welche. Die Sorte, bei der man Schweißausbrüche bekam. »Nein. Aber der Hauptsitz von Hawthorne ist doch hier.«
»Und mein Hauptsitz ist in Italien.«
Ein stundenlanger Flug. Quer über den Atlantik.
Sie fühlte, wie sie ins Schwitzen geriet. Sie hatte schreckliche Höhenangst. Und Fliegen war das Schlimmste überhaupt.
Die Seitenwände der Limousine schienen näher zusammenzurücken. Eine fahrende Gefängniszelle. Um einer Panikattacke zu entgehen, schaute Maddie aus dem Fenster. Sie fuhren gerade nach Brooklyn hinüber. Offenbar wusste LeCroix längst, wo sie wohnte. Das erklärte natürlich, weshalb er sich ihrer so verdammt sicher gewesen war.
Sie fühlte, wie Zorn in ihr aufstieg, und war froh darüber. Während LeCroix auf seinem Laptop in aller Seelenruhe Tabellen durchging und E-Mails las, musterte sie finster sein kantiges Profil und schürte ihren Zorn immer mehr, bis er die Angst und die Scham verdrängte.
»Ihr Monet ist gar nicht gestohlen worden, stimmt’s?«, unterbrach sie schließlich das Schweigen. »Das ist doch wieder nur ein Trick. Noch so ein Schwindel, der beweisen soll, dass Sie klüger sind als alle anderen.«
Er hob den Kopf und erwiderte ihren Blick. »Wenn ich das bejahen würde, wären Sie als meine Anwältin zum Schweigen verpflichtet, nicht wahr, Madeline?« Er verzog die Lippen zu einem leichten Lächeln. »Selbst wenn ich zugeben würde, dass ich die Dame in Rot tatsächlich gestohlen habe, könnten Sie nicht das Geringste unternehmen, jetzt, wo Sie mich vertreten.«
Ihr kam die Galle hoch. »Und, geben Sie es zu?«
Er grinste über das ganze Gesicht. »Im Herzen sind Sie immer noch Staatsanwältin, nicht wahr, mein Schatz?«
Ihr Blutdruck stieg. »Ich bin nicht Ihr Schatz, Sie Mistkerl.«
Sein Lächeln wurde noch breiter. »Verzeihen Sie bitte. Ich vergesse immer wieder, wie empfindlich die amerikanischen Frauen sind.«
»Lassen Sie den Quatsch. Sie sind ja selbst Amerikaner.«
»Ich bin zwar hier geboren, aber ich sehe mich als Weltbürger.«
Über seine Herkunft war Maddie bestens im Bilde. Seine Eltern waren beide bekannte Maler, die kreuz und quer durch Europa gereist waren und jeweils für ein paar Monate in den Villen ihrer vielen wohlhabenden Gönner gewohnt hatten, sodass Adam LeCroix kaum etwas von seiner Kindheit in Amerika zugebracht hatte.
Er war Einzelkind, sprach sieben Sprachen fließend und hatte einen schwindelerregend hohen IQ. Mit zweiundzwanzig hatte er beide Eltern durch einen Flugzeugabsturz vor Korsika verloren, woraufhin er die Wagenladung Bilder, die sie ihm hinterlassen hatten, verkauft und aus dem kleinen Vermögen, das er dafür bekam, schnell ein gigantisches großes gemacht hatte. Maddie hatte sich vor fünf Jahren genau darüber informiert, wie viel seine international tätigen Firmen wert waren. Die Summe war damals schon atemberaubend gewesen, und seitdem hatte sie sich verdoppelt.
Er gehörte zu den reichsten Männern der Welt. Dieses Arschloch.
Der Wagen kam ohne jeden Ruck zum Stehen. Sie waren vor Maddies tristem Wohnhaus angekommen.
Fredo eilte um den Wagen herum und öffnete die Tür. Als Maddie gerade aussteigen wollte, klappte LeCroix den Laptop zu und rutschte in Richtung Tür. Maddie erstarrte mitten in der Bewegung.
»Moment mal. Ich habe Sie nicht zu mir eingeladen.«
Er blickte sie mit Unschuldsmiene an. »Dieses Fahrzeug ist zwar ziemlich gut ausgestattet, aber über ein WC verfügt es nicht. Ich hatte gehofft, Ihres benutzen zu dürfen.«
Was konnte sie dagegen schon einwenden? Nichts.
Mit grimmigem Blick und steifem Rücken stieg sie aus. Fredo lächelte ihr mitfühlend zu. Der Mann war ihr sympathisch.
Als sie sich zwischen einem rostigen Honda und einem blitzblanken SUV hindurchzwängte, hörte sie Adam sagen: »Wir sind in zehn Minuten wieder da, Fredo.«
Zehn Minuten, um für Italien zu packen?
Sie wandte sich um und wollte ihm gerade sagen, was sie davon hielt, als sie unter dem Honda eine Bewegung bemerkte. Rasch sprang sie auf den Bürgersteig, in der Erwartung, dass gleich eine Ratte hervorkommen würde. Doch nichts geschah.
Da hörte sie ein leises Winseln. Sie bückte sich, um nachzuschauen.
»Oh nein!« Unter dem Auto lag ein Hund, mehr tot als lebendig. Er blinzelte, sah sie kurz an und schloss wieder die Augen.
Maddie ließ sich auf die Knie sinken und schob Kopf und Schultern unter die Stoßstange.
»Was in aller Welt …« Adam kniete sich neben sie. »Oh mein Gott.« Als sie nach dem Hund greifen wollte, hielt er sie zurück. »Er ist verletzt. Vorsicht, er könnte beißen.«
Sie schüttelte seine Hand ab, aber er hatte recht. Maddie hatte schon öfter mit herrenlosen Hunden zu tun gehabt und wusste, dass selbst die sanftmütigsten manchmal aggressiv wurden, wenn sie verletzt waren. Und diesem Hund ging es offenbar ziemlich schlecht. Er war unter den Honda gekrochen, um zu sterben.
Sie richtete sich wieder auf, blieb aber neben dem Auto knien und richtete ihre Empörung gegen Adam, der soeben aufstand. »Wir lassen ihn nicht da liegen!«
»Natürlich nicht.« Er zog sein Jackett aus, legte es auf dem Honda ab, entfernte seine Manschettenknöpfe und krempelte die Ärmel hoch. Dabei wies er Fredo an, den Wagenheber zu holen, und fragte Maddie, wo der nächste Tierarzt zu finden war.
»Gleich um die Ecke.« Dort hatte ihr Freund Parker seine Praxis. In seinem Tierasyl nebenan half sie manchmal aus.
Innerhalb kürzester Zeit hatte Fredo den Honda mit dem Wagenheber in die Höhe gestemmt. Bei dem grausigen Anblick, der sich Maddie bot, wurde ihr schwer ums Herz.
Ein Hund mit kurzem sandfarbenem Fell lag ausgestreckt auf der Seite, in einer öligen Pfütze. Er hätte fünfundzwanzig Kilo oder mehr wiegen müssen, brachte aber wahrscheinlich nicht einmal mehr zwanzig Kilo auf die Waage. Seine Rippen traten hervor, in seinem Fell gab es kahle Stellen, und wo sein Halsband gesessen hatte, verlief eine Wunde rings um den Hals.
Adam kniete sich neben sie. »Hallo, mein Kleiner«, sagte er mit einer Stimme, die selbst Maddie besänftigte. »Du hast wohl schon länger nichts mehr zu fressen bekommen. Dagegen können wir etwas tun.«
Der Hund zuckte mit dem Schwanz und öffnete die braunen Augen, aber nur kurz.
Adam griff nach seinem Jackett, kroch unter den Wagen, wickelte das abgemagerte Tier in den Stoff und kam mit ihm auf den Armen wieder hervor.
»Biegen Sie an der Ecke rechts ab«, sagte Maddie zu Fredo, während dieser den Honda wieder herunterließ. »Es ist auf halbem Weg zur nächsten Ecke.« Sie schob den Laptop beiseite und stieg in die Limousine, gefolgt von Adam. Der Hund lag völlig schlaff auf seinem Schoß.
Maddie drückte die Schnellwahltaste für Parker. »Ich habe einen Notfall. Einen Hund. Nein, ich glaube nicht, dass er angefahren wurde. Aber er ist fast tot«, sagte sie mit rauer Stimme. Der Hund hatte die Augen nicht noch einmal geöffnet. Die Wunde am Hals war entzündet. Er wirkte völlig entkräftet.
Parker wartete bereits an der Tür. Sie durchquerten das Wartezimmer, vorbei an einem Kind mit einem unruhigen Welpen auf dem Schoß und einem alten Mann mit einem Chihuahua in jeder Armbeuge, und betraten das Behandlungszimmer am Ende des Ganges. Adam legte den Hund auf dem Stahltisch ab, immer noch in das Jackett gewickelt.
»Ich kümmere mich um ihn.« Parker scheuchte sie aus dem Zimmer.
Draußen wartete bereits die Tierarzthelferin, ein Klemmbrett in der Hand. »Wem gehört der Hund?«
Maddie wollte sich melden, biss sich dann jedoch auf die Lippe. In ihrer Wohnung durfte sie keine Hunde halten.
»Schicken Sie die Rechnung an mich«, sagte Adam.
»Wie heißt er?«
»Er ist herrenlos.«
Die Dame ließ den Stift klicken, schrieb John Doe auf das Formular, wie die Polizei es bei einem unbekannten Toten getan hätte, und reichte Adam das Klemmbrett. »Bitte tragen Sie hier Ihre Rechnungsanschrift ein, Mr LeCroix.«
Adam zuckte nicht mit der Wimper, als sie ihn mit Namen ansprach. Natürlich nicht. Er war schließlich eine Berühmtheit. Sein Gesicht war nicht nur jeden Abend auf dem Wirtschaftskanal CNBC zu sehen; da er im Gegensatz zu anderen Multimilliardären wie George Soros oder Warren Buffett auch verdammt sexy war, berichteten außerdem People und TMZ über ihn und beobachteten sein Liebesleben ebenso genau, wie man an der Wall Street seine Firmenübernahmen registrierte.
Es war einfach widerlich. Der Mann war ein Verbrecher. Maddie wechselte stets den Sender, wenn ihn mal wieder sämtliche Reporter umschwärmten, und einmal hatte sie ihre People-Ausgabe sogar quer durchs Zimmer geworfen, weil sie darin auf ein Foto von ihm gestoßen war: auf seiner Jacht, mit nacktem Oberkörper, neben ihm ein Supermodel, das sich sonnte.
Jetzt verkniff sie sich jedoch ihren Hohn, denn Adam reichte der Tierarzthelferin soeben eine Visitenkarte und sagte: »Schicken Sie die Rechnung an diese Adresse. Für alles, was der Hund benötigt.«
John Doe zu versorgen würde viele Hundert Dollar kosten, und die hatte Maddie einfach nicht übrig.
Sie setzten sich auf die harten Stühle im Wartezimmer. Der Welpe befreite sich aus dem Griff des Jungen und rannte zwischen ihren Füßen umher. Die zwei zitternden Chihuahuas auf den Armen des alten Mannes beobachteten alles mit großen Augen.
Adam holte sein Handy hervor und drückte eine Kurzwahltaste. »Wir sind hier noch ein Weilchen beschäftigt«, teilte er Fredo mit. »Park den Wagen und sag Jacques, er soll den Flugplan streichen lassen und weiter in Bereitschaft bleiben.«
»Gehen Sie ruhig«, sagte Maddie, als er das Telefon wieder einsteckte. »Ich habe hier alles im Griff.«
»Nichts da.«
»Nun, den Versuch war es wert.«
Er lachte auf und legte den Arm auf die Rücklehne ihres Stuhls. Sie rutschte auf der Sitzfläche nach vorn und warf ihm einen strengen Blick zu.
Erst da bemerkte sie die Ölflecke auf seinem weißen Hemd und den gebräunten (und sehnigen) Unterarmen. Seine dunkle Hose war ebenfalls schmutzig, von den Knien bis zur (nett verpackten) Lendengegend. Und sein deutlich zu langes pechschwarzes Haar war zerzaust … was lächerlich sexy wirkte.
Sie wandte den Blick ab, ärgerlich darüber, dass sie ihm gegenüber etwas anderes als Abneigung empfand. Aber Mann, sie hatte ihn eben auch noch nie ohne Jackett gesehen. Nicht persönlich. Er war verdammt gut gebaut. Und wahrscheinlich auch gut bestückt.
»Ein echter Schmutzfink«, sagte er belustigt.
Sie fuhr herum. Hatte er etwa ihre Gedanken gelesen?
Dann merkte sie, dass er auf ihr Kostüm schaute. Puh. Er hatte ihr liebstes Stück von Armani gemeint, nicht ihre Sexfantasien.
Sie zuckte mit den Schultern. »Macht nichts, das kommt auf die Spesenrechnung. Die Schuhe auch.« Sie deutete auf den Kratzer an ihrem Schuh. »Ich warne Sie, die sind teurer als das Kostüm.«
Er lächelte leicht. »Ich schicke Ihnen ein Paar in jeder Farbe.«
»Größe 6.« Haha. Zehn Paar Jimmy Choos würden ihn zehn Riesen kosten, plus Steuern.
»Dieser Parker, ist das ein guter Tierarzt?«, fragte er.
»Aber natürlich.«
»Sie sind nicht zufällig voreingenommen?«
»Weshalb sollte ich voreingenommen sein?«
»Sie scheinen sich ziemlich gut zu kennen.«
»Tun wir auch. Ich helfe oft in dem Tierasyl, das er nebenan betreibt. Er ist der beste Tierarzt, den ich kenne.«
»Hm.« Adam blickte sich prüfend im Wartezimmer um, und plötzlich sah Maddie es mit seinen Augen. Wasserflecken an der Decke, welliger Linoleumfußboden, Fliegendreck an den Wänden.
Sofort wurde sie ärgerlich. »Falls Sie es noch nicht gemerkt haben sollten, wir sind hier nicht in Beverly Hills. Die Leute in dieser Gegend verpassen ihren Haustieren keine Schönheitsoperationen, aber sie lieben sie trotzdem. Und durch die niedrige Miete kann Parker mehr Geld ins Tierasyl stecken. Er finanziert es zum größten Teil aus eigener Tasche.«
LeCroix schaute sie an. »So etwas bewundere ich«, sagte er und nahm ihr damit den Wind aus den Segeln.
»Ja, nun, das sollten Sie auch.« Etwas Besseres fiel ihr nicht ein.
Sie wich seinem Blick aus. Sobald sie ihm in die tiefblauen Augen sah, verflog ihr Kampfgeist, und das durfte auf gar keinen Fall passieren. Sie musste stark bleiben, verdammt noch mal.
Aber sosehr sie es auch versuchte, sie konnte ihn nicht ignorieren – so wie man einen Panther nicht ignorieren konnte, der direkt neben einem saß, ein schlankes, geschmeidiges, starkes Tier, das einen mit einem Hieb töten konnte.
Sie wusste einiges über seine Herkunft. Er vereinte die besten Eigenschaften seiner Eltern in sich: Die wunderschönen Augen und die Figur eines Quarterbacks hatte er von seinem keltischen Vater, das glänzende schwarze Haar und die Gesichtsform mit den hohen Wangenknochen von seiner feurigen italienischen Mutter.
Aber über die Eltern des attraktivsten Mannes der Welt Bescheid zu wissen machte es nicht einfacher, mit ihm klarzukommen.
Ärgerlich über sich selbst kratzte sie an dem Straßenschmutz an ihren Knien herum, bis Parker ins Wartezimmer schaute.
»Hey, Mads, komm mal her.«
Adam folgte ihr. Da er die Rechnung bezahlen würde, konnte sie ihn kaum daran hindern. Aber es musste ihr ja nicht gefallen.
John Doe lag noch auf dem Untersuchungstisch, ausgestreckt auf einer Decke. Adams ruiniertes Jackett lag auf einem Stuhl.
Als sie eintraten, schaute Parker auf, aber er hatte nur Augen für Maddie.
»Es ist nicht ganz so schlimm, wie es aussieht. Im Moment ist die Dehydrierung das größte Problem, die hätte ihn fast das Leben gekostet. Dagegen hilft eine Infusion, dazu legen wir einen Zugang am Rücken. Er ist natürlich unterernährt, und da wir nicht genau wissen, seit wann, lässt sich schwer sagen, ob dadurch innere Organe geschädigt wurden.«
Parker strich dem Hund sanft über den knochigen Rücken, dann berührte er seinen Hals, dicht neben der Wunde. John Doe öffnete seine traurigen schokoladenbraunen Augen. »Alles gut, mein Kleiner«, murmelte Parker. »Jetzt tut dir niemand mehr weh.«
Maddie brannten die Augen, und eine Träne lief ihr über die Wange. Sie wischte sie weg.
Adam legte ihr eine Hand auf den Rücken, eine seltsam tröstende Geste. »Wird das abheilen?«, fragte er Parker.
»Aber sicher. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. So etwas passiert, wenn der Hund wächst, aber der Besitzer das Halsband nicht lockert. Irgendwann gräbt es sich dann in die Haut. In unserem Fall muss das Arschloch von Halter das Halsband abgerissen haben, bevor er den Hund ausgesetzt hat.«
»Du meine Güte«, murmelte Adam, und in diesen drei Worten schwangen Wut, Ekel und Mitgefühl mit.
»Ich habe ihm ein Schmerzmittel gegeben. Er wird gleich einschlafen. Dann trage ich Antibiotika-Salbe auf.« Parker schaute Maddie an. »Hilfst du mir, ihn nach hinten zu bringen?«
»Ich kann ihn tragen«, sagte Adam.
»Danke, aber Maddie kennt sich aus.« Parker ging um den Tisch herum, schob Adam zur Seite und trat neben Maddie. »Sie können uns die Tür aufhalten.«
Er fasste am einen Ende der Decke an, Maddie am anderen, und gemeinsam trugen sie den Hund an Adam vorbei.
Als Adam ihnen folgen wollte, stieß Parker mit dem Fuß die Tür hinter sich zu.
4
Adam bekam die Tür gerade noch zu fassen, bevor sie ihm gegen das Kinn knallte.
Was sollte der Quatsch?
Seit seiner Kindheit war er nicht mehr so rücksichtslos behandelt worden. Die Erfahrungen damals hatten dazu geführt, dass er seit zwanzig Jahren stets darauf achtete, überall der Alphamann zu sein.
Offensichtlich hatte Parker das noch nicht mitbekommen.
Am liebsten wäre Adam hinterhergerannt, aber er riss sich zusammen. Stattdessen durchquerte er das Behandlungszimmer, blieb vor dem kleinen Fenster stehen und blickte wütend hinaus. Die Scheibe war schmutzig, sodass die schmale Gasse dahinter noch trister aussah.
Er blickte auf den Eingang zum Tierasyl. Die blaue Tür war neu gestrichen worden, der Rest des Hauses dagegen wirklich heruntergekommen. Eben trat ein schlaksiger Teenager ins Freie, begleitet von einem putzmunteren Husky-Mischling. Der Hund beschnüffelte sofort eingehend den Boden, für ihn war das Pflaster offenbar die reinste Zeitung. Der Junge strich ihm über den Rücken, und der Hund wedelte fröhlich mit dem Schwanz. Vollkommen zufrieden im Hier und Jetzt.
Adam fühlte einen Druck auf der Brust. Der dumme Hund wusste eben nicht, dass er herrenlos war. Dass ihn niemand mehr wollte. Er nahm einfach jedes bisschen Freundlichkeit an, das die kalte, grausame Welt zu bieten hatte, und machte das Beste aus dem miesen Blatt, das man ihm zugeteilt hatte.
Genauso hatte Adam es auch gemacht, nur war er noch einen Schritt weiter gegangen: Er hatte schon in jungen Jahren aufgehört, von irgendjemandem Freundlichkeit zu erwarten. Sich Zuneigung und Nähe zu erhoffen, wo ja doch keine zu finden war.
Er hatte sich sogar von seinem alten, kindlichen Wunsch verabschiedet, einen Hund zu besitzen, einen einzigen zuverlässigen Begleiter, den er mitnehmen konnte, wenn seine ruhelosen Eltern wieder einmal die Zelte abbrachen und er die wenigen Freunde, die er an seinem derzeitigen Wohnort gewonnen hatte, schon wieder verlor.
Wer von der Großzügigkeit anderer lebte, musste mit leichtem Gepäck reisen, das hatten ihm seine Eltern oft erklärt. Schlimm genug, dass sie ein Kind am Hals hatten. Wie hätten sie von ihren Gastgebern verlangen sollen, auch noch einen Hund zu tolerieren?
Eine gute Frage. Jedenfalls hatte er das Beste daraus gemacht, oder etwa nicht? Er hatte gelernt, sich anzupassen und mit Menschen jeder Art zurechtzukommen, von den Sprösslingen ihrer wohlhabenden Gönner bis zu den Kindern des Dienstpersonals. Er hatte ihre jeweiligen Muttersprachen gelernt und ebenso die Sprachen der unterschiedlichen Klassen, der Reichen und der Armen, der Salons und der Straße.
Diese Erfahrungen waren später sein Kapital gewesen, zusammen mit der Intelligenz, die Gott ihm geschenkt hatte, und den sechzig Gemälden, die seine Eltern ihm hinterlassen hatten. Dass die riesige Geldlawine, die tagtäglich in seine Taschen rutschte, ihren Ursprung letztlich in der Kunst hatte, die seine Eltern auf seine Kosten erschaffen hatten, zauberte ihm immer wieder ein Lächeln auf die Lippen. Nicht aus Freude, sondern aus bitterer Genugtuung.
Hinter ihm wurde die Tür wieder geöffnet, und Parker kam herein. »Ich werde gut für ihn sorgen«, sagte er über die Schulter hinweg. Durch seine Größe verdeckte er Madeline völlig. »Komm doch nach der Sprechstunde noch mal her und schau nach ihm.«
Dieser durchsichtige Winkelzug entlockte Adam ein Grinsen. Parker sah gut aus, war ein fähiger Tierarzt und offensichtlich auch ein intelligenter Mensch, aber anscheinend hatte er etwas noch nicht mitbekommen. Nämlich dass Madeline nur äußerst flüchtige Beziehungen hatte.
Wie erwartet ließ sie ihn abblitzen. »Mal sehen, ob ich es schaffe.« Sie ging zur Tür. »Schick mir eine SMS, wenn sich sein Zustand verändert, okay? Und mach dir wegen der Kosten keine Gedanken.« Sie wies mit dem Daumen in Adams Richtung. »Das geht alles auf seine Rechnung.«
Parker wandte sich Adam zu. Unter den gegebenen Umständen fand Adam es nicht weiter überraschend, dass in seinen Augen Misstrauen und Abneigung zu lesen waren. Was ihn allerdings doch überraschte, war, dass er das Gleiche empfand. Normalerweise hätte er Parker für sein Mitgefühl bewundert, aber nun gönnte er ihm nur einen herablassenden Blick.
Und als wäre das nicht schon seltsam genug, hörte er sich auch noch sagen: »Ihre Assistentin hat meine Karte. Sagen Sie ihr, sie soll mich informieren, sobald mein Hund reisefähig ist.«
Er fasste Maddie am Arm und schob sie sanft durch die Tür. Sobald sie draußen auf dem Bürgersteig standen, schüttelte sie seine Hand jedoch ab.
»Was soll das denn heißen – Ihr Hund? Ich habe ihn gefunden. Sie wären an ihm vorbeigelaufen.«
Er schaute betont gleichgültig auf sie herab. »Sie dürfen in Ihrer Wohnung keine Tiere halten.«
Sie funkelte ihn an, offenbar stinkwütend darüber, dass er so viel von ihr wusste. Außerdem fragte sie sich zweifellos, was er wohl noch herausgefunden hatte. Er verkniff sich ein Grinsen und behielt die gelangweilte Fassade bei. Wenn sie wüsste, wie gründlich seine Leute ihr Leben durchleuchtet hatten, träfe sie vermutlich der Schlag.
Der Wagen hielt am Straßenrand. Maddie streifte die Limousine mit einem vernichtenden Blick und machte sich zu Fuß auf den Weg zu ihrer Wohnung.
Sollte sie laufen, wenn es ihr Spaß machte. Als der Wagen an ihr vorbeifuhr, zeigte sie ihm den Stinkefinger. Im Schutz der getönten Scheiben lachte Adam laut auf.
Sein unerwartetes Auftauchen hatte sie aus der Bahn geworfen, von der Umkehrung der Machtverhältnisse ganz zu schweigen. Aber sie würde sich bald wieder fangen. Und so gern er auch geglaubt hätte, dass er sie fest im Griff hatte – wenn sie wieder auf Hochtouren lief, könnte sie klug genug sein, ihm zu entwischen.
Natürlich gefiel ihm gerade diese Klugheit an ihr. Außerdem war sie eine echte Giftspritze. Im Kampf gegen Hawthorne konnte er sowohl ihre Intelligenz und als auch ihre scharfe Zunge sehr gut gebrauchen.
Wobei sich Letztere im Moment ja einzig und allein gegen ihn richtete.
Fredo hielt am Straßenrand, und im gleichen Moment rauschte Maddie an ihnen vorbei. Adam holte sie ein, als sie eben den Haustürschlüssel ins Schloss rammte.
»In der Praxis gab es ein WC«, blaffte sie ihn über die Schulter hinweg an.
»Stimmt.« Er streckte den Arm aus, um die Tür für sie aufzudrücken. Madeline grummelte irgendetwas vor sich hin und stapfte die Treppe zu ihrer Wohnung im ersten Stock hinauf, wo sie sich wieder einen Kampf mit dem Türschloss lieferte.
Auch diesmal hielt er ihr die Tür auf. Sie betraten ein Wohnzimmer, das kaum größer war als der Innenraum seiner Limousine. Madeline ließ ihn stehen, marschierte einen kleinen dunklen Flur entlang und verschwand im Schlafzimmer.
Im Flur entdeckte Adam auch die Tür zum Badezimmer. Es war so klein, dass es in die Badewanne in seiner Villa gepasst hätte.
Zwischen Duschkabine und Kloschüssel gezwängt pinkelte er und inspizierte dabei den winzigen Raum. Weiße Kacheln, Armaturen aus Chrom. Badvorleger zusammengeknautscht in einer Ecke, Zahncremetube ohne Schraubverschluss auf dem Waschbeckenrand.
Unaufgeräumt, aber an den entscheidenden Stellen doch sauber.
An der Wand über der Toilette hingen vier gerahmte Bleistiftskizzen, zu einem Quadrat arrangiert. Szenen von einem Bauernhof. Pferde, eine Scheune, ein alter Jagdhund. Sein geschulter Blick verriet ihm, dass es sich um Frühwerke eines talentierten Künstlers handelte. Die Zeichnungen waren nicht signiert, aber er wusste trotzdem, von wem sie stammten.
Während er sich Schmutz und Öl von den Händen wusch, untersuchte er den Inhalt von Madelines Medizinschränkchen. Antibabypillen, wie zu erwarten. Sonst nur frei verkäufliches Zeug, mit einer überraschenden Ausnahme. Schlaftabletten. Er prüfte das Etikett. Erst wenige Tage alt, was erklärte, warum seine Leute nicht darauf gestoßen waren. Er schüttete die Tabletten in seine offene Hand – alle dreißig noch vorhanden.
Er füllte sie wieder in das Fläschchen und stellte es an dieselbe Stelle im Regal zurück. Ob Madelines finanzielle Nöte ihr nachts den Schlaf raubten? Sehr gut. Je größer ihre Sorgen, desto fester hatte er sie im Griff.
Als er das Badezimmer verließ, war die Tür zum Schlafzimmer noch immer geschlossen. Er kehrte ins Wohnzimmer zurück. Es war wie ein übervoller Koffer, vollgestopft mit schönen Möbelstücken, die wahrscheinlich noch aus den Zeiten stammten, als Madeline mehr Geld hatte. Eine Stehlampe mit einem extravaganten perlengeschmückten Schirm stand zwischen einem bequem wirkenden Zweiersofa und einem dazu passenden Sessel, beide mit samtigem rubinrotem Bezug. Eine kunstvoll verzierte japanische Truhe diente als Couchtisch. Dem Sofa gegenüber stand ein Flachbildfernseher, der in ein viel größeres Zimmer gehört hätte. Er füllte die ganze Wand und beherrschte das vollgestellte Zimmer wie eine Kinoleinwand.
Auch hier herrschte Durcheinander. Eine weiße Fleecedecke lag zerknautscht auf dem Sofa. Die Sonntagsausgabe der Times war unordentlich über den Couchtisch verstreut, im Magazinteil war das halb gelöste Kreuzworträtsel aufgeschlagen. Daneben stand eine Frühstücksschüssel mit einem eingetrockneten Rest Milch.
Adam hatte plötzlich das Bedürfnis, die Schüssel in die Küchenecke zu tragen und auszuspülen. Er steckte die Hände in die Hosentaschen. Wann hatte er das letzte Mal etwas so Alltägliches, so Normales getan, wie Geschirr abzuwaschen? Er konnte sich nicht daran erinnern. Diese unaufgeräumte kleine Wohnung brachte irgendwo in ihm eine Saite zum Schwingen, sodass er sich auf einmal fragte, wie sich ein ganz normales Leben wohl anfühlen mochte. Er sehnte sich geradezu danach, die bestrumpften Füße auf den Couchtisch zu legen, sich den angeknabberten Bleistift zu schnappen, der noch zwischen den Seiten des Magazins steckte, und das Kreuzworträtsel in Angriff zu nehmen.
Das ergab doch keinen Sinn. In seiner eigenen Welt bestand er auf Ordnung und Sauberkeit. Er besaß ein Dutzend Häuser, eines herrschaftlicher als das andere, und dort war nie auch nur ein Atom am falschen Ort. Wenn er etwas liegen ließ, räumten seine Bediensteten es weg. Alle Spuren von Leben wurden schnell wieder beseitigt, sodass er jederzeit problemlos fortgehen konnte. Mit keinem dieser Häuser fühlte er sich besonders verbunden, die Villa vielleicht ausgenommen.
Diese armselige, winzige, vollgestellte Wohnung dagegen, die so weit von aller Herrschaftlichkeit entfernt war, fühlte sich irgendwie … anheimelnd an. Hier lebte jemand. Im Geist sah er sich auf dem Zweiersofa sitzen, und fast konnte er Johns schweren Hundekopf auf seinem Schenkel spüren.
Er betrachtete die Wände. Überall hingen Bilder. Bisher hatte er sie noch gar nicht richtig wahrgenommen, so sehr hatte ihn diese unerklärliche Sehnsucht beschäftigt.
Jetzt richtete er seine ganze Aufmerksamkeit auf die Gemälde.
Mit Kunst kannte er sich aus – wie hätte es auch anders sein sollen, bei dieser Kindheit? Und er sammelte nicht nur die alten Meister. Er hielt auch nach neuen Talenten Ausschau und unterstützte sogar einige vielversprechende junge Künstler.