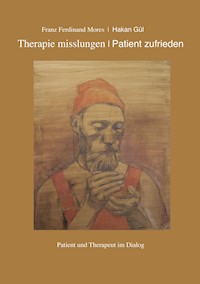
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Morddrohung gegen einen Staatsangestellten, der verzweifelt seine Familie schützen will, aber auch selbst einen Weg aus seinen Todesängsten finden will. Kann in einer solchen Situation Psychotherapie helfen? Über den gemeinsamen Weg Patient/Therapeut schreiben die beiden authentisch, ehrlich berührend, wie dieser Weg beschritten wurde. Trost für Andere und Anregung selbst nicht aufzugeben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Gemeinsame Vorbemerkung
Einleitung (Patient)
Einleitung (Therapeut)
Biografisches (Therapeut)
Ausbildung (Therapeut)
Meine ersten Jahre als Gastarbeiterkind in der BRD (Patient)
Meine schulische und berufliche Laufbahn (Patient)
Der Moment des eigentlichen Traumas (Patient)
Die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung (Patient)
Finden der Diagnose, Momente des Traumas und Bedeutung der Diagnose (Therapeut)
Die Begegnung mit meinem Therapeuten (Patient)
Die erste Begegnung (Therapeut)
Die Folgen meines Dienstunfalls (Patient)
Ein Dialog (Patient, dann beide)
Weitere therapeutische Momente (Therapeut)
Der Verlust meines sozialen Umfelds (Patient)
Noch mehr Theorie (Therapeut)
Ungewöhnliche Therapieformen (Patient)
Ein zweiter Dialog (beide)
Aufgeben ist keine Option (Patient)
Ein dritter Dialog (beide)
Ausblick und Resummé (Therapeut)
Das Ende des Buches (Patient)
Schlusswort und Dank (Therapeut)
Gemeinsame Vorbemerkung
Zwei Autoren, zwei Lebensläufe, zwei unterschiedliche Sichtweisen der Dinge. Ein Mensch befürchtet ermordet zu werden, befürchtet dass seiner Familie existentieller, evtl. gewalttätiger Schaden zugefügt wird. Man zieht sich zurück, man meidet die Öffentlichkeit, man hofft nicht entdeckt zu werden, man lebt in ständiger Angst.
Eine Situation vergleichbar mit einer Diktatur, dem Krieg, schrecklichen Ereignissen. Kann denn in solchen Situationen Psychotherapie überhaupt etwas bewirken? Was versuchen Ärzte und Psychotherapeuten, um Jemandem, der so etwas erlebt hat, zu helfen?
Wie könnte man so etwas so darstellen, damit Interessierte oder sogar Menschen, die ähnlich massive Ängste haben, davon profitieren könnten? In diesem Buch erzählt der Betroffene und sein Therapeut in großer Offenheit über ihr Leben, die Therapie und was dabei heraus gekommen ist.
Der Therapeut hat in dieser Zeit auch gemalt. Es ist eine begleitende Bilderserie entstanden, die einen Prozess darstellt, der klein beginnt, mit einem Strich, so wie sich zwei Menschen das erste Mal erblicken und der über viele Zwischenschritte zu einem vollständigen Bild wird. Die momenthaften Entstehungschritte der Bilderserie sind eingefügt in die Kapitel der therapeutischen Begegnung.
Hakan Gül und Franz Ferdinand Mores
Einleitung (Patient)
Wie kommt man als Psychotherapeut und Patient dazu, gemeinsam ein Buch über die Stunden, Tage, Monate und Jahre der Therapiezeit zu schreiben?
Im Nachhinein und mittlerweile etwas nüchtern betrachtet, würde ich behaupten, dass es aus einer Not heraus und aus Verzweiflung geschehen ist.
Mein Therapeut war sozusagen mit seinem Latein am Ende und wusste nicht mehr, was er alles versuchen sollte, um mir mein Leben zurückgeben zu können. Es war für mich irgendwann spürbar, dass er nicht nur mal eben so gut es geht, seinen Job erledigen und das Geld dafür kassieren wollte. Nein, er wollte mir unbedingt das wiedergeben, was ich einmal besaß:
Freude am Leben und Freude zu leben.
Ich meinerseits wollte in erster Linie, diese unerträglichen, schmerzhaften und einen in den Wahnsinn treibenden Ängste loswerden. Aber, und das hatte ich meinem Therapeuten bis zum Verfassen dieses Buches, zu keiner Zeit offenbart, wollte in zweiter Linie, dass er dafür belohnt wird, mich und das Glauben an sich und sein Können nicht aufgegeben hatte, denn auch er war wirklich spürbar verzweifelt.
Seine und meine Zeilen in diesem Buch soll den Leserinnen und Lesern vermitteln, wie zerrissen wir mit unseren Gedanken und Gefühlen umgingen und gleichzeitig dabei lernten, am Unmöglichen nicht zu verzweifeln und nicht aufzugeben, weil wir beide irgendwann an ein positives Ende glaubten oder vielleicht einfach nur hofften, dass der Kampfgeist und der Kampfeswille eine schwere psychosomatische Krankheit besiegen kann.
Einleitung (Therapeut)
In der Therapie hatte eine Annäherung zwischen dem Patienten und Therapeuten stattgefunden, wie das öfter vorkommt. Allerdings stand bisher kein Patient unter laufender Morddrohung.
Bestimmte traumaspezifische Verfahren, auch in Kliniken, waren nicht möglich gewesen. Der Patient hat aber durch den Aufenthalt in verschiedenen REHA-Kliniken eine große Anzahl von Therapeuten und Verfahren kennengelernt und konnte so gut zwischen diesen Verfahren und Therapeuten und dem Angebot der kardio-kognitiven Transformation unterscheiden.
Obwohl ihm die Angst vor der Ermordung und vor einem Angriff auf seine Familie nicht genommen werden konnte, verzeichnet der Patient vorwiegend das Erkannte und Erlebte aus der dargestellten Therapie als Erfolg.
Die gemeinsame Arbeit an diesem Buch trug nochmals stark zu dem Fortschritt bei, der gemeinsam erzielt werden konnte. Wir hoffen, dass die Beschreibung dieser Form von Psychotherapie und Aufarbeitung, bzw. Erarbeitung einer Lebensbasis unter Extrembedingungen, anderen Menschen, die ähnlich betroffen sind, Hoffnung geben kann, um nicht aufzugeben und sich der eigenen Problematik zu stellen, egal wie schwer sie ist.
Nicht ohne Grund kam es zu einem gemeinsamen Buch. Oft werden Patienten von Therapeuten beschrieben und dargestellt. Selten kommt es zu einer gemeinsamen Darstellung der Therapie. Wie wird diese Zeit von beiden Seiten gesehen? Welche Gedanken machen sich Patient und Therapeut?
Wir saßen nebeneinander beim Schreiben. Wir wollten das beide. Es ist Ausdruck dessen, was in dieser Therapieform möglich ist. Dies ist der Abstinenzregel, die in klassischen, vor allem psychoanalytischen Therapien die Regel ist, natürlich vollkommen entgegengesetzt. Aber so bekommt man einen guten Einblick in die praktische und übliche Arbeit der kardio-kognitiven Transformation.
Es ist letztlich ein Stück Weg – Lebensweg – der beschrieben wird. Lebensweg, mit der Besonderheit, sich therapeutisch zu begegnen, d.h. sich helfen zu wollen, durch die Klippen des Lebens hindurch. So gehört zur kardio-kognitiven Transformation immer der Wunsch sich gegenseitig zu bereichern, und es wird immer davon ausgegangen, dass jeder Patient auch für den Therapeuten hilfreich ist.
Setzen Sie sich mal mit ihrem Therapeuten zusammen und schreiben ein gemeinsames Buch. Vielleicht ist das eine Möglichkeit in Zukunft Therapien zu gestalten? Schreiben wir nicht alle permanent gemeinsam Bücher? Wie viele sagen: „Ich könnte ein ganzes Buch schreiben“? Warum tun sie es nicht?
Wir haben uns die Freiheit genommen. Ein guter Weg, mit viel Lachen, etwas Weinen, berührt sein, sich entwickeln, sich letztlich weiter transformieren. Das Ziel: ein zufriedener, liebevoller, friedfertiger Mensch, der tolerant geworden ist, einfühlsam und stark. Und mit all den errungenen Fähigkeiten auch schwierige Lebenssituationen meistern kann.
Wie viele unserer Eltern sagten, wir haben den Krieg, die Bombennächte, die Gewalttaten überlebt, was soll uns noch passieren? Auch heute geschieht noch viel Gewalt in der Welt, in den Familien. An allem kann man wachsen.
Biografisches (Therapeut)
Ich wurde im Verborgenen geboren. Meine Großeltern sollten nichts von der Schande der Tochter erfahren und erfuhren es dann von Dritten beim sonntäglichen Kirchgang. Man sagte ihnen, dass es ein uneheliches Kind gäbe, weit weg, dort, wohin sich die Tochter geflüchtet hatte.
Ein Verhältnis der ledigen, katholischen Hausangestellten mit dem verheirateten katholischen Unternehmer in der kleinen Gemeinde hatte Früchte getragen. Diese Frucht war ich. Die Welt war aus den Fugen, für die im Krieg geborenen: Der Vater, ehemaliger Kapp-Putschist hatte seine Hauswirtin mit ihren beiden Söhnen geheiratet. Sie hatten einen gemeinsamen Sohn. Sein kleines Unternehmen florierte während des Hitler-Faschismus. Die große Liebe meiner Mutter, ihr Verlobter, betrog sie, als er an der Front war und kündigte die Verlobung auf. Nervenzusammenbruch der Mutter, ihr schwerstes, mir geschildertes, emotionales Erlebnis.
Den Krieg überstand sie, nach ihren Erzählungen mit einer vorübergehenden Flucht in die Tschechei und nach Österreich, erstaunlich gut. Außer einer versuchten Vergewaltigung durch einen russischen Offizier hatte sie keine wesentlichen negativen Kriegserlebnisse. Sie war damals sehr hübsch, zwischen 17 und 23 Jahre alt und abenteuerlustig, fröhlich und sang gerne.
Nachdem ihre Ausbildung als Glasmalerin wegen einer Allergie beendet werden musste, wurde sie bei ihrem Arbeitgeber im Haushalt eingestellt, zumal dort eine gleichaltrige Tochter war, die auch Gesellschaft suchte. Daraus entstand eine lebenslange Freundschaft. Im Haus dieses Unternehmens lernte sie meinen Vater kennen, der dort zum Freundeskreis gehörte.
Man nennt das wohl ein Bratkartoffelverhältnis. Mein Vater war über 20 Jahre älter, gutaussehend, vermögend und verwöhnte meine Mutter in dieser schweren Zeit mit Lebensmitteln, auch für ihren Bruder und ihre Eltern, und mit kleinen Geschenken. Er verliebte sich in sie. Sie konnte zwar ihre große Liebe, den Verlobten nicht vergessen, aber Jugend und Sehnsucht brachten die beiden dennoch zusammen: Gott sei Dank, sonst könnte ich das ja nicht schreiben.
Vermutlich wollte mein Vater, nach dem Erkennen einer Schwangerschaft, dass meine Mutter in die Schweiz reist, wo seine Schwester lebte, um das kleine „Unwesen“ vorzeitig aus der Welt zu schaffen. In der Bahn, auf dem Weg in die Schweiz, scheint sich meine Mutter entschieden zu haben und fuhr stattdessen zu ihrem Bruder, der nach dem Krieg in den Süden geflüchtet war, und wollte mich gebären.
Ohne Geld, band sie sich den Bauch weg und bekam so eine Stelle in einer Spinnerei im Akkord, wo sie bis kurz vor der Entbindung nicht auffiel. In einer Hypnose-Sitzung sah ich mich in einem frühen embryonalen Entwicklungsstadium und sah meine Mutter im Akkord und dachte: „Das kannst du ihr nicht antun, du musst abgehen!“
In einem zweiten Bild, kam ein Teil dieses Embryos in meine Fantasie, der sagte: „Ich will leben!“. Das dritte Bild - ich im Alter von drei, vier Monaten auf dem Schoß meiner Mutter, sie anlachend und ihre glücklichen Augen sehend, mit dem Gedanken - „siehst du, es hat sich doch gelohnt geboren zu werden!“.
Zwei ledige Jungfern, dem anthroposophischen Denken zugetan, übernahmen meine Erziehung, da meine Mutter arbeiten musste. Sozialhilfe gab es noch nicht. Meine Betreuerinnen waren die Vermieterinnen meiner Mutter und ihres Bruders. Sie mochten mich, was leicht war, da ich ein sonniges Wesen hatte. Nach etwa einem halben Jahr bekam meine Mutter das Angebot einen kleinen Lebensmittelladen zu eröffnen und gleichzeitig die Eröffnung, dass die beiden Damen meine Ganztagsbetreuung nicht aufrechterhalten könnten/wollten.
Also musste der Junge weg. Aber wohin? Waisenheim? - sieben Kilometer weiter weg oder zu den Großeltern - 700 km weiter weg? Da meine Mutter die Kraft, Liebe und Fürsorge ihrer Eltern kannte, entschied sie sich, mich zu den Großeltern, weit weg zu geben.
Dort wuchs ich nach alten Wertvorstellungen auf: katholisch, schlesisch, kaiserlich/preußisch. Die Großeltern waren bodenständig, ehrlich, mutig und klar in ihrem Weltbild. „Ja“ war „ja“ und „nein“, „nein“ und dazwischen war wenig, wenn überhaupt.
Der asthmatische Großvater, von mir dann an Mutters statt, mehr geliebt als die Oma, starb als ich sechs Jahre alt war. Er war mein Vorbild. Er hatte beide Weltkriege mitgemacht und überlebt, er konnte Malen, konnte Schlachten, Schuhe selber herstellen, Zähne ziehen, er rauchte Pfeife und liebte mit mir seinen Schrebergarten. Während des Hitlerfaschismus ging er unter dem Gelächter seiner Kollegen jeden Sonntag zur Kirche. Das beeindruckte mich.
Ich war dabei als er starb und litt darunter sehr. Ich durfte nicht mit zur Beerdigung auf den Friedhof und fand die tröstenden Hinweise auf „die Wolke, auf der er jetzt sitzen würde“ albern. Er war weg und ich war sein bester Freund gewesen und niemand schien das zu begreifen. Alle waren von der eigenen Trauer gefesselt und konnten nicht ahnen, dass auch ein kleiner, sechsjähriger „Mann“ schon große Gefühle haben konnte und eine realistische Sicht auf die Welt.
Ausbildung (Therapeut)
Kurz darauf wurde ich eingeschult, in der DDR, und liebte nun meine junge Lehrerin und die Schule. Ich lernte sehr schnell schreiben und lesen und war auch im Sport gut. Die Trauer um den Verlust des Großvaters musste ich schnell vergessen, sprach ja doch niemand mit mir darüber und so richtig fühlte ich mich auch nicht ernst genommen.
Nun hatte sich das Verhältnis meiner Mutter zu meiner Großmutter längst wieder normalisiert und man plante, in den „goldenen Westen“ zu ziehen, weil dort die Mutter mit gewissem Erfolg ihr Lebensmittelgeschäft, ihr „Edika-Lädle“ führte. Der Vater war bereits ein paar Jahre vorher in den Westen geflohen, als die Enteignungswelle in der DDR stattfand.
Wir zogen also mit einem LKW nach Süddeutschland und als wir ankamen fragte ich sachgemäß: „Bist du meine Mutter?“ als sie mich auf den Arm nehmen wollte. Inzwischen war ich sieben Jahre. Es gab das erste Mal in meinem Leben total süße „Libbys Pfirsiche“ aus der Dose. Ich hätte mir alles aussuchen dürfen, sagte meine Mutter und ich wählte Pfirsiche. Mein erster westlicher Genuss.
Mit Spielkameraden war es zunächst schwierig – der für mich ausgesuchte Freund rannte nach kurzem Spielversuch zu seiner Mutter und beklagte sich: „Dr Franz koa gar keu deitsch“ - So lernte ich relativ schnell „deitsch“ und wuchs fortan zweisprachig auf – Zuhause „deutsch“ und unterwegs „deitsch“ - Na, es war ja ähnlich. Aber „Krumbiera“ hört sich dann eben doch anders an als Kartoffeln, oder „Präschtlingsgselz“ anders als Erdbeermarmelade.
Solche Freundschaften, wie ich sie in der DDR zurücklassen musste, entstanden nicht mehr. Und richtig Heimat gefunden habe ich bis heute nicht. Zu viele Trennungen in jungen Jahren, das macht schon etwas aus. Andere Flüchtlingskinder kamen ins Dorf. Die hatten wenigstens einen Vater. Als einer meiner Leidensgenossen von dem jähzornigen Klassenlehrer mit dem Rohrstock grün und blau geschlagen wurde, nachdem er sich unter das Waschbecken im Klassenzimmer geflüchtet hatte und der Lehrer in seiner Wut immer drauf schlug, könnte es sein, dass mein politisches Interesse geweckt oder genährt wurde. Diese Ohnmacht und Ungerechtigkeit konnte nicht ewig so weiter gehen.
Von meiner Mutter bezog ich mit 10 dann einmal Prügel mit dem Teppichklopfer weil ich gelogen hatte. Durch den Sputnik-Schock und der Folge, dass man in der westlichen Welt seine Kinder auf höhere Schulen schicken solle, kam auch ich in den Genuss, ein Gymnasium besuchen zu dürfen.
Wie die Großmutter es von Anfang an vorhergesagt hatte und meiner Mutter vorhielt, dass sie mich in die falsche Schule geschickt hätte, versagte ich. Ich hatte einen Tic entwickelt, bei dem sich ein Automatismus meines linken Mundwinkels bemächtigte und ein Zucken in mein Gesicht zauberte, das ich hasste.
Inzwischen hatte ich mir durch Zuschlagen und Frechheiten und eine gute „Bündnispolitik“ - ich verbündete mich immer mit den Stärksten in der Klasse - ein gewisses Ansehen, auch als uneheliches Kind, als Bastard, erarbeitet. Ich spielte in einer Beatband, hatte eine tolle Abschlusspartnerin beim Abschlussball der Tanzschule, ich gehörte zu den coolen Typen der Klasse. Und dann sollte ich ein Deutschreferat halten und alle in der Klasse könnten den „zuckenden Bastard“ bewundern.
Ich verließ die Schule und sagte meiner Mutter, dass ich Künstler werden möchte. Sie musste es unter Tränen akzeptieren, was blieb ihr übrig? Ich machte eine Lehre im graphischen Gewerbe. Meine Vorstellung in der Kunstakademie führte nicht zur Aufnahme dort, sondern eben zur Empfehlung der Lehre.
Alkoholkonsum im Zusammenhang mit den Auftritten meiner Beatband, in der ich Bass spielte, verfestigte sich während der Lehrzeit. Es setzte sozusagen ein Lernprozess ein, der mir ermöglichte, meine Ängste klein zu halten, durch Alkohol. Dennoch schaffte ich die Lehre mit Auszeichnung, sowohl theoretisch, als auch praktisch.
Der Tic entstand während einer emotional nicht zu lösenden Spannungssituation bei meiner Mutter im „Lädle“. Ich war etwa 10 Jahre alt und half ihr, wie so oft, hinter der Ladentheke. Kundin war unsere ehemalige Nachbarin mit ihrer 15jährigen Tochter. Und eben diese Tochter hatte mich unter Androhung von Ärger und Schokoladenentzug genötigt, sie sexuell zu befriedigen.
Diese Mutter fragte nun: „Franz hoscht du au scho a freindin?“ Meine Antwort: „Ja, mehrere“ und der Mundwinkel zuckte und ich rannte zu meiner Oma, (wir wohnten um die Ecke) warf meinen Kopf in ihren Schoß und weinte bitterlich. Natürlich konnte ich nicht sagen weshalb. Hätte ich sagen sollen: „Ich streichel der Ursel (der Tochter der Nachbarin die daneben stand) die Muschi“? Das war undenkbar.
Durch diese sexuelle Erfahrung fühlte ich mich andererseits auch schon sehr reif, wobei es später bei der ersten heiligen Kommunion zu unsäglichen Gewissensbissen kam, zur Lüge in der ersten heiligen Beichte und zur Vermutung, dass ich aufgrund meiner sexuellen Missetaten nach meinem Tode in der Hölle würde schmoren müssen.
Heute hört es sich eher amüsant an, damals war es Tortur und im Grunde schon Hölle auf Erden und vor allem: ich war mit allem allein. Wie hätte ich mit irgendjemand über all diese Dinge sprechen können? Ich hatte heldenhaft weiter gemacht - Jahr um Jahr - und es gab auch viel Stärkendes. Ich war bei den Pfadfindern seit ich acht Jahre alt war. Es war toll. Ich lernte Feuer machen mit nassem Holz, ich lernte Holzbrücken bauen und Knoten, ich lernte Zelte auf- und abbauen, ich lernte schwimmen, paddeln, rennen, von Brücken springen, Karte und Kompass lesen.
Hier wuchsen meine Ressourcen. Hier war ich schon anerkannt, hier war noch ein Flüchtling in unserer Gruppe, Sippe. Ich lernte dass man gemeinsam etwas erreichen kann und vor allem Spass haben kann. Ich lernte natürlich die ersten Mädchen kennen. Küsste liebend gerne stundenlang, ich tanzte gerne. Allerdings dauerte es sehr lange bis zum ersten Sex.
Ich lernte meine erste Frau bei der katholischen Jugend kennen. Es war wunderschön mit ihr. Auf so etwas zartes, hübsches zu treffen, wieder geliebt werden, das war so etwas wie die Mutter nochmal wieder gewinnen, oder erstmals ganz? Diese Frau half mir die Lehre fertig zu bekommen. Sie half mir das Abendgymnasium zu schaffen und als Schulbester abzuschneiden, sie half mir durch das Medizinstudium. Ich bin ihr unendlich dankbar. Sie schenkte uns zwei wundervolle Kinder, einen Sohn und eine Tochter, die uns inzwischen schon zwei supertolle Enkelkinder schenkte.
Bei Oma und Mutter hatten wir einen Hausarzt der alten Schule: eine Autorität. Sowieso hatten meine Vorfahren erheblichen Respekt um nicht zu sagen Angst vor Autoritäten, teilweise auch Achtung: also gegenüber Bürgermeistern, Professoren, Ärzten, Apothekern, Doktoren. Der Hausarzt imponierte mir. Er kam immer entweder mit rauchender, oder gerade ausgegangener und stark riechender Zigarre zum Hausbesuch. Auch seine Praxis roch nach Zigarre. Groß gewachsen, sicher in einer schlagenden Verbindung gewesen (Schmiss im Gesicht), etwas unnahbar, verbreitete er ein gewisses Mysterium um sich. Das reizte mich. Für meine Kriegsdienstverweigerung schrieb er mir ein Attest, was ich sehr bestärkend fand.
Ob er mitverantwortlich für meine spätere Berufswahl war? Eine Rolle kann es gespielt haben.
Ich war allabendlich in meiner Stammkneipe so ab 18, 19. Diskozeit war vorbei. Mit anderen jungen Männern, Freunden, Freundinnen wurde allabendlich diskutiert über Gott und die Welt. Ich wurde Fatalist. Alles ist vorher bestimmt, es gibt keinen freien Willen. Das war für mich eine erste Erleichterung bezüglich meiner alten auf Sexualität, später vorwiegend Onanie, bezogenen Schuldgefühle.
Das Argument – „Dann kannst du dich ja gleich umbringen“ konterte ich mit dem Hinweis, dass derjenige meine Philosophie nicht verstanden hätte – „Wenn alles vorher bestimmt sei und ich keinen freien Willen hätte, weil ja alles vorher bestimmt sei, wie ich mich dann für einen Selbstmord entscheiden soll, das geht doch nur, wenn ich entscheiden kann“.
Nun trotz Fatalismus wollten wir was tun – aber was? Sieben der Jungs schlossen sich zusammen und gründeten eine Juso-Gruppe. Mit vier zu drei Stimmen wurde ich zum Vorsitzenden gewählt. Nun setzten wir uns ein für einen öffentlichen Spielplatz in der Gemeinde. Helfen war schon früh eine meiner Eigenschaften gewesen. Als Kind gab ich mein Taschengeld für einen kleinen Afrikaner namens Johannes, damit er getauft werden konnte und nicht in die Hölle musste, wie all die Menschen die nicht getauft sind. So hatte ich das gelernt.
Später sammelte ich mit den Pfadfindern in der Aktion „Flinke Hände, flinke Füße“, Altkleider und Altpapier für afrikanische Projekte. Hilfsbereitschaft war eine Familienhaltung. Das war eine Selbstverständlichkeit. Zu Zeiten meiner Großeltern kamen oft Bettler an die Tür, die nichts zu essen hatten. Trotz eigener Knappheit wurde nie einer weggeschickt ohne etwas Suppe oder Brot.
Aus all meinen Problemen wurden Fragen, die mich philosophisch bis heute begleiten. Im Nachhinein bin ich den Problemen dankbar, wiesen sie mir doch den Weg zu Lösungen. Heute habe ich viele der alten Fragen aufgelöst, dafür kamen noch mehr neue hinzu.
Damals war vieles dramatisch. Dennoch - mit meinem guten Durchschnitt im Abitur konnte ich gleich Medizin studieren. Jetzt waren Oma und Mama stolz – der Junge studiert Medizin. Und ich war auch stolz. Inzwischen war ich zwar Marxist geworden und Parteimitglied der deutschen kommunistischen Partei, aber ich studierte Medizin. Nach meiner Heirat mit meiner ersten Frau, mit 23, war ich aus der katholischen Kirche ausgetreten.
Dass ich nun nicht mehr gläubig war im althergebrachten Sinne, das konnte meine Mutter nicht verstehen. Dennoch entzweiten wir uns nie vollständig. Auch als sie sagte, der Kommunismus sei der Satan und wenn ich auf der anderen Seite im Schützengraben liegen würde, würde sie auf mich schießen, konnte ich das mehr der Kirche in der Schuhe schieben, dass jemand so denkt, als ihr. Ich habe sie geliebt, ich bin ihr dankbar, dass sie mir unter solch verworrenen Umständen das Leben schenkte, dass sie immer für mich da war und ich liebe sie noch und bin eng mit ihr verbunden, wie das eben Söhne mit ihrer Mutter sind.
Nach einer harten, knapp einjährigen Alkoholphase mit 23, machte ich meine erste Therapie - eine stationäre Verhaltenstherapie mit anschließender Paartherapie mit meiner Ehefrau. In der Therapie wurde mir nun nahegebracht, dass ich ruhig ab und zu Alkohol trinken könne, nur ich sollte nicht trinken, wenn ich Sorgen hätte oder allein wäre.
Diese Ansicht, diese ärztliche Ansicht, führte dazu, dass ich etwa 15 Jahre Therapie machte, 15 Jahre versuchte kontrolliert zu trinken, immer stärker in eine bipolare Störung hinein schlitterte, die mein Leben und meine Persönlichkeit hätte vollständig zerstören können. Gott sei Dank war immer eine Führung da, die mich auf dem richtigen Weg führte.
Ich begann zu forschen. Im marxistisch-philosophischen Lexikon versuchte ich, die Dialektik zwischen Zufall und Notwendigkeit zu verstehen. Zu Beginn des Studiums kam Erich Fromm in mein Leben mit seinem Buch: „Haben oder Sein“. Willst du im Leben viel haben? Oder: Willst du zur Persönlichkeit werden, willst du dem Sein den Vortritt lassen?
Meine Lebensentscheidung war gefällt: ich wollte „sein“. Von nun an sollten vor allem Schriftsteller meine Wegbegleiter sein. Was folgte ist eine Bibliothek mit mehreren Tausend Büchern, unmöglich das zu schildern.
Die Themen waren schon angerissen, es ging jetzt um die innere, die gedankliche Ausformulierung, die Schwerpunktsetzung: Religion (Glaube), Philosophie, Naturwissenschaften, Kunst, Psychologie, Politik, Medizin, Prävention, Frieden, Liebe, Emotionen.
Das Theoretische musste praktisch erfahrbar werden, musste sich in der Praxis, ja im Alltag bewähren. So hatte ich es von Marx verstanden: „Die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit!“ Aber zunächst war das Studium zu bewältigen. Die Kurzform ist, dass ich mit relativ wenig Anstrengung auswendig lernte, was die sogenannten Gegenstandskataloge vorgaben. Für jedes Fach, ob Chirurgie, Augenheilkunde, Gynäkologie oder Pathologie musste man zig Tausend Einzelheiten auswendig lernen für die jeweiligen Klausuren. Können musste man so gut wie nichts.
Auch im sogenannten Praktischen Jahr, das in Innerer Medizin, Chirurgie und einem Wahlfach in der Klinik stattfand (ich wählte Kinderheilkunde), kam nicht viel praktisches Wissen dazu. Und dann sollten wir auf die Menschheit losgelassen werden.
Ich ging ein Jahr in die Pathologie, da konnte ich nicht viel „kaputt“ machen und lernte umso mehr, woran Menschen sterben und was die häufigsten Erkrankungen sind, und vor allem natürlich auch über die Pathogenese – also wie der Verlauf von körperlichen Erkrankungen ist. Danach lernte und arbeitete ich fünf Jahre in der Psychiatrie und fünf Jahre in der Psychosomatik.
Ohne Facharzt ließ ich mich dann mit dem Zusatztitel Psychotherapie nieder. Den Zusatztitel hatte ich bei der Ärztekammer Schleswig Holstein und Niedersachsen erworben. Die Ausbildung hatte sich über etwa 10 Jahre hingezogen: tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie nennt sich diese Therapieform.
Unsere praktischen Lehranteile waren Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie nach Rogers, Katathymes Bilderleben nach Leuner und Psychodrama nach Moreno. Davor hatte ich verschiedene andere Therapieverfahren kennen gelernt: Gestalttherapie nach Fritz Pearls, Primärtherapie nach Arthur Janov. Ich hatte meine Lehranalyse bei einem Jungianer absolviert, die Balintgruppe bei einer Erich Fromm-Anhängerin.
Ich hatte aus eigener Erfahrung 12-Schritte-Gruppen kennengelernt, in der psychosomatischen Klinik Erfahrungen gesammelt, in der Ergotherapie, Mal- und Musiktherapie sowie im Plastizieren. Nach dem Zusatztitel machte ich eine dreijährige Ausbildung in Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl.
Die letzten zehn Jahre und damit die Zeit, in der ich Herrn G. behandelte waren geprägt von einer immer stärkeren Kritik der kennengelernten psychotherapeutischen Ansätze und der Psychoanalyse. Ich übernahm zunehmend das Therapieverfahren der kardio-kognitiven Transformation von Nettig.
Dieser therapeutische Ansatz hat christliche Wurzeln im Nächstenliebe- und Feindesliebegebot des Neuen Testamentes. Er greift die Idee von Sheldon B. Kopp auf, der in seinem Buch: „Triffst du Buddha unterwegs“ sinngemäß schrieb: Therapie ist die Begegnung zweier Menschen, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen miteinander teilen.
In dem Therapieansatz Nettigs spielt die „Machtfrage“, wie sie vor allem Nietzsche ganz besonders in seiner Philosophie herausgearbeitet hatte, eine entscheidende Rolle. Durch Sammy Molcho, den großen österreichischen Pantomimen, kam auch ich zu der Auseinandersetzung um Machtfragen in Therapien. Er betont im Wesentlichen die Körpersprache und wie mittels Körpersprache, durch Mimik und Gestik, Macht transportiert wird.





























