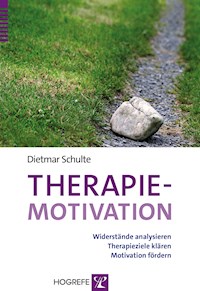
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wirksame psychotherapeutische Methoden alleine sind nicht ausreichend für eine erfolgreiche Therapie. Der Patient muss auch zur Therapie bereit sein, bereit sein sich zu ändern, mitzuarbeiten und durchzuhalten. Die schwierigste Situation in einer Therapie ist, wenn der Patient »nicht will«, wenn er nicht das tut, was nötig und möglich wäre, um ihm zu helfen oder ihn zu unterstützen, wenn er »Widerstand« zeigt. Es gibt vielfältige Gründe für einen solchen Widerstand. Der Therapeut sollte sie kennen, sie diagnostizieren und mit geeigneten therapeutischen Maßnahmen reagieren können. In diesem Buch wird – ausgehend von der Grundlagenforschung zu Motivation und Volition und langjährigen Forschungsarbeiten zu unterschiedlichen Aspekten der Therapiemotivation – ein umfassendes Modell der Therapiemotivation vorgestellt. Dieses gibt Therapeuten klare Regeln an die Hand, wie Widerstände analysiert, Therapieziele geklärt und die Therapiemotivation von Patienten gefördert werden kann. Da die Gründe für eingeschränkte Mitarbeit sehr vielfältig sind und in verschiedenen Phasen der Therapie sehr unterschiedlich sein können, gibt es auch nicht »die« Methode zur Motivierung von Patienten. Therapeuten müssen die verschiedenen Erscheinungsformen von Widerstand genau diagnostizieren und den Einsatz von therapeutischen Strategien und Techniken der Motivationsförderung strukturiert und gezielt darauf abstimmen. Wie dabei in der Therapie vorgegangen werden kann, zeigt der vorliegende Leitfaden praxisorientiert auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Therapiemotivation
Widerstände analysieren – Therapieziele klären – Motivation fördern
von
Dietmar Schulte
Prof. Dr. Dietmar Schulte, geb. 1944. 1964–1968 Studium der Psychologie in Münster. 1968–1974 Wissenschaftlicher Assistent am Psychologischen Institut der Universität Münster, Abteilung für Klinische Psychologie. 1974–2009 Inhaber der Professur für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Fakultät für Psychologie der Ruhr-Universität Bochum. Seit 1988 Einrichtung und Leitung des „Zentrums für Psychotherapie“ der Fakultät für Psychologie sowie Aufbau und Leitung des weiterbildenden „Studiengangs Psychotherapie“. Forschungsschwerpunkte: Diagnostik in der Verhaltenstherapie, Angststörungen, Entscheidungsprozesse von Therapeuten, Therapiemotivation, Messung von Therapieerfolg.
Wichtiger Hinweis:Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
©2015Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Göttingen·Bern·Wien·Paris·Oxford·Prag·Toronto·Boston·Amsterdam·Kopenhagen·Stockholm·Florenz·Helsinki
Merkelstraße 3, 37085 Göttingen
http://www.hogrefe.de
Aktuelle Informationen·Weitere Titel zum Thema·Ergänzende Materialien
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Umschlagabbildung: © digital-fineart – Fotolia.com
Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar
Format: EPUB
Print: ISBN978-3-8017-2641-6
E-Book-Formate: ISBN978-3-8409-2641-9(PDF), ISBN978-3-8444-2641-0(EPUB)
http://doi.org/10.1026/02641-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
|5|Vorwort
Die Verhaltenstherapie glich einer Revolution der Psychotherapie. Als sie Ende der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts mit berauschendem Tempo die Klinische Psychologie auch in Deutschland zu erobern begann, blieb nichts wie es war. Von Heft zu Heft erschien in der einzigen existierenden Verhaltenstherapie-Zeitschrift (Behavior Research and Therapy) mindestens ein Artikel darüber, wie erneut jemand bei einer weiteren Störung versucht hatte, mit lerntheoretisch begründeten Methoden eine Modifikation herbeizuführen – und es funktionierte. Das gesamte Tätigkeitsfeld der Klinischen Psychologen und ihr Selbstverständnis änderten sich radikal.
Aber es gab eine Bedingung dafür, dass das funktionierte – der Patient musste mitmachen, er musste sich ändern wollen. Und das Ärgerliche war, dass das manchmal nicht gegeben war. Es hat relativ lange gedauert bis auch die Vertreter der Verhaltenstherapie erkannten, dass dies nicht einfach eine Voraussetzung für Psychotherapie ist, sondern Teil der Therapie, Teil der Aufgabe des Therapeuten. Das war eine Herausforderung, nicht zuletzt für die Forschung. Aber nur wenige stellten sich dieser Herausforderung. Mich faszinierte das Phänomen, dass man wusste oder glaubte zu wissen, wie man einem Patienten helfen konnte, aber der Patient wollte nicht. Warum nicht?
Schon eine der ersten Diplomarbeiten brachte ein desillusionierendes Ergebnis: Nicht der Schweregrad der Störung ihres Kindes veranlasste die Eltern eine Erziehungsberatungsstelle aufzusuchen, sondern inwieweit sie selber dadurch gestört oder beeinträchtigt waren. Wie ist das mit der Rolle der selbstlosen Eltern vereinbar?
Es sollte nicht das einzige Ergebnis sein, das uns irritiert hat. Aber es waren stets spannende Fragen und oft auch spannende Ergebnisse, manchmal erfreuliche und manchmal ärgerliche, die in den folgenden über dreißig Jahren zusammenkamen, vor allem in vielen Dissertationen, aber auch in anderen Projekten und Publikationen. Ich möchte diejenigen nennen, die dazu wesentlich beigetragen haben (in alphabetischer Reihenfolge): Christine Alterhoff (Selbstwertstabilisierung), Susanne Annies (Selbsteffizienzerwartung), Bettina Becker (konflikthafte Therapieziele), Claudia Fedtke-Polley (Reaktanz), Johanna Hartung (volitionale Prozesse), Christoph Koban (positive Ziele), Joachim Kosfelder (Handlungsorientierung), Rainer Künzel (Leidensdruck), Frank Meyer (persönliche Ziele), Johannes Michalak (Zielkonflikte, Veränderungsmotivation), Inken Schröder (Selbstöffnung), Thomas Schulte-Bahrenberg (Veränderung von Therapiezielen), Andreas Veith (Therapiemotivation) Georg Vogel (therapeutische Entscheidungen) und last but not least Ulrike Willutzki (Konzepte zur Therapiemotivation). Bestimmt habe |6|ich jemanden vergessen, und die vielen Diplomanden und Masterstudierenden, die mit ihren Examensarbeiten dazu beigetragen haben, habe ich erst gar nicht versucht zu nennen. Was in diesem Buch steht, fußt auf all diesen Beiträgen, und ich möchte allen dafür herzlich danken.
Es war mir ein Bedürfnis, all das am Ende zusammenzufassen. Mit dem vorliegenden Buch möchte ich das versuchen. Es stellt einen theoretischen Zugang vor, das Konzept des „motivierten Widerstands“, und darauf fußend das modularisierte Motivationsförderungsprogramm (MFP). Inwieweit es damit gelungen ist, das Problem des „unmotivierten Patienten“ besser in den Griff zu bekommen, bleibt dem Leser überlassen zu beurteilen.
Alle Forschung und Theorienbildung aufgrund nicht zuletzt auch großer Fortschritte der Grundlagenforschung reicht nicht, um eine Beitrag dafür zu leisten, wie der Herausforderung, vor die uns die Patienten in der Praxis stellen, Rechnung zu tragen ist. Hier brauchte ich Unterstützung und Rat, und ich fand dies in all den Jahren vor allem bei Burgi Schulte, meiner Frau. Ihre Erfahrung in unterschiedlichen Feldern psychotherapeutischer Tätigkeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen war oft genug eine Herausforderung für die Konzepte und die Umsetzung der Forschungsergebnisse und eine unerschöpfliche Quelle für die vielfältigen Erscheinungsformen von „Widerstand“, wenn die Patienten einfach nicht so wollten, wie sie wollen sollten. Ihr sei hier gedankt und dieses Buch gewidmet.
Ich hoffe, dass möglichst viele der Leser von diesen wechselseitigen Herausforderungen von Therapeuten, Forschern und nicht zuletzt Patienten und den gefundenen Lösungswegen profitieren können, zum Nutzen der Patienten.
Schwerte, im April 2014
Dietmar Schulte
Inhalt
Vorwort
1 Widerstand
1.1 Definition von Widerstand: der frustrierte Therapeut
1.2 Erscheinungsformen von Widerstand: der schwierige Patient
1.2.1 Therapienachfrage
1.2.2 Mitarbeit
1.2.3 Umsetzung
1.3 Umgehen mit Widerstand: Basisverhalten fördern
1.4 Klassifikation von Widerstandstypen
Widerstand als Eigenschaft (Trait)
Störungsbedingter Widerstand
Motivierter Widerstand (mangelnde Therapiemotivation)
2 Motivationstheoretische Grundlagen
2.1 Absichten
2.2 Entstehung und Umsetzung von Absichten
2.3 Widerstand: Diskrepanz zwischen eigenen Absichten und fremden Ansprüche
2.4 Ziele
2.4.1 Ziele, Motive, Werte und Normen
2.4.2 Was macht Ziele erstrebenswert?
2.4.3 Zielkonflikte
3 Therapieziele und Therapienachteile
3.1 Therapieziel „Problemreduktion“
3.1.1 Leidensdruck als Voraussetzung von Problembewusstsein
3.1.2 Internale Attribuierung als Voraussetzung von Änderungsbereitschaft
3.2 Verlust von Störungsgewinn
3.2.1 Äußerer Störungsgewinn
3.2.2 Störung als Selbstwertschutz – Innerer Störungsgewinn
3.3 Positive Therapieziele
3.3.1 Keine positiven Ziele
3.3.2 Geringe Zielvalenz
3.3.3 Eingeschränkte Realisierbarkeit
3.4 Unerwünschte Nebenwirkungen
3.4.1 Ungewollte Effekte
3.4.2 Beeinträchtigung konfligierender Ziele
3.5 Kurzfristige Therapievorteile
3.5.1 Sozialer Druck
3.5.2 Behandlungsgewinn
3.5.3 Therapeutische Bindung und das Ziel „Therapeutenkontakt“
4 Psychotherapie – ein Weg zum Ziel?
4.1 Entwicklung von Handlungsplänen
4.2 Zweifel an der Therapie
4.2.1 Zweifel an der Passung (Therapiemodell)
4.2.2 Zweifel an der Wirksamkeit (Erfolgserwartung)
4.2.3 Zweifel am Nutzen bei hohem Therapieaufwand
4.2.4 Zweifel an der eigenen Kompetenz (Selbstwirksamkeit)
4.3 Zweifel am Therapeuten
4.3.1 Bedrohung der Handlungsfreiheit: Direktivität und Reaktanz
4.3.2 Der Psychotherapeut – kompetent und unterstützend?
5 Ausführung von Absichten – Realisierung des Verhaltens
5.1 Entscheiden
5.1.1 Qual der Wahl: Welche Absicht gewinnt?
5.1.2 Selbstverpflichtung: Ich tu’s!
5.2 Planen
5.2.1 Ausgangsbedingungen: Wann soll ich handeln?
5.2.2 Konkretisierung und Differenzierung von Handlungsanweisungen: Was muss ich tun?
5.3 Durchhalten: Probleme der Absichtsstabilisierung
5.3.1 Schwächung von Absichten durch Veränderungen
5.3.2 Selbstkontrolle zum Schutz von Absichten
5.3.3 Schwächung von Absichten durch Emotionen
6 Wie wirkt Therapiemotivation?
6.1 Erster Teilprozess: Therapiemotivation beeinflusst Widerstand
6.2 Zweiter Teilprozess: Therapiemotivation und Widerstand beeinflussen den Therapieerfolg
6.2.1 Therapiemotivation als therapeutische Wirkvariable
6.2.2 Therapiemotivation als Therapievoraussetzung
6.2.3 Therapiemotivation reduziert Leidensdruck
7 Diagnostisch-therapeutisches Basisverhalten der Motivationsförderung
7.1 Motivationsförderndes Basisverhalten des Therapeuten
7.1.1 WEISE-Regel 1: Therapeutische Bindung durch Wertschätzung und Unterstützung
7.1.2 WEISE-Regel 2: Akzeptanz durch Empathie
7.1.3 WEISE-Regel 3 (I1): Transparenz durch Information
7.1.4 WEISE-Regel 4 (I2): Zuversicht durch beiläufige Information
7.1.5 WEISE-Regel 5: Kompetenz des Therapeuten durch sicheres Auftreten
7.1.6 WEISE-Regel 6: Autonomie durch ebenbürtige Direktivität
7.1.7 Zusammenfassung: sei WEISE
7.2 Diagnostisches Basisverhalten: Screening der Therapiemotivation
8 Das Motivationsförderungsprogramm (MFP)
8.1 Therapieprogramme zum Aufbau von Therapiemotivation
8.1.1 Motivational Counseling
8.1.2 Motivational Interviewing
8.2 Das Motivationsförderungsprogramm: Überblick
Zur Diagnostik
Zur Behandlung
Therapieziele
9 Zielentwicklung I: Förderung des Problembewusstseins
9.1 Strategie A1: Ist Leiden zu intensivieren?
Diagnostik von Leiden und Beeinträchtigungen
Therapeutische Methode: Intensivierung des Leidens
9.2 Strategie A2: Ist Änderungsbereitschaft zu fördern?
Diagnostik des subjektiven Störungsmodells
Therapeutische Methode: Reattribuierung von Leiden
9.3 Strategie A3: Ist Störungsgewinn zu relativieren?
Diagnostik positiver Störungsfolgen
Therapeutische Methode: Relativierung von Störungsgewinn
9.4 Strategie A4: Sind selbstwertdienliche Fehlattributionen zu relativieren?
Diagnostik selbstwertdienlicher Fehlattributionen
Therapeutische Methode: Relativierung selbstwertdienlicher Fehlattributionen
10 Zielentwicklung II: Förderung positiver Therapieziele
10.1 Strategie B1: Sind positive Therapieziele zu entwickeln?
Diagnostik: Analyse positiver Therapieziele
Therapie: Entwicklung positiver Therapieziele
Therapeutische Methode 1: Remoralisierung
Therapeutische Methode 2: Entwicklung positiver Therapieziele
10.2 Strategie B2: Ist die Realisierbarkeit von Absichten zu verbessern?
Therapeutische Methode: Anpassung der Ziele
10.3 Strategie B3: Ist die Zielvalenz durch Harmonisierung von Ziel und Motiv zu stärken?
Diagnostik der zugrunde liegenden Motive
Therapeutische Methode: Ziele verändern
10.4 Strategie B4: Ist die Zielvalenz durch Harmonisierung von Wunsch und Norm zu stärken?
Diagnostik: Klären von Wunsch und Anspruch
Therapeutische Methode: Hinterfragen von Wunsch und Norm
10.5 Strategie B5: Sind unerwünschte Nebenwirkungen zu relativieren?
10.5.1 Unerwünschte Effekte
10.5.2 Beeinträchtigung konfligierender Lebensziele
10.6 Strategie B6: Sind Kurzfristige (unmittelbare) Vorteile zu berücksichtigen?
Sozialer Druck
Behandlungsgewinn
Therapeutische Bindung
11 Methodenentwicklung: Förderung der Therapieakzeptanz
11.1 Strategie C1: Sind Zweifel an der Therapie zu zerstreuen?
Diagnostik: Zweifel erkunden
Therapeutische Methode: Stärkung der Zuversicht – Zweifel zerstreuen
Grundsätzliche Zweifel an einer Psychotherapie
Zweifel an der Indikation (Passung)
Zweifel am Nutzen
Zweifel an der Selbstkompetenz
11.2 Strategie C2: Sind Zweifel am Therapeuten zu berücksichtigen?
12 Realisationsförderung I: Initiierung des Basisverhaltens
12.1 Strategie D1: Ist die Entscheidung des Patienten zu fördern?
Diagnostik
Therapeutische Methode: Entscheidungsförderung
12.2 Strategie D2: Ist der Patient bei der Planung der Durchführung zu unterstützen?
Therapeutische Methode: Planungsförderung
13 Realisationsförderung II: Stabilisierung des Basisverhaltens
13.1 Strategie E1: Sind die Ausgangsbedingungen an Veränderungen anzupassen?
13.2 Strategie E2: Ist die Absicht im Therapieverlauf zu stärken?
Diagnostik
Therapeutische Methode: Absichtsstärkung
14 Therapeutische Techniken
14.1 Technik 1: Änderung rationaler Überzeugungen
14.2 Technik 2: Intensivierung subjektiver Bedeutung/Wichtigkeit
14.3 Technik 3: Relativierung subjektiver Bedeutung/Wichtigkeit
14.4 Technik 4: Zusammenhänge erklären (Psychoedukation)
14.5 Technik 5: Änderung von Attributions-Überzeugungen
Reattribuierung nach dem Abwertungsprinzip
Schritt 1: Erarbeitung plausibler Alternativ-Erklärungen
Schritt 2: Gewichtung der Alternativ-Erklärungen
Reattribuierung nach dem Aufwertungsprinzip
14.6 Technik 6: Bilanzierung von Handlungsfolgen
14.7 Technik 7: Selbstverpflichtung
14.8 Technik 8: Entwicklung von Planungsstrategien
14.9 Technik 9: Exploration von Folgen
Explorationshilfen
Klärung des Ursache-Folge-Verhältnisses (Attribution)
Ein Wort zum Schluss
Karte: Widerstands-Checkliste
Literatur
Anhang
Sachregister
|11|1 Widerstand
1.1 Definition von Widerstand: der frustrierte Therapeut
Young, attractive, verbal, intelligent, and successful – so beschrieb 1964 Schofield den idealen Psychotherapie-Patienten1, den YAVIS-Patienten, der am meisten von einer (psychodynamischen) Psychotherapie profitieren würde. Neben solchen eher statischen Personmerkmalen ließen sich aus der Perspektive des Therapieprozesses einige weitere Merkmale ergänzen, etwa: motiviert, aenderungsbereit, vertrauensvoll, engagiert und zuversichtlich: der MAVEZ-Patient. Aber zum Leidwesen der Therapeuten ist nicht jeder Patient ein YAVIS-Patient und auch kein MAVEZ-Patient.2
Therapeuten wissen häufig, wie sie ihren Patienten helfen könnten, welche Methoden Erfolg versprechend sind. Doch die Patienten „wollen nicht“. Sie sind nicht überzeugt von dem, was der Therapeut ihnen vorträgt, sie haben Bedenken, halten sich zurück, beantworten Fragen nur zögerlich, Hausaufgaben werden nicht erledigt, der Sinn von Methoden wird infrage gestellt und ihre Wirksamkeit bezweifelt. Manchmal drücken sie auch mehr oder weniger deutlich ihre Skepsis oder gar Kritik gegenüber der Therapie oder ihrem Therapeuten aus. Schließlich kann es dazu kommen, dass der Patient die Therapie vorzeitig abbricht. Eventuell wird die Therapie aber auch fortgesetzt, bis der Therapeut mehr oder minder bewusst resigniert und sich mit seinem Patienten darauf „einigt“, dass doch schon einige Fortschritte erreicht sind und von daher die Therapie beendet werden könnte, obwohl die bisherigen Erfolge noch mehr oder weniger weit von dem entfernt sind, was zumindest der Therapeut ursprünglich für erreichbar gehalten hat.
|12|Freud hat dieses Phänomen bereits im Jahr 1900 beschrieben. Er nannte es Widerstand und meinte damit alles, „was die Fortsetzung der Arbeit stört“ (S. 521, zitiert nach Thomä & Kächele, 1989, S. 101) – eine sehr treffende Beschreibung, die deutlich macht, dass Widerstand zunächst gewissermaßen auf Seiten des Therapeuten zu verorten ist. Es ist der Eindruck des Therapeuten, dass der Patient die therapeutische Arbeit behindert.
Der Begriff Widerstand soll auch im Folgenden benutzt werden, allerdings lediglich zur Beschreibung dessen, was der Therapeut wahrnimmt, als deskriptives Konstrukt. Freud hatte in späteren Arbeiten mit dem Begriff Widerstand auch eine bestimmte Erklärung des Phänomens verbunden (Widerstand als explikatives Konstrukt): Widerstand ist die Kraft, mit der sich der Patient gegen das Bewusstwerden der unbewussten Es-Ansprüche wehrt (siehe Begriffsklärung: Widerstand nach Freud).
Begriffsklärung: Widerstand nach Freud
Widerstand nach Freud ist Ausdruck der Verdrängung, also der Kraft, die unakzeptable Triebansprüche aus dem Bewusstsein fernhält. Während der Therapie sorgt sie dafür, dass ein Aufdecken dieser Triebansprüche verhindert wird.
Widerstand ist demnach Folge der Neurose, genau genommen der Bedingungen, die auch die Neurose verursachen. So gesehen ist Widerstand dann auch nicht mehr ein Störfaktor, sondern ein notwendiger Teil des Änderungsprozesses. Denn mit der Bearbeitung des aktuell vorliegenden Widerstandes wird die Verdrängung bearbeitet. Spätere Autoren haben weitere Funktionen von Widerstand vermutet (Näheres bei Thomä & Kächele, 1989).
Die Vorstellung, dass Widerstand eine Kraft ist, die dem therapeutischen Fortschritt entgegensteht, spiegelt sich in fast allen Definitionen von Widerstand wieder. Caspar (1982) fasst die verschiedenen Definitionsversuche folgendermaßen zusammen: „Widerstand beinhaltet alles, was sich bei einem Patienten bewusst oder unbewusst gegen bestimmte therapeutische Interventionen oder die Therapie richtet“ (S. 452). Widerstand wird damit durch eine bestimmte Funktion definiert. Aber ist dies wirklich die einzige Funktion von Widerstand, „drohenden“ Therapiefortschritt zu verhindern? Tatsächlich werden in der Literatur vielfältige andere Funktionen und Gründe genannt, die zu Widerstand führen können; darauf wird später eingegangen.
Bleiben wir folglich dabei, mit dem Begriff Widerstand lediglich ein Phänomen zu beschreiben, ohne es gleich damit zu erklären. Das Phänomen stellt der Therapeut fest: Der Patient verhält sich in einer Art und Weise, die nach dem Eindruck des Therapeuten die Therapie oder den Therapiefortschritt stört.
|13|Wenn zum Beispiel ein Patient in der Therapie eine Interpretation oder Deutung seines Therapeuten zurückweist, verweist dies für einen Analytiker auf „Widerstand“. Für einen Verhaltenstherapeuten könnte das gleiche Verhalten möglicherweise ein Hinweis auf engagierte Mitarbeit, auf das Mitdenken seines Patienten sein, also eher ein Zeichen für einen positiven Therapieverlauf. Er würde keinen Widerstand feststellen. Es ist also unumgänglich, den Therapeuten bei der Definition von Widerstand mit zu berücksichtigen. Entscheidend für den Eindruck von Widerstand ist nicht nur, welches Verhalten der Patient zeigt, sondern auch, welches Verhalten der Therapeuten erwartet oder gerade nicht erwartet! Das Verhalten eines Patienten wird dadurch zu Widerstand, dass es dem widerspricht, was der Therapeut von ihm erwartet oder wünscht.
Gelegentlich wird diskutiert, dass Widerstand ein positiv zu bewertendes Phänomen in der Therapie sei. Doch die empirische Befundlage ist eindeutig und sagt etwas anderes: Beutler, Moleiro und Talebi (2002a, S. 139; übersetzt) kommen nach einer Übersicht über die Literatur zu dem Schluss, „dass es zwingende und konsistente Belege für eine negative Beziehung zwischen der Auslösung von Widerstand beim Patienten und dem Therapieergebnis gibt.“
Merke:
Widerstand ist die vom Therapeuten wahrgenommene Diskrepanz zwischen einem Verhalten, das der Patient zeigt, und dem Verhalten, das der Therapeut oder andere relevante Dritte vom Patienten im Hinblick auf einen positiven Therapieverlauf wünschen. Widerstand des Patienten geht mit einem schlechteren Therapieergebnis einher.
1.2 Erscheinungsformen von Widerstand: der schwierige Patient
Es gibt verschiedene Versuche, die Auftretensformen von Widerstand aufzulisten oder zu kategorisieren (siehe Kasten). Doch die meisten Autoren sind sich einig darin, dass grundsätzlich alle Verhaltensweisen Widerstand sein können. Nach der oben genannten Definition von Widerstand ist dies auch nachvollziehbar: Entscheidend ist nicht ein bestimmtes Verhalten des Patienten, sondern entscheidend ist, dass es den Anforderungen oder Wünschen des Therapeuten widerspricht. Die Anforderungen von Therapeuten können unterschiedlich sein: von Therapeut zu Therapeut, je nach Therapieschule, von Patient zu Patient und von Situation zu Situation. Das gleiche Verhalten kann also in einem Moment Widerstand, in einem anderen Moment ein durchaus erwünschtes Patientenverhalten sein.
|14|
Beispiele für Widerstand:
Beispiele für Widerstand(nachCaspar & Grawe, 1981, S. 351)
Verstöße gegen Grundregeln der Therapie.
Ständiges Vermeiden, Umgehen oder sprachlich gezwungenes Umschreiben bestimmter Schemata.
Lang anhaltender Smalltalk.
Vermeidung von subjektiv Bedeutsamem.
Vermeidung von Nachdenklichkeit.
Auffallend langes Schweigen.
Auseinanderfallen von Inhalten und Affekt.
Gebrauch von Klischees, um emotionale Beteiligung zu vermeiden.
Vergessen von Material.
Gähnen des Patienten.
Kurzdauerndes Einschlafen.
Auffallende Körperhaltung.
„Türpfosten-Bemerkungen“, d. h. Bemerkungen am Sitzungsende zwischen Tür und Angel.
Zuspätkommen.
Versäumen.
Falschdatieren von Sitzungen.
„Fixierung in der Zeit“ (Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft ohne gelegentliches Zurückgreifen auf andere Zeiträume).
Klassifikation von Widerstandsverhalten nachOtani (1989)
Quantität der sprachlichen Äußerungen (z. B. Schweigen, anhaltendes Reden).
Inhalt der Nachricht (zum Beispiel Smalltalk, haften am Symptom, haften an der Zukunft oder Vergangenheit).
Kommunikationsstil (z. B. „Ja, aber“-Haltung, Vergessen von Unterlagen).
Einstellung zum Therapeuten und den therapeutischen Sitzungen (z. B. Termine nicht einhalten, Rechnungen nicht bezahlen).
Daher ist statt einer Auflistung von Widerstand eine Beschreibung derjenigen Verhaltensweisen sinnvoll, die für eine erfolgversprechende Therapie Voraussetzung sind und deren Realisierung sich Therapeuten von ihren Patienten erhoffen. Auch hier gilt natürlich, dass verschiedene Therapeuten bei verschiedenen Patienten zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliches Verhalten erwarten oder wünschen. Doch bestimmte Verhaltensweisen von Patienten sind für jede Therapie erforderlich oder zumindest förderlich – das Basisverhalten des Patienten (Schulte, 1996). Dieses lässt sich in drei Kategorien einteilen, die ansatzweise den Therapieverlauf widerspiegeln: Therapienachfrage, Mitarbeit und Umsetzung.
|15|1.2.1 Therapienachfrage
Für den idealen Patienten (den MAVEZ-Patienten) ist zunächst kennzeichnend, dass er die Therapie nachfragt, also eine entsprechende Institution oder einen Therapeuten aufsucht, zumindest den Kontakt zulässt. In diesem Fall kommt der Anspruch an das Verhalten natürlich noch nicht vom Therapeuten, sondern vielleicht von Angehörigen, vom Hausarzt oder anderen relevanten Personen – oder vom Patienten selber (siehe Kasten).
Der Weg zum Psychotherapeuten:
Der Weg in eine Psychotherapie ist für Menschen meist nicht leicht: Im Durchschnitt dauerte es zumindest in den achtziger Jahren sieben Jahre, bis ein Patient mit neurotischen oder psychosomatischen Erkrankungen erstmals psychotherapeutisch behandelt wurde (Meyer, Richter, Grawe, Graf v. d. Schulenburg & Schulte, 1991).
Gründe für diesen langen Weg liegen zum einen in der Person selbst: Im Allgemeinen bemüht sie sich zunächst, mit ihren Schwierigkeiten selbst zurechtzukommen oder hofft, dass die Probleme von allein verschwinden. Oft ist es der Person nicht klar, dass es sich um psychische Probleme handelt. Weitere Gründe liegen in der medizinischen und psychosozialen Versorgung: Informationsmängel bei Ansprechpartnern im Gesundheitssystem oder seinem Vorfeld führen teilweise zu Fehldiagnosen, Fehlbehandlungen und zu verspäteten Überweisungen an Psychotherapeuten. Hinzu kommen oft noch Wartezeiten, bis die Person schließlich dann einen Therapieplatz bekommt (näheres bei Schulte, 1996).
Nach Aufnahme der Therapie erwartet der Therapeut, dass sein Patient kontinuierlich und regelmäßig, über eine mehr oder minder lange Zeit hinweg, zur Therapie kommt und die Therapie nicht vorzeitig abbricht. Doch das ist ganz häufig der Fall. Ein vorzeitiger Therapieabbruch, der nicht auf „technische“ Gründe wie Umzug oder Krankenhausbehandlung zurückzuführen ist, sondern auf „motivationale Probleme“, liegt in 15 % bis fast 50 % der Fälle vor (Bados, Balaguer & Saldana, 2007; Cincaya, Schindler & Hiller, 2011).
Widerstand im Sinne fehlender Therapienachfrage kann auch vorliegen, wenn der Patient bereits in Therapie ist, nämlich dann, wenn im Verlauf einer Behandlung deutlich wird, dass noch weitere Probleme vorliegen, die von dem Patienten selber jedoch nicht gesehen oder als Probleme akzeptiert werden. So kann ein Patient beispielsweise seine phobische Angst als Problem ansehen und zur Therapie bereit sein, bezüglich seiner Partnerschaft weist er hingegen kein Problembewusstsein auf („In meiner Ehe ist alles in Ordnung!“). Dies ist besonders |16|dann problematisch, wenn Zusammenhänge zwischen den Problemen bestehen (im Beispiel: die Eheprobleme werden vom Therapeuten als mögliche aufrechterhaltende Bedingung des Vermeidungsverhaltens gesehen).
1.2.2 Mitarbeit
Während der Therapie wird sich der ideale Patient selber aktiv beteiligen. Dies ist notwendig, denn Psychotherapie ist zunächst nichts anderes als ein mehr oder minder gezieltes Verhalten eines Therapeuten in Interaktion mit seinem Patienten in einem geschützten Setting. Das Verhalten des Therapeuten ist in allen Therapien durch mehr oder minder präzise Regeln gesteuert. Es zielt unmittelbar darauf ab, dem Patienten ungewohnte Einsichten zu vermitteln, ihn Erfahrungen machen zu lassen, emotionale Reaktionen zu provozieren oder ihn zu bestimmtem Verhalten zu veranlassen, um dadurch mittelfristig (Lern-)Veränderungen zu bewirken. Das wird dem Therapeuten nur dann gelingen, wenn der Patient diese Interaktionsangebote nicht voller Zweifel und Misstrauen betrachtet und gegebenenfalls unterläuft, also Widerstand zeigt.
Drei Basisverhaltensweisen lassen sich der Kategorie Mitarbeit zuordnen:
Bereitschaft3 meint die grundsätzliche Akzeptanz einer psychotherapeutischen Behandlung oder dieser speziellen Behandlung durch diesen Therapeuten. Mangelnde Bereitschaft würde sich in aktivem Widerstand zeigen, in Gegenarbeiten und in Frage stellen des Therapeuten, oder in passivem Widerstand wie Schweigen oder so tun als ob (Beutler, Moleiro & Talebi, 2002a).
Engagement4 meint die aktive Mitwirkung des Patienten. Engagement ist mehr als „Compliance“, als das Befolgen von Anweisungen eines Arztes oder Therapeuten (siehe Kasten). Anders als eine pharmakologische Behandlung bedarf zumindest die Verhaltenstherapie einer aktiven Mitwirkung des Patienten. Der Patient wird im Verlauf der Behandlung zu seinem eigenen Therapeuten. Patienten, die erwarten, in der Therapie auch selber aktiv sein zu müssen, brechen die Behandlung seltener vorzeitig ab (Heine & Trosman, 1960). In ihrem Sammelreferat verweisen Orlinsky, Grawe und Parks (1994) auf fast 50 Studien, von denen 70 % einen Zusammenhang von Mitarbeit und Therapieerfolg nachweisen.
Compliance:
In gewissem Maße ist Mitarbeit bereits bei einer somatisch-medizinischen Behandlung erforderlich. Meichenbaum und Turk (1994) nennen verschiedene Verhaltensweisen, die unter den Begriffen „Compliance“ oder „Adherence“, also |17|Befolgen medizinischer Anordnungen, zusammengefasst werden und für eine erfolgreiche Behandlung Voraussetzung sind: z. B. Einhaltung therapeutischer Termine, korrekte Medikamenteneinnahme oder aktiver Versuch der Lebensstiländerung (z. B. Diät, mehr Bewegung). Diese Verhaltensweisen werden oftmals nur in erschreckend geringem Ausmaß ausgeführt. So halten sich z. B. 19 % bis 74 % der Patienten nicht an die Medikamentenverschreibung, bis zu 60 % machen Fehler bei der Dosierung, obwohl in vielen Fällen damit ihre Gesundheit gefährdet ist (Stimson, 1974). Nur in durchschnittlich 50 % der Fälle geben Eltern ihren Kindern die pädiatrisch verordneten Medikamente (Olson, Zimmerman & Reyes de la Rocha, 1985). 9 % bis 57 % der Patienten mit bipolaren Störungen hören – gegen den Rat des Arztes – mit der Einnahme von Lithium auf (Cochran, 1986).
Selbstöffnung meint eine spezielle Form der Bereitschaft und Mitarbeit, die Therapeuten von ihrem Patienten erwarten. Für die Durchführung der Therapie ist es erforderlich, dass der Patient Auskunft gibt über persönliche, auch intime Aspekte seines Lebens, seiner Vergangenheit, seines Verhaltens und seiner Umwelt. Patienten fällt es mehr oder weniger schwer, über manche Sachverhalte freimütig zu reden. Sie schämen sich ihres Verhaltens oder ihrer Wünsche und Bedürfnisse, verschweigen lieber ihre subjektive Sichtweise, haben Schuldgefühle wegen ihres Verhaltens anderen gegenüber und fürchten, von anderen, auch vom Therapeuten, deswegen abgelehnt zu werden. Gerade die Kenntnis dieser subjektiven Perspektive ist für eine psychotherapeutische Behandlung, für verschiedene Therapierichtungen in unterschiedlichem Ausmaß, von besonderer Bedeutung, um das Problem verstehen und definieren zu können, aber auch, um die Motivation des Patienten und damit Quellen für möglichen Widerstand berücksichtigen zu können.
1.2.3 Umsetzung
Besonders in der Verhaltenstherapie ist für eine erfolgreiche Therapiedurchführung maßgeblich, dass die Patienten bereit sind, neue, bislang nicht gewohnte oder vermiedene Verhaltensweisen in der Therapiesitzung auszuführen, zu erproben. Selbst wenn ein Patient in der Therapiesitzung zu bestimmten Methoden bereit ist und entsprechende Übungen durchführt, muss das nicht notwendigerweise heißen, dass er diese Übungen dann auch zu Hause weiter fortsetzt, etwa im Rahmen von „Hausaufgaben“ oder Selbstkontrollprogrammen. Oft wird das Verhalten immer wieder aufgeschoben – ein Phänomen, das vor allem die Pädagogische Psychologie unter der Bezeichnung Prokrastination erforscht.
Der Patient muss das, was er in der Therapiesitzung gelernt hat – neues Verhalten, neue Beurteilungen – auf seine Alltagswelt übertragen. Und er muss dieses neue Verhalten durchhalten, selbst wenn es schwerfällt und sich im Alltag Hindernisse in den Weg stellen. Zumindest muss er dazu bereit sein, dies zu probieren.
|18|
Merke: Erwünschtes Basisverhalten des Patienten
Therapienachfrage.
Mitarbeit
Bereitschaft,
Engagement,
Selbstöffnung.
Umsetzung.
1.3 Umgehen mit Widerstand: Basisverhalten fördern
Widerstand tritt also in verschiedenen Formen in Erscheinung, je nach Therapiekontext und Verlauf unterschiedlich: als unzureichende Therapienachfrage, als unzureichende Mitarbeit oder als unzureichende Umsetzung. Wenn der Patient das Basisverhalten nicht zeigt, wird der Therapeut Widerstand feststellen. Der ideale Patient (der MAVEZ-Patient) zeigt dieses therapeutische Basisverhalten in ausreichendem Maße.
Primäre Aufgabe des Therapeuten ist sicherlich, die psychischen und psychosomatischen Störungen des Patienten zu behandeln und dazu effektive Therapiemethoden einzusetzen. Doch der Therapeut hat nach dem Dualen Modell der Psychotherapie (Schulte, 1996) noch eine zweite Aufgabe. Er muss die Voraussetzungen – falls erforderlich – schaffen und erhalten, um überhaupt seine Therapiemethoden durchführen zu können; das heißt, er muss das Basisverhalten des Patienten fördern und stabilisieren (siehe auch Kanfer & Grimm, 1981). In den meisten Fällen wird zwar der Patient von sich aus motiviert sein, das erforderliche Basisverhalten zu zeigen. Doch das gilt nicht für alle Patienten, und selbst wenn Patienten anfangs engagiert sind, muss das nicht für den gesamten Verlauf der Therapie gelten. Das Engagement des Patienten kann auch schwanken; es ist keine Konstante. Der engagierten Mitarbeit in der einen Sitzung kann in der nächsten eine skeptische Zurückhaltung folgen. Schwankungen kann es auch in kürzerem Rhythmus geben, in der gleichen Sitzung, beim gleichen Gespräch. Mal ist der Patient bereit sich zu ändern, im nächsten Moment ist er zögerlich oder äußert Bedenken. Es sind gerade diese Schwankungen, die unter dem Stichwort Ambivalenz in der Literatur als motivationales Problem hervorgehoben werden (Rollnick & Miller, 1995).
Für den Therapeuten bedeutet dies, dass er sein Augenmerk nicht nur auf die Schwierigkeiten und Probleme des Patienten sowie seine Ressourcen lenken darf, sondern auch auf das Engagement des Patienten in der Therapie, auf die Ausprägung des Basisverhaltens beziehungsweise umgekehrt auf möglichen Widerstand. Gibt es – zu Beginn oder auch erst im Verlauf der Therapie – Hinweise darauf, |19|dass das Engagement des Patienten gering ist, stark schwankt, dass es nachlässt oder der Patient gar erwägt, die Therapie abzubrechen, dann sollte der Therapeut nach möglichen Ursachen suchen und diese zu verändern trachten und gegebenenfalls die „eigentliche“ Therapie zurückstellen.
Diese Empfehlung scheint im Widerspruch zum Vorgehen der Psychoanalyse zu stehen, nach der die Bearbeitung von Widerstand ein zentrales therapeutisches Agens ist. Doch – wie geschildert – ist Widerstand in der Psychoanalyse Ausdruck der Ursachen der Neurose, der Verdrängung, Bearbeitung von Widerstand also ursächliche Therapie der Neurose. Dies ist zweifellos ein angemessenes Vorgehen, sofern tatsächlich der Widerstand auf die Störung beziehungsweise ihre Ursachen zurückzuführen ist. Die Frage ist jedoch, ob oder wann dies gilt. Das bringt uns zu der Frage nach den Ursachen von Widerstand.
Merke:
Wenn der Therapeuten zu Beginn der Therapie oder im späteren Verlauf kontinuierlich oder in wechselnden Phasen den Eindruck von Widerstand hat, dass also das Basisverhalten über einen längeren Zeitraum unzureichend ist, sollte das für ihn ein Anlass sein, die Gründe für diesen Widerstand zu analysieren.
1.4 Klassifikation von Widerstandstypen
Nicht nur die Erscheinungsformen von Widerstand sind unterschiedlich, sondern auch seine Ursachen. Unterschiedliche Ursachen erfordern gegebenenfalls unterschiedliche Maßnahmen, um den Widerstand zu überwinden beziehungsweise das Basisverhalten zu fördern. Von daher sollten die Ursachen von Widerstand die Basis für die Unterscheidung unterschiedlicher Widerstandstypen sein. In der Literatur sind viele Gründe für Widerstand diskutiert worden. Meist stehen die einzelnen Gründe oder Ursachen unverbunden nebeneinander. Im Folgenden werden die Grundzüge eine Systematik der Gründe für Widerstand und damit unterschiedlicher Typen von Widerstand vorgestellt; in den Kapiteln 3, 4 und 5 wird diese Systematik differenziert, theoretisch begründet und die einzelnen Formen von Widerstand werden genauer beschrieben und erklärt.
Widerstand als Eigenschaft (Trait)
Menschen lassen sich unterschiedlich leicht zu Widerstand provozieren, wenn etwas von ihnen erwartet wird, was nicht ihren Vorstellungen entspricht. Widerstand ist damit auch eine Persönlichkeitseigenschaft – Widerstand als trait –, der zu unterscheiden ist von dem jeweils aktuellen Verhaltensphänomen Widerstand – Widerstand als State (Beutler, Moleiro & Talebi, 2002b). Die relativ über|20|dauernde Persönlichkeitseigenschaft Widerstand entspricht der Persönlichkeitseigenschaft Reaktanz, die vor allem in der Grundlagenforschung untersucht wurde (siehe dazu Kapitel 4.3.1). So sind in einigen Untersuchungen Geschlechtsunterschiede festgestellt worden. Danach zeigen Jungen und Männer stärkerer Reaktanz als Mädchen und Frauen.
In unserem Zusammenhang ist der aktuelle Widerstand von Interesse. Zu den Gründen oder Ursachen dieses aktuellen Widerstands (als State), die im Folgenden näher betrachtet werden, ist jeweils die Persönlichkeitseigenschaft Widerstand oder Reaktanz als weitere Ursache hinzu zu denken, die die Auftrittswahrscheinlichkeit des Widerstands in der aktuellen Situation beeinflusst.
Störungsbedingter Widerstand
Wie zuvor erwähnt, kann Widerstand Folge der Störung selber sein. Die Inaktivität eines depressiven Patienten wird sich auch in einem reduzierten Engagement während der Therapie zeigen und die Angst eines agoraphobischen Patienten das Haus zu verlassen wird ihn bei einer Reizkonfrontation zögern lassen. Der Widerstand des Patienten ist in solchen Fällen nur eine Erscheinungsweise der Symptomatik. Widerstand als Form der Verdrängung ist ein der psychodynamischen Position entsprechender Spezialfall dieses Widerstandstyps.
Bei Patienten mit Persönlichkeitsstörungen kommt es regelmäßig zu interaktionellen Problemen im Kontakt zum Therapeuten. Auch in diesen Fällen tut der Patient nicht das, was der Therapeut möchte; insofern handelt es sich um Widerstand. Wir werden aber auf die besonderen Probleme bei dieser Gruppe von Patienten hier nicht eingehen; sie sind eher im Zusammenhang mit den Persönlichkeitsstörungen zu betrachten.
Motivierter Widerstand (mangelnde Therapiemotivation)
Ob Menschen das tun, was von ihnen erwartet wird, hängt in den meisten Fällen davon ab, welches Verhalten von ihnen erwartet wird und in welcher Art und Weise der Wunsch oder der Anspruch an sie herangetragen wird, also zum einen vom Inhalt und zum anderen von der Form das Anspruchs: Ist die Person für das Verhalten, das von ihr erwartet wird, motiviert?
Grundprämisse der Motivationspsychologie:
Die Grundprämisse der Motivationspsychologie ist, dass jede Handlung, jedes zielgerichtete Verhalten – nicht Reflexe, Emotionen oder Körperreaktionen – motiviert ist; ähnlich der lerntheoretischen Position, dass jedes operante Verhalten verstärkt wird. Wenn eine Handlung ausgeführt wird, dann ist zu unterstellen, dass |21|auch eine entsprechende Motivation in ausreichender Stärke vorlag, und wenn eine bestimmte Handlung nicht ausgeführt wird, so war die Person zur Ausführung dieser Handlung nicht oder nicht hinreichend motiviert, vorausgesetzt die Umstände hätten die Ausführung der Handlung grundsätzlich erlaubt.
Der Anspruch des Therapeuten kann also in unterschiedlichem Ausmaß zur Motivation des Patienten, zu seinen Wünschen oder Absichten passen. Oder anders ausgedrückt: Die Motivation des Patienten für das von ihm erwartete Verhalten, das Basisverhalten, ist gegebenenfalls nicht vorhanden, nur schwach ausgeprägt oder schwankend, das heißt manchmal gegeben, dann wieder nicht. Je schwächer diese Motivation, desto geringer die Wahrscheinlichkeit das Basisverhalten zu zeigen bzw. desto größer die Wahrscheinlichkeit von Widerstand.
Diese erste grobe Gliederung von Widerstandstypen ist im folgenden Kasten aufgelistet.
Erscheinungsformen und Typen von Widerstand – eine erste Klassifizierung:
Erscheinungsformen von Widerstand:
Therapienachfrage.
Mitarbeit.
Umsetzung.
(Ursachen-)Typen von Widerstand:
Tendenz zur Reaktanz (Widerstand als Trait).
Störungsbedingter Widerstand.
Motivierter Widerstand (geringe Therapiemotivation).
Störungsbedingter Widerstand wird im Folgenden nicht weiter erläutert. Widerstand ist in diesen Fällen ja Bedingung oder Symptom der Störung. Insofern wird in der Regel in der Literatur bei Darstellung der einzelnen Störungen darauf eingegangen.
Auch Reaktanz als Persönlichkeitseigenschaft werden wir im Folgenden nicht weiter behandeln. Für die praktische Arbeit eines Therapeuten ist sie weniger wichtig. Es ist lediglich zu bedenken, dass bei manchen Patienten bereits eine geringere Ausprägung der akuten (motivationalen) Bedingungen für eine Einschränkung des Basisverhaltens ausreicht als bei anderen Patienten. Um gegebenenfalls den Widerstand des Patienten zu beeinflussen wird der Therapeut an den aktuellen motivationalen Bedingungen ansetzen und nicht versuchen, eine überdauernde Eigenschaft des Patienten zu verändern.
Im Zentrum der folgenden Ausführungen steht der Widerstandstyp „Motivierter Widerstand“. Wir werden ihn genauer ausarbeiten und differenzieren. Zunächst werden wir dazu die allgemeinen theoretischen Grundlagen erarbeiten.
Ich werde in diesem Buch das generische Maskulinum für die Bezeichnung von Patientinnen und Patienten und Therapeutinnen und Therapeuten benutzen, solange das Geschlecht nicht von Belang ist. Zur „Rechtfertigung“ möchte ich mich Klaus Grawe anschließen (aus seinem Buch „Neuropsychotherapie“, 2004): „Auch meine gründliche Beschäftigung mit dem Gehirn hat mich nicht in der Frage weitergebracht, wie man sprachlich elegant deutlich machen kann, dass das, was man meint, für beide Geschlechter gleichermaßen gilt. Ich bin einfach nicht zwanghaft oder gewissenhaft genug, um jedes Mal, wenn es politisch korrekt anstünde, beide Geschlechtsformen auszuformulieren, und die dafür benutzten Abkürzungen finde ich ästhetisch unbefriedigend. So versichere ich an dieser Stelle, dass ich mit meinen Aussagen über das psychische Funktionieren und über Psychotherapie in diesem Buch jeweils Menschen beiderlei Geschlechts im Auge habe, wenn ich grammatikalisch nur die männliche Form verwende.“
Gelegentlich werden kleinere Abschnitte aus dem Buch Therapieplanung (Schulte, 1998) oder aus dem Artikel Therapiemotivation (Schulte, Willutzki & Michalak, 2007) übernommen, ohne dass dies in jedem Fall kenntlich gemacht wird.
Frühere Bezeichnung dieses Basisverhaltens: (kein) Widerstand
Frühere Bezeichnung dieses Basisverhaltens: Mitarbeit
|22|2 Motivationstheoretische Grundlagen
Widerstand – so haben wir gesehen – bedeutet, dass ein Patient erwünschtes oder für erforderlich gehaltenes Verhalten nicht zeigt: Er kommt nicht zur Therapie, arbeitet nicht mit, engagiert sich nicht – er zeigt nicht das erwünschte Basisverhalten. Die Grundannahme ist, dass er das deswegen nicht tut, weil dafür die Bedingungen nicht gegeben sind. Wir müssen also fragen, was sind die Bedingungen für die Ausführung des Basisverhaltens und welche davon fehlen gegebenenfalls momentan bei meinem Patienten? Wir können die Frage verallgemeinern: Was sind die Bedingungen dafür, dass eine Person ein bestimmtes Verhalten zeigt beziehungsweise nicht zeigt?
Eine Vielzahl von Theorien sind aufgestellt worden, eine Vielzahl von theoretischen Konstrukten wurden formuliert, um diese Frage zu beantworten: Ziele, Erwartungen, Kontrolle, Attribution und vieles mehr. All diese theoretischen Ansätze oder Konstrukte sind auch benutzt worden, um das Verhalten von Patienten in Psychotherapien zu erklären. Oft stehen diese Konstrukte relativ isoliert nebeneinander oder in einzelnen Arbeiten wird jeweils lediglich eines dieser Konstrukte für die Erklärung des Patientenverhaltens herangezogen.
Kognitive Handlungskontrolltheorien und motivationspsychologische Ansätze haben komplexere Modelle der Handlungsregulation entwickelt, bei denen die verschiedenen Konstrukte in ihrer jeweils spezifischen Funktion berücksichtigt werden. Motivation ist ein facettenreiches Gebilde, ein multifaktorielles Konstrukt. Wir werden dies durch Rückgriff auf einige grundlegende Modelle, vor allem das sogenannte Rubikon-Modell der Handlungsphasen (Gollwitzer, 1996, 1991) darstellen. Auch andere Handlungskontroll- oder Handlungsregulationstheorien (z. B. Dörner, 1988) und kognitiv-soziale Motivationstheorien (z. B. Ajzen, 1991) werden im Folgenden berücksichtigt, auch die Theorie der Hoffnung von Snyder (Snyder et al., 2000). Trotz Unterschieden im Detail stimmen die meisten der Theorien hinsichtlich der zentralen Annahmen überein.
Diese Theorien sind nicht speziell für die Erklärung der Motivation von Psychotherapiepatienten entwickelt worden. Ihr Geltungsanspruch ist allgemeiner. Sie versuchen, allgemein zielgerichtetes Handeln von Menschen zu erklären. Durch Rückgriff auf solche grundlagenwissenschaftlichen Theorien und Ergebnisse lassen sich jedoch auch die Inhalte und Prozesse der Motivierung eines Patienten, eine Psychotherapie aufzusuchen und in ihr mitzuarbeiten, erklären. Vor allem liefern sie Hinweise zur Beantwortung der Frage, wie es dazu kommen kann, dass Menschen nicht motiviert sind Handlungen durchzuführen, die – objektiv gesehen oder zumindest nach Meinung anderer – für sie hilfreich und förderlich wären: die Frage nach Ursachen oder Bedingungen von Widerstand.
|23|2.1 Absichten
Eine Grundannahme dieser Theorien ist, dass Kognitionen wesentlich an der Wahl und Ausführung eines Verhaltens beteiligt sind. Kognitionen repräsentieren jeweils aktuell das Wissen der Person, das aktuelle Wissen über die gegenwärtige Situation und Lage und das im Gedächtnis gespeicherte Wissen. Die verschiedenen Wissenselemente stammen aus verschiedenen miteinander in Beziehung stehenden Gedächtnisbereichen – einem Netzwerk aus sensorischem, motivationalem und motorischem Wissen (Dörner, 1988).
Für die Initiierung und Ausführung von Handlungen sind all die Wissenselemente relevant, die Informationen über eine mögliche Handlung enthalten: Informationen über das auszuführende Verhalten selber, über die Bedingungen, die gegeben sein müssen, um dieses Verhalten ausführen zu können, und nicht zuletzt Informationen über das angestrebte Handlungsziel und seine Folgen, die dieses Handlungsziel gegebenenfalls erst attraktiv machen. All diese Informationen, die für eine Handlung relevant sind, bilden eine Wissenseinheit, die als „Absicht“, auch als (Ziel-)Intention, bezeichnet wird (siehe Kasten)5.
Die kognitiven Grundbestandteile einer Absicht:
1. Angestrebter Zielzustand: Welches Ziel oder welches Teilziel strebe ich an?
2. Instrumentalität: Warum oder wozu strebbe ich dieses Ziel überhaupt an? Was sind die Folgen?
3. Ausgangspunkt (Situation): Bei welchen Gegebenheiten, unter welchen Voraussetzungen kann ich das Ziel erreichen?
4. Operation oder Plan (Verhalten): Welche Operation oder Handlungsroutine muss ich ausführen, um bei diesem Ausgangszustand dieses Ziel zu erreichen?
Zusätzlich:
5. Selbstverpflichtung: Entschluss, diese Absicht zu realisieren.
Eine Absicht ist also ein Konzept, das all die notwendigen Informationen enthält, um bei gegebenen Bedingungen ein bestimmtes Ziel anzustreben. Ziele sind die zentrale Komponente einer Absicht. Kognitive Motivations- und Handlungstheorien betonen, dass – anders als die Lerntheorien – nicht die Erfahrung der Konsequenzen des Verhaltens entscheidend ist, sondern bereits deren Antizipation: die Antizipation der (u. a. aufgrund der Lernerfahrungen) vermutlich er|24|reichbaren Verhaltensresultate. Die Person strebt durch ihr Verhalten Zustände an, die für sie erstrebenswert sind, also ein Ziel darstellen; das Verhalten ist zielgerichtet.
Welche Zustände erstrebenswert sind, ergibt sich im Wesentlichen aus den Folgen, die das Erreichen dieser Zustände nach sich ziehen wird (Instrumentalität des Zielzustands) und den mit der Zielerreichung und den Folgen einhergehenden emotionalen Reaktionen.
Diese Konzeption verhaltenssteuernder Handlungsfolgen ist differenzierter als die der Lerntheorie. Sie sieht die Person in diesem Prozess außerdem weniger passiv, sondern als gestaltenden Akteur. Die Ziele, also die antizipierten Handlungsergebnisse und ihrer antizipierten Folgen, sind nicht einfach gegeben. Es handelt sich um Kognitionen, konkreter um Erwartungen der Person, die von ihr bewusst durch verschiedene kognitive Strategien – etwa genauere Analyse der Umstände, Einholen zusätzlicher Informationen, Abwägen von Alternativen – bearbeitet und modifiziert werden können: potenzielle Ansatzstellen für einen Psychotherapeuten.
Das gilt auch für die vierte Komponente von Absichten: Die Vorstellungen der Person von dem Verhalten oder einem komplexen Handlungsplan, der zur Zielerreichung erforderlich ist.
Die ersten vier Komponenten (Situation, Handlung, Ziel und Folgen) bestimmen eine Absicht inhaltlich-qualitativ. Sie stellen die notwendigen kognitiven Grundbestandteile einer jeden Absicht dar. Hinzu kommt als fünftes der Entschluss, dieser Handlung tatsächlich ausführen zu wollen.
Es lassen sich noch weitere Absichtskomponenten aufführen: die Relevanz, die Dringlichkeit, die Kompetenzeinschätzung, die Effektivitätseinschätzung und die Aufwandschätzung. Auf diese sogenannten quantifizierenden Komponenten werden wir erst später zu sprechen kommen.
In der Regel sind Absichten unvollständig, enthalten also nicht unbedingt alle Komponenten, und vor allem sind nicht alle bewusst präsent. Sie beruhen z. B. auf implizit gespeichertem oder automatisiertem Wissen, das zum Teil erst aufgerufen wird, wenn es zur Ausführung der Handlung kommt. Absichten können sich somit hinsichtlich des Grades ihrer Elaboriertheit unterscheiden.
Absichten werden im Gedächtnis gespeichert, so dass jederzeit verschiedene Absichten zur Realisierung bereit liegen, sobald sich dazu die Gelegenheit bietet. Absichten werden erinnert und sie werden vergessen. Sie können Gegenstand unterschiedlicher Verarbeitungsprozesse im Gedächtnis sein. Ihnen kommt dabei im Vergleich zu anderen Gedächtnisinhalten ein Sonderstatus zu: Sie werden nicht so leicht vergessen. Die gängigen Zerfalls- oder Interferenzmodelle, die |25|das Vergessen ansonsten erklären, scheinen für Absichten nicht zu gelten (vgl. Anderson, 1983; Prinz, 1983; Goschke & Kuhl, 1987; Piekara, 1989).
Absichten haben – so lässt sich das veranschaulichen – immer zumindest eine Konkurrenz: das Verhalten nicht zu zeigen, also alles so zu belassen wie es ist, um nicht den Verhaltensaufwand betreiben zu müssen. Meist dominiert eine der beiden Absichts-Alternativen, und wir bemerken die andere kaum. Sind die beiden Alternativen allerdings annähernd gleich stark, erleben wir bewusst die Notwendigkeit, sich entscheiden zu müssen – to do or not to do. Dabei kann die Dominanz der beiden Alternativen, auch schwanken, denn ihre Komponenten können sich verändern. Mal scheint das Ziel besonders attraktiv, dann wieder erscheint es „der Mühe nicht wert“, mal nehmen die Zweifel an der Erreichbarkeit zu, dann wieder kommen Folgen in den Sinn, die bislang nicht für so wichtig erachtet wurden – und anders mehr. Die Person befindet sich in einen Zustand der Ambivalenz, ein Zustand, der vor allem im Zusammenhang mit der Frage der Aufnahme einer Therapie von besonderer Bedeutung ist.
Überwunden wird ein solcher Zustand der Ambivalenz letztlich erst durch die Entschlussbildung. Aber ein Entschluss wird eher dann getroffen werden, wenn die motivationale Stärke des erwünschten Verhaltes hinreichend gestärkt bzw. die des konkurrierenden Nichttuns geschwächt ist.
Absichten konkurrieren nicht nur gewissermaßen mit sich selber, sondern in der Regel auch mit anderen Absichten. Sie tragen so etwas wie einen Verdrängungswettbewerb aus (Dörner, 1988; Vogel & Schulte, 1991, siehe auch Kapitel 5.1). Einer Person können sich zur gleichen Zeit eine Vielzahl von gewissermaßen vorgefertigten Absichten aufdrängen: „Soll ich dem Therapeuten von dem gestrigen Ereignis erzählen? Oder soll ich erst einmal abwarten, was er besprechen möchte? Soll ich ansprechen, dass ich seine Erklärung vom letzten Mal nicht sehr überzeugend finde?“ Und neue Absichten können hinzukommen: „Ich sollte meinem Therapeuten sagen, dass ich es für wenig sinnvoll halte, solche Sprüche vor mich hin zu sagen, wenn ich wieder in meine Angstsituation komme!“.
Die Vorstellung, dass Absichten unser Handeln regulieren, gilt für alles zielgerichtete Verhalten. Aber nicht jede Handlungsregulation erfolgt bewusst. In Anlehnung an handlungstheoretische Modelle (z. B. Hacker, Volpert & Cranach, 1982; Osterloh, 1983) lassen sich drei Ebenen kognitiver Handlungskontrolle mit abnehmendem Abstraktionsgrad unterscheiden:
Rationale Regulation,
Automatisierte Regulation,
Sensumotorische Ausführungsregulation.





























