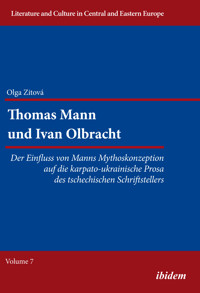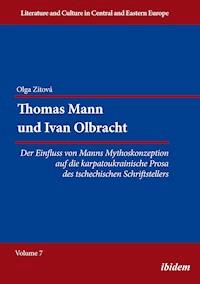
Thomas Mann und Ivan Olbracht. Der Einfluss von Manns Mythoskonzeption auf die karpatoukrainische Prosa des tschechischen Schriftstellers E-Book
Olga Zitova
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Literatur und Kultur im mittleren und östlichen Europa
- Sprache: Deutsch
Zitovás literaturwissenschaftliche Analyse setzt an einer Schnittstelle der tschechischen und deutschen Literatur in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts an. Thomas Manns Roman Joseph und seine Brüder wird vergleichend in Beziehung gesetzt zu Ivan Olbrachts in den dreißiger Jahren entstandenen Prosatexten Nikola Šuhaj loupežník und Golet v údolí. Olbracht übersetzte parallel zur Abfassung seiner Prosawerke insgesamt drei Bände aus Manns umfangreicher Josephs-Tetralogie. Diese Übersetzertätigkeit blieb, wie Zitová aufzeigt, nicht ohne Einfluss auf sein eigenes Schaffen. Das Buch knüpft an eine von Jirí Opelík geschriebene Studie Olbrachts reife Schaffensperiode sub specie seiner Übersetzungen aus Thomas Mann und Lion Feuchtwanger (1967) an, in der dieser tschechische Literaturwissenschaftler das Thema eröffnete. Mit Zitovás Tiefenanalyse schließt sich diese germanobohemistische Forschungslücke.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Danksagung
Ich danke Prof. Jiří Holý für seine wertvollen Ratschläge und die Unterstützung bei der Entstehung dieses Buches.
Olga Zitováim November 2014
Inhaltsverzeichnis
1.Einführung
Das Thema desvorliegendenBandes,deraufeiner überarbeiteten,2012 an der Philosophischen Fakultät derKarlsuniversitätPragverteidigten Diplomarbeitbasiert,bewegt sich an einerSchnittstelle der tschechischen und deutschen Literaturinder ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts.Gegenstand des Interesses sind ausgewählte Werke zweier fraglos sehr unterschiedlicher Autoren:Thomas Mann und Ivan Olbracht.Manns RomanJoseph und seine BrüderwirdmitOlbrachts in dendreißiger JahrenentstandenenProsatextenNikolaŠuhaj loupežníkundGolet vúdolíverglichen.Diebeiden letztgenannten Textewerdenin der tschechischen Literaturgeschichtsschreibung zusammenfassend als „karpatoukrainische Prosa“[podkarpatské prózy] bezeichnet, da siethematischengmit der Karpatenukraine, deröstlichstenund gleichzeitig auchkulturell entlegenstenRegionder damaligen Tschechoslowakei,verbunden sind.Diese Textauswahl erfolgtekeineswegszufällig, denn es ist wahrscheinlich, dassOlbrachtsichinseinem Schaffen vonMannsWerkenbeeinflussen ließ.Parallel zur Entstehung seinerkarpatoukrainischen Prosaübersetzteernämlich (neben einer Reihe vonWerken andereraufDeutsch schreibender Autoren)insgesamt dreiBände vonManns umfangreicher Josephstetralogie.
Aufeinen möglichen Einfluss der ÜbersetzertätigkeitOlbrachts aufseineigenes Schaffen wurde erstmals von dem tschechischen LiteraturhistorikerJiří Opelíkverwiesen, und zwar in einer Studie aus dem Jahr1967,die ausschließlichauf Deutsch unter dem TitelOlbrachts reife Schaffensperiode sub specie seiner Übersetzungen aus Thomas Mann und Lion Feuchtwanger[1]erschienen ist.Opelíkist überzeugt, dassinsbesondere die Übersetzungen von Texten Thomas Manns und Lion FeuchtwangersdieEntwicklung einerneuenkünstlerischenOrientierunganregten und beschleunigten, die in Olbrachts Werk bis dahin nur in Ansätzenvorhandenwar.Als entscheidend erweisen sichhierbeizwei Aspekte:
1)Olbrachtbegann sich in seinen während der dreißiger Jahre entstandenen Werkender Vergangenheit zuzuwenden.
2)Dieliterarische Gestaltungder Vergangenheiterfolgtevor allem mithilfe von Legende oder Mythos.
Mit demStromder VergangenheittratinOlbrachts Werk aucheine weitaus stärkereEpizität.Das Bewusstsein über Zeit und Kontinuität des menschlichen Lebens spiegelt sich in der Darstellung der Figuren – sowohl des Räubers Šuhaj, Hauptfigur des RomansNikola Šuhaj loupežník, als auch der karpatoukrainischen Juden inGolet v údolí– wider.
Die Figuren emanzipieren und lösen sich von der ideellen Haltung des Autors,derz.B.den Charakter der FigurenAnna und Toníkindem in den zwanziger Jahren verfasstenkommunistischen AgitationsromanAnna proletářkanoch fest definierthatte. Undauch die Haltungdes Erzählerswandeltsich:In OlbrachtsWerkhält nun eine liebevolle IronieEinzug, gepaart mitVerständnis für dieEigenarteneiner anderen Welt.
Der Mythos erscheint in Olbrachts Textenin aktualisierter Form und in Konfrontation mit der Gegenwart.So lagen demRomanNikola Šuhaj loupežníkamtliche Dokumente und Augenzeugenberichte zugrunde, die Olbrachtzu einemmodernenMythosumformte.Auf dieseWeiseerzielte ereine künstlerische Synthese von Mythos und Realität. InGoletvúdolíwiederumerfassteerdas Fortwirken des alttestamentarischen Mythos im Alltagsleben karpatoukrainischer Juden.Thomas MannformulierteinJoseph und seine Brüderden jüdischen Mythosin zeitlich rückwärtsgerichteterRichtung neu, indem erdie griechische, ägyptische undbabylonische Mythologie in ihn einfließen ließ.Dieantinazistische Funktiondes Mythos ergibt sichhierbeilaut Opelík ganz natürlichaus dem Stoffselbst und aus der Art, wie Mann mit diesem arbeitete. Olbrachthingegen aktualisierte denMythosinzeitlichvorwärtsgerichteter Richtung, und zwarinsbesonderedurch die bereits genannte Konfrontation von Mythos undGegenwart.
Opelík kommt in seiner Studiezu dem Schluss, dasszwischenOlbrachts Werk und demWerkManns (wie auch Feuchtwangers)viele Berührungspunkte bestehen undOlbrachtsZugang zu den Werken, die er aus dem Deutschenübersetzte, ein sehr aktiver war,da er viele Anregungen in schöpferischer Weise in seine eigenen Prosatexte einarbeitete.Beginnendmit dem RomanNikola Šuhaj loupežníklässt sich, soOpelík,ein Wandel in Olbrachts Schaffen beobachten, der sichu.a.durch„die Verschiebung vom Bürgerlichen zum ‚Immer-Menschlichen‘ (Mann)“äußert.[2]
Ziel dieses Buches ist es,Erscheinungsformen, Umfang und Grenzeneines direkten (genetischen)wie aucheinesindirekten(typologischen)Einflusses von Manns Tetralogieauf diekarpatoukrainischen TexteOlbrachts zu überprüfen.Dabei soll insbesondere Manns Mythosauffassung zu Olbrachts Prosatexten der dreißiger Jahrein Bezug gesetzt werden.Thomas Mannließ sichauf seinem Weg zur künstlerischenGestaltungdes Mythos inJoseph und seine Brüdervon vielenAutoren beeinflussen, deren Werke er gelesen hatte oder mit denen er korrespondierte. Dieser biografische Hintergrundist Gegenstand des einführenden KapitelsDer MythosundThomas Mann.Im KapitelIvan Olbracht,die Karpatenukraine und Übersetzungen aus dem Deutschenwird der Leser mitdem Schriftsteller Ivan Olbracht und dessenGesamtwerk, insbesondere aber mit der Beziehungvon OlbrachtsÜbersetzertätigkeit zuseinemeigenenliterarischenSchaffen,vertraut gemacht.Zu Beginn der dreißiger Jahrewar Olbrachtals Journalist ohne feste Anstellungund verdiente sich seinen Lebensunterhalt mit Übersetzungen ausgewählter Werke der deutschen Literatur, darunter auch dreier Bände von MannsRomantetralogieJoseph und seine Brüder.ImselbenZeitraum begann er,sich mit der Karpatenukraine zu befassen.
Den zentralen Teil dieses Buches bildeninterpretatorisch ausgerichteteKapitel,in denennacheinander Manns Tetralogie, OlbrachtsNikola Šuhaj loupežníkund OlbrachtsGoletvúdolíbesprochen werden.Der Einführungsteil der Kapitel istdabei jeweilsderEntstehung undzeitgenössischenRezeption des besprochenenTextsgewidmet. Die darauffolgendenSubkapitel sindvom Aufbauherthematischan die einzelnen analysierten Texte angepasst.BesondereAufmerksamkeitgilt dabei jeweilsdem Erzähler und seiner Rolle im Rahmen des fiktionalen Texts.Allen drei Texten gemeinsam istdie Problematik dermythischen Identität,dieengmit derDarstellungder einzelnen Figuren verknüpft ist. Im Falle vonJoseph und seine BrüderundGoletv údolíist eszudemproduktiv, sichmitder Konstruktion der fiktiven Welt im Ganzenzu befassen. BeiNikola Šuhajloupežníkistwiederum einSubkapitel zuRaum und Zeitsinnvoll.In den einzelnenKapitelnsollversucht werden, diefiktiveWeltdereinzelnenProsatextezu rekonstruieren, und zwarjeweils unter Berücksichtigung des Mythos als gemeinsamer Schnittstellealler drei analysierten Texte.In einigen Fällen wirdauch recht spezifischenProblemen Aufmerksamkeit geschenkt, soz.B.im Falle vonJoseph und seineBrüderdensogenanntenSchönen Gesprächen. DieWahl dieses(im Kontext von Manns Werk)Details erfolgtemit Blick aufOlbrachtsRomanNikolaŠuhaj loupežník,da es sichhiermöglicherweiseum einender wenigen Fälle einesgenetischen Einflusses von Manns Werk aufOlbrachts Texte handelt. Analogien auf typologischer Ebene sind,wie sich zeigen wird, inweitausgrößerer Zahlnachweisbar.
2.Der Mythos und Thomas Mann
Thomas Mann interessierte sich bereits in seiner Kindheit für Mythos und Mythologie. Als frühes Erlebnis, an das er sich beim Schreiben vonJoseph in Ägyptenoft erinnerte, führt er eine Stunde aus dem Religionsunterricht an. Der Lehrer wollte den Namen desheiligenStiersderaltenÄgypterwissen. Der Schüler Thomas Mann meldete sich und nannte die ursprüngliche ägyptische Namensform „Chapi“. Dafür wurde er getadelt, dader Lehrer nur die lateinische bzw. griechische Namensform „Apis“kannte: „Ich wusste es besser als der gute Mann, aber die Disziplin erlaubte mir nicht, ihn darüber aufzuklären. Ich schwieg – und habe mir mein Leben lang dies Verstummen vor falscher Autorität nicht verziehen. Ein amerikanischer Junge hätte gewiß seinen Mund aufgetan.“[3]
Auch in Manns literarischen Werkenkommt der Mythos bereits lange Jahre vorNiederschrift derRomantetralogieJosephund seine Brüderzum Tragen.Zentralemythische Elemente, auf die sich Mannin seiner „vorjosephischen Zeit“ bezieht, sind Märchen, dieEpenRichard Wagners wie auchdie reichhaltige antikeMythentradition.[4]Der erste Text, derdeutliche mythologische Bezüge aufweist(wenngleich sich Mann in jener Zeitnoch nichtmit dem Mythos als solchem befasste), ist die 1911 entstandene dekadente NovelleDerTod in Venedig,[5]die eng mit denNamen Friedrich Nietzschesund Erwin Rohdes(insbesonderemit NietzschesDieGeburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik,1871, und der darin entworfenenUnterscheidung des Apollinischen und Dionysischensowiemit RohdesPsyche,1890–1894)verknüpft ist. Aus dem Mythos bezog Mann wichtige Impulsefür sein eigenes Schaffen. Er wandte sich derVergangenheitzu, in deren Koordinaten jedes einzelne Leben alsWiederholung von etwas schon früherGelebtem erscheint. Manns „Neigung zum Archaisch-Primitiven wirdbei ihm [jedoch] immer durch den Intellekt neutralisiert“.[6]Es handelt sich also keineswegs um blinde Nostalgie –vielmehrlässt der Mythos ihn die Grenzen des Raumsüberschreiten, in dem sich der Künstler-Ästhet in Isolation von der umgebenden Welt befindet. Er befreitden Menschenvon einer Gesellschaft, die oftmals zu eng an die Probleme der jeweiligen Zeit gekettetist, und ermöglichtihmeinen gewissen Abstand und Überblick. Gleichzeitig ist der Mythos Refugium für jeden,der den festenBoden unter den Füßen und die Sicherheit dereigenen Existenz verloren hat.Er schaffteinengedanklichenRaum, der dem modernen Menschen in Zeiten derWirrnis und Unsicherheit, in Zeiten der Zersplitterung des Individuums,eine Palette musterhafter Situationen und entsprechenderLösungsmöglichkeiten zubietenvermag, ohne die spezifische Problematikder modernen Zeit zubagatellisieren. Literarischen Texten kann der Mythos als formale Basis wie auch als Handlungsgrundlage dienen. Diese „Vorprägung“ des literarischen Werks durch eine vom Mythos getragene Tradition ermöglichteThomas Mann eine stärkere Konzentration auf die stilistische und analytische Ebene. Das Werk wird auf diese Weise zu einer künstlerischen Variation, die nichts an ihrer Wirkung einbüßt. Die Bedeutung des Mythos für Manns frühe, „vorjosephische“ Zeit besteht in derDarstellung fesselnder Einzelschicksale vor dem Hintergrund eines typisierten mythischen Schicksals. Mann „konfrontiert Psychologie und Mythos und kann dabei die Einmaligkeit desSonderfalls schärfer beleuchten, oft auch geheime Identitäten zwischen dem Individuellen und Typischen aufblitzen lassen.“[7]
Die Bezugsetzung des Mythos zum Begriffspaar „Individuelles vs. Typisches“ istfür Mannauch in den zwanziger Jahren charakteristisch, als er bereits an derJosephstetralogiearbeitete, und lässt sichbis in die vierziger Jahreverfolgen, d.h. bis in die Zeit,in der er die Tetralogie abschloss und den RomanDoktor Faustusschrieb. In dem EssayJoseph undseine Brüderaus dem Jahr 1942 formuliert Thomas Mann seineÜberlegungen zum Mythoswie folgt:
Es ist wohl eine Regel, daß in gewissen Jahren der Geschmack an allem bloß Individuellen und Besonderen, dem Einzelfall, dem ‚Bürgerlichen‘ im weitesten Sinne des Wortes allmählich abhanden kommt. In den Vordergrund des Interesses tritt dafür das Typische, Immer-Menschliche, Immer-Wiederkehrende, Zeitlose, kurz: das Mythische. Denn das Typische ist ja das Mythische schon, insofern es Ur-Norm und Ur-Form des Lebens ist, zeitloses Schema und von je gegebene Formel, in die das Leben eingeht, indem es aus dem Unbewußten seine Züge reproduziert.[8]
In diesem Zusammenhang istder Einfluss Arthur Schopenhauers, insbesondere seiner AbhandlungDie Welt als Wille und Vorstellung,[9]zu nennen,in welcherder Philosophunterscheidet
zwischen der Welt als Wille, die raum- und zeitlos ist, undder Welt als Vorstellung, die vom Intellekt in Raum und Zeit gegliedert wird. In Anlehnung an Platons Ideenlehre kennter [Schopenhauer]ein Zwischenreich der Willensobjektivation, in dem der Wille nicht mehr raum- undzeitlos, aber auch noch nicht Erscheinung in Raum und Zeit ist – das Reich der Ideen.[10]
DieRezeption dieserphilosophischen ÜberlegungeröffneteThomas Mann die Möglichkeit, seine Gedankenund literarischen Bilder ausdenkonkreten zeitlich-räumlichenKoordinaten zu lösen undsich auf dasUnveränderliche in der Welt und im Menschen zukonzentrieren, auf das,wasderenWesen ausmacht und was keinentiefergreifenden Wandlungen und Degenerationen unterworfen ist. Gerade der Mythos erweist sichdiesbezüglichals ein Bereich,derinsich ganz ähnliche „Werte“vereintund mithilfe dessen sich auch scheinbar rein individuelleAngelegenheiten aufeine universelle Basis übertragen lassen.DieBeziehung zwischen Individuum und Kollektiv ist dabei einer der Aspekte, die Thomas Mannmit seinenÜberlegungen zum Mythos untrennbar verband.
Weitere wichtige Impulse fürManns Mythosauffassung kamen aus denWerkenRichard Wagners, Johann Wolfgang Goethes, Sigmund Freuds, Carl Gustav Jungsund desMythenforschersKarl Kerényi.[11]Goethe und Wagner werden vonMann alskomplementäre Künstlerpersönlichkeitenaufgefasst, diezweiunterschiedliche Positioneninnerhalb der deutschen Kultur repräsentieren und die sich – nicht zufällig – gerade auf dem Bodendes Mythos begegnen. Goetheverkörpert fürMann dieLeichtigkeit der antiken Tradition, die zum Fundament der europäischen Kultur wurde. Bei ihm findet er zudem Elemente von Komik und Ironie,die auch ihmselbst eigensind. Charakteristisch für Wagnerseihingegen dessenPathos, derRückgriff aufklassische Stoffe der nordischen Heldenmythologie und die Betonung der germanischen Tradition, die für ihn unauflöslichmit der Musikalitätverknüpft ist. Höchste Kunstform ist für Wagner das Drama, das mehrereKunstgattungen zu einem vollendeten Ganzen verbindet und auf diese Weise einsogenanntesGesamtkunstwerk entstehen lässt. Diegeeignetsten Stoffe für Operndramen sindfolglichalte mythische Erzählungen, in denen sich die schöpferische Kraft des Volkes konzentriert. Dem Künstlerkommt hierbei „nur eine mystisch-mediale Funktion zu“.[12]
Eine engeBezugsetzung zwischen Mythos und Musik ist auchdem Religionswissenschaftler und MythenforscherKarl Kerényizueigen,mit dem (der ebenfalls musikalisch begabte) Thomas Mannlange Zeit in Briefwechsel stand. ImEinführungskapitelseines BuchesEinführung in das Wesen derMythologiebedient sichKerényiderMusik alsdesgeeignetsten Mittels zur Annäherung an das Wesen von Mythos und Mythologie:Wie das musikalische Werk durchgegenseitige Inbezugsetzung einzelnerTöne entsteht,sosetzt sich der Mythos aus Mythologemen, d.h. aus grundlegenden Bausteinenmit einer komplexen, nicht weiter zerlegbaren semantischen Botschaft,zusammen.Die einzelnen Elemente sind– wiedieTöne der Musik – miteinander kombinierbar, sodass immer neue Variationen und Harmonien entstehen.Gerade in dieser Fähigkeit zurfortwährendenVerwandlung, der Fähigkeit, mittels eines relativ begrenzten Repertoiresunveränderlicher Mythologeme eine Unzahl von Situationenzu benennen,besteht der Reichtum des Mythos. Für Kerényiist der Mythos ein separates Zeichensystem und dahernicht in ein anderes übersetzbar.Der SinnjedeseinzelnenMythologemsist„schwer in die Sprache der Wissenschaft zu übersetzen, weil er völlig nur auf mythologische Weise ausgedrückt werden“[13]kann.
Mann undKerényiempfahlen sich in ihrer Korrespondenzgegenseitig Literatur,sietauschten ihre Arbeiten aus und diskutierten sowohl über Literatur und Mythosals auch über die aktuelle gesellschaftliche und politische Situation.[14]ThomasMann dankt Kerényi oft für die Zusendung inspirierender Lektüre underwähntu.a.die bemerkenswerten, bis ins Detail reichendenÜbereinstimmungen zwischenseinem Werk und Kerényis wissenschaftlichen Erkenntnissen. In einem seiner Briefe schreibt Thomas Mann:
Ihr AufsatzWas ist Mythologieist wieder nicht wenig interessant. Mit vielen Anstreichungen habe ich ihn sorgsam für den Zeitpunkt beiseite gelegt, wo ich die Joseph-Saga wieder werde aufnehmen können, um ihn dann, nebst Ihren anderen Schriften, zur Erquickung und Belebung mythischer Stimmung wieder zu lesen.[15]
Gemeinsam erörterten sie auch die Beziehung zwischen Mythos und Psychologie. Kerényihattesein oben genanntesBuchEinführung in das Wesen der Mythologiein Zusammenarbeit mit C. G. Jungverfasst, sodass ihm dieses Thema ebenfallsnahelag. Mann kannte sowohl Freuds als auch Jungs Arbeiten, bekanntesich jedochoffen vor allemzu Freud und dessen Psychoanalyse, da er – wie bereits Tagebucheintragungen aus den Jahren 1934–1935 belegen – um JungsanfänglicheSympathien für den Nationalsozialismus und um seine Kooperationmit diesem wusste. Jung stand also „genau auf der politischgegnerischenSeite, gegen die Thomas Mann ja sein Kampfbündnis mit der Psychoanalyse gerichtet hatte“.[16]
Psychologie wirdvonMannalsein Mittel verstanden, mit demder Mythos humanisiert, d.h. vonnazistischerInstrumentalisierungbefreit, werden kann:
Dies einander in die Hände arbeiten von Mythologie und Psychologie ist eine höchst erfreuliche Erscheinung! Man muß dem intellektuellen Faschismus den Mythos wegnehmen und ihn insHumane umfunktionieren. Ich tue längst nichts anderes mehr.[17]
Thomas Mann gehörte nicht zu den Autoren, die sofort nachder MachtübernahmeHitlers1933 daran dachten, ins Exil zu gehen. Zum Zeitpunkt des Reichstagsbrands befandersich mit seinemWagner-Vortragauf Auslandsreise undbeschlosserst nachmehrfacher Warnung, nicht nach Deutschland zurückzukehren.Da er jedoch um die Veröffentlichung seiner Bücherin Deutschlandfürchtete,enthielt er sich auf Wunschdes Verlegers BermannFischereiner Zusammenarbeit mit der ExilzeitschriftDie Sammlung, die sein Sohn Klaus Mann in den Jahren 1933–1935 im Amsterdamer Exilverlag Querido herausgab. In Exilkreisen rief er damit Zweifel darüber hervor, welcher Seite er eigentlich zuneigte, und man erwartete von ihm einentschlossenes Wort.Diesesfolgte 1936 in einem Brief an Eduard Korrodi, den Literaturredakteur derNeuen Zürcher Zeitung.[18]In seiner privaten Korrespondenz bezog Mann jedoch schonviel früher gegenden Nazismus Stellung. Dies belegt zum Beispiel ein aus dem Jahr 1934 stammender Brief an Karl Kerényi,in dem erunter anderem schreibt:
Ja, erlauben Sie mir das Geständnis, daß ich kein Freund der – in Deutschland namentlich durch Klages[19]vertretenen – geist- und intellektfeindlichen Bewegung bin. Ich habe sie früh gefürchtet und bekämpft, weil ich sie in allen ihren brutal-antihumanen Konsequenzen durchschaute, bevordiese manifest wurden. […] Ich bin ein Mensch des Gleichgewichts. Ich lehne mich instinktiv nachlinks, wenn der Kahn nach rechts zu kentern droht, – und umgekehrt.[20]
Manns vor allem im RomanJoseph und seine BrüderumgesetzteMythosauffassung gerätjedocherst allmählich in KontrastzumNationalsozialismus undder Art, wie dieser sich denMythoszunutze machte.In der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre, als Mann an der Tetralogie zu arbeitenbegann,war nämlich die kulturelle und politische Situation bei Weitem noch nicht so beunruhigend wie in den dreißiger Jahren.Undauch derGedankeeiner Humanisierung des Mythos stammt ursprünglichnicht von Thomas Mann, sondern von Ernst Bloch.[21]Dies ändert jedoch nichts daran, dass MannseineTetralogierückblickend alsein literarisches Werkbetrachtete, mithilfe dessen der „Mythos […] dem Faschismus aus den Händen genommen und bis in den letzten Winkel der Sprache hineinhumanisiertwurde […]“.[22]
3.Joseph und seine Brüder
Der RomanJoseph und seine Brüderentstandvon 1926 bis 1942, alsoübereinenZeitraum von sechzehn Jahren. Die Konzeption des Romans zeichnetesich bereits 1925ab, als der Autor mit den Vorbereitungsarbeiten begann.Das Vorwort – deneinführendenEssay mit dem TitelHöllenfahrt– begann Mann Ende 1926 zu schreiben. Der erste Teil der Tetralogie,Die Geschichten Jaakobs,wurde 1930 abgeschlossen und erschien im Oktober 1933 im Berliner S.-Fischer-Verlag. Teil Zwei,Der junge Joseph,wurde Mitte 1932 fertiggestellt und im April 1934im selben Verlag herausgegeben. Beide Teile verfasste Mann in Deutschland. Der dritte Teil,Joseph in Ägypten,wurde nochin Deutschland begonnen, zu einem Großteil entstand er jedoch im Schweizer Exil.Ererschienim Oktober 1936imVerlagBermann-Fischer in Wien. Der Verkauf des Romans war im nazistischen Deutschlandzwarweiterhinerlaubt, durfte jedoch durch keinerlei Werbung unterstütztwerden.Nach Erscheinen diesesvorletzten Teilsbeschäftigte sich Mann drei Jahre lang intensiv mit der PersonJohann Wolfgang Goethes. Er widmete Goethe den RomanLotte in Weimar, der 1939 in Stockholm herausgegeben wurde.[23]1940begann er mitder Arbeit amvierten, abschließenden Teil derJosephstetralogie,den er 1942 im Exil inden Vereinigten Staaten fertigstellte.Zu den Entstehungsumständender beiden letztenBände äußerte Mann: „Im Zeichen des Abschiedes von Deutschland stand dieser dritte der Josephsromane,–im Zeichen des Abschiedes von Europa der vierte.“[24]Der letzte Teil erschien unter dem TitelJoseph der Ernährer–abermals im Fischer-Verlag,der seinenSitz mittlerweilenachStockholmverlegt hatte.[25]Und diesmal war der Verkauf des Buches inDeutschland bereits gänzlich verboten.[26]
Ursprünglich hatte Mann vorgehabt, eine Novelle zu schreiben, die zusammen mit zwei weiteren Novellen (überPhilipp II.von Spanien sowieüberLuther undErasmus von Rotterdam) ein Triptychon historischer Prosa bilden sollte.[27]Seine literarischen Pläne kommentierteer folgendermaßen:
Ach, es war alles ganz anders geplant gewesen, anders – und wie immer. WieBuddenbrooksals eine Kaufmannsgeschichte von beiläufig zweihundertfünfzig Seiten gedacht waren unddann überhandnahmen, wie derZauberberggar nur eine Erzählung vom Umfang desTod in Venedig, dessen groteskes Gegenstück hatte werden sollen und dann nach eigenem Sinn hypertrophierte, so hatte indiesem Fall ein Triptychon religiös gefärbter Novellen mir vorgeschwebt, von denen die erste mythischen, biblischen Charakters sein sollte – dieJosephsgeschichte,lebhaft noch einmal erzählt, war dazuausersehen.[28]
WenngleichMannsursprüngliche künstlerische Absicht wesentliche Veränderungen erfuhr, blieb seinzentrales Interessean dem biblischen bzw. mythischen Stoffbestehen. Die Ideeeiner künstlerischen Verarbeitung des Josephsstoffsentstandhöchstwahrscheinlich im Winter 1923/24. Im darauffolgenden Jahr unternahmMann eine Mittelmeerreise. In dieser Zeit begannsichdie bereits erwähnte Konzeption des Romansherauszubilden.[29]
In seinemVortragJoseph undseine Brüder[30]äußert sich Mannu.a.überdie Motivation, die ihn dazu bewog, einensolch umfangreichen Roman zu schreiben. Dies waren insbesondere die Person Johann WolfgangvonGoethes und MannsBibellektüre. Dem jungen Goethe erschien die Josephsgeschichte in ihrer biblischen Form zu kurz, daher wollteer sie zu einem umfangreicheren epischen Werkausarbeiten:
Zur Erklärungdes jugendlich verfrühten Unternehmensbemerktdersechzigjährige Goethe: ‚Höchst liebenswürdig ist diese natürliche Geschichte: nur erscheint sie zu kurz, und man fühlt sich versucht, sie in allen Einzelheiten auszuführen.‘ Merkwürdig!DieserSatz aus „Dichtung und Wahrheit“ war mir alsbald gegenwärtig, mitten in meinen Träumereien: ich hatte ihn im Gedächtnis, brauchte ihn nicht nachzulesen, – und wirklich scheint er ja wie zum Motto geschaffen für das, was ich dann unternahm, er bietet die einfachste und einleuchtendste Erklärung fürdiesUnternehmen.[31]
Was Goethenicht gelungen war, gelang Thomas Mann,der„diese reizende Geschichte mit modernen Mitteln – mitallenmodernen Mitteln, den geistigen und technischen – zu erneuern und erzählerisch frisch hervorzubringen“gedachte.[32]BezeichnetMann Goethes Vorhabenals „jugendlich verfrüht“,so betrachtete erseinen Josephsromanalsein„manifest mythologisches Werk“,[33]alsAlterswerk.In einem seiner Briefe an Karl Kerényischreibt er:
Mein Interesse fürs Religionshistorische und Mythische ist spät erwacht; es ist einProdukt meiner Jahre und war in Jugendzeiten überhaupt nicht vorhanden. Jetzt aber ist es sehr lebhaft und wird vorhalten zur Durchführung des sonderbaren Roman-Unternehmens […].[34]
Die Konzeption des Josephsromans isteng mit Manns Mythoskonzeptionwie auch mitseiner späten Schaffensphase verbunden.Das Wesen des Mythos,wie Mann ihn auffasst,ist ambesten verständlich inOpposition zu allem Individuellen:Zur Ebene der individuellenErfahrunggehörenlaut ManndieEinzelfälle, wobei es sich stetsum etwas Besonderes und Einzigartiges handelt. In Bezug auf die Struktur der Gesellschaft ist diesdieSphäre desBürgerlichen. Alles Mythischehingegen istkollektiv und typisch. Der Mythos ist von allgemeinmenschlicher Gültigkeit und durch ständigeWiederkehr geprägt,er ist zeitlos, das heißt,er entbehrt der linearen Zeit. Das Mythische ist Quelle allen Lebens, esist„Ur-Form“,„Schema“des Lebens. Thomas Mann konnte seinen Josephsroman nicht früher schreiben,da der Erzähler seinerAnsicht nachreif für den Mythos seinmuss:Erst mit einem gewissen Altergewinnt er die Fähigkeit, das Geschehen um sich herummit einem mythisch-typischen Blick zu betrachten,„denn im Leben der Menschheit stellt das Mythische zwar eine frühe und primitive Form dar, im Leben des einzelnen aber eine späte und reife“.[35]
Die Materialien,dieMannbeiseiner Arbeit an der Tetralogie verwendete, werden im Thomas-Mann-ArchivinZürich aufbewahrt.Die Frage, wieMann die einzelnen Quellen nutzte, bildet neben Studien zurRolle des Mythos, Analysen zur Form des Romans undnebender theologischen Problematikeinen umfangreichen Forschungsbereich innerhalb desliteraturwissenschaftlichen Interesses an der Tetralogie.[36]Während seiner Arbeit amJosephsroman lasMann sowohl Fachliteratur als auch Belletristik. Als „Stimulans“ oder „Stärkungslektüre“[37]dienten ihmunteranderemGoethesFaustundTristram Shandyvon Laurence Sterne.AnFachliteraturstudierteer zum BeispielDas Alte Testament im Lichte des Alten Orientsvon Alfred Jeremias,Die Sagen der JudenundDie Wirklichkeit der Hebräer. Einleitung in das System des Pentateuchvon Oskar Goldberg,Urwelt, Sage und Menschheitvon EdgarDacqué,dieGesammelten WerkeSigmund Freuds,Urreligion undantike Symbolevon Johann Jakob BachofenundDie Geheimnisse des OstensvonDmitri Mereschkowski. Darüber hinaus las er auch verschiedene ägyptologische Literatur.[38]
Seinewichtigste Quelle war jedoch dieBibel, insbesonderedieGenesis(Erstes Buch Mose)aus demAlten Testament. Mann arbeitete nicht nur die zentraleJosephslegende zu einer epischen Erzählung aus, sondern auch ältere Legenden (Rebekka und Isaak,Abraham etc.).Manns EinstellungzurBibelwardabeikritisch. Er „st[and]zurBibelim Verhältnis nüchterner Sachlichkeit“,[39]betrachtetesie jedochalsbeständige Quelle,dieihm beim Schreiben des Romans als interessante literarische Sammlung unterschiedlicher Mythen, Legenden undhistorischer Berichte zur Verfügung stand, und entlehnte ihr den Handlungsverlauf seines Romans. Die Lektüre dienteMann als künstlerische Inspiration, ernutztesie „zur Erquickung und Belebung mythischer Stimmung“.[40]Gleichzeitig bildete sieden wissenschaftlichen und sachlichen Hintergrund seinerArbeit.[41]
3.1Erzählen als Fest und als Reise in die Vergangenheit
In der TetralogieJoseph und seine Brüderwirdvor dem Leser eine umfangreichenarrativeWelt ausgebreitet,die mehrereSchichtenumfasst.MarkanteKomponenten des fiktionalen Textes sind–neben dereigentlichenalttestamentarischen Geschichte von Joseph und seinen Brüdern–dieStimmedes Erzählensselbstunddie kommentierende Stimme des Erzählers. Beide Ebenen sind gleichwertigeBestandteile des Romans und auchMannselbstbetrachtetesie in diesem Falle als vollwertige künstlerischeMittel.[42]Die Geschichte wird als „gewagte[]Expedition“[43]in die Vergangenheit aufgefasst.
Verbindungskanal zu den weit zurückliegenden Ereignissenist der „Brunnen der Vergangenheit“.[44]Dieses zentrale Motiv nimmt im Laufe des Romansdie Gestalt einer Grubeoder Zisterne,einesGrabes, eines Gefängnisses undder Unterwelt an. Mit dem Sturz in den Brunnen gelangtman ineinen Bereich des Übergangs, insbesondere eines inneren Wandels der Persönlichkeit. Der Brunnenfungiert alsBrücke zwischen zwei Welten, und der Aufenthalt in ihmist stets mit einer essenziellen Erfahrung überdenMenschen als solchenoder überdie eigene Person verbunden.Gleichzeitig geht man niemals unverändert aus dem Brunnen hervor. In Manns Roman stürzt sich der Erzählergemeinsammit dem Leser in die unendlichen Tiefender mythischen Geschichte.Jaakobgerät in mehrjährigenDienst bei seinem Onkel Laban in der Unterwelt, nachdem er – ebenfalls am Brunnen –der geliebten Rahel begegnet ist. Am Brunnen spielt sich daseinführende Gespräch zwischen Jaakob und Joseph ab. Ineinen Brunnen bzw. eineGrube wird Joseph von seinen Brüderngeworfen und gelangt auf diese Weisein das als Unterwelt konnotierte Ägypten,wo er nach der Szene mit Potiphars Weib ins Gefängnis geworfen wird.[45]
Mit einemebensolchen Sprung in den Brunnen begibt sichder Erzählerdes Romans aufeine „Höllenfahrt“.[46]Die Bedeutungdieses Geschehens wirdin der „anthropologische[n]Ouvertüre“[47]erläutert, in welcherder Erzähler mitteilt, dass ergemeinsam mit demLeser „als […] Abenteurer in die Vergangenheit“[48]fährt, und zwar mit einem einzigen Interesse: „d[em] Menschenwesen, das wir in der Unterwelt und im Tode aufsuchen, gleichwie Ischtar den Tammuz dort suchte und Eset denUsiri,um es zu erkennen dort, wo das Vergangene ist.“[49]Die Reise in die Vergangenheit ist eine der vielenVarianten,mittels derer inManns Josephsroman das mythische Schema der Unterweltsfahrt umgesetzt wird. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eineVergangenheit, wie wir siein Form der historischenZeit kennen,dieentlangeinerlinearen Achse kontinuierlich rückwärts gerichtetist.Es ist eine andere Vergangenheit, für die die Regeln der mythischen Zeit gelten,es ist „die Vergangenheit des Lebens, die gewesene, dieverstorbene Welt, der auch unser Leben einmal tiefer und tiefer gehören soll, der seine Anfänge schon inziemlicher Tiefe gehören“[50].DieseVergangenheit ist auch deshalb eine mythische, weil sie „ist, […] immer [ist], möge des Volkes Redeweise auch lauten: Es war“[51].Sie ist zwar tot und gehörtdem Bereich derUnterweltan, dennoch umgibt sich der Menschständig mit ihrund vergegenwärtigt sie.Sie ist das Reservoir, in demsich alle menschliche Erfahrung sammelt,eine Art kollektives Gedächtnis, aus dem man jederzeitlernen und Musterfür das eigene, im Hier und Jetzt gelebte Lebenbeziehenkann.
Der „Brunnen der Vergangenheit“ist bodenlos, zu seinemGrundvorzudringenwäre ein übermenschliches Unterfangen:
[…] dennnun gerade geschieht es, daß, je tiefer man schürft, je weiter hinab in die Unterwelt des Vergangenen man dringt und tastet, die Anfangsgründe desMenschlichen, seiner Geschichte, seiner Gesittung, sich als gänzlich unerlotbar erweisen undvorunseremSenkblei, zu welcher abenteuerlichen Zeitenlänge wir seine Schnur auch abspulen, immer wieder und weiter ins Bodenlose zurückweichen.[52]
Im KapitelHöllenfahrtsucht der Erzähler nach einer zumindest relativ festen Verankerungseines Erzählensin der Zeit. Das Bestreben, denAnfangaller Dinge auszuloten,erweist sich als unrealistisch, da der tatsächlicheAnfangin so ferner Vergangenheitliegt, dassman ihn nicht erreichen, geschweige dennbeschreiben und erfassen kann. Daher muss man sich mit „Scheinhalte[n] und Wegesziele[n]“ zufrieden geben, mit „lehmigen Dünenkulisse[n]“,[53]hinter denen sichjeweils eine weitereDüne verbirgt.Wer will, kann die Dünen der Vergangenheit aufdecken und endlos mit dieser Sisyphosarbeit fortfahren. Im Interesse des Erzählens ist esdaher erforderlich, sich mit „Anfänge[n] bedingter Art“ zufriedenzugeben, welche jedoch „den Ur-Beginn der besonderen Überlieferung einer bestimmten Gemeinschaft, Volkheit oder Glaubensfamilie praktisch-tatsächlich bilden“.[54]Für Joseph und die gesamte jüdischeGemeinschaft istein solchstellvertretenderAnfang das Schicksal desUrvaters Abraham, des „Ur-Mannes“,[55]einesWanderers,den „geistliche Unruhe“ und „Gottesnot“ „in Bewegung gesetzt“[56]hatten. Doch auch dieBestimmung des Verwandtschaftsverhältnisses zwischen Joseph und Abraham erweist sich als vageund relativ, da zwischen ihnen schlichtwegeinige Jahrhunderte liegen und das, „[w]as uns beschäftigt, […] nicht die bezifferbare Zeit“[57]ist.Abraham begleitetJoseph jedoch in verschiedenerForm das ganze Lebenhindurch, sei es in Form seiner Neigung zum Mond oder durch dieAnwesenheit des Lehrers und Dieners Eliezer.[58]Undauch Jaakobträgt ZügeAbrahams, da er von Gott geprüft wurde,auch wenn erdie Prüfung nicht bestanden zu haben meint.[59]Für das jüdische Volk ist Abraham einsolchstellvertretender Anfang, da erGott„entdeckte“und einenBundmitihm schloss.[60]
ImVorangegangenenblieb jedoch ungeklärt, welche Prinzipien dem Erzählen in Manns Roman zugrunde liegen. In dem „phantastische[n] Essay“[61]Höllenfahrtspricht der Erzähler davon, dass er mit dem Leser an einem „Todesfest“[62]teilnimmt. Dieses Fest ist ebenjene „Höllenfahrt“, die Reise in die Tiefen der mythischen Vergangenheit,welchetot und gerade deshalb immer gegenwärtig ist. Der Tod gewinntim Kontext desRomans eine spezifische Bedeutung, und zwar vor allemin Verbindung mit derAuffassung vonZeit:
Sterben, das heißt freilich die Zeit verlieren und aus ihr fahren, aber es heißt dafür Ewigkeit gewinnen und Allgegenwart, also erst recht das Leben. Denn das Wesen des Lebens ist Gegenwart, und nur mythischer Weise stellt sein Geheimnis sich in den Zeitformen derVergangenheit und der Zukunft dar.[63]
Erzählen ist an vergangene,quasi bereits tote Ereignisse geknüpft. Im Akt des Erzählens kommt es zueiner Vergegenwärtigung dieser Ereignisse, die dadurch mit „wahrem Leben“ erfüllt werden, unddieEinbindungdes Erzählens in dieGegenwartgehtmit einer Bindung an den Mythos einher, der dasgegenwärtigeErzählenzuVergangenheitundZukunftin Bezug setzt. DasErzählen trittdamitaus der Zeit – der linearen, historischen Zeit –heraus.
Diese spezifischen Zeitrelationensinddem bereits mehrmals erwähnten Begriffdes„Fests“inhärent,dessen Inhaltin Manns Roman insbesondereim KapitelDer Adonishaindeutlichwird.[64]Charakteristisch für das Fest ist einandersartigerLauf derZeit. Die Frauen, von denen imgenanntenKapitel die Rede ist, sind für die Zeit des Fests aus dergewöhnlichen Zeit aus-undin eine heilige Zeit eingetreten,in der eineursprüngliche mythische Realität und Erfahrung aktualisiert wird.Sie sindmit der ontologischen Zeit in Kontakt getreten undhabensich andenAnfangaller Dinge begeben.Während des Fests durchleben siedaherinauthentischer WeisedieUrerfahrungder Göttin Ischtarund suchen „ihre[n] Sohn[], Bruder[] und Gatten, de[n] Tammuz-Adoni“.[65]Joseph führt Benjamin an den heiligen