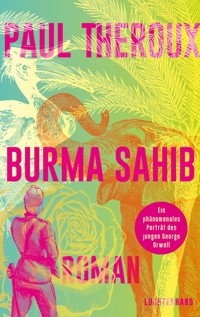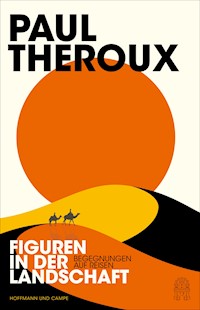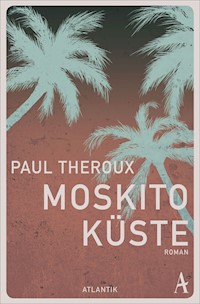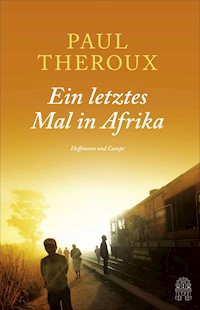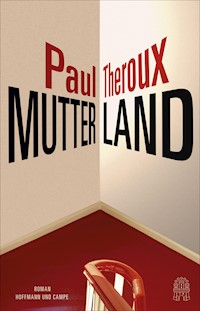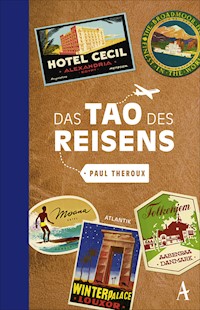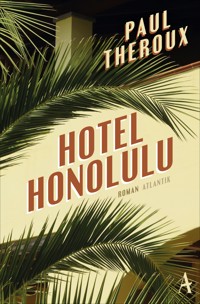15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paul Theroux hat die ganze Welt bereist - Afrika, Indien, Ozeanien sind ihm vertraut. In "Tief im Süden" begibt er sich auf neues Terrain: Erstmals erkundet er sein eigenes Land und unternimmt einen Roadtrip durch die Südstaaten. Der Südosten der USA präsentiert sich ihm als eine Realität voller Härten, in der ihm zugleich ungeahnter Mut, Herzlichkeit und Gemeinschaftsgefühl begegnen. Er fühlt sich erinnert an seine Reisen durch die ärmsten Länder der Welt. Exotisch erscheint ihm diese Gegend, erstaunlich die Offenheit, mit der ihm die Menschen begegnen. Er landet in Geisterstädten, Freikirchen und auf Waffenausstellungen entlang des "Old Man", des Mississippi. Rassismus und die Folgen von jahrhundertelanger Segregation sind allgegenwärtig. Theroux begibt sich hinein in diese gespaltene Gesellschaft, fragt nach und hört zu, getrieben von einer unstillbaren Neugier auf die Menschen und ihre Leben. Er ist fasziniert von diesem unbekannten Amerika, aus einer geplanten Reise werden vier: "Da wusste ich", so schreibt er, "dass der Süden mich festhielt, mal in einer wohligen Umarmung, mal in einer unerbittlichen Umklammerung." Mit Fotos von Steve McCurry
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 806
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Paul Theroux
Tief im Süden
Reise durch ein anderes Amerika
Hoffmann und Campe
Dem Andenken von George Davis (1941–2013) aus Medford, Massachusetts, gewidmet – Sportler, Reisender, Lehrer, Bürgerrechtler, unbesungener Held des »Bloody Sunday« von Selma – in Dankbarkeit für fünfzig Jahre Freundschaft
»Wir dachten, wir wären allein und könnten nichts ausrichten. Aber was passierte mit der Bewegung? Wir trafen uns in Gruppen. Es war eine wunderbare Sache.«
Auf den roten Lehmstraßen im afrikanischen Busch, unter armen und missachteten Menschen, musste ich oft an die Mittellosen in Amerika denken, die genauso lebten – in prekären Verhältnissen, im Hinterland des Tiefen Südens, mit ärmlichen Farmen, elenden Dörfern, einfachen Unterständen für Schafe und mit Mühlen. Diese Menschen kannte ich – genau wie anfangs die Afrikaner – nur aus Büchern, und es fühlte sich an wie ein heimatlicher Gruß.
Paul Theroux, The Last Train to Zona Verde – My Ultimate African Safari (2013)
In diesem ungereimten, unklassifizierbaren Buche meiner Wanderungen bricht zwar der Faden der Geschichten und Betrachtungen nicht ab, aber er verwickelt sich manchmal in einer Weise, dass er sich, wie ich wohl sehe und fühle, in dem wirren Gewebe nur mit großer Geduld unterscheiden und verfolgen lässt.
Almeida Garrett, Der Mönch von Santarem oder Wanderungen in meinem Vaterlande (Lissabon 1846)
Teil IHerbst
»Hier landet man nicht zufällig«
»Der Fremde erfüllet das Auge.«
Arabisches Sprichwort
(Zitiert bei Richard Francis Burton,
First Footsteps in East Africa)
Sei behütet
An einem heißen Sonntagmorgen in Tuscaloosa, Alabama, auf einem Motel-Parkplatz. Ich saß in meinem Auto und studierte einen Stadtplan, um eine bestimmte Kirche ausfindig zu machen. Das hatte weder religiöse noch voyeuristische Gründe. Vielmehr erhoffte ich mir dort Musik und gute Laune, mitreißende Gospels und eine feierliche Stimmung. Und vielleicht auch Freundschaft.
Ich schlug mit dem Handrücken auf den Plan und sah wahrscheinlich einigermaßen konfus aus.
»Verfahren, Baby?«
Nach einer dreitägigen Autofahrt vom heimatlichen New England aus war ich in einer anderen Welt angekommen – in den warmen und grünen Staaten des »Tiefen Südens«. Ich hatte immer große Sehnsucht gehabt nach einer Reise in diese Region, wo »das Vergangene nicht tot« ist, wie ein berühmter Mann einmal gesagt hat, und »nicht einmal vergangen«. Ein paar Wochen später saß ich in einem Barbershop in Greensboro, ließ mir die Haare schneiden und unterhielt mich dabei mit dem schwarzen Friseur über die aktuellen Rassenunruhen. Lachend sagte er zu mir: »Die Geschichte ist lebendig und direkt vor der Haustür.« Das klang fast wie das Zitat dieses Schriftstellers, von dem er garantiert noch nie etwas gehört oder gelesen hatte.
Im Süden ist eine Kirche das pulsierende Herz des Viertels. Sie fungiert als Sozialzentrum, Glaubensanker, Leuchtturm, Konzerthalle und Versammlungsort, wo man vieles bekommt: Hoffnung, Rat, Fürsorge, menschliche Wärme, Gemeinschaft, Melodien, Harmonie und etwas zu essen. In manchen Kirchen gehören auch Schlangen-Rituale, Fußwaschungen und Zungenrede dazu. Letzteres ist eine Form des Gebets, die sich gelegentlich so anhört, als ob jemand unter der Dusche steht und gurgelnd vor sich hin plappert.
Die Armut ist in diesen Kirchen auffallend gut gekleidet, und alle sind ausgesprochen offen und zugänglich. Ein Gottesdienst im Süden ist ein imposantes und eindrucksvolles kulturelles Ereignis, das sich durchaus mit einem College-Footballspiel oder einer Waffenmesse vergleichen lässt. Und es gibt viele davon. »An jeder Ecke gibt es eine Kirche«, sagt man hier. Wird eine Kirche zum Ziel einer Gewalttat – gerade jährte sich zum fünfzigsten Mal der Bombenanschlag auf die 16th Street Baptist Church in Birmingham, Alabama, bei dem vier kleine Mädchen ums Leben kamen –, wird einer Gemeinde förmlich das Herz aus dem Leib gerissen, und die Menschen versinken in Kummer und Leid.
»Verfahren?«
Sie sprach so sanft und leise, dass ich zunächst gar nicht bemerkte, dass sie mich meinte. Es war die Frau im Wagen direkt neben mir, einem ausgeblichenen Viertürer mit einer völlig verbeulten und rissigen hinteren Stoßstange. Sie trank Kaffee aus einem Pappbecher und hatte die Tür geöffnet, um frische Luft ins Fahrzeuginnere zu lassen. Sie war schätzungsweise Ende vierzig, hatte blaugraue Augen und war in auffallendem Kontrast zu ihrem armseligen Auto geradezu vornehm in schwarzer Seide mit Spitzenärmeln gekleidet. An einer Schulter prangte eine große Blume, und auf dem Kopf trug sie einen weißen Hut mit Schleier, den sie elegant mit dem Handrücken ein Stück anhob, wenn sie den Kaffeebecher an ihren hübschen Mund führte, der am Rand einen dunkelroten Lippenstiftabdruck hinterließ.
Ich sagte ihr, dass ich hier fremd sei.
»Fremde gibt’s hier nicht, Baby«, antwortete sie und lächelte mich an. Neckisch, dachte ich, und hier im Süden dachte ich dieses Wort ganz ironiefrei. »Ich bin Lucille.«
Ich stellte mich vor und teilte ihr mit, wo ich hinwollte: zur Cornerstone Full Gospel Baptist Church im Brooksdale Drive.
Umgehend ließ sie mich wissen, dass es zwar nicht ihre Kirche sei, sie diese jedoch kenne. Nachdem sie mir den Namen des Pastors, Bishop Earnest Palmer, genannt hatte, begann sie mir den Weg zu beschreiben und sagte dann: »Wissen Sie, was?«
Mit einer Hand hielt sie ihren Schleier hoch und starrte konzentriert auf den Rand ihres Kaffeebechers. Nach einer Weile trank sie den letzten Schluck aus, während ich darauf wartete, dass sie weitersprach.
»Ist doch viel einfacher, wenn ich Sie hinbringe«, teilte sie mir mit und leckte sich dann mit der Zungenspitze einen Rest Milchschaum von der Oberlippe. »Ich treffe mich erst in einer Stunde mit meiner Tochter. Folgen Sie mir einfach, Mr Paul.«
Ich heftete mich also an die verbeulte Heckstoßstange ihres Kleinwagens und fuhr etwa drei Meilen weit hinter ihr her. Immer wieder bogen wir unerwartet irgendwo ab, fuhren in Wohnsiedlungen mit niedrigen Bungalows hinein und kurz darauf wieder heraus. Im vorigen Jahr hatte hier ein katastrophaler Tornado gewütet, und die Folgen waren immer noch unübersehbar. Inmitten dieser geschundenen Umgebung tauchte in einer Vorortstraße der Kirchturm auf. Lucille fuhr langsamer, zeigte darauf und winkte mich dann weiter.
Als ich an ihr vorbeifuhr, um auf den Parkplatz einzubiegen, bedankte ich mich bei ihr, woraufhin sie mir ein bezauberndes Lächeln schenkte und mir zurief: »Be blessed.« Sei behütet.
Das schien im Tiefen Süden die bestimmende Grundhaltung zu sein: Freundlichkeit, Großzügigkeit, andere willkommen zu heißen. Auf meinen Reisen in aller Welt war mir dies häufig begegnet, aber hier war es so allgegenwärtig, dass ich gar nicht genug davon bekommen konnte – weil das Wohlwollen sich anfühlte wie eine Umarmung. Obgleich das Lebensgefühl im Süden auch stets einen gewissen düsteren Unterton hat, der in vielen Interaktionen mitschwingt. Aber es dauert geraume Zeit, bis man ihn wahrnimmt, und noch viel länger braucht man, um ihn zu verstehen.
Gelegentlich wurde mir die Zeit auch lang, doch Begegnungen wie jene mit Lucille gaben mir immer wieder neuen Mut, tiefer vorzudringen in den Süden, zu abgelegenen Kirchen, wie The Cornerstone Full Gospel, oder zu Orten, die so klein waren, dass man sie auf manchen Karten gar nicht fand. Orte, in denen man nicht zufällig landete – oder wie man hier sagte: »You gotta be going there to get there.«
Nachdem ich eine Weile im Tiefen Süden unterwegs gewesen war, fand ich großen Gefallen an der Gewohnheit, einander zu grüßen – das freundliche »Hallo« von Passanten und die liebevollen Kosenamen wie Baby, Honey, Babe, Buddy, Dear, Boss und nicht selten auch Sir. Ich mochte Floskeln wie: »What’s going on, Bubba?« – Was läuft? Oder: »How ya’ll doin’?« – Wie geht’s denn so? Oder wenn man auf der Post oder in Geschäften mit einem freundlichen Lächeln empfangen wurde. Immer wieder sagten Schwarze »Mr Paul« zu mir, nachdem ich mich mit meinem vollständigen Namen vorgestellt hatte (was möglicherweise ein Überbleibsel aus den Zeiten der Sklaverei war, lautete eine Erklärung). Es ging hier gänzlich anders zu als im Norden – oder sonst irgendwo auf der Welt, wo ich auf meinen Reisen gewesen war. Als »raging politeness« wird diese auffallende Freundlichkeit gelegentlich bezeichnet, als »Höflichkeitshysterie«, aber selbst wenn sie als aufgesetzt empfunden wird, ist sie doch auf jeden Fall angenehmer als der eisige oder abgewandte Blick und die brüsk-abweisende Art, wie ich es aus New England gewohnt war.
Die wichtigste Beziehung eines Menschen, so schrieb Henry James einmal über das Reisen in Amerika, sei die Beziehung zu seinem Heimatland. Nachdem ich schon viel in der Welt herumgekommen war, plante ich – mit diesem Gedanken im Hinterkopf –, für den Herbst vor den Präsidentschaftswahlen 2012 zum ersten Mal eine ausgedehnte Reise in die Südstaaten zu unternehmen, um darüber zu schreiben. Doch kaum war ich zurück, wollte ich unbedingt noch einmal hin. Also fuhr ich im Winter erneut gen Süden – und im Frühjahr noch einmal, und im Sommer wieder. Da wusste ich, dass der Süden mich nicht loslässt – mal in einer wohligen Umarmung, mal in einer unerbittlichen Umklammerung.
Wendell Turley
Eine Woche oder länger vor der Begegnung mit Lucille hielt ich in einer dunklen Nacht – es war schon nach zehn – vor einem Minimarkt mit angeschlossener Tankstelle unweit der Kleinstadt Gadsden im Nordosten von Alabama.
»Kin I he’p you?«, fragte ein Mann vom Fenster seines Pickups aus. Er hatte diesen leicht beschwipsten und fragenden Tonfall, der typisch ist für den Tiefen Süden und der so schwerfällig und unbeholfen klang, dass es mich nicht gewundert hätte, wenn er im nächsten Moment volltrunken umgekippt wäre. Dabei war er einfach nur freundlich. Er öffnete die Tür seines seltsam dunkel angestrichenen Wagens und schluckte, nachdem er ausgestiegen war. Seine Unterlippe war feucht und hing leicht herunter. Er fügte hinzu: »In inny way?« Helfen, egal wie.
Ich sagte ihm, dass ich nach einer Unterkunft suchte.
Er hielt eine Bierdose in der Hand, die jedoch noch nicht geöffnet war. Er hatte graubraune Augen und Hängebacken und leichte Gleichgewichtsprobleme, obwohl er offensichtlich nüchtern war. Mein Anliegen ignorierte er einfach. Ich musste daran denken, dass die Reisegötter immer wieder dafür sorgten, dass man, wenn man nicht aufpasste, in schlimmen Stereotypen dachte. Und so war es hier – denn ich sah vor mir einen Parade-Südstaatler, der sich mit seinem typischen, breiten Akzent zum einem kleinen Plausch anschickte.
»Ich erklär Ihnen mal was«, kündigte er an.
»Ja?«
»Ich erklär Ihnen mal den Süden.«
Das kam überraschend. Aus der Distanz ist es immer einfach, mit Kennermiene zu behaupten: »So und so läuft das in Afrika«, oder: »China befindet sich im Umbruch.« Doch dass mir jemand direkt vor Ort kurzerhand eine gesamte Region in allen Einzelheiten erklären wollte, das hatte ich so noch nicht erlebt.
»Ich bin nur auf der Durchreise. War noch nie hier. Bin ein Yankee, haha.«
»Hab ich doch gleich gemerkt, so wie Sie reden«, antwortete er. »Und an dem Nummernschild an Ihrem Auto hab ich’s auch erkannt.«
Ich stellte mich vor, und er streckte mir seine freie Hand entgegen.
»Ich heiß Wendell Turley. Hab ne Firma hier in Gadsden. Die Karre da is meine. Alles selber gemacht.«
Er meinte die Karosserie seines alten olivgrünen Pickups, die über und über mit braunen und grünen Ahornblättern verziert war.
»Tarnung«, erklärte er. »Damit fahr ich immer zur Jagd.«
»Gibt es denn hier viel Wild?«
»Jede Menge.«
Jetzt bemerkte ich, dass auf seiner vorderen Hemdtasche der Slogan »Roll Tide Roll« aufgestickt war. Das ist der Schlachtruf des Footballteams der University of Alabama, das von den Einheimischen leidenschaftlich unterstützt wird. Einige gehen sogar so weit, dass sie sich ein scharlachrotes A auf den Hals tätowieren lassen, um als Fans erkennbar zu sein. Nun, »Fan« ist eben nicht ganz zufällig die Kurzform von »Fanatiker«.
»Und, was wollten Sie mir über den Süden erklären, Wendell?«
»Ich werds Ihnen sagen …«
Für einen Reisenden – der obendrein noch vorhatte, über seine Reise zu schreiben – war ein Mann wie Wendell eine willkommene und gern gesehene Zufallsbekanntschaft: geduldig, freundlich, mitteilsam, gastfreundlich und humorvoll in seiner Art. Ein wahrer Segen – vor allem für jemanden, der sich in der Gegend nicht auskannte, insbesondere spätabends in einer menschenleeren Seitenstraße.
»Was zum Kuckuck …«
Er konnte nicht weitersprechen, denn jetzt hielt neben uns ein tiefergelegter, ziemlich verrosteter Chevrolet. Die Fenster waren heruntergelassen und die Musik laut aufgedreht.
Get a glimpse of a nigga
Bet your bitch put her lips on a nigga
We in the strip for the paper
Have these niggas just waiting for a favor …
Ein Mann mit einer speckigen Baseballcap, deren Schirm zur Seite gedreht war, schwang seine Beine aus dem Wagen und stieg aus – der Motor lief, die Tür stand offen, und die Musik dröhnte noch ein wenig lauter. Der Bezug des Fahrersitzes war so zerschlissen, dass an einigen Stellen die Polsterung heraushing.
Wendell machte große Augen, und leise, als ob er mich beruhigen wollte, sagte er zu mir: »Ich kenn den Mann da.«
Der Mann da hatte gerötete Augen, war unrasiert und sah einigermaßen bedrohlich aus. Doch als er Wendell sah, salutierte er unbeholfen und zeigte uns seine Zahnlücken. »What’s going on?«, sagte der Mann, als er Richtung Minimarkt marschierte.
»How y’all doin?«, antwortete Wendell.
»It’s all good, brother.«
»I hear ya.«
Wir warteten, während der Lärm aus dem Auto ohrenbetäubend weiterdröhnte und in den nachtschwarzen Bäumen rings um den Parkplatz widerhallte. Es dauerte geraume Zeit, bis der Mann mit der schiefen Kappe – einen Sixpack Bier unter dem Arm – wieder aus dem kleinen Laden kam, sich schwerfällig in sein Auto fallen ließ, kurz zurücksetzte und dann mitsamt dem Geheul in der Dunkelheit verschwand.
»Was wollten Sie gerade sagen, Wendell?«
»Ich will Ihnen was vom Süden erzählen«, sagte er. Und dann beugte er sich ganz dicht zu mir heran und sagte betont langsam: »Wir sind anständige Leute. Nich so gebildet wie ihr oben aus’m Norden. Aber anständig. Und gottesfürchtig.« Blinzelnd suchte er offenbar nach einem Beispiel und fügte dann hinzu: »Ob’s Gott gibt oder nich – für solche Fragen braucht man Bildung.«
»Wahrscheinlich«, pflichtete ich bei.
»Wie auch immer. Im Süden fragen wir so was nich. Aber wir sind anständige Leute.« Dann straffte er sich, stellte sich noch ein Stück aufrechter hin und äußerte mit großem Nachdruck einen weiteren Gedanken: »Kein Mensch im Süden – schwarz oder weiß, ganz egal – würde ’nem Gast zu Hause nix zu essen anbieten, was Warmes, ’n Sandwich, paar Erdnüsse oder so.« Langsam und bestimmt ergänzte er: »Sie geben Ihnen zu essen, Sir.«
»Verstehe.«
»Und wieso?«
»Sagen Sie’s mir.«
»Weil’s sich’s so gehört.«
»Das ist Gastfreundschaft«, sagte ich.
»Das ist Gastfreundschaft! Und wenn Sie wieder in Gadsden sind, dann kommen Sie bei mir und Sandy vorbei, und dann essen wir was zusammen.« Er legte mir seine freie Hand auf die Schulter. »Ich kenn Sie zwar nur kurz, aber ich merk, Sie sind ’n gebildeter Mann. Ihr seid anständige Leute. Ich fahr dann mal los und erzähl’s Sandy.«
Und dann riet er mir noch dringend davon ab, in Gadsden zu übernachten. Auch ein Stück weiter in Collinsville sollte ich nicht bleiben, sondern noch zwanzig Meilen weiter bis nach Fort Payne zu fahren, wo es ein viel besseres Motel gebe. Wenn ich jedoch das nächste Mal hier wäre, dann würden er und Sandy mich gern zu sich einladen.
»In welcher Richtung liegt denn Fort Payne?«
Wendell hob den Kopf, schaute in die Dunkelheit zu der kaum erkennbaren Auffahrt und deutete mit dem Kinn in die entsprechende Richtung.
Was Wendell gesagt hatte, selbst wie er meine Schulter umklammert hatte, beeindruckte mich. Ich musste an die vielzitierten Zeilen aus William Faulkners Absalom, Absalom! denken: »Erzähl mir was vom Süden. Wie es dort aussieht. Was sie dort machen. Warum sie dort leben. Warum sie überhaupt leben.« Faulkner, der unbestrittene Meister des vielschichtigen Erzählens, versucht in mehreren Anläufen diese Fragen zu beantworten. Doch Wendell hatte auf seine Weise eine ebenfalls sehr überzeugende Antwort darauf gefunden, und so fuhr ich ein Stück unbeschwerter in die Nacht.
Dieses Erlebnis gleich zu Beginn meiner Reise hellte meine Stimmung beträchtlich auf. Es war eine von vielen Begegnungen, die mir zeigten, wie der Reisende direkt nach seiner Ankunft in den hiesigen Lebensrhythmus eintaucht, wenn der Süden ihn auf subtile Weise willkommen heißt und ihn schon bald voll und ganz in seinen Bann zieht.
Road Candy: Reisen in Amerika
Die meisten Reiseerzählungen – vielleicht sogar alle, die Klassiker eingeschlossen – berichten von den Mühen und Glücksmomenten, die damit verbunden sind, wenn sich jemand von einem fernen Ort an einen anderen begibt. Es geht um die Herausforderung, ans Ziel zu gelangen, und die damit verbundenen Verwicklungen. Von Interesse ist dabei der Weg, nicht so sehr das Ziel, und meist steht der Reisende – vor allem dessen Stimmungslage – im Zentrum des Geschehens. Ich habe es zu meinem Broterwerb gemacht, mich selbst auf meinen Reisen zu porträtieren. Und viele andere Autoren schreiben ebenfalls auf ganz traditionelle Weise Reiseliteratur, in der ein Ich-Erzähler im Mittelpunkt steht. V.S. Naipaul hat den Reisenden in seinem Buch In den altenSklavenstaaten recht scharfsinnig als jemanden bezeichnet, der vor einem fremden Hintergrund seine Position bestimmt.
Doch in Amerika zu reisen ist vollkommen anders als irgendwo sonst auf der Welt. Ganz zu Beginn meiner Erkundungen des Tiefen Südens suchte ich einen Lebensmitteladen in einer Kleinstadt von Alabama auf, wo ich mir etwas zu trinken kaufen wollte. Eigentlich hatte ich vor allem deshalb dort angehalten, weil das Geschäft so bodenständig und anheimelnd aussah. Es befand sich in einer Nebenstraße und schien lediglich aus verwitterten Brettern zusammengenagelt. Ein rostiges Coca-Cola-Schild prangte an der Hausfront. Auf der kleinen überdachten Veranda stand eine Bank, auf die ich mich setzen, meinen Durst stillen und mir Notizen machen konnte. Der Betreiber eines solchen Ladens konnte nur jemand sein, der aufgeschlossen und redselig war.
Ein Mann mit Kappe, um die sechzig, stand hinter dem Verkaufstresen und begrüßte mich, als ich den Laden betrat. Ich nahm eine Limo aus dem Kühlschrank, bezahlte die Flasche und sah an der Kasse, dass auf der Theke zahllose bauchige Glasbehälter standen, die an Goldfischgläser erinnerten und mit einzelnen Bonbons gefüllt waren. Schlagartig fühlte ich mich an meine Kindheit erinnert und zurückversetzt in einen Gemischtwarenladen namens Sam’s Store, der sich um 1949 in meinem Heimatort Medford, in Massachusetts, an der Kreuzung zwischen Webster und Fountain Street befand. Dort standen auf dem Tresen ebenfalls solche Gläser, bis obenhin voll mit Süßigkeiten.
»Als ich noch ein Kind war«, sagte ich, »haben wir das Penny Candy genannt.«
»Road Candy«, antwortete der Mann, der mir freundlich zugehört hatte. »Kann man unterwegs naschen.«
»Road Candy« klang für mich nach dem perfekten Ausdruck für den Genuss, der einem die Fahrt durch den Tiefen Süden bescherte, für das, was ich sah, was ich erlebte, die Freiheit beim Reisen, die Begegnungen mit den Menschen, was ich dabei lernte.
Über tadellos instand gehaltene Straßen von einem Ort zum nächsten zu rauschen ist so herrlich und einfach. Doch sollte man dabei nicht dem Trugschluss erliegen, dass die guten Straßen ein Beleg für den Wohlstand sind und Amerika leicht zu bereisen ist. Paradoxerweise enden viele amerikanische Straßen in Sackgassen. Die eigentliche Herausforderung besteht also darin, anzukommen, und das in einem Land, das einen starken Hang zur Improvisation hat und eine tiefsitzende Verachtung für Vorschriften jeglicher Art. Doch Amerika sollte sich für mich als ausgesprochen zugänglich erweisen – durchaus im Gegensatz zu seinen Bewohnern, denn diese sind weitaus verschlossener als alle anderen Nationalitäten, denen ich auf meinen Reisen begegnet bin.
In Amerika reist man derart komfortabel, dass sich eine Reiseerzählung nicht lange mit der Beschreibung der eigentlichen Fortbewegung aufhalten kann, also mit dem, was oft den Kern von Reiseliteratur ausmacht. Man befindet sich in der Lage des Prinzen Husein aus Tausendundeiner Nacht mit seinem fliegenden Teppich, »der zwar unansehnlich ist, jedoch solche Eigenschaften besitzt, dass, wenn sich einer darauf setzt und auch nur in Gedanken den Wunsch hegt, irgendein Land oder eine Stadt zu besuchen, er sogleich sicher und bequem dorthin getragen wird«.
Eine gefährliche oder unwegsame Straße kann durchaus das Thema einer Reise sein, das Reisen mit einem fliegenden Teppich eher nicht. Im klassischen Reisebericht geht es im Grunde immer noch um die Nacherzählung der Odyssee – in moderner Funktionskleidung –, es geht um die Hindernisse, die sich dem Helden in den Weg stellen, und um die glückliche Heimkehr. Das beginnt in der Neuzeit mit Büchern wie Auf schmalen Pfaden durchs Hinterland des japanischen Dichters Matsuo Bashō aus dem 17. Jahrhundert, trifft zu auf Werke wie Francis Parkmans Der Oregon-Treck von 1849 und auf die großen Reiseberichte unserer Zeit mit den störrischen Kamelen in Wilfred Thesigers Brunnen der Wüste, den mörderischen Schlammpfaden in Kongofieber von Redmond O’Hanlon und den Fußmärschen eines Bruce Chatwin in dem Buch In Patagonien. In Reiseberichten geht es generell um das mühsame Erreichen eines Zielorts.
In Amerika hingegen ist das Reisen praktisch ein Spaziergang, der jede Beschreibung überflüssig macht.
V.S. Naipaul beschreibt in seinem Buch über das Reisen in den Südstaaten das Land als groß, vielfältig und auch teilweise wild. Doch alles sei standardisiert worden, das Land stelle für den Reisenden keine Herausforderungen bereit. In einem Reisebericht könne es daher nicht um die Straßen oder die Unterkünfte gehen. Weiter schreibt er, dass Amerika nicht fremd genug sei. Eine Aussage, die mit Vorsicht zu genießen ist, denn auf seiner Reise durch den Süden beschränkte sich Naipaul auf die größeren Städte, und sein Hauptthema waren die noch heute spürbaren Auswirkungen der Sklaverei. Als hilfreiche Erkenntnis fügt er hinzu, dass Amerika zu bekannt, zu häufig fotografiert, zu ausführlich beschrieben sei und wenig Gelegenheit für unkonventionelle Erfahrungen biete.
Man kann sich natürlich künstliche Hindernisse schaffen und in Pseudoheldentum schwelgen, wenn man seine Erzählung unbedingt nach klassischem Vorbild anlegen will, dem zufolge Reiseschriftsteller viel leiden müssen, Not und Angst ausstehen und absonderliche Rituale über sich ergehen lassen müssen. Viele Autoren tun dies, selbst in diesem sorgenfreien Land. Ich betrachte ihre Bücher als Schilderungen von Pseudostrapazen.
Pseudostrapazen
Manche in Amerika angesiedelte Reiseberichte haben ein gewisses Maß an Erfolg, weil sie erschreckende, gefährliche und riskante Abenteuer vortäuschen, in denen es angeblich um Leben oder Tod geht. Dieses pseudoheldenhafte Genre wurde möglicherweise von Henry David Thoreau begründet, der – obgleich zweifelsohne ein genialer Literat – sich nach seinem Harvard-Abschluss von den Eltern aushalten ließ und die meiste Zeit im Haus der Familie verbrachte. Zeit seines Lebens (er starb im Alter von nur vierundvierzig Jahren) hatte er gesundheitliche Probleme. Insofern war es keine Übertreibung, als er 1843 in seinem Tagebuch festhielt, dass er ein kränkliches Nervenbündel sei, das wie ein welkes Blatt zwischen Zeit und Ewigkeit hinge.
Damals war er sechsundzwanzig und litt an chronischer Bronchitis, Stimmungsschwankungen und widerholten Schüben der Schlafkrankheit. Obwohl er ein Loblied auf die Natur sang und das Wandern pries, war er alles andere als ein »Naturbursche«. Bekanntermaßen wagte er im Alter von achtundzwanzig Jahren ein Experiment mit der Abgeschiedenheit und baute sich in Massachusetts am Seeufer des Walden Pond eine Blockhütte. In diesem Zusammenhang wird er häufig als Einsiedler beschrieben, der ein einsames Leben in der Wildnis führte. In Wahrheit war er jedoch nur gut anderthalb Meilen von seiner Mutter entfernt, die ihm Essen brachte und seine Kleidung wusch. Wenn er nicht gerade las oder schrieb, vertrieb er sich die Zeit mit Freunden und Bekannten beim Heidelbeersuchen.
Am Walden Pond las Thoreau unter anderem Taïpi von Hermann Melville. In dieser farbenfrohen Beschreibung Hawaiis und einer Fahrt mit einem Walfänger im Pazifik desertiert Melville gemeinsam mit einem Kameraden von diesem Schiff, und die beiden finden anschließend Zuflucht auf den abgelegenen Marquesa-Inseln. Dort erlebt er eine idyllische Romanze mit einer grazilen Inselschönheit: »Fayaweh und ich lagen im Boot, die zarte Schöne setzte von Zeit zu Zeit die Pfeife an die Lippen und blies die milden Tabakwölkchen von sich, die ihr frischer Atem noch duftender machte …«
Thoreau – zwei Jahre älter als Melville – konnte nicht wissen, dass der Autor sein Inselerlebnis arg glorifiziert hatte und keineswegs vier Monate, sondern lediglich vier Wochen auf den Marquesas gewesen war. Doch Melville fand mit diesem Buch großen Anklang, und das ausgelassene Abenteuer in diesem fernen, unverdorbenen und fremden Winkel der Welt (mit Kannibalen, Wassernymphen und Nacktheit) beeindruckte auch den zölibatär lebenden und unter Bronchitis leidenden Mann am Walden Pond zutiefst. Zumal er einige Jahre zuvor von der einzigen Frau, die er je liebte, zurückgewiesen worden war. Nach einem Jahr in Einsamkeit drohte ihm endgültig die Decke auf den Kopf zu fallen.
Zum Teil als Antwort auf Taïpi und aus dem leidenschaftlichen Wunsch heraus, ein eigenes Abenteuer in der Wildnis zu erleben, über das er dann ebenfalls schreiben konnte, begab sich Thoreau auf eine umständliche Reise nach Maine. Mit dem Zug fuhr er zuerst nach Boston, dann weiter nach Portland, dann mit dem Dampfer den Penobscot River hinauf nach Bangor, wo er auf einen Vetter und zwei Holzhändler traf. Die vier reisten zusammen mit einer wackeligen Postkutsche ins Landesinnere nach Mattawamkeag. Von dort aus ging es mit dem Kanu noch etwa fünfundzwanzig Meilen weiter bis zum North Twin Lake. Thoreau war begeistert von den dortigen Wäldern, die er als wild und undurchdringlich beschrieb, wie sie wohl auch die ersten Siedler erlebt haben mussten. Eine vergleichbare Wildnis hatte er noch nicht erlebt.
Er war überwältigt von der Natur. Endlich hatte er etwas gefunden, das ähnlich wild, ursprünglich und voller Gefahren war wie Melvilles Marquesas. Die kleine Gruppe wanderte durch den Wald bis an die unteren Hänge des Mount Kathadin. Thoreau bestieg diesen Berg allein, wobei er sich – so sagt er – wie Prometheus fühlte. Die Besteigung des Kathadin inspirierte ihn zu einer hinreißenden Beschreibung über die Schönheiten der Natur.
»Die Natur war hier etwas Wildes und Ehrfurchtgebietendes, und doch schön. Ich sah mit Staunen auf den Boden, über den ich schritt, betrachtete die Formen und Gestalten und den Stoff, auf den die Kräfte hier gewirkt hatten. Das war die Erde aus den alten Erzählungen, geschaffen aus dem Chaos und der Nacht. Dies war niemandes Garten, sondern ungezähmte Natur. Es war weder Rasen noch Wiese oder Weide, nicht Wald und Flur, nicht Acker, nicht Brachland. Es war die junge, natürliche Oberfläche des Planeten Erde, gemacht für die Ewigkeit …«
Diese kleine Spritztour, auf der vier Männer hauptsächlich durch den Wald wanderten, dauerte ganze zwei Wochen. Thoreau machte daraus in Die Wildnis von Maine eine ausgedehnte Forschungsreise. Später behauptete er, die Natur dort sei ursprünglicher und schwerer zugänglich gewesen als alles, was Melville auf den entlegenen Marquesas-Inseln erlebt habe. Und er redete sich ein, dass die Sache sehr strapaziös gewesen sei.
Pseudostrapazen dieser Art wurden alsbald fester Bestandteil amerikanischer Reiseliteratur, der sich bis zum heutigen Tag erhalten hat. Henry James muss man zugutehalten, dass er sich in den Beschreibungen seiner langen Zugreisen von Boston nach San Diego nie über Unannehmlichkeiten beschwert hat. Er erwähnt lediglich die an ein Nadelkissen erinnernde Silhouette New Yorks, monierte die optische Hässlichkeit mancher Städte und die Enge in den Reisebussen und war hinterher froh, wieder in London zu sein.
Charles Dickens fand es als Engländer gänzlich unmöglich, in den USA zu leben. Die Erinnerungen an seine USA-Reise hielt er in den Aufzeichnungen aus Amerika fest. Diese Einschätzung von Dickens teilen vier weitere aus England stammende Reisende, die in Amerika mit dem Bus unterwegs waren.
Das Gebäude der Hafenverwaltung von New York City sei ein furchteinflößender Ort, an dem man sich vollkommen alleingelassen fühle, klagt die erfolgreiche und ansonsten unerschrockene Ethel Mann in in ihrem Buch American Journey (1967) über den Beginn ihrer Busreise, und sie schreibt, man müsse der Versuchung widerstehen, sich niederzusetzen und in Tränen auszubrechen.
Mary Day Winn berichtet in The Macadam Trail: Ten Thousand Miles by Motor Coach (1931) von den Strapazen, die sie erlitt, als in Arizona ein bewaffneter Mann ihren Luxusreisebus stoppte. Beim Anblick seiner Pistole habe ein übertrieben geschminktes Mädchen auf dem Platz direkt hinter dem Fahrer schrill gekreischt. Doch statt die Passagiere auszurauben, verlangt der Mann lediglich, sechs von den Frauen im Bus zu küssen. Ehe er die verängstigten Fahrgäste schließlich verlässt, erklärt er noch, dass er es keinen Tag länger ausgehalten hätte, ohne ein hübsches Mädel zu küssen.
Ungemach bereitet es dem englischen Schriftsteller Ernest Young in San Antonio, Texas, dass er so früh aufstehen muss, um den Bus zu seiner North American Excursion (1947) zu erreichen. Darin berichtet er über eine Tagesreise von vierhundertdreißig Meilen, was in etwa der Strecke von der schottischen Grenze bis nach Land’s End in Cornwall entspricht. Dazu habe er erneut sehr zeitig aufstehen müssen, was ihm nicht sonderlich behagte. Ein überhastetes Frühstück in einer kleinen Hütte an der Straße, während es draußen verregnet und neblig war, erschien ihm nicht als der ideale Beginn einer so langen Reise.
James Morris schreibt in seinem Buch Coast to Coast (1965) von Menschen verschiedenster Abstammung, die nach Amerika kamen, um reich zu werden, und dort geblieben seien und nun ein Leben führten wie verwahrloste Tiere. Weiter berichtet er, dass unter solch prekären Umständen Rassenvorurteile entstünden, deren Auswirkungen man häufig in Form von Pöbeleien und Rempeleien im Bus oder auf der Straße beobachten könne – wenn etwa ein betrunkener Schwarzer die Weißen verfluchte, während er sich auf seinen Platz fallen ließ, oder ein Weißer sich rücksichtslos seinen Weg durch eine Gruppe von schwarzen Frauen bahnte.
Obwohl das Buch von Morris ansonsten warmherzig und wohlwollend geschrieben ist, enthält es doch auch immer wieder von Furcht geprägte Betrachtungen. So stellt er beispielsweise fest, dass eine gewisse Brutalität im amerikanischen Alltag stets präsent sei. Außerdem berichtet er von Stürmen, Hochwasser, dem reißenden Rio Grande und starken Böen (die er als Taifun bezeichnet) in Vicksburg, Mississippi. »Gewalt lauert überall.«
Selbst die Zusammenkünfte ehrbarer Geschäftsleute wirken auf ihn »rüde«, ja sogar die Versammlungen einschlägiger Wohltätigkeitsvereine. Dabei war die Reise, die Morris unternahm, gänzlich harmlos und von Wildnis meilenweit entfernt. Trotzdem notiert er, dass die Leute ihn mit impertinenten Fragen bedrängt hätten.
Viele Jahre später wurde durch Geschlechtsumwandlung aus dem James eine Jan. Jan erwarb eine Eigentumswohnung in New York, einer Stadt, auf die sie schon bald ein Loblied sang.
Dazu muss gesagt werden, dass niemand von diesen Reisenden einen Berg bestiegen, sich durch dichten Wald gekämpft oder zu Fuß eine Wüste durchquert hat. Vielmehr waren sie allesamt komfortabel per Bus oder Auto auf intakten Straßen unterwegs. Doch mit ihren heillosen Übertreibungen sind sie keineswegs allein. Viele amerikanische Autoren ergehen sich in Pseudostrapazen und stellen das Unterwegssein auf den Straßen Amerikas als höchst beschwerlich dar. In seinem Buch Die Reise mit Charley beschreibt John Steinbeck die Mojawe-Wüste als groß und furchterregend. Als Beispiel für die Gefahren führt er an, wie er auf zwei Kojoten stieß, die ihn aus nur knapp fünfzig Metern Entfernung bedrohlich anstarrten. Er hatte gelernt, dass sie getötet werden müssen. Der investigative Journalist Bill Steigerwald vollzog Steinbecks Reise nach und belegte in seinem Buch Dogging Steinbeck, dass der spätere Nobelpreisträger nicht einmal die Hälfte der Orte, die er beschreibt, selbst bereist hat und meistens mit seiner Frau in noblen Hotels abgestiegen war. Ein Großteil seines Buches ist somit also Fiktion, und die Kojoten hat es möglicherweise nie gegeben.
In Der klimatisierte Alptraum schildert Henry Miller seine Reise von New York nach Los Angeles (Ende 1940 bis 1941). Darin schreibt er zu Beginn: »Ich fühlte das Bedürfnis, mich mit meinem Heimatland auszusöhnen.« Doch später bezeichnet er das Unterfangen als »bedrückende Reise durch Amerika«. Sein Buch ist voll von Klagen über die Langeweile während der Fahrt, das schlechte Essen (ein ganzes Kapitel widmet er seiner Empörung über die schlechte Qualität von amerikanischem Brot) und die hässlichen Städte.
St. Louis ist für Miller ein besonderer Horror: »Die Häuser scheinen mit Rost, Blut, Tränen, Schweiß, Galle, Schleim und Elefanten-Dung herausgeputzt zu sein … Nichts kann mich mehr erschrecken als der Gedanke, dazu verdammt zu sein, den Rest meiner Tage in einem solchen Ort verbringen zu müssen.« Kalifornien gefällt ihm auch nicht besser und verursacht ihm zudem Brechreiz: »Ich hatte Lust zu kotzen. Aber man braucht eine Erlaubnis, um sich öffentlich zu übergeben.«1 Ein Jahr nach diesen Strapazen verlegte Miller seinen Wohnsitz nach Kalifornien. Zunächst lebte er in Big Sur, und seinen Lebensabend verbrachte er in Los Angeles – als glücklicher Mann, wie er selbst sagte.
Das beschwerliche Amerika ist auch das Thema des Buches Desert Solitaire: A Season in the Wilderness von Edward Abbey. Darin beschäftigt er sich allerdings ausschließlich mit den rauen Elementen. Außerdem stellt er fest, dass man zu Fuß, vom Pferderücken aus oder mit dem Fahrrad innerhalb einer Meile mehr sehen, spüren und genießen könne als motorisierte Touristen auf hundert Meilen. Dabei verschwieg er allerdings, dass er selbst Auto fuhr. Allein das Wort Wildnis klinge schon wie Musik, so schrieb er. Während er die Einsamkeit und den innigen Kontakt mit der Natur im Süden Utahs preist, versäumt er es zu erwähnen, dass er über fünf Monate hinweg mit seiner dritten Frau Rita und dem gemeinsamen kleinen Sohn in einem Wohnwagen lebte, und zwar unweit von seinen trinkfesten Kumpels und einer Stadt mit Saloon.
In Mississippi: Roman einer Reise schrieb mein Freund Jonathan Raban über seine Fahrt mit einem kleinen Motorboot auf dem Mississippi. Er kann Reiseerlebnisse wunderbar anschaulich wiedergeben, lokale Besonderheiten scharfsinnig analysieren, und sein Buch ist besonders kenntnisreich und humorvoll. Als Ausländer nimmt er in diesem Land vieles wahr, was Amerikaner zumeist übersehen. Auch wenn er sich in seinem Buch kaum über Pseudostrapazen auslässt, erschreckt er sich an einer Stelle sehr über einen Vogelschwarm. Am zu Illinois gehörenden Ufer sah er einen abgestorbenen Baum, der offenbar als Schlafquartier für eine Gruppe großer Vögel diente, vor denen er sich fürchtete, weil sie seiner Ansicht nach nichts Gutes im Schilde führten. Daraufhin kramte er hektisch seine Sonnenbrille hervor – besessen von dem Gedanken, dass sie als Erstes versuchen würden, ihm die Augen auszuhacken.
So bedrohlich die Vögel auch auf ihn wirkten, sie verschonten den reisenden Engländer und seine Augen. Im weiteren Verlauf übersteht er noch eine Schlechtwetterperiode, eine glücklose Liebesaffäre, ist einmal dem Ertrinken nahe, kommt dann jedoch mit heiler Haut in New Orleans an. Eine weitere – wenngleich weniger ambitionierte – Reisende, die in jüngerer Zeit den Mississippi entlangsegelte, ist Mary Morris, die in River Queen genüsslich allerlei Pseudostrapazen ausbreitet. Das Schiff sagt ihr nicht zu, ihre Mitreisenden, Tom und Jerry, gehen ihr auf die Nerven. Das Essen findet sie widerlich. In einer Schimpftirade fasst sie zusammen, wie sehr sie Pizza verabscheue und sich dringend anständiges Essen, eine Dusche und überhaupt etwas mehr Komfort wünsche.
Eine Wanderung auf dem Appalachian Trail, dem bekannten US-Fernwanderweg, sollte für einen gesunden Menschen eigentlich ein anregendes und bereicherndes Erlebnis sein. Viele Menschen haben ihn schon bewältigt. Bill Bryson, der zusammen mit einem Freund diesen Weg für sein Buch Picknick mit Bären in Angriff nahm, berichtet darin über einen der Klassiker unter den Pseudostrapazen: seine Begegnung mit einem Bären, als er in Virginia nahe einer Quelle im Zelt übernachtete. Ein Bär – möglicherweise auch zwei, denn er konnte nur die Augen erkennen – kam dort zum Trinken vorbei. Bryson schreckte hoch und griff instinktiv nach seinem Messer, fand es jedoch nicht, sondern lediglich einen Nagelknipser. Selbstironisch schreibt er weiter, dass Schwarzbären nur sehr selten angriffen, doch manchmal täten sie es eben doch. Wenn sie jemanden töten und fressen wollten, dann seien sie dazu in der Lage, und zwar so ziemlich jederzeit.
Dies sei schließlich Amerika, konstatiert er an anderer Stelle, wo man ständig mit Mord und Totschlag rechnen müsse.
Doch die Bären lassen ihn in Ruhe, er wird nicht getötet und erleidet bis auf die Blasen an den Füßen auch kaum Unannehmlichkeiten in seinem – trotz der darin ausgebreiteten Pseudostrapazen – lesenswerten Buch.
Elijah Wald beschreibt in seinem Buch Riding With Strangers (2006), wie er zu Beginn einer Reise quer durchs ganze Land an einer Raststätte außerhalb von Boston im Regen steht und darauf wartet, dass ihn endlich der erste Autofahrer per Anhalter mitnimmt. Doch dieses Abenteuer wird an Selbstironie und Witz noch übertroffen von John Waters, der – einfach zum Spaß – von Baltimore nach San Francisco trampte und darüber ein Buch namens Carsick schrieb, in dem es vor Pseudostrapazen nur so wimmelt. Er gibt jedoch offen zu, dass die meisten davon nur dem furchtsamen und fiebrigen Hirn eines reichen schwulen Filmregisseurs entsprungen seien, der sich genauso gut einen Flug erster Klasse hätte leisten können, sich jedoch nach ein bisschen Mühsal gesehnt habe, um seine Reise mit etwas Schweiß und Staub zu würzen.
Es gibt noch viele andere ähnlich geartete Bücher – Hunderte, vielleicht Tausende, doch alle widmen sich auf ihre ganz eigene, aufschlussreiche Weise dem Reisen an entfernte Orte und stellen die USA als fremdes, unwirtliches Gelände dar, wo das Unterwegssein ein riskantes Abenteuer, ja ein geradezu lebensgefährliches Unterfangen sei.
Sieht man von diesen Übertreibungen einmal ab, sind einige von diesen Büchern durchaus lesenswert. Was ihnen allerdings fehlt, ist die schlichte Feststellung, dass dem Reisenden in den Vereinigten Staaten nur selten ernstzunehmende Steine in den Weg gelegt werden. Die Reiseautoren sind zu Fuß, mit dem Boot, per Anhalter oder als Camper unterwegs und bauschen alles kräftig auf, um auf sich aufmerksam zu machen. Dabei ist doch nichts leichter, als dieses Land auf seinen Straßen zu durchqueren. Das Autofahren wird ganz besonders von Larry McMurtry in seinem Buch Roads: Driving Americas Great Highway (2000) gefeiert. Darin sinnt er über das Reisen mit dem Auto nach und stellt sich die großen Straßen als Flüsse vor. Auf manchen lässt er sich einfach mit der Strömung treiben, und bei anderen muss er gegen den Strom ankämpfen. In diesem erfreulichen Essay über das Durchqueren des Landes geht es auch um alberne Selbstgespräche am Steuer, Tagträumereien während der Fahrt, Erinnerungen an Bücher, alte Filme, Nachdenken über Vergangenes. Der Autor bezeichnet dies als stumpfsinniges Fahren, begleitet von minimalem Denkeinsatz.
McMurtry bezeichnet den Highway 90 einmal liebevoll als seinen guten alten Freund, und an anderer Stelle schreibt er, dass er eine Stunde lang durch Alabama fährt. Dabei muss er allerdings geflogen sein, denn es geht um die Strecke von Duluth nach Wichita, die rund 770 Meilen lang ist. Dazu merkt der Autor an, dass er nie weiter als hundert Meter vom Highway abfahren musste, wenn er tanken, etwas essen oder eine Toilette aufsuchen wollte. Oder im Motel übernachten, hätte er noch ergänzen können. Sein Buch gibt recht treffend wieder, wie ich das Reisen in Amerika empfinde. Der einsame Roadtrip ist in vielerlei Hinsicht eine Zen-ähnliche Erfahrung, die – versüßt durch »Road Candy« – so in keinem anderen Land der Erde denkbar ist.
Trotzdem treten beim Reisen in den USA gelegentlich doch Hindernisse auf, zumindest wenn es einem darum geht, das Land wirklich kennenzulernen. Obwohl wir von Natur aus aufgeschlossen sind, reagieren wir abweisend, wenn Fremde zu offensiv werden. Unsere Herzlichkeit kühlt dann spürbar ab, verschwindet alsbald ganz und weicht skeptischer Zurückhaltung. Wir haben zwar zu allem eine Meinung, schätzen aber Widerspruch oder eindringliche Fragen nicht sonderlich. Und Reisende haben ja oft recht viele Fragen. Amerikaner reden gern den lieben langen Tag, sind allerdings ausgesprochen schlechte Zuhörer.
Amerikaner haben mit den Angehörigen indigener Volksgruppen in aller Welt eines gemeinsam: ihre tiefe Skepsis gegenüber zu persönlichen Fragen. Wir behaupten zwar, dass wir andere Ansichten tolerieren, doch sobald jemand einen abweichenden Standpunkt mit Vehemenz vertritt, gilt er schnell als unsympathisch oder gar als Feind. Konträre Meinungen werden häufig als Angriff verstanden, obwohl man das bei unserem Faible für die Freiheit niemals ahnen würde. Einwanderer, Flüchtlinge, Menschen, die Tyrannei und Schrecken in ihrer Heimat hinter sich gelassen haben und vor allem wegen dieser Freiheit nach Amerika gekommen sind, sind uns häufig zu kompromisslos und kritisch. Widerspruch tolerieren wir nur, wenn er uns nicht direkt betrifft und wir nicht gezwungen sind, uns damit auseinanderzusetzen.
Der große Vorzug unseres Landes besteht in seiner Größe und der vergleichsweise geringen Bevölkerungsdichte, wodurch reichlich Platz für jeden Einzelnen vorhanden ist. Das schafft Raum für Artenvielfalt, die häufig mit Toleranz verwechselt wird. Der wahre Reisende wagt es, in diesen Raum einzudringen.
Wieder zum Reisenden werden
Auf meiner Fahrt gen Süden stellte es sich wieder ein, dieses längst vergessene Gefühl, ein Reisender zu sein. Da das »Loskommen« so mühelos vonstattenging und ich mich förmlich auf die Straße hinauskatapultiert fühlte, entdeckte ich meine Freude am Reisen schnell wieder, die ich zu jener Zeit empfunden hatte, als man auf Flughäfen noch keine Warteschlangen, Kontrollen, Beleidigungen und Eingriffe in seine Privatsphäre über sich ergehen lassen musste. Dieses ganze Prozedere ist eine einzige Zumutung, die einem das ganze Reiseerlebnis verleiden kann. Zudem findet es statt, noch ehe man sich überhaupt vom Fleck bewegt hat. Vor Flugreisen muss man sich heutzutage einem richtiggehenden Verhör aussetzen.
Früher ist man einfach aufgebrochen, hat sein Ticket vorgezeigt und ohne weitere Gepäck- oder Gesinnungskontrolle das Flugzeug bestiegen, das kurz darauf gestartet ist. In früheren Zeiten meines Lebens als Reisender war das für mich immer ein besonderer Glücksmoment.
Das Reisen ist inzwischen mit unerträglich vielen Ärgernissen verbunden, die zum Teil noch vor der Abreise beginnen. Das Geschehen am Flughafen ist nicht nur ein lästiger Vorgeschmack auf die Affronts, die einem unterwegs noch bevorstehen, sondern auch eine unschöne Methode, um den potenziellen Reisenden daran zu erinnern, dass er oder sie im Heimatland als Fremdling angesehen wird. Und nicht nur das. Obendrein als potenzielle Gefahr, als Unruhestifter, wenn nicht gar als Terrorist. Mit viel Brimborium büßt man Schuhe, Gürtel und Jacke ein, wird bloßgestellt und durchleuchtet, während man ungeduldig mit den Hufen scharrt und eigentlich nur weg will.
Der Flughafen ist ein einziger Hindernisparcours, der einem die Lust am Reisen gründlich verderben kann. Im Laufe der letzten Jahre hat sich das Geschehen auf Flughäfen zu einer Art Totalitarismus entwickelt, wobei man bewusst entmündigt und pauschal verdächtigt wird und keinerlei Einfluss auf das Prozedere hat. Die Befragungen sind derart plump, dass man nur mit mühsam verhohlener Wut darauf reagieren kann, wie sie früher Reisende in Osteuropa begleitet hat, wo Polizeischikane an der Tagesordnung war. Einst war Reisen eine Befreiung, jetzt ist das Gegenteil der Fall – zumindest wenn man das Flugzeug wählt. Jüngere Reisende haben keine Vorstellung davon, was für ein Verlust das ist.
Diese Grenzüberschreitung zu akzeptieren und sich dabei auch noch kooperativ zu zeigen (»Es geschieht doch alles in meinem eigenen Interesse«) ist mehr als ärgerlich, denn wir beruhigen uns mit denselben Argumenten und Ausflüchten, die schon immer geholfen haben, dass repressive Diktaturen und Gewaltregimes sich behaupten konnten. Wenn man auf den Flughäfen Reisende systematisch ihrer Würde beraubt und sie zwingt, sich dieser Praxis zu fügen, ist dies das genaue Gegenteil von dem, wonach man als Reisender strebt. Wir leben in der Tat in gefährlichen Zeiten, aber wenn das bedeutet, dass wir keinerlei Recht mehr auf Privatsphäre haben, dann lohnt es sich kaum, sich überhaupt auf den Weg zu machen.
Doch es gibt eine Alternative – zumindest für die Glücklichen, die in einem so großen Land wie den USA leben und damit die Chance haben, Flughäfen generell zu meiden und sich stattdessen auf die Straße zu beschränken. Selbst die rostigste Schrottkiste ist immer noch besser als ein Flugticket erster Klasse, das man sich durch unwürdige Kontrollen und Leibesvisitationen erkauft. Wenn man hingegen ins Auto steigt und Gas gibt, hat niemand das Recht, dies in Frage zu stellen. In diesem Fall gibt es kein nervtötendes Vorgeplänkel, sondern man kann von einem Moment auf den anderen verschwinden.
Das Reisen bringt heute die zweifelhafte Errungenschaft mit sich, dass man eine Vielzahl von Flughäfen mit all ihren Unannehmlichkeiten passieren muss, wenn man in der Ferne einen kurzen Hauch von Exotik erleben will und dabei der Illusion erliegt, dass darin das Reisen besteht: Wie ein Geschoss in eine Röhre gestopft und dann wie aus einer Kanone abgefeuert zu werden. Denn genauso fühlen sich die meisten von uns in dieser Situation – wie eine menschliche Kanonenkugel, verwirrt und benommen, zusammen mit jeder Menge anderer Kanonenkugeln.
Doch es gibt einen besseren Weg, der echter und ursprünglicher ist – den guten alten Highway, die Straße über Land.
Nach Süden
Ohne ein konkretes Ziel im Hinterkopf, war ich an einem nebelfeuchten Herbstmorgen vom heimatlichen Cape Cod aus aufgebrochen und steuerte mein Auto gen Süden, zuerst in Richtung New York und dann vorbei an Washington, D.C. Auch als die Sonne längst untergegangen war, fuhr ich noch weiter und erreichte bei Dunkelheit Front Royal, Virginia. Es war Oktober. Ich wollte in den Tiefen Süden, hatte also noch eine lange Strecke vor mir. Doch ich kannte schon den angenehm tranceartigen Zustand, der sich auf langen Autofahrten einstellt – die Highway-Hypnose, das Fixiertsein auf die weißen Markierungen am Fahrbahnrand bei längeren, wenig befahrenen Abschnitten: das Satori der freien Strecke, wenn aus dem gewöhnlichen Autofahren ein höherer spiritueller Pfad wird.
Normalerweise war ich vor dem Aufbruch zu einer längeren Reise immer auch ein bisschen nervös. Doch diesmal empfand ich nichts als Freude und Ungeduld, endlich zu starten. Kein Reisepass, keine Sicherheitskontrollen, keine feste Abflugzeit, keine Warteschlangen. Mit diebischem Vergnügen tat ich ein Klappmesser in meine Reisetasche. Außerdem nahm ich reichlich Lektüre mit. Dazu ein Zelt samt Schlafsack, für alle Fälle. Ich leerte den Kühlschrank und packte einen Proviantvorrat zusammen – Saft und hartgekochte Eier, eine Dose mit selbstgekochtem Chili, Käse, Obst und ein paar Weinflaschen.
Ehe ich mich versah, erreichte ich den Tiefen Süden, weil es schlichtweg so großen Spaß machte, mit dem eigenen Auto unterwegs zu sein. Ich genoss die Freiheit, vorab keine großen Pläne machen zu müssen, denn nur in Amerika kann man ganz unbesorgt ins Blaue fahren: Jedes noch so unbedeutende Städtchen besitzt eine Übernachtungsmöglichkeit – in der Regel etwas außerhalb gelegen, zumeist ein heruntergewirtschaftetes Motel – und ein Lokal, in dem man etwas zu essen bekommt – im besten Fall einen Soul-Food-Imbiss mit traditionell-afroamerikanischer Küche, vermutlich jedoch eine Filiale einer Fastfood-Kette wie Hardee’s, Arby’s, Zaxby’s oder Lizard’s Thicket. Oder es gibt einen eigenständigen Hähnchengrill, wo es zwar penetrant nach Bratfett riecht, man jedoch freundlich empfangen wird. Typischerweise waren es kleinere Läden, wo in einer Theke das Tagesangebot ausgestellt war: Fisch, Geflügel, Burger, Kartoffeln oder sogar frittierte Pies – einfache Gerichte für jedermann. Große Städte oder Küstenorte mied ich. Stattdessen konzentrierte ich mich auf die Region Lowcountry, den Black Belt, das Mississippi-Delta, das Hinterland und die Provinzorte.
Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2012 ging es in den Debatten der Kandidaten immer wieder um die amerikanische Mittelschicht und wie sehr sie unter Druck stehe, viel zu hoch besteuert werde und unter Schulden und Unsicherheit leide. Alle Kandidaten legten dar, wie sie diese Klasse retten wollten, und warben um deren Stimmen. Auf dem Weg nach New Jersey hörte ich im Radio, dass fünfzehn Millionen Amerikaner in Armut lebten, von denen die wenigsten dort wohnten, wo ich zu Hause war, sondern überwiegend in der Region, die ich gerade ansteuerte. Sechzehn Prozent der Amerikaner gelten offiziell als arm. Im Süden sind es hingegen zwanzig Prozent. Hier gibt es Gegenden, wo die Schere bei den Einkommen heute weiter auseinanderklafft als je zuvor in der Geschichte. Die Präsidentschaftskandidaten sagten nicht, dass sie die Armen retten wollten.
»Das Wort ›arm‹ wird vermieden«, sagte mir ein Sozialarbeiter zu Beginn meiner Reise in Alabama, »denn ›arm‹ ist ein anderes Wort für ›schwarz‹«.
Ich war gespannt auf die Armen im Süden. Es ist unmöglich, die Landstraßen im Süden zu befahren, ohne regelmäßig in Kontakt mit der amerikanischen Unterschicht zu kommen. Zu meiner Reise war ich aus den üblichen Gründen aufgebrochen: weil ich ruhelos und neugierig war und Gegenden besuchen wollte, die ich noch nicht kannte. Wenn wir reisen, dann tun wir dies aus Vergnügen; um mit einem »Ich bin dann mal weg« die Tür zuzuschlagen; aus Lust auf einen Luftwechsel; zur Erbauung; um damit prahlen zu können, was wir alles gesehen haben; weil es uns vielleicht verändert und wir ganz voyeuristisch ein bisschen Exotik betrachten wollen.
»Du bist doch schon überall gewesen«, bekomme ich immer wieder zu hören, aber das ist lächerlich. Ja, ich hatte Patagonien, den Kongo und den indischen Bundesstaat Sikkim bereist, aber als Amerikaner kannte ich die landschaftlich schönsten US-Bundesstaaten noch nicht und war noch nie in Alaska, Montana, Idaho oder den beiden Dakotas gewesen, und von Kansas und Iowa hatte ich bisher auch nur einen ganz flüchtigen Eindruck bekommen. Und der Tiefe Süden war mir noch gänzlich fremd. Ich möchte diese Staaten kennenlernen und erleben, nicht einfach nur dort einfliegen, sondern sie mir langsam, über abgelegene Straßen erschließen und mich über gängige Regeln hinwegsetzen – wie zum Beispiel der Regel, nie in Restaurants zu essen, die »Mom’s« im Namen führen, oder mit jemandem Karten zu spielen, der sich »Doc« nennt …
Nichts ist für mich aufregender, als sehr früh am Morgen zu Hause aufzustehen, in mein Auto zu steigen und loszufahren – auf eine lange, verschlungene Reise durch Nordamerika. Ich kann mir nur wenig Schöneres vorstellen, als gänzlich frei zu sein beim Reisen – ohne Körperscan, Reisepass, Flughafengewirr, sondern einfach mit quietschenden Reifen davonzufahren und eine Staubwolke zu hinterlassen. Lange, mehr oder weniger improvisierte Fahrten mit dem Auto quer durchs Land sind etwas durch und durch Amerikanisches. Diese Tradition ist mit dem Aufkommen zuverlässiger Kraftfahrzeuge zu Beginn des vorigen Jahrhunderts entstanden.
Die erste Fernstraße, die sich durch das ganze Land zog, war der 1913 eröffnete Lincoln Highway. Diese Verbindung zwischen New York und San Francisco ist eine Nationalstraße, die aus etlichen, von Osten nach Westen verlaufenden Straßen »zusammengestückelt« ist. Sie war kein staatliches Projekt, sondern ein Vorhaben, das von privaten Geschäftsleuten vorangetrieben wurde. Diese Männer, die allesamt mit der Automobilindustrie in Verbindung standen, wurden von Carl G. Fisher koordiniert, der in Indianapolis Autoscheinwerfer herstellte (er errichtete außerdem die Rennstrecke Indianapolis Speedway). Um etwa die gleiche Zeit entstand auch eine durchgängige Nord-Süd-Verbindung. Scott und Zelda Fitzgerald unternahmen darauf 1920, drei Monate nach ihrer Hochzeit, eine viel beachtete Fahrt in einem Sportwagen der Marke Marmon, Baujahr 1918, und fuhren damit von Connecticut nach Alabama. Scott schrieb darüber sein launiges Buch The Cruise of the Rolling Junk, eine der ersten amerikanischen Beschreibungen einer Autoreise.
Viele weitere sollten folgen. Die wichtigsten Autoren sind Henry Miller, Kerouac, Steinbeck und William Least Heat-Moon mit Blue Highways. Die Autofahrten, die Vladimir Nabokov mit seiner Frau am Steuer durch ganz Amerika unternahm, mündeten in Lolita, einem Roman, der im Übrigen ebenfalls als Roadtrip angelegt ist. The Dog of the South von Charles Portis ist einer der ganz großen Romane über eine Autofahrt quer durch Amerika, die in Arkansas beginnt und in Honduras endet. Es geht um eine wilde Tour, die ausgesprochen unterhaltsam geschildert wird und auch kluge Einsichten liefert, beispielsweise wenn der Autor feststellt, dass das einsame Fahren gelegentlich einer spirituellen Erfahrung gleiche.
Seitdem es Kraftfahrzeuge gibt, gibt es auch Erzählungen über Autofahrten, nicht nur in Amerika. Rudyard Kipling gehörte zu den ganz frühen Autofahrern. 1910 kaufte er sich einen Rolls-Royce und ließ sich damit von seinem Chauffeur durch ganz England kutschieren, während er sich dabei Notizen machte. Die amerikanische Schriftstellerin Edith Wharton war eine enthusiastische Autobesitzerin – sie unternahm ihre erste Fahrt im Jahr 1902, kaufte sich 1904 einen Panhard & Levassor und später einen schwarzen Pope-Hartford. Im ersten Satz ihres Buches Frankreichfahrt stellt Edith Wharton fest, dass durch das Automobil das Reisen wieder romantischer geworden sei. Genau wie Kipling hatte sie einen Chauffeur, und häufig nahm sie ihren unverheirateten Freund Henry James mit. James liebte ihre Autos und bezeichnete die neueste Anschaffung als »vehicle of passion«.
Colm Tóibín schrieb in der Vogue über sein Buch Porträt des Meisters in mittleren Jahren, dass James sie verehrte und ihre Energie bewunderte. Während einer Hitzewelle bei einem seiner Aufenthalte in ihrem Haus (The Mount genannt) in Massachusetts fand er nur Erleichterung, wenn sie ununterbrochen mit dem Auto unterwegs waren. Täglich fuhren sie meilenweit durch die Landschaft, die von der Hitze wie erstarrt war, berichtet Edith Wharton. Diese Fahrten erfrischten ihn und hoben seine Stimmung.
Während sich die Straßen in Amerika allesamt gleichen und frei von Hindernissen sind, unterscheiden sich die hiesigen Orte und Menschen erheblich voneinander und sorgen für andere Probleme. Die Straßen sind im Allgemeinen mühelos zu bewältigen, selbst wenn sie viel befahren sind. Dadurch haben die unvermittelten Ankünfte und Begegnungen manchmal etwas leicht Surrealistisches an sich: Ich fahre zu Hause auf Cape Cod los, wo mir alles so unendlich vertraut ist, und finde mich am Ende des Tages noch immer auf der gleichen Straße in einer gänzlich anderen Umgebung wieder, unter Menschen, die zwar durchaus freundlich, aber auch ein wenig reserviert sind.
In Afrika, China, Indien und Patagonien scheinen die Einheimischen immer sehr dankbar zu sein, wenn Fremde bei ihnen auftauchen. Das macht Reiseberichte in der Regel spannend und lebendig. Doch in den Vereinigten Staaten veranlasst der Besuch eines Mitbürgers niemanden, besondere Gastfreundschaft an den Tag zu legen oder die arabische Grußformel »Salam aleikum ya dayf al-Rahman! – Friede sei mit dir, Gast des Barmherzigen!« – beziehungsweise die Hindi-Variante »Willkommen! Atithi devo Bhava! Der Gast ist Gott!« auszusprechen.
Stattdessen wird man vielfach skeptisch, feindselig oder gleichgültig empfangen. Dadurch ist es in den USA manchmal schwieriger, Kontakte zu knüpfen, und die Menschen sind oft verschlossen und misstrauisch, sodass ich mich hier manchmal fremder fühle als an weit exotischeren Orten, die ich in meinem Leben schon besucht habe.
Die unsichtbaren zwanzig Prozent
Ich reiste mit großer Neugier in den Süden, weil ich bisher nur selten dort gewesen war und denkbar wenig darüber wusste. Es ist allgemein bekannt, dass es in den schöneren Ecken der Südstaaten durchaus Reichtum, Eleganz, wohlhabende Städte und Unbeschwertheit gibt, weitläufige Anwesen, Pferdefarmen, gehobene Gastronomie, noble Vororte und einige der gefragtesten Immobilien in ganz Amerika.
Doch das ist der alte Süden, den man auch als »Old Magnolia South« bezeichnet. Nicht weit davon und doch Welten entfernt, gibt es Hunger, Elend und enorme Armut. Denn in diesen sonnenverwöhnten Staaten befinden sich zugleich auch die ärmsten Gegenden Amerikas. Statistiken besagen, dass etwa zwanzig Prozent unterhalb der Armutsgrenze leben. Es ist ein Paradox, dass diese Menschen in den schönsten Gegenden des Südens zu Hause sind: auf dem Land, im Lowcountry von South Carolina, im Black Belt von Alabama, im Mississippi-Delta, auf dem Ozark-Plateau in Arkansas. Die Armen dort sind (wie ich feststellen sollte) auf ihre eigene Weise ärmer, schlechter gestellt und verzweifelter als viele Menschen, die ich auf meinen Reisen in den notleidenden Regionen Afrikas und Asiens traf. Sie leben im abgeschiedenen Hinterland, in nicht mehr intakten Gemeinschaften, sterbenden Städten und wirklich am Rand der Gesellschaft.
Die ärmeren Amerikaner, die mit sehr wenig auskommen müssen, legen großen Wert auf ihre Privatsphäre – sie ist in vielerlei Hinsicht das Letzte, was ihnen geblieben ist, und das wollen sie sich keinesfalls auch noch nehmen lassen. Dies ist eine Herausforderung für den Reisenden, der gern erfahren möchte, was Menschen tun, wenn sie auf den ersten Blick nichts tun.
Der Reisende erschließt sich gewissermaßen das Land, indem er eine ganz eigene Fahrtroute wählt. Doch was er unterwegs erlebt, kann der wahrhaftig Reisende nicht erfinden, und diese Erfahrungen bilden ja den Stoff seiner Erzählung. Viele Bücher sind geschrieben worden über die augenfälligen Reize des Südens. Ich habe mir jedoch angewöhnt, die pulsierenden Städte mit ihren offenkundigen Annehmlichkeiten links liegenzulassen und lieber weiterzufahren in kleinere Städte und Provinznester, um den unsichtbaren zwanzig Prozent zu begegnen.
Inder im Süden
Die Straße, die aus Fort Royal hinausführt (»Gibt nur die eine«), führt mit einem Schlenker über den Skyline Drive (»Is nich zu verfehlen«) durch den Shenandoah National Forest. Die Fahrt ist an diesem sonnigen Herbsttag besonders schön und spektakulär. Das welke Laub leuchtete in Rot- und Gelbtönen und wehte wie kleine Stofffetzen über die schmale, kurvenreiche Straße oben auf dem Bergkamm, von dem aus man das rund neunhundert Meter tiefer gelegene Tal überblicken konnte – und ich musste an den Großen Afrikanischen Grabenbruch denken.
Wenn Amerikaner auf Reisen waren, stellen sie nach ihrer Heimkehr unweigerlich Vergleiche an. Bilder aus Ostafrika gingen mir durch den Kopf, als ich gemächlich an New Market, an Harrisburg und Wytheville vorbeifuhr. Mir fielen die Dornenbäume, das Hochland, die Dörfer und die Inder ein, die überall in Ostafrika als Ladenbesitzer und Kleinhändler ihren Lebensunterhalt verdienten und dukawallahs genannt wurden. Aber der Große Grabenbruch, in jüngerer Zeit Schauplatz von blutigen Stammesmassakern und daher Ansiedlungsort von Flüchtlingsdörfern, wirkte im Vergleich zu dieser majestätischen Landschaft geradezu klein und unscheinbar.
Bestens gelaunt fuhr ich den ganzen Tag durch diese golden leuchtenden Berge mit dem herabfallenden Laub und dem angenehmen Mulchgeruch, der durch das Fenster hereindrang.
Bei Einbruch der Dämmerung betrat ich in Bristol, im südöstlichsten Zipfel von Virginia am Rand der Appalachen, den Eingangsbereich eines einfachen Motels, wo mir eine Räucherstäbchen-Wolke entgegenschlug, die einen starken Currygeruch nur teilweise überdeckte. Genauso roch es in Indien überall und in jedem indischen duka (oder Laden) in Afrika ebenfalls.
»Ja, bitte?«
Ein kleiner Mann kam mit gerunzelter Stirn durch den Perlenvorhang, der an der nach hinten führenden Tür angebracht war – auch eine indische Reminsizenz. Ihn umgab eine exotische Duftwolke, die ihre ganz eigene Geschichte erzählen könnte, denn hinter dem Vorhang brachte man mit Duftstäbchen den Göttern ein Rauchopfer dar, womit sich zugleich andere Gerüche überdecken ließen. Die Räucherstäbchen waren allerdings so intensiv, dass einem die Augen davon brannten.
In einer ansonsten von Schwarzen und Weißen geprägten Gegend machte dieser Mann besonderen Eindruck auf mich, denn er war der erste Inder, den ich im Süden traf. Er trug einen Stirnpunkt und war der Besitzer des Motels. Tankstellen, Gemischtwarenläden und Motels sind fest in indischer Hand, und dieses hier war lediglich das erste von vielen weiteren auf meiner Reise. Hinter vorgehaltener Hand erzählt man sich, dass die Weißen diese Geschäfte aus Trotz an Inder verkauft haben, um sie nicht in die Hände von Schwarzen zu geben. Ich habe Hunderte von Indern getroffen, die fast alle aus dem Bundesstaat Gujarat in Westindien stammten und zumeist erst vor kurzem eingewandert waren.
Er hieß Mr Hardeep Patel und kam aus Surat in Gujarat. Gujaratis, die von den Punjabis geringgeschätzt werden, sind einfache Inder, die in Ost- und Zentralafrika als Kleinhändler tätig sind, in Großbritannien kleine Läden und Postagenturen an Hauptstraßen betreiben und im Süden der USA eben Motels. Mr Patel war zunächst nach Kanada ausgewandert, dort einige Jahre geblieben und dann über die Grenze in die USA gekommen. Spontan würde man denken: Der arme Mann, der hier ganz allein sein Unternehmen am Laufen halten muss! Aber in der Regel erfährt man von ihnen sehr schnell, dass sie mit sämtlichen anderen Gujaratis – den Patels, den Desais und den Shahs – in der Stadt oder im Viertel verwandt sind.
»Ich kannte ein paar Leute hier, andere Inder, die schon Motels hatten. Die haben mir geholfen.«
»Gibt es in Bristol Inder?«
»Fünfzehn Familien.« Interessant: Er sprach nicht von Einzelpersonen, sondern von Familien, der wichtigsten gesellschaftlichen Einheit in Indien.
Am Morgen, nachdem die sieben oder acht Zimmer des »Budget Inn« geräumt waren, sah ich Mr Hardeep Patel, wie er höchstpersönlich einen Wäschewagen von einem Raum zum nächsten schob und mit Bettwäsche und benutzten Handtüchern belud. Auch nach fast vierzig Jahren putzte er offenbar immer noch selbst und hatte – zumindest an diesem Morgen – keine Bediensteten, die ihm dabei halfen. War das ein Anzeichen dafür, dass seine Geschäfte schlecht liefen und Mr Patel chronisch knapp bei Kasse war? Nein, vermutlich war es eher die Erklärung für den Lexus, der vor seiner Tür parkte.
In den Südstaaten gibt es noch eine weitere Gruppe von Einwanderern. Einige Jahre lang gab es für indische Ärzte eine schnelle Möglichkeit, ein US-Visum zu bekommen, wenn sie sich bereit erklärten, in den ärmeren Gegenden Amerikas tätig zu sein (die offiziell als unterversorgt eingestuft sind). Dieses Programm heißt inzwischen »National Interest Waiver«.
In diesem Rahmen wurden seit den neunziger Jahren Tausende Visas bevorzugt erteilt. Doch was die Betreffenden im Nachhinein taten, wurde nie überprüft. Viele dieser Visas wurden im US-Konsulat von Madras ausgestellt, und zwar an Ärzte im Bundesstaat Tamil Nadu und auch in Hyderabad, im angrenzenden Andhra Pradesh – in der Annahme, dass die Empfänger einige Jahre in einer bestimmten Region der USA, wo großer Bedarf bestand, tätig sein würden. Dies galt insbesondere für die Appalachen.
Nicht lange nach Einführung dieses Programms entwickelte sich eine spezielle Form des Visa-Betrugs: Viele dieser indischen Ärzte beantragten bei den Einwanderungsbehörden Arzthelfer für ihre Praxen, die als befristete Arbeitskräfte sogenannte H1B-Visas bekamen. Diese angeblichen Arzthelfer waren jedoch zweifelsohne selbst Ärzte, die an einer US-Staatsbürgerschaft interessiert waren. Im Verlaufe des Antragsverfahrens wurden mehrere Hinweise auf einen Betrug festgestellt und anschließend ein regelrechter Betrugsring aufgedeckt.
Weder das Arbeitspensum noch die Einnahmen der Ärzte in den Appalachen rechtfertigten den Bedarf an solchen Hilfskräften. Viele von den eingereisten Ärzten (überwiegend aus Hyderabad und vielfach in den systematischen Betrug verwickelt) landeten zwar in den Appalachen, zumindest für ein paar Jahre, wechselten dann aber in lukrativere Praxen im eher städtischen Raum – entweder ganz offiziell oder auf undurchsichtigen Wegen.