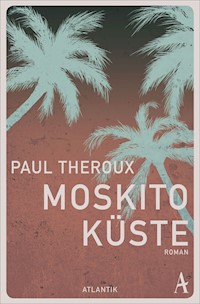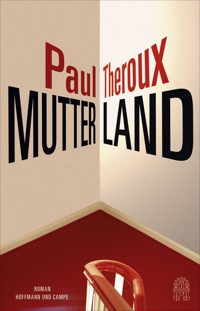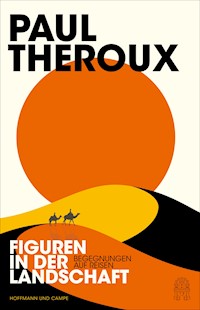
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sammlung der jüngsten Essays des großen amerikanischen Autors: In seinen Reiseessays teilt er mit uns unerwartete, absolut nicht googelbare Einblicke in Länder wie Ecuador oder Simbabwe. In Theroux' Schriften zur Literatur blicken wir auf ungekannte Seiten vermeintlich bekannter großer Köpfe wie Graham Greene, Joseph Conrad und Henry David Thoreau ganz neu kennen. Schillernde Porträts lassen uns mit Elizabeth Taylor in einem Helikopter Kurs auf Michael Jacksons Neverland Ranch nehmen, mit Oliver Sacks surfen oder einer Domina in Manhattan bei ihrer tagtäglichen Arbeit begegnen. "An Theroux' Werk muss sich alle Reiseliteratur messen." The Observer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 827
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Paul Theroux
Figuren in der Landschaft
Begegnungen auf Reisen
Aus dem amerikanischen Englisch von Cornelius Reiber
Hoffmann und Campe
Der HERR aber antwortet mir und spricht: Schreib das Gesicht und male es auf eine Tafel, daß es lesen könne, wer vorüberläuft!
Habakuk 2,2
Einleitung
Studie für Figuren in der Landschaft
Ich bin Romanschriftsteller, und nur gelegentlich Essayist oder Chronist meiner Reisen. Wie gerne wäre ich dazu fähig, die Schneckenspur meiner Schriftstellerei zu beschreiben – diese tastende innere Reise voller Fehlstarts und frustrierenden und dann wieder bezaubernden Momenten –, ohne großspurige Vagheiten und absurde Scheinheiligkeiten zum Besten zu geben. Schon diese Zeilen klingen prätentiös und unangenehm, Sie sehen also das Problem.
Wenn ich die maßlose Eitelkeit so verabscheue, mit der andere Schriftsteller in Abstraktionen über ihr Werk sprechen, warum sollte ich es dann selbst tun? Ich sehe Leute lieber gute Literatur schreiben, als mir ihre stöhnenden Berichte darüber anzuhören, wie sie es gemacht haben. Wenn Schriftsteller darüber klagen, wie hart das Schreiben ist, sich über ihr Leid auslassen, weiß wirklich jeder, dass das, was sie sagen, Unsinn ist. Verglichen mit einem richtigen Beruf, wie in einem Bergwerk oder der Gastronomie, als Feuerwehrmann oder Ananaspflücker, ist Schreiben der Himmel.
Außerdem bin ich von der großen, nagenden Angst vieler Schriftsteller besessen, dass ich, wenn ich das Handwerk der Romanschriftstellerei allzu genau analysieren würde, vielleicht nie wieder ein Wort zu Papier brächte. Also lieber gar nicht erst darüber schwadronieren. Jeder Schriftsteller muss das Geheimnis des Schreibens in sich selbst finden. Leid kann hilfreich sein, Durcheinander auch, so wie auch die Liebe zu Büchern und das Verlassen der Heimat. Ich bin mit der Vorstellung groß geworden, die der Reiseschriftsteller Norman Lewis so treffend ausgedrückt hat: »Je weiter ich von zu Hause weg war, desto besser würde es sein«, und es erwies sich auch als wahr.
Aber wenn das Schreiben von Romanen ein Ritual im Dunkeln ist, obskur und so ungreifbar, dass man kein Wort von dem versteht, was man geschrieben hat, bis man fertig ist, erfordern andere Arten des Schreibens einen einfacheren und praktischeren Ansatz.
Reiseschriftstellerei: Dazu kann ich was sagen. Für die habe ich bestimmte Richtlinien. Die erste ist: Reisen Sie so inoffiziell wie möglich.
Die Gefahren offizieller Reisen und Besuche sieht man überall. Nichts auf der Welt ist irreführender als der gesponserte Besuch, die Pressereise, der Pressepool, die Pressemappen, die Informationsreise. Der Subtext des offiziellen Besuchs ist immer tendenziös, und es sind Faulheit, Selbstherrlichkeit und Gier, die den Besucher dazu bringen, solchen Einladungen zu folgen und die Lügen zu schlucken. Der einzige Sinn des roten Teppichs besteht darin, den Besucher zu blenden und die Wahrheit zu verschleiern.
»Uganda macht sich großartig«, sagte Präsident Clinton zu mir bei einem Treffen, als ich ihm erzählte, dass ich dort herumgereist war.
»Nein, überhaupt nicht«, sagte ich. »Die Regierung ist korrupt. Die Opposition wird unterdrückt und verfolgt. Das Leben im Busch ist schwieriger als in den 1960ern, als ich dort Lehrer in Kampala war. Und wie gesagt, ich war vor einem Monat dort.«
»Hillary war gerade da.« Der Präsident lächelte über meine Unwissenheit. »Dem Land geht es gut.«
Und daraufhin musste ich dann lächeln.
»Für wen halten Sie sich, solche schrecklichen Dinge über den Iran zu sagen? Sie lügen!«, brüllte mich Marion (Mrs. Jacob) Javits im August 1975 in den Kulissen des NBC-Fernsehstudios in New York City an, kurz nachdem ich mein erstes Reisebuch, Basar auf Schienen, veröffentlicht hatte. Der Iran sei ein stabiles, prosperierendes und gut regiertes Land, sagte sie. Wirklich?
Ich war mit dem Zug und dem Bus durch das ganze Land gereist, von West nach Ost, und in der heiligen Stadt Meschhed gelandet. Ich hatte nichts als Geschichten von Folter, Unterdrückung und Tyrannei von sehr wütenden Iranern gehört, die davon sprachen, den Schah loswerden zu wollen. Es stellte sich heraus, dass Frau Javits eine bezahlte Beraterin der iranischen Regierung war, und ihr Ehemann, der US-Senator Jacob Javits, gerne iranische Empfänge besuchte und den dort gereichten Kaviar genoss, auf Einladung des Schahs, der vier Jahre später gestürzt wurde.
»Kein Schicksal ist so ungewiss wie das der Reisebücher«, schrieb Joseph Conrad in seinem Vorwort zu Richard Curles Into the East. »Sie sind das angreifbarste aller literarischen Erzeugnisse. Der Mann, der ein Reisebuch schreibt, liefert sich mehr als jeder andere in die Hände seiner Feinde.«
In meinem 1988 erschienenen Buch über meine Reisen durch China, Riding the Iron Rooster (nennen Sie mir einen beliebigen Zug in China, ich bin mit ihm gefahren), schrieb ich, dass die chinesische Polizei, die bewaffnete Volkspolizei und die »Friedensagenten« aus Chengguan mit Vorliebe Studenten verprügelten. Ich war ein Jahr lang durch China gereist; ich hatte viele Demonstrationen gesehen. Die gängige Meinung im Westen war, dass die chinesische Regierung reformorientiert und tolerant sei. Die Rezensenten zerrissen mein Buch in der Luft. Und nur ein Jahr später fand das Massaker am Tiananmen-Platz statt.
Wahres Reisen und die Recherche des Essayisten bedürfen recht einfacher Kunstgriffe: bescheiden, geduldig, allein, anonym und wachsam sein. Das sind alles keine Eigenschaften, die man für gewöhnlich mit stubenhockerischen Abgeordneten auf einer Inspektionsreise verbindet oder mit Tugendhelden auf der Suche nach Ländern, die sie mit ihrer Wohltätigkeit und ihren Lebensmittelgeschenken beglücken können, oder mit Journalisten, die über hochrangige Treffen berichten – die allesamt hauptsächlich auf den ausgerollten Teppich aus sind.
Für mich als wohlhabenden, älteren, halbwegs bekannten Schriftsteller, der es sich leisten kann, Erster Klasse zu fliegen, schöne Autos zu mieten und in guten Hotels zu übernachten, ist es besonders wichtig, dass ich in alten Kleidern, mit kleinem Budget, in einem Bus oder mit dem Zug oder auf einem Viehtransporter reise. Mein Element (und seit Herodot der Stoff, aus dem die Reiseberichte sind) ist die Begegnung mit gewöhnlichen Leuten. Als ich 2001 in Afrika war, erfuhr ich so gut wie nichts Interessantes von Politikern, aber sehr vieles durch meine Gespräche mit Lastwagenfahrern, Wanderarbeitern, Prostituierten und Bauern. Auch Schriftsteller sind eine Quelle der Inspiration, besonders wenn sie Teil einer bestimmten Landschaft zu sein scheinen. In Buenos Aires suchte ich Jorge Luis Borges auf, in Tanger Paul Bowles, in Brasilien Jorge Amado, in der Türkei Yaşar Kemal und später Orhan Pamuk. Auf meinen Reisen durch Afrika verbrachte ich in Ägypten Zeit mit Nagib Mahfuz und in Johannesburg mit Nadine Gordimer. Das gesamte Genre der Reiseliteratur und vieler Reise-Essays scheinen mir treffend in dem Titel des rätselhaften Gemäldes von Francis Bacon Studie für Figuren in einer Landschaft zusammengefasst.
Ich genieße den Komfort ebenso wie jeder andere Reisende. Und niemand weiß ein zurückgezogenes Leben mehr zu schätzen als ein Schriftsteller – und empfindet weniger Freude am eitlen Schwarm, wo Jugend herrscht und Gold und sinnlos Prunken. Kommt Ihnen bekannt vor? Es sind die Worte des Herzogs in Shakespeares Maß für Maß, und Reiseschriftsteller tun gut daran, sie sich zu Herzen nehmen. Um herauszufinden, was in seinem Herzogtum wirklich vor sich geht, sagt der Herzog, müsse er in eine bescheidene Verkleidung schlüpfen, wie das Gewand eines Mönchs, um »sowohl Fürst als auch Volk zu besuchen«.
Auch von Harun al-Rashid, Kalif von Bagdad im 8. Jahrhundert, kann man lernen. Der Kalif verkleidete sich regelmäßig als Mann aus dem Volk und ging dann auf den Markt, um zu sehen, wie die Menschen lebten, welche Sorgen sie hatten, was sie beschäftigte, worauf sie stolz waren. Die großen Reisenden der Vergangenheit unternahmen ihre Wanderungen in einem ähnlichen Entdeckergeist – die mittelalterlichen Mönche, die nach China kamen, die japanischen Bettelmönche, die wandernden Tagebuchschreiber, die der französische Historiker Fernand Braudel in meinem Lieblingsbuch Sozialgeschichte des 15.–18. Jahrhunderts: Der Alltag so ausführlich zitiert. Offizielle Reisen zeigen Ihnen nicht, wie die Welt aussieht; inoffizielle Reisen, bei denen Sie die Leute belauschen und beobachten, hingegen schon.
Den Weg von Kairo nach Kapstadt, als ich für mein Buch Dark Star Safari durch Afrika reiste, legte ich mit Bussen, Lastwagen, Fähren, Kanus und Zügen zurück. Ich hatte keinen Namen; ich war nie jemand Besseres. Manchmal war ich Effendi oder Faranji, aber überall im suahelisprachigen Afrika war ich Mzee – Papa, Opa –, so wie ich es wollte, ein anonymer älterer Mann. Natürlich ist das Alleinreisen mit Risiken verbunden, aber es hat auch enorme Vorteile. Als amerikanischer Reisender ist man ohnehin privilegiert, aber mir ist schleierhaft, wie es möglich sein soll, ein Land wirklich zu verstehen, ohne seine Kehrseiten, sein Hinterland, sein Alltagsleben zu sehen. Nicht Bürokraten in Büroräumen, sondern Figuren in der Landschaft.
Der aufschlussreichste Teil eines Landes, und besonders eines afrikanischen Landes, ist seine Grenze. Jeder kann am Flughafen einer Hauptstadt ankommen und sich von der Modernität dort täuschen lassen, aber es braucht schon einen gewissen Mut, um mit dem Bus oder dem Zug an die Grenze zu fahren, immer das Gebiet der Vertriebenen und Verarmten, der Menschen, die versuchen, das Land zu verlassen oder hineinzugelangen, der Fluch der Bürokratie. Die Zoll- und Einwanderungsbeamten an den Grenzübergängen sind zwar nicht für ihre freundliche Art bekannt, aber sie sind repräsentativer für das Leben vor Ort als die Leute, die Sie am internationalen Flughafen der Hauptstadt mit einem breiten Lächeln in Empfang nehmen.
Wenn Sie inoffiziell unterwegs sind und auf Reisen improvisieren, worauf können Sie dann zurückgreifen? Auf Ihren Mut, sonst nicht viel. Sie gehen hin und hoffen auf das Beste. Den weisesten Ratschlag für Reisen habe ich von einem Strandgutsammler in Australien, der dort campte und vorhatte, die Halbinsel Cape York zu umsegeln. Mit einem größeren Schiff wäre das eine haarsträubende Tour, sein Plan war aber, die Fahrt mit einem kleinen selbstgebauten Floß zu machen. Er hatte keinen Zweifel daran, dass er die starke Strömung und die starken Winde der Torres-Straße überleben und vielleicht sogar nach Papua-Neuguinea weiterfahren würde.
»Meiner Erfahrung nach«, sagte er, »kann man fast alles machen und fast überall hingehen, wenn man nicht in Eile ist.«
Mir scheint, dass alle guten Ratschläge, die ich jemals erhalten habe, von Menschen kamen, die nichts als den Wunsch haben, in Bewegung zu sein – Optimisten allesamt. Als ich 1992 für mein Buch Die glücklichen Inseln Ozeaniens auf Reisen und mit einigen Fischern auf einem Auslegerkanu bei den Trobriand-Inseln unterwegs war, sagte mir der Steuermann, dass er auf der Suche nach Fisch Hunderte von Meilen aufs Meer hinausfuhr.
»Der Ozean sieht wie eine einzige geschlossene Wasseroberfläche aus, aber das stimmt nicht«, sagte er. »Es gibt überall Felsen und kleine Inseln, an denen man sein Kanu festmachen und wo man die Nacht verbringen kann.«
Das Reisen besteht zu einem Großteil aus Scherereien und Verzögerungen, was keinen Leser interessiert. Ich tue mein Bestes, um auf eine Reise gut vorbereitet zu sein. Ich erkundige mich nur selten nach Namen von Leuten, die man vor Ort aufsuchen sollte.
Vorsicht und Improvisationstalent sind nützlich für den Reisenden, da er dauernd daran erinnert wird, dass er ein Fremder ist, und entsprechend wachsam und einfallsreich werden muss. Bevor ich mich auf den Weg mache, studiere ich gründlich die detailliertesten Karten, die ich finden kann, und lese alle Low-Budget-Reiseführer. Geld zu haben ist von Vorteil, aber Zeit ist wertvoller. Abgesehen von einem kleinen Kurzwellenradio trage ich keine Hightech-Gegenstände mit mir herum – mittlerweile zusätzlich noch ein Telefon, niemals eine Kamera oder einen Computer, nichts Zerbrechliches oder Unersetzliches. In Südafrika wurde mir meine Tasche gestohlen, und fast alles, was ich besaß, war weg: eine gute Lektion. Ich hatte aber immer noch meine Notizen. Wer stiehlt schon Notizbücher?
Das Schreiben also. Ich habe ein Notizbuch im Taschenformat dabei und kritzle es den ganzen Tag lang voll. Abends übertrage ich diese Notizen in ein größeres Tagebuch und ordne den Tag zu einer Erzählung. Ein durchschnittlicher Eintrag für einen Tag beträgt etwa tausend Wörter, manchmal weniger, oft mehr. Wenn ich unterwegs die Möglichkeit habe, fotokopiere ich die Seiten, etwa vierzig oder fünfzig auf einmal, und schicke sie nach Hause. Bis zum Ende einer Reise habe ich ungefähr sieben oder acht Notizbücher vollgeschrieben, die die Grundlage für das Buch bilden. Wenn ich jemanden für ein literarisches Porträt interviewe, insbesondere wenn es eine potenziell klagefreudige Person ist, lasse ich ein Aufnahmegerät laufen, während ich die Antworten zusätzlich in ein Notizbuch schreibe, um später die wichtigen Passagen klarer vor Augen zu haben.
Danach transkribiere ich das gesamte Interview eigenhändig vom Band, die langweiligen Passagen lasse ich aus. Ich habe noch nie eine Sekretärin, einen Assistenten oder Rechercheur beschäftigt. Obwohl ich deutlich mehr Romane als Reisebücher geschrieben habe, könnte ich über meine Methode als fiktionaler Schriftsteller nie so genau oder sicher Auskunft geben, falls ich überhaupt eine Methode habe.
Nach Sunrise with Seamonsters (1984) und Fresh Air Fiend (2001) ist Figuren in der Landschaft mein dritter Band mit Essays, insgesamt 134 Essays, über 53 Jahre hinweg geschrieben. In der gleichen Zeit habe ich dazu Romane, Kurzgeschichten und Reisebücher veröffentlicht. Millionen von Wörtern! Was wie Graphomanie oder Furor Scribendi wirken mag, ist aber nicht zwanghafter als der natürliche Drang des durchschnittlichen Künstlers, der sein schöpferisches Leben lang eine Vielzahl von Gemälden und Skizzen anfertigt. Genau wie für einen Maler stellte für mich die Vertiefung ins Schreiben nicht nur eine Möglichkeit dar, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern auch, mein Leben zu ergründen. Ich sehe mich ähnlich wie Ford Madox Ford, der sich in der Widmung zu seinem umfassenden Überblick The March of Literature als »einen alten Mann« beschreibt, »der verrückt ist nach dem Schreiben – in dem Sinne, wie Hokusai sich als einen alten Mann bezeichnete, der verrückt war nach dem Malen«.
Als ich 1971 meinen Job an der Universität von Singapur kündigte, schwor ich mir, nie wieder für einen Chef zu arbeiten oder Memos wie »Institutstreffen am Donnerstag. Seien Sie da« zu befolgen. Ich hatte vier Romane veröffentlicht und arbeitete an einem fünften, Saint Jack. Mir wurde klar: Ich kann kein Teilzeit-Autor sein. Ich muss mich der Sache ganz verschreiben, selbst wenn das heißen sollte, in Armut zu leben.
»Der Wert einer Sache bemisst sich danach, was man dafür aufgeben würde, sie zu besitzen.« Dieser aphoristische Satz aus dem Roman The Secret Books meines Sohnes Marcel drückt auf elegante Weise aus, wie ich mich vor sechsundvierzig Jahren gefühlt habe, als ich die Sicherheit meiner Anstellung, eine mögliche Rente, ein gewisses Prestige und ein festes Monatsgehalt für die prekäre Existenz in einer kleinen, schlecht beheizten Steinhütte in einer abgeschiedenen Gegend von Dorset in England aufgab. Die erste Version von Saint Jack wurde dort glücklich fertiggestellt.
Die Notwendigkeit lehrte mich, dass ich meine Rechnungen auch durch Auftragsarbeiten bezahlen konnte: Buchbesprechungen, Reiseberichte, Porträts bekannter und unbekannter Leute. Anthony Burgess schrieb einmal: »Ich lehne keinen vernünftigen Auftrag ab, und nur sehr wenige unvernünftige.« Burgess, mit dem ich befreundet war und der sich sehr großzügig über meine Arbeit äußerte, ist jemand, mit dem ich mich identifizieren kann, wie mit all den anderen Schriftstellern, die ihre Schriftstellerei durch Aufträge finanziert haben. Graham Greene, V.S. Naipaul, V.S. Pritchett, Jonathan Raban und viele andere Schriftsteller, die ich persönlich kannte, haben als freiberufliche Autoren, als Freelancer begonnen. Mir gefällt der Begriff des »Freelancers«, mit seiner Andeutung von Unabhängigkeit und potenzieller Macht: ein bewaffneter Reiter, der allein durch die Lande zieht, sich gegenüber keinem Ritter zu verantworten hat, aber offen ist für Verhandlungen und bereit, in den Kampf zu ziehen. In Bezug auf seine Romane schrieb Henry James: »Es ist die Kunst, die das Leben schafft, etwas interessant und bedeutend macht, und ich weiß nichts, was die Kraft und Schönheit dieses Prozesses ersetzen könnte.« Doch müssen diese edlen Worte eben auch der Tatsache gegenübergestellt werden, dass James seinen Lebensunterhalt mit Reiseberichten und Rezensionen bestritt.
Als Jonathan Raban 1987 seiner ersten Essay-Sammlung den pointierten Titel For Love and Money gab, lieferte er zugleich das Motto im Wappen der Freelancer. Natürlich nehmen Schriftsteller Aufträge an, um ihre Rechnungen zu bezahlen, denn, wie Dr. Johnson sagte: »Nur ein Holzkopf hat je für etwas anderes als Geld geschrieben.« Aber niemand hat je gut geschrieben ohne die Liebe zum Schreiben.
Ich habe zwar solche offiziellen Förderungen nie erhalten, habe aber auch nichts gegen die Guggenheim-Stipendien, die Fulbright-Preise, das MacArthur-Stipendium oder die Ernennungen zu Stadtschreibern. Nur können sie die Schriftsteller täuschen und betören. Der Glamour und die sozialen Annehmlichkeiten, die mit solchen Auszeichnungen einhergehen, können zu der irrigen Vorstellung führen, dass es der Mäzen ist, der dem Autor Würde verleiht, und nicht sein Werk. Zu den Folgen solcher Förderungen gehören die Selbstgefälligkeit, die Überheblichkeit der Prominenz, das unvermeidliche Händegeschüttel und eine Art Unwirklichkeit. Auffällig bei vielen Schriftstellern in dieser glücklichen Lage ist dazu der Unwille, sich ins Unbekannte zu stürzen. Schlimmer als all das ist jedoch die Verachtung des Freelancers als armem Lohnschreiber – ein Reflex, dem man bei den geförderten, mit Preisen überhäuften Autoren recht häufig begegnet. Alles in allem habe ich dann wohl doch, wenn ich das jetzt so geschrieben vor mir sehe, geringfügige Vorbehalte, was die Literaturförderung betrifft.
Der Freelancer wird von Neugierde geleitet und muss, wenn er ihr folgt, kompromisslos sein, er darf niemals seine schriftstellerische Gabe verraten, indem er schlecht oder in Eile schreibt, oder auf Geheiß des Redakteurs in einem bestimmten Stil. Die Freiheit – zu reisen oder kurzfristig einen Auftrag anzunehmen – ist für ein solches Leben eine unerlässliche Voraussetzung. Wenn Sie sich darauf einlassen, kann aber schon der geringste Anlass eine ganze Kette von Ereignissen auslösen.
Ich wollte zum Beispiel mal den Sambesi mit dem Kajak hinabfahren und hatte mit National Geographic vereinbart, dass ich einen Artikel darüber schreibe. Während der Reise traf ich ein attraktives Paar, das gerade eine Luxus-Safari auf der simbabwischen Seite des Flusses machte. Die Frau trug hohe Stiefel und eine maßgeschneiderte Safarijacke; der Mann war vom Typ Hemingway, bärtig und schroff, und auch er trug stilvolles Khaki. Sie kamen aus New York, und ich hielt sie für Mann und Frau. »Wir bleiben in Kontakt«, sagte die Frau zu mir beim Abschied.
Zurück in den USA rief ich sie an, um mehr über ihre Eindrücke von Afrika zu hören, und erkundigte mich im Laufe des Gesprächs nach ihrem Beruf. »Ich bin eine Domina«, sagte sie. »Der Mann, mit dem ich zusammen war, ist ein Kunde von mir. Ich habe ihm auf der Safari ziemlich oft den Hintern versohlt.«
So traf ich »Nurse Wolf«, die sich bereit erklärte, sich mit mir für den Artikel zu unterhalten, der in diesem Band enthalten ist und im New Yorker erschien. Zugleich ermöglichten mir der Bericht über meine Fahrt auf dem Sambesi und die Gage vom New Yorker, eine noch ehrgeizigere Afrikareise in Angriff zu nehmen, von Kairo nach Kapstadt auf dem Landweg, woraus mein Reisebuch Dark Star Safari hervorging.
Im besten Fall lebt der Freelancer ein Leben voller glücklicher Zufälle. Ein Auftrag für einen Zeitschriftenartikel führte mich 1980 nach China, für eine Kreuzfahrt auf dem Jangtse, was wiederum zu weiteren Aufträgen für Texte über China führte und schließlich zu meiner einjährigen Chinareise für Riding the Iron Rooster. Eine Geschichte über Neuseeland Ende der 1980er Jahre weckte meine Neugier und brachte mich dazu, einige Jahre darauf für Die glücklichen Inseln durch den Pazifik zu reisen und mich später auf Hawaii niederzulassen.
Hin und wieder siegt die Neugier, und ich schreibe etwas auf eigene Faust in der Hoffnung, dass sich eine Zeitschrift dafür interessiert. Nachdem ich viele seiner Bücher gelesen hatte, schrieb ich Oliver Sacks, ob ich ihn zum Mittagessen einladen dürfe, um mit ihm über das Konzept der »Neurologie der Straße« zu sprechen, die Analyse der Störungen zufälliger Passanten auf den Straßen New Yorks. Wir gingen spazieren, und Oliver diagnostizierte die Tics und Zwangsstörungen Fremder. Wir wurden Freunde. Ich machte mir ausgiebig Notizen und schrieb schließlich ein Porträt, das dann auch von einer Zeitschrift veröffentlicht wurde. Meine Texte über Hawaii in diesem Band, über mein Leben in London, über Autobiographien, über Gänsezucht, über meine Erfahrung mit der psychedelischen Droge Ayahuasca, über ein Leben als Leser und die vielen Gastkommentare und Kolumnen habe ich nicht auf Anfrage geschrieben. Den Text über meinen Vater, »Lieber alter Dad«, habe ich im Winter 2007 in der Transsibirischen Eisenbahn geschrieben, als ich neun untätige Tage (und 9289 Kilometer) vor mir hatte. In Wladiwostok fing ich an, meine Erinnerungen an ihn aufzuschreiben, schrieb, während draußen die Birken und kahlen schneebedeckten Weiten vorbeizogen, und war fertig, als der Zug in den Jaroslawler Bahnhof in Moskau einfuhr. Der Essay über meinen Vater führte zu umfassenderen Überlegungen zu meiner Familie und einem Haufen Notizen, die schließlich die Grundlage für meinen Roman Mutterland wurden.
Dann gibt es noch die Texte, die auf die Anfrage oder das Gespräch mit einem Herausgeber oder Redakteur zurückgehen. Solche Vorschläge für Texte, aus heiterem Himmel, haben oft den Vorzug, dass man mit Büchern, mit der Welt, mit komplexen Figuren und eindrucksvollen Landschaften in Kontakt bleibt. Der Herausgeber oder Redakteur fragt an, ob man vielleicht Interesse daran habe, einen Prominenten zu porträtieren oder die Einführung zu einem Buch oder einen Essay über einen Schriftsteller zu schreiben. Wenn es sich um Autoren oder Bücher handelt, die ich bewundere, sage ich zu. Daher die Essays in diesem Buch über Henry David Thoreau, Henry Morton Stanley, Joseph Conrad, Somerset Maugham, Graham Greene, Paul Bowles, Muriel Spark, Hunter Thompson. Ich las Georges Simenons Chez Krull zum ersten Mal als Lehrer in Afrika, las weitere Bücher Simenons und stellte erfreut fest, dass auch er in den 1930ern durch Afrika gereist war (und drei Romane mit afrikanischem Hintergrund geschrieben hatte); dass er durch den Pazifik gesegelt war, in Arizona und Connecticut gelebt und Hunderte von Romanen veröffentlicht hatte. Nachdem ich fünfzig Jahre lang Simenon gelesen hatte, entsprach ich gern der Bitte eines Verlegers, die Einführung zu einer Neuauflage seines Romans Die Witwe Couderc zu schreiben.
Eine der angenehmen Nebenwirkungen des Schreibens über all diese verschiedenen Themen ist, dass man davon ganz gut leben kann, ohne die andere Arbeit beiseitelegen oder vor einer Klasse stehen zu müssen, sich auf Stipendien zu bewerben oder als irgendeine Art von Berater zu arbeiten. Ein weiterer willkommener Nebeneffekt ist, dass solche gelegentlichen Auftragsarbeiten die ermutigende Illusion einer richtigen Anstellung erzeugen, das Gefühl, man sei sehr beschäftigt und habe Arbeit zu verrichten. Die große Furcht eines Schriftstellers ist nämlich, dass das Schreiben so langsam vorangeht, dass es eher eine Art perverses Hobby ist als eine solide Beschäftigung, und schon gar nicht vergleichbar mit einem richtigen Beruf.
Vieles davon gehört einer alten Welt an, mit einem literarischen Leben, das am Verschwinden ist. Vor kurzem habe ich meine Papiere an eine renommierte Bibliothek verkauft; sie schickten einen Lastwagen, um sie abzuholen. Auch das wird zu einem Anachronismus, denn ich schreibe meine ersten Entwürfe noch von Hand, anders kenne ich es nicht. Wie lange werden Schriftsteller noch ein Papierarchiv besitzen? Der Lastwagen mag bereits jetzt überflüssig sein; viele Schriftsteller können ihr gesamtes Archiv auf ein oder zwei USB-Sticks speichern.
Während ich das schreibe, werden Zeitschriften eingestellt, im Fernsehen kaum noch Interviews mit ernst zu nehmenden Schriftstellern gezeigt, und im Radio kommt vor allem Musik, unterbrochen von irgendwelchen Diskussionen über Sport. Der Beruf des Schriftstellers, wie ich ihn bisher kannte, wandelt sich grundlegend. Die alten Medien sind zu Fossilien geworden, und was ich über die neuen Medien weiß, ist, dass sie flüchtig, rechthaberisch und improvisiert sind, die Texte weitgehend unredigiert, voller Lügen und Plagiate und schlecht bezahlt. Wenn ich mir so zuhöre, steigt in mir aber zugleich das Gefühl auf, dass ich wahrscheinlich falschliege und (wie mein Sohn einst über alte Männer schrieb) das Ende meines Lebens mit dem Ende der Zivilisation verwechsle, und dass es verknöchert ist, sich so geringschätzig über Innovationen auszulassen oder mit Erstaunen zu vermelden, dass die Barbaren vor den Toren stehen, wo sie dort doch immer schon standen – und den Schriftstellern einen Grund gaben, wachsam, schonungslos und beschäftigt zu sein.
1Meine Drogentour: Auf der Suche nach Ayahuasca
Als ich zum ersten Mal Auf der Suche nach Yage durchgelesen hatte, William Burroughs’ humorvollen Bericht über seine Reise nach Peru und an den Río Putumayo in Kolumbien auf der Suche nach der Droge, die er in Junkie als den Gral der Psychodrogen bezeichnete (»Vielleicht ist Yage der endgültige Fix«) – eine Reise, bei der er abgezogen und ausgeraubt wurde, Hunger litt, an die falschen Orte gelotst und grenzenlos verarscht wurde, alles für einen Kick, der wenig gemein hat mit den Träumen des durchschnittlichen Kiffers von richtig gutem Dope –, machte ich das Buch zu und dachte: Irgendwann mal muss ich genau diese Reise auch machen.
Das Buch war in den frühen 1960ern erschienen, begleitet vom Aufschrei und den Verwünschungen der üblichen Heuchler. Es ist eine Ermunterung jedes zukünftigen Gralssuchers und dabei ziemlich lustig. »Während all meiner Erfahrungen als Homosexueller bin ich noch nie Opfer solch idiotischer Diebstähle geworden«, schreibt er über die Folge eines Techtelmechtels mit einem Jungen in Peru und merkt an: »Das Problem ist, dass ich mit dem verblichenen Pater Flanagan – dem von [der Jugendhilfe-Organisation] Boy’s Town – die tiefe Überzeugung teile, dass es so etwas wie einen schlechten Jungen gar nicht gibt.«
Yage is yajé, Banisteriopsis caapi: Seelenranke, geheimer Nektar des Amazonas, das heilige Getränk des Schamanen, das ultimative Gift, ein Wundermittel. Allgemeiner bekannt war es unter dem Namen Ayahuasca, dessen Klang mich in seinen Bann zog, und man sagte ihm nach, dass es den Konsumenten hellseherische, wenn nicht telepathische Fähigkeiten verleihe. Ein weiterer Wirkstoff ist Raketentreibstoff: Immer wieder wird davon berichtet, wie man in einer Ayahuasca-Trance zu fernen Planeten reist und Außerirdischen und Mondgöttinnen begegnet. »Yage ist eine Reise durch Raum und Zeit«, schrieb Burroughs. Ein einzigartiges Zeugnis davon ist die Sammlung tranceartiger Gemälde von einem der größten Verfechter Ayahuascas, dem Schamanen und Vegetalista Don Pablo Amaringo. Das Buch Ayahuasca Visions, das er zusammen mit Luis Eduardo Luna veröffentlicht hat und in dem die Bilder abgedruckt sind, ist ein akribisches Protokoll seiner Ayahuasca-Räusche in Gemälden. Die Droge birgt aber auch Risiken, zu denen nicht zuletzt krampfartige Anfälle und schreckliche Brechattacken gehören. Auf vielen von Don Pablos Gemälden sieht man jemanden, der sich gerade aufs malerischste übergibt.
Selbst meinen engsten Freunden ist es selten gelungen, mit ihren bösen Werbetaktiken zu mir durchzudringen: Ich mag keine Überredungsversuche und bin resistent gegen Verkaufstaktiken. Überzeugende Verkaufsgespräche gibt es für mich nicht, sie führen allesamt bei mir zu angewidertem Zucken und erhöhtem Puls vor lauter Abscheu. Preisen Sie mir gegenüber ein Produkt oder eine Person an, versuchen Sie, mein Urteil über irgendwas oder irgendwen positiv zu beeinflussen, drängen Sie mich, tiefes Mitgefühl für ein Anliegen oder eine Kampagne zu empfinden, und mein Shit-Detektor stößt einen schrillen Ton aus, der mir in den Kopf fährt und mich in die entgegengesetzte Richtung rennen lässt.
Doch bei allen sonstigen Vorbehalten habe ich mich durch Bücher bereitwillig verführen und auf Abwege leiten lassen. Als ich über Afrika las, wollte ich sofort dorthin; ich verbrachte dann sechs Jahre in Malawi und Uganda in den 1960ern und war begeistert. Meiner Faszination für Joseph Conrad folgend, ging ich nach Singapur, nicht um Urlaub zu machen, sondern für drei Jahre als Bewohner dieser tyrannisch regierten und feuchten Insel missmutiger Überflieger – auch wenn mein ausgedehnter Aufenthalt dort durch Reisen nach Nordborneo, Burma und Indonesien etwas erleichtert wurde. Bücher führten mich nach Afrika, nach Indien, nach Patagonien, bis ans Ende der Welt. Ich reise, um auf Hindernisse zu stoßen, meine Grenzen kennenzulernen, als Zeitvertreib und mich zu versichern, dass es so etwas wie Unschuld gibt und das Altertum, um nach Verbindungen zur Vergangenheit zu suchen und um vor der Abscheulichkeit des städtischen Lebens zu fliehen und vor der Paranoia oder vielleicht einfach nur der Demenz der technologischen Welt. Ich war besessen von Auf der Suche nach Yage. »Ich habe beschlossen, nach Kolumbien zu gehen und mir Yage zu besorgen«, schreibt Burroughs in aller Einfachheit.
Jahre vergingen. Dann schrieb ich gerade an einem Roman, und mir fehlten Ideen, als mir »Das Aleph« einfiel, die großartige Geschichte von Borges über Visionen, in der ein Mann eine kleine leuchtende Stelle findet, das Aleph, die es ihm ermöglicht, in sein Herz und in das der Welt zu blicken. Mir wurde klar, dass der Augenblick für mich gekommen war, mich auf die Suche nach den Einsichten und telepathischen Fähigkeiten durch Ayahuasca zu begeben, als meinem Aleph.
Einige Freunde, ehemalige Amigos von Moritz Thomson, dem alten Gringo und Schriftsteller im selbstgewählten Exil, erzählten mir, dass sie von Ayahuasqueros unter den Flussbewohnern im Osten Ecuadors wussten. Man hatte mir den Namen eines Veranstalters gegeben, der Fremde zu den Nebenflüssen des oberen Amazonas brachte, wo es reihenweise traditionelle Heiler gab. Ich traf die nötigen Vorkehrungen und fand mich schon bald darauf in einem billigen Hotel in Quito wieder, wo ich auf das Eintreffen der anderen Teilnehmer dieser Drogentour wartete.
»Drogentour« war meine Bezeichnung. »Ethnobotanische Erfahrung« war der beschönigende offizielle Name, und manche sahen es als eine Suche, als Chance, ein echtes Indianerdorf zu besuchen, eine Lichtung im selva tropical, dem Regenwald, wo amerikanische Missionare noch wenige Jahrzehnte zuvor den Märtyrertod im Hagel der Geschosse aus Blasrohren und vergifteten Pfeilen von empörten Animisten gesucht hatten, die sich der gewaltsamen Bekehrung zum Christentum widersetzten.
Die Organisatoren dieser Vergnügungsreise verkauften es als eine kulturell anspruchsvolle Exkursion, acht Tage im Regenwald zur Schaffung eines Bewusstseins für die Natur und spiritueller Solidarität und um die Namen und Verwendungen von Heilpflanzen zu lernen. Eine dieser Pflanzen war Ayahuasca. Man versprach uns zwar nicht die Teilnahme an einem Ritual, es gab aber Andeutungen über eine »heilende Erfahrung«. Wir sollten in einem traditionellen Dorf des indigenen Volks der Secoya leben, tief in Ecuadors Oriente, nahe der kolumbianischen Grenze, an einem schmalen Seitenarm von Burroughs’ Putumayo, wo die Ayahuasca-Lianen sich dick wie Kinderarme um die Bäume des Regenwalds ranken.
Doch ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl. Ich bin es nicht gewohnt, in Gruppen zu reisen, und es war ein nervöser und heterogener Haufen, acht oder zehn Leute, mehr als ich erwartet hatte.
Für mich bestand der große Reiz darin – das war auch der Grund, warum ich mich angemeldet hatte –, dass Don Pablo Amaringo unser Vegetalista sein würde. Aber selbst Don Pablo sprach in seinem bewegenden Vortrag in Quito, bevor wir aufbrachen, von den widersprüchlichen Schwingungen, die von unserer Gruppe ausgingen.
Don Pablos sanfte Art, sein schüchternes amazonisches Lächeln und sein umfassendes Wissen über die Pflanzen des Dschungels ließen ihn sofort überzeugend wirken. Er hatte einen goldenen Teint, war von schmaler Statur und sein Gesichtsausdruck so lebhaft und aufmerksam, dass es unmöglich schien, sein Alter zu schätzen. Als erfahrenem Ayahuasca-Konsumenten war es ihm aufgrund seiner Meisterschaft als Maler gelungen, die Erfahrung in seinen Bildern festzuhalten. Er ist ein angesehener Schamane, obwohl er das Wort selten verwandte. »Schamane« ist eine Bezeichnung, die vom sibirischen Volk der Ewenken stammt und sich weit verbreitete. Auf Ketschua ist das Wort für Schamane Pajé, »der Mann, der die gesamte Erfahrung verkörpert«.
Don Pablo war auch Lehrer; er leitete eine Kunstschule in Pucallpa, Peru. In Pucallpa hatte Burroughs 1953 Ayahuasca gefunden. Ich vertraute Don Pablo vom ersten Moment an. Er bleibt einer der begabtesten, einfühlsamsten und charismatischsten Menschen, denen ich in meinem Leben begegnet bin. Don Pablo erkannte sofort, dass bei mir zu Hause vieles ungeklärt war – meiner Frau ging es nicht gut, insgesamt waren meine Angelegenheiten in einem Durcheinander; er schien zu wissen, dass ich mit einem Buch nicht weiterkam. Seine Klugheit erinnerte mich daran, dass eine Substanz namens Telepathin aus Ayahuasca gewonnen wurde.
»Dein Geist ist zu einem Teil hier und zu einem anderen zu Hause«, sagte er zu mir.
Die anderen Teilnehmer empfand ich als Belastung. Abgesehen von einem Psychiater und Dichter und einem jungen Mann, der die Reise machte, um seinen Drogenerfahrungen ein weiteres Kapitel hinzuzufügen (kurz zuvor war er noch auf dem Burning Man Festival herumgetollt), waren diese Leute keine Reisenden. Schon in Quito wirkten sie überfordert, und später, als wir tief ins Landesinnere von Ecuador vordrangen, schienen sie der Situation nicht mehr gewachsen. Eine Frau weinte bei den geringsten Anlässen, ein Mann predigte militanten Zionismus, eine andere Frau über ihre Suche nach spiritueller Erfüllung, wieder eine andere sagte schluchzend: »Ich will geheilt werden.« Ein hübsches Mädchen wurde von chronischem Durchfall geplagt.
Sie selbst sahen sich als Suchende. Sie schienen einen rührenden Glauben an die Wirkung dieser Reise zu haben, wirkten jedoch miserabel vorbereitet auf die Strapazen. Die schluchzende Frau schien mir kein Anlass zur Sorge; beunruhigender war für mich das ängstlich kreischende Gescherze einiger anderer. Sie wirkten vollkommen arglos. Sie waren leicht zu verschrecken und wollten zugleich ihr Leben in Ordnung bringen. Die meisten waren noch nie im Dschungel gewesen oder litten an Schlaflosigkeit. Sie wirkten verwirrt, kicherten verzweifelt in ihrer verschwitzten Kleidung, als erwarteten sie ständig, aus dem Hinterhalt überfallen zu werden. Die Organisatoren taten ihr Bestes, die Nerven dieser Leute zu beruhigen, mein Missmut und Missfallen ließen aber nicht nach, so viel Ängstlichkeit war ich nicht gewohnt. Eine Frau bekam ihre Periode. Von der Zeremonie war sie damit ausgeschlossen.
Als endlich alle zur Abfahrt bereit waren, verließen wir Quito mit einiger Verspätung; an den heißen Quellen von Papallacta machten wir eine längere Pause. Während wir dort am Rand des Regenwaldes unsere Zeit vertrödelten, zeigte mir Don Pablo eine Blüte, eine Engelstrompete aus der Gattung der Brugmansia. Es gibt viele verschiedene Sorten, aber die war besonders stark. »Sie werden Datura genannt – Toé auf Guaraní. Sie können einem Visionen verschaffen. In gewisser Weise wirkt die Pflanze stärker als Ayahuasca.«
»Inwiefern?«
»Großartige Visionen«, sagte er und rieb ein Blatt zwischen den Fingern wie ein chinesischer Kenner ein Stück Seide prüft, »aber man kann davon blind werden.«
Die Nacht brach herein, während wir weiter nach Osten reisten, nur langsam vorankommend auf den schlechten Straßen. In der Dunkelheit erreichten wir Lago Agrio, eine Boomtown, die entstanden war, um die Bedürfnisse amerikanischer Ölfirmen zu befriedigen, die hier den Regenwald ausbeuteten und die Indianer verdrängten. Am Hotel ging es darum, den Bus möglichst versteckt zu parken (»Sonst wird er gestohlen«).
Wir gingen in einer stinkenden Stadt lauernder Schatten schlafen, in der man nur das scharfe Klicken von Absätzen vernahm; und erwachten an einem heißen, hellen Ort, an dem sich das Verkehrsgewimmel mit dem Geruch von saurer Sahne mischte, der von ausgelaufenem Öl und der giftgetränkten Erde stammte.
Lago Agrio lag in der glühenden Äquatorsonne da wie ein Schandfleck. Da sich unsere Abfahrt zum Fluss verzögerte, saß ich mit einem Kaffee da und kam mit Joaquín ins Gespräch, einem Einheimischen und Fremdenführer, der von sich behauptete, ein Vegetalista zu sein. Er war ein junger Mann, nicht älter als dreißig, mit dem Aussehen eines Asketen – lange Haare, verblasstes Hemd, Sandalen –, und seine Erscheinung legte nahe, dass er jemand war, der kein Risiko scheute. Er sagte, dass das Geräusch, das ich die Nacht hindurch gehört hatte, von den Absätzen der trippelnden Prostituierten kam. Die Stadt, so meinte er, sei eine Stadt der Huren, Drogen, des Waffenschmuggels, der Rebellen und Ölsucher. Man könne hier alles kaufen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sogar die Bordelle hätten nie zu. Es war halb neun Uhr morgens.
»Die Burdeles sind auch jetzt offen«, sagte Joaquín.
Da ich daran Zweifel hatte, nahm er mich auf eine zehnminütige Taxifahrt zu einem niedrigen Gebäude an einer staubigen Straße mit. Drinnen saßen Frauen, alte und junge, alle in Badeanzügen, steif auf Klappstühlen vor kleinen Kabinen, die eine große Tanzfläche umgaben. Niemand tanzte, während laute Musik spielte. Zwei Männer stritten sich und warfen dabei Stühle um. Acht oder zehn andere Männer tranken Bier. Die Morgensonne schien durch die kleinen Fenster des Gebäudes.
»Sie arbeiten die ganze Nacht auf den Ölfeldern und kommen morgens hierher, um sich zu betrinken und sich eine Frau zu suchen.«
Joaquín führte mich durch die Hintergassen der heruntergekommenen Stadt, wo in kleinen Geschäften die Händler im Flüsterton ihre Ware anboten und mir Knochen reichten. »Gefährdete Arten!« Zu kaufen gab es polierte Schädel von Jaguaren, den sogenannten Tigres. Es gab auch Haufen von Schildkrötenpanzern, ausgestopften Fledermäusen, auf Brettern befestigten Eidechsen, toten Spinnen, die mit Nadeln aufgespießt waren, und Waffen aller Art – Blasrohre, Giftpfeile, Macheten, gefährlich aussehende Klingen, Bögen und Pfeile.
»Das hier war mal ein Regenwald. Nur Indianer und Tiere.« Joaquín fragte mich, was ich haben wolle. Ich könne alles bekommen – einen Affenschädel, ein Tigerfell, Drogen, Waffen, ein vierzehnjähriges Mädchen. Er könne sogar eine Toxic Tour organisieren, wie er es nannte, einen Überblick über die schädlichen Einflüsse von Halliburton und Occidental Petroleum in der Umgebung.
Ich sagte, dass ich mit meiner Gruppe von Gringos den Río Aguarico flussabwärts reisen würde, in ein Dorf der Secoya. Er verstand es als einen Code für eine Drogentour und machte mit der Hand eine Trinkbewegung.
»Ayahuasca«, sagte ich.
»Sie könnten es auch hier in der Gegend trinken. Ich kenne da Leute«, sagte er. In einem Laden zeigte er mir auch Beutel mit Heilkräutern und Pflanzen und fette, staubige Stücke abgeschnittenen Ayahuascas, die aus Jutesäcken ragten.
»Nein, ich will das Dorf sehen.«
Was ziemlich direkt als Suche nach einem Ayahuasca-Erlebnis begonnen hatte, wurde zunehmend komplexer, und mein Kopf füllte sich mit Bildern: Öl, das aus den geflickten Pipelines neben der Straße spritzte, die Gesichter der Prostituierten – junge verängstigte Mädchen und alte verbitterte Frauen, die teuflischen Fratzen ihrer Kunden –, die grinsenden Tigerschädel, die faustgroßen Spinnen, die Hitze, der Staub.
Und es gab Terrorismus. Joaquín hatte mir erzählt, dass auf der Brücke nach Kolumbien, etwa zehn Meilen entfernt, Guerillakämpfer der FARC in der Nacht zuvor zwanzig Autos angehalten hätten. Mit vorgehaltener Waffe hätten sie den Fahrern Benzinkanister in die Hand gedrückt und gesagt: »Übergieß dein Auto damit und zünde es an, oder wir erschießen dich.«
Zwanzig brennende Autos blockierten an diesem Tag die San-Miguel-Brücke nach Kolumbien, an der Grenze bei La Punta.
»Es soll der Abschreckung von Besuchern dienen«, sagte Joaquín mit ecuadorianischem Understatement.
Ich verabschiedete mich von Joaquín und schloss mich wieder meinen Ökotouristen an. Wir nahmen einen Bus zu der schlammigen Siedlung Chiritza, am Ufer des Río Aguarico. In Lago Agrio am Straßenrand, in Chiritza und entlang des Ufers sah man oft dreckbespritzte Schilder, alle mit der gleichen Aufschrift: Prohibido el Paso. Betreten verboten. Dann bestiegen wir ein Einbaumkanu, hockten in diesem gewaltigen ausgehöhlten Baumstamm und machten uns auf den Weg stromabwärts, angetrieben von einem furzenden Außenbordmotor.
Der Fluss verengte sich von gut hundert Metern auf fünfzig, dann dreißig, in weniger als einer Stunde, der Dschungel überwölbte ihn wie ein Strohdach, mit hängendem Bambus und sich rankenden Schlingpflanzen und Bäumen mit riesigen Blättern. Das nervöse Geplapper der Passagiere im Einbaum übertönte die Schreie der umherschwirrenden Vögel.
So ein Fluss, tiefbraun vom eingeschwemmten Schlamm nach den Regenfällen, und ein so instabil wirkendes Boot an einem so entlegenen Ort erzeugten bei den Gringos ein Gefühl der Unsicherheit. Die langsame Fahrt in den Schlund des Dschungels war mit der Sorge verbunden, dass man von einem Ort, der so schwierig zu erreichen war, auch nur schwierig wieder wegkommen würde. Wir waren in den Händen der einsilbigen Reiseleiter und schweigsamen Bootsführer. Das Gefühl, mit den anderen im selben Boot zu sitzen, behagte mir nicht. Ich brauche ein gewisses Maß an Kontrolle über meine Bewegungen und Wege. Ich fühle mich nicht wohl in Herden, schon gar nicht in einer von Anfängern.
Das Tageslicht schwand am Himmel, der Dschungel wurde dunkler, der Fluss gluckste am Rumpf des Einbaums; doch der Fluss selbst war erstaunlicherweise noch gut sichtbar, barg das letzte Licht, als glimme der Tag unaufgelöst in seinem schlammigen Strom.
»Remolino«, sagte ein Bootsführer. Strudel.
Hinter der Stromschnelle und in einiger Entfernung vom Fluss lag das Dorf: Männer in orangenen Kitteln, ein oder zwei trugen Kränze aus Federn und Lianen; Jungen griffen nach dem Seil und halfen den Besuchern an Land.
Wir wurden zu einem Podest im Dorf geführt, auf dem wir in Hängematten und auf Matten schlafen sollten. Ich weigerte mich, zum einen, weil pelzige Insekten, groß wie Fingerknöchel, lautstark gegen die grellen Laternen schwirrten, hauptsächlich aber, weil ich alleine schlafen wollte. Ich hatte mein kleines Zelt mitgebracht – zusammengerollt war es so groß wie ein Football – und meinen Daunenschlafsack, in seinem Beutel deutlich kleiner als das Zelt. Ich baute mein Zelt auf einer Lichtung am Rande des Dorfes auf.
Über die nächsten zwei Tage verstärkte sich das unangenehme Gefühl, das ich von Anfang an gehabt hatte. Zu Hause, so mein Gefühl, erwartete mich nur Unklarheit, eine Art Unglück und Grauen; und auch hier empfand ich alles in Unordnung und eine sogar noch größere Unsicherheit.
Die Aussicht darauf, in diesem traurigen und verfallenen Secoya-Dorf die Zeit totschlagen zu müssen, zog mich noch weiter runter.
Ich saß mit Don Pablo auf einem umgefallenen Baumstamm und machte mir Notizen, während Spinnen und Ameisen über die Seiten meines Notizbuches krochen und der Fluss ans schlammige Ufer schwappte. Ich sagte zu ihm, dass ich Probleme mit meinem Roman habe. Er sprach mit mir über das Auge des Verstehens.
»Dieses Auge kann Dinge sehen, die man physisch nicht sehen kann«, sagte er. »Bei einigen Leuten ist dieses dritte Auge bereits entwickelt. Und andere können das Auge des Verstehens durch Ayahuasca oder andere Dschungelpflanzen erwerben.«
Jeden Morgen hatte die Gruppe die gleiche Frage: »Heute Abend?«
»Nicht heute Abend.«
War es kein günstiger Abend, oder war ein bestimmter Schamane nicht eingetroffen wie geplant, oder gab es irgendein Missverständnis? Ein großes schläfriges Unbehagen senkte sich auf die Gruppe, feucht vom Moos und dem Mehltau des Waldes.
Wenn jemand fragte, ob es irgendwas zu tun gäbe, war die Antwort: »Du kannst in Juanas Garten Unkraut jäten.«
Oder wir konnten Bilder malen, auf Baustellen helfen oder die Heiler zu botanischen Strategien befragen. Die meisten der Gringos waren froh, bei irgendetwas mitzumachen, aber die Ungeduld wuchs, das Unbehagen und der Eindruck mangelnder Organisation.
Die Gringos, die in Quito so ordentlich gewirkt hatten, sahen mittlerweile schmuddelig aus, verschwitzt und von Sorgen gezeichnet. Der Franzose in der Gruppe verhöhnte Amerika, und der junge Schriftsteller erhob Einspruch gegen diese beiläufigen Beschimpfungen; eine Frau beschrieb ihr Leben als eine einzige Abfolge trauriger Phasen und fing an zu weinen. Niederschwelliges Gezänk wurde zum kaum hörbaren Grundton auf der Dschungellichtung.
»Wo warst du?«, fragten mich die Leute auf einmal.
»Mich umsehen«, sagte ich und ärgerte mich, dass man meine Abwesenheit überhaupt bemerkte. Tatsächlich verbrachte ich meine Zeit meist am Flussufer am Rande des Dorfes, wo ich in mein Notizbuch schrieb, oder in meinem Zelt, fern der Spinnen, mit meinem Kurzwellenradio.
Eines Morgens wurde Enrique, ein Ecuadorianer, für seine Betrunkenheit am Abend vorher öffentlich zurechtgewiesen. Während er gedemütigt und aufgefordert wurde, sich bei den Gringos zu entschuldigen, konnte ich über die Scheinheiligkeit seiner Ankläger nur höhnisch grinsen. Als sie fertig waren, wies ich darauf hin, dass alle, die hier zu Gericht saßen, Kettenraucher und Drogenkonsumenten waren. Warum war Alkohol ein besonderes Problem?
»Alkohol hat unter der indigenen Bevölkerung viele Opfer gefordert«, sagte einer der amerikanischen Führer.
Doch ich dachte auch: Und wie sieht es mit Ayahuasca aus? Don Pablo versuchte, es mir zu erklären. Ayahuasca sei wie der Tod, sagte er. »Wenn du es trinkst, stirbst du. Die Seele verlässt den Körper. Aber diese Seele ist ein Auge, mit dem du die Zukunft siehst. Du wirst deine Enkel sehen. Wenn die Trance vorbei ist, ist die Seele zurück im Körper.«
Eines Tages, als ich gelangweilt und unruhig im Dorf umherlief, fand ich einen Secoya-Mann, der bereit war, mich tiefer in den Regenwald zu führen.
»Es gibt dort Blumen zu sehen«, sagte er. »Vögel. Große Bäume.«
Er ging vor mir her und schlug den Weg mit einer Machete frei; ein kleiner Secoya-Junge folgte uns. Es war alles wie auf Burroughs’ Reise, genauso ziellos und improvisiert. Die Leute machten solche Drogentouren, wenn sie im Leben gerade nicht weiterwussten, so schien es. Sie waren es nicht gewohnt, ein einfaches Dorf aus nächster Nähe zu erleben, und wurden ungeduldig, genau wie ich, beim Warten darauf, dass der Schamane uns endlich zur Ayahuasca-Zeremonie ruft. Ich war froh, fern von ihrem aufgedrehten Gelächter zu sein.
Wie liefen drei Stunden in der feuchten Hitze auf einem matschigen Pfad unter dem hohen Regenwalddach. Die wild wachsenden Blumen brachte ich eher mit Hawaii in Verbindung: leuchtende Helikonien, schnabelförmige Strelitzien, wild dreinblickende Blüten, rosa Fackeln wilden Ingwers und die etwas blassere Datura, die Engelstrompete, von der die Menschen Visionen bekamen und erblindeten. Und auch Ayahuasca: Die Ranke war eher unansehnlich und wand sich um die Baumstämme.
Zum Waldboden drang kaum Licht durch. In der grünlichen Luft schwirrten die Stechmücken und das gefilterte Sonnenlicht, und hier und da sah man das große wollene Rad eines Spinnennetzes, an dessen Rand die Spinne wie eine kleine staubige Pflaume mit Beinen hockte.
Gerade als ich darüber nachdachte, wie unberührt dieses Stück Natur von menschlichen Einflüssen war, dass hier vielleicht noch niemand je auch nur einen Stängel umgeknickt oder eine Blume ausgerupft hatte, und ich mich in einem kleinen Garten Eden des Volkes der Secoya wähnte, rief der kleine Junge »Escucha« und lauschte.
Man hörte ein weit entferntes Tuckern, wie von einem Motorboot, das unsichtbar durch den Himmel pflügte, und als es näher kam, wurde es zu einem deutlicheren Rat-tat-tat.
»Mira! Helicóptero«, sagte der Junge, seine Haare in den Augen.
Ein Schatten zog wie eine große braune Wolke über uns hinweg, ein gigantischer russischer Hubschrauber.
Das Walddach mit seinen Zweigen und Blättern verhinderte, dass wir sehen konnten, wohin der Hubschrauber flog, aber wir konnten ihn noch hören und sein hämmerndes Geräusch verfolgen, den Trommelschlag seiner Motorrülpser in der Ferne.
Wir gingen jetzt nicht mehr auf dem Pfad, sondern durch brusthohen Farn und riesige Blätter, als wir vor uns etwas Helles sahen, vielleicht eine Lichtung, und dann den Schatten des sich senkenden Hubschraubers, der zur Landung ansetzte.
Wir kamen an einen mannshohen Maschendrahtzaun, der quer durch den Wald verlief, mit NATO-Draht-Rollen obendrauf und alle fünf Meter einem Schild mit Totenkopfzeichen und der Aufschrift Prohibido el Paso. Die Sonne versengte die eingezäunte Lichtung – Sonne und Stahltürme und kistenförmige Fertigbauten und Ölfässer und der riesige knatternde Hubschrauber. Seine zwei Rotoren wurden langsamer, während Männer mit gelben Schutzhelmen hin und her eilten und Kartons aus dem offenen Laderaum luden.
Das Lager war vollständig von dem Zaun und vom Wald umschlossen. Keine Straße führte hierher. Und es gab keine Lücke im Zaun – keine Öffnung, nicht einmal ein Tor. Als der Lärm des Hubschraubers nachließ, konnten wir das leisere, aber gleichmäßige Pulsieren eines Motors hören und sahen, wie sich in der Mitte der Lichtung ein Stahlzylinder auf und ab bewegte, der mit einem Geräusch in die Erde stieß, das abwechselnd wie Japsen und Schlucken klang, dem Taumel grunzender Befriedigung beim Pumpen von Öl.
In der Nähe des Eingangs zu einem der neuen hellen, kastenförmigen Gebäude beriet sich ein Ecuadorianer, ganz in Weiß – weißes Hemd, weiße Schürze, große weiße Kochmütze –, mit einem anderen dunkelhäutigen Mann in einer kurzen schwarzen Jacke, gestreiften Hosen und mit einer Fliege. Dieser zweite Mann, offensichtlich ein Kellner, balancierte auf seinen Fingerspitzen ein Tablett mit dünnstieligen Weingläsern und einer Weinflasche in einem Eiskübel.
Gringos, eindeutig Amerikaner, kletterten aus dem Cockpit des Hubschraubers.
»Petroleros«, sagte der Secoya-Mann und fügte hinzu, dass wir jetzt sofort gehen müssten. Es war eines der hässlichsten Dinge, die ich je in meinem Leben gesehen hatte.
»Es ist Secoya-Land«, sagte ich. »Wie können sie hier nach Öl bohren?«
»Uns gehört, was obendrauf ist«, sagte er. »Die Regierung besitzt das, was drunterliegt.«
Später erfuhr ich, dass die Einheimischen von der amerikanischen Ölgesellschaft ein Almosen erhalten hatten, damit der Zaun errichtet werden konnte, sie aber an den Gewinnen nicht beteiligt würden, und es war nur eine Frage der Zeit, bis es auch in diesem Teil des Regenwaldes die Läden und Bordelle und Bars und ölverschmutzten Straßen von Lago Agrio geben würde.
Der Anblick dieser Ölquelle im Urwald trug zu meinem Gefühl des Durcheinanders bei und raubte mir die Moral. Ich fragte Don Pablo um Rat.
»Du bist nicht ruhig«, sagte er und hielt meine Hände.
Das war eine Untertreibung. Ich kroch in dieser Nacht in mein Zelt, hörte das Geplapper der Gringos auf der Schlafplattform und fragte mich, ob ich die Nerven hierfür hatte. Meine Suche nach dem ultimativen Kick verwandelte sich in eine hartnäckige Flaute dauernden Aufschubs. In dieser Nacht hatte ich einen Albtraum: Meine Frau war sehr krank und rief nach mir. Am Morgen schrieb ich das meinem diffusen Schuldgefühl zu, mein Unbewusstes passte sich an meinen Zustand der Verwirrung an und machte Schuldzuweisungen.
Als ich am Flussufer saß und darüber nachdachte, was ich tun sollte, sah ich, wie drei Gringo-Frauen aus unserer Gruppe, gekleidet in Hemden und Shorts, vom anderen Ufer aus über den Fluss schwimmen wollten. Sie waren vergnügt und verschluckten sich am Wasser, während sie unbeholfen durch den schnellen braunen Strom paddelten. Dann rief eine: »Ich habe meinen Ring verloren! Einfach vom Finger gefallen!«
Die beiden anderen zögerten, und als sie aufhörten zu schwimmen, trieb es sie stromabwärts. »Egal«, sagte die Frau, die den Ring verloren hatte, »dann sollte es so sein«, aber der Fluss war auch für sie zu viel. Ich schleuderte meine Sandalen weg und sprang rein, erreichte sie nach ein paar Zügen und zog sie an Land. Eine der anderen beiden strampelte zwar wild, brauchte aber nicht viel Hilfe, also machte ich mich auf zur dritten, die in dem aufgewühlten Strom Richtung Brasilien unterwegs war. Sie schnaubte und keuchte, als ich sie erreichte. Ihre Kleidung zog sie nach unten, sie konnte ihre Arme kaum heben, aber ihr Hemd bot mir etwas zum Festhalten, und so zog ich sie langsam – verbunden mit der Warnung, nicht nach mir zu greifen, da ich ihren panischen Griff fürchtete – an Land.
Vielleicht stand sie unter Schock. Sie wieherte ein bisschen, ein freudloses Lachen. Sie bedankte sich nicht und sagte nur: »Ich glaube, ich hätte es auch alleine geschafft.«
In diesem Moment der Undankbarkeit, einer gerade so abgewendeten Tragödie und schlichter Dummheit, beschloss ich zu gehen. Mein ungutes Gefühl gegenüber dieser Gruppe und diesem Ort schien sich zu bestätigen. Was tat ich hier? Ich war wegen der Droge gekommen und war im Horror von Lago Agrio gelandet – Huren und Drogen und Geschichten von brennenden Autos und die Toxic Tour. Auf der Suche nach der Reinheit des Dschungels war ich auf dessen Entweihung durch Ölleute gestoßen. Diese leichtsinnigen Frauen, die sich fast ertränkt hätten, schienen der Beweis dafür, dass noch Schlimmeres auf uns zukommen könnte. Und außerdem war meine Frau krank.
Ich rollte meinen Schlafsack zusammen, faltete mein Zelt und fand einen Secoya-Mann, der sagte, er hätte ein Boot mit einem Außenbordmotor. Ich zahlte ihm die 100 Dollar, die er dafür verlangte – ziemlich happig, dachte ich –, und er brachte mich flussaufwärts nach Shushufindi, von wo aus ich den Weg nach Lago Agrio allein zurücklegte.
Sobald ich allein war, konnte ich klar denken. Statt Öko-Chic, Ethno-Botanik, dem Erlebnis des Regenwalds, Schamanismus oder Visionen war ich Kinderprostituierten und Waffenschmugglern begegnet, Ölgiganten und dem verschandelten Dschungel, umgeben von FARC-Guerillas. Das Schicksal der Secoya schien besiegelt. Das Dorf würde bald dem Vordringen der Ölmenschen zum Opfer fallen, die nur einen halben Tagesmarsch durch den Wald entfernt waren.
Vielleicht sollte genau das mein Abenteuer sein, ohne dass ich es vorher wissen konnte. Der ganze Sinn eines Abenteuers besteht darin, dass es ungeplant ist; ein Sprung in die Dunkelheit, eine Annäherung ans Unglück, Andeutung von Gefahr; was Abenteuer von Katastrophen unterscheidet, ist lediglich, dass man es überlebt hat und davon erzählen kann.
Als ich wieder in Lago Agrio war, fand ich Joaquín. Er machte die Geste des Glas-zum-Mund-Führens und sah mich mit einem fragenden Lächeln an.
Auf Spanisch sagte ich: »Nein. Es ist eine chinesische Geschichte.«
Eine Redewendung, die besagt: lang und sinnlos.
»Vielleicht kann ich dir helfen«, sagte er.
Die anderen, flussabwärts, bereiteten sich vielleicht gerade auf ihre Zeremonie vor. Ich hatte diesen ganzen Weg zurückgelegt, und doch war ich jetzt, in dieser grässlichen Stadt, ruhig, sogar froh. Ich war auf mich allein gestellt. Ich rief meine Frau an – ja, ihr sei es schlecht gegangen, aber nur vor Sorge, weil sie von mir nichts gehört hatte. So hatte ich also eine Gnadenfrist und fühlte mich nicht zur Eile gedrängt.
Meine Ayahuasca-Zeremonie fand nur für mich persönlich statt, zu zweit in einem großen, zu einer Seite hin offenen Schuppen in der ummauerten Anlage – Prohibido el Paso – eines großen Hauses am Stadtrand von Lago Agrio. Don Pablo hatte mich eingewiesen, also war ich vorbereitet, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass er mein Schamane gewesen wäre. Nach allem, was ich gesehen hatte, befürchtete ich, dass die Zeremonie eine Enttäuschung werden würde. Es war zwar kein Secoya-Dorf, aber der Schamane war immerhin ein echter, und was das Ayahuasca betraf, so überzeugte mich mein Kotzen davon, wie Gift als Medizin wirken kann.
Kauernd und würgend landete ich in einer Zeitschleife, wand mich in einer Hängematte zu akustischen Schwällen, Stromschnellen aus Geräuschen, einem klingelnden Gesang und dazu passenden Bildern – Sturzfluten, ein Wasserfall aus Schlangen, die durch Seen aus Öl glitten, blutende Bäume und Spinnen, Hubschrauber, die Raumschiffe gewesen sein könnten, der geschuppte glitschige Fluss, der sich zusammenzog und anschwoll wie eine Anakonda. Das kratzende Summen in meinem Bauch könnte der Gesang des Schamanen gewesen sein. Mein ganzer Körper vibrierte unter der Synkope von Grunzlauten und Gemurmel, aber die Farben, die ich sah, waren gedämpft, wie vergrößerte Pixel.
Die Visionen, so verstörend sie auch waren – der klebrige Ölfluss, die sich windenden Schlangen –, machten mir keine Angst, sondern schienen Teil von etwas Ganzem und Stimmigem zu sein und fügten sich in eine harmonische Welt der Schöpfung und Zerstörung ein. Die Harmonie lag sowohl im Klang des Gesangs als auch im Geglitzer des Blattwerks und der schwirrenden Vögel und, wie in einem Gedicht von Rimbaud, der monströsen maulförmigen Blüten.
Ich wachte sabbernd und keuchend auf, aus irgendeinem Grund auf dem Boden eines Freiluftpavillons, mein Gesicht klebte an einer Bastmatte. Ich hatte Yajé gefunden.
Wieder zu Hause, war ich beruhigt, dass es meiner Frau wieder gut ging. Während der gesamten Zeit, als ich mich an dem Ort flussabwärts aufhielt, hatte sie unter Atemnot gelitten, sich fast asthmatisch gefühlt vor Angst, dass ich in Gefahr sein könnte. Einige Zeit später sprach ich mit ein paar Leuten aus der Gruppe, die an der Ayahuasca-Zeremonie im Secoya-Dorf teilgenommen hatten. Bei einem oder zwei von ihnen hatte die Droge keine Wirkung gezeigt, andere waren auf den Mond geflogen. Und es hatte einen Besucher gegeben – mich, in meinem Panamahut und Hawaii-Hemd.
»Zwei Leute haben dich gesehen«, sagte mir einer der Ayahuasqueros. »Du warst in unseren Visionen dabei, hast uns beobachtet.«
Diese geisterhafte Erscheinung war wie eine Metapher dafür, was es heißt, Schriftsteller zu sein. Wenig später warf ich den angefangenen Roman weg und begann mit dem richtigen. Nachdem ich das blendende Licht dieser Drogentour gesehen hatte, hatte ich das Gefühl, dass ich mein Thema besser verstand. Das Schreiben des Romans lief gut, und während der Jahre, in denen ich an ihm arbeitete, dachte ich immer wieder: Manchmal ist eine Spinne in deinem Becher, die du nicht siehst. Du trinkst und machst weiter, ohne zu wissen, dass diese Kreatur in der Flüssigkeit lauert. Ich hatte jedoch den ganzen Becher hinuntergekippt und einen Blick auf das giftige Insekt geworfen. Ich war fest entschlossen, oder mit einem meiner Lieblingsverse von Shakespeare, den ich innerlich immer wieder vor mich hin murmelte: »Ich habe getrunken und die Spinne gesehen.«
Ich hatte wirklich nicht gewusst, worauf ich mich einließ, bevor ich aufbrach. Ich wusste jetzt, wohin ich gegangen war und was es mit mir gemacht hatte. »Ein Ort, wo sich die unbekannte Vergangenheit und die langsam zur Gewissheit werdende Zukunft in einem lautlos vibrierenden Vakuum treffen«, schrieb Burroughs in Auf der Suche nach Yage über seine Ayahuasca-Erfahrung. »Larven, die auf ein Lebendiges warten, in dem sie sich entpuppen können.«
Das war eine lyrische Art, es auszudrücken. Und ich war dieses »Lebendige« gewesen. Ayahuasca war der formelle Anlass für meine Reise, aber der Sinn eines Sprungs in die Dunkelheit ist, dass man sein Schicksal nicht vorhersagen kann. Viele Dinge, die ich auf dieser Reise sah, hatten viel mehr Bedeutung für mich als das Ayahuasca. Die paar Gringos, die sich mal an einem psychotropen Drogentrank versuchen wollten, waren nur eine Farce im Vergleich zu allem anderen, was außerhalb des Dorfes vor sich ging.
In gewisser Weise war die Wirkung wie die von Datura, der Brugmansia-Droge, die einen blind macht. Die systematische Ölsuche und das fieberhafte Bohren liefen auf eine Verschwörung amerikanischer Ölfirmen und der ecuadorianischen Regierung hinaus, die sich geeinigt hatten, dass die Firmen sich das Öl einfach nehmen und das Gesicht des Regenwaldes für immer verändern können. Und wofür? Genug Öl, um Los Angeles eine Woche lang zu versorgen, gigantische Gewinne für ein paar Leute, und noch mehr Nutten, Waffenschmuggler, Guerillas und Obdachlose in einem noch weiter ausgedehnten Lago Agrio. Es war eine schreckliche Vision, die ich mit nach Hause nahm und mit der ich fortan lebte. Wie Borges in Das Aleph sah auch ich den Kreislauf meines dunklen Blutes. Abenteuer bedeutet die überraschende Erfahrung von Entdeckungen, aber es bedeutet auch eine Art Tod, das Ende der Unschuld.
(2012)
2Thoreau in der Wildnis
Henry David Thoreau war emotional so stark mit seinem Haus in Concord verbunden, dass ihm das Weggehen stets schwerfiel. Nach 1837 verließ er es tatsächlich nur noch für kurze Zeit: für eine dreizehntägige Reise auf dem Concord und dem Merrimack River, für einige Besuche auf Cape Cod, drei Wanderungen in die Wälder von Maine und für kurze Aufenthalte auf Staten Island und in Minnesota. Bei diesen Reisen war er nie allein unterwegs, sondern hatte stets einen Freund oder Verwandten dabei. Er war einer der Ersten, die den Mount Katahdin bestiegen, was aber eine wagemutige Ausnahme darstellt, und wahrscheinlich schaffte er es auch nicht auf den höchsten Gipfel. Die Kanutour über 325 Meilen, über die er in »The Allagash and East Branch« in The Maine Woods schreibt, war seine ehrgeizigste Reise – und tatsächlich eine ziemlich anspruchsvolle –, aber das Buch zeigt auch, dass Thoreau bei aller Begeisterung für die Wildnis in der Tiefe der Wälder gelegentlich hilflos und verloren war. Die Erfahrung führte zur Überzeugung, dass er dort niemals allein leben könnte.
Die Wälder von Maine waren Wildnis, Thoreau betont jedoch ihre Nähe zur Zivilisation: Sie seien nur wenige Stunden vom gut erreichbaren Bangor entfernt. Der Walden Pond lag nur einen angenehmen Fußmarsch von seinem Elternhaus entfernt, in dem er fast sein ganzes Leben verbrachte. Dass er während seines berühmten Experiments in der Blockhütte am Walden Pond, beim Philosophieren über die Einsamkeit, seiner Mutter die schmutzige Wäsche brachte und weiterhin ihren Apfelkuchen genoss, verschwieg er. Sein Freund William Ellery Channing schrieb, dass Thoreau, als seine Mutter nach seinem Abschluss am Harvard College und der Rückkehr nach Concord das Thema des Auszugs aus dem Elternhaus aufbrachte, weinerlich reagierte – und dort wohnen blieb.
Sein Freund und literarischer Mentor Ralph Waldo Emerson ging auf der Suche nach neuen Eindrücken nach England, und auch andere Schriftsteller seiner Zeit reisten um die halbe Welt – Nathaniel Hawthorne nach England, Washington Irving nach Spanien, Melville in den Pazifik –, doch Thoreau ließ sich davon nicht beirren. Auf die Berichte von diesen Reisen reagierte er abwehrend, manchmal auch abschätzig. Er war ein Widerspruchsgeist aus Überzeugung. Er kultivierte seine Eigenwilligkeit und stilisierte sie in seinen Schriften, dabei war seine Persönlichkeit noch weit merkwürdiger, als ihm bewusst war.
Seine typische Reaktion auf die Reisen seiner Freunde in aller Welt findet man in einem Brief an seine Mutter: »Das Leben, das wir leben, ist ein seltsamer Traum, und ich vertraue überhaupt keiner Rechenschaft, die Menschen von ihm ablegen. Ich glaube, ich würde zufrieden sein, wenn ich an der Hintertür in Concord unter dem Pappelbaum sitzen könnte, von nun an für immer.« Das klingt vielleicht nicht wesentlich anders als Dorothys Epiphanie am Schluss von Der Zauberer von Oz: »Und wenn ich je wieder die Wünsche meines Herzens suchen sollte, dann werd’ ich nicht weiter streifen dafür als in unseren eigenen Garten«, doch ist Geringschätzung bei Thoreau oft ein Paradox. Aber warum auch Concord verlassen, wenn es dort so ist wie in einem Gedicht von ihm beschrieben:
Our village shows a rural Venice,
Its broad lagoons where yonder fen is;
As lovely as the Bay of Naples
Yon placid cove amid the maples;
And in my neighbor’s field of corn
I recognize the Golden Horn.
Unser Dorf ist ein ländliches Venedig
Mit seinen breiten Lagunen dort hinten im Moor;
Lieblich wie die Bucht von Neapel
Jene beschauliche Wölbung im Ahorn;
Und in des Nachbarn Getreidefeld
Sehe ich das Goldene Horn.
Man ist diese Pose von Thoreau gewohnt, die liebenswerte, aber mitunter auch unerträgliche Stubenhockersturheit des amerikanischen Welterklärers vom Land, der noch nie in Venedig, Neapel oder der Türkei war und auch nicht vorhat, je dorthin zu reisen.