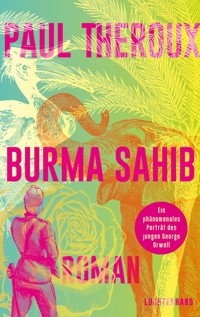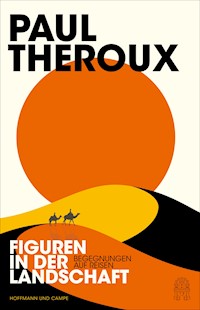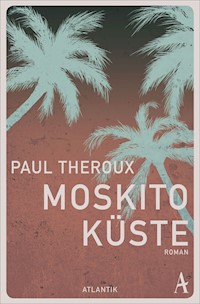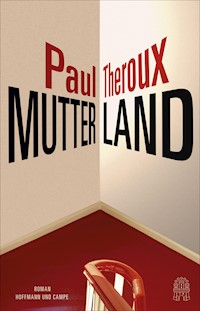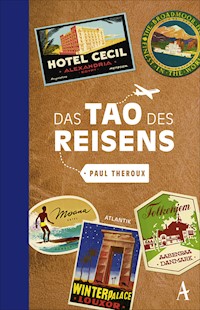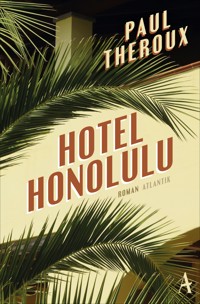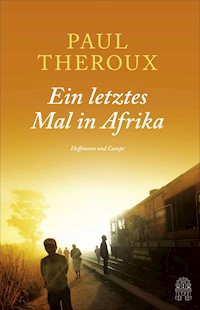
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Nach zehn Jahren kehrt der 72-jährige Paul Theroux zurück in sein geliebtes Afrika – »das Königreich des Lichts« – und findet ein zerstörtes Paradies. Er will von Kapstadt aus durch Namibia und Angola nach Timbuktu reisen, doch mit jeder Meile nordwärts werden das Elend, die Korruption und seine Frustration über die Entwicklungen des 21. Jahrhunderts und die verheerenden Bemühungen der Hilfsorganisationen größer. Trotz aller Schönheit, der er jenseits der Städte begegnet und von der er mit Liebe und Humor erzählt, bricht er seine Reise ab und macht sich desillusioniert auf den Weg zurück nach Südafrika. Sein Buch erzählt auf sehr persönliche Weise von einem Kontinent im Niedergang und einem empfindsamen Menschen, dessen Erschütterungen sich unmittelbar auf den Leser übertragen. Eine Reise ins Herz der Finsternis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Paul Theroux
Ein letztes Mal in Afrika
Aus dem amerikanischen Englisch von Sigrid Schmid und Reiner Pfleiderer
Hoffmann und Campe
Für Albert und Freddy,
Sylvie und Enzo,
in Liebe, Euer Opa
Wenn mein Vater früher auf Reisen war, fürchtete er sich nicht vor der Dunkelheit. Aber hatte er noch alle seine Zehen?
Sprichwort der Bakongo (Angola)
Gott der Allmächtige sprach zu Mose, Friede sei mit ihm: Nimm einen Eisenstab und ziehe eiserne Sandalen an, und dann reise um die Erde, bis der Stab zerbrochen und die Schuhe durchgelaufen sind.
Muḥammad Ibn-Aḥmad as-Sarrāǧ, Uns as-sārī was-sārib(Labsal dessen, der bei Tag und Nacht reist – ein marokkanisches Pilgerbuch des frühen 17. Jahrhunderts), 1630
1Bei den (Un-)Wahren Menschen
In der heißen Buschebene im äußersten Nordosten Namibias kletterte ich über einen aufragenden Termitenhügel aus glattem, von Ameisen zerkautem Sand. Auf der Spitze dieser winzigen Anhöhe stehend, fächerte sich vor meinen Augen die majestätische Landschaft auf wie die knisternden Seiten eines noch ungelesenen Buches.
Dann stolperte ich weiter den kleinen, größtenteils nackten Männern und Frauen hinterher, die schnellen Schrittes unter dem feurig goldgefleckten Himmel durch das dürre Buschland eilten, das auf Afrikaans einst einfach Boesmanland (Buschmannland) hieß. Insgesamt waren wir neun – lachende Frauen mit hängenden Brüsten, eine Frau hatte sich ein Tuch umgebunden, aus dem der wippende Kopf eines Kleinkinds ragte wie eine flaumige Frucht, Männer in Lederschurzen mit Speeren und Bogen in den Händen – und ich dachte, wie so oft auf meinen jahrelangen Reisen um die Erde: Die besten Menschen haben nackte Hintern.
Ich war froh, wieder in Afrika zu sein, dem Königreich des Lichts, als ich zu Fuß auf neuen Wegen durch diese uralte Landschaft stapfte und mich an »einer greifbaren, vorstellbaren, erlebbaren Vergangenheit – an der nahen Ferne und den offenkundigen Mysterien« – erfreute. Ich kauerte mit schlanken Menschen zwischen den Büschen, die goldfarbene Haut hatten und zum ältesten Volk der Erde gehörten; ihr Stammbaum ließ sich bis in die dunkle Vergangenheit und die Abgründe der Zeit im Jungpleistozän zurückverfolgen, etwa 35000 Jahre weit, zu den nachweislichen Vorfahren aller Menschen, den wahren Aristokraten dieses Planeten.
Das Schnauben eines Tieres außer Sicht ließ uns anhalten. Dann raschelte sein Hinterteil durchs Unterholz. Dann das hüpfende Trappeln von Hufen auf losen Steinen.
»Kudu«, flüsterte ein Mann und horchte gebeugt nach den Bewegungen des Tieres, ohne zur Seite zu blicken. Er sprach den Namen aus wie den vertrauten Vornamen eines Bekannten. Dann sagte er noch etwas, das ich nicht verstand, aber ich lauschte ihm, als hörte ich neue Musik; seine Sprache war absurd und wohlklingend in meinen Ohren.
An jenem Morgen hatte ich in Tsumkwe, der nächstgelegenen Stadt – die keine Stadt war, sondern eine sonnenverbrannte Straßenkreuzung mit vielen Hütten und ein paar wenigen schattenspendenden Bäumen – im Radio gehört: Finanzmärkte sind weltweit in Aufruhr und stehen vor der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Griechenland droht der Staatsbankrott, weil die griechische Regierung einen 45-Milliarden-Dollar-Kredit zur Begleichung der Staatsschulden abgelehnt hat. Damit steuern die Länder der Eurozone auf einen Finanzkollaps zu.
Die Menschen, denen ich folgte, lachten. Sie sprachen Khoisan und gehörten zur Volksgruppe der !Kung, die sich selbst Ju/'hoansi nennen. Der Name ist durch die Klicklaute schwer auszusprechen und bedeutet »Wahre Menschen« oder »Harmlose Menschen«. Sie lebten traditionell als Jäger und Sammler und hatten nie Geld verwendet. Inzwischen leben sie abgedrängt an den Rand des sogenannten Buschmannlands (diesen Teil nennen sie selbst Nyae Nyae) – manche von ihnen haben sich niedergelassen und besitzen Vieh oder Felder, doch auch heute noch bekommen diese Menschen nur selten Geld zu Gesicht und benutzen das verfallende Zeug fast nie. Sie ergänzen ihren Speiseplan immer noch durch Wild, Wurzeln und anderes Essbares, das sie draußen finden – und durch Almosen. Wahrscheinlich denken sie gar nicht über Geld nach, oder wenn sie es tun, dann wissen sie, dass sie nie welches haben werden. – Die Griechen randalierten und schimpften lautstark auf ihre Regierung, die Italiener demonstrierten in den Straßen von Rom gegen Armut, die Portugiesen und Spanier sahen mit leerem Blick dem Bankrott entgegen, und in den Nachrichten wurde über den Zusammenbruch wertloser Währungen und über harte Sparmaßnahmen berichtet, aber die Ju/'hoansi und ihre althergebrachte Lebensweise schien das nicht zu beeinträchtigen. Oder zumindest glaubte ich das in meiner Unwissenheit.
Die junge Frau vor mir fiel im Sand auf die Knie. Sie hatte ein hübsches elfenhaftes Gesicht mit asiatischem Einschlag – das auch etwas Außerirdisches hatte –, wie die meisten San. Ein unschuldiges und bezauberndes Gesicht wie das eines Kindes. Sie fuhr mit den Fingern über eine Ranke, die aus dem Sand ragte, ging, auf einen Ellbogen gestützt, in die Hocke und begann zu graben. Bei jeder Handvoll Sand strahlten ihre Augen, ihre Brüste bebten, und nach weniger als einer Minute zog sie eine fingerartige Wurzel aus dem dunklen, auffallend feuchten Loch, das sie gegraben hatte, und legte sie auf ihre Handfläche. Sie wischte Erde von der Wurzel, die in ihren Händen eine bleiche Farbe annahm. Lächelnd bot sie mir den ersten Bissen an.
»Nano«, sagte sie, was für mich als »Kartoffel« übersetzt wurde.
Von der Konsistenz und vom süßlich-erdigen Geschmack her erinnerte die Wurzel an eine rohe Karotte. Ich gab ihr den Rest zurück, den alle miteinander teilten, jeder durfte daran knabbern, neun Bissen. In den Wäldern, Wüsten und Hügeln überall auf der Welt teilen Sammlervölker wie die Ju/'hoansi ihre Nahrung penibel; dieses Miteinanderteilen schweißt die Gemeinschaft zusammen.
Vor uns knieten sich zwei der Männer auf verstreut herumliegenden Nussschalen und altem Laub eines Dornbuschs einander gegenüber auf den Boden und drehten abwechselnd einen fünfzig Zentimeter langen Stock zwischen den Händen. Nach kurzer Zeit stieg vom unteren Ende der Spindel, wo sich der Stock in einem Stück weichem Holz drehte und es zunehmend schwärzte, eine Rauchfahne auf. Den Stock bezeichnen sie als Mann; das untere Stück Holz mit der Einbuchtung als Frau. Das heiße gebohrte Holz begann zu glimmen, und einer der Männer hob das glühende, schwach rauchende Brett an, blies mit einem Kussmund Luft in die Glut und fachte sie so weiter an. Er sprenkelte erst Nussschalen und trockenes Laub darauf, dann kleine Zweige. Wir hatten ein Feuer.
Die Streiks in Griechenland haben in vielen Städten zu Stromausfällen geführt. Es wird erwartet, dass die Regierung ihre Schulden nicht zurückzahlen kann, Europa in noch größere Unsicherheit stürzt und die Zukunft des Euro in Frage stellen wird. Das könnte auch amerikanische Banken in Gefahr bringen. In Athen werfen Demonstranten gegen die immer strengeren Sparmaßnahmen Steine und plündern Läden …
Die Nachrichten schienen von einem anderen Planeten zu kommen, von einem dunklen, chaotischen Planeten, nicht diesem strahlenden Ort der kleinen, sanftmütigen Menschen, die in den gesprenkelten Schatten der niedrigen Büsche lächelten; die Frauen gruben mit Stöcken weitere Wurzeln aus, eine saß im Halbschatten und stillte ihr zufrieden nuckelndes Baby.
Ihnen blieben die verwirrenden und seltsam orphischen Metaphern der zusammenbrechenden Märkte erspart – Die Subprime-Krise war nur die Spitze des Eisbergs eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs und Die Schulden der Regionalverwaltungen in Spanien erhöhten sich um 22 Prozent auf fast 18 Milliarden US-Dollar und Die Gefahr für wirtschaftliche Schäden in New York City durch die europäische Schuldenkrise ist extrem hoch, weil die Banken Wertpapiere im Wert von mehr als einer Billion US-Dollar halten –, ebenso wie die höhnische Erkenntnis, dass Geld nur zerknittertes, farbiges Papier ist, kaum besser als Bonbonpapier, und dass die Märkte selbst mehr oder weniger Spielhöllen sind. Zehn Tage hintereinander … Die Panik, die Wut, die Hilflosigkeit der Menschen, die in stagnierenden Städten eingesperrt waren wie Affen im Käfig. Sollte Griechenland seine Schulden nicht zurückzahlen, stürzt es in eine Todesspirale.
Am prasselnden Feuer wurden weitere Wurzeln herumgereicht.
»Sehen Sie, Mister Bol…«
Ein in der Hocke sitzender Mann hatte eine Falle gebaut. Dazu hatte er Ranken zerteilt und zu Garn verdreht und damit die Spitze eines heruntergebogenen Astes in der Erde verankert. Er tippte mit den Fingern auf den Sand, um mir vorzuführen, wie die Falle nach den tapsenden Füßen eines achtlosen Vogels schnappte, eines Perlhuhns vielleicht – die gab es hier zahlreich –, das sie dann rupfen und auf dem Feuer rösten würden. Sie zeigten mir die Giftpflanzen und erzählten von den Käfern, die sie zerstießen und auf ihre Pfeilspitzen auftrugen, um daraus tödliche Waffen zu machen, und auch von den Blättern, mit denen sie Bauchschmerzen linderten, den Zweigen, mit denen sie Wunden reinigten oder die gegen Hautausschläge wirkten.
Diese »Wahren Menschen«, die Ju/'hoansi, waren von dem Moment an verfolgt, bedrängt, ermordet und vertrieben worden, als die ersten Weißen im Jahr 1652 in Afrika an Land gekommen waren. Diese Weißen waren Jan van Riebeeck mit Frau und Kind und einer kleinen Schar weiterer Holländer, die dem Land den Namen Groot Schur, Gute Hoffnung, gaben und sich dort niederließen, um Gemüse für eine »Versorgungsstation« anzubauen, die holländische Schiffe auf dem Weg nach Ostasien beliefern sollte.
Die Neuankömmlinge waren penibel, was das Thema Rassen betraf, und hatten die typisch holländische Vorliebe für feine Unterscheidungen. So schufen sie eine Klassifikation der einheimischen Völker. Sie bezeichneten die ziegenhütenden Khoikhoi als »Hottentotten« (in Anlehnung an die alveolaren Klicklaute, mit denen diese sprachen), die Bantu als »Kaffir« (»Ungläubige« – die Holländer hatten das Wort von den Portugiesen übernommen, die es bei arabischen Händlern gehört hatten) und die !Kung San als »Buschmänner« nach deren bevorzugtem Lebensraum. Den Namen San hatte das Hirtenvolk der Khoikhoi ihnen gegeben – es war ein abwertendes Wort für »viehlos« (im Sinne von rückständig). Die Holländer verdrängten all diese Völker, als sie das Land in Besitz nahmen. Zwar wehrten sie sich alle, und die sogenannten !Kung San zogen sich recht schnell zurück, allerdings nicht schnell genug. Die Buren machten noch im späten 19. Jahrhundert zum Spaß Jagd auf sie. Aber diese angeblich rückständigen Menschen – autarke Jäger und Sammler, die Städte hassten und scheinbar jenseits der Weltwirtschaft lebten – würden, so glaubte ich, den längeren Atem haben.
Auch später noch, als diese Ju/'hoansi, die ich besuchte, ihre Perlen, Grabstöcke, Pfeil und Bogen abgelegt und die hübschen Felle, die sie trugen, gegen zerlumpte westliche Kleidung – zerrissene Hosen, verblichene T-Shirts, Gummi-Flipflops, Röcke und Blusen, Altkleider, die in Ballen aus Europa und den USA geschickt wurden – eingetauscht hatten, selbst dann behielten sie ihre Ausstrahlung. Die Ju/'hoansi wirkten immer noch uralt und unverwüstlich und weise, gründlich angepasst an ihr Leben im Busch; über die Torheit und Inkompetenz der Welt da draußen lächelten sie leise.
Das war meine Wahrnehmung. Oder war es eine Illusion? Vielleicht führten sie für mich nur ein Schauspiel ihrer alten Lebensweise auf, wie die Mohawks in einem Historienspiel, die mit perlenbesetzten Wildlederjacken in Birkenrindenkanus den Fluss Hudson entlangpaddeln. Wer das Verhalten der Ju/'hoansi für typisch hält, wie einige Anthropologen geschrieben haben, erhält einen liebevoll erfundenen Mythos aufrecht, eine Travestie im wörtlichen Sinn, bei der die Teilnehmer sich nur verkleiden und ein Leben romantisch verklären, das antiquiert und für immer verloren ist.
Die Ju/'hoansi wurden verstreut und umgesiedelt, sie kämpften mit Alkoholismus, und viele von ihnen hatte das Stadtleben verdorben. Aber einen Teil ihrer Kultur haben die Ju/'hoansi bewahrt. Ihre Sprache ist intakt; sie haben noch ihre Geschichten und ihre Kosmologie; sie haben ihre Überlebensstrategien im Busch bewahrt und weitergegeben. Viele jagen auch heute noch Wild, wenn auch nicht mehr mit vergifteten Pfeilen; manche ergänzen ihre Ernährung immer noch mit Wurzeln; und sie können mit zwei aneinandergeriebenen Stöcken Feuer machen. Ihr Verwandtschaftssystem – Familien, Beziehungen, Abhängigkeitsverhältnisse – hat immer noch Bestand.
Sie wirkten auf mich immer noch wie die Wahren Menschen, auch wenn sie heute Lumpen statt Fellen trugen. Aber vielleicht sah ich auch nur, was ich sehen sollte. In ihren Köpfen (so vermutete ich) waren die alten Traditionen noch lebendig, denn sie hatten noch ihre traditionellen Fertigkeiten. Sie hatten sogar noch ihren ganz eigenen Gang. Im Gegensatz zu den Stadtbewohnern, diesen nachlässig schlurfenden Menschen, die vage grinsend in die Ferne blicken, waren die Ju/'hoansi wachsam. Sie trödelten nie, gingen nie gebeugt; sie bewegten sich schnell, aber lautlos, die Körper gerade, lauschten dabei. Sie tanzten eher, als dass sie durch den Busch gingen, leichtfüßig auf den Fußballen, ein graziöser Gang.
Sie waren an die harschen Bedingungen eines Lebens in der Halbwüste angepasst und hatten ein Gespür für die Tiere, die sie jagten. Aber den Völkern, die sie verfolgten, unter ihnen die Khoikhoi, die Herero und die Weißen, sind sie nie gewachsen gewesen. Ein paar !Kung San, die das Pech hatten, in der Nähe von Städten zu wohnen, sind durch oshikundu vergiftet und neutralisiert worden, dem Bier, das in Namibia aus vergorener Sorghumhirse gebraut und in Dörfern und Shebeens verkauft wird. (Shebeen ist ein irisches Wort, das »schlechtes Bier« bedeutet. Es wurde von irischen Einwanderern in Südafrika eingeführt als Bezeichnung für die übelsten Spelunken.)
Wegen ihrer Sanftmütigkeit, ihrer komplexen Glaubensvorstellungen und ihres weit zurückreichenden Stammbaums sind die !Kung San zu Lieblingen ausländischer Agenturen und Hilfsorganisationen geworden. Und auch der Anthropologen: Die !Kung San zählen zu den am intensivsten erforschten Völkern Afrikas. Jene, die auf sie herabblicken, könnten viel mehr von ihnen lernen als ihnen beibringen. Sie sind zuallererst ein friedliebendes, egalitäres Volk, dessen Erfolgsgeheimnis das Miteinanderteilen und das gemeinschaftliche Leben sind. In der Vergangenheit haben sie sich lieber tief in den Busch zurückgezogen, als in einem aussichtslosen Krieg vernichtet zu werden. Sie sind bekannt für ihre Geduld und daher ein zufriedenes Volk. Sie sind vor allen anderen da gewesen – haben gejagt, Feuer gemacht und nach Wurzeln gegraben –, und ich war überzeugt, dass sie auch noch da sein würden, wenn sich der Rest der Welt selbst zerstört hatte.
Sie haben immer in der Peripherie gelebt. Könnte irgendein Außenstehender von einer wohltätigen, Spenden sammelnden, Altkleider verteilenden Organisation oder ein edler Spender ihnen eine bessere Lebensweise zeigen? Äußere Umstände – vor allem politische – haben dazu geführt, dass die Ju/'hoansi an einem Ort bleiben mussten, und obwohl sie eigentlich Nomaden sind, haben sie Ackerbau und Viehzucht lernen müssen. Doch in der Vergangenheit waren sie Jäger und Sammler mit einer starken Verbindung zum Land, das sie als ihre lebendige Mutter betrachteten. Würden sie dann nicht auf diese Weise überdauern?
Viele Afrikaner stammen von untergegangenen Kulturen ab, den verstreuten Überbleibseln alter Reiche, die von Sklavenhändlern aus Arabien und Europa zerstört oder gestürzt wurden – den Königreichen Dahomey und Kongo, dem riesigen Kaiserreich Monomatapa im Südafrika des 15. Jahrhunderts. Wie die Agrarvölker des alten Europa vergaßen auch viele Afrikaner ihr traditionelles Wissen über Strohdächer, Schmiedekunst, Holzschnitzen, Ackerbau oder wie man Nahrung sammelt, oder sie gaben diese Fähigkeiten auf. Vor allem aber verloren sie die größten Fähigkeiten von allen, den gegenseitigen Respekt und die Fairness, die es Menschen ermöglichen, freundlich zusammenzuleben. In wenigen Jahrzehnten wird die Mehrheit der Afrikaner in Städten leben. Heute leben laut dem »State of African Cities 2010 Report« von UN-Habitat 200 Millionen im südlichen Afrika in Slums, mehr als irgendwo sonst auf der Welt. Und die Bezeichnung »Slum« passt eigentlich nicht für diese unfassbar chaotischen Orte ohne Zukunft.
Die nächstgelegene Stadt vom winzigen Dorf der Ju/'hoansi aus, der Verkehrsknotenpunkt Tsumkwe, etwa fünfundvierzig Kilometer entfernt, hatte ein paar Annehmlichkeiten zu bieten: einen Laden, in dem Konserven, Brot und Süßigkeiten verkauft wurden, eine Tankstelle und einen rudimentären Straßenmarkt – sieben improvisierte Stände, an denen Kleidung, Fleisch, selbstgebrautes Bier und, am letzten Stand, Haarverlängerungen angeboten wurden. Die Verkäufer gähnten in der Hitze; die Geschäfte liefen schlecht.
Ich hatte schon seit vielen Jahren die !Kung San besuchen und im Land umherwandern wollen. Und ich hatte noch ein weiteres Motiv. Für ein früheres Buch, Dark Star Safari, war ich auf der rechten Seite Afrikas über Land von Kairo nach Kapstadt gereist. Dieses Mal wollte ich diese Unternehmung spiegeln und meine Reise von Kapstadt aus fortsetzen. Ich wollte sehen, wie sich die Stadt in den letzten zehn Jahren verändert hatte, und danach in einer anderen Richtung nach Norden reisen, auf der linken Seite des Kontinents, bis ich die Endstation erreichte, entweder das Ende der Straße oder meiner Reiselust.
Doch es gab noch weitere, ebenso dringliche Gründe. Vor allem wollte ich von den Menschen weg, die meine Zeit mit Trivialitäten verschwendeten. »Ich glaube, dass der Geist auf Dauer entweiht werden kann durch die Gewohnheit, nichtige Dinge aufzunehmen, sodass alle unsere Gedanken einen Anstrich von Nichtigkeit erhalten«, schrieb Thoreau in seinem Essay Leben ohne Grundsätze.
Mit meinem Weggang wollte ich mich all jenen entziehen, die mich verfolgten und belästigten. Ich wollte unerreichbar sein und nicht mehr nach der Pfeife der E-Mail-Schreiber tanzen müssen oder jener Leute, die mich immer ermahnten: »Wir müssen uns an die Termine halten!« – wobei das immer die Termine anderer Leute waren, nicht meine. Ohne jede Verbindung nach Hause zu reisen, außer Sicht- und Reichweite, ist ein Genuss. Ich hatte diese Freiheit verdient: Für meinen letzten Roman hatte ich eineinhalb Jahre am Schreibtisch gesessen, und nach seiner Fertigstellung hatte ich es satt. Ich wollte aus dem Haus kommen – und nicht nur aus dem Haus, sondern ganz weit weg. »Ich mache diese wunderbare Reise nicht, um mich selbst zu betriegen, sondern um mich an den Gegenständen kennenzulernen«, schrieb Goethe in der Italienischen Reise. »Überhaupt ist mit dem neuen Leben, das einem nachdenkenden Menschen die Betrachtung eines neuen Landes gewährt, nichts zu vergleichen. Ob ich gleich noch immer derselbe bin, so mein’ ich, bis aufs innerste Knochenmark verändert zu sein.«
Afrika reizte mich, weil es immer noch so leer ist, so unvollendet wirkt, voller Möglichkeiten, weswegen es Wichtigtuer und Analysten anzieht, Voyeure und Hobby-Philanthropen. Vieles ist dort noch wild, und trotz des Hungers ist der Kontinent hoffnungsvoll, vielleicht eine Folge der Verzweiflung. »Ich will eine Wildheit, deren Anblick keine Zivilisation ertragen kann – als ob wir vom roh verzehrten Knochenmark der Kudus lebten.« Die Reise durch Afrika war auch mein persönlicher Widerstand gegen die Beschleunigung durch Technologie – ich widersetzte mich und ließ mich zurückfallen, und so lernte ich die Welt und die Geduld kennen.
Afrika hatte sich in zehn Jahren verändert, und ich mich auch. Die Welt war älter geworden, und das Reisen selbst hatte sich gewandelt und beschleunigt. Es heißt, die bekannte Welt sei noch nie so gut erforscht und so gut erreichbar gewesen. Im Jahr 2011, in dem ich reiste, besuchten eine Million Touristen Namibia, in Südafrika waren es fast doppelt so viele. Aber diese Besucher hielten sich an sichere und ausgetretene Routen. Viele Orte in Südafrika bekamen nur selten einen Touristen zu sehen, und in Namibia beschränkten sich die Touristen auf die Wildparks und die Küste, wagten sich nur selten in den hohen Norden, das unwirtliche Grenzland zu Angola. Und auch unter den kühneren Reisenden, den Rucksacktouristen und Wanderern, hatte ich noch keinen getroffen, der tatsächlich die Grenze nach Angola überquert hatte.
Die bekannte Welt ist gut bereist, und auch entfernte Orte tauchen auf Touristenrouten auf (Bhutan, die Malediven, das Okavango-Delta, Patagonien), doch es gibt Orte, die kein Fremder besucht. Die Reichen fliegen in Charterflugzeugen mit eigenem Gourmet-Koch und Fremdenführern zu abgelegenen Landepisten in Afrika. Alle anderen machen Pauschalreisen oder ziehen auf gut Glück mit dem Rucksack los. Doch es gibt Orte, die aus dem Blickfeld rutschen, zu unzugänglich oder gefährlich für Reisende sind. Viele Wege im Busch enden im Nichts. Und manche Länder sind bis auf weiteres geschlossen. In Somalia herrscht Anarchie, und das Land steht nur bei Waffenhändlern auf der Reiseroute. Die Zwangsherrschaft macht Zimbabwe unwirtlich. In anderen Ländern – der Kongo ist ein gutes Beispiel – gibt es keine nennenswerten Straßen. Doch selbst wenn es Straßen gäbe, wären weite Teile des Kongos dennoch feindliches Sperrgebiet, in dem Milizen, Stammesfürsten und Warlords herrschen. So war es schon, als Henry Morton Stanley das Land zu Fuß und auf dem Fluss durchquerte.
Bei meiner Reiseplanung las ich immer wieder von militanten Islamisten, die in Niger und Tschad Ungläubige töteten und die Gegend unsicher machten, und in Nigeria ermordeten die sogenannten Boko-Haram-Gangs – Muslime, die den Anblick von verwestlichten Nigerianern nicht ertrugen – jeden Mann in Hosen und T-Shirt und jede Frau im Kleid. Diese Gruppen suchten nach leichten Zielen – Rucksacktouristen, Wanderer, Leute wie ich.
Daher brach ich mit einer düsteren Vorahnung zu dieser Reise auf. Ein Mann, der seit fünfzig Jahren unterwegs war, war ein leichtes Ziel: Allein und im Rentenalter, fiel ich in Ländern wie Namibia auf, wo die durchschnittliche Lebenserwartung bei 43 Jahren liegt. Ich beruhigte mich damit, dass man in Afrika einen alten, alleinreisenden Mann als schrulligen Kauz belächeln würde. Meine Kleidung war abgetragen, ich hatte eine Zwanzig-Dollar-Armbanduhr und eine billige Sonnenbrille und trug ein kleines Zwanzig-Dollar-Handy aus Plastik bei mir – warum sollte mich da jemand überfallen?
Ich vermutete außerdem, dass dies eine Abschiedsreise werden würde. Für viele ältere Autoren, und auch ein paar nicht ganz so alte, ist Afrika das letzte Reiseziel gewesen. Die letzte ernsthafte Reise, zu der Joseph Conrad aufbrach, seine achtundzwanzigtägige Schiffsreise auf dem Kongo, bildete die Grundlage für seine eindrucksvolle Erzählung Herz der Finsternis, die er acht Jahre nach seiner Rückkehr aus Afrika schrieb. Er beschrieb die Geschichte als »Erfahrungsbericht, der ein wenig (und nur ein ganz klein wenig) über die tatsächlichen Geschehnisse hinausgeht«. Nach einem Leben auf Reisen verbrachte Evelyn Waugh den Winter des Jahres 1959 in Ost- und Zentralafrika und schrieb darüber in A Tourist in Africa. Er starb sechs Jahre später. Laurens van der Post und Wilfred Thesiger verbrachten ihre letzten Jahre auf Reisen in Afrika – van der Post in der Kalahari-Wüste, Thesiger im Hochland von Kenia – und schrieben darüber. Hemingways letzte Safari, seine letzte richtige Reise, führte ihn in den Jahren 1953 bis 1954 nach Ostafrika, und obwohl er sich sechs Jahre später erschoss, wurde seine Romanversion dieser Safari, Die Wahrheit im Morgenlicht, überarbeitet von seinem Sohn Patrick, erst im Jahr 1999 posthum veröffentlicht. Nachdem V.S. Naipaul sein Afrikanisches Maskenspiel, eine umfangreiche Untersuchung über die »afrikanischen Religionen« in sechs afrikanischen Ländern, veröffentlicht hatte, machte er deutlich, dass dies sein letzter Reisebericht sein würde.
Afrika kann rau sein, und Teile davon sind wirklich furchterregend, aber wie Naipauls Bericht zeigte, kann es kränkelnden älteren Reisenden gegenüber auch freundlich sein. Man könnte erwarten, dass die Menschen dort sagen: »Geh heim, alter Mann.« Aber nein – in aller Regel weist Afrika niemanden ab.
Das macht diesen grünsten aller Kontinente zur perfekten Wahl für eine Abschiedsreise, eine Gelegenheit, der Natur und dem entweihten Garten Eden, aus dem wir stammen, Respekt zu erweisen. »Alle Arten von Hunger treten dort offen zutage«, schrieb der englische Autor und Reisende V.S. Pritchett vor fünfzig Jahren über Spanien. Aber seine Worte könnten auch Afrika beschreiben. »Man sieht dort alle Grundbedürfnisse, die unser Leben bestimmen, und doch werden die Leidenschaften der menschlichen Natur dank einer erstaunlichen Kombination aus Stoizismus, Fatalismus und Lethargie gerade so im Zaum gehalten.« In Afrika sieht man die Menschheitsgeschichte auf den Kopf gestellt, und in Afrika kann man sehen, wo die Menschheit in die Irre ging.
»Afrika gibt einem das wichtige Gefühl zurück, dass die Welt riesig, wunderbar und edel ist«, schrieb ein anderer Reisender in ebendieser Region, Jon Manchip White, in The Land God Made in Anger. »Die Experten haben unrecht: Unser Planet ist weder überfüllt noch verachtenswert.«
Wenn man alleine reist, hat man insbesondere die Freiheit, sein zu können, wer man sein will. Viele Länder sind gefährdet, und die Zukunft vieler Orte ist bedroht. Ich denke da an die radioaktive Ukraine, das anarchische Tschetschenien, die überlasteten Philippinen oder das tyrannisierte Weißrussland. All diese Länder würden Unterstützung begrüßen, aber wenn ein Prominenter oder ein Ex-Präsident oder eine andere Persönlichkeit des öffentlichen Lebens wohltätig wahrgenommen werden will, dann geht er oder sie fast immer nach Afrika, weil es exotisch ist – oder geht es um den dramatischen Schwarz-Weiß-Kontrast oder darum, dass der Kontinent so faszinierend unverständlich ist? In Afrika hat der Reisende unbegrenzte Freiheit, und Afrika selbst verstärkt die Erfahrung, wie es kein anderer Ort kann.
Ich war, wo ich sein wollte, und wusste das, als ich den munteren, leichtfüßigen Ju/'hoansi im Sonnenschein durch das Buschland von Nyae Nyae folgte. Durch diese Art des Reisens gewann ich meine Jugend zurück, denn als zweiundzwanzigjähriger Lehrer an einer kleinen Schule im ländlichen Afrika hatte ich einige der glücklichsten Jahre meines Lebens verbracht – erfüllt von Freiheit, Freundschaft und großen Hoffnungen.
Meine düsteren Vorahnungen bezüglich dieser Reise hatten damit zu tun, dass Reisen ins Unbekannte wie Sterben sein können. Nach all dem Abschiedsschmerz und der Abreise selbst scheint man zu schwinden, wird immer kleiner und kleiner, verblasst in der Ferne. Nach einiger Zeit vermisst einen niemand mehr, außer auf eine nachlässige, leicht scherzhafte Art, mit der man sagt: »Was wurde eigentlich aus dem alten Soundso, der damit gedroht hat, er werde nach Afrika abhauen?« Man ist weg, niemand kann sich mehr auf einen verlassen, und wenn man nur noch eine verblasste Erinnerung ist, dann mischt sich Bitterkeit in die Erinnerung, so wie man Toten manchmal übelnimmt, dass sie tot sind. Was nützt man schon, wenn man unerreichbar und weit weg ist?
So wird man zu zwei Geistern, weil man auch in jenem fernen Land ein Gespenst ist, das mit dem Gesicht ans Fenster einer fremden Kultur gepresst ein fremdes Leben anstarrt. Und vieles von dem, was man sieht, hat eine Kehrseite, wie das harmonische Leben im Busch.
Ich brauchte eine Weile, um zu erkennen, dass das Fenster Afrikas, wie das Fenster eines Zuges, der durch die Nacht rast, ein Zerrspiegel ist, der zum Teil das Gesicht des Betrachters zurückspiegelt. Bei den Ju/'hoansi erlebte ich tatsächlich ein Historienspiel, und ich erkannte, dass diese Leute, die sich die Wahren Menschen nannten, leider, eine Lüge waren. Die heroische Welt der Ju/'hoansi mit der goldfarbenen Haut war eine Illusion. Ich hatte gehofft, eine Rarität auf dieser Welt zu finden: ein Land der reinen Freude. Stattdessen war ich auf verzweifelte Menschen gestoßen, traurige Seelen ohne Hoffnung, nicht unzerstörbar, wie ich geglaubt hatte, sondern rettungsbedürftig.
2Der Zug aus Khayelitsha
Ein paar Wochen vor meinem Besuch bei den Ju/'hoansi, die in ihren einfachen Unterschlupfen auf dem Boden schlafen, immer wachsam wegen der nachtaktiven Raubtiere, erwachte ich in einem weichen Bett in einem Luxushotel, das zwischen den grünen Ausläufern des Tafelbergs und den glitzernden Wassern der Tafelbucht stand, aus tiefem Schlaf. Das war in Kapstadt mit seinen Hügeln und Felsen, der einzigen Stadt in Afrika, die eine gewisse Erhabenheit ausstrahlt.
Ich gähnte herzhaft wie ein Pavian, schaltete den Fernseher ein und sah dort die Unruhen in Europa, die Art von Fehlplanung und Chaos, die man normalerweise mit Afrika verbindet, und ich war dankbar, dass ich weit weg war. In den nächsten Tagen würde ich auf der Straße Richtung Norden aufbrechen nach Namibia, Botswana und Angola und vielleicht noch weiter. Langfristige Planungen waren unnötig. Ich war allein, reiste mit leichtem Gepäck und brauchte nur eine billige Hinfahrkarte. In die Nordkap-Provinz, zum abgelegenen Springbok, fuhr täglich ein Bus, der über Nacht weiterfuhr und die Grenze zu Namibia überquerte, den von Ost nach West fließenden Fluss Oranje.
Ich nahm meine Morgentabletten, zwei verschiedene gegen Gicht, eine Vitamintablette und eine gegen Malaria, wie es sich für einen älteren Reisenden gehört, und ließ mir dann Zeit, denn der Jetlag machte mir noch zu schaffen. Mir fiel ein, dass ich mich auf Reisen befand, und daher schrieb ich den ersten Eintrag, mit Datum, für mein Reisetagebuch über das Aufwachen im weichen Bett eines Luxushotels.
An einem so angenehmen Ort, egal wie fern er ist, glaubt man niemals, man könnte zu alt zum Reisen sein. Ich könnte das bis zu meinem Tod machen, denkt man, während man beim Zimmerservice Lotus zu essen bestellt (»Oder nein, ich nehme doch lieber das Wagyu-Steak mit Pfefferkruste und Schwarzer-Trüffel-Vinaigrette«). Erst wenn ich in einer Hütte im Busch sitze oder von einer feindseligen, stinkenden Menschenmenge angestarrt werde (»Miester! Miester!«) oder einen dubiosen Eintopf mit schwarzem Fleisch oder einen Teller mit kalten, halb rohen, fettigen und mit Augen übersäten Kartoffeln esse oder in einer Klapperkiste neun Stunden lang eine Bergstraße voller Schlaglöcher hinunterpoltere – erst dann kommt mir der Gedanke, dass ein anderer das machen sollte, vielleicht ein Jüngerer, mit mehr Lebenshunger, mehr Kraft, der verzweifelter ist, verrückter.
Aber da ist diese Sache namens Neugier, die als Forscherdrang gewürdigt wird, und diese Neugier hat mein Leben als Reisender und als Schriftsteller bestimmt.
In weiten Teilen Europas und Nordamerikas gilt ein neugieriger Blick als aufdringlich, und auf neugierige Fragen gibt es häufig böse oder wenig hilfreiche Antworten. »Du schreibst ein Buch, Kumpel? Dann lass dieses Kapitel weg.« Aber in Afrika wird besondere Aufmerksamkeit als Anteilnahme begrüßt, vor allem wenn die üblichen Höflichkeiten ausgetauscht und die Stammessitten beachtet werden. Ich wollte eigene Erfahrungen machen, das hatte mich in diese wunderschöne Stadt und auf diesen Kontinent zurückgeführt, diese belebende Lust, die uns alle immer wieder überrascht und viele von uns immer weiterziehen lässt.
Beim Frühstück – Lachs, Rührei, Obst, Guavensaft, grüner Tee, Vollkorntoast und »Bitte reichen Sie mir die Marmelade« – las ich in der Cape Times die Überschriften »Berg nachts geschlossen« und »Stadt reagiert auf Angriffe«. Der Grund für die Absperrung des Tafelbergs nach Einbruch der Dunkelheit war Kriminalität – Räuber und Diebe, oder Tsotsis und Skelms, wie Gauner im südafrikanischen Slang hießen. Zahlreiche nächtliche Spaziergänger und Leute, die in ihren geparkten Autos die Lichter der Stadt bewundern wollten, waren angegriffen, bewusstlos geschlagen und beraubt worden. Keine Ahnung, wie man einen solchen Berg abriegeln kann. Dieser riesige, dominante Felsblock, dessen Hochplateau drei Kilometer breit ist, erstreckt sich als Bergrücken sechzig Kilometer weit bis zur Kapspitze.
Aber dies hier war Afrika, wo sich alles schnell ändern konnte. Kaum einen Monat später wurde der Tafelberg (ebenso wie die Halong-Bucht in Vietnam, der Regenwald am Amazonas, die Iguaçu-Wasserfälle und drei weitere Orte) zu einem der sieben Naturwunder der Welt erklärt. Nachdem der Tafelberg weltweit als Wunder anerkannt war, wurde er stolz wieder für die Öffentlichkeit geöffnet.
Nachdem ich an jenem Tag im Luxushotel erwacht war, brach ich zu einem Spaziergang auf. Im Texies Fish and Chips in der Adderley Street am Grand-Parade-Platz beim Bahnhof aß ich gebratenen Aal und bewunderte die Aussicht, den offensichtlichen Wohlstand, das geschäftige Kommen und Gehen der Käufer, die Tauben, die von Passanten ausgestreute Krümel aufpickten. Dabei fielen mir im Schatten eines Torbogens, ganz in der Nähe meines Außentisches, einige junge Männer auf, die meinen Blick erwiderten. Einer von ihnen, ein magerer Teenager, sah, dass ich satt war, kam herüber und fragte zögernd: »Kann ich den Rest haben?« Ich nickte nur, völlig überrascht. Er ging mit den Essensresten – den fettigen Pommes – ein paar Schritte weiter, scheuchte dabei einige Tauben auf und verschlang das Essen.
Reiseliteratur ist manchmal nur ein literarisches Schmuckblatt für spottende Misanthropie und Mythomanie oder zusammengeschusterte Romantik, aber in jenem Moment fühlte ich nur hilfloses Mitleid. Und auf diesen verzweifelten Reflex sollte ich auf dieser Afrikareise noch öfter stoßen, auf den hungrigen, lauernden Mann oder Jungen, der darauf wartete, sich meine Reste oder die eines anderen holen zu können, und sie dann mit schmutzigen Fingern verzehrte.
Ich fragte mich, warum ich nach Afrika zurückgekehrt war, und die Antwort lautete wohl: Um genau das zu erleben, neben anderen zufälligen Begegnungen. Es wäre falsch gewesen zu behaupten, dass ich etwas suchte. Ich suchte nichts. Ich floh vor der Routine und der Verantwortung und meiner generellen Abscheu vor albernen Unterhaltungen, vor Gesprächen über Geld, Geschichten über Geld, das wiehernde Lachen bei Dinnerpartys. Abscheu ist ein Antrieb. Er machte den Zickzackflug von New York und die nächste Etappe nach Kapstadt erträglich, zweiundzwanzig Stunden Flug, dreißig Stunden Reisezeit insgesamt. Aber ich war froh, wegzukommen. Diese Reise war eine Zurückweisung, als würde ich mit meiner Abreise jenen törichten Menschen sagen: Das habt ihr jetzt davon. Und vielleicht hoffte ich, dass sie im Nachhinein sagen würden: Was ist passiert? Wo ist er? Habe ich etwas Falsches gesagt?
Vor allem aber wollte ich nach Afrika zurück und dort weitermachen, wo ich aufgehört hatte.
Zehn Jahre zuvor war ich hier durch den Slum einer Squattersiedlung namens New Rest auf der trostlosen Sandebene am Stadtrand von Kapstadt gegangen. Bei meiner Rückkehr war diese Siedlung mein erstes Ziel. Ich wollte sehen, was aus den Bretterbuden geworden war, den Klohäuschen, den verwahrlosten Menschen, die sich in dieser Einöde abseits der Schnellstraße niedergelassen hatten.
War es immer noch ein Ort voller Not, ein Slum aus Sperrholz und zerschlissenem Plastik, der schäbig zwischen den Dünen aus grobem Sand lag?
Die Mehrheit der schwarzen Südafrikaner lebt in den tieferen Lagen, nicht in malerischen Dörfern oder strohgedeckten Hütten auf grünen Hügeln. Drei Viertel der afrikanischen Stadtbewohner leben in abstoßenden Slums und Squattersiedlungen. Aber was geschieht mit diesen Orten nach einem Jahrzehnt oder mehr?
»Gehen Sie nicht in eine Squattersiedlung. Gehen Sie nicht in ein Township der Schwarzen. Sie werden ausgeraubt oder Schlimmeres«, hatte mir ein Angestellter, der Eltern mit unterschiedlicher Hautfarbe hatte, im Hauptbahnhof von Kapstadt an einem Sonntagmorgen vor zehn Jahren geraten, und er hatte sich geweigert, mir eine Fahrkarte nach Khayelitsha zu verkaufen.
Ich fragte ihn damals nach dem Grund. Seine unerschütterliche Überzeugung hatte meine Aufmerksamkeit erregt. Er verallgemeinerte nicht aufgrund der Hautfarbe. Er wollte mir nur keine Fahrkarte zur Gewalt verkaufen. Er erklärte, der Zug nach Khayelitsha werde regelmäßig von arbeitslosen Jugendlichen aus dem Township und der nahe gelegenen Squattersiedlung mit Steinen beworfen, die Fenster zerschmettert, die Fahrgäste angegriffen.
Aufgrund dieser Warnung ging ich am nächsten Tag zur Squattersiedlung New Rest, und damals schrieb ich über die tausendzweihundert Bretterhütten, die sich dort in einem Jahrzehnt auf dem sandigen, unfruchtbaren Boden der Cape Flats neben der verkehrsreichen Straße zum Flughafen angesammelt hatten. Die meisten der achttausendfünfhundert Einwohner lebten im Elend. Es war schlimm, aber nicht entsetzlich. Es gab kein fließendes Wasser; es gab keine Beleuchtung und keine Bäume. Es war windig und öde. Squatter hatten die Hütten einfach so auf sechzehn Hektar Sand gesetzt, daher gab es keine Anbindung an Kanalisation oder Stromversorgung, es stank und sah hässlich aus. Die Hütten waren aus ungleichen Brettern, Sperrholz, Blech und Plastikplanen zusammengeschustert. Durch die Lücken zwischen den Brettern blies der Wind Sand hinein. Ein Mann erzählte mir, er habe ständig Sand und Staub im Bett.
Schlimmer konnte das Leben nicht werden, dachte ich damals – diese städtische Barackenstadt, ohne Grün, zu sandig, als dass irgendetwas dort hätte wachsen können außer dürren Geranien und stacheligen Kakteen; die Menschen mussten ihr Wasser in Plastikeimern von Pumpen holen und ihre Hütten mit Kerzen beleuchten; die Hütten waren kalt im Winter, drückend heiß im Sommer und sehr dreckig, sie lagen beidseits einer Hauptverkehrsstraße mit all ihrem Lärm. Was konnte schlimmer sein? Sie als »informelle Siedlungen« zu bezeichnen, wie manche Leute es taten, machte es keinen Deut besser.
Doch trotz des Elends waren die Menschen in New Rest optimistisch und entschlossen. Ein Bewohner, der Mann, der über den Sand im Bett klagte, nahm mich zum New-Rest-Komitee mit, das sich regelmäßig in einer Hütte traf. Die Mitglieder des Komitees erzählten mir, diese Squatter seien vom Ostkap hergekommen, den alten, staatlich bestimmten Homelands Transkei und Ciskei, sowie aus den Slums von East London, Port Elizabeth und Grahamstown, Industriestädten, denen es seit der Unabhängigkeit wirtschaftlich schlecht ging. Ziele des New-Rest-Komitees waren Straßen, Wasseranschlüsse, Strom und – durch einen Prozess namens »Vor-Ort-Upgrade« – der Bau eines festen Hauses anstelle jeder Hütte.
Stadtplaner von der Universität Kapstadt hatten ehrenamtlich eine umfassende Planung entworfen und ausgearbeitet. Jede klägliche Hütte, egal wie klein sie war, hatte eine Nummer bekommen, und das Stück Land, auf dem sie stand, war erfasst worden. Man hatte eine Volkszählung durchgeführt. Die Transformation einer Squattersiedlung zu einer lebensfähigen Gemeinde – die Umwandlung eines Slums in eine Wohnsiedlung – war in Brasilien und Indien bereits erfolgreich durchgeführt worden, aber in Südafrika noch nicht. Die Triebkraft dahinter war der Stolz der Menschen, dass sie einen sicheren Ort zum Leben gefunden hatten. Auch Unterstützer aus dem Ausland hatten geholfen: Wohlmeinende Besucher hatten Geld für die Finanzierung der Kinderbetreuung gespendet, für drei Ziegelmaschinen und für die Einrichtung eines Treuhandfonds zugunsten der Siedlung. Der Fonds wurde ehrenamtlich von einem Safari-Unternehmen und dem New Rest/Kanana Community Development Trust verwaltet, der für den Tourismus in die Townships warb. Amerikaner und Europäer schickten regelmäßig Geld für Kleidung und Schulgebühren für ein paar Kinder. Es war ein improvisiertes Arrangement, das sich gerade so über Wasser hielt, bei dem aber Selbsthilfe eine Rolle spielte, und daher wünschte ich ihm Erfolg.
Was hatte sich seither getan?
Nach einem weiteren Gourmet-Frühstück im Hotel fuhr ich an meinem zweiten Tag in Kapstadt die Dreißig-Minuten-Strecke zum Berg und um ihn herum zur Squattersiedlung. Ich hatte einen Taxifahrer gefunden, der unweit von New Rest in der älteren Siedlung Guguletu lebte, die ich ebenfalls besuchen wollte, wie ich es zehn Jahre zuvor getan hatte.
In meiner Geburtsstadt Boston steht kein Besucher im Luxushotel auf und nimmt nach einem opulenten Frühstück ein Taxi, um aus rein voyeuristischer Neugier in die ärmeren Teile der Stadt zu fahren – in das Schwarzenviertel in Roxbury, wo der Malcolm-X-Boulevard zum Dudley Square führt; in die Armenviertel von Charlestown und Chelsea; oder in die ärmlichen Straßen von Everett, mit den Eckläden, Billardsalons und dreistöckigen Holzhäusern. Gaffer sind an diesen Orten nicht erwünscht, aber selbst wenn sie es wären, würde niemand einfach so hinfahren, weil die ärmeren Viertel von amerikanischen Städten als gefährlich gelten. Daher war ich mir meines Privilegs als Besucher in Südafrika sehr wohl bewusst – dass ich etwas tat, was ich zu Hause unterließ.
Und es war ganz einfach. In Kapstadt führen die gut beworbenen Stadtrundfahrten durch viele arme Townships, die zum Teil fast identisch sind. »Das hier ist Imizamo Yethu«, erzählt der Fremdenführer dann über Lautsprecher, wenn die Busrundfahrt sich einem Hang voller maroder Häuser und unbefestigter Straßen nähert. »Es bedeutet ›Unser Kampf‹ und war ursprünglich eine Squattersiedlung. Heute ist es ein Township. Es wurde in den 1980er Jahren gegründet, als die Passgesetze abgeschafft wurden. In den neunziger Jahren wuchs die Siedlung. Sie können hier aussteigen, wenn Sie einen Rundgang mit einem Bewohner der Gemeinde machen wollen. Der nächste Bus fährt in dreißig Minuten …«
Mein Fahrer hieß Thandwe. Er war aus dem Stamm der Xhosa und war vor siebenundzwanzig Jahren als kleiner Junge aus Port Elizabeth ans Ostkap gekommen, um bei seinem Onkel zu leben.
»Ich fahre hin und wieder nach Hause«, erzählte Thandwe. »Aber wohnen will ich hier.«
Wir fuhren den Highway entlang, den die meisten Besucher aus dem Ausland sehen, weil er die Hauptverbindung zum Internationalen Flughafen von Kapstadt ist. Ich wollte – erhoffte – gute Neuigkeiten; dass ich eine Veränderung sah.
»New Rest – wir sind da«, verkündete Thandwe und deutete auf eine Ansammlung kleiner Häuser mit rotbraunen Dächern, die hinter einem hohen Zaun abseits der Straße standen. Es waren keine überholten oder renovierten Hütten; dort standen neue, stabil aussehende Häuser, die sehr eng zusammenstanden, offensichtlich auf den Grundrissen der Schuppen und Hütten, die ich vor zehn Jahren gesehen hatte. Das war der »Vor-Ort-Upgrade«, den die Stadtplaner erhofft hatten.
Wir bogen vom Highway auf die Nebenstraße ab, die nach New Rest führte, und fuhren durch dieses sichtlich sanierte Township. Vor vierzig Jahren war dies eine ländliche Gegend gewesen mit einer spirituellen Aura und ritueller Bedeutung für das einheimische Volk der Xhosa. Initianten (mkweta) bei den Beschneidungszeremonien (ukoluka) wurden hier im Busch verborgen. Nachdem ihre Penisse mit einer Speerspitze (mkonto) beschnitten worden waren, blieben die Jungen als Gruppe dort, bis ihre Wunden verheilt waren. Vor zehn Jahren hatte man mir erzählt, dass die frisch beschnittenen Jungen im Juni und Dezember gesichtet wurden, »manchmal ganz viele, die sich im Busch auf der anderen Seite versteckten«.
Inzwischen sah man keine Jungen mehr. Alle Büsche waren zurückgeschnitten worden, auf dem früheren Buschland standen jetzt Häuser, und kein einziger Baum wuchs mehr dort. Aber ich hatte eine Veränderung gesehen, und ich verstand, wie es dazu gekommen war. Am Anfang hatten sich Menschen aus Dörfern in der Provinz eine Squattersiedlung aus Plastikplanen, Lumpen und gefällten Bäumen errichtet; dann hatten sie die Unterschlupfe mit alten Holzbrettern und Blech zu Hütten ausgebaut, aus denen die Shantytown entstand; mit der Zeit kamen Gemeinschaftstoiletten und eine Wasserpumpe dazu; und schließlich war die Siedlung durch die Beharrlichkeit der Menschen – jener, die mir bei meinem früheren Besuch erzählt hatten: »Wir bleiben hier. Das ist unser Zuhause« – sowie der ehrenamtlichen Stadtplaner und Unterstützer weiter aufgewertet worden. Inzwischen gab es eine Regierungsabteilung, das Reconstruction and Development Program, das für die Verbesserung und den Neubau der Squattersiedlungen sorgte.
»Es gibt jetzt Läden dort. Die Schule ist ganz in der Nähe«, erzählte Thandwe. »Ein Grund für diese Verbesserungen war die Fußballweltmeisterschaft.«
Nachdem Südafrika als Austragungsland für die FIFA-Weltmeisterschaft 2010 ausgewählt worden war, wurden in den größten Städten des Landes drei riesige Fußballstadien gebaut, und sieben bereits existierende Stadien wurden umfassend renoviert. Neue Hotels wurden errichtet und der öffentliche Nahverkehr verbessert, und durch all diese Investitionen entstand ein Bewusstsein, das dazu führte, dass Geld für die Wohnungen der Menschen ausgegeben wurde, die in den neuen Einrichtungen arbeiten würden. Die schlecht bezahlten Arbeiter, die dafür sorgen, dass Südafrika ein angenehmer Ort bleibt, die das Dienstbotenproblem gelöst haben – die Hausangestellten, Gärtner, Taxifahrer, Kellner, Kindermädchen, Krankenschwestern und Lehrer –, leben überwiegend in diesen Townships. Daher war die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen von essenzieller Bedeutung, um die Stadt am Laufen zu halten.
Am nächsten Tag fuhr ich mit einem anderen Fahrer ein weiteres Mal von meinem herrlichen Hotel im Stadtzentrum los. Dieser Mann hieß Phaks – »Pax« ausgesprochen. Er war mir als Experte für das Leben im Township empfohlen worden und wohnte selbst in der riesigen Siedlung Khayelitsha, die eine halbe Million Einwohner und achtzig Prozent Arbeitslosenquote hatte. Die Gegend war berüchtigt für Kriminalität, Trägheit, Glücksspiel, Gewalt und Saufgelage.
»Aber es ist nicht alles schlecht dort«, sagte Phaks, als wir den Highway entlangfuhren. Er war recht fröhlich, hatte aber wohl ein paar ungelöste Probleme, die ihm auf der Seele lagen, denn manchmal verdüsterte sich sein Gesicht und er wirkte bedrückt.
Wir machten einen Abstecher zu District Six, während der Zeit der Apartheid ein lebendiger Teil von Kapstadt, der dem Rassismus widerstanden hatte und als sicheres, multikulturelles Innenstadtviertel aufgeblüht war. Es war für Musik, gutes Essen, Farbenfreude und Lebenslust bekannt gewesen. In den späten 1960er Jahren wollte die Stadtverwaltung auf dem Land eine weiße Wohngegend errichten und siedelte die Bewohner des Viertels, getrennt nach Hautfarbe, in entsprechende Townships um – die Weißen in weiße Gegenden, die Schwarzen nach Khayelitsha, jene mit Eltern unterschiedlicher Hautfarbe (»Farbige«) nach Mitchells Plain und Bonteheuwel.
Man wollte dort ein rein weißes Viertel mit neuen Häusern errichten, das den Namen Zonnenbloom (»Sonnenblume«) erhalten sollte, aber das hatte nicht funktioniert. Niemand wollte dort leben, und vor zehn Jahren war dort nur noch eine Baubrache, die von zwei alten Kirchen eingerahmt wurde – nur die Kirchen waren von District Six übrig geblieben.
Aber seit dem letzten Mal waren einige Häuser gebaut worden. Im Jahr 2005 hatte das Reconstruction and Development Program etliche neue Häuser errichtet, und viele davon – aber nicht alle – waren bewohnt.
»Die sind für jene, die zurückkommen wollen«, berichtete Phaks. »Aber manche wehren sich.«
»Es liegt zentral, ist sicher, die Häuser sind neu. Warum wollen die Leute nicht wieder zurück?«, fragte ich.
»Sie sagen, es ist nicht mehr dasselbe, deswegen bleiben sie weg.«
»Was heißt ›nicht mehr dasselbe‹?«
»Es ist nicht mehr multikulturell. Nur noch schwarz.«
Als Nächstes fuhr er mich zum Langa-Township, das ein bisschen näher am eigentlichen Kapstadt und, wie viele andere Townships, direkt an der Hauptstraße zum Flughafen lag. Langa zeichnete sich dadurch aus, dass es eines der ersten schwarzen Townships gewesen war. Phaks erzählte, die ersten Siedler habe es dort im Jahr 1900 gegeben, aber der Historiker vor Ort widersprach ihm und sagte, es sei 1927 gewesen. Dann behauptete Phaks, der Name Langa bedeute »Sonne«, aber der Historiker sagte, das Township sei nach dem berühmten Stammesführer und regierungsfeindlichen Aktivisten Langalibalele benannt worden, der als unerwünschte Person an einen Ort in der Nähe verbannt worden war.
Der Lokalhistoriker, von Phaks beauftragt, uns zu begleiten, war ein Xhosa-Mann namens Archie, der erklärte, dieses Township sei ein Ergebnis des südafrikanischen Apartheidsystems, vor allem des Group Areas Act, der vorschrieb, dass Nicht-Weiße nur in ausgewiesenen Gegenden leben durften. Diese Ghettoisierung aller Nicht-Weißen wurde mit dem Pass Laws Act von 1952 durchgesetzt, nach dem alle Nicht-Weißen ein Ausweisdokument mit sich führen mussten, das auf Afrikaans Bewysboek hieß, auf Englisch »the Reference Book« und bei denen, die es mit sich tragen mussten, meist dompas, »der dumme Pass«.
Der dompas war tatsächlich ein Pass, mit ebenso vielen Seiten wie ein normaler Reisepass. Die südafrikanische Parlamentsabgeordnete und Apartheid-Gegnerin Helen Suzman nannte ihn »das am meisten verhasste Symbol der Apartheid. Auf den Seiten eines dompas waren die Fingerabdrücke, ein Foto, genaue Angaben über Beschäftigungsverhältnisse, die behördliche Erlaubnis, sich in einem bestimmten Teil des Landes aufzuhalten, die Berechtigung, in der Gegend zu arbeiten oder Arbeit zu suchen, und ein Arbeitszeugnis.«
Proteste gegen die Passgesetze – zunächst in den frühen 1950er Jahren von mutigen Frauen, dann in den 1960ern von Männern, die von den Frauen inspiriert worden waren – führten zu deren Niederschlagung, einem regelrechten Massaker in Sharpeville und noch mehr Protesten, die den Kampf um die Apartheid ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit rückten. In Südafrika wird heute mit zwei landesweiten Feiertagen an diese Proteste erinnert, dem Tag der Frauen und dem Tag der Menschenrechte. Im Jahr 1986 wurden diese Passgesetze abgeschafft, nachdem die Inlandspässe vierunddreißig Jahre lang das Leben der Südafrikaner mit dunkler Hautfarbe bestimmt hatten.
Archie erzählte mir ungehalten, fast wütend von den verhassten Passgesetzen und dem Group Areas Act, während wir durch die Straßen von Langa gingen, auf denen Müll, alte Reifen und Glasscherben herumlagen. Sogar die neu angelegten Blumenbeete und Rasenflächen waren zerstört.
»Euer Bill Gates hat uns bei dem Kulturzentrum unterstützt«, erzählte Archie beim Rundgang durch das Guga S’thebe Arts and Cultural Center, wo in einem Hinterzimmer drei Frauen Töpferwaren bemalten. Damit sollten Fertigkeiten vermittelt und Arbeitsplätze geschaffen werden. Die südafrikanischen Frauen waren motiviert, aber mehr als sechzig Prozent der volljährigen Männer in Langa waren ohne Beschäftigung. Das bunt bemalte Kulturzentrum, mit Kunstkeramik an der Außenfassade, war ein phantasievoll entworfener Post-Apartheid-Bau, gedacht für Workshops und Aufführungen, und wahrscheinlich das einzige neue Gebäude im Township. Es war bewusst ganz in der Nähe der Stelle errichtet worden, wo im Jahr 1954 mehrere tausend Bewohner von Langa gegen die Passgesetze demonstrierten – indem sie massenhaft dompas verbrannten – und dann ins Stadtzentrum marschierten. Das Gebäude war erst zehn Jahre alt, doch es verfiel bereits – war schmutzig und offensichtlich verwahrlost. Es lag auf der Touristenroute durch das Township und wurde von mehr Touristen als Einheimischen besucht.
»Wie hat Bill Gates geholfen?«
»Er hat uns diese Computer geschenkt.«
Auf Schreibtischen standen vier unbenutzte Computer mit verdreckten Tastaturen und Bildschirmen.
»Leider funktionieren sie seit einem Jahr nicht mehr.«
Was Archie nicht erzählte, was er vielleicht gar nicht wusste, war, dass die Gates Foundation Geld für eine Aids/HIV-Aufklärungskampagne gespendet hatte. Langa hat eine der höchsten Infektionsraten in Südafrika. Samstag war der »Beerdigungstag«, und jede Woche gab es um die vierzig Beerdigungen an diesem Tag. Trotz aller Bemühungen, die Bewohner von Langa aufzuklären, steigt die Sterberate an HIV/Aids.
»Hier entlang«, forderte Archie uns auf.
Ich nutzte die Gelegenheit, als er mit dem Fuß eine Bierdose zur Seite kickte, und fragte, warum die sorgfältig angelegten Blumenbeete vor dem Kulturzentrum zerstört und die gesamte Straße und der Gehsteig mit Bierdosen, Papier- und Plastikabfall übersät seien.
»Wir wissen nicht, was wir damit tun sollen. Die Leute werfen es weg, und es wird fortgeweht.«
»Warum sammelt es niemand ein?«
»Das ist ein Problem.«
»Archie, dazu braucht man nur einen Besen und ein Fass.«
»Darum kümmert sich die Gemeindeverwaltung.«
»Warum liegt das Zeug dann noch hier?«
Ich brachte ihn absichtlich in Verlegenheit, weil er, nach eigenen Angaben, der Gemeindesprecher war und weil das Kulturzentrum ein Hauptanlaufpunkt der Township-Touren war – zufällig kam gerade eine Busladung weißer Touristen an und sah sich mit dem »Wo sind wir?«-Blick von Besuchern um, die gerade aus dem Bus gestiegen sind. An einem Ort, wo mehrere zehntausend Menschen keine Arbeit und nichts zu tun hatten – viele saßen unübersehbar nur herum und plauderten oder starrten die Touristen an –, sammelte kein einziger den ganzen Abfall ein.
Möglicherweise nahm Archie, der immer noch über die ungerechten Passgesetze schimpfte, die Unordnung gar nicht wahr, und er wirkte verärgert, dass ich sie erwähnte. Wie um davon abzulenken – oder vielleicht wollte er damit auch nur den Zerfall erklären –, begann er zu erzählen.
»Vor vielen Jahren lebte hier ein Prophet. Sein Name war Ntsikana – und er machte eine Prophezeiung.«
»Worum ging es in der Prophezeiung?«
»Es war im Jahr 1600«, erzählte Archie und zitierte in feierlich prophetischem Ton Ntsikana: »Menschen werden vom Meer kommen.« Er erhob einen Finger für mehr Nachdruck. »Diese Menschen werden ein Buch und Geld bringen.« Archie drohte mit dem Finger. »Nehmt das Buch, aber nicht das Geld!« Archie ließ den Finger sinken. »Aber sie nahmen beides.«
»Sie hätten das Geld nicht nehmen sollen?«
»Das war ihr Verderben«, sagte Archie.
Ich merkte mir den Namen Ntsikana, schaute später nach und fand heraus, dass ein Xhosa-Prophet dieses Namens tatsächlich gelebt hatte und sein Leben gut dokumentiert war. Er war ein Pionier der »schwarzen Theologie« gewesen, ein selbsternannter Christ (er hatte Kontakt zu Missionaren gehabt, war aber nie getauft oder von ihnen unterrichtet worden), der Ende des 18. bis ins frühe 19. Jahrhundert gelebt hatte. Im Jahr 1815 hatte Ntsikana eine Offenbarung, »eine Erleuchtung der Seele«, die ihn im Glauben an Monogamie, Flusstaufe und das Sonntagsgebet an einen allmächtigen Gott bestärkte. Er komponierte Kirchenlieder und verfasste Gedichte. Seine Anhänger »behaupteten, das Xhosa-Christentum sei unabhängig und ohne Einfluss von Missionaren entstanden«, weil bei seiner Konvertierung keine Missionare beteiligt gewesen waren.
»Gott hat mich geschickt, aber ich bin nur wie eine Kerze«, predigte Ntsikana und verwendete dabei ein treffendes Bild für Erleuchtung und Endlichkeit. »Ich habe nichts zu mir beigetragen.« Er missionierte mit Feuereifer und gründete im ganzen Ostkap ländliche Gemeinden. Eines Tages sagte Ntsikana die Ankunft eines Volkes an den Küsten von Südafrika voraus. Er beschrieb Menschen, »durch deren Ohren die Sonne rötlich scheint« und »deren Haar so lang ist wie der Schweif eines Zebras«. Er hatte schon Weiße gesehen, daher erwies sich diese Prophezeiung als zutreffend, und offensichtlich warnte er seine Anhänger davor, den neuen Menschen zu sehr zu vertrauen. Ntsikana starb im Jahr 1821, und sein Grab bei Fort Beaufort in der Ostkap-Provinz ist heute eine Pilgerstätte.
Archie lag zwar bei Einzelheiten daneben, aber durch seine unerwartete Parabel lernte ich eine mächtige Sekte kennen, die immer noch viele Anhänger hat. Wir gingen auf schadhaften und müllverdreckten Straßen zwischen zwei doppelstöckigen Betonbauten hindurch, die, wie viele Sozialbauten, so schmucklos wie Gefängnisse waren. Archie erzählte, früher seien dies Sammelunterkünfte für Wanderarbeiter gewesen – nur Männer –, die während der Apartheid in Kapstadt als Hausangestellte, Feld- oder Fabrikarbeiter beschäftigt wurden. Dadurch, dass man sie an einem abgelegenen Ort unterbrachte, von ihnen das Tragen eines Dompas verlangte und sie von Frau und Kindern trennte, die im fernen Heimatdorf blieben, konnte man sie effektiv kontrollieren.
Hinter diesen verfallenen Unterkünften standen kleine Holzhütten dicht aneinandergedrängt. An diesem kühlen Morgen versteckten sich zerlumpte Kinder mit laufenden Nasen in den Türeingängen.
»Mehr Menschen, mehr Hütten«, kommentierte ich.
»Informelle Siedlungen«, nannte Archie sie. Bei dem Namen verzog ich immer das Gesicht, weil ich dabei Menschen in hellen Bungalows vor mir sah, die sich auf Sofas rekelten. »Sie heißen siyahlala.«
Ich bat ihn, den Namen zu buchstabieren, und schrieb ihn auf.
»Das ist Xhosa und bedeutet: ›Wir bleiben hier.‹«, erklärte Archie.
Er sagte, in jeder Hütte, die kaum groß genug für zwei war, lebten fünf bis sechs Personen. Am Rand der Siedlung, jenseits der Unterkünfte, jenseits der Hütten, standen Schiffscontainer – große rostige Stahlkisten –, und auch in denen lebten Menschen, Neuankömmlinge, erzählte Archie. Manche Container waren in Wohnbereiche für zwei oder drei Familien aufgeteilt, an den Seiten waren mit dem Schneidbrenner grobe Öffnungen als Türen und Fenster hineingeschnitten worden. Vor einigen standen Verkaufsstände, an denen man verbrannte Schafsköpfe erstehen konnte.
»Wir nennen sie Smileys.« Archie erklärte, dass »die Lippen zu einem Lächeln zusammenschrumpeln«, wenn man den Kopf auf den Grill legte. Die Einheimischen aßen sie mit »Gleismatsch«, fügte er hinzu und lachte. »Tomatensoße.«
Teenager, die auf Bänken oder Gummireifen saßen, beobachteten uns bei unserem Rundgang. Manche blickten uns finster aus Türeingängen hinterher, andere schauten vom Karten- oder Fußballspiel auf, wieder andere standen einfach da, wie Fischreiher, bewegungslos, auf einem Bein, das andere dahinter eingehakt. Die Jugendlichen hingen alle nur herum, nicht nur ein paar von ihnen, sondern Dutzende, vielleicht Hunderte, die offensichtlich nichts zu tun hatten. Ein paar wenige folgten Archie und mir, aber sie wurden es schnell leid – vielleicht gingen wir zu schnell für sie. Eine meiner Regeln für riskante Orte bestand darin, schnell zu gehen und beschäftigt zu wirken.
Archie sagte, die Unterkünfte seien im Jahr 2002 renoviert worden, was wohl bedeutete, dass sie in jenem Jahr in der blassgelben Farbe gestrichen worden waren, die ich sah. Er zeigte mir eines der Häuser von innen – ein Bienenstock aus mit verdreckten Matratzen vollgestopften Zweiraumwohnungen.
»Hier gibt es sechs Zimmer«, sagte er bei einer anderen Sammelunterkunft. In den Zimmern lagen massenweise feuchte Decken, alte Kleider, kaputte Schuhe und Kinderspielzeug aus Plastik neben CD-Spielern und Radios.
»Wie viele Menschen leben hier?«
»Achtunddreißig.« Ich glaubte ihm nicht. »Manche schlafen auf dem Esstisch. Und darunter«, erklärte er.
Elend beschert uns eigenartige Bettgenossen. Im letzten kleinen Zimmer, zu dem wir vordrangen, roch es noch stärker als in den anderen. Zwei kleine Betten standen dort. In dem Zimmer lebte eine Familie, die er kannte.
»In diesem Zimmer wohnen neun Menschen«, erzählte er.
Ich stellte mir vor, wie es sein mochte, nachts in den Betten und auf dem Fußboden in diesem Raum zu liegen, der nur drei mal eineinhalb Meter groß war. Er nickte zufrieden, dass er mich schockiert hatte, weil einige dieser Township-Touren anscheinend auf diesen Effekt bei Besuchern angelegt sind. Aber ich überlegte mir, dass es auch in den Vereinigten Staaten Orte wie diesen geben musste, vielleicht sogar viele davon, doch wie konnte ich davon erfahren? Es gab keine Rundgänge, keine Männer wie Phaks oder Archie, die Leute dorthin führten.
»Und das Widerlichste ist, dass sie alle eine einzige Toilette benutzen«, sagte er und meinte die achtunddreißig Bewohner des Hauses.
»Wo sind die Leute jetzt?«
»Draußen. Es ist zu eng, um sich tagsüber drinnen aufzuhalten.«
Dies war ebenfalls eine Gewohnheit aus dem Dorf, wo die Menschen den Tag unter freiem Himmel verbrachten, unter einem Baum oder im Hof, und ihre Lehmhütten nur zum Schlafen oder als Schutz gegen nachtaktive Tiere benutzten.
Die nächsten Gebäude, die Archie mir zeigte, boten mehr Platz, und eines sah bewohnbar aus. Auf jeden Fall war es sauberer, eine Zweiraumwohnung, in der eine Familie lebte. Die wachsame, aber höfliche Matriarchin nickte mir zu, und ein kleiner, überrascht wirkender Junge lugte hinter einem Türrahmen hervor. Die Miete betrug 500 Rand pro Monat, damals etwa 55 Euro.
In der Nähe standen noch mehr Hütten der übelsten Art, einfach Plastikplanen auf Sperrholz mit niedrigen Decken. Dass darin jemand lebt, konnte man sich kaum vorstellen.
An ein paar Straßen ganz in der Nähe dieser Hütten standen saubere, kompakte Bungalows, pastellfarben gestrichen und mit Gartenzaun umgeben, vor denen neue Autos in der Einfahrt parkten. An der Hauptstraße, der Schnellstraße zum Flughafen, standen weitere stabile Häuser, manche von ihnen gerade erst fertiggestellt. Diese Häuser sahen die ausländischen Besucher im Vorüberfahren und sagten vielleicht zueinander: »Das sieht gar nicht so schlimm aus, Doris«, und hatten keine Ahnung von den Bruchbuden und Hundehütten, die dahinterstanden, außer Sicht. Vor einer dieser Hütten hatte eine Frau einen wackligen Tisch mit einer Auswahl Perlarmbänder aufgestellt. Sie sagte, sie stelle sie eigenhändig her. Bei diesen Worten warf ich einen Blick auf ihre Hände – die sie sorgenvoll rang. Sie hatte neun Kinder, die alle in dieser Hütte lebten. Sie sah mich bittend an, ich möge doch etwas kaufen, und beim Weggehen hatte ich die Taschen voller Perlenschmuck.
»Und das hier ist ein Shebeen«, erklärte Archie, als er den Vorhang zur Seite schob, der im Eingang eines Schuppens hing. Der Raum war so niedrig, dass ich nicht aufrecht stehen konnte, die warme Luft stank widerlich. Nachdem sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte ich sechs Bier saufende Männer, drei auf Bänken sitzend, drei auf dem Boden hockend, am Montagmittag betrunken und zu nichts mehr fähig. Eine alte, hagere Frau mit Schürze führte hier das Regiment. Sie rührte eine haferschleimartige Flüssigkeit in einer Schüssel.
Ein Mann grinste mich an und trank aus einer großen Emailletasse wie eine Katze, die Milch aufschleckt, dann schüttelte er sich, was die cremige Flüssigkeit in der Tasse schwappen ließ.
»Probieren Sie mal«, forderte Archie mich auf. Ich war überzeugt, dass er mich auf die Probe stellte, indem er mir den übelsten Teil des Townships zeigte. Ich hatte betont unberührt gefragt: »Wie schreibt man das?«, und: »Sehen wir uns doch noch ein anderes an.« Aber das hier war wie eine Gefängniszelle oder der schlimmste Raum in einer Irrenanstalt. »Das Bier wird aus Mais und Hirse gebraut. Es heißt umqombothi.«
»Wie schreibt man das?«
Ein paar Tage später hörte ich das Wort noch einmal, in einem hübschen, schwungvollen Lied über eine stolze Frau, die Bier braut, »Zauberbier«. Das Lied wurde von der südafrikanischen Sängerin Yvonne Chaka Chaka kraftvoll und melodiös interpretiert.
Zu dem Zeitpunkt hatten wir über einen Kilometer zurückgelegt, befanden uns aber immer noch im Township Langa. Aber Archie wollte mir noch etwas anderes zeigen, etwas Besonderes, wahrscheinlich ein weiterer Schock.
»Mr. Ndaba«, sagte Archie. »Er ist unser traditioneller Heiler.«
Mr. Ndaba lebte in einem Raum mit ebenfalls niedriger Decke – ich musste mich bücken, um ihn zu betreten, und mich hinknien, um mit dem Mann zu sprechen. Der Heiler saß auf einem Schemel und sägte mit der Hand an etwas herum, das er in der anderen Hand hielt.
Ich atmete ein und musste würgen. Im Raum stank es stechend nach Verwesung, nach Maden, und ich sah auch bald, warum. An den Wänden und von der Decke hingen alte, gelbe Affenschädel und Kieferknochen, die verwesenden Felle kleiner Tiere, Pelz, Federn, noch mehr Knochen, ein totes Schuppentier, Schlangenhäute, Stachelschweinstacheln, vertrocknete tote Vögel, und in einer Ecke kaute ein kleines, dreckiges Kätzchen an einer frisch getöteten Ratte.
»Das ist alles Medizin«, erklärte Archie. »Er kann Aids heilen.«
»Was ist das?«, fragte ich und deutete auf das gepunktete Fell eines toten Tieres, möglicherweise einer Zibetkatze.
»Das ist mein Hut«, antwortete Mr. Ndaba, und jetzt sah ich, was er aß. Er sprach mit vollem Mund und stocherte und sägte immer noch mit dem Messer daran herum. Das Kratzen der Klinge bildete ein dumpfes Hintergrundgeräusch. In seiner Hand hielt er einen gelben Knochen, von dem graues Fleisch hing. Er säbelte etwas davon ab und führte es mit dem Messer zum Mund.
»Und was ist das?«
»Ich esse einen Schweinekopf.« Er hob das Ding hoch, und die Ohren des Schweins wackelten.
Der ranzige Fleischgestank traf mich wie ein Schlag, und ich wollte mich übergeben.
»Er ist ein Heiler«, sagte Archie. »Er kann Aids heilen. Er kann dafür sorgen, dass sich jemand in dich verliebt. Er kann Geister vertreiben. Er kann Leute gesund machen. Wir nennen ihn einen igqirha.«
»Wie schreibt man das?«, fragte ich und duckte mich aus der Hütte.
Mr. Ndaba verabschiedete sich freundlich, als ich ging, und ich dachte: Wie einfach ist es doch, sich über den Heiler mit dem Zibetkatzenpelz auf dem Kopf, umgeben von stinkenden Knochen und Federn und Schlangenhäuten, lustig zu machen. Jeder, der dort in der Hoffnung auf Heilung und im Vertrauen auf den Heiler eintrat, würde erleben, was Wissenschaftler als therapeutische Begegnung bezeichnen – das gute Gefühl, das man in der Gegenwart eines Arztes verspürt, dem man vertraut, einem mit einer freundlichen, interessierten Art und mit Affenschädeln statt eines Diploms an der Wand. Der Gestank allein könnte einen Plazebo-Effekt auslösen wie der Anblick eines Stethoskops.
Doch allein aufgrund der Intimität dieser halbdunklen Hütten fühlte ich mich unwohl, als habe ich nicht das Recht, dort zu sein.
Welchen Sinn haben diese Township-Rundgänge? Das habe ich Weiße in Kapstadt immer wieder fragen hören. Dabei erschauderten sie vor verlegener Ungläubigkeit. Warum stellen Afrikaner ihr Elend zur Schau und verkaufen Eintrittskarten zu ihren Slums?
Ich fand es ebenfalls seltsam, dass Touristen eingeladen wurden, sich die Townships anzuschauen, und dazu aufgefordert wurden, die armseligen Innenräume zu betreten, weil diese genauso dreckig, unordentlich und von Verbrechen heimgesucht waren wie während der Apartheid – vielleicht sogar noch mehr. Besonders schockierend daran war, dass man, wenn die Bewohner über die alten Zeiten klagten, nur daran denken konnte, wie schrecklich und wie ungeeignet für menschliche Bewohner es jetzt dort war. Etwas später an jenem Tag, in Guguletu, sah ich eine Kleinbusladung gut gekleideter italienischer Touristen in einem schmuddeligen Hühnchenrestaurant Bier und Mineralwasser trinken. Diese Italiener hätten sich bestimmt niemals in die Slums von Neapel getraut (wie sie in dem italienischen Film Gomorrha von 2009
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: