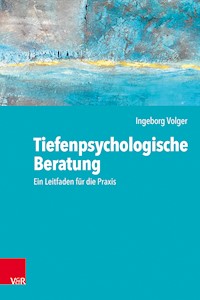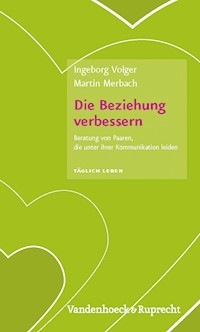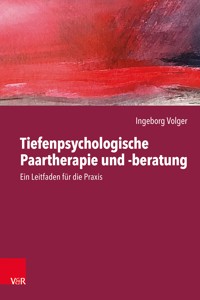
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Partnerschaften und Ehen sind heute mit hohen Anforderungen konfrontiert, das Beziehungsleben wird mit Erwartungen besetzt, die von realen Partnern kaum einzulösen sind. Auf die große Sehnsucht, mit dem Partner oder der Partnerin das persönliche Glück verfolgen und biografisch bedingte Verletzungen heilen zu können, folgt häufig Ernüchterung oder gar ein Scheitern der Beziehung Eine tiefenpsychologische Paartherapie oder -beratung unterstützt Paare, ihre Unterschiedlichkeit anzuerkennen, zu integrieren und kommunikativ zu überwinden. Dies ist ein oft mühsamer Weg und fordert von der Paartherapeutin oder dem Paarberater umfassende professionelle Kompetenzen. Ingeborg Volger vermittelt, wie die strukturierte tiefenpsychologische Arbeit mit Paaren gelingt. Anhand differenzierter Falldarstellungen und detaillierter Interventionsprozesse gewährt die Autorin Einblicke in die therapeutisch-beraterische Praxis und zeigt, wie mit Übertragung, Abwehr und Widerstand gearbeitet werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ingeborg Volger
Tiefenpsychologische Paartherapie und -beratung
Ein Leitfaden für die Praxis
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2023 Vandenhoeck & Ruprecht, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe (Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, V&R unipress und Wageningen Academic.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Gabriele Lennarz, Dämmerung
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99390-4
Inhalt
Einführung
1 Paardynamik aus tiefenpsychologischer Perspektive
1.1 Liebesbeziehungen: Ersehnt und voller Konflikte
1.2 Konflikt und Paardynamik
1.3 Biografie und Partnerschaftsvorstellung
1.4 Biografie und Persönlichkeitsstruktur
1.4.1 Depressive Persönlichkeitsstruktur und Partnerschaft
1.4.2 Zwanghafte Persönlichkeitsstruktur und Partnerschaft
1.4.3 Histrionische Persönlichkeitsstruktur und Partnerschaft
1.4.4 Narzisstische Persönlichkeitsstruktur und Partnerschaft
1.4.5 Persönlichkeitsstrukturen prägen die Paardynamik
1.5 Biografie, Bindungsstile und Bindungsrepräsentanzen
1.5.1 Autonome Bindungsrepräsentanz
1.5.2 Unsicher-distanzierte Bindungsrepräsentanz
1.5.3 Verstrickte Bindungsrepräsentanz
1.5.4 Desorganisierte Bindungsrepräsentanz
1.6 Biografie und Partnerwahl
1.6.1 Partnerwahl als Wiederholung und Wunsch nach Lösung alter Konflikte
1.6.2 Zwei Modi der Partnerwahl
1.7 Entwicklungen in Partnerschaften
1.8 Auslöser für Krisen
1.9 Störungen in Partnerschaften
2 Kommunikation aus tiefenpsychologischer Perspektive
2.1 Paare erzählen sich Geschichten
2.2 Komponenten der Kommunikation
2.3 Kommunikationsmodelle
2.4 Kommunikation in Paarbeziehungen
2.4.1 Alltagskommunikation: Ein komplexer Prozess
2.4.2 Selbstexploration zur Beziehungsebene
2.5 Kommunikation und biografische Erfahrungen
2.5.1 Kommunikation als Widerspiegelung des Innen im Außen
2.5.2 Kommunikation als Inszenierung von Abwehr
2.5.3 Kommunikation als Mentalisierung innerer Prozesse
2.6 Kommunikationsstörungen in Partnerschaften
2.6.1 Externalisierung dysfunktionaler Repräsentanzen in der Partnerwahl
2.6.2 Eingeschränkte Fähigkeit zur Affektwahrnehmung und Mentalisierung
2.6.3 Fehlende affektive Beziehungskommunikation
3 Tiefenpsychologische Paartherapie und -beratung: Konzept und Methodik
3.1 Zentrale Positionen
3.1.1 Das gemeinsame unbewusste Thema
3.1.2 Zirkularität und Interpunktion
3.1.3 Polarisierung und Ambivalenzspaltung
3.1.4 Reinszenierung biografischer Themen
3.2 Grundannahmen tiefenpsychologischer Paartherapie und -beratung
3.3 Gestaltung der beraterisch-therapeutischen Beziehung
3.3.1 Empathische Beziehungsaufnahme
3.3.2 Empathisches Sinnverstehen
3.4 Die Übertragungsbeziehung
3.5 Funktionen der Paartherapeutin und -beraterin
3.6 Die Interventionen
3.6.1 Das Beschreiben
3.6.2 Das Benennen von Interdependenzen
3.6.3 Das Konfrontieren
3.6.4 Das Deuten
3.6.5 Das Anregen
3.7 Das Zwiebelmodell: Ebenen psychodynamischer Interventionen
3.8 Ein Therapie- und Beratungsprozess im Überblick
3.8.1 Perspektive der Paardynamik
3.8.2 Perspektive der Reinszenierung biografischer Themen
3.8.3 Perspektive der Initiierung von Veränderungen
4 Tiefenpsychologische Paartherapie und -beratung: Praxis und Methodik
4.1 Ziele tiefenpsychologischer Paartherapie und -beratung
4.2 Das Therapie- und Beratungssetting
4.3 Die Anfangsphase
4.3.1 Kontaktaufnahme und Inhalte des Erstgesprächs
4.3.2 Exploration der Paardynamik
4.3.3 Die Schlussintervention
4.3.4 Die Übertragungsbeziehung: Inszenierung eines Paarkonflikts
4.3.5 Therapie- und Beratungskontrakt
4.3.6 Essentials der Anfangsphase
4.4 Die Mittelphase
4.4.1 Ziele der Mittelphase
4.4.2 Beschreibung der Paardynamik
4.4.3 Wahrnehmung von Reinszenierungen
4.4.4 Formulierung des gemeinsamen unbewussten Themas
4.4.5 Bearbeitung von Widerständen
4.4.6 Auflockerung der Ambivalenzspaltung
4.4.7 Initiierung von Veränderungen
4.4.8 Essentials der Mittelphase
4.5 Die Schlussphase
4.5.1 Beendigung der Paartherapie und -beratung
4.5.2 Bilanzierung des Therapie- und Beratungsprozesses
4.5.3 Die Prophylaxe
4.5.4 Essentials der Schlussphase
5 Abwehr und Widerstand in der Paartherapie und -beratung
5.1 Abwehr
5.1.1 Innerpsychische Abwehr und ihre interpersonellen Folgen
5.1.2 Komplementäre interpersonelle Abwehrformen
5.1.3 Bearbeitung von Abwehr
5.2 Widerstand
5.2.1 Dynamik von Widerstand
5.2.2 Äußerung von Widerständen: Formale Aspekte
5.2.3 Äußerung von Widerständen: Beziehungsdynamische Aspekte
5.2.4 Widerstand und Angst
5.2.5 Widerstände des Paartherapeuten und -beraters
5.2.6 Arbeit am Widerstand: Grundlegende Fragestellungen
5.2.7 Widerstand in der Anfangsphase
5.2.8 Widerstand in der Mittelphase
5.2.9 Vom Paartherapeuten und -berater induzierter Widerstand
5.3 Essentials
6 Übertragung in der Paartherapie und -beratung
6.1 Übertragung in Partnerschaften
6.2 Übertragung und Gegenübertragung in der Therapie und Beratung
6.3 Theoretische Konzeptionen zur Übertragung
6.4 Übertragung im triadischen Therapie- und Beratungssetting
6.5 Übertragungsformen in der Paartherapie und -beratung
6.5.1 Polarisierte Übertragung
6.5.2 Gemeinsame Übertragung
6.6 Gegenübertragung im triadischen Therapie- und Beratungssetting
6.7 Übertragung im Prozess der Paartherapie und -beratung
6.7.1 Übertragung im Erstgespräch
6.7.2 Paarbiografie und Übertragung
6.7.3 Biografie und Partnerwahl
6.7.4 Übertragung und Widerstand
6.7.5 Bearbeitung von Reinszenierungen
6.8 Essentials
7 Die Persönlichkeit der Paartherapeutin und -beraterin
7.1 Die Persönlichkeitsstruktur
7.1.1 Reaktualisierung innerer Konfliktthemen
7.1.2 Reflexion biografischer Erfahrungen
7.2 Das Geschlecht und die Geschlechtsidentität
7.2.1 Die Rolle von genderspezifischen Signalen
7.2.2 Gendertypische thematische Differenzen
7.2.3 Reflexion persönlicher Genderausformungen
7.3 Die triadische Kompetenz des Paartherapeuten und -beraters
7.3.1 Exkurs: Triangulierung im Entwicklungsverlauf
7.3.2 Triangulierungsstörungen in der Paartherapie und -beratung
7.3.3 Reflexionen zur triadischen Kompetenz
7.4 Die empathische Kompetenz des Paartherapeuten und -beraters
7.4.1 Empathie in triadischen Therapie- und Beratungsbeziehungen
7.4.2 Empathiestörungen
7.4.3 Reflexionen zur empathischen Kompetenz
Literatur
Einführung
Partnerschaften und Ehen sind heute mit hohen Anforderungen konfrontiert, da die Partner und Partnerinnen in sie große Erwartungen und Sehnsüchte setzen. Partnerschaften waren über lange Zeit Versorgungsgemeinschaften, die die ökonomische und gesellschaftliche Situation der Familie absichern sollten. Dies bedingte über Jahrhunderte hinweg eine eklatante Asymmetrie zwischen den Geschlechtern, indem die Frauen in der Regel in ökonomischer und rechtlicher Abhängigkeit von ihrem Mann lebten. Mit der zunehmenden Auflösung von Orientierung gebenden Institutionen und Werten und der Zunahme von Wahlmöglichkeiten veränderte sich auch im Zusammenhang mit der fortschreitenden ökonomischen Eigenständigkeit der Frauen die geschlechtsspezifische Machtdynamik. Partnerschaften müssen nicht mehr aus ökonomischen Gründen aufrechterhalten werden, die Verfolgung des persönlichen Glücks wird denkbar. So wird das Beziehungsleben mit Sehnsüchten besetzt, die von realen Partnern kaum einzulösen sind. Nicht nur das seit der Romantik etablierte Bild von Partnerschaft, das Gefühle in den Mittelpunkt der Beziehung rückte, wurde bedeutsam, der Partner soll nun auch zahlreichen anderen Anforderungen genügen. So werden weitreichende Hoffnungen mobilisiert, gemeinsam mit der geliebten Person die eigenen Lebensziele und Ideale verwirklichen zu können, vom Partner die Liebe und Anerkennung zu erhalten, die bisher schmerzlich vermisst wurde, und die Suche nach der eigenen Identität zu befördern. Zumeist wird diese Idealisierung von Partnerschaft nicht als Ausdruck und Projektion innerer Themen gesehen, sondern als reale Lebensmöglichkeit. Umso ernüchternder sind die Enttäuschungen, wenn auf die große Sehnsucht das Scheitern folgt.
Unter psychoanalytischer Perspektive ist die meist unbewusste Hoffnung, mit einem Partner biografisch bedingte alte Verletzungen zu heilen und gemeinsam eine neue Paaridentität zu entwickeln, ein »normales« und progressives Motiv der Partnerwahl. Damit einhergeht allerdings auch die ebenfalls unbewusste Wiederholung alter Beziehungsthemen, die nun die Partnerschaft mit kaum lösbaren Konflikten beschweren. In diesem Spannungsfeld zwischen der Hoffnung auf die Lösung alter Konflikte und deren gleichzeitiger Reinszenierung in der Paarbeziehung leben Paare oft in großer Konflikthaftigkeit, Enttäuschung und Entfremdung miteinander. Viele von ihnen suchen dann Unterstützung und Hilfe bei der Klärung ihrer Probleme in einer Paartherapie oder -beratung. Innerhalb derartiger Prozesse wird den Beteiligten oft sehr schmerzhaft bewusst, dass sie den Partner oder die Partnerin vorwiegend aus ihrer persönlichen inneren Sicht und Bedürfnislage wahrgenommen haben und weniger als eigenständige Person. Damit werden Differenzen offenkundig, die bisher auf vielfältige Weise ignoriert oder bekämpft wurden, nun aber integriert werden müssen, um eine neue Paardefinition entwickeln zu können. Dies ist ein anspruchsvoller, oft auch schmerzhafter Weg für das Paar, der eine Kenntnis der eigenen inneren Welt ebenso voraussetzt wie die des Partners und auf dem darüber hinaus eine Sprache gefunden werden muss, um darüber zu kommunizieren.
Tiefenpsychologische Paartherapie und -beratung unterstützt Paare in diesem Verstehens- und Entwicklungsprozess. Vor dem Hintergrund eines differenzierten diagnostischen Modells werden mit dem Paar die Besonderheiten seiner Paardynamik erarbeitet und ein Verständnis für deren individuelle Erscheinungsform entwickelt. Damit zielt tiefenpsychologische Beratung darauf ab, dem Paar einen Zugang zu inneren Themen und Prozessen zu ermöglichen, die selbst tiefe Beziehungskrisen als nachvollziehbare Entwicklungen verständlich machen. Auf der Basis dieser Erfahrung von Sinnhaftigkeit werden dann gemeinsam Veränderungsmöglichkeiten ausgelotet und der mühsame Prozess der Aufgabe alter Positionen und Verhaltensweisen angeregt und begleitet.
Vonseiten des Therapeuten oder der Beraterin erfordert die tiefenpsychologische Arbeit mit Paaren ein profundes Wissen über paardynamische Prozesse und deren psychodynamische Hintergründe. Sie beinhaltet zugleich eine besondere methodische Kompetenz, da die Arbeit in einem triadischen Setting sehr anspruchsvoll ist. Therapeutinnen und Berater müssen in der Lage sein, sich gleichzeitig in die innere Welt zweier unterschiedlicher Menschen hineinzuversetzen, ohne dabei ihre Allparteilichkeit aufzugeben. Zugleich müssen sie bereit sein, sich von den unterschiedlichen Beziehungsangeboten der Partner berühren zu lassen, um die in Szene gesetzten Beziehungsthemen als gemeinsame Themen des Paares verstehen zu können. Und schließlich bedarf es vieler therapeutischer Fertigkeiten, um die Empathie- und Sprachfähigkeit der Partner so weitgehend zu verbessern, dass es ihnen gelingt, die erlebte Unterschiedlichkeit immer wieder kommunikativ zu überwinden.
Das vorliegende Buch gibt allen Paartherapeutinnen und -beratern einen theoretischen und praxisorientierten Leitfaden an die Hand, wie der Prozess tiefenpsychologischer Paartherapie und -beratung gestaltet werden kann.
In den Kapiteln eins und zwei findet sich ein Überblick über unterschiedliche tiefenpsychologische Konzeptualisierungen von Paardynamik und Kommunikation innerhalb von Paarbeziehungen.
In Kapitel drei wird das tiefenpsychologische Therapie- und Beratungskonzept ausführlich dargestellt und seine Anwendung mit vielen konkretisierenden Beispielen veranschaulicht.
In Kapitel vier werden am Beispiel einer Falldarstellung die verschiedenen Phasen des beraterisch-therapeutischen Prozesses mit ihren jeweils spezifischen Zielen und Anforderungen mithilfe ausführlicher Stundenprotokolle dargestellt.
In Kapitel fünf und sechs werden, ebenfalls mit differenziertem Fallmaterial, die für die tiefenpsychologische Arbeit mit Paaren zentralen Konzepte von Übertragung, Abwehr und Widerstand veranschaulicht.
Das letzte Kapitel widmet sich der Bedeutung der Persönlichkeit des Therapeuten bzw. der Beraterin. Hier sind zu wesentlichen, Therapie und Beratung beeinflussenden Aspekten nicht nur theoretische Ausführungen zu finden, sondern auch gezielte Fragestellungen für die persönliche Selbstexploration.
Die Kapitel sind so aufgebaut, dass sie ein Thema jeweils abschließend behandeln. Da die dargestellten Themen auf grundlegenden Prämissen der psychoanalytischen Theorie beruhen, kann es dabei zu Überschneidungen mit anderen Kapiteln kommen. An verschiedenen Stellen beziehe ich mich auf Ausführungen, die bereits in anderen Veröffentlichungen entwickelt wurden, etwa Volger (1999, 2002, 2021) sowie Volger und Merbach (2010).
Wie aus dem Titel des Buches ersichtlich ist, unterscheidet das hier vorgestellte Konzept nicht zwischen tiefenpsychologischer Paartherapie und -beratung. Im Gegensatz zur Arbeit mit Einzelnen ist eine inhaltliche Unterscheidung der beiden Formate bei der Arbeit mit Paaren nicht möglich. Abgrenzungskriterien zwischen tiefenpsychologischer Einzelberatung und tiefenpsychologischer Kurzzeittherapie beziehen sich in erster Linie auf die Frage, inwieweit das Gesundheitssystem für die Behandlung einer Störung aufzukommen hat. Daraus ergeben sich verschiedene Implikationen, wie beispielsweise die Erstellung von Diagnosen durch den Therapeuten und ein hoher Professionalisierungsgrad des Psychotherapeutenberufs mitsamt eines geschützten Titels.
All dies spielt im Kontext der Arbeit mit Paaren keine Rolle, da es sich bei der Bezeichnung »Paartherapeut« nicht um einen geschützten Titel handelt, keine feste Weiterbildungsordnung existiert und es bisher für tiefenpsychologische Paartherapie keine Kassenfinanzierung gibt. Die dort vorgesehene Möglichkeit des »Einbezugs einer Bezugsperson« würde dem hier vorgestellten Therapie- und Beratungskonzept nicht entsprechen, da sie von der Markierung eines Indexpatienten ausgeht und nicht von der Gleichwertigkeit der Partner. Das professionelle Selbstverständnis der in diesem Arbeitsfeld tätigen Kolleginnen und Kollegen wird eher durch den eigenen Professionalisierungsprozess bestimmt. So bezeichnen sich Psychotherapeuten, die mit Paaren arbeiten, als Paartherapeuten, während Sozialarbeiterinnen, Pädagogen, Psychologinnen etc. ohne psychotherapeutische Weiterbildung sich eher als Paarberater definieren. Dies findet sich auch im institutionellen Kontext wieder: Kolleginnen und Kollegen, die in einer Beratungsstelle arbeiten, sind in der Selbst- und Fremdwahrnehmung eher Paarberater, während diejenigen in freier Praxis sich, abhängig von der jeweiligen Grundprofession, als Paarberater und/oder Paartherapeutinnen bezeichnen. Inhaltliche Unterschiede in der Arbeit von Paartherapeuten und Paarberatern kann ich nach meiner langjährigen Tätigkeit als Supervisorin nicht definieren.
Dieses Buch ist aus der jahrelangen Zusammenarbeit und Diskussionen mit den Kolleginnen und Kollegen des Evangelischen Zentralinstituts für Familienberatung in Berlin entstanden. An dieser Stelle möchte ich meinen Kolleginnen Sabine Hufendiek und Annelene Mayer sowie meinen Kollegen Martin Merbach und Achim Haid-Loh danken, die in den letzten Jahren dieses Konzept der Paarberatung maßgeblich mit- und weiterentwickelt haben.
Ganz besonders danke ich Gabriele Lennarz, Friedrich-Wilhelm Lindemann und Martin Merbach. Durch ihre kontinuierliche Unterstützung haben sie mir geholfen, dieses Buch zu schreiben, und durch ihre Anregungen, es zu verbessern.
Gabriele Lennarz, mit der ich alle psychoanalytischen Fragestellungen diskutieren konnte, danke ich für ihre umfassende Unterstützung und Begleitung und ihre Bereitschaft, ihr Bild »Dämmerung« für die Gestaltung des Umschlags zur Verfügung zu stellen.
Friedrich-Wilhelm Lindemann danke ich für seine stetige Unterstützung meines Schreibens, die lebendigen Falldiskussionen und die wertvollen Anregungen, die der Lesbarkeit des Buches zugutekamen.
Martin Merbach, mit dem ich über Jahre der Zusammenarbeit das hier dargestellte Konzept diskutiert und präzisiert habe, danke ich für den kontinuierlichen Austausch und seine konstruktive und zugleich kritische Durchsicht und Diskussion des Manuskripts.
In einem Bereich, in dem es um Männer und Frauen, Klientinnen und Klienten, Therapeutinnen und Therapeuten, Beraterinnen und Berater geht, ist die Realisierung einer gendersensiblen Sprache nicht ganz einfach, da sie die Lesbarkeit des Textes beeinträchtigen kann. Ich werde im Folgenden mal die männliche, mal die weibliche Form benutzen. Dies betrifft alle Textpassagen, in denen nicht eindeutig Männer oder Frauen gemeint sind. Die Verwendung von Paarberater(in) bzw. Paartherapeut(in) wird ebenso in lockerer Folge abgewechselt.
Hinweis: Die Pfeile verweisen auf Falldarstellungen, die Ausrufezeichen markieren tiefenpsychologisches Fallverstehen, die Köpfe verweisen auf Anregungen zur Selbstexploration.
1 Paardynamik aus tiefenpsychologischer Perspektive
1.1 Liebesbeziehungen: Ersehnt und voller Konflikte
Mit dem Übergang zur Moderne entwickelten sich neue Beziehungsformen zwischen Männern und Frauen: Nicht mehr Wirtschafts- und Standesinteressen bestimmten die Partnerwahl, sondern die freie Entscheidung zweier Personen, die eine enge gefühlsmäßige Bindung zueinander suchen und in dieser die Sehnsucht nach Liebe und Glück verwirklichen möchten. So hoffen wir, einen Partner zu finden, mit dem wir uns innig verbunden fühlen, mit dem erotische, leidenschaftliche Liebe erlebt werden kann, einen Partner, der mit uns die Welt erobert und das Leben gestaltet, der uns in unserem Inneren und unserem Wesen versteht, unsere Werte teilt und uns mit Achtung und Empathie begegnet. Konflikte sind zwar potenziell denkbar, im Grunde aber nicht vorgesehen, da eine harmonische Gemeinsamkeit gesucht wird, in der der Partner zur selben Zeit dasselbe möchte wie wir.
In dieser Vorstellung wird deutlich, dass die Suche nach Verbundenheit und Anerkennung, nach Harmonie und Frieden von Sehnsüchten geleitet wird, die mit den Urbeziehungen in Verbindung stehen. Aktualisiert werden Wünsche des Kindes, in der Beziehung zu den Eltern eine sichere und schützende Bindung zu erhalten und von ihnen mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen wahrgenommen und im persönlichen Wesen erkannt zu werden. Je weniger diese Wünsche und Sehnsüchte in den frühen Beziehungen gestillt werden konnten, umso größer ist die Hoffnung, sie in einer anderen Beziehung erfüllen zu können. Die Paarbeziehung eignet sich daher in ganz besonderer Weise dazu, auf sie all jene Fantasien zu projizieren, in denen die Verheißung zwischenmenschlichen Glücks anklingt. Unter diesem Aspekt ist die Idealisierung von Paarbeziehungen ein verständlicher, normaler und sogar die Selbsterkenntnis befördernder Prozess, da er Auskunft gibt über die persönlichsten und intimsten Beziehungssehnsüchte.
In Paarbeziehungen wird aber nicht nur eine innige Bezogenheit gesucht, sondern auch ein Partner, mit dem Neues erkundet und gemeinsame Vorstellungen vom Leben gestaltet werden können. Auch diese Wünsche gehen zurück auf die Erfahrungen mit den frühen Bindungspersonen, die das Explorationsbedürfnis und den Autonomiewunsch des Kindes durch die Herstellung von Geborgenheit ermöglichen und wohlwollend begleiten. So wird beim Partner Sicherheit und Stabilität gesucht und darin zugleich die Voraussetzung für Expansion und Freiheit. In der inneren Welt stellt diese Bipolarität menschlicher Grundbedürfnisse kein Problem dar: Es liegt in der Natur des Menschen, dass er Bindung und Bezogenheit und zugleich Freiheit und Autonomie sucht. Nicht selten sind beide Bedürfnisse zugleich virulent, da der Autonomie-Abhängigkeits-Konflikt nie ganz befriedigend gestaltet werden kann. Eindeutigkeit und Widerspruchsfreiheit sind Gebote des Bewusstseins, deren Ausbalancierung nur mittels einer gut funktionierenden innerpsychischen Abwehr gelingt. So muss in Paarbeziehungen immer wieder darum gerungen werden, im Bedürfnis nach Bezogenheit genügend Freiraum zu finden und umgekehrt im Wunsch nach Autonomie genügend Bindung. In derselben Weise ist die emotionale Ambivalenz zwischen Liebe und Hass, beides Emotionen mit hoher energetischer Aufladung, ein zentrales Merkmal aller Beziehungen und muss immer wieder neu reguliert werden. Menschen wünschen sich klare Verhältnisse, da Ambivalenzen irritieren und verstören können. Zugleich sind wir voller Widersprüche, die zu ertragen nicht selten unsere psychischen Kapazitäten übersteigen.
Diese, jedem Menschen innewohnende Disposition findet in der psychoanalytischen Theorie einen konzeptuellen Rahmen. Im psychoanalytischen Verständnis sind Konflikte und Ambivalenzen Grundbedingungen des menschlichen Lebens, sie sind nicht zu vermeiden oder gar pathologisch, sie sind auch nicht dazu da, um gelöst und schließlich von ihnen befreit zu werden. Sie zeigen sich in allen unseren Beziehungen, insbesondere aber in der Liebe und unseren Partnerschaften. Denn das ist das Kernproblem aller Beziehungskonflikte und -störungen: Wir suchen und ersehnen eine konflikt- und ambivalenzfreie Partnerbeziehung und sind konfrontiert mit dem Gegenteil, mit Spannungen, Gegensätzen und Unvereinbarkeiten, die zu Auseinandersetzungen, Streit, Krisen und oft zu Trennungen führen. Konflikte als Normalität anzuerkennen fällt sicher schwer, könnte aber dazu beitragen, dass ihr Auftauchen nicht als ausschließlich beunruhigend erlebt werden muss. Nicht das Vorhandensein von Konflikten stellt sich als Problem in Paarbeziehungen, sondern die mangelnde bis zuweilen vollständig fehlende Fähigkeit der Partner zu deren Regulation.
1.2 Konflikt und Paardynamik
Die Psychoanalyse hat nicht nur Theorien zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Entstehung von Krankheiten entwickelt, sie bietet auch eine allgemeine Theorie zwischenmenschlicher Prozesse und Beziehungen, die innerseelische Vorgänge und deren Wirkung im Außen beschreibt (Kutter u. Müller, 2008). Dabei spielt der Konfliktbegriff eine zentrale Rolle. Eine grundlegende tiefenpsychologische Annahme beinhaltet, dass Konflikte für den Menschen konstitutiv sind. So gibt es keine zwischenmenschliche Situation, in der nicht unterschiedliche Bedürfnisse der Partner zu äußeren Konflikten führen können. Aber auch im Inneren des Menschen existieren unterschiedliche, oft konträre Bedürfnisse, die zu inneren Spannungen führen, da sie sich in ihrer Realisierung geradewegs ausschließen. Dabei geht es oft um den Konflikt zwischen selbstbezogenen und objektbezogenen Tendenzen. In der Psychoanalyse wird dieser Konflikt als Autonomie-Abhängigkeits-Konflikt bezeichnet und beschreibt die dem Menschen inhärenten Wünsche nach Autarkie und Selbstständigkeit einerseits und seinen Wunsch nach Bindung, Bezogenheit und Vereinigung mit dem Objekt andererseits. Andere Theorien, wie die Bindungsforschung, beschreiben diesen Konflikt als Bindung- svs. Explorationsbedürfnis. Diese Bipolarität ist ein zentraler Aspekt unserer psychischen Verfassung und muss in jedem Lebensalter neu reguliert werden.
Unter günstigen Entwicklungsbedingungen können diese gegensätzlichen Strebungen in einem kontinuierlichen Prozess ausbalanciert und schlussendlich immer wieder zu einem Ausgleich gebracht werden. Dies ist zwar ein mühsamer und lebenslanger Prozess, trägt aber sowohl innerlich wie auch äußerlich zur Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit bei. Diese ist in der Lage, Ambivalenzen zuzulassen, zu halten und angemessene und realisierbare Konfliktlösungen zu entwickeln. Über diese Fähigkeit zur Regulation innerer Konflikte, die die Fähigkeit zu Ambivalenztoleranz und zum Ausgleich von Gegensätzen bereithält, entwickelt sich Differenzierung und damit eine innerpsychische Bereicherung.
Neben den inneren und äußeren Konflikten sind die verinnerlichten Konflikte besonders geeignet, die Komplexität menschlicher Beziehungen abzubilden. Diese sogenannten Triebkonflikte etablieren sich innerpsychisch durch die Internalisierung von frühen Erfahrungen und Einschränkungen. Über diesen Prozess gestalten sie entscheidend die Persönlichkeit des Menschen und seine Beziehungsaufnahme zur Welt. In einem zunächst als äußerer Konflikt imponierenden Streit zweier Partner stehen sich dann zwei Menschen gegenüber, die im Kontext ihrer Biografie mit dem Thema oder der Kommunikation des Streits bereits vielfältige, oft schmerzliche Erfahrungen gemacht haben. Diese innerpsychische Konfliktdynamik des Menschen, das heißt, die Art und Weise, wie die Grundbedürfnisse zum Ausdruck gebracht und gelebt werden können (siehe Volger, 2021, S. 59 ff.), bestimmt, wie Partnerschaften gestaltet werden. So kann es sein, dass eine Paarbeziehung zum Auslöser für äußere Konflikte wird, weil die Partner durch ihre spezifischen Persönlichkeitseigenschaften innere Konflikte im Gegenüber anstoßen. Konflikte, die bereits in der Kindheit nicht befriedigend gelöst werden konnten, können sich auf diese Weise auch in aktuellen Beziehungen Bahn brechen und alte, meist unproduktive Konfliktlösungsmodi in Szene setzen. Insofern gibt es keine Auseinandersetzung zwischen Partnern, die nicht immer auch zugleich ein inneres Thema jedes Partners anstoßen würde.
Umgekehrt werden innere Konflikte, die durch seelische, intrapsychische Mittel nicht gelöst werden können, oft im Außen deponiert und in externalisierter Form mit dem Partner ausgefochten. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn im Partner Eigenschaften und Haltungen bekämpft werden, die im eigenen Inneren existieren, aber abgelehnt werden. Da es sich hier oft um unbewusste innere Konflikte handelt, ist es den Betreffenden nicht bewusst, dass es sich bei dem Streit um eine Externalisierung eigener intrapsychischer Themen handelt. Phänomenologisch inszeniert sich dann ein äußerer Konflikt, der nur aufgrund seiner Unlösbarkeit im Außen darauf verweist, dass innere Themen und Spannungen behandelt und zur Austragung gebracht werden sollen.
Innere und äußere Konflikte sind konstitutiv für das menschliche Leben.
Nähe- und Bindungswünsche stehen immer auch im Konflikt mit Wünschen nach Autonomie und Abgrenzung.
In Paarbeziehungen können unterschiedliche Bedürfnislagen, unterschiedliche Bewältigungs- und Abwehrmechanismen und unterschiedliche Werthaltungen der Partner zu Konflikten führen.
1.3 Biografie und Partnerschaftsvorstellung
Wenn zwei Menschen sich kennenlernen und eine Partnerschaft eingehen, sind sie in der Regel entwickelte Persönlichkeiten mit je individuellen Haltungen, Überzeugungen, Stilen und Eigenarten. Sie kommen aus unterschiedlichen Familien, die ihre Persönlichkeit geformt haben. Sie haben vor dem Hintergrund ihres familiären und sozialen Gefüges unterschiedliche Erfahrungen gemacht und dementsprechend individuelle Be- und Verarbeitungsmechanismen entwickelt, um ihre Wünsche in der Welt platzieren zu können. So haben sie gelernt, wie sie ein Gegenüber für sich gewinnen können. Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen mit Eltern und Geschwistern haben sie spezifische, ebenfalls unterschiedlich strukturierte Wünsche und Hoffnungen, aber auch Befürchtungen und Ängste mit Blick auf eine mögliche Partnerschaft entwickelt. Wie sie ihren Beziehungswunsch realisieren, ob sie aktiv auf die Suche gehen, ob sie hoffen, »gefunden« zu werden, oder aber sich selbst und anderen gegenüber eine vermeintliche Autarkie in Szene setzen, hat ebenfalls etwas mit ihrer Biografie zu tun. Begegnen sich zwei potenzielle Partner, finden sie wiederum Dinge aneinander attraktiv, die ebenfalls etwas mit ihrer Lebensgeschichte zu tun haben. Das können äußere Merkmale ebenso sein wie innere, also Charaktereigenschaften oder Vorlieben und Interessen. Umgekehrt kann auch die Abwesenheit von Merkmalen der Herkunftsfamilie einen Partner attraktiv erscheinen lassen. So kann ein Mensch, der aus einer sehr nüchternen und emotional kühlen Familie kommt, sich besonders von einem gefühlsbetonten Partner angesprochen fühlen. Oft sucht ein Mensch, der in seiner Familie viel Streit und Auseinandersetzungen erlebt hat, bewusst einen Partner, der nicht dazu neigt, laut und aggressiv zu sein. Wir sind bei der Partnerwahl also kein unbeschriebenes Blatt, wir wählen einen Partner nicht zufällig, sondern werden durch unsere biografischen Erfahrungen und deren Bewältigung unbewusst darin beeinflusst, ob und auf welche Weise wir welchen Partner suchen.
Die frühen Erfahrungen des Menschen sind in erster Linie Beziehungserfahrungen. Über die Beziehung zu Mutter und Vater lernt das Kind die Welt, seine Bedürfnisse und sein Gegenüber kennen. Die Erfahrungen mit diesen frühen Bezugspersonen bleiben nicht äußerlich, sondern werden internalisiert und bilden dauerhafte intrapsychische Strukturen. Entkoppelt von den ursprünglichen Beziehungserfahrungen werden sie zu grundlegenden Elementen der Persönlichkeitsentwicklung des Menschen. Diese intrapsychischen Repräsentationen früher Beziehungserfahrungen, die sogenannten Beziehungsrepräsentanzen, enthalten gefühlsbetonte Erinnerungen an real Erlebtes im Kontext von Beziehungen. Vor dem Hintergrund dieser biografischen Perspektive wird verständlich, dass in einer Partnerschaft, die die wichtigste Beziehung des Erwachsenenlebens ist, unmittelbar frühe Erfahrungen mobilisiert werden. Dies bedeutet, dass der Partner nicht »quasiobjektiv« wahrgenommen wird, sondern immer durch den Filter der innerpsychischen Repräsentanzen, die unter anderem gefühlsbetonte Erinnerungen an reale frühe Erfahrungen mit den Bezugspersonen der Kindheit enthalten. Aber nicht nur die inneren Repräsentanzen vom anderen (sogenannte Objektrepräsentanzen) werden aktualisiert, sondern auch Selbstrepräsentanzen, in denen sich das innere Bild der Beziehung zur eigenen Person widerspiegelt und zum Beispiel Fantasien über die persönliche Attraktivität oder aber Wertlosigkeit enthält.
Die Beschaffenheit dieser Repräsentanzen ist selbstverständlich in entscheidendem Maße geprägt von den frühen Beziehungserfahrungen zu den Eltern, in deren Kontext sich diese inneren Abbilder entwickeln. So unterscheiden sich die Beziehungsrepräsentanzen eines Menschen, der mit seinen frühen Bindungspersonen die Erfahrung gemacht hat, dass er auch mit unerwünschten Verhaltensweisen nicht als Person abgelehnt wird und bei ihnen Schutz in aufgewühlten inneren Zuständen findet, von denen eines Menschen, der gefühlsabweisende und kontrollierende Eltern hatte, die besonders an seinen Leistungen und Erfolgen Interesse zeigten, zu seinem Inneren aber keinen Zugang suchten.
Ein weiterer Aspekt der Beziehungsrepräsentanz umfasst die innere Repräsentation der Qualität der elterlichen Paarbeziehung. Sie stellt für das Kind das erste Modell gelebter Partnerschaft bereit. Dabei geht es nicht ausschließlich um real existierende Partner, sondern auch, wie im Fall von Alleinerziehenden, um die Repräsentation des abwesenden Elternteils in der Beziehung zum Kind. Wird dieser positiv konnotiert, bilden sich im Kind andere Repräsentanzen als bei strittigen Eltern, die schlecht vom getrennten Partner sprechen.
Das Kind erlebt die Eltern sehr früh als Paar und bekommt mit, ob sie in Harmonie oder Anspannung leben, ob sie sich gegenseitig unterstützen oder bekämpfen. Es beobachtet, in welcher Weise Konflikte bearbeitet werden und erlebt die Beziehungsstruktur der Eltern untereinander. Paare, die die elterliche Beziehung als belastet und destruktiv in Erinnerung haben, sind in der Regel bemüht, genau derartige Beziehungsformen zu vermeiden. Gleichwohl bewirkt das Fehlen alternativer innerer Bilder, dass das Paar in Konfliktsituationen leicht in vertraute, wenngleich abgelehnte Interaktionsmuster der Eltern geraten kann. Unter diesem Aspekt sind die Erfahrungen, die Menschen im Laufe ihrer biografischen Entwicklung mit triadischen Beziehungen gemacht haben, von essenzieller Bedeutung für die Konstruktion der Paarbeziehung, da die darüber erworbene triadische Kompetenz ebenfalls den Charakter und die Struktur der Partnerschaftsbeziehung bestimmt (siehe Kapitel 7.3).
Partner werden nicht zufällig gewählt, sondern durch biografische Erfahrungen und deren Bewältigung beeinflusst.
Indem eine Partnerschaft meist die wichtigste Beziehung des Erwachsenenlebens darstellt, werden unmittelbar frühe Erfahrungen mobilisiert.
Daher wird der Partner immer auch durch den Filter der innerpsychischen Repräsentanzen wahrgenommen.
Die Beziehungsrepräsentanzen umfassen nicht nur die unmittelbaren Erfahrungen mit den primären Bezugspersonen (Eltern), sondern repräsentieren ebenso die Qualität der elterlichen Paarbeziehung.
Die triadische Kompetenz bestimmt in entscheidendem Maße die Fähigkeit zur Herstellung einer gelingenden Paarbeziehung.
1.4 Biografie und Persönlichkeitsstruktur
Die in der persönlichen Geschichte gemachten frühen Erfahrungen prägen in entscheidendem Maße die Persönlichkeit des Menschen. Im Zuge der Internalisierung dieser insbesondere mit Objektbeziehungen gemachten Erfahrungen entwickeln sich innere Strukturen. Diese stellen nicht lediglich innerpsychische Abbildungen des Erlebten dar, sondern werden durch einen individuellen Abwehr- und Bearbeitungsprozess assimiliert. Dadurch entstehen mentale Repräsentationen der äußeren Welt im innerseelischen Raum. Über diesen Prozess und die Entkoppelung von den ursprünglichen Beziehungspersonen bilden sich schließlich unter anderem die innerpsychischen Strukturen der Selbst-, Objekt- und Beziehungsrepräsentanzen, die sich in spezifischen innerpsychischen Haltungen und Überzeugungen, in persönlichen Kompetenzen und charakteristischen Persönlichkeitsmerkmalen des Betreffenden zeigen. Auch wenn es in den seltensten Fällen »reine« Persönlichkeitsstrukturen gibt und wir es in der Regel mit Mischstrukturen zu tun haben, so hat es sich zum Zweck der Hypothesenbildung doch als hilfreich erwiesen, die typischen Haltungen und Stile einzelner Strukturen voneinander abzugrenzen. Für das Verständnis von Paardynamik ist diese Perspektive besonders bedeutsam, da jede Persönlichkeitsstruktur vor dem Hintergrund der je speziellen Selbst- und Objektrepräsentanzen unterschiedliche Beziehungswünsche und -ängste entwickelt hat, die unmittelbar und ohne bewusste Einflussnahme die Partnerschaft in entscheidendem Maße prägen.
Da nach psychoanalytischem Verständnis die Entwicklung von Persönlichkeitsstrukturen immer das Ergebnis der Verarbeitung und Bewältigung innerer und äußerer Konflikte zum Ausdruck bringt, sind Persönlichkeitsstrukturen auch stets geprägt von Ambivalenzen, je nachdem, welcher Konfliktverarbeitungsmodus im Vordergrund steht. So kann bei all diesen Strukturen mehr oder weniger deutlich ein aktiver von einem passiven Modus unterschieden werden, der zu phänomenologisch sehr unterschiedlichen Erscheinungsformen führt. Diese theoretische Perspektive stellt eine wesentliche Voraussetzung für das Verständnis von Paarbeziehungen dar, wonach Ambivalenzspaltungen den Hintergrund für eine gestörte Paardynamik bilden (siehe Kapitel 1.9). Im Folgenden werden daher die einzelnen Persönlichkeitsstrukturen sowohl in ihren aktiven als auch passiven Verarbeitungsmodi beschrieben.
1.4.1 Depressive Persönlichkeitsstruktur und Partnerschaft
Menschen mit einer depressiven Persönlichkeitsstruktur haben häufig eine Einengung ihrer explorativen Impulse erfahren und konnten in der Folge wenig Autonomie entwickeln. Entsprechend löst jede Trennung oder Distanz zum anderen heftige Ängste aus, die vermieden werden sollen, indem alles Trennende verhindert wird. Mit der Autonomieeinschränkung geht die Angst einher, nicht geliebt zu werden, verbunden mit der Überzeugung, auch gar nicht liebenswert zu sein. Dies hat zur Folge, dass der Betreffende nicht offensiv für seine Wünsche und Bedürfnisse eintreten kann, sondern Zuneigung und Anerkennung durch Erfüllung der Erwartungen des Gegenübers zu erlangen sucht. Mit dieser submissiven Haltung neigt er dazu, sich selbst zu überfordern und ohne Kenntnis seiner Grenzen sich von anderen überfordern zu lassen. Die Angst vor dem Verlassenwerden und damit die Bestätigung der eigenen Wertlosigkeit führt zur Anpassungsneigung und Unterwerfungshaltung, die extreme, ja masochistische Züge bis zu völliger Erschöpfung annehmen können.
In der Partnerschaft dominiert die Angst, den Partner zu verlieren, wenn man sich seinen Wünschen und Bedürfnissen nicht unterordnet. Dies führt oft zu hierarchisch strukturierten Beziehungen und einer klaren Rollenverteilung mit Blick auf das Erleben und Vertreten autonomer Bedürfnisse in der Beziehung. Eine andere Möglichkeit der Bewältigung der Trennungsangst besteht in der Herstellung einer besonders liebevollen und empathischen Beziehungsform, in der dem Partner Wärme und Geborgenheit angeboten wird, seine expansiven Bedürfnisse allerdings beschnitten werden. In einer übersteigerten Variante wird der Partner in unangemessener Weise verwöhnt und gerät damit in eine kindliche Abhängigkeit, die dessen Autonomie beschneidet. Sowohl die Inszenierung der eigenen Abhängigkeitswünsche als auch die intensive Bestärkung der passiven Bedürfnisse des Partners sollen unbewusst vor potenziellen Trennungen schützen. Hintergrund für diese Haltung ist unter anderem die Blockierung der persönlichen autonomen Entwicklung, die zu einer chronischen Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls führt und in dem Versuch der »Selbstverkleinerung« (Mentzos, 2009, S. 142) eine masochistische Lösung für diesen Konflikt sucht.
Eine andere Verarbeitung, die phänomenologisch zunächst nicht unmittelbar als depressiv imponiert, zeigt sich in einem überkritischen, aggressiv getönten Verhalten den Mitmenschen und der Welt gegenüber. Durch ständiges »Meckern« und Anklagen an den Partner werden Aggressionen, die in der masochistisch geprägten Haltung eher autoaggressiv verarbeitet werden, unmittelbar im Außen, insbesondere in der Partnerschaft, in Szene gesetzt. Hier handelt es sich um den Versuch, mittels der Verurteilung des Partners (oft der ganzen Welt) sich selbst in eine überlegene Position zu versetzen in der Hoffnung, die jeder depressiven Haltung inhärenten Selbstzweifel mit dieser Wendung der Anklage nach außen abzuwehren. Hier hätte der Partner eine zwar belastende, oft unerträgliche, gleichwohl stabilisierende Funktion, indem er sich als Adressat für die Feindseligkeit und Aggressionen zur Verfügung stellt, mit deren Hilfe die Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls kompensatorisch abgewehrt werden soll. Damit wird unerträgliche Ohnmacht durch Angriff in Macht verwandelt.
1.4.2 Zwanghafte Persönlichkeitsstruktur und Partnerschaft
Zwanghafte Menschen haben ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis, was dazu führt, dass alles Spontane und Unkontrollierbare gefürchtet wird. In der Folge werden alle seelischen Funktionen intensiviert, mit deren Hilfe die Wahrnehmung der inneren Welt der Gefühle ebenso wie die Wahrnehmung der äußeren Welt kontrolliert werden können. Dazu dient in erster Linie die Vorherrschaft rationaler Denkprozesse, aber auch das Herstellen von Ordnung und Struktur in der Außenwelt. Die Angst vor dem Spontanen führt in ausgeprägten Fällen zum Vermeiden jeglicher Emotionalität und damit zu einem deutlich erschwerten Zugang zu inneren Prozessen. Insbesondere wird der Kontakt zu aggressiven Impulsen gefürchtet. Dies führt dazu, dass nicht nur im Außen eine gewisse Rigidität entsteht, sondern auch im Innen starre Regulierungen das Fehlen einer emotional getragenen Orientierung ersetzen.
Sosehr der zwanghafte Mensch bemüht ist, seine Aggressivität nicht zum Ausdruck zu bringen, so stellen sich umgekehrt aber oft bei seinen Mitmenschen ärgerliche Gefühle ein, da er sie durch seine Pedanterie und Zögerlichkeit quält. Dasselbe Phänomen zeigt sich bei übertrieben ordentlichen Menschen, die sich, oft im Verborgenen, mit Schmutz und Unordnung umgeben. Sowohl die passive Aggressivität als auch das Chaos markieren die Tendenz, dass immer auch das Gegenteil dessen, was im aktiven Modus bewältigt wird, innerseelisch vorhanden ist und zum Ausdruck kommen kann.
Vom Partner wird erwartet, dass er sich diesen Regulierungen der Lebensführung ebenfalls unterwirft. Darüber entstehende Konflikte können meist nicht produktiv ausgetragen werden, da nur eine geringe Einfühlung in den Partner möglich ist. Häufig kommt es in der Folge von Konflikten, in denen es darum geht, recht zu behalten, zu einem Beziehungsabbruch. Bezogenheit und Zuneigung als zentrale Werte einer Beziehung spielen eher eine untergeordnete Rolle. Häufig werden komplementäre Partner gesucht, die dann als Projektionsfläche für die eigenen abgewehrten Impulse dienen. Auf diese Weise kommt es zu Konstellationen, in denen beim Partner bekämpft werden muss, was zuvor auf ihn projiziert wurde.
1.4.3 Histrionische Persönlichkeitsstruktur und Partnerschaft
Der histrionische Mensch zeichnet sich durch eine Fülle sehr unterschiedlicher, sich oft widersprechender Haltungen und Verhaltensweisen aus, daher kann er nicht über phänomenologische Merkmale charakterisiert werden. Das Gemeinsame all dieser unterschiedlichen Erscheinungsformen ist der Modus der Verarbeitung innerer oder äußerer Konflikte. Dieser Modus besteht in dem Bestreben des Menschen, durch eine unbewusste Inszenierung die jeweilige Situation und/oder die eigene Person anders erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich ist. Damit präsentiert der Betreffende sich in einem anderen, für ihn angenehmeren Licht, womit er die Unerträglichkeit seiner inneren Konflikte und Belastungen abmildern kann (siehe Mentzos, 2009, S. 97). Diese können das gesamte Spektrum schwer erträglicher Gefühlszustände betreffen, wie das Erleben von Minderwertigkeitsgefühlen, Verlustangst, Schuld- und Schamgefühlen oder Leere und Sinnlosigkeit. Vor diesem Hintergrund lassen sich sehr unterschiedliche Verhaltens- und Erlebensweisen konzeptuell miteinander verbinden.
Je nachdem, welche inneren Spannungen reduziert werden müssen, kann die unbewusste Inszenierung des histrionischen Menschen ihn kompetenter, mächtiger, schöner, besser und stärker erscheinen lassen, als er ist. Hier würde die Inszenierung durch Dramatisierung und Affektualisierung zu einem besonders starken Gefühlsausdruck führen. Umgekehrt kann aber auch Schwäche, Ohnmacht und Hilflosigkeit in Szene gesetzt werden, was phänomenologisch zu einem völlig anderen Erscheinungsbild führt und im Gegenüber entsprechend andere Reaktionen mobilisiert. Unabhängig vom jeweils in Szene gesetzten Thema erwartet der histrionische Mensch von seinem Partner viel Aufmerksamkeit und intensive Zuwendung sowie, je nach Inszenierung, Bewunderung oder aber Mitleid und Unterstützung. Kann der Partner diese Erwartungen nicht (mehr) erfüllen, kommt es zu schweren Enttäuschungen, die ebenfalls dramatisch in Szene gesetzt werden. Aufgrund des großen Inszenierungsbedürfnisses kann es zu häufigen Partnerwechseln kommen, da in einer dauerhaften Beziehung das große Bedürfnis nach Aufmerksamkeit meist nur ungenügend befriedigt werden kann. Häufig wird sie als monoton empfunden, was den Betreffenden mit seiner Angst vor Leere und Desorientierung konfrontieren kann.
1.4.4 Narzisstische Persönlichkeitsstruktur und Partnerschaft
Der narzisstische Mensch erlebt sich als stark und leistungsfähig, er fühlt sich kompetent und autark, ist von sich und seinen Möglichkeiten überzeugt und kann sich ein Scheitern kaum vorstellen. Über Ehrgeiz, Charme oder besonderes Engagement gelingen ihm oft beeindruckende Leistungen und Erfolge. Im Selbsterleben der Betreffenden bildet sich dies als Beweis ihrer Autonomie und Einzigartigkeit ab. Über diese Selbstidealisierung gelingt die Überzeugung, auf die Bewunderung anderer nicht angewiesen zu sein. Phänomenologisch zeigt sich diese pseudounabhängige narzisstische Persönlichkeit tatsächlich in ausgesprochen autarkem Verhalten, bei genauerem Hinsehen wird allerdings deutlich, dass sie mithilfe dieser Erfolge die Mitmenschen zu Bewunderung und Anerkennung nötigt, ohne sich ihrer Abhängigkeit (daher pseudounabhängig) bewusst werden zu müssen.
Die Partner des narzisstischen Menschen haben daher die Aufgabe, diesem Bedürfnis nachzukommen, was bedeutet, dass sie selbst möglichst wenig eigene Ansprüche und Wünsche in die Beziehung einbringen. Dies kann sich in sehr subtiler Weise zeigen, indem unter einer intakten Fassade wenig Interesse am Partner besteht. Es kann aber auch zu einer extremen Dominanz führen, in der vom Partner Unterordnung erwartet wird. In anderen Konstellationen finden sich zwei ähnlich strukturierte Partner, die sich gegenseitig bestätigen, darüber hinaus aber keine innere Bezogenheit haben. Oft handelt es sich bei den Partnern um eine abhängige narzisstische Persönlichkeit, die ein Gegenüber benötigt, das sich für Idealisierungen eignet. Der andere wird idealisiert, um dessen Zuwendung und Anerkennung zu sichern. Dafür ist der Betreffende bereit, auf seine eigene Autonomie zu verzichten und sich mit den Bedürfnissen des anderen so zu identifizieren, dass er sie für die eigenen Bedürfnisse hält. Mit dieser besonderen Selbstaufgabe unterstreicht er die hohe, beinahe überlebenswichtige Bedeutung des Partners, was zu intensiven Bindungen führen kann. Dass es sich bei diesen Menschen um eine Kehrseite der Grandiosität handelt, lässt sich phänomenologisch nicht erkennen, erst nach längeren therapeutischen Prozessen werden diese unbewussten Verbindungen sichtbar (Ermann, 2016).
1.4.5 Persönlichkeitsstrukturen prägen die Paardynamik
Dieser kurze Überblick verdeutlicht, dass Persönlichkeitsstrukturen vielfältige Funktionen haben können. Bei genauerer Analyse dienen sie immer auch als Schutz und Stabilisierungsmechanismus für den Betreffenden. Sie sollen das Selbst stützen und potenzielle innere und äußere Gefahren abwenden. Damit haben sie eine wichtige Funktion für die betreffende Person und müssen in jeder Paarberatung als etwas Gegebenes anerkannt werden, das das ganze Paarsystem einerseits stützt, andererseits aber auch belastet und vermutlich nicht veränderbar ist. Auf die Stabilität von Persönlichkeitsstrukturen hat auch die neurophysiologische Forschung aufmerksam gemacht (Roth, 2015), die betont, dass zentrale Persönlichkeitsmerkmale nicht nur in der Seele, sondern auch im Gehirn verankert sind.
Es können auch Entwicklungsbedingungen vorliegen, die nicht lediglich zur Ausbildung zwar einschränkender, gleichwohl geordneter Persönlichkeitsstrukturen führen, sondern schwerwiegende Persönlichkeitsstörungen zur Folge haben, wie etwa die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Diese Partnerschaften sind stets von massiven Instabilitäten gekennzeichnet und changieren zwischen emotionaler Abhängigkeit und Verschmelzung einerseits und gewalttätigen Auseinandersetzungen andererseits. Die Partner derartiger Paarkonstellationen haben stets in ihrer Biografie traumatische Beziehungserfahrungen gemacht und/oder waren anderweitigen Traumatisierungen ausgesetzt. Die beraterischtherapeutische Arbeit mit diesen Paaren setzt profunde traumatherapeutische Kenntnisse voraus.
Durch Internalisierung früher Erfahrungen mit den Bezugspersonen entstehen innere Strukturen, die mentale Repräsentationen der äußeren Welt im innerseelischen Raum darstellen.
In der Folge bilden sich Selbst-, Objekt- und Beziehungsrepräsentanzen, die sich in charakteristischen Persönlichkeitsmerkmalen niederschlagen.
Jede Persönlichkeitsstruktur steht in Verbindung zu je charakteristischen Beziehungswünschen und -ängsten.
Diese bestimmen entscheidend sowohl die Partnerwahl als auch die Gestaltung der Paarbeziehung.
1.5 Biografie, Bindungsstile und Bindungsrepräsentanzen
Die Gestaltung einer Beziehung hat nicht nur mit den Persönlichkeitsstrukturen der Partner zu tun, sondern auch mit deren Bindungsstilen. Seit der von Bowlby (1975, 1976, 1983) entwickelten Bindungstheorie hat eine intensive und breit angelegte empirische Forschung die Bindungsstile von Säuglingen, Kindern und Erwachsenen beschrieben. Die kindlichen Bindungsstile werden anhand einer von der amerikanisch-kanadischen Psychologin Ainsworth entwickelten Testsituation, der sogenannten Fremde-Situation, bestimmt, in der Kinder zwischen 12 und 18 Monaten einer kurzen Trennungssituation ausgesetzt werden. Dabei konnten vier verschiedene Bindungsstile voneinander unterschieden werden, die bis ins Erwachsenenalter hinein stabil bleiben: die sichere Bindung, die unsicher-vermeidende Bindung, die unsicher-ambivalente Bindung und die desorganisierte Bindung (Boll-Klatt u. Kohrs, 2018). Infolge der transgenerationalen Weitergabe der Bindungsrepräsentation an die nächste Generation werden diese Bindungsstile mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit (70–80 Prozent) von den Bindungsstilen der Eltern bestimmt.
Kinder mit einem sicheren Bindungsstil haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Schutz suchenden ebenso wie ihre autonomen und aggressiven Impulse wahrgenommen und angemessen beantwortet werden. Im Fremde-Situation-Test sind diese Kinder bei der Trennung von der Mutter irritiert, suchen sie und/oder protestieren heftig. Sie lassen sich von der Mutter trösten und können sich danach wieder von ihr lösen und ihr Spiel fortsetzen.
Kinder mit einem unsicher-vermeidenden Bindungsstil haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Schutz suchenden Impulse konsequent nicht beantwortet wurden. Sie suchen in der durch den Test hergestellten Trennungssituation nicht die Nähe zur Mutter, sie erleben auch keine wahrnehmbare Belastung bei Abwesenheit der Mutter.
Kinder mit unsicher-ambivalentem Bindungsstil haben ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass ihre Schutz suchenden Impulse nicht beantwortet wurden, sie sind aber aufgrund der Unsicherheit der Mutter an diese gebunden. Im Fremde-Situation-Test sind sie ausgesprochen ängstlich und bei Abwesenheit der Mutter extrem belastet. Gleichwohl lassen sie sich von der Mutter nicht wirklich beruhigen, sondern schwanken zwischen ihrem Nähewunsch und einem Widerstand gegen die Kontaktaufnahme mit der Mutter.
Kinder mit einem desorganisierten Bindungsstil zeigen im Fremde-Situation-Test keine konsistenten Verarbeitungsstrategien angesichts der Trennungssituation. Sie reagieren mit unvereinbaren Verhaltensweisen wie Erstarrung oder stereotypen Bewegungsabläufen, zur Mutter können sie keine Nähe herstellen.
Die in der Testsituation beschriebenen Verhaltensweisen sind auch Kennzeichen für überdauernde Merkmale der Beziehungsrepräsentanz der betreffenden Personen. Hier handelt es sich um einen Begriff der Psychoanalyse, der die inneren, affektbesetzten Vorstellungen der Beziehungen der Menschen untereinander erfasst und beschreibt, was man von ihnen zu erwarten hat. Die Bindungsrepräsentanz ist ein Begriff aus der Bindungsforschung und erfasst die innerpsychische Abbildung von Erfahrungen und deren Verarbeitung, die mit relevanten Bindungspersonen gemacht wurden. Der Bindungsstil beschreibt die Art und Weise, in der sich eine Person auf andere Menschen bezieht. Im Bindungsstil kommt die Qualität der Bindungsrepräsentanz zum Ausdruck.
Bei der retrospektiven Erfassung der Bindungsqualität Erwachsener ergaben sich ebenso wie bei den in vivo beobachteten Kindern vier Arten von Bindungsrepräsentanzen, die mit vier unterschiedlichen Bindungsstilen der erwachsenen Person korrespondieren. Bei diesen Untersuchungen wurden erwachsene Personen in einem halbstandardisierten Interview, dem Adult Attachment Interview (George et al., 1985), sowohl zu den Bindungserfahrungen ihrer Kindheit befragt als auch zur Bedeutung von Bindungsbeziehungen in ihrem Erwachsenenleben. Die folgende Darstellung der Bindungsstile von Kindern und der Bindungsrepräsentanzen von Erwachsenen orientiert sich an der Systematisierung von Strauß und Schwarze (2016, S. 107).
1.5.1 Autonome Bindungsrepräsentanz
Sicher gebundene Kinder zeigen wie bereits beschrieben im Fremde-Situation-Test einen deutlichen Kummer angesichts des Verlassenwerdens durch die Mutter, sie protestieren und rufen nach ihr. Bei der Wiedervereinigung suchen sie den Körperkontakt zur Mutter, lassen sich trösten und können sich, innerlich beruhigt, schließlich wieder ihrem Spiel zuwenden. Ein derartiges Verhalten ist möglich, weil die Kinder ihre Gefühle zulassen können und zugleich die Erwartung haben, dass sie durch ihr Rufen nach der Mutter ihr Kommen bewirken. Indem dies prompt einsetzt, bewahrheitet sich die kindliche Erwartung nicht nur mit Blick auf die mütterliche Präsenz, sondern auch mit Blick auf ihre Sicherheit und emotionale Beruhigung vermittelnde Funktion. Die Bindungsrepräsentanz dieser Kinder beinhaltet demnach die Überzeugung, dass ihre Gefühle, gleich welcher Art, von ihrem Gegenüber wahr- und ernst genommen werden und im Kontakt eine angemessene Reaktion erfahren. Über diese Erfahrungen vermittelt sich dem Kind eine Selbstrepräsentanz, in der es sich als wertvolle und geliebte Person erfahren kann und in seiner Objektrepräsentanz auf zuverlässige Bezugspersonen vertraut. Darüber entwickelt sich schlussendlich eine stabile innerpsychische Struktur, die es sicher gebundenen Personen ermöglicht, Konflikte und Ambivalenzen ohne Angst vor Verlust oder Schuldgefühlen zuzulassen.
Entsprechend ist der autonome Bindungsstil einer erwachsenen Person durch Selbstvertrauen, Empathie und Respekt gegenüber anderen und die Fähigkeit zur Frustrationstoleranz charakterisiert. So können sich sicher gebundene Menschen ohne massive Abwehr ihrer Biografie zuwenden und ihre Eltern in realistischer Weise mit ihren für ihre Entwicklung förderlichen, aber auch hinderlichen Haltungen wahrnehmen. Sie verfügen über ein breites emotionales Spektrum und können sowohl den Schmerz und die Trauer über ihnen widerfahrene Verletzungen zulassen als auch Freude und Dankbarkeit für liebevolle und unterstützende Haltungen der Eltern. Sie stehen in einem lebendigen und sicheren Kontakt zum eigenen Inneren und haben die Fähigkeit zur Reflexion ihres Erlebens und Handelns. Sie vertrauen ihren Bezugspersonen, haben ihnen gegenüber eine positiv getönte, zugleich realistische Sicht und müssen weder sich selbst noch anderen durch Idealisierung einen Wert verleihen (Köhler, 1992). In Partnerschaften können sie die guten und schlechten Seiten der Beziehung in emotional lebendiger Weise zulassen und sind bemüht, Konflikte und Schwierigkeiten auf eine angemessene Weise zu regulieren. Dabei sind sie sich ihrer Anteile am Zustandekommen von Konflikten bewusst und bereit, sich immer wieder intensiv um eine Beziehungsform zu bemühen, in der die Unterschiede und Eigenarten der Partner kommuniziert, ertragen, respektiert und zugleich begrenzt werden.
1.5.2 Unsicher-distanzierte Bindungsrepräsentanz
Unsicher-vermeidend gebundene Kinder reagieren in der Trennungssituation des Fremde-Situation-Tests nicht mit Kummer und Protest, sondern wirken unberührt und ignorieren das Verlassenwerden ebenso wie die Wiedervereinigung mit der Mutter. Ihre ganze Aufmerksamkeit ist auf Exploration ausgerichtet ebenso wie ihr Bemühen, schmerzvolle Zurückweisungen durch Vermeidung zu umgehen. Dies zeigt sich bei erwachsenen Personen beispielsweise in ihrem Kontakt zu ihrer Biografie. Diese Menschen haben wenige Erinnerungen an ihre Kindheit, gleichwohl neigen sie dazu, die Eltern zu idealisieren, allerdings ohne konkrete Erfahrungen beschreiben zu können, die diese positive Sicht verifizieren. Daneben stehen häufig Erinnerungen an Abweisungen, Vernachlässigungen oder direkte Aggressionen der Eltern, die in ihrer Wirkung auf die eigene Person bagatellisiert werden. Sie haben keine Erinnerung daran, sich angesichts fehlender Unterstützung und Bezogenheit der Eltern traurig, enttäuscht oder verärgert gefühlt zu haben, stattdessen sind sie der Überzeugung, durch eigene Stärke ihr Leben bewältigen zu müssen. Insgesamt messen diese Personen ihren frühen Erfahrungen mit ihren Eltern keine affektive Bedeutung zu, sie haben nicht den Eindruck, dass diese Einfluss auf ihre Entwicklung genommen haben.
Obwohl diese Personen im Laufe ihrer frühen Entwicklung viel Zurückweisung erfahren haben, zeigen sie keine offensichtlichen Anzeichen von Belastung oder Stress. So ist der distanziert-beziehungsabweisende Bindungsstil einer erwachsenen Person durch ein starkes Unabhängigkeitsstreben und ein Bedürfnis nach Stärke und Autarkie unter Vermeidung von emotionaler Berührung gekennzeichnet. Dies steht allerdings im Gegensatz zu einer inneren Anspannung, die den Betreffenden häufig nicht bewusst ist und sich eher dem Gegenüber vermittelt oder in physiologischen Parametern (z. B. erhöhtem Cortisolspiegel) nachgewiesen werden kann. Indem ihre Autonomie- und Explorationsimpulse unterstützt und gefördert, ihre Bindungsbedürfnisse aber enttäuscht wurden, entwickelte sich in der Folge eine Beziehungsrepräsentanz, in der das Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit als ängstigend und bedrohlich erlebt und durch entsprechende Impulse abgewehrt wird. In Partnerschaften kann das konsequente Vermeiden zu großer Nähe durch unterschiedliche Verhaltensweisen hergestellt werden. So kann ein Partner bevorzugt werden, der ebenfalls seine Autonomie betont, es können Streitsituationen inszeniert werden, es besteht ein chronisches Misstrauen dem Partner gegenüber oder aber dessen Bedürfnisse werden zugunsten der kompromisslosen Verfolgung der eigenen Wünsche ignoriert. Bei Belastungssituationen kommt es zu einem schnellen Rückzug, der gelegentlich bis hin zum Kontaktabbruch reichen kann. Im Bemühen, die eigene Autonomie aufrechtzuerhalten, wird die Bedeutung der Beziehung entwertet und stattdessen Sicherheit in Abgrenzung und Unabhängigkeit gesucht.
1.5.3 Verstrickte Bindungsrepräsentanz
Unsicher-ambivalent gebundene Kinder reagieren in der Testsituation auf die Trennung von der Mutter mit starken Gefühlen wie Wut und Angst, sie lassen sich allerdings im Gegensatz zu sicher gebundenen Kindern von der Mutter nicht beruhigen, sondern bleiben über lange Zeit auf dem erhöhten Erregungsniveau. So suchen sie einerseits die Nähe zur Mutter und sind andererseits zugleich distanziert und abweisend.
Durch diese Ambivalenz ist auch der präokkupiert-verstrickte Bindungsstil einer erwachsenen Person gekennzeichnet, indem diese Menschen sich einerseits nach Zuwendung und Nähe sehnen, sie aber andererseits in ihren Beziehungen entweder nicht zulassen oder verhindern. Vor dem Hintergrund einer frühen Beziehungserfahrung, in der die Person sich genötigt sah, eine instabile Mutter zu stützen, wird Bindung gesucht und zugleich abgelehnt, da die ängstliche und inkompetente Mutter aufgrund ihrer eigenen Instabilität in Notsituationen keinen Schutz bot. So besteht noch im Erwachsenenalter der intensive Wunsch, den Eltern zu gefallen und von ihnen Anerkennung zu erhalten. In ihren biografischen Schilderungen hatten diese Menschen oft sehr verwöhnende Eltern, ein Verhalten, das bei genauerem Hinsehen eher zur Verhinderung von Autonomie-, Aggressions- und Explorationsimpulsen des Kindes diente.
So kommt es zu einer inneren Orientierungslosigkeit, in der Angst ebenso wie Wut und Ablehnung das Verhalten dominieren. In Partnerschaften neigen diese Personen zu heftiger Affektivität und sind von Abgrenzungs- und Autonomiewünschen des Partners sehr geängstigt. Konflikte mobilisieren aufgrund der massiven Verlustangst große Verunsicherungen, der sie mit einer Intensivierung der Beziehung begegnen. Die große Bedürftigkeit führt dann oft zu forderndem und ansprüchlichem Verhalten, was im Partner Feindseligkeit und Ablehnung provozieren und zu einer massiven Belastung der Partnerschaft beitragen kann. Das inkonsistente Verhalten spiegelt dabei die innere Ambivalenz wider und reinszeniert die frühe Beziehungssituation: Der Partner wird einerseits gebraucht und herbeigesehnt, andererseits aber gehasst und abgelehnt, da er sich mit seiner Autonomie der Kontrolle entzieht.
1.5.4 Desorganisierte Bindungsrepräsentanz
Personen mit einem Bindungsstil mit unverarbeitetem Trauma haben in ihrer Kindheit mannigfache Traumatisierungen erlebt oder sind mit Bindungspersonen aufgewachsen, die ihre unbearbeiteten Erfahrungen von Gewalt, Vernachlässigung und Missbrauch über den Prozess der transgenerationalen Wiederholung an ihre Kinder weitergegeben haben. Derartige frühe Erfahrungen führen immer zu schweren Störungen in der seelischen Entwicklung und beeinträchtigen durch die Entstehung struktureller Defizite die Lebensgestaltung und partnerschaftlichen Beziehungen der Betreffenden in erheblichem Umfang. Der desorganisierte Bindungsstil führt zu schweren Belastungen und Störungen der betroffenen Personen. Die sich daraus ergebenden beraterisch-therapeutischen Implikationen sind sehr komplex und bedürfen einer traumatherapeutischen Kompetenz.
Es wird deutlich, dass Partnerbeziehungen immer auch die erworbenen Bindungsrepräsentanzen aktualisieren und zu einer Reinszenierung alter Bindungsmuster führen:
Sicher gebundene Personen erleben Vertrauen zu ihren Bezugspersonen und können diese realistisch wahrnehmen. Sie entwickeln einen autonomen Bindungsstil, in dem sie auch die Autonomie des Partners akzeptieren können und angesichts von Konflikten in der Lage sind, sowohl die eigenen als auch die Bedürfnisse des Partners für deren Bewältigung zu berücksichtigen. Hier wiederholt sich die frühe feinfühlige Beziehung zu den Eltern.
Unsicher-vermeidende Personen erleben Nähe als angstauslösend. Sie entwickeln einen distanziert-beziehungsabweisenden Bindungsstil, mit dessen Hilfe sie diese innere Belastung durch Intensivierung ihrer Autonomie und die Herstellung von Distanz zum Partner regulieren. Hier wiederholen sich die pseudoautarken frühen Bewältigungs- und Abwehrmanöver angesichts einer nicht respondenten elterlichen Beziehung.
Unsicher-ambivalente Personen erleben Autonomie und Distanz des Partners als angstauslösend. Sie entwickeln einen präokkupiert-verstrickten Bindungsstil, mit dessen Hilfe sie diese innere Belastung durch eine Intensivierung der Beziehung bei gleichzeitiger aggressiv getönter Haltung dem Partner gegenüber regulieren. Hier wiederholen sich die frühen Ambivalenzen angesichts eines erlebten Verlusts bei zugleich instabiler, wenig Halt gebender Beziehung zu den Eltern.
Personen mit einem Bindungsstil mit unverarbeitetem Trauma haben schwere Beziehungsstörungen, die insbesondere durch eine ausgeprägte Regulationsschwäche angesichts von Belastungssituationen gekennzeichnet sind, wie es beispielsweise eine auch nur kurzzeitige Trennung sein kann. In der Folge kommt es dann leicht zu affektiven Entgleisungen mit häufiger Gewaltanwendung. Hier wiederholen sich die früh erlebten Traumatisierungen in den aktuellen Partnerschaften.
1.6 Biografie und Partnerwahl
Vor dem Hintergrund der biografischen Besonderheiten der Partner und den sich daraus entwickelnden Persönlichkeitsstrukturen und Bindungsstilen wird deutlich, dass die Partnerwahl nicht dem Zufall unterliegt, sondern nach sehr spezifischen Kriterien erfolgt. Die im Folgenden beschriebenen Aspekte der Partnerwahl sind nicht ausschließend, sondern als Ergänzungsreihen zu verstehen.
1.6.1 Partnerwahl als Wiederholung und Wunsch nach Lösung alter Konflikte
Partner werden nach Gesichtspunkten der Familiarität gewählt (König, 1996). In einem potenziellen Partner wird Vertrautes gesucht, das aufgrund der Bekanntheit Sicherheit und Schutz gewährt. Wir fühlen uns von Menschen besonders angezogen, die über entsprechende Übertragungsauslöser (siehe Kapitel 6) verfügen, die somit an vertraute frühere Bezugspersonen erinnern. Dabei kann es sich um äußere Merkmale handeln wie Aussehen und Körperbau, aber auch um nichtverbale wie die Klangfarbe der Stimme oder eine bestimmte Gestik oder Mimik. Diese Übertragungsauslöser werden zum Anlass genommen, noch weitere Ähnlichkeiten bei dem Gegenüber zu vermuten, verbunden mit der Hoffnung, eine Bestätigung für die vorgenommenen Übertragungen zu finden.
Hier handelt es sich also zunächst um einen projektiven Prozess, der mit dem konkreten Gegenüber nichts zu tun haben muss, sondern ganz dem inneren Bild des Projizierenden geschuldet ist. Dennoch muss diese Projektion sich sehr schnell an der Realität »beweisen«, da vom Gegenüber weitere Übereinstimmungserfahrungen erwartet werden. Da dieser Prozess wechselseitig abläuft, beide demnach auf der Suche nach einer Bestätigung ihrer Familiaritätswünsche sind, lässt sich leicht verstehen, wie störanfällig das erste Kennenlernen ist. Wohnt den Übertragungsauslösern eine hohe Attraktivität inne, werden häufig sehr nachhaltige Versuche unternommen, den Partner dahingehend aktiv zu beeinflussen, dass er die auf ihn projizierten Erwartungen erfüllt. Diese Manipulationsversuche umfassen ein weites Verhaltensspektrum, das von verführerischem Verhalten bis zu subtiler, gelegentlich auch massiver Machtausübung reicht. Gemeinsam ist all diesen Versuchen der Wunsch, den anderen dazu zu bringen, sich den Übertragungswünschen entsprechend konform zu verhalten. Dieser interaktionelle Prozess bewirkt eine gegenseitige Beeinflussung mit dem Ziel, dass der Partner dem übertragenen Objekt ausreichend ähnlich wird, aber doch unähnlich genug bleibt, damit keine »Verwechslung« mit den Personen der frühen Kindheit stattfindet.