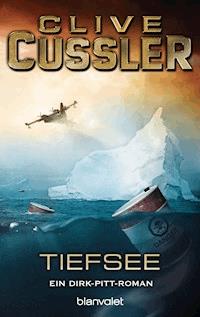
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dirk-Pitt-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Ein rätselhaftes Gift tötet vor der Küste Alaskas jegliches Leben. Als man begreift, dass sich eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes anbahnt, kann nur noch einer das Schlimmste verhindern: Dirk Pitt, Major der Meeresbehörde NUMA. Doch ihm stellt sich eine weltweit operierende kriminelle Organisation entgegen, die keinerlei Skrupel kennt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
Tiefsee
Roman
Übersetzt von Willy Thaler
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Deep Six« bei Simon & Schuster, New York.
1. Auflage
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © der Originalausgabe 1984 by Clive Cussler Enterprises, Inc.
All rights reserved throughout the world.
By arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176 – 0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1988 by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-15219-2
www.blanvalet.de
Für Tubby’s Bar und Grill in Alhambra,Rand’s Roundup auf dem Wilshire Boulevardden Black Knight in Costa Mesaund Shanner’s Bar in Denver.Vorbei – aber nicht vergessen
VORSPIEL Die »San Marino«
15. Juli 1966
Pazifik
Eine dunkelhaarige junge Frau beschirmte mit der Hand ihre braunen Augen gegen die Sonne und starrte zu dem großen Sturmvogel hinauf, der über dem hinteren Ladebaum des Schiffes schwebte. Sie bewunderte für ein paar Minuten den eleganten Flug des Vogels, dann wurde es ihr langweilig, und sie setzte sich auf, sodass nun regelmäßige rote Streifen auf ihrem braun gebrannten Rücken zu sehen waren, die von den Latten eines Sessels auf dem alten Dampfer herrührten.
Sie blickte sich nach der Deckmannschaft um, die aber nirgends zu sehen war, und drückte den Busen in den Schalen ihres BHs in eine angenehmere Lage.
Infolge der heißen Tropenluft war ihr Körper erhitzt und schweißbedeckt. Sie strich mit der Hand über ihren straffen Bauch und spürte, wie der Schweiß aus den Poren drang. Sie lehnte sich beruhigt und entspannt wieder zurück, während das hämmernde Stampfen der alten Maschinen des Frachters und die drückende Hitze der Sonne sie schläfrig machten.
Die Angst, die in ihr getobt hatte, als sie an Bord gekommen war, hatte sich gelegt. Sie lag nicht mehr wach und horchte auf das Klopfen ihres Herzens, versuchte nicht mehr, in den Gesichtern der Besatzung Anzeichen irgendeines Verdachtes zu lesen, und wartete auch nicht mehr darauf, dass der Kapitän ihr mitteilte, er müsse sie in Gewahrsam nehmen. Sie verdrängte allmählich die Gedanken an ihr Verbrechen und begann an ihre Zukunft zu denken. Sie stellte erleichtert fest, dass Schuldgefühl letzten Endes nur eine vorübergehende Gemütsbewegung war.
Aus den Augenwinkeln bemerkte sie die weiße Jacke des chinesisch aussehenden Messeboys, der bei der Treppe auftauchte. Er näherte sich ihr ängstlich, während sein Blick auf das Deck gerichtet war, als mache es ihn verlegen, ihre nahezu unbekleidete Gestalt anzusehen.
»Verzeihen Sie, Miss Wallace«, sagte er, »Kapitän Masters ersucht Sie höflich, heute Abend bitte mit ihm und seinen Offizieren zu Abend zu essen, das heißt, wenn Sie sich besser fühlen …«
Estelle Wallace war dankbar, dass ihre zunehmende Sonnenbräune ihr Erröten verbarg. Seit sie in San Francisco an Bord gegangen war, hatte sie eine Erkrankung vorgetäuscht und alle Mahlzeiten in ihrer Kabine eingenommen, um einemGespräch mit den Schiffsoffizieren zu entgehen. Sie erkannte, dass sie sich kaum für immer absondern konnte. Es war an der Zeit, dass sie sich daran gewöhnen musste, mit einer Lüge zu leben. »Richten Sie Kapitän Masters aus, dass es mir viel besser geht. Ich freue mich darauf, mit ihm zu Abend zu essen.«
»Das wird er gern hören«, sagte der Messeboy mit breitem Lächeln, das eine große Lücke in seiner oberen Zahnreihe enthüllte. »Ich werde dafür sorgen, dass Ihnen der Koch etwas Besonderes zubereitet.«
Er machte kehrt und schlich in einer Haltung davon, die Estelle selbst bei einem Asiaten ein wenig zu unterwürfig vorkam.
Ihr Entschluss stand fest, und sie starrte zu den drei Decks des Mittelschiffsaufbaus der San Marino empor. Über der schwarzen Rauchwolke, die aus dem einzigen Schornstein aufstieg und sich scharf von der abblätternden weißen Farbe der Schotten abhob, war der Himmel von einem unwirklichen Blau.
»Ein seetüchtiges Schiff«, hatte der Kapitän geprahlt, als er sie in die Kabine führte. Er leierte die Geschichte und technischen Daten der San Marino herunter, als wäre Estelle ein ängstlicher Passagier bei der ersten Kanufahrt über die Stromschnellen.
Die San Marino war 1943 nach dem Standard der Libertyschiffe gebaut worden und hatte militärisches Nachschubmaterial über den Atlantik nach England befördert, wobei sie sechzehn Mal die Überquerung in beiden Richtungen geschafft hatte. Als sie einmal von dem Begleitschutz getrennt worden war, traf sie ein Torpedo, aber sie weigerte sich unterzugehen und schaffte es mit eigener Kraft bis nach Liverpool.
Nach dem Krieg hatte sie unter der Flagge Panamas als eines von dreißig Schiffen der Manx Steamship Company in New York die Weltmeere befahren und in den verschiedensten kleinen Häfen angelegt. Ihre Gesamtlänge betrug 132 Meter, sie hatte einen überhängenden Steven und ein Kreuzerheck, und sie tuckerte mit elf Knoten durch die Dünungen des Pazifik. Sie würde nur noch ein paar Jahre lang Gewinn abwerfen und dann schließlich verschrottet werden.
Roststreifen zeichneten ihre Stahlhaut. Sie sah so schäbig aus wie eine Hure auf der Bowery, doch in Estelles Augen wirkte sie jungfräulich und schön.
Estelles Vergangenheit rückte in immer weitere Ferne. Mit jeder Drehung der ausgeleierten Maschinen vergrößerte sich die Kluft zwischen Estelles eintönigem Leben voll Selbstverleugnung und der strahlenden Zukunft, die sie für sich anpeilte.
Arta Casilighios Metamorphose zu Estelle Wallace begann, als sie unter dem Sitz eines Autobusses auf dem Wilshire-Boulevard während der Stoßzeit einen verlorenen Pass entdeckte. Ohne eigentlich zu wissen warum, steckte ihn Arta in ihre Handtasche.
Auch mehrere Tage danach hatte sie das Dokument noch immer weder dem Busfahrer gegeben noch der rechtmäßigen Besitzerin zugeschickt. Sie studierte die Seiten mit den ausländischen Stempeln stundenlang. Das Gesicht auf dem Foto faszinierte sie. Obwohl die Passbesitzerin besser frisiert war, sah sie ihr erstaunlich ähnlich. BeideFrauen waren ungefähr im gleichen Alter, ihre Geburtstage lagen kaum acht Monate auseinander. Ihre braunen Augen entsprachen dem Passbild, und abgesehen vom Unterschied in Frisur und Haartönung hätte man sie für Schwestern halten können.
Sie begann sich so zu schminken, dass sie wie Estelle Wallace aussah, die ihr zweites Ich wurde, das zumindest im Geist an die exotischen Orte der Welt flüchten konnte, die für die schüchterne mausgraue Arta Casilighio unerreichbar waren.
Eines Abends nach Geschäftsschluss in der Bank, in der sie arbeitete, war ihr Blick auf die Bündel frisch gedruckter Geldscheine gefallen, die am Nachmittag von der Federal Reserve Bank im Geschäftsviertel von Los Angeles geliefert worden waren. Sie hatte sich in den vier Jahren ihrer Anstellung schon so sehr daran gewöhnt, mit großen Geldsummen zu arbeiten, dass sie der Anblick kaum erregte, eine Abstumpfung, die früher oder später bei allen Kassenbeamten eintritt. Doch unerklärlicherweise eröffneten diesmal die Bündel grüner gedruckter Zahlungsmittel eine ganz neue Dimension: Im Unterbewusstsein begann sie sich vorzustellen, dass sie ihr gehörten.
Arta fuhr an diesem Wochenende nach Hause und schloss sich in ihrer Wohnung ein, wo ihr Entschluss reifte und sie das Verbrechen plante, das sie begehen wollte; sie übte jede Bewegung, jede kleinste Geste ein, bis sie ihr glatt und reibungslos gelang. Die ganze Sonntagnacht über lag sie wach, bis der Wecker klingelte; sie war in kalten Schweiß gebadet, aber fest entschlossen, ihren Plan durchzuführen.
Die Bargeldsendung traf jeden Montag in einem Panzerwagen ein und belief sich gewöhnlich auf sechs- bis achthunderttausend Dollar. Nach nochmaligem Zählen wurden die Banknoten bis zur Verteilung am Mittwoch an die Zweigstellen der Bank im ganzen Stadtbereich von Los Angeles aufbewahrt. Sie hatte sich ausgerechnet, dass der Montagabend die richtige Zeit für ihren Coup war, während sie ihre Geldlade im Tresor deponierte.
Nachdem Arta am Morgen geduscht und sich geschminkt hatte, zog sie eineStrumpfhose an. Sie wickelte eine Rolle mit doppelseitigem Klebeband von der Mitte der Waden bis über die Oberschenkel um ihre Beine, wobei sie die äußere Schutzschicht desKlebestreifens nicht abzog. Diese merkwürdige Vorrichtung verdeckte sie mit einemlangen Rock, der ihr fast bis zu den Knöcheln und noch einige Zentimeter über den Klebestreifen hinaus reichte.
Als Nächstes nahm sie sauber zurechtgeschnittene Päckchen festes Schreibpapier und schob sie in eine große Beuteltasche. Jedes zeigte auf der Außenseite einen frisch gedruckten, funkelnagelneuen Fünfdollarschein und war mit der blauweißen Originalbanderole der Federal ReserveBank umwickelt. Bei flüchtigem Hinsehen würden sie daher durchaus echt wirken.
Arta stand vor einem bis zum Boden reichenden Spiegel und wiederholte immer wieder, »Arta Casilighio existiert nicht mehr. Du bist jetzt Estelle Wallace.« Die Autosuggestion wirkte. Sie spürte, wie sich ihre Muskeln entkrampften und ihr Atem langsamer, weniger hastig ging. Dann zog sie die Luft tief ein, straffte die Schultern und ging zur Arbeit.
Weil sie bemüht war, nicht aufzufallen, kam sie unabsichtlich zehn Minuten zu früh zur Bank, was eigentlich ein erstaunlicher Vorgang für alle, die sie näher kannten, hätte sein müssen, aber es war ein Montagmorgen und fiel daher niemandem auf. Sobald sie hinter ihrem Kassenschalter Platz genommen hatte, wurde ihr jede Minute zu einer Stunde, jede Stunde zu einem ganzen Leben. Sie fühlte sich merkwürdig losgelöst von der vertrauten Umgebung, doch die Vorstellung, den gefährlichen Plan aufzugeben, verdrängte sie rasch.
Glücklicherweise kamen weder Angst noch Panik bei ihr auf.
Als es endlich sechs Uhr war und einer der stellvertretenden Vizepräsidenten die massiven Eingangstüren schloss und versperrte, rechnete sie rasch ihre Geldkassette ab und verschwand unauffällig in die Damentoilette, wo sie in der Sicherheit einer Kabine die Außenschicht des Klebestreifens von ihren Beinen ablöste und sie die Toilette hinunterspülte. Dann nahm sie die falschen Geldpäckchen, klebte sie auf den Klebestreifen und stampfte auf, um sich zu vergewissern, dass keines herunterfallen würde, wenn sie ging.
Als sie sich davon überzeugt hatte, dass alles in Ordnung war, kam sie heraus und trödelte so lange in der Vorhalle, bis die anderen Kassierer ihre Bargeldladen im Tresor deponiert hatten und weggegangen waren. Sie brauchte nur zwei Minuten in der großen Stahlkammer allein zu sein, und diese zwei Minuten bekam sie.
Sie zog rasch denRock hoch und tauschte die präparierten Pakete gegen solche mit echten Geldscheinen um. Als sie den Tresor verließ und dem stellvertretenden Vizepräsidenten zulächelte, der sie mit einem Nicken durch eine Seitentür hinausließ, konnte sie kaum glauben, dass ihr Coup tatsächlich gelungen war.
Sekunden nachdem sie ihre Wohnung betreten hatte, zog sie den Rock aus, nahm die Geldpakete von ihren Beinen und zählte sie. Ihre Beute betrug einundfünfzigtausend Dollar.
Das war bei Weitem zu wenig.
Eine Welle der bitteren Enttäuschung brandete in ihr auf. Sie brauchte mindestens das Doppelte, um außer Landes gehen und sich ein Minimum an Komfort leisten zu können, während sie den Löwenanteil durch Investitionen zu vermehren hoffte.
Die Mühelosigkeit der Unternehmung hatte sie kühn gemacht. Sie fragte sich, ob sie es wagen würde, ihren Fischzug im Tresor zu wiederholen? Das Geld der Federal Reserve Bank war schon gezählt und würde erst am Mittwoch an die Zweigstellen der Bank verteilt werden. Morgen war Dienstag. Sie hatte noch einmal die Möglichkeit zuzuschlagen, bevor der Verlust entdeckt wurde.
Warum nicht? Die Vorstellung, dieselbe Bank zweimal innerhalb von zwei Tagen zu berauben, erregte sie. Vielleicht fehlte es Arta Casilighio an dem nötigen Mut dazu, aber Estelle Wallace musste man keineswegs dazu überreden.
An diesem Abend kaufte sie in einem Trödlerladen einen großen, altmodischen Handkoffer und baute darin einen doppelten Boden ein. Sie verstaute darin das Geld zusammen mit ihren Kleidern und nahm ein Taxi zum Internationalen Flughafen von Los Angeles, wo sie den Koffer über Nacht in einem Schließfach verstaute und ein Ticket für die Dienstagabendmaschine nach San Francisco kaufte. Sie wickelte ihr unbenütztes Ticket für Montag Abend in eine Zeitung und warf sie in einen Abfallkorb. Somit war alles Notwendige getan, und sie fuhr nach Hause und schlief wie ein Murmeltier.
Der zweite Raub verlief ebenso glatt wie der erste. Drei Stunden nachdem sie die Beverly Wilshire Bank zum letzten Mal verlassen hatte, zählte sie das Geld in einem Hotel in San Francisco noch einmal. Der Gesamtbetrag machte nun einhundertachtundzwanzigtausend Dollar aus. Keine umwerfende Summe, wenn man die Inflation bedachte, aber mehr als ausreichend für ihre Bedürfnisse.
Der nächste Schritt war verhältnismäßig einfach. Sie suchte die Zeitungen nach Schifffahrtsplänen ab und fand die San Marino, einen Frachter, der um halb sieben am nächsten Morgen mit dem Bestimmungshafen Auckland, Neuseeland, in See stach.
Eine Stunde vor der Abfahrtszeit ging sie den Laufsteg hinauf. Der Kapitän meinte zwar, dass er nur selten Passagiere mitnähme, erklärte sich jedoch freundlicherweise bereit, sie für einen einvernehmlich ausgehandelten Fahrpreis an Bord zu nehmen, wobei Estelle annahm, dass das Geld in seiner Brieftasche und nicht in der Kasse der Schifffahrtsgesellschaft landen würde.
Estelle trat über die Schwelle der Offiziersmesse und verharrte einen Augenblick lang, als sie sich den sechsMännern gegenübersah, die sie abschätzend musterten.
Ihr kupferfarbenes Haar fiel auf ihre Schultern herab und passte gut zu ihrem gebräunten Teint. Sie trug ein langes, glattes rosa T-Shirt-Kleid, das ihre Figur an den richtigen Stellen betonte, mit einem weißen Elfenbeinarmband als einzigem Schmuck. Für die Offiziere war ihre schlichte Eleganz eine Sensation.
Kapitän Irwin Masters, ein hochgewachsener Mann mit graumeliertem Haar, kam auf sie zu und ergriff ihren Arm. »Miss Wallace«, begrüßte er sie mit freundlichem Lächeln, »es ist schön, dass Sie sich bei uns wohlfühlen.«
»Das Schlimmste habe ich überstanden.«
»Ich muss zugeben, ich begann schon, mir Sorgen zu machen. Dass Sie fünf Tage lang Ihre Kabine nicht verlassen haben, ließ mich schon das Schlimmste befürchten. Da wir keinen Arzt an Bord haben, hätten wir uns in einer unangenehmen Lage befunden, wenn Sie dringend ärztliche Behandlung gebraucht hätten.«
»Ich danke Ihnen«, sagte sie leise.
Er sah sie erstaunt an. »Sie danken mir, wofür?«
»Für Ihre Fürsorge.« Sie drückte sanft seinen Arm. »Es ist lange her, seit sich jemand meinetwegen Sorgen gemacht hat.«
Er nickte und zwinkerte ihr zu. »Dafür sind Schiffskapitäne ja da.« Dann wandte er sich an die anderen Offiziere. »Meine Herren, darf ich Ihnen Miss Estelle Wallace vorstellen, die uns mit ihrer entzückenden Anwesenheit beehrt, bis wir in Auckland anlegen.«
Sie wurde jedem der Reihe nach vorgestellt. Die Tatsache, dass die meisten der Männer mit Nummern bezeichnet wurden, belustigte sie: Der Erste Offizier, der Zweite Offizier, sogar ein Vierter war an Bord. Alle schüttelten ihr die Hand, als bestünde sie aus zartem Porzellan, alle außer dem Schiffsingenieur, einem kleinen, breitschultrigen Mann mit einem slawischen Akzent. Er verbeugte sich steif und küsste ihre Fingerspitzen.
Der Erste Offizier winkte dem Messeboy, der hinter einer kleinen Mahagonibar stand. »Miss Wallace, was würden Sie gerne trinken?«
»Könnte ich einen Daiquiri bekommen? Ich habe Lust auf etwas Süßes.«
»Selbstverständlich«, antwortete der Erste Offizier. »Die San Marino ist vielleicht kein Luxus-Kreuzfahrtschiff, aber wir haben die beste Cocktailbar auf dieser Breite im Pazifik.«
»Seien Sie ehrlich«, ermahnte ihn der Kapitän gutmütig. »Sie haben nicht erwähnt, dass wir wahrscheinlich das einzige Schiff in diesen Breitengraden sind.«
»Ein unwesentlicher Umstand.« Der Erste Offizier zuckte mit den Achseln. »Lee, einen deiner berühmten Daiquiris für die junge Dame.«
Estelle sah interessiert zu, wie der Messeboy fachmännisch die Limone ausdrückte und die Bestandteile zusammenmixte. Jede Bewegung erfolgte mit elegantem Schwung. Der schäumende Drink schmeckte gut, und sie musste ihr Verlangen bremsen, ihn in einem Zug zu leeren.
»Lee«, sagte sie, »du bist ein Wunderknabe.«
»Das ist er wirklich«, stimmte Masters zu. »Es war ein Glück, dass wir ihn angeheuert haben.«
Estelle trank noch einen Schluck. »Sie scheinen etliche Asiaten in Ihrer Mannschaft zu haben.«
»Ersatzleute«, erklärte Masters. »Zehn Mann von der Besatzung sind abgehauen, nachdem wir in San Francisco angelegt hatten. Zum Glück schickte uns die Arbeitsvermittlung Leeund seine neun koreanischen Kameraden vor unserer Weiterfahrt.«
»Alles verdammt merkwürdig, wenn Sie mich fragen«, brummte der Zweite Offizier.
Masters zuckte die Schultern. »Dass Besatzungsmitglieder in einem Hafen abspringen, kam schon vor, als der erste Cromagnon sein erstes Floß zusammenbastelte. Daran ist gar nichts merkwürdig.«
Der Zweite Offizier schüttelte zweifelnd den Kopf. »Einer oder zwei vielleicht, aber nicht zehn. Die San Marino ist ein seetüchtiges Schiff, und der Kapitän ist fair. Es gab keinen Grund für solch einen Massenexodus.«
»So ist es eben auf See«, seufzte Masters. »Die Koreaner sind ordentliche, schwer arbeitende Seeleute. Ich würde sie nicht für die halbe Fracht in unseren Laderäumen hergeben.«
»Das ist ein ziemlich hoher Preis«, murmelte der Schiffsingenieur.
»Ist es ungehörig«, fragte Estelle, »wenn ich mich erkundige, was für Ladung Sie befördern?«
»Keineswegs«, antwortete der sehr junge Vierte Offizier eifrig. »In San Francisco wurden unsere Frachträume mit …«
»Titanbarren vollgeladen«, unterbrach ihn Kapitän Masters.
»Sie sind acht Millionen Dollar wert«, fügte der Erste Offizier mit einem strengen Blick auf den Vierten hinzu.
»Noch einmal dasselbe, bitte«, bestellte Estelle und reichte dem Messeboy ihr leeres Glas. Dann wandte sie sich wieder an Masters. »Ich habe von Titan gehört, habe aber keine Ahnung, wofür es verwendet wird.«
»Wenn man es ordnungsgemäß in reiner Form verarbeitet, wird Titan haltbarer und leichter als Stahl, ein Vorteil, der es bei den Herstellern von Düsenflugzeugen sehr begehrt macht. Es wird außerdem für die Erzeugung von Farben, Kunstseide und Kunststoffen verwendet. Ich nehme an, Sie finden sogar Spuren davon in Ihren Kosmetika.«
Der Koch, ein anämisch aussehender Asiate mit weißer Schürze, schaute aus einer Seitentür heraus und nickte Lee zu, der daraufhin mit einem Mixlöffel an ein Glas klopfte.
»Das Abendessen ist bereit«, verkündete er in seinem stark akzentuierten Englisch und zeigte strahlend lächelnd seine Zahnlücke.
Es war eine fantastische Mahlzeit, und Estelle war davon überzeugt, sie nie zu vergessen. Sechs aufmerksame Männer in eleganten Uniformen umringten sie, und ihre weibliche Eitelkeit war zutiefst befriedigt.
Nach einer halben Tasse Kaffee entschuldigte sich Kapitän Masters und ging auf die Brücke. Die anderen Offiziere verschwanden nacheinander, um ihren Pflichten nachzugehen, und Estelle machte mit dem Schiffsingenieur eine Runde auf Deck. Er unterhielt sie mit Seemannsgarn, Geschichten von unheimlichen Ungeheuern der Tiefe und ausgesuchten Anekdoten über die Besatzung, die sie zum Lachen brachten.
Schließlich kamen sie zu ihrer Kabinentür, und er küsste ihr wieder galant die Hand. Als er sie bat, am nächsten Morgen mit ihm zu frühstücken, nahm sie seine Einladung dankend an.
Sie trat in die kleine Kabine, ließ das Türschloss einschnappen und knipste die Deckenbeleuchtung an. Dann zog sie den Vorhang über das einzige Bullauge des Raumes, zog ihren Koffer unter dem Bett hervor und öffnete ihn.
Der oberste Einsatz enthielt ihre Kosmetika und ihre sorglos hineingestopfte Unterwäsche; sie hob ihn heraus. Darunter lagen ordentlich gefaltete Blusen und Röcke. Sie nahm sie gleichfalls heraus, um später in der Dusche die Falten im Dampf zu glätten. Vorsichtig fuhr sie mit einer Nagelfeile die Kanten des falschen Bodens entlang und hob ihn hoch. Dann lehnte sie sich zurück und seufzte erleichtert. Das Geld war noch in seinem Versteck in mit der Banderole der Federal Reserve Bank umwickelten Bündeln. Sie hatte kaum etwas davon ausgegeben.
Sie stand auf und zog sich das Kleid über den Kopf – sie trug gewagterweise nichts darunter –, ließ sich auf das Bett fallen und verschlang die Hände hinter dem Kopf.
Sie schloss genüsslich die Augen und versuchte, sich den erschrockenen Gesichtsausdruck ihrer Vorgesetzten vorzustellen, wenn sie entdeckten, dass das Geld und die verlässliche kleine Arta Casilighio zugleich fehlten. Sie hatte sie alle hereingelegt!
Sie spürte eine seltsame, fast sexuelle Erregung, wenn sie daran dachte, dass das FBI sie auf seine Liste der dringend gesuchten Verbrecher setzen würde. Die mit der Untersuchung betrauten Beamten würden alle ihre Freunde und Nachbarn befragen, alle ihre alten Schlupfwinkel durchstöbern, tausendundeine Bank auf plötzliche große Einzahlungen von Banknoten mit laufender Nummerierung überprüfen, aber sie würden nichts finden. Arta, alias Estelle, war nicht dort, wo sie deren Meinung nach sein konnte.
Sie schlug die Augen auf und starrte auf die bereits vertrauten Wände ihrer Kabine. Seltsam, der Raum begann sich zu drehen. Die Gegenstände verschwammen vor ihren Augen und wurden wieder deutlich. Ihre Blase verlangte, dass sie eigentlich die Toilette aufsuchen sollte, doch ihr Körper verweigerte dem Befehl denGehorsam – alle Muskeln schienen erstarrt zu sein. Dann ging die Tür auf, und der Messeboy Lee trat mit einem zweiten asiatischen Besatzungsmitglied ein.
Lee lächelte nicht mehr.
Das darf doch nicht wahr sein, sagte sie sich. Die Mannschaft würde es doch nicht wagen, sie zu stören, während sie nackt auf dem Bett lag. Dies musste ein verrückter Traum sein, verursacht durch die reichlichen Speisen und Getränke, ein Albtraum, den eine Magenverstimmung ausgelöst hatte.
Sie fühlte sich von ihrem Körper losgelöst, als beobachtete sie die unglaubliche Szene aus einer Ecke der Kabine. Die beiden Männer trugen sie sanft durch die Tür, den Korridor entlang und auf das Deck.
Dort waren etliche koreanische Besatzungsmitglieder anwesend, deren ovale Gesichter durch Flutlicht von oben beleuchtet wurden. Sie hoben große Bündel in die Höhe und warfen sie über die Reling. Plötzlich starrte eines der Bündel sie an. Es war das aschgraue Gesicht des jungen Vierten Offiziers, seine Augen waren in einer Mischung von Unglauben und Entsetzen weit aufgerissen. Dann verschwand auch er über die Reling.
Lee beugte sich über sie und machte sich an ihren Füßen zu schaffen. Sie spürte nichts, nur dumpfe Betäubung und Kraftlosigkeit. Er schien eine rostige Kette an ihren Knöcheln zu befestigen.
»Warum tat er das nur?«, fragte sie sich vage. Sie beobachtete apathisch, wie man sie in die Höhe hob. Dann wurde sie losgelassen und schwebte durch die Dunkelheit.
Etwas traf sie mit fürchterlicher Wucht, schlug ihr die Luft aus der Lunge. Eine kühle, nachgiebige Masse schloss sich über ihr, ein unbarmherziger Druck wirkte auf ihren Körper ein, zog sie nach unten und presste ihr Inneres wie in einem riesigen Schraubstock zusammen.
Ihre Trommelfelle platzten, und in diesem Augenblick reißenden Schmerzes wurde ihr Geist vollkommen klar, und sie wusste, dass es kein Traum war. Ihr Mund öffnete sich, um einen hysterischen Schrei auszustoßen. Sie brachte keinen Ton heraus. Der zunehmende Druck des Wassers presste ihr bald den Brustkorb ein. Ihr lebloser Körper trieb in die wartenden Arme des dreitausend Meter tiefen Abgrunds.
ERSTER TEIL Die »Pilottown«
1
25. Juli 1989
Cook Meerenge, Alaska
Schwarze Wolken türmten sich drohend über dem Meer um die Insel Kodiak auf und färbten die dunkle blaugrüne Fläche bleigrau. Die orangefarbene Glut der Sonne wurde ausgelöscht wie der Schein einer Kerze. Im Gegensatz zu den meisten Stürmen, die vom Golf von Alaska herabfegten und Windgeschwindigkeiten vor 80 bis 160 Stundenkilometern erreichten, brachte dieser eine milde Brise. Regen setzte ein, zuerst nur einzelne Tropfen, dann zu einer wahren Sintflut anwachsend, die das Wasser zu weißem Gischt aufpeitschte.
Auf der Kommandobrücke des Kutters der Küstenwache Catawaba hielt Korvettenkapitän Amos Dover ein Fernglas und bemühte sich, den dichten Regenschleier mit seinem Blick zu durchdringen. Es war, als würde er durch einen schimmernden Bühnenvorhang starren. Nach 400 Metern war jegliche Sicht am Ende. Der Regen fühlte sich kalt auf seinem Gesicht an und noch kälter, als er an dem aufgestellten Kragen seiner wasserdichten Jacke vorbei seinen Hals hinunterlief. Schließlich spuckte er die wassertriefende Zigarette über die Reling und betrat die trockene Wärme des Ruderhauses.
»Radar!«, rief er mürrisch.
»Kontakt sechshundertfünfzig Meter voraus und näherkommend«, antwortete der Mann am Radarschirm, ohne von den kleinen Anzeigen auf dem Schirm aufzublicken.
Dover knöpfte seine Jacke auf und wischte sich mit einem Taschentuch die Nässe vom Hals. Probleme waren das Letzte, was er bei dem wilden Wetter erwartete.
Im Hochsommer kam es selten vor, dass ein Kutter der Fischfangflotte oder ein privates Vergnügungsschiff vermisst wurde, vielmehr war der Winter die Jahreszeit, in der sich der Golf heimtückisch und gefährlich zeigte. Kalte arktische Winde trafen auf wärmere, aus dem Alaskastrom aufsteigende Luft und lösten unglaubliche Stürme aus, türmten riesige Wellen auf, zermalmten Schiffsrümpfe und vereisten die Deckaufbauten, bis ein Schiff so sehr kopflastig wurde, dass es kenterte und wie ein Stein versank.
Sie hatten den SOS-Ruf eines Schiffes aufgefangen, das sich Amie Marie nannte. Ein rasches SOS-Signal, gefolgt von einer Loran-Positionsangabe und den Worten: »… glaube, alle sterben.«
Funksprüche mit dem Ersuchen um weitere Informationen wurden wiederholt ausgesandt, aber der Funker an Bord der Amie Marie meldete sich nicht mehr.
Eine Suche aus der Luft kam erst dann infrage, wenn das Wetter aufklarte. Jedes Schiff innerhalb von hundert Meilen änderte seinen Kurs und fuhr mit Volldampf auf die angegebene Position zu. Wegen der größeren Geschwindigkeit der Catawaba nahm Dover an, dass sie das in Seenot befindliche Schiff als Erste erreichen würde. Dank der riesigen, dröhnenden Dieselmotore war sein Kutter schon an einem Küstenfrachter und einem Golf-Linienschiff vorbeigezogen, die nun beide in seinem Kielwasser weitab dahinschaukelten.
Dover war ein bärenstarker Hüne, der im Seerettungsdienst seinen Mann gestanden hatte. Er hatte zwölf Jahre in den nördlichen Gewässern verbracht und sich hartnäckig gegen jede widerwärtige Wetterlaune gestemmt, der ihn die Arktik ausgesetzt hatte. Er war zäh und windgegerbt, bewegte sich langsam und schwankend, besaß jedoch einen Geist wie eine Rechenmaschine, der seiner Besatzung immer von neuem Ehrfurcht einflößte. Noch ehe die Schiffscomputer programmiert worden waren, hatte er im Kopf den Windfaktor und den Strömungsabtrieb schneller ausgerechnet und die Position ermittelt, an der das Schiff, Wrack oder etwaige Überlebende gefunden werden mussten, und hatte dann oft den Nagel auf den Kopf getroffen.
Das Summen der Maschinen unter seinen Füßen stieg zu einem schrillen, hohen Ton an. Die Catawaba schien wie ein von der Leine gelassener Spürhund die Witterung ihrer Beute aufzunehmen. Alle Besatzungsmitglieder wurden von Jagdfieber gepackt. Ohne sich um den Regen zu kümmern, standen sie auf den Decks und der Brücke.
»Vierhundert Meter«, schrie der Beobachter am Radarschirm.
Da begann auf einmal ein Seemann, der die Bugstange hielt, energisch in denRegen hinauszuzeigen.
Dover beugte sich aus der Tür des Ruderhauses und rief durch den Lautsprecher: »Hält sie sich über Wasser?«
»Schwimmt wie eine Gummiente in einer Badewanne«, brüllte der Matrose durch die um den Mund gelegten Hände zurück.
Dover nickte dem wachhabenden Leutnant zu. »Maschinen drosseln.«
»Maschinen ein Drittel Kraft«, bestätigte der Leutnant, während er eine Reihe von Hebeln am vollautomatischen Schiffssteuerpult betätigte.
Langsam tauchte die Amie Marie durch die Regenwand auf. Sie waren darauf gefasst, sie halb überflutet, kurz vor dem Sinken vorzufinden. Aber sie lag makellos im Wasser und trieb in der leichten Dünung ohne das geringste Anzeichen von Seenot. Eine unnatürliche, fast gespenstische Stille lag über ihr. Ihre Decks waren verlassen, und als Dover über den Lautsprecher hinüberrief, erfolgte keine Antwort.
»Sie sieht aus wie ein Krebsfänger«, murmelte Dover mehr zu sich als zu jemand Bestimmtem. »Stahlrumpf, etwa fünfunddreißig Meter Länge. Stammt wahrscheinlich aus einer Schiffswerft in New Orleans.«
Der Funker lehnte sich aus der Funkkabine und winkte Dover. »Aus dem Register, Sir: Der Besitzer und Kapitän der Amie Marie ist Carl Keating. Heimathafen ist Kodiak.«
Wieder rief Dover das merkwürdig stille Krebsschiff an, diesmal nannte er Keatings Namen. Immer noch keine Antwort. Alle wurden allmählich so nervös wie ein Junge bei seinem ersten Rendezvous, der sich fragt, wie es weitergeht.
Die Catawaba fuhr langsam einen Kreis und drehte bei, dann brachte sie die Maschinen zum Stillstand und trieb längsseits.
Die Stahlbehälter für die Krebse waren ordentlich auf dem verlassenen Deck gestapelt, eine dünne Rauchfahne stieg aus dem Schornstein und wies darauf hin, dass die Dieselmotoren im Leerlauf liefen. Durch die Bullaugen oder die Fenster des Ruderhauses waren keine menschlichen Wesen zu entdecken.
Das Team, das an Bord der Amie Marie gehen sollte, bestand aus zwei Offizieren, Fähnrich Pat Murphy und Leutnant Marty Lawrence. Sie zogen ohne das übliche Geplauder ihre Schutzanzüge über, die sie vor dem kalten Wasser schützen würden, falls sie zufällig ins Meer fielen. Sie wussten kaum mehr genau, wie viele Routineuntersuchungen ausländischer Fischereifahrzeuge sie durchgeführt hatten, die sich in die 200-Meilen-Fischereizone vor Alaska verirrt hatten, aber dieser Fall gehörte nicht zur üblichen Routine. Keine Mannschaft aus Fleisch und Blut stand an der Reling, um sie zu begrüßen. Sie stiegen in ein kleines, von einem Außenbordmotor angetriebenes Gummi-Zodiacboot und legten ab.
Bis zum Einbruch der Dunkelheit waren es nur mehr ein paar Stunden. Der Regen war in ein Nieseln übergegangen, doch der Wind hatte sich verstärkt und somit auch der Seegang. Unheimliche Stille lag über der Catawaba. Keiner sprach; es war, als hätten sie Angst davor, zumindest bis der Bann aus dieser Ungewissheit gebrochen war.
Sie beobachteten Murphy und Lawrence, während sie ihr kleines Boot an dem Krebsfänger vertäuten, sich auf Deck schwangen und durch eine Tür in die Hauptkabine verschwanden.
Mehrere Minuten schleppten sich dahin. Gelegentlich erschien einer der Suchenden auf Deck, verschwand jedoch gleich wieder in eine Luke. Das einzige Geräusch im Ruderhaus der Catawaba kam von Störgeräuschen in dem offenen Radiolautsprecher des Schiffes, der auf maximale Lautstärke aufgedreht und auf Notfrequenz eingestellt war.
Plötzlich, und so unvermittelt, dass sogar Dover überrascht zusammenzuckte, hallte Murphys Stimme laut durch das Ruderhaus.
»Catawaba, hier spricht Amie Marie.«
»Kommen, Amie Marie«, antwortete Dover in sein Mikrofon.
»Sie sind alle tot.«
Die Worte klangen so kalt, dass zunächst niemand ihren Inhalt erfasste.
»Wiederholen Sie.«
»Nicht der leichteste Pulsschlag in einem von ihnen. Sogar die Schiffskatze hat es erwischt.«
Das Enterteam hatte ein Totenschiff vorgefunden. Kapitän Keatings Leiche lag auf dem Deck, sein Kopf lehnte an einem Schott unter dem Radio. Im ganzen Schiff, in der Kombüse, dem Speisesaal und den Schlafräumen lagen die Leichen der Besatzungsmitglieder der Amie Marie herum. Ihre verzerrten Gesichter schienen vor Schmerz erstarrt, und ihre Glieder waren in grotesken Stellungen verkrümmt, als hätten sie in den letzten Augenblicken ihres Lebens heftig um sich geschlagen. Ihre Haut hatte eine merkwürdige schwarze Farbe angenommen, und aus allen Körperöffnungen war Blut ausgetreten. Die siamesische Katze des Schiffes lag neben einer dicken Wolldecke, die sie in ihrem Todeskampf zerfetzt hatte.
Dovers Gesicht spiegelte bei Murphys Beschreibung eher Verwunderung als Schrecken wider. »Können Sie die Todesursache feststellen?«, fragte er.
»Ich kann nicht einmal eine einigermaßen vernünftige Vermutung äußern«, antwortete Murphy. »Kein Hinweis auf einen Kampf. KeineSpuren auf den Leichen, aber sie haben geblutet wie geschlachtete Schweine. Sieht aus, als wären sie alle zugleich von derselben Todesursache betroffen worden.«
»Warten Sie.«
Dover drehte sich um und musterte die Gesichter um ihn, bis er den Schiffsarzt, Korvettenkapitän Isaac Thayer, erblickte.
Thayer war der beliebteste Mann an Bord. Er war ein Oldtimer des Küstenwachdienstes und hatte vor langer Zeit die luxuriösen Ordinationen und das hohe Einkommen der Ärzte an Land zugunsten des manchmal harten und beschwerlichen, jedoch den Lohn in sich tragenden Seerettungsdienstes aufgegeben.
»Was halten Sie davon, Doc?«, fragte ihn Dover.
Thayer zuckte die Schultern und lächelte. »Sieht so aus, als sollte ich einen Hausbesuch machen.«
Dover marschierte ungeduldig auf der Brücke auf und ab, während Doc Thayer ein zweites Zodiac bestieg und über die Strecke zwischen den beiden Schiffen brauste. Dover befahl dem Rudergast, die Catawaba so in Position zu bringen, dass sie das Krebsschiff ins Schlepptau nehmen konnte. Er konzentrierte sich auf das Manöver und bemerkte nicht, dass der Funker neben ihm stand.
»Soeben ist eine Meldung eingelangt, Sir, von einem Piloten, der ein Team von Wissenschaftlern auf der Insel Augustin von der Luft aus mit Nachschub versorgt.«
»Nicht jetzt«, wehrte Dover brüsk ab.
»Es ist dringend, Kapitän«, beharrte der Funker.
»Okay, lesen Sie das Wichtigste vor.«
»›Wissenschaftlerteam alle tot.‹ Dann kam etwas Unverständliches und etwas, das klingt wie ›… rettet mich!‹«
Dover starrte ihn verständnislos an. »Ist das alles?«
»Ja, Sir. Ich habe versucht, das Flugzeug noch einmal zu rufen, aber ich bekam keine Antwort.«
Dover musste keine Karte zu Rate ziehen, um zu wissen, dass Augustin, eine unbewohnte, vulkanische Insel, nur 50 Kilometer nordöstlich von seiner derzeitigen Position lag. Plötzlich schoss ihm eine schreckliche Erkenntnis durch den Kopf. Er griff nach dem Mikrofon und schrie in das Mundstück: »Murphy! Sind Sie da?«
Nichts.
»Murphy! … Lawrence! … können Sie mich hören?«
Wieder keine Antwort.
Er blickte durch das Brückenfenster und sah Doc Thayer über die Reling der Amie Marie klettern. Für einen Mann mit einer so hünenhaften Gestalt konnte sich Dover äußerst schnell bewegen. Er nahm das Megafon und rannte hinaus.
»Doc! Kommen Sie zurück, verlassen Sie sofort dieses Schiff!«, dröhnte seine Stimme über das Wasser.
Seine Warnung kam zu spät. Thayer war schon in eine Luke gestiegen und verschwunden.
Die Männer auf der Brücke starrten mit verständnislosem Blick ihren Kapitän an. Seine Gesichtsmuskeln verkrampften sich, er stürzte verzweifelt ins Ruderhaus zurück und ergriff das Mikrofon.
»Doc, hier spricht Dover, können Sie mich hören?«
Zwei Minuten verstrichen, zwei endlose Minuten, während Dover versuchte, seine Leute auf der Amie Marie zu erreichen. Sogar auf das ohrenbetäubende Geheul der Sirene der Catawaba erfolgte keine Antwort.
Endlich kam Thayers Stimme mit merkwürdig eisiger Ruhe aus dem Lautsprecher auf der Brücke.
»Ich muss leider berichten, dass Fähnrich Murphy und Leutnant Lawrence tot sind. Ich kann kein Lebenszeichen an ihnen mehr entdecken. Was immer die Ursache ist, sie wird mich ebenfalls treffen, bevor ich entkommen kann. Sie müssen dieses Schiff unter Quarantäne stellen. Verstehen Sie mich, Amos?«
Dover wollte nicht wahrhaben, dass er plötzlich kurz davor war, seinen alten Freund zu verlieren. »Verstehe nicht, werde mich aber fügen.«
»Gut. Ich werde die Symptome in der Reihenfolge ihres Auftretens beschreiben. Mir wird schon schwindlig. Puls steigt auf hundertfünfzig. Könnte mir die Ursache durch Hautabsorption zugezogen haben. Puls hundertsiebzig.«
Thayer machte eine Pause. Seine nächsten Worte kamen stockend.
»Zunehmende Übelkeit. Beine … können nicht mehr … tragen. Heftiges Brennen … in der Sinusgegend. Innere Organe fühlen sich an, als würden sie explodieren.«
Alle auf der Brücke der Catawaba beugten sich mit einem Mal näher zu dem Lautsprecher, denn sie wollten nicht verstehen, dass ein Mann, den sie alle kannten und verehrten, in geringer Entfernung von ihnen starb.
»Puls … über zweihundert. Schmerz … unerträglich. Schwärze engt Sehkraft ein.« Deutlich hörbares Stöhnen folgte. »Sagen … sagen Sie meiner Frau …«
Der Lautsprecher verstummte.
Man konnte den Schrecken geradezu spüren, ihn von den weit aufgerissenen Augen der Besatzung ablesen, als sie das Entsetzen erfasste.
Dover starrte stumpf zu dem Grab, das Amie Marie hieß, und presste seine Hände in Hilflosigkeit und Verzweiflung zusammen.
»Was geht dort drüben vor sich?«, murmelte er tonlos. »Was in Gottes Namen tötet dort alle?«
2
»Ich sage nur, hängt den Bastard!«
»Gib acht, was du vor den Mädchen sagst, Oscar.«
»Die haben schon Schlimmeres gehört. Es ist der helle Wahnsinn! Der Dreckskerl ermordet vier Kinder, und ein idiotischer Richter verwirft den Fall, weil der Angeklagte zu high durch Drogen war, um seine Rechte wahrnehmen zu können. Mein Gott, soll man das glauben?«
Carolyn Lucas schenkte ihrem Mann die erste Tasse Kaffee an diesem Tag ein und brachte ihre zwei kleinen Töchter schnell zur Haltestelle des Schulbusses. Er drohte dem Fernseher mit der Faust, als wäre es die Schuld des Moderators, der die Nachricht durchgegeben hatte, dass der Mörder frei herumlief.
Oscar Lucas hatte eine Art, mit den Händen zu reden, die eine gewisse Ähnlichkeit mit der Zeichensprache für Schwerhörige aufwies. Er saß mit vorgebeugten Schultern am Frühstückstisch, sodass man dem schlanken Mann seine ein Meter achtzig nicht ansah. Sein Kopf war bis auf ein paar graue Strähnen um die Schläfen kahl wie eine Billardkugel, und buschige Brauen zogen sich über seine dunkelbraunen Augen. Er hatte in Washington nie zu den Männern in blauen Nadelstreifenanzügen gehört, sondern trug Sporthose und -jacke.
Er war Anfang vierzig, und man hätte ihn eher für einen Dentisten oder Buchhalter als für einen Geheimagenten gehalten, der die Abteilung des Secret Service zum Schutz des Präsidenten leitete. Während seiner zwanzigjährigen Dienstzeit als Agent hatte er viele Menschen dadurch getäuscht, dass er aussah wie der gute Nachbar von nebenan, von den Präsidenten, deren Leben er schützte, bis zu den potentiellen Mördern, die er abgeblockt hatte, bevor sie Gelegenheit fanden, in Aktion zu treten. Bei der Arbeit wirkte er konzentriert und ernst, doch zu Hause war er für gewöhnlich voller Übermut und Humor, ausgenommen, wenn er durch die Acht-Uhr-Nachrichten am Morgen verärgert wurde.
Lucas trank einen letzten Schluck Kaffee und stand auf. Er hielt seine Jacke auf – er war Linkshänder – und zog das Hüfthalfter zurecht, das einen S & W 357 Magnum Revolver, Modell 19, mit einem Lauf von 2 1/2 Zoll enthielt. Die Einheitswaffe war ihm von der Dienststelle zur Verfügung gestellt worden, als seine Ausbildung beendet war und er im Außendienst in Denver als Anfänger Erhebungen über Falschmünzer und Banknotenfälscher anstellte. Er hatte ihn während seiner Dienstzeit nur zweimal gezogen und hatte noch nie außerhalb des Schießstandes auf den Abzug gedrückt.
Carolyn räumte die Geschirrspülmaschine aus, als er hinter sie trat, die blonde Haarmähne beiseiteschob und ihr einen Kuss auf den Nacken drückte.
»Ich verschwinde jetzt.«
»Vergiss nicht, heute Abend ist die Pool-Party bei den Hardings gegenüber.«
»Ich müsste eigentlich rechtzeitig zu Hause sein. Heute ist nicht vorgesehen, dass der Boss das Weiße Haus verlässt.«
Sie blickte ihn lächelnd an. »Du sorgst dafür, dass er es nicht tut.«
»Ich werde den Präsidenten sofort davon informieren, dass meine Frau es ungern sieht, wenn ich Überstunden mache.«
Sie lachte und lehnte kurz den Kopf an seine Schulter. »Sechs Uhr.«
»Wie du willst«, sagte er gespielt missmutig und verschwand durch die Hintertür.
Lucas stieß mit seinem Leasing-Dienstwagen, einer eleganten Buick-Limousine, zurück auf die Straße und fuhr ins Stadtzentrum. Bevor er das Ende des Blocks erreichte, rief er über sein Autofunkgerät die Zentrale des Geheimdienstes an.
»Crown, hier spricht Lucas. Ich bin unterwegs zum Weißen Haus.«
»Gute Fahrt«, antwortete eine metallisch klingende Stimme.
Er begann schon zu schwitzen und schaltete die Klimaanlage ein. Die Sommerhitze in der Landeshauptstadt schien nie nachzulassen. Die Feuchtigkeit betrug über neunzig Prozent, und die Fahnen an der Reihe von Gesandtschaften auf der Massachusetts-Avenue hingen schlaff und schwunglos in der stickigen Luft.
Er fuhr langsamer, blieb bei der Checkpointsperre auf der West-Executive-Avenue stehen und wartete ein wenig, bis ein uniformierter Wachtposten des Service ihm zunickte und ihn durchließ. Lucas stellte den Wagen ab und betrat durch den nächstliegenden Eingang das Untergeschoss des Weißen Hauses.
Bei dem Secret-Service-Kommandoposten, Codename W-16, blieb er stehen und plauderte mit den Männern, die eine Menge elektronischer Kommunikationsgeräte überwachten. Dann ging er über die Treppe in sein Büro im ersten Stockwerk des Ostflügels.
Jeden Morgen nachdem er hinter seinem Schreibtisch Platz genommen hatte, überprüfte er zunächst den Stundenplan des Präsidenten sowie die Vorschläge der Agenten, die mit der Planung der Sicherheitsmaßnahmen betraut waren.
Lucas studierte die Mappe, in der die voraussichtlichen »Bewegungen« des Präsidenten verzeichnet waren, zum zweiten Mal, und auf seinem Gesicht spiegelte sich wachsende Bestürzung. Unerwartet war ein wesentlicher Programmpunkt hinzugekommen. Er warf die Mappe ärgerlich auf den Tisch, drehte sich in seinem Drehstuhl herum und starrte auf die Wand.
Die meisten Präsidenten waren Gewohnheitsmenschen, und so hatten sie knapp bemessene Stundenpläne, die sie strikt einhielten. Nach Nixons Kommen und Gehen hätte man seine Uhr stellen können und auch Carter und Reagan wichen selten von den festgelegten Plänen ab. Nicht so der neue Mann in dem ovalen Büro. Er empfand die Abteilung als lästig und war, was noch schlimmer war, verdammt unberechenbar.
Lucas und seine Untergebenen versuchten rund um die Uhr, »ihrem Mann« immer um einen Schritt voraus zu sein, zu erraten, wann und wohin er plötzlich verschwinden und welche Besucher er einladen würde, ohne ihnen Zeit für entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu lassen. Es war ein Spiel, bei dem Lucas häufig verlor.
Kaum eineMinute später war er die Treppe hinuntergelaufen und stand im Westflügel dem zweitmächtigsten Mann unter den leitenden Angestellten gegenüber, dem Chef des Mitarbeiterstabes, Daniel Fawcett.
»Guten Morgen, Oscar.« Fawcett lächelte freundlich. »Ich habe mir schon gedacht, dass du um diese Zeit hereinstürmen wirst.«
»Im Stundenplan ist ein neuer Ausflug vorgesehen.« Lucas’ Ton war sachlich.
»Das tut mir leid. Aber eine wichtige Abstimmung über die Finanzhilfe für die Ostblockländer steht bevor, und der Präsident will Senator Larimer und den Sprecher des Repräsentantenhauses, Moran, mit seinem Charme dazu bringen, dass siesein Programm unterstützen.«
»Deshalb lädt er sie zu einer Bootsfahrt ein.«
»Warum auch nicht? Seit Herbert Hoover benützt jeder Präsident die Präsidentenjacht für Besprechungen auf höchster Ebene.«
»Ich habe nichts gegen den Grund«, antwortete Lucas entschieden. »Ich protestiere lediglich gegen die zeitliche Abstimmung.«
Fawcett sah ihn arglos an. »Was passt dir am Freitagabend nicht?«
»Das weißt du verdammt gut. Bis dahin sind es nur noch zwei Tage.«
»Na und?«
»Für eine Kreuzfahrt den Potomac hinunter mit einer Übernachtung in Mount Vernon benötigt meine Vorausabteilung fünf Tage, um die Sicherheitsmaßnahmen festzulegen. An Land muss ein komplettes Kommunikations- und Alarmsystem eingerichtet werden. Die Jacht muss auf Sprengkörper und Abhörgeräte untersucht, die Ufer müssen abgesucht werden und die Küstenwache braucht einen Vorsprung, um einen Kutter als Begleitfahrzeug auf dem Fluss bereitzustellen. In zwei Tagen können wir keine ordentliche Arbeit leisten.«
»Glaubst du nicht, dass du aus einer Mücke einen Elefanten machst, Oscar? Morde ereignen sich auf überfüllten Straßen oder in Theatern. Wer hat je von einem Staatsoberhaupt gehört, das auf einem Schiff überfallen wurde?«
»Es kann überall und jederzeit geschehen«, widersprach Lucas. »Hast du den Burschen vergessen, den wir unschädlich machten, als er versuchte, ein Flugzeug zu entführen, mit dem er das Flugzeug des Präsidenten rammen wollte? Tatsache ist, dass die meisten Attentate dann stattfinden, wenn der Präsident sich außerhalb seiner üblichen Aufenthaltsorte befindet.«
»Der Präsident besteht auf dem Datum.« Auch Fawcett konnte sachlich sein. »Solange du für den Präsidenten arbeitest, hast du zu tun, was dir befohlen wird, genauso wie ich. Und wenn er allein in einem Schlauchboot nach Miami rudern will, ist das seine Angelegenheit.«
Fawcett hatte offenbar den falschen Ton angeschlagen. Lucas’ Gesichtsausdruck verhärtete sich, und er ging auf den Leiter des Mitarbeiterstabes des Weißen Hauses so weit zu, bis er dicht vor ihm stand.
»Wir wollen gleich einmal eines festhalten: Laut Verfügung des Kongresses arbeite ich nicht für den Präsidenten, sondern für das Schatzamt. Er kann mir also nicht befehlen, ich soll abhauen und tun, was er will. Es ist meine Pflicht, ihm den bestmöglichen Schutz zu bieten und sein Privatleben dabei so wenig wie möglich zu stören. Sobald er den Fahrstuhl zu seiner Wohnung betritt, bleiben meine Leute und ich unten. Aber von dem Moment an, in dem er im Erdgeschoss aussteigt, bis er wieder nach oben fährt, gehört sein Hintern dem Geheimdienst.«
Fawcett war über die Persönlichkeit der Leute, die um den Präsidenten arbeiteten, im Bild. Er wusste, dass er bei Lucas zu weit gegangen war, und war klug genug, den Streit nicht weiterzuführen. Er wusste, dass Lucas fanatisch an seiner Aufgabe hing und dem Mann in dem ovalen Büro fraglos loyal ergeben war. Aber sie konnten nie enge Freunde werden; vielleicht Berufskollegen, zurückhaltend, aber wachsam. Da sie nicht um die Macht als Rivalen kämpften, würden sie zumindest nie zu Feinden werden.
»Kein Grund zur Aufregung, Oscar. Ich nehme den Verweis zur Kenntnis. Ich werde den Präsidenten über deine Bedenken unterrichten. Aber ich bezweifle, dass er essich anders überlegen wird.«
Lucas seufzte. »Wir werden unser Bestes tun. Aber man muss ihm einmal klarmachen, dass er mit seinen Sicherheitsbeamten unbedingt zusammenarbeiten muss.«
»Was soll ich dazu sagen? Du weißt besser als ich, dass sich alle Politiker für unsterblich halten. Für sie ist Macht mehr als ein Aphrodisiakum, sie ist eine Kombination von Drogenrausch und Alkoholnebel. Nichts versetzt sie so in Entzücken wie ein Haufen Leute, der ihnen zujubelt und ihnen die Hand schütteln will. Deshalb sind sie alle vor einemMörder ungeschützt, der zur rechten Zeit am richtigen Ort steht.«
»Das brauchst du mir nicht zu erzählen, ich habe bei vier Präsidenten Babysitter gespielt.«
»Und du hast keinen einzigen verloren.«
»Zweimal war ich bei Ford nahe daran, einmal bei Reagan.«
»Du kannst Verhaltensmuster nicht genau vorausberechnen.«
»Das vielleicht nicht. Aber nach all diesen Jahren entwickelt man eine Art sechsten Sinn. Deshalb gefällt mir diese Bootsfahrt ganz und gar nicht.«
Fawcett wurde förmlich. »Du glaubst, dass jemand darauf aus ist, ihn zu töten?«
»Immer ist jemand darauf aus, ihn zu töten. Wir stellen täglich Ermittlungen über 20 potentielle Verrückte an und halten Aufzeichnungen über 2000 Personen auf dem Laufenden, die unserer Meinung nach gefährlich oder zu einem Mord fähig sind.«
Fawcett legte Lucas die Hand auf die Schulter. »Mach dir keine Sorgen, Oscar, der Freitagausflug wird erst in allerletzter Minute der Presse bekanntgegeben. Das verspreche ich dir.«
»Dafür bin ich dir dankbar, Dan.«
»Außerdem, was kann schon draußen auf dem Potomac passieren?«
»Vielleicht nichts. Vielleicht etwas Unerwartetes. Und das Unerwartete verursacht mir Albträume.«
Megan Blair, die Sekretärin des Präsidenten, sah aus dem Augenwinkel Dan Fawcett in der Tür ihres kleinen Büros stehen und nickte ihm über die Schreibmaschine hinweg zu. »Hi, Dan. Ich habe dich nicht kommen sehen.«
»In was für einer Stimmung ist der Chef heute Morgen?«, fragte er; er informierte sich jeden Tag erst mal über die Lage, bevor er das ovale Büro betrat.
»Müde«, antwortete sie. »Der Empfang zu Ehren der Filmindustrie dauerte bis nach ein Uhr morgens.«
Megan war eine gut aussehende Frau Anfang der Vierziger. Sie zeigte ein strahlendes offenes Lächeln, trug ihr schwarzes Haar kurz geschnitten und hatte etwa zehn Pfund Untergewicht. Sie war ein Dynamo und liebte ihre Arbeit und ihren Chef mehr als alles auf der Welt. Sie kam früh, ging spät und arbeitete auch an den Wochenenden. Sie war unverheiratet und hatte nur zwei flüchtige Affären hinter sich, denn sie zog die Arbeit und das unabhängige Leben als alleinstehende Frau vor. Fawcett bewunderte sie immer, weil sie sich zugleich unterhalten und maschineschreiben konnte.
»Ich werde vorsichtig zu Werke gehen und seine Verabredungen auf ein Minimum beschränken, damit er sich Zeit lassen kann.«
»Du kommst zu spät. Er befindet sich schon in einer Besprechung mit Admiral Sandecker.«
»Mit wem?«
»Admiral James Sandecker, Leiter der Nationalen Unterwasser- und Marinebehörde.«
Ein ärgerlicher Ausdruck flog über Fawcetts Gesicht. Er nahm seine Rolle als Hüter der Zeiteinteilung des Präsidenten ernst und verübelte jeden Übergriff in seinen Aufgabenbereich. Alles, was er nicht genehmigt hatte oder was nicht auf dem Stundenplan stand, bedrohte seine Macht. Wie zum Teufel war es Sandecker gelungen, ihn zu umgehen?
Megan erriet seine Gedanken. »Der Präsident hat den Admiral holen lassen«, erklärte sie. »Er erwartet, dass auch du bei der Besprechung anwesend bist.«
Fawcett nickte etwas besänftigt und betrat das ovale Büro. Der Präsident saß auf dem Sofa und studierte mehrere auf dem großen Kaffeetisch ausgebreitete Papiere. Ein kleiner, magerer Mann mit rotem Haar und dazu passendem Van Dyke-Bart saß ihm gegenüber.
Der Präsident blickte auf. »Ich bin froh, dass Sie hier sind, Dan. Sie kennen Admiral Sandecker?«
»Ja.«
Sandecker erhob sich und gab ihm die Hand. Der Händedruck des Admirals war fest und kurz. Er nickte Fawcett zu und nahm seine Anwesenheit zur Kenntnis. Es war keine Unhöflichkeit von Seiten Sandeckers, aber er war ein Mann, der keine Zeit für gesellschaftliche Spielregeln im politischen Wettstreit hatte. In Washington wurde er gehasst und beneidet, aber auch allgemein geachtet, weil er nie Partei ergriff und immer in die Tat umsetzte, was von ihm verlangt wurde.
Der Präsident deutete auf das Sofa und klopfte auf ein Kissen neben sich. »Setzen Sie sich, Dan. Ich habe den Admiral ersucht, mich über eine Krise zu informieren, zu der es in den Gewässern vor Alaska gekommen ist.«
»Ich habe nichts davon gehört.«
»Das wundert mich nicht«, sagte der Präsident. »Der Bericht gelangte erst vor einer Stunde in meine Hände.« Er legte eine Pause ein und zeigte mit der Bleistiftspitze auf ein mit einem roten Kreis markiertes Gebiet auf einer großen Seekarte. »Hier, 300 Kilometer südwestlich von Anchorage im Gebiet der Cook Meerenge, tötet ein nicht identifiziertes Gift alles, was sich im Meer befindet.«
»Es klingt, als würden Sie von einem Ölteppich sprechen.«
»Viel schlimmer«, antwortete Sandecker und lehnte sich zurück. »Was hier vorliegt, ist ein unbekannter Wirkstoff, der Menschen und Meereslebewesen innerhalb von nicht einmal einer Minute nach dem Kontakt tötet.«
»Wie ist das möglich?«
»Die meisten Giftstoffe gelangen durch Schlucken oder Einatmen in den menschlichen Körper«, erklärte Sandecker. »Der Stoff, mit dem wir es zu tun haben, tötet durch Hautkontakt.«
»Er muss in einem kleinen Gebiet in höchster Konzentration vorhanden sein, um so stark zu wirken.«
»Wenn Sie zweieinhalbtausend Quadratkilometer offenes Meer kleinnennen …«
Der Präsident machte ein verwundertes Gesicht. »Ich kann mir keinechemische Substanz von so schrecklicher Wirksamkeit vorstellen.«
Fawcett sah den Admiral an. »Welche einzelnen Vorfälle haben sich ereignet?«
»Ein Kutter der Küstenwache fand ein Fischerboot aus Kodiak, das mit seiner toten Besatzung auf dem Wasser trieb. Zwei Marineoffiziere und ein Arzt wurden an Bord geschickt und starben gleichfalls. Ein Team von Geophysikern auf einer fünfzig Kilometer entfernten Insel wurde von einem Piloten, der einen Versorgungsflug durchführte, tot aufgefunden. Er selbst starb, während er ein Notsignal aussandte. Wenige Stunden später berichtete ein japanischer Fischtrawler, dass er einen Schwarm von nahezu hundert Grauwalen gesehen hatte, die plötzlich mit dem Bauch nach oben dahintrieben. Der Trawler verschwand dann, und man fand keine Spur mehr von ihm. Krebsbänke, Seehundkolonien wurden ausgerottet. Das ist erst der Anfang. Es gibt vielleicht noch viele weitere Todesfälle, von denen wir nur noch nichts erfahren haben.«
»Was ist im schlimmsten Fall zu erwarten, wenn die Ausbreitung ungehemmt fortschreitet?«
»Praktisch die Ausrottung der gesamten Meeresfauna im Golf von Alaska. Und wenn das Gift in den Japanischen Meeresstrom gelangt und nach Süden getragen wird, wäre es in der Lage, entlang der Westküste bis nach Mexiko alle Menschen, Fische, Tiere und Vögel zu vergiften, mit denen es in Berührung kommt. Ich kann mir vorstellen, dass der Verlust an Menschenleben in die Hunderttausende gehen könnte. Fischer, Schwimmer, jeder, der sich an der Küstenlinie bewegt, jeder, der einen vergifteten Fisch isst – es breitet sich aus wie eine Epidemie. Ich will gar nicht daran denken, was geschehen könnte, wenn es verdunstet, in die Atmosphäre aufsteigt und von dort in Form von Regen auf die Bundesstaaten im Landesinneren niederfällt.«
Es war Fawcett beinahe unmöglich, die Ungeheuerlichkeit des Ganzen zu erfassen. »Um Himmels willen, worum zum Teufel handelt es sich?«
»Für definitive Aussagen ist es noch zu früh«, antwortete Sandecker. »Das Amt für Umweltschutz verfügt über ein computerisiertes Datenspeicher- und Abrufsystem, das detaillierte Informationen über 200 wesentliche Charakteristika von etwa 1100 chemischen Verbindungen enthält. Sie können innerhalb von wenigen Sekunden die Wirkungen bestimmen, die eine gefährliche Substanz im Falle ihrer Verbreitung hervorrufen kann, ihren handelsüblichen Namen, ihre chemische Formel, die hauptsächlichen Hersteller, Transportart und Bedrohung für die Umwelt. Die Verseuchung in Alaska passt jedoch zu keiner der Daten in ihren Computeraufzeichnungen.«
»Sie müssen doch irgendeine Ahnung haben?«
»Nein, Sir. Es gibt nur einen schwachen Anhaltspunkt, aber ohne Autopsieergebnisse ist er reine Spekulation.«
»Ich möchte ihn dennoch wissen«, sagte der Präsident.
Sandecker holte tief Atem. »Die drei gefährlichsten Giftstoffe, die wir kennen, sind Plutonium, Dioxin und die chemischen Kampfstoffe. Die beiden ersten passen nicht in das Schema. Das dritte ist, zumindest meiner Ansicht nach, am verdächtigsten.«
Der Präsident starrte Sandecker an, als auf seinem Gesicht Begreifen und Entsetzen einander abwechselten. »Nervengas?«, fragte er langsam.
Sandecker nickte schweigend.
»Deshalb konnte das Amt für Umweltschutz nichts damit anfangen«, stellte der Präsident fest. »Die Formel ist streng geheim.«
Fawcett wandte sich an den Präsidenten. »Ich bin leider nicht damit vertraut …«
»Nervengas S war ein teuflisches Präparat, das die Wissenschaftler im Rocky Mountain Arsenal vor etwa zwanzig Jahren entwickelt haben. Ich habe den Bericht über die Tests gelesen. Es tötete innerhalb weniger Sekunden nach einem Hautkontakt. Es schien die ideale Kampfmethode gegen einen Feind zu sein, der Gasmasken und Schutzkleidung trug, denn es haftete an allem, was damit in Berührung kam. Aber es war zu flüchtig und dadurch genauso gefährlich für die eigenen Truppen, die es absprühten, wie für den Gegner. Die Armee gab deshalb den Gedanken an einen Einsatz auf und begrub es in der Wüste Nevadas.«
»Ich kann keinen Zusammenhang zwischen Nevada und Alaska erkennen«, sagte Fawcett.
»Während des Eisenbahntransportes von dem Arsenal bei Denver«, informierte ihn Sandecker, »verschwand ein Waggon, der nahezu viertausend Liter Nervengas S enthielt. Er wurde bis heute nicht gefunden, und man weiß nichts über seinen Verbleib.«
»Wenn essich bei dem ins Meer gelangten Giftstoff tatsächlich um dieses Nervengas handelt, wie kann man es, sobald es gefunden ist, neutralisieren?«
Sandecker zuckte mit den Schultern. »Leider erlaubt der derzeitige Stand der Wissenschaft in der Eindämmungs- und Neutralisierungstechnologie aufgrund der physikalisch-chemischen Charakteristika von Nervengas S nur sehr wenige Möglichkeiten, etwas dagegen zu unternehmen, wenn es erst einmal im Wasser aufgelöst ist. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, die Quelle zu verstopfen, bevor sie genügend Gift abgibt, um den Ozean in eine Kloake ohne organisches Leben zu verwandeln.«
»Gibt es einen Hinweis, woher es stammen könnte?«, fragte der Präsident.
»Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um ein zwischen der Insel Kodiak und dem Festland von Alaska gesunkenes Schiff«, antwortete Sandecker. »Unser nächster Schritt muss darin bestehen, das Ausströmen zurückzuverfolgen und ein Koordinatennetz zu ermitteln.«
Der Präsident beugte sich über den Kaffeetisch und betrachtete den roten Kreis auf der Seekarte. Dann schaute er Sandecker mit festem, würdigendem Blick an. »Als Leiter des NUMA haben Sie die undankbare Aufgabe, Admiral, diesen Stoff zu neutralisieren. Ich erteile Ihnen Vollmacht, jede Regierungsstelle oder -abteilung, die über die erforderliche Sachkenntnis verfügt, einzuspannen, den Nationalen Wissenschaftsrat, die Armee, die Küstenwache, den Umweltschutz, wen immer.« Er dachte eine Weile nach, dann fragte er: »Wie wirkungsvoll ist im Meerwasser aufgelöstes Nervengas S?«
Sandecker sah müde aus, seine Gesichtszüge wirkten angespannt. »Ein Teelöffel voll tötet jeden lebenden Organismus in zwanzig Millionen Litern Seewasser.«
»Dann sollten wir es besser finden«,erklärte der Präsident mit einem Anflug von Verzweiflung in der Stimme. »Und verdammt rasch!«
3
Tief unten im trüben Wasser des James River, vor der Küste von Newport News in Virginia, kämpften zwei Taucher gegen die Strömung an, während sie sich einen Weg durch den Schlamm bahnten, der am verrottenden Rumpf eines Wracks klebte.
In der schwarzen, dimensionslosen Flüssigkeit hatte man kein Gefühl für Richtung. Die Sicht betrug nur wenige Zentimeter, während sie sich verbissen am Rohr einer Absaugvorrichtung festhielten, die den dicken Schlamm hinaufbeförderte und ihn zwanzig Meter weiter oben im Sonnenschein auf einen Schleppkahn spuckte. Sie arbeiteten beinahe im völligen Dunkel, denn ihre einzige Lichtquelle waren die schwachflimmernden Unterwasserlampen, die am Rand des Kraters befestigt waren, den sie in den letzten Tagen langsam ausgehöhlt hatten. Das Einzige, was sie erkennen konnten, waren im Wasser schwebende Teilchen, die an den Sichtgläsern ihrer Tauchermasken vorbeitrieben wie windgepeitschter Regen.
In dieser Lage konnten sie kaum glauben, dass es oben eine Welt mit Himmel und Wolken und Bäumen gab, die sich in der Sommerbrise wiegten. In dem Albtraum aus aufgewirbeltem Schlamm und ständiger Dunkelheit schien es ihnen unwahrscheinlich, dass sich in kaum fünfhundert Meter Entfernung Menschen und Autos auf den Gehsteigen und Straßen der kleinen Stadt bewegten.
Es gibt Leute, die behaupten, dass man unter Wasser nicht schwitzen kann, aber man kann. Die Taucher fühlten, wie ihnen der Schweiß trotz der eng anliegenden Taucheranzüge aus den Poren drang; sie begannen eine schleichende Müdigkeit zu spüren, obwohl sie sich erst seit acht Minuten auf dem Grund befanden.
Zoll um Zoll arbeiteten sie sich in ein gähnendes Loch an der Steuerbordseite des Rumpfes vor. Die Planken, die die höhlenartige Öffnung umgaben, waren zertrümmert und verbogen, als hätte eine Riesenfaust sich in das Schiff gerammt. Sie begannen Gebrauchsgegenstände freizulegen: einen Schuh, das Scharnier einer alten Truhe, einen Messingzirkel, Werkzeug, sogar ein Stück Stoff. Es war ein unheimliches Gefühl, Gegenstände zu berühren, die seit 120 Jahren niemand mehr zu Gesicht bekommen hatte.
Einer der Männer machte eine Pause, um die Luftanzeige zu kontrollieren. Er rechnete sich aus, dass sie noch weitere zehn Minuten arbeiten konnten und dann noch immer einen ausreichenden Vorrat an Atemluft hatten, um die Oberfläche zu erreichen.
Sie drehten das Ventil der Absaugvorrichtung zu, sodass der Sog abgestellt wurde, und warteten darauf, dass die Strömung des Flusses die aufgewirbelte Schlammwolke wegschwemmte. Bis auf das Blubbern der verbrauchten Atemluft wurde es still. Ein weiterer Teil des Wracks wurde sichtbar. Die Deckbalken waren geborsten und nach innen gedrückt. Seilschlingen hingen in dem trüben Wasser wie schlammverkrustete Schlangen. Das Innere des Rumpfes sah düster und unheildrohend aus. Sie konnten fast die ruhelosen Gespenster der Männer spüren, die mit dem Schiff untergegangen waren.
Plötzlich hörten sie ein seltsames Brummen; nicht das Geräusch, das der Außenbordmotor eines kleinen Bootes verursacht, sondern stärker, wie das entfernte Dröhnen eines Flugzeugmotors. Es war unmöglich, die Richtung festzustellen, aus der das Geräusch kam. Sie lauschten einige Augenblicke, während das Brummen lauter wurde, verstärkt durch die bessere Leitfähigkeit des Schalls im Meer. Es war ein Geräusch an der Oberfläche, das sie nicht betraf, also schalteten sie die Absaugvorrichtung wieder ein und kehrten an ihre Arbeit zurück.
Kaum eine Minute später stieß das Ende des Saugrohres auf etwas Hartes. Sie drehten das Luftventil rasch wieder zu und schoben aufgeregt den Schlamm mit den Händen weg. Bald erkannten sie, dass sie nicht Holz, sondern einen härteren, viel widerstandsfähigeren, mit Rost überzogenen Gegenstand berührten.
Die Hilfsmannschaft auf der Barkasse über dem Wrack glaubte ihren Augen nicht trauen zu dürfen. Sie sahen gebannt zu, wie ein altes, von Westen kommendes PBY Catalina-Flugboot eine Schleife zog, auf den Fluss einschwenkte und auf dem Wasser aufsetzte. Die Sonne glänzte auf dem aquamarinblauen Anstrich des Aluminiumrumpfes, und die Buchstaben NUMA wurden größer, während das schwerfällige Wasserflugzeug auf die Barkasse zuhielt. Man stellte die Motoren ab; der Kopilot lehnte sich aus einer Seitenluke und warf einem der Männer auf der Barkasse ein Haltetau zu.
Dann erschien eine Frau und sprang leichtfüßig auf das abgescheuerte Holzdeck. Sie war schlank, und ihren ebenmäßigen Körper bedeckte ein braunes, loses, kurzes Hemdkleid, das über der Hüfte von einem Gürtel zusammengehalten wurde. Darunter trug sie eine unten enger werdende Hose aus grüner Baumwolle und an den Füßen mokassinartige Kantenschuhe. Sie mochte Mitte vierzig sein, etwa einssiebzig groß, ihr Haar schimmerte in der Farbe von Espengold, und ihre Haut war kupferbraun von der Sonne gebrannt. Ihr Gesicht mit den hohen Backenknochen war von der Schönheit, die eine Klasse für sich allein darstellte.
Sie ging zwischen einem Gewirr von Kabeln und Bergungsgeräten hindurch und blieb stehen, als sie sich von den Männern und deren faszinierenden Blicken umringt sah. Sie schob ihre Sonnenbrille hoch und starrte zurück.
»Wer von Ihnen ist Dirk Pitt?«, fragte sie.
Ein kräftiger Kerl, kleiner als sie, aber mit Schultern, die doppelt so breit waren wie seine Taille, trat vor und zeigte in den Fluss.
»Sie werden ihn dort unten finden, Lady.«
Sie drehte sich um, und ihr Blick folgte dem ausgestreckten Finger. In der leicht gekräuselten Strömung schwankte eine große orangefarbene Boje, deren Kabel in der schmutzig grünen Tiefe verschwand. Etwa zehn Meter dahinter sah sie die Luftblasen des Tauchers auf der Wasserfläche zerplatzen.
»Wie lange dauert es, bis er wieder auftaucht?«
»Noch fünf Minuten.«
»Na gut.« Sie überlegte für einen Augenblick. Dann fragte sie: »Ist Albert Giordino bei ihm?«
»Er steht hier vor Ihnen, und Sie sprechen mit ihm.«
Giordino trug nur schäbige Segeltuchschuhe, abgeschnittene Jeans und ein zerrissenes T-Shirt, während sein schwarzes, lockiges, zerrauftes Haar und sein zwei Wochen alter Bart zu seiner nachlässigen Kleidung passten. Er entsprach entschieden nicht ihrer Vorstellung von NUMAs stellvertretendem Direktor für Spezialprojekte.
Sie schien mehr belustigt als überrascht. »Ich heiße Julie Mendoza und bin von der Umweltschutzbehörde. Ich muss einedringende Angelegenheit mit Ihnen beiden besprechen, aber vielleicht sollte ich warten, bis Mr. Pitt auftaucht.«
Giordino zuckte mit den Schultern. »Wie Sie meinen.« Er lächelte freundlich. »Wir können Ihnen nicht vielan persönlichem Komfort bieten, aber ich habe schön kaltes Bier auf Lager.«
»Ich nehme gern eines, danke.«
Giordino nahm eine Dose Coors aus einem Eimer mit Eis und reichte sie ihr. »Wozu fliegt ein Umweltschutz-Mann … äh … eine Frau in einem NUMA-Flugzeug in der Gegend herum?«
»Eine Idee von Admiral Sandecker.«
Mehr sagte Mendoza nicht, also drängte Giordino sie auch nicht.
»An welchem Projekt arbeiten Sie?«, fragte Mendoza.
»Die Cumberland.«
»Ein Schiff aus dem Bürgerkrieg, nicht wahr?«
»Ja, historisch sehr wichtig. Sie war eine Fregatte der Union, die 1862 durch das konföderierte Panzerschiff Merrimack – oder Virginia, unter welchem Namen sie im Süden bekannt war – versenkt wurde.«
»Soweit ich mich erinnere, ging sie unter, bevor die Merrimack gegen die Monitor kämpfte; dadurch wurde siezum ersten Schiff, das von einem Panzerschiff vernichtet wurde.«
»Sie sind in der Geschichte ganz schön beschlagen.« Giordino war beeindruckt.
»Und die NUMA wird sie heben?«
Giordino schüttelte den Kopf. »Zu kostspielig. Wir wollen nur den Rammsporn.«
»Rammsporn?«
»Es war eine höllische Schlacht«, erklärte Giordino. »Die Mannschaft der Cumberland kämpfte, bis Wasser in ihre Kanonenrohre drang, obwohl ihre Kanonenkugeln von der Panzerung des Konföderiertenschiffes abprallten wie Golfbälle von einem Förderwagen. Schließlich rammte die Merrimack die Cumberland, und sie ging mit fliegenden Fahnen unter. Aber beim Zurücksetzen brach der riesige, keilförmige Rammsporn am Bug des Panzerschiffes, der in die Fregatte eingedrungen war, ab. Diesen Rammsporn suchen wir.«
»Hat so ein altes Stück Eisen überhaupt einen Wert?«





























