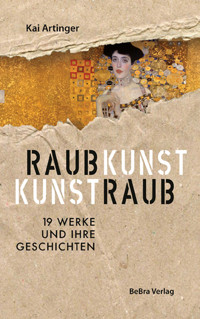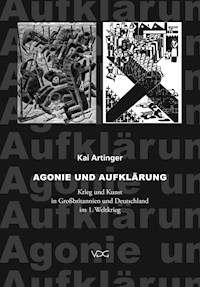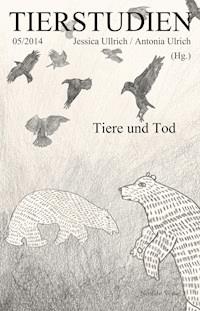
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neofelis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tierstudien
- Sprache: Deutsch
Tierstudien 05/2014
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tierstudien 05/2014
Tiere und Tod
Tierstudien
05/2014
Tiere und Tod
Herausgegeben von Jessica Ullrich und Antonia Ulrich
Neofelis Verlag
Tierstudien
05/2014: Tiere und Tod
Hrsg. v. Jessica Ullrich / Antonia Ulrich
Wissenschaftlicher Beirat
Petra Lange-Berndt (London), Roland Borgards (Würzburg), Dorothee Brantz (Berlin), Thomas Macho (Berlin), Sabine Nessel (Berlin), Martin Ullrich (Nürnberg), Markus Wild (Basel).
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2014 Neofelis Verlag UG (haftungsbeschränkt), Berlin
www.neofelis-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Marija Skara
E-Book-Format: epub, Version 2.0
ISSN: 2193-8504
ISBN: 978-3-943414-36-3
Erscheinungsweise: zweimal jährlich
Jahresabonnement 18 €, Einzelheft 11 €
Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder direkt beim Neofelis Verlag unter:
Ein Abonnement verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn die Kündigung nicht mindestens drei Monate vor Ende des Kalenderjahrs erfolgt ist.
Inhalt
Editorial
Methoden im Umgang mit dem tierlichen Tod und dessen Repräsentation
Ariane Koller / Anna Pawlak
Spektakel der NeugierStrandung und Tod eines Wals als mediales Ereignis in der niederländischen Kunst der Frühen Neuzeit
Éric Baratay
Geschichtsschreibung von Seiten der TiereLeben und Sterben im Ersten Weltkrieg
Zur Phänomenologie des Todes
Christian Sternad
Den Tod als Tod vermögen Zum Tod des Tieres aus phänomenologischer Sicht
Martin Huth
Ihr Tod geht uns an Eine Phänomenologie des Sterbens von Tieren
Opfer und Rituale
Melanie Augstein
Gefährte, Opfer, Statussymbol? Tierdeponierungen im Kontext prähistorischer Bestattungsplätze
Stephanie Zehnle
„Der Leopard spielt mit den Herrschern.“ ‚Leopardenmorde‘ im kolonialen Afrika (ca. 1870–1950)
Theresa Eisele
Sterbende Stiere – oder von der Kunst des aufgeklärten Todes
Bilder vom Tod
Kai Artinger
Schwäche bedeutete Tod. Zum Wandel des Todesbildes in Tierkampfbildern der Malerei
Jan Henschen
Bärenfell und Filmpreis Zu Inszenierungen getöteter Bären und Verhandlungen des filmischen Dokuments anno 1908
Tiere als Todesboten
Ramona Sickert
Nacht- und Todesvögel Zur Symbolik der Eule im Mittelalter
Jonathan Kassner
Der Tod als solcher Kreatürliche Konfusionen in Kleists Das Bettelweib von Locarno
Künstlerische Positionen
Vroni Schwegler
Wandzeichnungen (2013)
John Darwell
Dark Days (2001)
Rezensionen
Abbildungsnachweise
Editorial
In dieser Ausgabe von Tierstudien geht es um das Thema „Tiere und Tod“. Der Tod von Tieren ist ein alltägliches Hintergrundrauschen.1 Tiere werden Opfer von Krankheiten, Unfällen oder von Altersschwäche. Doch die Geschichte des Tier-Mensch-Verhältnisses ist nicht nur geprägt vom natürlichen Tod von Tieren, sondern vor allem auch vom gewaltsamen Tod. Zuweilen töten Tiere Menschen; viel häufiger ist es aber in heutiger Zeit, dass Menschen Tiere töten, direkt und indirekt durch ihre Lebensweise: Nicht nur bei der Schlachtung zum Fleischgewinn, sondern auch bei Sport und Spiel, im Krieg und in der Forschung, durch Umweltzerstörung oder Gedankenlosigkeit, beim Opferritus oder sogar durch vom Gesundheitsamt angeordnete Massentötungen.2
Die Beiträge dieser Ausgabe setzen sich mit all diesen Phänomenen auseinander, betrachten aber auch tierinvolvierende Sepulkralkultur, untersuchen kulturelle und künstlerische Repräsentationen des Todes von Tieren und Verkörperungen des Todes in Tiergestalt oder erörtern die Anwendbarkeit philosophischer Fragen auf den tierlichen Tod. Sie stellen dar, wie, warum und wo Tiere sterben und wie der Tod von Tieren erlebt, gerechtfertigt, repräsentiert, anerkannt, verarbeitet oder verdrängt wird. Dabei wird auch die speziesistische Bewertung des Todes von Individuen verschiedener Tierarten deutlich. Martin Heidegger und andere Philosophen haben dem Tier gar die Möglichkeit zum Sterben ganz abgesprochen – eine Auffassung, die in den Animal Studies schon lange kritisiert wird. Menschen können nicht wissen, ob nicht-menschliche Tiere eine Vorstellung vom Tod haben. Zutiefst anthropozentrisch ist jedoch die Vorstellung, dass der eigene Tod oder der Tod anderer für Tiere weniger gravierend als für Menschen sei.3
Die Ausgabe wird durch die Darstellung zweier historisch unterschiedlicher Methoden im Umgang mit dem tierlichen Tod und dessen Repräsentation eröffnet. Ariane Koller und Anna Pawlak zeigen, welches Spektakel die Strandung eines Wals in der niederländischen Kunst der Frühen Neuzeit gewesen ist und wie damalige Künstler, z. B. Jan Saenredam oder Hendrick Goltzius, sich diesem Phänomen in zoologisch-realistisch anmutenden Tierstudien näherten. Die sinnliche Erfahrung einer Walstrandung sollte in diesen Darstellungen eindringlich vermittelt werden. Die Autorinnen interpretieren jedoch die toten und sterbenden Wale auch als Manifestation einer Bedrohung in einem theologisch-historischen Kontext, die u. a. durch die Produktion von Bildern bewältigt werden konnte. Die Waldarstellungen entpuppen sich in ihrer Lesart sowohl als Medien künstlerischer Selbstreflexion als auch als identitätsstiftende Projektionsfläche für die noch jungen Niederlande.
Éric Baratay, ein wichtiger Protagonist der internationalen Animal Studies, stellt am Beispiel des Sterbens von Tieren im Ersten Weltkrieg seine Methode einer „Geschichtsschreibung von Seiten der Tiere“ dar und präsentiert damit eine ganz aktuelle Form der akademischen Annäherung an Tiere. Er ruft dazu auf, die jeweils spezifische Biologie, Psychologie, Physiologie und Ethologie der Tiere einzubeziehen, wenn es um die historische Konstruktion von Tier-Mensch-Beziehungen geht. Dabei plädiert er für eine tierzentrierte Geschichtsschreibung (mit Rekurs auf Ökologie, Ethologie und Neurowissenschaften), die Tiere als eigenständige Akteure mit einer eigenen Geschichte ernstnimmt, und exemplifiziert dies am Beispiel vor allem der equinen und kaniden Kriegsopfer im Jahr 1914.
Die nächsten beiden philosophisch ausgerichteten Beiträge beschäftigen sich mit dem tierlichen Tod aus phänomenologischer Sicht. Ausgehend von Heideggers berühmtem Diktum, dass das Tier nicht sterbe, sondern „verendet“ und den „Tod als Tod weder vor sich noch hinter sich“4 habe, unternimmt Christian Sternad den Versuch, die Behauptung, das Tier sei „weltarm“5, sowie die Verleugnung des Todes von Tieren in ihrer Gewalttätigkeit, die bis heute andauert, zu widerlegen. Er besteht auf der Bedeutung des tierlichen Todes, die er u. a. über Jacques Derridas Darstellung einer Affizierung durch Tiere begründet. Dabei weist er auf einen Widerspruch innerhalb der phänomenologischen Methode in Bezug auf Tiere hin, und zwar, dass aus einer menschlichen, notwendig anthropozentrischen Perspektive weder behauptet werden kann, dass Tiere den Tod erfahren, noch, dass sie diesen nicht erfahren.
Auch Martin Huth betont, dass das tierliche Sterben das menschliche (und tierliche) Individuum zutiefst angeht und unmittelbar berührt. Mit Emmanuel Levinas und Maurice Merleau-Ponty argumentiert er, dass die Verletzlichkeit des Tieres den Menschen betrifft, weil beide sie teilen. Ebenso wie Sternad nimmt er Bezug auf aktuelle Praktiken des Angriffs auf die Leiblichkeit von Tieren beispielsweise im Schlachthof oder im Forschungslabor. Hier greife das Gegenteil von Mitleid, nämlich eine Verobjektivierung von Tieren (Theodor W. Adorno / Max Horkheimer). Dagegen spricht sich Huth für ein Sich-infrage-stellen-Lassen durch die Sterblichkeit des (tierlichen) Anderen und für eine Integration des Todes von Tieren in das menschliche Leben aus.
Tiere als Opfer oder Protagonisten in religiösen oder kulturellen Ritualen stehen im Fokus der folgenden drei Beiträge. Melanie Augstein beschäftigt sich – u. a. inspiriert von Erkenntnissen der Archäozoologie – mit Tierdeponierungen im Kontext prähistorischer Bestattungsplätze und versucht eine systematische Kategorisierung der involvierten Tiere in verschiedene Gruppen. Dabei nimmt sie sich vier Fallbeispiele genauer vor und zeigt, dass der vereinheitlichende Terminus „Tiergrab“ höchst unterschiedliche sepulkrale Praktiken und damit auch soziale Räume subsumiert. Sie plädiert für eine gründliche Betrachtung von Regelhaftigkeiten und Mustern in der Analyse von Tierdeponierungen, um zu seriösen Deutungen der Phänomene in ihrem Kontext zu gelangen.
Die geheimnisvollen ‚Leopardenmorde‘ im kolonialen Afrika von Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts stehen im Zentrum von Stephanie Zehnles Aufsatz. Sie überprüft den Wahrheitsgehalt und die Funktion der verbreiteten Gerüchte um von ‚Leopardenmenschen‘ begangene Morde an Menschen vor dem Hintergrund ihrer Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte. Ihren Ursprung hatten die Gerüchte, die sich von den Kolonialherren leicht instrumentalisieren ließen, u. a. in Initiationsriten. Die Kolonialmächte hätten dabei ‚Leopardenmänner‘ als Teil eines vermeintlichen organisierten antikolonialen Widerstands gefürchtet, gegen den sie mit Todesurteilen gegen Menschen sowie Jagd auf Tiere vorgegangen seien.
Theresa Eisele schließlich bietet eine neue Sicht auf den spanischen Stierkampf und das hochritualisierte Töten der Stiere in der Arena. Sie zeichnet die Geschichte der Corrida von archaischen Bräuchen bis zum modernen ökonomisierten, rationalisierten und ästhetisierten Spektakel nach. Dabei verweist sie auf die machtpolitischen und sozialen Funktionen der inszenierten Stiertötungen, u. a. im Hinblick auf Stierkampfdarstellungen von Francisco de Goya. Ähnlich wie in Zehnles Rekonstruktion der ‚Leopardenmorde‘ führt hier in Bezug auf die Corrida die Angst vor einer Verbindung von Menschen mit Tieren und gewaltsamen Toden zu kanalisierenden Strategien: Eine aufklärerische Einhegung chaotischer Stierkampffeste soll soziale Unruhen und den Umsturz bisheriger Machtverhältnisse verhindern.
Mit populären malerischen bzw. filmischen Darstellungen von Jagdszenen beschäftigen sich die Beiträge von Kai Artinger und Jan Henschen. Artinger schildert die ikonographische Entwicklung der beliebten Tierkampfbilder Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts als Spiegel sich wandelnder gesellschaftspolitischer Ideologien, die teilweise von den Naturwissenschaften beeinflusst waren. Richard Frieses Gemälde von sich angreifenden und tötenden Wisentbullen stehen beispielsweise im Kontext des Sozialdarwinismus und gaben der Sehnsucht nach einer heroischen, streng hierarchisch, naturgesetzlich geordneten Natur einen künstlerischen Ausdruck.
Henschen verfolgt die Entwicklung der Jagdfilme der Nordisk Films-Kompagni in etwa demselben Untersuchungszeitraum. In seiner semiotisch ausgerichteten Studie liest er den dänischen Film Bjørnejagt i Rusland (Bärenjagd in Rußland) von 1908 und dessen großangelegte mediale Präsentation auf der Hamburger Filmausstellung, die u. a. mit den Fellen getöteter Bären inszeniert wurde, als bedeutsam für die Referenzialität und den dokumentarischen Charakter von Filmen. Mit Rückgriff auf die – auch kommerzielle – Geschichte des frühen Tierfilms zeigt er, wie mittels dieser Ausstellungsinstallation und dem Bärenjagdfilm, welche verschiedene Realitätsebenen des Bärentodes exemplifizieren, das Sehen von (filmischen) Zeichen reflektiert wird.
Die beiden abschließenden Texte haben Tiere als Todesboten und die symbolische Bedeutung von Tieren zum Thema. So zeichnet Ramona Sickert die überwiegend pejorative Symbolik der Eule als Todes- und Unglücksvogel von der Antike bis zum Mittelalter anhand verschiedener textlicher Quellen nach. Aufgrund der damit in Zusammenhang stehenden Zuschreibung der Eule als apotropäisches Zeichen mussten auch reale Vögel sterben. Der Aufsatz macht anhand einer konkreten Spezies noch einmal klar, dass nicht nur biologische Gattungseigenschaften Einfluss auf menschliche Vorstellungen von der betreffenden Tierart haben, sondern auch, dass Vorstellungen von Tieren immer Rückwirkungen auf reale Tiere haben.
Jonathan Kassner untersucht die Bedeutung des Haushundes in Heinrich von Kleists Das Bettelweib von Locarno. In seiner u. a. von Walter Benjamin und Heidegger gespeisten Lektüre der Novelle ist der Hund einerseits Zeichen von Lebendigkeit, steht aber als Zeuge auch zwischen den Toten (hier dem Gespenst des Bettelweibes) und dem Totenreich. Weder er noch die menschlichen Protagonisten haben Macht über den Tod. Die geteilte Kreatürlichkeit von Mensch und Tier, die auch die gemeinsame Sterblichkeit beinhaltet, impliziert darüber hinaus eine Verantwortung dem companion animal gegenüber.
Die beiden Künstler_innenstrecken beschäftigen sich in jeweils ganz anderer Weise mit dem Tod: Vroni Schwegler zeichnet detailgetreu einen toten Wolfsbarsch und gibt ihm durch seine schwarmhafte Vervielfältigung in Form einer Wandzeichnung ein unheimliches, neues (Nach-)leben von faszinierender Schönheit. Ihre Arbeit steht in der Tradition altmeisterlicher Tierstudien mit ihrer genauen Naturbeobachtung, die diesem Journal seinen mehrdeutigen Namen geben.
Der britische Künstler John Darwell dokumentiert das massenhafte Töten von Schafen in seiner Heimatregion nach der verheerenden Maul- und Klauenseuche 2001. In suggestiven Fotos wird die Sinnlosigkeit dieser säkularen Brandopfer auf beklemmende Art und Weise deutlich. Der alltägliche Tod sogenannter Nutztiere für menschliche Zwecke bekommt hier eine neue, tragische Dimension.
Selbstverständlich, aber vielleicht dennoch wichtig ist es, anzumerken, dass alle Tiere, von denen in dieser Ausgabe die Rede ist, nie einfach nur als symbolische Tiere verstanden werden dürfen. Die Fische, Wale, Leoparden, Braunbären, Wisente, Hirsche, Schafe, Pferde, Hunde, Tauben und Eulen, die die Texte bevölkern, sind niemals nur Vehikel für Bedeutung oder akademischer Untersuchungsgegenstand. Sie alle hatten, so ihre Darstellung auf reale Individuen zurückgeht, ein nur ihnen eigenes, individuelles Leben, das durch ihren – oft gewaltsamen und unzeitigen – Tod unwiederbringlich verloren ist und das es zu betrauern gilt.
Jessica Ullrich und Antonia Ulrich
Anmerkungen
1 Jay Johnston / Fiona Probyn-Rapsey: Introduction. In: Dies. (Hrsg.): Animal Death. Sydney: Sydney University Press 2013, S. XIII–XX, hier S. XIV.
2 Vgl. The Animal Studies Group: Killing Animals. Urbana, IL: University of Illinois Press 2006; Dawne McCance: Critical Animal Studies. An Introduction. Albany, NY: State University of New York Press 2013.
3 Vgl. zur Trauer bei Tieren (z. B. bei Vögeln, Delphinen, Walen, Affen, Büffeln, Elefanten, Bären, Schildkröten, Katzen, Hunden, Hasen, Ziegen oder Pferden) u. a. Barbara J. King: How Animals Grieve. Chicago / London: University of Chicago Press 2013.
4 Martin Heidegger: Das Ding. In: Ders.: Vorträge und Aufsätze. Gesamtausgabe, Bd. 7. Frankfurt am Main: Klostermann, S. 165–187, hier S. 180.
5 Martin Heidegger: Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit. Gesamtausgabe, Bd. 29/30. Frankfurt am Main: Klostermann 2004, S. 263.
Methoden im Umgang mit dem tierlichen Tod und dessen Repräsentation
Spektakel der Neugier
Strandung und Tod eines Wals als mediales Ereignis in der niederländischen Kunst der Frühen Neuzeit
Ariane Koller / Anna Pawlak
In seinem 1851 erschienenen Hauptwerk Moby-Dick; or, The Whale, dem zweifellos berühmtesten und umfangreichsten Jagdepos der Literaturgeschichte, schildert Herman Melville einen schicksalhaften Zweikampf zwischen dem nach Vergeltung sinnenden Kapitän Ahab und einem sagenumwobenen weißen Pottwal, der dem fanatischen Walfänger einst ein Bein abbiss. Die manische Fixierung des Seemanns auf Moby-Dick macht die Jagd auf den ungreifbaren Leviathan zu einer Odyssee über die Abgründe obsessiver Rachsucht: Moby-Dick ist Ahabs Nemesis und Alter Ego zugleich. Die Rollen des Helden und dessen Antagonisten, des Jägers und Gejagten oszillieren paradigmatisch zwischen Mensch und Tier, bis diese „Nietzscheanische Osmose“1 durch den gewaltsamen Tod des Kapitäns im tragischen Finale der symbolisch übercodierten Erzählung ihre Auflösung findet. Der auf dem Höhepunkt der Walfangindustrie im 19. Jahrhundert entstandene Roman fungiert gleichermaßen als detailliertes Fachbuch des mörderischen Walfangs wie universelle Parabel des gewaltsamen Ringens zwischen dem Wal als Verkörperung archaisch-ungebändigter Natur und der ihn ausrottenden, technisch versierten Industrie, für die programmatisch das Schiff Pequod, die ‚schwimmende Ölfabrik‘, steht Paradoxerweise ist es gerade Ahabs vom Hass getriebene, unerbittliche Suche nach dem furchterregenden Phantom der Tiefe, die das primäre Bestreben seiner Schiffsmannschaft nach wirtschaftlichem Profit konterkariert und den weißen Wal zu einem Mythos erhebt, zu einem legendären Wesen, das menschliche Neugierde und Ehrfrucht bannt. Eine derartige Anziehungskraft übten Wale bereits seit Jahrhunderten aus, doch für kein anderes europäisches Land und seine Kultur besaßen die gigantischen Meeressäuger – und das war für Melville als Nachfahre niederländischer Einwanderer eine größere historische Relevanz als für die Republik der Sieben Vereinigten Provinzen. Insbesondere das Phänomen der Walstrandung, des scheinbar mirakulös den Meeresfluten entrissenen gewaltigen ‚Seemonsters‘ im Zustand der Agonie, lockte in regelmäßigen Abständen alle Schichten der holländischen Gesellschaft an die Küste und stillte ebenso die zügellose Sensationsgier wie das wissenschaftliche Bedürfnis der Naturerforschung. Die sterbenden und toten Wale dienten jedoch nicht nur als Objekte der Anschauung und Autopsie, die empirisch vermessen, dokumentiert und gewinnbringend verwertet wurden, sondern boten zugleich ein breites Spektrum an unterschiedlichen Exegeseansätzen. Zahlreiche, mit gelehrten Inschriften versehene Druckgraphiken, deren ästhetisch-ökonomischer Erfolg auf dem Konzept der Augenzeugenschaft beruhte, trugen zu der immensen Popularität von Walstrandungen und ihrer semantischen Aufladung bei. Namhafte Künstler der Zeit suchten deshalb die sterbenden Meeressäuger auf und stellten mit vermeintlichem Realismus den ebenso ehrfürchtigen wie pietätlosen Umgang mit den Tierkadavern dar, die zum präzedenzlosen Gegenstand bildlicher Auffassung wurden. Dieser relevanten Ausnahmepraxis in der niederländischen Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts widmet sich der vorliegende Beitrag. Er analysiert anhand ausgewählter Darstellungen des Phänomens die differenzierten Prozesse der sinnlichen Wahrnehmung, Ansätze der theologisch-historischen Auslegung und Formen der künstlerischen Reflexion dieses zu einem Massenspektakel avancierten Sterbeaktes. Den Ausführungen liegt dabei die These zugrunde, dass die gestrandeten Wale jenseits genuin wirtschaftlicher und zoologischer Interessen zu einer identitätsstiftenden Projektionsfläche für die sich gerade konsolidierende, junge Republik, den kollektiven Prodigien- und Profitglauben ihrer Bewohner sowie für deren Erfahrung respektive Vorstellung einer andauernden Bedrohung durch das Fremde wurden. In den komplexen Strategien der kulturellen Bewältigung von Walstrandungen, deren integraler Bestandteil die Bilder waren, reflektierten die Niederländer letztlich stets über ihr eigenes Land, ihre Geschichte und ihr Verhältnis zur Welt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!