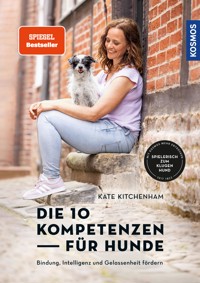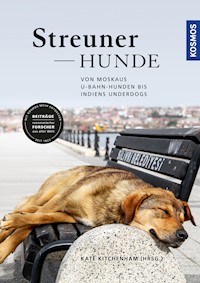16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Tierische Freundschaften – was wir von ihnen lernen können Der Anblick echter Tierfreundschaften berührt unser Herz – da die Bedürfnisse der Tiere nach Nähe und Geborgenheit unseren gleichen. Die Zoologin und TV-bekannte Tierexpertin Kate Kitchenham zeigt uns an eindrucksvollen Beispielen aus der Tierwelt, warum es zu Freundschaften zwischen Tieren kommt und wie diese sogar über Artgrenzen hinaus entstehen, etwa zwischen Hund und Vogel. Was können wir von diesen tierischen Beziehungen über uns selbst und andere Tiere lernen? Nicht weniger als zu verstehen, wer wir sind, woher wir kamen – und dass wir immer noch dazugehören. »Wir alle – Menschen und viele nichtmenschliche Tiere – haben ähnliche Bedürfnisse nach Sicherheit, Freundschaft und Zusammensein und sind in der Lage, sie im Gegenüber zu erkennen und zu befriedigen.« Kate Kitchenham
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kate Kitchenham
Tierischbeste Freunde
Liebe kennt keine Grenzen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Tierische Freundschaften – was wir von ihnen lernen können
Der Anblick echter Tierfreundschaften berührt unser Herz – da die Bedürfnisse der Tiere nach Nähe und Geborgenheit unseren gleichen. Kate Kitchenham zeigt uns an eindrucksvollen Beispielen aus der Tierwelt, warum es zu Freundschaften zwischen Tieren kommt und wie diese sogar über Artgrenzen hinaus auch zwischen zum Beispiel Hund und Vogel entstehen. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt: Was können wir von diesen tierischen Beziehungen über uns selbst und andere Tiere lernen? So können wir besser verstehen, wer wir sind, woher wir kamen – und dass wir dazugehören.
Inhaltsübersicht
Widmung
Einleitung Wozu gibt es eigentlich Freunde?
Emotionen und Gefühle bei uns und nichtmenschlichen Tieren
Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Freundschaft
Verhaltensforschung – die Welt aus der Perspektive der anderen erleben
Grundbaustein der Gemeinsamkeit: das soziale Gehirn
Sich sicher fühlen
Sich gut fühlen, Spaß haben
Gemeinsamkeiten, keine Gleichmacherei
Geschichte der Freundschaft
Wieso wir uns ähnlich sind: der Fisch in uns
Liebe vermehrt sich
Hingebungsvolle Rattenmütter
Programmierung auf Liebe
Freude an Freundschaft
Psychologie und Physiologie der Freundschaft zwischen verschiedenen Arten am Beispiel der Mensch-Hund-Beziehung
Empathie entwickeln, Freunde werden
Faszination Gesicht
Lernen, Gesichtsausdrücke zu lesen, um zu verstehen und zu antworten
Ein weit verbreitetes Phänomen
Beziehung oder Bindung? Wie wir soziale Netze knüpfen und Freundschaft lernen
Achtung, Infektionsgefahr: Hier droht emotionale Ansteckung!
Selbsterleben ermöglicht Fremderleben: Was fühlst du?
Wie erforscht man Gefühle und Empathie bei Tieren?
Spielen als Lernmotor
Spielen fühlt sich gut an und pusht EQ & IQ
Wie sich Empathie und Reaktionsschnelligkeit entwickeln
Soziale Regeln spielend lernen
Mimik und Verhalten lesen zwischen verschiedenen Arten
Drei tierisch beste Freunde fürs Leben
Alberne Pferde- und Hundekumpels
Spielen zwischen verschiedenen Arten in freier Wildbahn
Bindung beflügelt!
Krähe Wolle & vier Jagdhunde
Persönlichkeit macht den Unterschied
Neue Welten wahrnehmen durch das Leben mit Tieren
Wie Tiere Freund und Feind unterscheiden
Gleich und gleich gesellt sich gern: Warum Freunde sich oft irgendwie ähnlich sind
Ähnlichkeit: Bedürfnisse & Interessen
Ähnlichkeit: Persönlichkeit und »Werte«
Wie geht Denken ohne Worte?
Ist Freundschaft wirklich selbstlos?
Altruismus in Tierfreundschaften
Flexible Formen von Freundschaft und Loyalität in sozialen Gruppen
Selbst-Zivilisierung hat uns nett gemacht
Co-Evolution von Hund und Mensch?
Ist der Mensch ein Kosmopolit oder Clanmitglied?
Gruppenzusammenhalt und Abgrenzung können sich gut anfühlen
Warum die Nazis leider erfolgreich waren
Zwei Seelen in der Menschenbrust
Verschiedene Freundschaftsformen
Wie Freunde uns stark, gesund und klug machen
Lebensbegleiter Freund
Alte und viele Freunde sind am besten
Freunde sind Stresspuffer und halten uns dadurch gesund
Warum zu viel Stress krank macht
Freude am Nervenkitzel
Der Parasympathikus und gute Freunde bringen Entspannung
Trost und Unterstützung
Freunde machen klug
Leo, Sher Khan und Baloo: beste Freunde in guten wie in schlechten Tagen
Bindung beflügelt: Woran wir gute Freundschaften erkennen können
Freunde oder Bekannte?
Freunde sind Glückspakete
Mensch-Tier-Freundschaften
Anfänge der Haustierhaltung
Zunehmende Entfremdung von der Natur
Funktionen von Haustieren
Brückenbauer zurück zur Natur
Adriana & Sil, das blinde Pferd
Haustiere – Mischwesen aus Kultur und Natur
Die Hypothese der »Biophilie« von Edward Wilson
Machen Haustiere glücklich und gesund?
Langzeitstudien über die Wirkung von Haustierhaltung
Andersherum: Machen wir unsere Haustiere glücklich und gesund?
Treuer Hund, unabhängige Katze?
Stony
Begrüßungszeremonien beruhigen und stärken die Bindung
Glücksbringer auf vier Pfoten: Assistenzhunde
Nina & Hazel
Nur wer glücklich ist, kann glücklich machen
Flirtfaktor Hund
Haustiere sind soziale Katalysatoren
Die Gassigang
Heimtiere als Sozialarbeiter und Familienhelfer
Tierische Kollegen
Von außen betrachtet: Wie wirken Tierbesitzer auf ihre Umgebung?
Menschen mit Hund wirken glücklicher
Freundlichkeit – das Geheimnis unseres Erfolges
Zahmheit stößt Entstehung neuer Fähigkeiten an
»Nutztiere«: ähnlich, doch nicht gleich?
Birgit, Johannes & Nico
Freunde bis zum Schluss
Adoption
Apple & Curry
Biologische Hintergründe für Adoption
Alles selbstlos?
Sozialcheck Haustier
Gruppenaufzucht
Kindchenschema – das Bermudadreieck der Vernunft
Der biologische Prozess des artübergreifenden Säugens
Eltern sein kann glücklich machen
Freddy & Oskar
Wenn Räuber ihre Beute aufziehen wollen
Das Leben unter anderen
Moby Dick & Flipper
Demut tut gut
Hunde und Katzen auf dem Pavianfelsen
Verteidigungsaggression
Leg dich besser nicht mit Müttern an!
Wenn Menschen Haustiere verteidigen
Kindchenschema in der Rassezucht
Der Hundeblick – eine Mimik, um uns zu manipulieren?
Warum so oft Hunde?
Adoptionen – ein Widerspruch zum Egoismus der Gene?
Satt und sicher sein macht Adoption möglich
Ende
Bildteil
Dank
Quellen und Stoff zum Weiterlesen
Adressen
Für Susanne Kitchenham
Weil sie mein kleines, neugeborenes Gehirn durch ihre Liebe und Fürsorge wunderbar darauf programmiert hat, Leben, Liebe und Freundschaft so toll zu finden, dass ich bis heute nicht genug davon bekommen kann.
Einleitung Wozu gibt es eigentlich Freunde?
Als ich zum ersten Mal dem Hängebauchschwein »Bonnie« und der weißen Hausgans »MöpMöp« gegenüberstand, wurde ich alles andere als herzlich empfangen – »MöpMöp« startete mit waagerecht vorgestrecktem Hals lautstark eine empörte Attacke, weil ich ihrer Meinung nach überhaupt nichts in der Nähe von »Bonnie« zu suchen hatte!
Erst nachdem ich respektvoll ein paar Schritte zurückgewichen war, beruhigte sich die Gans und legte sich wieder zur Hängebauchsau, die unbeirrt vom Krach ihrer Freundin einfach in ihrer kühlen Suhle weitergeschlafen hatte. Dort knibbelte MöpMöp zärtlich die spärlichen Borsten an Bonnies Rücken, bis ihr selbst langsam die Augen zufielen. Ungefähr eine Stunde lang hielten die ungleichen Freundinnen so ihre gemeinsame Siesta im Schatten eines Pflaumenbaumes: die eine tiefenentspannt schnarchend, die andere dösend, doch jederzeit bereit, bei der kleinsten Unruhe die Umgebung sichernd zu beobachten. Ich hatte also genug Zeit, die beiden zu betrachten – diese besonderen Damen, von denen ich schon so viel gehört und gelesen hatte. Zum ersten Mal begegnet sind sie sich in einem Tierheim. Dort wurden sie von den Pflegern zusammen in ein Gehege gesetzt, wahrscheinlich aus Platzmangel und weil man dachte, Tiere vom Bauernhof würden sich bestimmt verstehen. Und das taten sie – schon bald war es mehr als nur ein gegenseitiges Tolerieren. Die räumliche Distanz zwischen ihnen wurde immer geringer, sie entwickelten eine Beziehung und schließlich eine sehr stabile Bindung, die bis heute andauert. Sie leben jetzt auf dem »Erdlingshof« im Bayerischen Wald – ein »veganer Lebenshof«, auf dem Tiere mit Menschen nahezu auf Augenhöhe ihren Alltag teilen. MöpMöp und Bonnie sind also sozusagen im Paradies auf Erden gelandet, dürfen nach Lust und Laune über das große Gelände streifen und haben jederzeit die Möglichkeit, zu Artgenossen zu gehen. Die schneeweiße Hausgans hat auch tatsächlich Anschluss an die Gruppe der anderen Gänse gefunden. Aber sobald »ihre« Bonnie beschließt, sich von der Gänsegruppe fortzubewegen, ist für die gefiederte Freundin klar, dass sie ihr folgt. Bonnie hat wahrscheinlich die Schweinesprache niemals richtig lernen können und zeigt kein großes Interesse an der Schweinerotte vor Ort – deshalb ziehen die beiden immer noch am liebsten zu zweit, Seite an Seite über den Hof.
Wie ich MöpMöp und Bonnie da zusammen ruhen sah, so entspannt und vertraut, strahlten sie all das aus, was ich wahrscheinlich auch bei meinen besten Freunden suche: angenommen zu werden, mich zeigen zu dürfen, so wie ich wirklich bin. »Meine Freunde«, das ist an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, sind für mich aber nicht nur Menschen. Mit wem ich mich innerlich verbinde, hat eher etwas mit einer gemeinsamen Geschichte, Vertrautheit und Sympathie als mit der jeweiligen Artzugehörigkeit zu tun – also ganz ähnlich wie bei der engen Freundschaft zwischen Gans und Sau. Bei meinem Freundeskreis gehören Hunde fest dazu, meine eigenen natürlich, aber auch die Hunde meiner besten Freunde. Wenn wir uns treffen, gibt es ein großes Hallo, wir begrüßen uns wild durcheinander, freuen uns riesig, uns zu sehen – kreuz und quer, Menschen und Hunde. Und dann verbringen wir entspannt eine schöne Zeit miteinander, gehen große Runden spazieren oder »hängen gemeinsam ab«. Die Hunde gehören dazu und mischen sich unter uns – oder ziehen sich zurück, wie sie eben Lust haben. Keiner fühlt sich gezwungen, alle fühlen sich wohl.
Freundschaft scheint also nicht nur zu Artgenossen, sondern querbeet durcheinander, zwischen Gänsen, Schweinen, Menschen, Hunden und noch viel mehr Getier möglich zu sein. Gute Freunde um sich zu haben ist damit offensichtlich nicht nur für uns, sondern für viele sozial lebende Tiere von Bedeutung. Aber wir bewegen uns hier in einem Bereich, in dem wir anderen Tieren Gefühle und Bedürfnisse zuschreiben, die für uns selbst gelten. Ist dies überhaupt möglich? Und wenn ja – gibt es eine gemeinsame Basis für die Sehnsucht nach Freundschaft?
Emotionen und Gefühle bei uns und nichtmenschlichen Tieren
In den letzten Jahrzehnten hat sich das Bild, das wir vom Innenleben anderer Tiere haben, drastisch verändert. Besonders für Haustierhalter*innen ist es mittlerweile vollkommen normal, von der Persönlichkeit ihres Meerschweinchens oder eifersüchtigen Hunden zu sprechen. Aber ist das wirklich korrekt, dürfen wir Tieren, bestätigt durch den aktuellen Forschungsstand, Individualität und höhere Empfindungen zuschreiben?
Immerhin ist für manche Menschen die Vorstellung, dass wir Tieren in unserer Gefühls- und Wahrnehmungswelt in vielen Bereichen ähnlich sein könnten, immer noch verstörend. Jahrhundertelang galten wir als »die Krone der Schöpfung«. Mit enormen geistigen Fähigkeiten und einem differenzierten Gefühlsleben ausgestattet, sahen wir uns auf einem Sonderast der Evolution thronen, im zoologischen System ganz weit weg angesiedelt von anderen Tieren wie Frettchen, Katze oder Krähe. Von dieser abgehobenen Position aus haben wir oft selbstzufrieden auf den Rest der Tierwelt herabgeschaut. Doch diese Sicht auf die lebendige Umwelt lässt sich immer weniger aufrechterhalten, denn der Abstand zwischen uns und anderen Tieren ist im Laufe der letzten hundertfünfzig Jahre durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse stetig geschrumpft. Immer mehr Fähigkeiten und Bedürfnisse wurden entdeckt, die den unsrigen gleichen und uns so den anderen Tieren immer nähergebracht haben.
Auch das Phänomen der »Bindung« bei sozial lebenden Tierarten ist in den letzten Jahrzehnten in zahlreichen Studien von Verhaltens-, Neuro- und Evolutionsbiolog*innen, Anthropolog*innen, Physiolog*innen, Genetiker*innen und Psycholog*innen intensiv erforscht worden. Die Studienergebnisse all dieser unterschiedlichen Disziplinen lassen vor unseren Augen langsam ein Bild entstehen, das uns dabei helfen kann, zu erkennen, wo es Überschneidungen zwischen uns und anderen Tierarten geben könnte. Das wiederum kann uns helfen zu verstehen, wie wir Menschen uns im Laufe der Evolution zu den »Beziehungstieren« entwickelt haben, die wir heute sind. Menschen suchen nämlich nicht nur Beziehung zu Artgenossen, sondern heute aktiv auch Bindungen zu anderen Tieren. Es ist mehr als ein Trend, es ist normal geworden, dass immer mehr von uns ihr Leben und ihr Zuhause mit »tierisch besten Freunden« teilen wollen.
Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Freundschaft
Als Menschen gehören wir zu einer Spezies, für die stabile Bindungen zu anderen eine existenzielle Bedeutung haben. Die Erkenntnisse der Wissenschaft zeigen uns aber: Mit diesem starken Bedürfnis nach Nähe zu und Austausch mit anderen stehen wir im zoologischen System keineswegs allein oder abseits da, sondern mittendrin. Mitten zwischen Papageien, Wildschweinen, Eseln, Schimpansen oder Rindern. Für all diese sehr unterschiedlichen Tierarten sind vertraute Partner nicht nur ein wichtiger Stresspuffer und Sicherheitsfaktor, sondern offensichtlich auch eine Quelle hoher Lebensqualität und damit gesundheitlicher Fitness. Der Wunsch nach Bindung an einen loyalen Freund ist also keine menschliche Erfindung. Es gibt viel ältere, gemeinsame evolutionäre Wurzeln, die weit zurückreichen und deshalb – unter besonderen Voraussetzungen – auch Beziehungen nicht nur zwischen Artgenossen, sondern auch zwischen unterschiedlichen Spezies wie zwischen Bonnie und MöpMöp möglich machen.
Ein Hängebauchschwein scheint also nicht nur in der Lage zu sein, zu einer Gans eine soziale Beziehung aufzubauen, sondern sogar eine stabile Bindung – sonst würden die beiden doch niemals so vertraut nebeneinander ruhen und sogar Zärtlichkeiten austauschen? Mit dem Interpretieren von Verhalten ist das so eine Sache: Auch wenn es nach starker Zuneigung aussieht, was uns Bonnie und MöpMöp da vorleben – auf das Innenleben von anderen können wir dadurch nicht immer unbedingt schließen. Schon zwischen Menschen wird Zuneigung oder gar Liebe bekanntlich von Partner zu Partner unterschiedlich erlebt. Wie sollen wir dann erst eine Vorstellung davon entwickeln, was Delfine oder Kühe beim Anblick ihrer Beziehungspartner empfinden?
Auch meine Mitmenschen kann ich oft nicht verstehen, obwohl wir uns über Worte austauschen. Der Grund ist eine manchmal unterschiedliche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Wir werden geprägt durch unsere unterschiedliche Lebenserfahrung von Kindesbeinen an, von kulturellen Gegebenheiten und einschneidenden Erlebnissen, die beeinflussen, wie wir Situationen oder eben so etwas wie Freundschaft interpretieren. Diese Unterschiede in der Wahrnehmung von Situationen und Gefühlen innerhalb der Spezies »Mensch« macht deutlich, wie schwierig es ist, die Welt aus dem Kopf des anderen sehen und erleben zu können – und das, obwohl wir uns über Sprache austauschen können.
Verhaltensforschung – die Welt aus der Perspektive der anderen erleben
Aber auch wenn es schwierig erscheint, nichtsprachliche Tiere verstehen zu können – der Versuch ist spannend! Verhaltensforschung versucht genau das – die Welt aus den Augen der anderen zu verstehen und dadurch eventuell auch Gemeinsamkeiten und Wurzeln unserer eigenen Fähigkeiten entdecken zu können.
Was bislang dabei herausgefunden wurde, ist erstaunlich. In einer im Jahr 2012 stattfindenden Konferenz von Neurowissenschaftler*innen zum Thema Bewusstsein und geistige Fähigkeiten von Tieren waren sich die Forscher*innen am Ende einig, dass es in Anbetracht aktueller Erkenntnisse eines neuen Blicks auf nichtmenschliche Tiere bedarf. Deshalb verfassten die Teilnehmer*innen der Konferenz eine wichtige Erklärung, die »Cambridge Declaration on Consciousness«. Übersetzt bedeutet das ungefähr »Cambridges Erklärung zum Thema Bewusstsein«. In dieser Schrift wird von den Neuroforscher*innen festgehalten, dass nach neuestem Erkenntnisstand nicht nur Menschen, sondern eine große Anzahl von nichtmenschlichen Tieren, und zwar nicht nur Wirbeltiere, sondern auch einige Nichtwirbeltiere, Lebewesen mit Bewusstsein sind: »Ergebnisse unterschiedlichster Studien zeigen uns, dass nichtmenschliche Tiere über die neuroanatomischen, neurochemischen und neurophysiologischen Voraussetzungen verfügen, die Bewusstseinszustände möglich machen und gleichzeitig die Fähigkeit, planvolles Verhalten zu zeigen.« Konsequenterweise zeige diese angesammelte Beweislast in Form von Studien, dass »Menschen nicht als einzige im Besitz von neurologischen Substraten sind, mit deren Hilfe Bewusstsein generiert wird. Nichtmenschliche Tiere, eingeschlossen Säugetiere und Vögel und viele andere Kreaturen wie Oktopusse, verfügen ebenfalls über diese neurologischen Voraussetzungen« (Declaration of Consciousness, 2012). Die Forscher*innen sprechen hier von Bereichen, die ein Bewusstsein und planvolles Handeln der verschiedenen Tierarten ermöglichen. Doch wenn wir uns die Gebiete ansehen, die uns ermöglichen, Bindungen einzugehen, dann befinden wir uns in sehr ursprünglichen und alten Teilen unseres Gehirns. Diese 600 bis 400 Millionen alten Gehirnstrukturen machen soziales Verhalten und damit Beziehungen zueinander möglich. Evolutionär entstanden sind diese Fähigkeiten also lange vor der Entstehung des Menschen. Zusammenhalt, Liebe und Loyalität scheint evolutionär betrachtet für das Überleben von vielen Tierarten also ein sehr Erfolg versprechendes Konzept zu sein.
Wir Menschen können uns über Sprache sehr komplex austauschen und reflektieren, wie sehr wir unseren Partner, unser Kind, unser Haustier oder unseren guten alten Schulfreund lieben. Wir können durch Wörter wie hier in diesem Buch dem Wunder außergewöhnlicher Tierfreundschaften auf den Grund gehen, dazu Studien abgleichen mit den realen Fällen und daraus Hypothesen entwickeln, die uns außergewöhnliche Tierfreundschaften verstehen helfen. Diese Form des hochentwickelten Sprachgebrauchs gilt bislang noch als eine einzigartig menschliche Fähigkeit. Doch sie verführt uns dazu, uns als Maßstab für Intelligenz zu sehen. Denn nur, weil andere Tiere ihre Wahrnehmungen, Beobachtungen oder Gefühle nicht in Worte fassen können, heißt das nicht, dass all das nicht existiert.
Grundbaustein der Gemeinsamkeit: das soziale Gehirn
Sich Gedanken über ein Gegenüber ohne Worte vorzustellen – das fällt uns Menschen naturgemäß nicht leicht. Doch wenn wir uns die Gehirne anderer Lebewesen ansehen, entdecken wir auch dort eine starke Vernetzung verschiedener Hirnareale, die in ihrer Zusammenarbeit als »soziales Gehirn« bezeichnet werden. Diese Bereiche sind bei uns und anderen Tierarten zuständig für Einfühlungsvermögen, Problemlöseverhalten, soziale Kompetenz und höhere Empfindungen wie Schuld oder Scham. Je sozialer eine Spezies lebt, desto mehr Freunde kann sie haben – deshalb ist das Frontalhirn beim Menschen größer als bei Makaken oder bei einer Katze. Doch auch dort ist es gut ausgebildet und die Fähigkeit zur Einfühlung ebenfalls, nur auf anderem Niveau vorhanden. Die Perspektive des anderen wahrnehmen, aus seinem Verhalten auf seine Stimmung und Absichten schließen zu können, spielt eben nicht nur für uns, sondern für viele Tierarten eine wichtige Rolle im sozialen Zusammenleben und ist deshalb auch in unterschiedlichen Ausprägungen vorhanden. Und auch wenn andere Tierarten keine Opern komponieren, keine Hochhäuser oder Raketen bauen und keine mathematischen Formeln entwickeln können, mag es andere Formen der Intelligenz geben, bei denen wir wiederum diesen Arten unterlegen sind. Die Grundlage unser aller Fähigkeiten aber ist in den gemeinsamen, alten Hirnteilen zu finden, in der Vernetzung der Großhirnrinde mit dem entwicklungsgeschichtlich sehr alten Teil des Gehirns, dem »sozialen Gehirn«.
Ein wichtiger Teil dieses sozialen Gehirns, den wir mit anderen Arten teilen, ist das »limbische System«. Dieser bei vielen Spezies ähnlich strukturierte Bereich liegt im »Zwischenhirn« direkt unter dem Großhirn und ist mit diesem je nach Tierart unterschiedlich intensiv vernetzt. Dieses »emotionale Zentrum« des Gehirns generiert Emotionen, die vom Thalamus, »dem Tor zum Bewusstsein«, bewertet werden: Wird eine Emotion aufgrund vorhergegangener Erlebnisse als sinnvoll erachtet, dann wird die Gefühlsinformation über Leitungsbahnen an die verschiedenen Bereiche der Großhirnrinde geschickt, und eine passende emotionale oder rationale Reaktion wird gezeigt.
Das Geräusch einer blubbernden Kaffeemaschine bewertet unser Gehirn deshalb nicht als gefährlich – wir haben es oft genug gehört, kennen den Zusammenhang, in dem es erzeugt wird – und zeigen keine Reaktion. Ein Mensch oder Haustier, der/das bislang keine Kaffeemaschinen kennt, wird ganz anders reagieren. So ermöglicht uns das Gehirn, uns in der Welt zu orientieren – also zum Beispiel auf unbekannte Situationen mit Vorsicht oder auf angenehme Situationen mit Wohlgefühl und Suche nach Nähe zu reagieren, aber eben auch Freude beim Lösen komplizierter Aufgaben zu empfinden. Besonders die im »Belohnungssystem« erzeugten Emotionen ermöglichen uns im Zusammenspiel mit verschiedenen Bereichen des Großhirns, immer mehr Positives erleben und lernen zu wollen. Emotionen sorgen also dafür, dass wir gerne leben, lernen und vermeiden, was uns nicht gefällt – und uns dadurch weiterentwickeln und (hoffentlich) immer klüger werden.
Auch andere Tiere, die wie wir in sozialen Gruppen leben oder sich sozial austauschen, müssen in verschiedenen Abstufungen in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, Ereignisse in der Umwelt zu bewerten und in Kategorien und Konzepte zu fassen. Die Qualität der Faltung der Großhirnrinde und ihre Vernetzung mit den anderen Gehirnbereichen sagt viel darüber aus, wie flexibel sich eine Art durch die Herausforderungen des Lebens manövrieren kann, wie sozial organisiert und wertvoll die Bindung zwischen Partnern werden kann. Je größer die Bedeutung von vielfältiger und anspruchsvoller sozialer Interaktion für eine Spezies ist, desto intensiver muss hier ein Austausch zwischen verschiedenen Mitgliedern einer sozialen Gemeinschaft stattfinden können. Denn die gut koordinierte Jagd auf eine Antilope verlangt von Löwen ein hohes Maß an individuellem Können und Kooperation. Ein Tier wie ein Löwe, Erdmännchen, Mensch, Elster oder Wolf muss also in der Lage sein, verschiedene Beziehungen zu unterschiedlichen Persönlichkeiten zu pflegen. So kann ich mein eigenes Verhalten auf das Verhalten anderer Gruppenmitglieder oder sogar einer ganz anderen Tierart abstimmen. Wenn das gelingt, funktionieren wir als Team, schenken uns gegenseitig Wohlgefühl und Sicherheit.
Diese Form der sozialen Kompetenz und der Fähigkeit, Erfahrungen auf neue Situationen zu übertragen und immer weiter zu lernen und abzuwägen, ist eben nicht nur beim Menschen, sondern auch bei vielen anderen Lebewesen anzutreffen. Besonders Bindung wird dabei vom limbischen System physiologisch belohnt – deshalb suchen alle sozial lebenden Arten Bindungspartner, es fühlt sich halt einfach gut an, eine vertraute Seele zur Seite zu haben. Die Nähe von guten Freunden oder engen Bindungspartnern sorgt für die Ausschüttung von Wohlfühl-Botenstoffen wie dem Bindungshormon Oxytocin, wir fühlen uns sicher aufgehoben und glücklich – unser Belohnungszentrum im Gehirn wird aktiviert und sorgt dafür, dass wir das Erlebnis von Nähe zu diesen Individuen immer wieder haben möchten. Dieser Effekt konnte in den letzten Jahren zumindest für Hunde sogar bildhaft dargestellt werden. Neurobiolog*innen und Verhaltensforscher*innen aus Budapest und Atlanta haben dazu Hunden zunächst beigebracht, mehr als sieben Minuten regungslos im Magnetresonanztomografen zu liegen (Berns et al., 2015; Andics et al., 2014). Auf diese Weise konnten die Forscher*innen Hundegehirne im zweiten Schritt dabei beobachten, wie sie auf den Geruch oder die Stimme von vertrauten versus fremden Personen reagierten. Das wenig erstaunliche Ergebnis für alle Hundefreunde: Beim Hören der Stimme oder Riechen des Geruchs ihrer Bezugspersonen reagierte das Belohnungssystem beim Hund, das für das Empfinden freudiger Gefühle zuständig ist, mit einem wahren Feuerwerk an neuronaler Aktivität! Spannenderweise hat das Belohnungssystem des Menschen im selben Versuch mit Familienmitgliedern genauso reagiert – wir haben hier also zum allerersten Mal die neuronale Grundlage von Bindung zwischen Mensch und Hund und die übereinstimmende Reaktion von Gehirnbereichen bildlich darstellen können. Beziehungstiere wie Menschen, Hunde und viele andere sozial lebende Arten suchen also nach Bindungspartnern. Unter besonderen Umständen ist es dann egal, ob diese Partner auf zwei oder vier Beinen laufen, wie sie aussehen oder sich verhalten. Entscheidend ist das gleiche Bedürfnis, das in diesem alten Teil unserer Gehirne angelegt ist, und das ist das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit.
Sich sicher fühlen
Sind die Erlebnisse mit einer ganz bestimmten Persönlichkeit dabei sehr positiver Natur, werden sie besonders schnell im Langzeitgedächtnis abgespeichert und dort mit einem schönen Gefühl verknüpft – der Startschuss für eine stabile Bindung und ein System, das deshalb bei ähnlich sozial organisierten Spezies wie MöpMöp und Bonnie artübergreifend funktionieren kann. Allein der Anblick des Bindungspartners löst dann schon positive Gefühle aus. Freundschaft ist also eine ziemlich erfolgreiche Erfindung der Evolution. Deshalb finden wir uns selbst in Bonnie und MöpMöp wieder, wenn wir sie dabei beobachten, wie die Gans als »zuverlässige Freundin« über ihre beste Freundin Wache hält, während diese schläft. Das hat eine beruhigende, entspannende Wirkung auf uns. Das schöne Bild weist uns darauf hin, dass uns Freunde in allererster Linie ein Gefühl der Sicherheit schenken. Sie sind der beste Stresspuffer, den man im Leben neben guten Eltern und einer stabilen Familie finden kann. Nach einer Freundin wie MöpMöp sehnen wir uns insgeheim alle.
Sich gut fühlen, Spaß haben
Aber enge Freunde sind nicht nur für uns da, wenn’s brennt; es fühlt sich neben dem Sicherheitsaspekt im Alltag einfach gut an, in ihrer Nähe zu sein. Dieses »Wohlgefühl«, die Unbeschwertheit im Umgang miteinander, ist eine weitere wichtige Funktion von guten Freunden. Wenn man in einer lauen Sommernacht über den Elbstrand in Hamburg schlendert, kann man hier herrliche Beobachtungen machen: Gruppen versammeln sich um kleine Grillstellen, liegen bis in die Nacht hinein am Wasser, aneinandergelehnt, manche lassen sogar zu, dass sie im »Würgegriff«, also mit dem Arm des Freundes oder der Freundin um den Hals gelegt, gehalten werden. Vertrauten Freunden gestehen wir sehr viel intime körperliche Nähe zu, wir reden albern oder philosophierend die Nächte durch; wir haben Zutrauen und können uns gehen lassen. All das fühlt sich einfach gut an, es bildet ein schönes Gegengewicht zum Alltag, in dem wir Aufgaben und Erwartungen erfüllen müssen. Bei besten Freunden brauchen wir uns dagegen nicht »konform« zu benehmen. Sie kennen uns so gut, dass es vollkommen sinnlos wäre, ihnen etwas vormachen zu wollen.
Das Schöne ist: Wenn man befreundete Tiere in entspannter Interaktion miteinander beobachtet, kann man genau die gleichen Kennzeichen vertrauter Freundschaft entdecken. Auch sie suchen die körperliche Nähe, zeigen sich verletzlich, indem sie empfindliche Körperteile wie ihre Kehle präsentieren, begrüßen sich ausgelassen, spielen schnell sehr vertraut und ohne Hemmungen miteinander. Auch das Streben nach Vertrautheit und Spaß an der Interaktion mit guten Freunden ist also bei Menschen und vielen anderen Tieren vorhanden. Deshalb können wir Freundschaft auch miteinander erleben. Menschen und Pferde, Hunde, Katzen, aber auch Rinder oder eben Schweine mit Gänsen können durch gleiche Hirnfunktionen und Botenstoffsysteme lernen, miteinander zu kommunizieren, Spaß zu haben und dadurch Vertrautheit und ein tiefes Sicherheits- und Wohlgefühl im Umgang miteinander zu entwickeln.
Gemeinsamkeiten, keine Gleichmacherei
Nach heutigem Erkenntnisstand sollten wir also davon ausgehen, dass Tiere viele Emotionen, differenzierte Gefühle und verschiedenste Fähigkeiten mit uns teilen. Das hat schon der große Evolutionsbiologe Charles Darwin erkannt und aus diesem Grund in weiser Voraussicht in seinem Buch Die Abstammung des Menschen1871 formuliert: »Die Unterschiede (…) sind eher gradueller, nicht grundsätzlicher Natur.« Hundertfünfzig Jahre später begeben wir uns in diesem Buch auf die Suche nach Gemeinsamkeiten, besonders nach unserem verbindenden Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Sicherheit und Liebe. Doch es geht niemals um Gleichmacherei – die Geschichten besonderer Beziehungen in diesem Buch zeigen vielmehr, wie wunderbar es ist, dass wir uns auch unterscheiden. Denn erst das Unterschiedlichsein macht die Begeisterung füreinander oft so wertvoll und bringt uns nahe, was wir sonst vielleicht niemals kennengelernt hätten. Wir werden sehen, wie Freundschaft und Bindung in der Tierwelt und zwischen Menschen und Tieren gelebt wird, wir begegnen außergewöhnlichen Geschichten von Tierfreundschaften, die uns zeigen, was Bindung alles möglich macht, wie sie uns beflügeln und inspirieren kann. Genau darum soll es in diesem Buch gehen – letztendlich ist sein Ziel ein besseres Tier- und dadurch Selbstverständnis. Damit wir wissen, wer wir sind, woher wir kamen – und dass wir immer noch dazugehören.
Geschichte der Freundschaft
Warum wir uns so gern binden: Vertrautheit fühlt sich gut an!
Es ist schon komisch, einem Uhu und einer Jagdhündin dabei zuzusehen, wie sie sich Schnauze an Schnabel zärtlich begrüßen. Aber das taten sie, Ronja und Hugo, das ungleiche Paar. Zu Beginn zwar etwas zögerlich, aber das lag wohl eher daran, dass wir gleich mit einem ganzen Fernsehteam angerückt waren, um das morgendliche Ritual zu dokumentieren. Und dabei natürlich die Intimsphäre massiv störten. Doch nachdem sich die beiden an uns gewöhnt hatten, gab es für sie kein Halten mehr: Hugo flog zu seiner Auserwählten und stolzierte ihr entgegen. Sie wiederum legte sich auf den Boden, machte sich extra für ihn klein und streckte ihm ihr Hundegesicht entgegen. Und dann zeigten sie das außergewöhnliche Schauspiel, das Falkner Marco Wahl im Tierpark Niederfischbach seit Jahren beobachten kann: Sie knabberten beziehungsweise leckten sich hingebungsvoll gegenseitig das Eulen- und Hundegesicht. Doch was das Fernsehteam und ich so noch nie gesehen hatten und was uns dahinschmelzen ließ, ist für Marco Wahl ein ganz normaler Start in den Arbeitstag. Bei seinem allmorgendlichen Rundgang durch die Wildvogel-Volieren wird er immer von der freundlichen Vorstehhündin begleitet. Und jeden Morgen fliegt Uhu Hugo von seinem Sitz hinunter auf den Boden, trabt leichtfüßig auf seine Freundin Ronja zu, und beide scheinen für einen Moment die Welt um sich herum zu vergessen – und vor allen Dingen, dass sie gar nicht einer Art angehören. Die Wiedersehensfreude der beiden ist echt und wird sich gegenseitig bestätigt, seit jenem Morgen, an dem Hugo aus dem Zuhause des Falkners hier eingezogen ist. Vorher war Hugo noch ein Uhuküken, und die beiden haben zusammen bei der Familie von Marco Wahl in einem Reihenendhaus gewohnt. Erst als das Wohnzimmer für Hugo zu klein wurde und er mehr Platz für seine ersten Flugversuche brauchte, war das Ende des »WG-Lebens« für die beiden gekommen. Doch das bedeutete nicht das Ende der Beziehung: Auch wenn sie heute viel weniger Zeit miteinander verbringen können, die Vertrautheit von damals ist geblieben.
Das Bedürfnis nach Nähe und Zugehörigkeit – das zeigt uns auch dieses Beispiel wieder wunderbar eindrücklich – ist bei vielen sozial lebenden Arten präsent und überspringt besonders leicht bei in Gefangenschaft lebenden Tieren die Artgrenze. Es hält uns vor Augen, wie alt die Suche nach Beziehung ist – jedenfalls viel, viel älter als die Gattung Mensch. Die Vorteile, die sich aus dem Leben mit anderen ergeben, haben dazu geführt, dass sich das Prinzip der Gemeinschaftlichkeit früh bei der Entstehung der Arten durchsetzen konnte. Deshalb kommt es dazu, dass sich Hunde und Vögel anfreunden – wenn sie auf engem Raum und über langem Zeitraum zusammenleben, sodass sie die Körpersprache des anderen verstehen und darauf reagieren lernen (siehe auch »Wolle« in Abschnitt »Krähe Wolle & vier Jagdhunde« im Kapitel »Bindung beflügelt«). Um die Faszination von Freundschaften wie der zwischen Hugo und Ronja besser verstehen zu können, hilft es, zu wissen, woher die Bindungsbereitschaft zwischen so unterschiedlichen Arten kommt. Also warum sie sich während der Evolution entwickelt hat, aber auch, auf welchen Grundlagen das Bedürfnis nach Bindung an andere während unserer individuellen Entwicklung erwächst. Wir schauen uns also zuerst eine Art »Chronologie der Freundschaft« an, bevor wir uns der Entstehung der Bindungsfreude und den vielfältigen Erscheinungsformen von Freundschaft zuwenden.
Wieso wir uns ähnlich sind: der Fisch in uns
Im letzten Jahr ging eine medizinische Meldung durch die Medien, die weltweit für Aufsehen sorgte: In den USA war es Biomediziner*innen mithilfe von Aquarienfischen gelungen, das passende Medikament für einen schwerkranken Jungen zu entwickeln – und ihm damit das Leben zu retten. Die Helden dieser Geschichte sind – neben den Forscher*innen natürlich – Zebrabärblinge. Das sind kleine Aquarienfische, die sich schnell vermehren und deshalb unter Wissenschaftler*innen sehr beliebt sind, um zum Beispiel die Vererbung von Genen zu untersuchen, die Krankheiten auslösen können. Den befruchteten Eiern dieser Fische wurde in einem sehr frühen Stadium ihrer Embryonalentwicklung deshalb das Krankheitsgen des zwölfjährigen Daniel eingeschleust. Dann beobachteten die Forscher*innen, wie in der Petrischale die Genmutation die kleinen Fische die gleichen Symptome wie bei Daniel entwickeln ließ: Bei allen Versuchsfischen kam es zur unkontrollierten Wucherung von Lymphgewebe. Um zu testen, wie die Wucherungen effektiv bekämpft werden könnten, gaben die Biomediziner*innen den kranken Fischembryonen unterschiedliche Medikamente in die Petrischalen und beobachteten, ob die Arzneien den Krankheitsverlauf beeinflussen. Tatsächlich entdeckten sie auf diese Weise die richtige Medizin! Als das Krebsmedikament dann bei dem Jungen eingesetzt wurde, konnte die krankhafte Ausbreitung seines Lymphgewebes, das ihm trotz Operationen das Atmen zunehmend erschwert hatte, genau wie bei den winzigen Fischchen gestoppt werden. Heute kann Daniel wieder ein fast normales Leben führen (Schlag, 2019; Dong Li et al., 2019). Dieses Beispiel aus der Gegenwart zeigt, was Charles Darwin und Ernst Haeckel vor mehr als einem Jahrhundert bereits ahnten: Ein Stück des Weges sind wir während unserer Entwicklungsgeschichte mit den Fischen zusammen gegangen.
Zugegeben, es ist lange her, dass der gemeinsame Vorfahre von Fisch, Frosch und Mensch mit einer Existenz an Land geliebäugelt hat. Die Entwicklung einer Lunge statt Kiemen zum Atmen, der Gang an Land, das Laufen auf zwei Beinen, die Nutzung unserer frei gewordenen Hände zum Werkzeuggebrauch und unseres hoch entwickelten Superhirns zur Kommunikation mittels Sprache durch das parallele Entstehen eines Kehlkopfes – all das kam erst sehr viel später. Die uralten Verwandtschaftsverhältnisse aber führen dazu, dass wir im Genom der Fische immer noch ungefähr 70 Prozent der Gene finden können, die auch wir Menschen besitzen. Dieser beeindruckend hohe Anteil paralleler Erbmasse wird besonders in der Frühphase der Embryonalentwicklung gebraucht: Sie sorgt dafür, dass sich aus befruchteten Eiern von Fisch und Mensch die ersten Zellen differenzieren und funktionsfähige Organe bilden, die in diesem Stadium noch nahezu identisch aussehen.
Neu ist die Erkenntnis der gemeinsamen Abstammungsgeschichte nicht, die sich in der Embryonalentwicklung wie im Zeitraffer wiederholt. Der Evolutionsforscher Charles Darwin hat bereits 1859 in seinem weltberühmten Werk Die Entstehung der Arten beschrieben, dass sich Tiere an ihren Lebensraum optimal angepasst entwickelt haben, aber alle auf einen gemeinsamen Vorfahren in der Artenentstehung zurückverfolgen lassen. Darwin und seine Kollegen haben sich nämlich schon damals nicht nur für die Spezialisierung auf verschiedene Lebensraumnischen und die damit verbundenen körperlichen und kognitiven Veränderungen interessiert. Besonders spannend fanden sie die frühen Stadien der Embryonalentwicklung von Fischen, Schildkröten, Vögeln, Katzenwelpen und Menschen. Beim Vergleich stellten sie fest: Ganz am Anfang sehen wir uns alle sehr ähnlich – und fangen erst relativ spät im Ei oder Mutterleib damit an, als Tier der jeweiligen Art erkennbar zu werden.
Diese »Biogenetische Grundregel« aus dem 19. Jahrhundert besagt, was die Biomediziner*innen auf der Suche nach einem Medikament für Daniel im 21. Jahrhundert erfolgreich genutzt haben: Die »Individualentwicklung« (=»Ontogenese«, also die Entwicklung eines Individuums vom befruchteten Ei bis zum ausgewachsenen Erwachsenen) sei eine verkürzte Wiederholung der »Phylogenese« (= Stammesentwicklung – also die Artenentwicklung im Schnelldurchlauf).
Historische Illustration der biogenetischen Grundregel von George Romanes
Der Embryo eines Menschen scheint während seiner Entwicklung vom Zellhaufen zum Baby also verschiedene Stadien der Evolutionsgeschichte zu wiederholen. Die Ausprägung von artspezifischen Unterschieden wie Fell oder Federn, kurzen oder langen Schnauzen mit feuchten oder trockenen Nasen, eine Bevorzugung von Einzelgängertum, Mono- oder Polygamie als bevorzugtes Lebensmodell wird erst viel später angelegt und noch später im Zuge des Erwachsenwerdens weiter ausdifferenziert durch das Zusammenspiel von Genen und Erfahrung, die wir in unserer jeweiligen Umwelt machen. Doch entscheidende genetische Informationen, die steuern, wann sich welche Organe entwickeln, sind vom Salamander bis zum Menschen sehr ähnlich.
Die verblüffend große Übereinstimmung an Genmaterial mit anderen Tieren verdeutlicht uns zum einen, was für große Auswirkungen kleinste genetische Veränderungen haben können. Zum anderen aber auch, dass wir in unseren Genen Zeugnisse unserer stammesgeschichtlichen Entwicklung konserviert haben. Alle Lebewesen sind also auf gewisse Weise miteinander verwandt. Aufgrund dieser Tatsache sollte es deshalb niemanden groß wundern, dass wir nicht nur wichtige Gene, sondern auch genetisch bedingte Schlüssel-Eigenschaften und Fähigkeiten teilen können, die sich schon früh bei der Entstehung sozialer Arten bewährt haben und die dafür sorgen, dass wir gut und sicher durchs Leben kommen. Wie zum Beispiel das Erfolgsmodell Bindung, also das Bedürfnis nach Sicherheit, Zusammenhalt und vertrauter Nähe, dem dieses Buch gewidmet ist.
Liebe vermehrt sich
Vertrauen und Liebe sind wunderbare Gefühlszustände. Das ist der Grund, warum wir die Nähe zu Lebewesen suchen, denen wir uns eng verbunden fühlen. Doch was bewirkt, dass wir lieben können und zurückgeliebt werden?
»You’ve got to learn how to love before you learn how to live.«
(Harry Harlow, Verhaltensbiologe und Psychologe)
Als Schülerin stand ich mit meiner erwachenden Leidenschaft für Verhaltensforschung ziemlich allein da. Anstatt mich für den damals total angesagten neuen Musikvideosender Viva oder die Bravo ehrlich zu begeistern, habe ich Bücher von Forscher*innen wie Konrad Lorenz oder der Primatenforscherin Jane Goodall verschlungen. Kein lebensgroßes Poster irgendeines Boygroup-Stars schmückte meine Jugendzimmerwand: Mein Regal stand voll mit jedem damals erhältlichen Buch der britischen Schimpansenforscherin. Vielleicht reagierte mein pubertäres Ich auf Janes Bücher auch deshalb so fasziniert, weil sich dort im tiefsten Dschungel Tanzanias all die alltäglichen Dramen abspielten, die ich auch auf dem Schulhof, in Diskotheken, Familien oder in der Politik beobachten konnte. Was die Primatologin über Intrigen, Affären und Komplotte in ihrer Schimpansengruppe beschrieb, unterschied sich für mich kaum von den Geschichten der Foto-Love-Story in der Bravo oder dem, was der Spiegel wöchentlich über Verwicklungen und Machtspielchen von Politikern berichtete. Während ich also gefesselt von persönlichen Schicksalsschlägen und intriganten Bestrebungen der einzelnen Schimpansenpersönlichkeiten las, tauchte ich tief ein in ihre Gemeinschaft. Die einzelnen Individuen wuchsen mir ans Herz, als Leserin erlebte ich mit, wie sie das Licht der Welt erblickten, wie sie ihre Pubertät überstanden und schließlich, wie sie das erste Mal als junge Schimpansin selbst Mutter wurden oder als Heranwachsende in der Rangordnung eine führende Position anstrebten. Aber was besonders faszinierend für mich war: Vieles von dem, was diese Affen-Persönlichkeiten erlebten, schien unseren Erlebnissen im Alltag ähnlich zu sein. Die Schimpansen hatten also vermutlich vergleichbare Motivationen, Gefühle und Lernprozesse zu durchlaufen wie wir!
Besonders im Gedächtnis geblieben sind mir Janes Beobachtungen über die Schimpansin Flo und ihre Kinder. Jane lernte Flo kennen, als diese bereits eine gestandene Schimpansenfrau war, und begleitete ihr Leben von diesem Moment an bis zu Flos Tod. Was ich schon damals besonders spannend fand: Die etwas zerzaust aussehende Flo zeichnete sich nicht nur durch einen hohen sozialen Status, ihre Freundlichkeit und ihren Sex-Appeal bin ins hohe Alter aus, sondern auch als besonders begabte Mutter. Sie war sehr zärtlich mit ihren Kindern, gleichzeitig aber auch lustig, denn sie liebte es, ausgelassen mit ihnen zu spielen. Sie war eine großartige Pädagogin, ohne jemals Erziehungsratgeber gelesen zu haben. Entfernten sich ihre kleinen Kinder vorwitzig zu weit von ihr, wurde sie kurz streng, war aber danach gleich wieder liebevoll. Brachten sich ihre Kinder ab einem bestimmten Alter selbst in Schwierigkeiten, schien sie genau abzuwägen, ob sie zur Rettung eilte oder den Nachwuchs selbst lernen ließ, einen Ausweg aus der Situation zu finden, in die er oder sie sich gebracht hatte. Jane selber war von Flos Erziehungsqualitäten so beeindruckt, dass sie einmal in einem Interview sagte, sie habe sich Flo zum Vorbild genommen, als sie selber Mutter ihres Sohnes Grub wurde. In vielen Situationen überlegte sie, was Flo jetzt wohl an ihrer Stelle getan hätte – und handelte danach. Zu Recht, denn wie sich später in den Biografien von Flos Kindern herausstellte, entwickelten sich jede und jeder einzelne von ihnen, wenn man das so sagen kann, als Schimpanse im gemeinschaftlichen Leben sehr erfolgreich. Sie waren angesehene Gruppenmitglieder mit hohem Rang, genau wie ihre Mutter. Die Söhne besetzten hohe Positionen oder führten die Gruppe sogar mit an. Die Töchter wurden sehr respektiert und entwickelten sich wie Flo zu großartigen Müttern (Goodall 1991, S. 50ff.). Diese »Fortsetzung« von psychischer Stabilität und Lebensklugheit ließ bei mir die Frage aufkommen, ob es sich hierbei um genetische Prozesse oder um den Einfluss früher positiver Lebenserfahrungen handeln könnte.
Dieser Frage konnte ich mich ein paar Jahre später zum ersten Mal in meinem Biologiestudium widmen. Zusammen mit Kommiliton*innen beobachtete ich die Orang-Utan-Gruppe im Hagenbecks-Tierpark. In unserer Beobachtungsstudie konzentrierten wir uns darauf, ob die Kinder von ranghohen Weibchen selbstbewusster agierten als Kinder rangniederer Weibchen. Im Hamburger Menschenaffenhaus lebt bis heute der letzte in Indonesien wild gefangene und heute älteste Orang-Utan, genannt Bella. 1964 wurde Bella mit ungefähr drei Jahren ihrer toten Mutter abgenommen und nach Hamburg gebracht. Hier hat sie sechs eigene Kinder bekommen. Die anderen Orang-Utan-Frauen hatten die Fürsorge einer »echten« Orang-Utan-Mutter nicht kennengelernt, sie waren in den Siebzigerjahren mit der Flasche aufgezogen worden, wie es damals noch üblich war. In der Folge hatten sie oft Schwierigkeiten mit der eigenen Mutterrolle. So kam es dazu, dass Bella insgesamt drei Mal deren Babys übernahm und neben ihren eigenen insgesamt neun Kinder großgezogen hat. Als Student*innen konnten wir dann das wahrnehmen, was schon Jane am Gombe-Strom in Tansania bei Flos Kindern hatte beobachten können: Nicht nur Bellas leibliche, auch ihre Adoptivkinder verhielten sich besonders selbstbewusst, aufgeschlossener und erkundungsfreudiger als vergleichbare Jungtiere, die nicht die ranghohe und sehr souveräne Bella zur Mutter gehabt hatten.
Hingebungsvolle Rattenmütter
In den letzten Jahren sind zu diesem Thema spannende wissenschaftliche Forschungen durchgeführt worden. Besonders der Einfluss frühkindlicher Umwelterfahrungen auf die Persönlichkeitsentwicklung von Ratten und Hunden wurde im letzten Jahrzehnt sehr intensiv erforscht. Bevor Sie jetzt angewidert den nächsten Absatz überspringen: Ja, Ratten sind für viele von uns keine Sympathieträger, und die Vorstellung, von der Rattenpsyche auf die unsrige zu schließen, erscheint dem einen oder der anderen bestimmt etwas weit hergeholt. Aber wenn wir uns kurz vom gruseligen Bild des Mülldurchwühlers und Krankheitsüberträgers freimachen und den Aufbau des Säugetiergehirns sowie das Familienleben sozial lebender Tiere wie eben Ratten etwas genauer ansehen, dann kommen wir nicht umhin zu erkennen, dass es viele Parallelen gibt. Und dass viele Rattenmütter genau wie die Schimpansin Flo oder die Orang-Utan-Frau Bella durchaus für uns zum Vorbild in Sachen Kindererziehung taugen könnten.
Unter anderem deshalb haben sich Genetiker*innen in ihren Untersuchungen für den Einfluss mütterlicher Fürsorge auf die individuelle Entwicklung bestimmter Fähigkeiten im späteren Leben interessiert. Sie teilten dazu die Rattenmütter zunächst in zwei Gruppen auf: eine Mütter-Einheit, die sich im Umgang mit ihren Welpen als sehr zärtlich zeigte und viel Zeit mit Säugen und Zuwendung verbrachte, und eine Gruppe, die eher nachlässig mit ihrem Nachwuchs umging. Um hier qualitative Unterschiede feststellen zu können, waren die Rattendamen vorher via Videoüberwachung genau bei der Kinderpflege beobachtet worden. Die Wissenschaftler*innen dokumentierten, wie viele Stunden die Mütter insgesamt bei ihren Welpen verbrachten und was sie dort taten (Weaver et al., 2004). Dabei wurde deutlich, dass die fürsorglichen Ratten länger bei ihren Kindern lagen, sie intensiver beleckten und beknabberten und häufiger säugten. Die nachfolgende Generation von weiblichen Ratten verhielt sich als Mutter interessanterweise entsprechend ihren ersten Lebenserfahrungen: Die Töchter der fürsorglichen Mütter wurden selbst zu sehr liebevollen Müttern. Töchter, die eher nachlässig behandelt wurden, zeigten später eine ähnlich geringe Motivation, sich stark in der Betreuung ihres Nachwuchses zu engagieren.
Eine Beobachtung, die auch Jane Goodall bei ihren Schimpansen machen konnte: Als Fifi, eine Tochter von Flo, zum ersten Mal Mutter wurde, engagierte sie sich intensiv in der Betreuung ihres Erstgeborenen Freud. Sie spielte mit ihm auf sehr ähnliche Weise, wie Flo mit ihr gespielt hatte, zeigte sich sehr zärtlich im Umgang mit Freud, ließ ihn die Umwelt erkunden, doch immer mit einem abwägenden und wachsamen Auge, genau wie ihre Mutter es bei ihr und ihren Geschwistern getan hatte. Zur etwa gleichen Zeit wurde noch ein Schimpansenkind in der Gruppe geboren: Pan, der erste Sohn von Pom. Pom wiederum war die Tochter von Passion, die sich ihr ganzes Leben lang mit den Herausforderungen von Mutterschaft schwergetan hatte. Und wieder zeigte sich eine Wiederholung eine Generation später: Die frischgebackene Mutter Pom neigte wie Passion dazu, dem eigenen Kind keine allzu große Beachtung zu schenken. So brach sie zum Beispiel manchmal einfach auf und ging davon – und wurde erst durch das Wimmern von Pan daran erinnert, dass sie jetzt ja Mutter war. Sie kehrte dann zwar zurück, schien aber von dem Neugeborenen zu erwarten, dass es selbstständig mitkommen würde. Schließlich sah sie ein, dass dies nicht funktionierte, und trug Pom auf sehr ähnliche Weise, wie sie früher getragen worden war: Oft rutschte er ihr aus dem Arm, und sie fing ihn gerade noch am Fuß auf. Pom zeigte generell keine große Lust, mit Pan zu spielen, sodass er früh damit anfing, sich an andere Kinder zu halten oder sich allein zu beschäftigen.