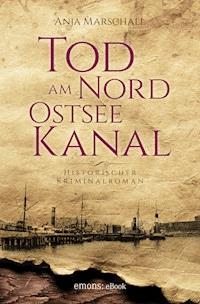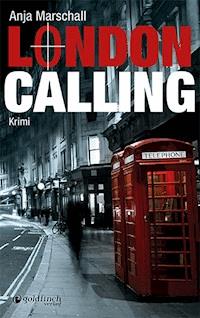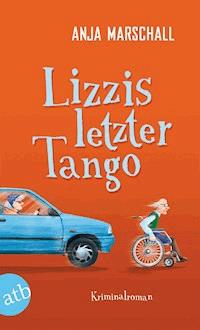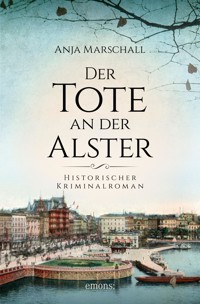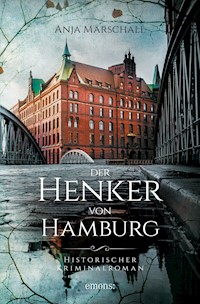9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Duft von frisch gemahlenem Kaffee und der Traum von Freiheit Drei starke Frauen in bewegten Zeiten: Band 3 der großen Familiensaga rund um den Aufstieg einer Hamburger Kaffeedynastie vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte zwischen 1889 und 1989. Hamburg 1945: »Behmer & Söhne« liegt in Schutt und Asche. Doch bald geht es mit dem Wirtschaftswunder aufwärts, und Cläre bezieht mit einem neuen Kontor die wiederaufgebaute Speicherstadt. Zu ihrem Unmut weigert sich ihre Tochter Anna, Verantwortung im Familienunternehmen zu übernehmen. Stattdessen heiratet sie den charmanten Prokuristen der Firma und stürzt sich voll in ihre Rolle als Ehefrau und Mutter. Als man ihren Mann bei der Unterschlagung von Firmengeldern erwischt, reicht Anna die Scheidung ein und fängt endlich an, ihr Schicksal und das von »Behmer & Söhne« selbst in die Hand zu nehmen. Die Hamburger Speicherstadt: weltweit größter historischer Lagerhauskomplex, Architektur-Juwel, UNESCO-Welterbe, Touristen-Magnet – und Herz des Hamburger Kaffeehandels Mit dem »schwarzen Gold« wird an der Waterkant schon lange gehandelt. 1887 eröffnete in der Speicherstadt die Hamburger Kaffeebörse und wurde zum wichtigen Handelsplatz für das begehrte und lukrative Genussmittel. 24 Millionen Jutesäcke Kaffee aus Brasilien und Zentralamerika sollen dort in den ersten eineinhalb Jahren gehandelt worden sein. Bis zum Ersten Weltkrieg blieb Hamburg führend für diesen besonderen Markt, und noch heute ist die Hansestadt für den Kaffeehandel von großer Bedeutung. Für LeserInnen der neuen historischen Sagas von Fenja Lüders und Anne Jacobs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Töchter der Speicherstadt – Das Versprechen von Glück« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Birgit Förster
Covergestaltung: t. mutzenbach design, München
Covermotiv: Ildiko Neer / Trevillion Images
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Stammbaum
1956–1959
Ein neuer Anfang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1959–1969
Verlorene Träume
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1976–1989
Die wahre Seele des Kaffees
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Nachwort
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1956–1959
Ein neuer Anfang
1
Gepflegtes Stimmengewirr erfüllte den Saal im Hotel Atlantic bis hinauf zur Stuckdecke. Silberbesteck klapperte leise auf Porzellan. Ein zarter Klang ging durch den Raum, sobald Kristallgläser mit moussierendem Weißwein dezent aneinanderstießen.
Ein Herr im Smoking lachte am Nachbartisch derart wiehernd auf, dass Anna grinsen musste. Schnell senkte sie den Blick, damit ihre Mutter es nicht bemerkte, die sich auf der anderen Tischseite angeregt mit dem Handelsattaché aus Guatemala unterhielt.
Anna war nun schon zum zweiten Mal mit ihren Eltern zum »Ball über den Wolken« in das luxuriöse Hotel an der Alster gekommen. Und dieses Mal schien ihr das Fest noch schillernder und imposanter als im letzten Jahr. Vielleicht lag es daran, dass den Deutschen im letzten Sommer ihre Souveränität von den Alliierten zurückgegeben worden war. Und das nur zehn Jahre nach Kriegsende. Hamburg feierte sich heute Abend selbst und die neue Zeit, obwohl draußen in der Stadt noch immer schwarze Lücken zwischen den Häusern und in den Seelen der Menschen klafften.
Jetzt, da Deutschland wieder ein Mitglied der Weltengemeinschaft sei und seit letztem Jahr auch seine Lufthoheit zurückbekommen habe, könne Hamburg wieder das Tor zur Welt werden, wie es das in der Vergangenheit immer gewesen war, meinte der Redner vorn am blumenumrankten Pult. Schon jetzt flöge die Lufthansa von Hamburg bis nach New York. Damit rückten all die faszinierenden Weltstädte wie London, Paris, Rom und Rio so dicht wie noch nie an die Elbe. Applaus.
Anna ließ ihren Blick unauffällig über die bunte Gästeschar gleiten. Ja, ein gewisser weltoffener Hauch lag tatsächlich im Saal. Da saßen Menschen nebeneinander, die bis vor wenigen Jahren noch Feinde gewesen waren. Da flatterten Sprachen durch die Luft, die Deutschland lange nicht gehört hatte, während vor den hohen Fenstern Schneeflocken über der Alster tanzten.
Dass sich seit Annas letztem Besuch beim »Ball über den Wolken« etwas geändert hatte, hatte sie bereits bemerkt, als sie mit ihren Eltern über den blauen Teppich in die Hotellobby geschritten war, eingemummelt in einen dicken Wintermantel. Anders als im Jahr zuvor waren kaum militärische Uniformen bei den Gästen auszumachen gewesen. Dieses Mal bewegten sich fast nur Zigarren rauchende Herren in Frack und Smoking im eleganten Modemeer aus Seide und Taft ihrer abendrauschenden Damen.
Nur vereinzelt hatte Anna Piloten der Lufthansa in den schicken blauen Uniformen ausmachen können und bildschöne Stewardessen, die die Gäste begrüßten und ihnen die Mäntel abnahmen. Der Fliegerball, wie Annas Vater Kurt den Abend nannte, war das Highlight der Ballsaison in der Stadt. Und Anna war mittendrin.
»Fräulein Ehmke …« Anna zuckte zusammen, als ihr Tischnachbar, ein gesetzter Herr im altmodischen Frack und mit ausgezeichnetem Appetit, sie ansprach. Er hatte sich als Sir Edmund Carlise vorgestellt und versuchte, Anna seit der Vorspeise von den Vorzügen der Britischen Insel zu überzeugen. »Sind Sie denn schon einmal geflogen?«
Anna verneinte bedauernd und nahm einen Schluck des französischen Weins, woraufhin ihre Mutter Cläre ihr einen warnenden Blick zuwarf.
Schnell wandte Anna sich wieder ihrem Tischherrn zu. Sie war froh, dass er so redselig war, denn Konversation mit betagten Männern zu halten, gehörte nicht zu ihren besonderen Fertigkeiten. Und die fünfundvierzig Jahre hatte der Brite bestimmt schon überschritten. Also beschränkte sie sich auf Lächeln und Nicken sowie ein »Ach, wie interessant«, sobald der Redefluss des Herrn ins Stocken geriet. Ältere Herren liebten es, wenn ein junges Ding auch nur mäßiges Interesse an ihnen vortäuschte.
Ungeduldig hoffte Anna indes, der letzte Gang des Menüs möge bald serviert werden und die letzte Rede ihr Ende finden, damit der Ball im Großen Festsaal endlich beginnen könne. Hier am Tisch konnte doch niemand ihr wunderschönes weißes Ballkleid mit der Tüllstola und dem perlenbesetzten Mieder sehen. Dieser betörende Traum sah fast aus wie ein Kleid von Grace Kelly, deren Bild Anna auf einem Filmplakat gesehen hatte. Inspiriert von dieser Schönheit und Eleganz hatte sie einfach eine der alten Abendroben ihrer Mutter genommen und Perlen aufgestickt, eine Bordüre angebracht und die Träger abgeschnitten. Der Clou aber war der Tüll, den sie sich locker um die nackten Schultern drapierte, um so ihr Dekolleté wunderbar zur Geltung zu bringen.
Anna setzte sich ein wenig gerader hin und nickte einem livrierten Diener zu, der ihr noch etwas Wein nachschenken wollte.
Sollte ihre Mutter doch gucken. Immerhin war sie seit Kurzem volljährig. Da durfte das eine oder andere Glas Wein schon mal sein.
Jetzt hörte sie die ersten Klänge des Orchesters durch die offenen Türen des Ballsaals hereinwehen. Ihr Herz machte einen Hüpfer. Es kostete sie alle Kraft der Welt, nicht aufzuspringen. Mit Elisabeth und Monika würde sie sich so schnell wie möglich vor den Eltern im Gewühl verstecken und sehen, ob es interessante junge Herren gab, die tanzen konnten. Hoffentlich spielte das Orchester nicht nur Walzer, sondern auch etwas Flotteres. Vielleicht sogar etwas aus Amerika. Anna winkte ihren beiden Freundinnen Elisabeth und Monika am Tisch ihres Vaters, Wirtschaftssenator Luigs, unauffällig zu.
Als endlich alle am Tisch den Kaffee ausgetrunken hatten und nur noch ein Stück Patisserie auf dem Teller lag, machte man sich bereit, in den Ballsaal hinüberzugehen. Anna folgte ihrer Mutter, die sich am Arm des Handelsattachés durch die Menge führen ließ, während ihr Gatte Kurt seinen Stock nahm und zusammen mit dem Geschäftsführer des Hamburger Flughafens folgte.
Für ihre Eltern, das wusste Anna, war dieser Abend weniger ein Vergnügen als vielmehr die Möglichkeit, neue Geschäftskontakte anzubahnen. Behmer & Ehmke hatte sich vom Krieg gut erholt, doch anders als ihre Eltern sah Anna in der Kaffeehandelsfirma mit Sitz am Sandtorkai keinen Phönix, der aus den Ruinen des Krieges auferstanden war, sondern eine stets fordernd quakende Ente, um die sich ihre Eltern rund um die Uhr liebevoll kümmerten. Die Firma war der ganze Lebensinhalt der beiden. Eine Leidenschaft, die sie teilten und die Anna ratlos und manchmal sogar einsam zurückließ.
Seit einiger Zeit fragte Anna sich, ob ihre Eltern außer ihrer Hingabe an die Firma überhaupt noch etwas anderes teilten. Sie konnte sich nicht erinnern, dass Cläre und Kurt Ehmke jemals eine vertraute Berührung ausgetauscht hätten. Manchmal fragte sie sich, ob das in den Anfängen ihrer Ehe wohl anders gewesen sein mochte. Noch mehr aber interessierte sie, ob ihre eigene Zukunft mit einem Mann auch so sachlich und poesielos enden würde.
In Gedanken versunken, folgte sie den anderen. Gerade spielte das Orchester die letzten Takte von einem Hit, den Anna seit einiger Zeit täglich im Radio hören konnte: »Arrivederci, Roma«. Schon summte sie mit. Ach, sie liebte alles Italienische, seit sie vor vielen Jahren die Schellackplatten ihrer Mutter in der Abseite entdeckt hatte. Cläre Ehmke hatte jede Platte dieses entzückenden Tenors Caruso gekauft, nachdem sie ihn einmal in der Laeiszhalle hatte sehen können. Leider gingen die meisten Platten bei einem Bombenangriff verloren, doch eine Handvoll der schwarzen Scheiben gab es noch.
Auf der Tanzfläche drehten sich bereits einige Paare. Anna ließ den Blick schweifen, auf der Suche nach Elisabeth und Monika, während ihre Mutter ein Stück entfernt mit einem Herrn plauderte, den Anna nicht kannte.
Annas ganzer Körper kribbelte vor Aufregung, denn sie wusste, dass dieser Abend nicht anders als großartig werden würde. Sie wollte tanzen und sich bewundern lassen, so wie jedes Mädchen im Saal.
»Darf ich Ihnen meine Tochter vorstellen?«, hörte sie die Stimme ihres Vaters hinter sich. Anna drehte sich um. Neben Kurt Ehmke stand ein hochgewachsener junger Mann mit vollem dunklem Haar und einem Lächeln wie Dean Martin. Anna schluckte. »Meine Tochter hilft mir in der Firma als Stenotypistin und Sekretärin, obwohl sie sich mit dem Geschäft selbst auch recht gut auskennt«, erklärte Kurt Ehmke. »Das Maschineschreiben hat sie im letzten Jahr gelernt. Sie ist wirklich flott. Ihre Mutter möchte, dass sie studiert, aber Anna konnte sich noch nicht entscheiden, welches Fach sie nehmen möchte. Ihre Schulnoten jedenfalls waren stets bestens. Aber man muss ja nichts überstürzen.«
Überrascht sah Anna ihren Vater an. »Ist das ein Verkaufsgespräch, Papi?«
Der Mann an der Seite ihres Vaters lachte auf. »Ich glaube eher, Ihr Herr Vater ist stolz auf Sie, Fräulein Ehmke.«
Kurt Ehmke lächelte. »Das ist Joost van der Vehlen, Kind. Er kommt aus einer Bremer Kaufmannsfamilie und arbeitete für Lloyd’s in London. Er wird künftig bei uns für den Einkauf in Südamerika zuständig sein und die Termingeschäfte überwachen. Ihr werdet euch also öfter im Kontor sehen.«
»Herr van der Vehlen.« Anna neigte ihr Haupt und reichte ihm die Hand.
»Es ist mir eine Ehre.« Er hauchte einen Kuss auf ihren Handrücken. Fast hätte Anna gelacht. Es kitzelte. »Darf ich Sie zum Tanz bitten?«, fragte er.
Kurz darauf schwebte Anna mit dem wohl attraktivsten Mann des Abends über das Parkett, während die Sängerin des Orchesters gedankenverloren Ganz Paris träumt von der Liebe sang und die Töchter von Senator Luigs vom Rand der Tanzfläche aus Anna mit neidischem Blick beobachteten.
2
»Schläft die Kleine schon?« Irma nahm das Kopftuch ab, hängte ihren schneenassen Mantel an den Garderobenhaken und ging in die kleine Küche, aus der Licht in den dunklen Flur fiel. Seit einem Jahr wohnten sie mit einigen anderen Familien in einem alten Haus am Stadtrand von Magdeburg. Den Weg zur Arbeit legte sie bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zurück. Heute Abend hatte es schon wieder geschneit, sodass sie ihr Rad einen Teil des Weges hatte schieben müssen. Ihre Hände waren eiskalt.
Als sie eintrat, nahm Walter gerade einen Schluck aus einer Bierflasche und stellte sie zurück auf den Tisch vor sich. Kopfschüttelnd ging Irma zum Hängeschrank und holte zwei Gläser heraus. Sie setzte sich zu ihm, nahm die halb leere Flasche und verteilte den Rest des Bockbiers auf die Gläser. »Du bist hier nicht im Betrieb. In meiner Küche trinken wir aus Gläsern.«
»Kannst es nicht lassen, was? Immer dieses vornehme Getue.« Er schob das Glas zur Seite und stand auf, um zur Abseite zu schlurfen, wo weitere Flaschen Diamantbier standen. »Und zu deiner Frage: Ja, unsere Tochter schläft.« Er nahm eine Flasche heraus, setzte sich wieder und öffnete den Bügelverschluss mit einem Plopp. Er setzte die Flasche an und trank.
Sie schwieg, denn sie wusste, wie der Abend enden würde.
Er stellte sein Bier ab. »Wenn du nicht so oft bei den Parteisitzungen wärst, dann wüsstest du, dass Michaela bereits seit drei Stunden im Bett ist.«
Irma schloss die Augen und rieb mit den Fingern ihre Schläfen. »Ich weiß, es ist spät geworden. Aber Genosse Bender hat schon wieder alle Anträge blockiert. Ich glaube, er macht das nur, um mich zu ärgern. Ines hat das auch gesagt.«
Walter hörte nicht zu, starrte nur auf das Etikett der Flasche in seiner Hand. Er arbeitete als Gießereimechaniker im Ernst-Thälmann-Werk, noch, denn er schien den Streit mit dem Werksleiter förmlich zu suchen.
»Ist etwas passiert?«
»Sie haben Klinger befördert.«
»Obersturmbannführer Klinger? Ich dachte, sie hätten ihn vor drei Jahren aus dem Verkehr gezogen?«
Walter zuckte mit den Achseln. »Die alten Nazis sitzen überall im Betrieb, schanzen sich gegenseitig die wichtigen Stellen zu, angefangen beim Werksdirektor, seinen Stellvertretern, den Direktoren, Assistenten und dem Oberbuchhalter bis runter zum Arbeiter. Alles eine Mischpoke.«
»Was redest du für einen Unsinn. Es sind einzelne Männer. So wie du es hinstellst, ist unser Land infiltriert mit alten Nazis. Das stimmt aber nicht! Wir haben sie alle aufs Genaueste geprüft.« Irma zog die Schuhe unter dem Tisch aus. Sie war Schichtleiterin beim VEB Röstfein, wo seit zwei Jahren auch echter Bohnenkaffee geröstet wurde und nicht nur Malzkaffee wie im Krieg. Neun Stunden Arbeit und danach in der Kantine Parteisitzungen zu leiten und die Hahnenkämpfe der Genossen zu schlichten, gaben Irma das Gefühl, sechzig statt dreißig Jahre alt zu sein. Sie scheute keine Arbeit, bestimmt nicht, aber als junge Parteisekretärin und Mutter eines kleinen Mädchens, als Hausfrau und auch als Ehefrau eines stets übel gelaunten und unzufriedenen Mannes, fühlte sie sich manchmal unendlich erschöpft.
»Bei uns haben die Kerle genauso Unterschlupf gefunden wie drüben«, behauptete Walter.
»Quatsch. Drüben läuft alles wie zuvor. Die alten Nazi-Bonzen in ihren alten Funktionen. Nur dass sie es jetzt Demokratie nennen. Wir aber sind dabei, ein ganz neues Land aufzubauen. Gerecht und ehrlich.«
Walter lachte. »Ich bin immer wieder fasziniert, Irma, dass du all das glaubst. Hat man uns nicht schon einmal belogen und den perfekten Staat versprochen?«
Erschöpft erhob sie sich. Sie hatte keine Lust auf die ewig gleiche Diskussion, zumal ihre Vorgesetzten derartige Reden sicherlich nicht gutheißen würden. »Ich gehe ins Bett«, murmelte sie, nahm ihre Schuhe in die Hände und wollte hinausgehen.
»Ich hau ab, Irma. Mache rüber. Vielleicht nach Hamburg.«
Sie fuhr herum. »Wie bitte?«
Walter schaute sie aus glasigen Augen an. »Siggi ist gestern mit seiner Familie auch abgehauen. Ihm ist letzte Woche die Hutschnur gerissen, als die TAN-Leute sagten, wir müssten für diese verdammte Arbeitsplatzanalyse sogar den Weg aufs Häuschen auflisten. Himmel!«, entfuhr es ihm.
Irma schreckte zusammen. »Still! Die Kleine!«
Aber Walter ignorierte sie. »Das sind nicht einmal zwei schäbige Minuten, die wir dann von der Maschine weg sind! Zwei Minuten!«
»Die Technische Arbeitsnorm ist wichtig, Walter. Das weißt du doch. Wir alle müssen schneller und besser werden. Darum sind die Genossen von der TAN-Analyse da und schreiben die Zeiten auf.«
»Unsinn! Das ist Schikane.«
Irma kam zurück in die Küche. Leise schloss sie die Tür hinter sich. Die Wände waren dünn, und ihre Nachbarn hatten gute Ohren. »Was ist passiert?«
Walter presste die Zähne gegeneinander. Sie sah seinen Kiefer mahlen. »Wir haben heute für eine Stunde die Arbeit niedergelegt.«
Irma ließ sich auf den Stuhl fallen. »Warum, Walter? Warum immer du?«
Er schlug mit der Hand auf den Tisch. Die Flasche wankte gefährlich. »Ich bin es leid, strammzustehen und alles mit mir machen zu lassen, was andere wollen. Jede meiner Eingaben wird ignoriert. Sie drehen mir jedes Wort achtmal im Mund herum, als suchten sie nur einen Grund, mich der Stasi zu melden. Wenn sie es nicht schon längst getan haben.« Er funkelte sie an. Sie schwieg. Dann ließ er sich auf den Stuhl zurückfallen. »Irma, komm, lass uns in die Westzone rübergehen. Die bauen ihr Land da drüben genauso auf, wie wir es hier tun.« Er nahm ihre Hand.
Irma zog sie fort. »Ich gehe nicht rüber. Das weißt du. Mein Zuhause ist hier. Da, wo meine Familie ist.«
Walter rollte mit den Augen. »Deine Familie ist nicht nur hier, sondern auch in Hamburg. Mensch, du hast doch die Tante mit der schicken Villa.«
»Das ist nicht meine Familie.«
»Klar doch! Nur weil deine Eltern tot sind, heißt das doch nicht … Irma, bleib hier!«
Irma stand auf. Dieses Gespräch hatten sie schon so oft geführt. Er wollte fort und sie nicht. Ihre Heimat war hier, beim Konsum an der Ecke, bei der Nachbarin, die immer die Wäscheleine für sich in Anspruch nahm, aber herrliches Rübenmus kochen konnte, hier, bei den Gartenfesten mit den anderen vom Kombinat, den nächtlichen Sitzungen in der Kantine und dem Schwätzchen in der Schlange vor den Läden.
Nein, nichts zog Irma zurück nach Hamburg, wo ihre Mutter nach einem Bombenangriff qualvoll zugrunde gegangen und ihr Vater gestorben war, während die neunzehnjährige Tochter voller Angst in einer kleinen Stadt bei Rostock die sowjetischen Besatzer erlebt hatte. Keiner der Familie Behmer hatte je versucht, sie zu finden, als sie in einem Gefangenenlager gesessen hatte und tagein, tagaus für die Soldaten waschen musste. Nein, sie hatte keine Familie mehr. Und von daher bezeichnete sie sich lieber als Kriegswaise.
Sie hatte sich in der neuen DDR ihr eigenes Leben aufgebaut. Nachdem sie vor vier Jahren beim VEB Röstfein angefangen hatte, hatte sie es schnell bis zur PGO geschafft. Als Parteigruppenorganisatorin hörte man auf sie und respektierte sie. Jetzt, da sich eine weitere Parteigruppe im Betrieb gegründet hatte, konnte sie sich sogar Hoffnung auf die Position der Abteilungsparteisekretärin machen. Was könnte der Westen ihr schon bieten, das sie nicht auch hier hatte?
In der Tür blieb Irma stehen. »Warum wehrst du dich so sehr gegen uns, Walter? Du bist intelligent. Mach doch endlich etwas aus dir. Die Partei braucht gute Leute.« Sie hörte selbst, dass ihre Stimme eher resigniert als aufmunternd klang. Und sie wusste, dass ihr Mann mit alldem nichts anfangen konnte. Ihm fehlte das Feuer, der Wille zu beweisen, dass der junge Staat der DDR eine bessere Zukunft bot als jener im kapitalistischen Westen. Dort machte man nach dem Krieg genauso weiter wie vorher. Dabei wusste doch jeder, wohin das geführt hatte! Nein, es war dringend Zeit, dass das Volk selbst die Dinge in die Hand nahm und nicht die da oben. »Wir bauen hier ein Land auf, Walter, in dem jeder Werktätige seine Fähigkeiten zum größten Nutzen für das Volk zur Verfügung stellt.«
Ihr Mann stöhnte auf. »Hör auf, du bist hier nicht auf einer Parteiversammlung.« Dann sah er sie an. »Also, kommst du mit? Du und die Kleine? Wir nehmen unsere Sachen und …«
»Wenn deine Tochter und ich dir so wenig bedeuten, dann solltest du wohl gehen. Es ist mir egal, wohin. Komm nur nicht wieder!« Mit diesen Worten verließ sie die Küche, lief über den Flur zum Schlafzimmer, knallte die Tür hinter sich zu und drehte den Schlüssel um.
3
Es war kurz vor Mitternacht. Ihre Füße schmerzten, aber sie tanzte und tanzte. Gerade spielte das Orchester Stairway To The Stars von Glenn Miller, während sich die Sängerin auf der Bühne in ihrem hautengen Glitzerkleid hin und her wiegte.
Anna stand nahe der Bühne und wartete darauf, dass Herr van der Vehlen ihr noch ein Glas Bowle brachte, als der Saxofonist sich von seinem Stuhl erhob und ein Solo begann. Sie hätte schwören können, dass er sie angelächelt hatte, kurz bevor er das Instrument an seinen Lippen ansetzte.
Als die ersten Töne sie erreichten, lief ein Schauder über ihren Rücken, und Anna schloss die Augen, vergaß, wo sie war. »… Can’t we sail away on a little dream …«
Sie lauschte den Klängen des Saxofons, spürte die kühle Seide ihres Kleides an den Oberschenkeln, hätte schweben können. Jede einzelne Note, die der Fremde auf der Bühne zu ihr schickte, schmiegte sich an ihre Haut und glitt an ihr auf und ab, je nachdem, wie er es wünschte.
Plötzlich wurde ihr Gesicht heiß. Es schickte sich nicht, an einem Ort wie diesem so selbstvergessen zu sein. Schnell öffnete Anna die Augen. Ihr Blick ging zu dem Musiker, der sich wieder setzte. Sie schluckte. Hoffentlich hatte er nicht bemerkt, welch eigentümliche Gefühle er und sein Saxofon in ihr ausgelöst hatten. Wahrscheinlich nicht, denn er sah hoch konzentriert auf seine Noten und wippte im Takt der Musik leicht mit dem Kopf. Annas Pulsschlag beruhigte sich ein wenig.
Sie schaute sich um. Langsam musste Herr van der Vehlen doch mit den Cocktails kommen. Sie beschloss, ein wenig umherzugehen und nach ihm zu suchen.
Ihre Eltern vermutete sie im Restaurant, wo sie mit einflussreichen Leuten plaudern würden, die früher oder später für die Firma von Nutzen sein könnten. Auf der Tanzfläche bemerkte Anna ihre Freundin Monika, die ebenfalls einen Galan für den Abend erhascht hatte, während ihre Schwester Elisabeth mit miesepetrigem Gesicht allein an einem der runden Tische saß und maulte.
Anna wollte hinübergehen, als Elisabeth sie sah und ihr demonstrativ den Rücken zudrehte.
»Na gut, dann eben nicht«, dachte Anna und schlenderte durch die Gästeschar hinüber zum kleinen Festsaal, wo für den Abend das Mitternachtsbüfett aufgebaut worden war. Da dort mehrere monströs große Kristallglasschüsseln mit verschiedenen Bowlen standen, vermutete sie van der Vehlen dort. Doch sie konnte ihn nicht entdecken.
Sie schaute sich das Büfett genauer an. Diener in weißen Jacketts standen auf der anderen Seite, halfen den Gästen, Hummerpasteten und Lachshäppchen, Goudaröllchen auf Schwarzbrottalern und Tomatenkreationen, die dank einiger Mayonnaisetupfer aussahen wie Fliegenpilze, auf ihre Teller zu laden. So mancher Besucher balancierte seine Beute zum Tisch, wo er sich über seinen Waldorfsalat und die Tomatenkörbchen mit den Gewürzgurken hermachte. Fürst-Pückler-Eis und Schwarzwälder Kirschtorte würden dann zum nächsten Gang folgen.
Plötzlich fiel Anna auf, wie hungrig sie war. Unschlüssig begutachtete sie die vielen Speisen. Dann beugte sie sich vor und griff nach einem der prächtigen Partyigel, um sich einen kleinen Spieß mit Käse und einer Weintraube herauszuziehen, als eine andere Hand Gleiches tat. Kurz berührten sich ihre Finger, und ein kleiner Stromschlag ging durch Annas Körper. Sie zuckte zurück und entdeckte neben sich den Musiker, der gerade noch auf der Bühne gestanden hatte.
»Verzeihung.« Er zog seine Hand fort. »Sie zuerst.« Seine Stimme war weich wie Samt.
Anna sah ihn an. Für den Bruchteil eines Augenblicks glaubte sie, er könne ihre Gedanken lesen. Sie spürte, wie ihre Wangen rot wurden. »Nicht so schlimm. Ist ja genug für alle da.«
Mit verschwörerischem Blick kam er näher zu ihr und nickte unauffällig zu einem dicken Herrn nicht weit von ihnen entfernt, der in der Tür stand und eifrig kleine Windbeutel aß, während die Gäste, die rein- oder rauswollten, sich an ihm vorbeidrängen mussten. Um seinen Mund hatte er einen Puderzuckerbart, und auf dem Revers seines Fracks prangte ein Marmeladenfleck.
»Dennoch sollten wir uns beeilen«, raunte er und zwinkerte ihr zu. »Sicher ist sicher.« Schnell häufte er allerlei Leckereien auf den Teller in seiner Hand.
»Dürfen Sie sich denn hier bedienen?«, flüsterte Anna. »Ich meine, es gibt doch hoffentlich für die Musiker hinter der Bühne etwas zu essen.«
Er grinste. »Sie haben mich ertappt. Und ich dachte, mit meinem Frack falle ich am Büfett nicht auf. Ja, für die Musiker steht in einem Hinterzimmer zwischen Besen und Eimern pro Person eine Schrippe mit welligem Gouda zur Verfügung. Alles abgezählt.« Er griff zu den kleinen Kanapees, die er kunstvoll aufstapelte. »Das hier ist übrigens für das Orchester, nicht für mich«, raunte er mit einem kurzen Blick auf die Hotelangestellten in weißen Jacken. »Werden Sie mich verraten, Fräulein?«
Sie schüttelte den Kopf, woraufhin er sie aus blauen Augen so munter anstrahlte wie ein kleiner Junge, dem gerade ein Streich vortrefflich gelungen war.
Anna musterte ihn unauffällig, während er immer mehr Leckereien auf den Teller legte. Er war nicht groß und sicherlich nicht so attraktiv wie Joost, aber er hatte etwas Schelmisches an sich, das ihr gefiel. »Spielen Sie noch andere Instrumente außer Saxofon?«, wollte sie wissen, um das Gespräch nicht so schnell beenden zu müssen.
Er nickte. Der Berg auf seinem Teller hatte mittlerweile eine allzu auffällige Höhe erreicht. Einer der Livrierten kräuselte bereits die Stirn. »Fünf«, antwortete der Musiker. »Mit dem Saxofon aber verdiene ich meinen Unterhalt. Gitarre macht am meisten Spaß. Klavier habe ich studiert, und der Rest ist nicht so wichtig.«
Jetzt kam der Angestellte zu ihnen herüber. Schnell schob Anna ihre neue Bekanntschaft vom Büfett fort. Hinter einer Säule gingen sie in Deckung.
»Wenn Sie möchten, können Sie meinen Teller auch noch mitnehmen«, schlug sie grinsend vor. »Wie heißen Sie eigentlich?«
»Hans Kanther. Musiker.« Er lächelte.
»Anna Ehmke«, erwiderte sie. »Tochter.«
Ein peinliches Schweigen kam auf. Anna mied seinen Blick. Dann aber fingen beide im selben Moment an, irgendetwas zu plappern. Ihre Worte holperten durcheinander.
»Sie zuerst«, sagte er.
»Nein, Sie.« Anna grinste auf ihren Teller hinunter.
»Sind Sie mit Freunden hier?«, wollte er wissen.
»Mit meinen Eltern. Ich nehme an, sie treffen sich gerade mit Geschäftspartnern in der Lobby oder im Restaurant.«
Wie aufs Stichwort trat ihr Vater neben seine Tochter. »Häschen, da bist du ja.« Kurt Ehmke nickte dem jungen Mann zu, nachdem er kurz einen erstaunten Blick auf den überladenen Teller geworfen hatte. »Ich habe dich überall gesucht, Anna. Es ist spät. Wir wollen nach Hause.«
Der Musiker reichte ihm die Hand, wobei er elegant mit der anderen versuchte, den Teller zu halten. »Hans Kanther.«
Kurt Ehmkes Gesichtszüge entspannten sich ein wenig. »Ach, von den Kanthers in Duisburg? Schwerindustrie?«
Hans legte den Kopf etwas schief. »Nein, eher Altona. Mein Vater macht in Geld.«
Kurt Ehmke horchte auf. »Bankiers?«
»Nicht wirklich. Er ist Geldbriefträger.«
Anna konnte ein Lachen gerade noch unterdrücken.
»Verstehe«, erwiderte Kurt Ehmke. »Sie sind einer von der ganz lustigen Sorte.« Er wandte sich Anna zu. »Liebes, geh und suche bitte deine Mutter. Es wird Zeit.« Er warf einen abschätzenden Blick auf sein steifes Bein, und Anna verstand. Er hatte wieder einmal Schmerzen. Als die Briten in der Nacht mit ihren Bombern kamen, hatte Kurt Ehmke Schutzdienst in der Speicherstadt leisten müssen. Vier Tage lag er verletzt unter den Trümmern am Sandtorkai, bevor man ihn fand. Das Bein war nur eines der Probleme, die ihn seither quälten. Schwer stützte er sich auf den Stock.
»Natürlich, Papi, sofort.« Anna drückte Hans ihren Teller in die Hand. »Das ist für das Orchester«, erklärte sie ihrem Vater. Eilig verabschiedete sie sich von dem Musiker und ging, um ihre Mutter zu suchen.
»Ich spiele jeden ersten Samstag im Monat im Barett in den Colonnaden. Saxofon. Immer ab acht«, hörte sie noch Hans’ Stimme hinter sich. »Vielleicht mögen Sie ja mal vorbeikommen.«
»Mal sehen«, rief sie munter zurück und ging mit ihrem Vater in die Lobby, wo sich bereits einige Gäste die Mäntel geben ließen, um den Weg nach Hause anzutreten. Durch die Glastür sah Anna schwarze Autos vorfahren und den livrierten Portier, wie er den Gästen beim Einsteigen half.
»Du wirst hoffentlich nicht in diesen Musikklub gehen, Anna.« Ihr Vater klang eindeutig besorgt.
Sie griente vor sich hin. »Komm doch mit, Papsi.«
»Ich?« Kurt Ehmke schüttelte sich. »Entweder spielt der junge Mann diesen Negerjazz oder diesen grauenvollen Halbstarken-Rock-und-Roll. Das ist beides nichts für mich. Ich bin zu alt für derart wilde Sachen. Kann mich auch gar nicht erinnern, dass wir so etwas früher gehört haben.« Er hielt auf die Garderobe zu. »Ich hole schon mal unsere Mäntel. Such du deine Mutter.«
Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange und eilte los.
Da Anna ihre Mutter weder im Großen Festsaal noch im Blauen Salon finden konnte, machte sie sich zu den hinteren Räumen im Erdgeschoss auf, wo man sich am Rand des Balls zu privateren Geschäftstreffen zurückziehen konnte.
Hinter sich hörte Anna die dumpfen Stimmen aus der Lobby, die schon nach wenigen Schritten, die sie über den tiefen, weichen Teppich in den Flur hineintat, verebbten. Elegante Stille umgab sie. Am Ende des Ganges entdeckte sie eine halb offene Tür. Sie trat näher und hörte Stimmen. Obwohl es unziemlich war, schob sie die Tür ein wenig weiter auf. Vielleicht hatte jemand ihre Mutter gesehen.
Der Raum war dunkel getäfelt. Einige lederne Sessel standen darin. Am Fenster sah Anna zwei Personen. Das Licht der Straßenlampen legte einen weichen Schimmer um die Silhouette der Frau. Dicht vor ihrer Mutter stand ein Mann, von dem Anna meinte, ihn schon einmal gesehen zu haben, doch sein Name wollte ihr nicht einfallen.
»Wann sehe ich dich wieder, Cläre?« Zärtlich streichelte er die Wange von Annas Mutter.
»Ach, Fritz. Es ist alles so kompliziert.«
Entsetzt sah Anna, wie ihre Mutter sich an den Mann schmiegte. Jetzt erkannte sie ihn. Sie hatte ihn nur ein einziges Mal gesehen. Damals hatte er eine britische Uniform getragen.
4
Der Frühling wollte und wollte nicht kommen. Nun war es schon März und draußen noch immer bitterkalt. Cläre zog die Wolljacke enger um ihre Schultern. Sie schob den Stuhl zurück, ging zur Heizung und legte ihre kalten Finger auf das Metall. Obwohl der Regler auf sieben stand, strahlte der Heizkörper nur lauwarm. Der Winter hatte in diesem Jahr äußerst heftig über das Land gefegt. Schlimmer noch als der von ’45. Und er weigerte sich, weiterzuziehen. Und so lag der Garten der Villa Behmer weiterhin unter einer tiefen Schneedecke. Eisblumen hafteten an der Innenseite der Fensterscheiben. Auch heute würde sich der Tag in seinem Grau verlieren.
Cläre beschloss, nach unten zu gehen, um Erna zu bitten, nach der Heizung zu sehen. Erna Klappke war über die Jahre hinweg zu einem Fels in Cläres Leben geworden. Während des Krieges hatte das patente Dienstmädchen mit recht fragwürdigen Methoden Essen für die Familie herbeigeschafft. Darüber hatte Cläre trotz aller Bedenken hinwegsehen können, denn es war damals um nicht weniger als das Überleben gegangen. Ernas Zuverlässigkeit und vor allem ihre Verschwiegenheit machten so manche kleine Unzulänglichkeit problemlos wett. Noch heute war Cläre dankbar, dass Erna Klappke die jüdische Familie Eppstein im Keller der Villa nicht an die Gestapo verraten hatte. Im Gegenteil. Sie hatte den Kohlenkeller für die Eppsteins mit Betten und Tischchen so gemütlich hergerichtet, wie es möglich gewesen war, um sich zu verstecken. Heimlich war Erna mit Essen zu den Eppsteins geschlichen und hatte sogar zum Geburtstag der kleinen Judith einen Kuchen gebacken.
Zudem hatte Erna es immer wieder geschafft, selbst in den schlimmsten Zeiten mit ihren manchmal recht derben Witzen ein Lachen ins Haus zu bringen. Und unter ihrem strengen Regiment wuchsen damals im Gemüsegarten stets genügend Wurzeln und Bohnen, Kartoffeln, Kohl und Kräuter, trug der Kirschbaum knallrote Früchte im Sommer, waren die Johannisbeerzweige im August voll köstlicher Beeren gewesen. Zumindest bis zu der Nacht, als eine britische Bombe die Villa getroffen hatte.
Cläre hatte sich für all die Treue nur schwer erkenntlich zeigen können. Ab und an schenkte sie Erna ein hübsches Tuch oder eine Handtasche aus dem Schrank vom Dachboden. Die vorsichtigen Hinweise an das burschikose Dienstmädchen hinsichtlich eines korrekten Deutschs aber schienen bei Erna noch immer nicht auf fruchtbaren Boden zu fallen. Munter plauderte sie das stadtübliche Plattdeutsch mit einer hartnäckigen Leidenschaft weiter, dass Cläre manchmal befürchtete, die Gelehrsamkeit im Hause ginge eher in die andere Richtung als jene, die sie geplant hatte. So hatte Cläre sich erst kürzlich dabei ertappt, dass ihr ein herzhaftes »Verdoorig ock« herausgerutscht war, als ihr zum zweiten Mal der Stift zu Boden gefallen war.
Seit damals waren nun über zehn Jahre vergangen. Heute leitete Erna in der Villa Behmer die Küche. Sie hatte ein besonderes Händchen für die nahrhaften Hamburger Gerichte und rustikalen Menüs wie Aalsuppe, Labskaus oder Fleischpudding, auch Grütze gelang ihr hervorragend. Wenn aber ein Diner oder eine größere Feierlichkeit anstand, engagierte Cläre doch lieber eine richtige Köchin. Für feinere Speisefolgen fehlten Erna einfach Talent und Fingerspitzengefühl. Anfänglich nahm Erna es übel, doch da sie einem freien Tag nie abgeneigt war, arrangierte sie sich mit den Umständen.
»Erna.« Cläre trat in die Küche im Untergeschoss, um nach der Heizung zu fragen. Überrascht blieb sie in der Tür stehen, als sie nicht nur die Köchin, sondern auch einen großen Mann mit Backenbart am Küchentisch sitzen sah, der ihr unbekannt war. Gerade biss er herzhaft in eine Scheibe Brot mit Mettwurst, als Cläre hereinkam.
Schnell stand er auf. »Gntn Ompfn.«
In der Annahme, dass er sie begrüßt haben könnte, trat Cläre näher. »Ihnen auch einen schönen guten Abend.« Mit fragendem Blick wandte sie sich Erna zu.
»Dat is’ Icke«, erklärte diese eilig.
Der Mann mit dem Namen Icke legte die angebissene Wurstbrotscheibe auf den Teller zurück, wischte die Hand an der Hose ab und reichte Cläre seine Pranke. »Rolf Stammer, mein Name. Also: eijentlich. Aber da, wo ick herkomm, sagen se Icke zu mir. Det is Berlinerisch für ›Ich‹.«
Zögerlich nahm Cläre seine angebotene Hand. »Angenehm, Ehmke.«
»Weeß ick. Hat mir meene kleene Zuckerschnute ja schon beijepuhlt.« Obwohl fast vierzig Jahre alt, giggelte Erna wie ein Backfisch. »Der Icke und ich, wir gehen seit ’n paar Wochen aus.«
Cläre unterdrückte ein Schmunzeln. »Das wusste ich ja gar nicht.« Erna war eine drahtige, sehr agile Person und schon länger auf der Suche nach einem geeigneten Ehemann. Auswahl hatte sie nach dem Krieg jedoch kaum, denn auf hundertsechzig Frauen kamen nur hundert Männer. Und die waren entweder zu alt oder kamen aus dem Krieg als Krüppel zurück.
Aus den Augenwinkeln sah Cläre sich den Herrn genauer an, während sie Erna fragte, warum es so kalt im Haus sei. Er war gut einen halben Kopf größer als Erna und hatte einen stattlichen Bauch. Um seine Augen herum lagen tiefe Lachfalten. Er trug eine grobe Manchesterhose und eine dick gefütterte Öljacke. Der selbst gestrickte Schal um seinen Hals erinnerte Cläre an ein Handarbeitsstück, das sie erst neulich in Ernas Händen gesehen hatte.
»Die Heizung im Salon ist nur lauwarm«, klagte Cläre und überlegte, welchen Beruf der Gast in der Küche wohl haben mochte.
»Da is’ nich’ jenug Dampf uff’m Kessel. Da muss mehr Kohle drunter. Und so janz neu is det Ding ja och nich mehr, oder, jnä’ Frau? Hab dat Schmuckstück erst letzte Woche uffjemöbelt. Dat Ding is noch von anno Tobak, stimmt’s?«
Cläre räusperte sich. »Nun, nach ’45 haben wir die Heizungsanlage wieder herrichten lassen. Und der Kessel … nun ja, der war ja noch in Ordnung.«
»Sehnse! Sach ick doch. Anno Tobak.«
Cläre wollte sich nicht mit ihm über das Baujahr der Heizung unterhalten. Allerdings hatte er recht, die Zentralheizung war tatsächlich schon sehr alt und hätte eigentlich dringend ausgewechselt werden müssen. Was vor siebzig Jahren einmal hochmodern gewesen war, schien heute kaum noch einer reparieren zu können.
Aber nach dem Krieg war nun einmal kein Geld da gewesen. Auch sonst gestaltete sich der Wiederaufbau der Villa nach dem Bombenangriff in jener schrecklichen Nacht eher halbherzig. Der Turm, auf dessen Dach Cläre damals die britischen Bomber beobachtet hatte, wie diese ihre tödliche Fracht über der Stadt abwarfen, war verschwunden. Ebenso der Wintergarten, den ihre Mutter so geliebt hatte. Stattdessen gab es dort jetzt eine Terrasse. Auch der Ballsaal gehörte der Geschichte an, nachdem ein Blindgänger in den letzten Kriegstagen durch das Dach gefallen war und die kuppelartige Stuckdecke und den schönen Intarsienboden zerstört hatte. Dennoch war es irgendwie gelungen, das Haus zu retten.
Aber ihm fehlte jene Eleganz, für die es früher so gelobt worden war. So mancher meinte, die Ehmkes sollten alles abreißen und neu bauen, ganz so, wie es viele andere machten. Doch Cläre konnte sich zu einem solch drastischen Schritt nicht durchringen. Die Freunde wunderten sich schon. So unentschlossen kannte man Cläre und ihren Mann Kurt eigentlich nicht. Und am Geld konnte es doch wohl nicht liegen.
Nein, es lag einzig an Cläre. Seit einiger Zeit sah sie manchmal schemenhaft ihre längst verstorbene Mutter Maria mit einem Buch in der Hand durch den Garten gehen. Dann wieder sah sie sie im Wintergarten unter der Palme im Korbsessel eine Tasse Kaffee trinken, obwohl weder der Wintergarten noch die Palme oder der Sessel noch existierten. Erst gestern glaubte sie, Maria die geschwungene Treppe in die Halle hinunterschweben zu sehen. Das konnte natürlich nicht sein, denn die Patriarchin war bereits vor Jahren auf ihrer Fazenda in Brasilien gestorben. Die ersten Male, als sie sie im Haus oder auch im Garten gesehen hatte, hatte Cläre sich gefragt, ob es jetzt an ihr war, den Verstand zu verlieren. So wie damals ihr Cousin Wilhelm. Dann aber schien es ihr fast natürlich, dass ihre Mutter bei ihr war. Maria Behmers Seele gehörte einfach in dieses Haus. Manchmal allerdings fragte Cläre sich, ob ihr diese Einbildungen etwas sagen wollten. Sie hatte nur noch nicht herausgefunden, was es sein könnte.
»Haben wir genügend Kohle, Erna?«, fragte Cläre, um sich aus ihren schweren Gedanken zu reißen.
Die Köchin schüttelte den Kopf. »Alles alle. Der Händler hett secht, wir schall’n wohl nur die Hälfte bekommen, weil de Kohle sonst nich’ mehr für die anderen reichen tut.«
»Ick hätt da wat vor Ihnen, Frau Ehmke«, mischte sich Icke ein. »Eierkohlen. So een paar Kiepen sind det schon.« Er grinste breit. »Frisch einjetroffen, sozusagen. Liegen noch im Hafen. Muss ick nur herschaffen.« Er sah Cläres fragenden Blick. »’n Kumpel von mir is mia wat schuldig, wenn Se versteh’n, wat ick meene. Ick könnt ja mal nachhorchen.«
»Das ist sehr großzügig, Herr … Icke«, erwiderte sie. »Aber wir warten besser, bis unser Kohlenhändler wieder liefern kann.« Sie hatte das Gefühl, das Brennmaterial könnte auf nicht legale Weise den Weg in den Besitz von Ernas Verehrer gefunden haben. In diesem entsetzlich eisigen Winter ’56 blühte der Schwarzmarkt wie zu Zeiten des Krieges. »Irgendwann muss es ja mal wieder wärmer werden.«
»Wie Se meinen, jnädige Frau. Aber wennse sich dat anders überlejen, wissen Se ja, wen Se fragen könn’.«
»Der Icke«, erklärte Erna eifrig, »der schippert mit sein’ Schiff auf der Elbe bis nach Berlin und zurück.«
Cläre schüttelte sich innerlich noch immer über Ernas Deutsch, doch sie lächelte tapfer. »Danke. Vielleicht komme ich später auf das Angebot zurück.«
Der Mann schob den Rest des Mettwurstbrotes in den Mund. »Ick bin die nächsten Tage mit ’ner Ladung Kaffee Richtung Berlin untaweechs. Det heißt, ick komm erst Sonntag zurück.«
Erna strahlte den großen Schipper aus ihren grauen Augen an, der sich mit einem schnellen Tüschi von ihr verabschiedete, wobei sie seinen Kuss mit einer lustigen Schnute beantwortete.
Als er die Küche verließ, lupfte er seine Hafenmütze. »Schön’ Tach ooch, die Damen«, wünschte er, setzte die Mütze neckisch schief wieder auf seine lockige Haarpracht und verschwand im Flur.
»Der Icke, der is’ ’n ganz Patenten. Der tut nich’ lange fackeln. Der packt an.« Dabei seufzte Erna selig.
Cläre lächelte.
5
Ohne den Blick von den Notizen ihres Vaters zu nehmen, ließ sie ihre Finger über die Tasten der grauen Olivetti Lettera huschen. Natürlich hätte Anna auch die klobige Adler-Schreibmaschine nehmen können, um den Brief an Senator Luigs zu schreiben, aber die hatte sie auf einen kleinen Tisch in der Ecke verbannt, wo das Gerät unter einer Stoffhülle aufbewahrt wurde. Anna bevorzugte die elegante Olivetti, die sie jeden Morgen sorgsam aus dem hellbraunen Reißverschlusskoffer nahm und auf ihren Schreibtisch stellte, um dann das erste weiße Blatt des Tages einzuspannen.
Ihr Vater hatte leise vor sich hin gegrummelt, als sie ihm vor einigen Monaten erklärt hatte, die alte Adler müsse endlich in den Ruhestand gehen. Kurt Ehmkes Argument, die Maschine funktioniere seit über vierzig Jahren tadellos und sei schon länger im Kontor als er, hatte sie mit einem charmanten Lächeln abgetan und ihm dann die todschicke und nur halb so große Olivetti präsentiert.
Anna war die einzige Frau bei Behmer & Ehmke, und sie war die Tochter des Chefs. Da hatte man Freiheiten, die anderen verwehrt blieben. Seit einem Jahr verbrachte sie jeden Tag im Dovenhof und erhielt sogar ein kleines Salär.
Das alte Kontorhaus gegenüber der Speicherstadt hatte den Krieg fast unbeschadet überstanden, und schon bald nach ’45 waren die ersten Firmen wieder eingezogen. Doch Annas Vater war ein Kaufmann und rechnete stets vorsichtig. Und so hatte man statt der hübschen Räume mit Blick auf den Zollkanal und die Speicherstadt vorerst Büros zur Brandstwiete hinaus angemietet, die nicht so teuer waren. Bescheidener als noch vor dem Krieg hatte man sich in der ersten Etage eingerichtet. Zum Kontor gehörten, neben dem Büro des Chefs, natürlich das Vorzimmer, in dem Anna gerade saß und ein Angebot tippte, sowie zwei weitere Räume, von denen einer als Probenlager sowie Verkostungs- und Pausenraum genutzt wurde.
Durch die offene Tür zum letzten Büro hörte Anna Herrn Heinbichel mit dem Makler telefonieren. Wer nicht vom Fach war, verstand kaum ein einziges Wort, das die beiden Männer austauschten. Erwin Heinbichel war Anfang der Fünfzigerjahre kriegsversehrt aus der Gefangenschaft zurückgekehrt. Er hatte nur noch ein Bein und schien ständig unter Schmerzen zu leiden, was ihm eine miesepetrige Ausstrahlung verlieh. Vor dem Krieg war er zweiter Buchhalter bei Lassally gewesen.
»Ich lasse Ihnen die Unterlagen gleich zukommen«, hörte Anna Heinbichel das Gespräch beenden. »Fräulein Ehmke, wären Sie so nett, die Papiere für die Rothfos-Lieferung fertig zu machen. Und sagen Sie dem Jungen, er solle alles rüber zum Hauptzollamt bringen«, rief er durch die offene Tür.
Anna wusste, dass der Mann nichts von dem Fernschreiber hielt, der sich im selben Raum befand wie er. Am liebsten hätte er die Papiere mit der Rohrpost hinüber in die Speicherstadt geschickt, von der Anna als Kind fasziniert gewesen war. Woher nur, so hatte sie sich damals gefragt, wussten die kleinen Metallbomben, die mit einem Zisch im Rohr verschwanden und bald darauf in irgendeinem Kontor auf der anderen Seite des Zollkanals wiederauftauchten, wohin sie reisen sollten?
Zu Heinbichels Bedauern hatte diese technische Errungenschaft aus Kaiserzeiten den Krieg nicht unbeschadet überlebt. Und seit es Fernschreiber und Telefone in den Kontoren gab, hatte diese Einrichtung auch ihren letzten Reiz für so manchen Kaufmann verloren.
Jetzt zog Anna die fertig geschriebenen Seiten, zwischen denen sich eine Lage Kohlepapier befand, aus der Olivetti und stand auf.
Sie hatte den ganzen Morgen nicht mehr an ihre Mutter und den Fremden am Fenster denken müssen, doch plötzlich schoss ihr das Bild der beiden wieder durch den Kopf. Sofort spürte sie, wie ihr Herz vor Wut zu rasen begann. Ganz so, wie letzte Nacht, als sie nicht hatte schlafen können. Die Vertrautheit ihrer Mutter mit diesem Mann hatte Anna geschmerzt, denn Derartiges hatte sie niemals zwischen ihren Eltern gesehen. Die ganze Nacht hatte sie mit sich gerungen, ob sie ihren Vater informieren oder ihre Mutter zur Rede stellen solle. Doch etwas ließ sie zögern, denn sie kannte beide nur zu gut. Kurt und Cläre Ehmke waren in Gefühlsdingen stets sachlich und konsequent. Anna konnte sich nicht daran erinnern, dass es je anders gewesen war. Ob ihr Vater von dem Mann wusste? Seit wann betrog ihre Mutter ihn? Anna wurde schwindelig. Energisch schob Anna den Gedanken aus ihrem Kopf.
Eines war für sie klar: Ihre eigene Ehe würde später voll Leidenschaft sein. Nicht so kalt. Und Ehrlichkeit sollte ihre künftige Ehe krönen. Niemals die Lüge.
»Ich kann die Papiere rüberbringen, Herr Heinbichel«, rief Anna nach nebenan, während sie den Durchschlag der beiden Seiten lochte und ihn in einem schwarzen Aktenordner abheftete.
»Das kann doch der Wolfgang machen«, rief Herr Heinbichel zurück. Wolfgang war der Lehrjunge im Kontor und mit seinen siebzehn Jahren ein echtes Früchtchen.
»Ich mache es aber gerne. Bei der Gelegenheit kann ich auch gleich die Proben bei Rothfos abholen.«
Wieder sah sie im Geiste ihre Mutter zärtlich den Kopf in die Hand des Fremden legen. Wie konnte sie nur!
Anna wusste, dass sie so schnell wie möglich an die Luft musste, sonst würde sie mitten im Kontor vor Wut platzen. Schnell klappte sie die schwarze Unterschriftenmappe auf und legte das eben getippte Original hinein, damit ihr Vater es nach seiner Rückkehr von den Feierlichkeiten in der neuen Kaffeebörse unterschreiben konnte. Bisher war er nicht ins Kontor zurückgekehrt, und Anna war froh darüber, denn sie wusste einfach nicht, ob sie ihm von dem Vorfall im Hotel erzählen sollte oder doch lieber schweigen.
Sie trat ins Nebenzimmer. Dort saß Buchhalter Heinbichel hinter seinem Schreibtisch und setzte gerade mit einem lauten Knall einen Stempel auf ein Schreiben. »Also, soll ich?«
»Ach, Fräulein Ehmke, geben Sie es zu: Sie wollen nur gucken, wie die neue Kaffeebörse aussieht.« Er hängte den Stempel wieder an seinen Platz im Gestell. Milde lächelte der rotgesichtige Mann die Tochter des Chefs an.
»Sie haben mich ertappt, Herr Heinbichel«, lachte Anna. »Wenn die Herren vom Kaffeeverein nicht so schrecklich altmodisch wären, hätten sie mich an der Eröffnungsfeier im Saal teilnehmen lassen.«
»Aber Fräulein Ehmke, Sie wissen doch, wie’s ist. Kaffeehandel und Frauen, das geht nun einmal nicht zusammen.«
»Jaja, ich weiß, die Tradition.« Anna nahm ihren Mantel vom Haken hinter der Tür. »Manchmal aber scheint es mir, als hätten die werten Herren Kaffeehändler in Wahrheit nur Angst vor uns Frauen.«
Ein Lachen hinter ihr ließ Anna zusammenschrecken. Joost van der Vehlen stand im Türrahmen zum Probenraum und warf den Kopf nach hinten. »Angst? Aber liebes Fräulein Ehmke, wie könnte ein Mann vor dem schwachen Geschlecht Angst haben?« Er kam näher und half ihr galant in den Mantel. »Nein, es ist nicht Angst, sondern die Pflicht des Mannes, die Angebetete vor so etwas Profanem wie Geschäften zu schützen.« Er deutete eine Verbeugung an und lächelte breit. »Es ist seit jeher unsere vornehmste Aufgabe, den Damen ein sorgloses Leben mit allen Annehmlichkeiten zu bieten. Keine Sorgenfalte soll je ihr Gesicht trüben.« Er öffnete für Anna die Tür zum Gang hinaus. »Und dafür revanchiert sich das schöne Geschlecht mit Eleganz und Liebreiz.«
Anna legte den Kopf schief. »Hm, haben Sie das in einem verstaubten Ritterroman gelesen, wo der Held die schöne Prinzessin rettet?«
Er schmunzelte. »Nein, ich bin nur ein Mann der guten alten Schule. Aber jetzt, da Sie es sagen: Wollen nicht alle Frauen von einem mutigen Ritter gerettet werden?«
Anna kicherte. »Die meisten wohl schon.«
»Und Sie?«
Bevor Anna wusste, was sie darauf antworten sollte, hörte sie ein Räuspern. »Fräulein Ehmke, Sie sollten sich beeilen«, meinte Heinbichel.
»Natürlich. Ich bin schon unterwegs«, rief sie über Joosts Schulter. Der grinste sie verschwörerisch an. Anna eilte aus dem Kontor, die Galerie entlang, hinüber zum Treppenhaus. Vielleicht würde der Neue ja ein wenig Schwung in das altehrwürdige Kontor bringen. Nur mit Buchhalter Heinbichel, ihrem Vater und Wolfgang, dem Lehrjungen, waren die Tage im Büro oftmals eintönig und unendlich lang.
Hätte jemand sie gefragt, sie hätte gestanden, dass ihr die Arbeit im Kontor alles andere als Freude bereitete. Doch ihre Mutter bestand darauf, dass Anna im Familienunternehmen arbeitete, wenn sie schon nichts Ordentliches studieren wolle. Ordentlich waren für Cläre Ehmke die Fächer Recht und Wirtschaft. Annas künstlerische Neigungen hingegen bezeichnete sie als brotlos und lehnte daher ein Studium an der Kunsthochschule rigoros ab. Nach vielen Tränen hatte Anna sich irgendwann der Unvermeidlichkeit gefügt und ihre Arbeit als Stenotypistin im elterlichen Betrieb aufgenommen. Der Musik und dem Zeichnen konnte sie sich ja noch immer in ihren freien Stunden widmen.
Und so arbeitete sie sechs Tage die Woche ab sieben Uhr in der Frühe im Kontor und sehnte den Feierabend herbei. Manchmal, wenn sie Glück hatte, bot sich die Gelegenheit zu einer kleinen Flucht, so wie heute. Und dieses Entkommen schien ihr gerade an diesem Tag besonders wichtig. Sie musste unbedingt ihre Gedanken sortieren.
Anna lief die breite Marmortreppe hinunter. Im Erdgeschoss angekommen, eilte sie am Paternoster vorbei, der wie eh und je seinen Dienst tat. Als Kind war sie stundenlang damit auf- und abgefahren.
In der Pförtnerloge saß der alte Herr Meiners, ein runzeliges Urgestein, das bestimmt schon zur Einweihung des Dovenhofs vor siebzig Jahren dort gesessen hatte.
»Nanu, schon Feierabend, Fräulein Ehmke?«, wollte er wissen.
»Dringende Erledigungen, Herr Meiners«, rief Anna und eilte hinaus auf die Straße.
Dort brach gerade die Sonne durch eine schwere Wolkendecke, die seit Tagen über der Stadt zu hängen schien. Geblendet blieb Anna für einen Moment stehen und schloss die Augen. Endlich Sonne. Sogleich meinte sie, Wärme auf ihrer Haut spüren zu können. Sie roch den Atem des Hafens, den rauchigen Ruß, der sich aus den Schornsteinen unzähliger Barkassen schob, welche sich tagein, tagaus wie Ameisen auf der Elbe tummelten. Die salzige Würze der von der See hereinkommenden Flut lag in der Luft. Anna hörte das Wummern der Presslufthämmer bei Blohm & Voss. In die derben Rufe der Schutenführer im Zollkanal hinein knatterten die Autos vor dem Dovenhof. Jemand ging an ihr vorbei. Sie hörte einen Stock auf den Fußweg klacken, erschnupperte einen leichten Zigarrengeruch, in den sich ein wenig 4711 mischte.
Noch immer hielt sie die Augen geschlossen. Sie brauchte ihr Hamburg nicht zu sehen. Sie konnte es riechen und schmecken. Das Hupen eines Autos ließ sie zusammenschrecken.
Sie riss die Augen auf. Im selben Moment verschwand die Sonne wieder hinter den dicken Wolken am Himmel. Anna knöpfte ihren Mantel zu. Sie fror.
6
»… In guter alter Tradition, ungeachtet der schweren Zeiten, die hinter uns liegen, tritt der Kaffeehandel in dieser Stadt … treten wir als hanseatische Kaufleute in die Zukunft ein …«
Senator Luigs’ Rede schien endlos zu sein.
Durch das Bleiglasfenster hinter ihm fielen bunte Sonnenstrahlen in den neuen Saal der Kaffeeterminbörse am Pickhuben. Das große Fenster zeigte die leuchtend roten Kaffeekirschen an Sträuchern und beim Trocknen in der heißen südamerikanischen Sonne. Es berichtete von der Arbeit auf den Plantagen und mahnte jeden der Gäste an diesem kalten Märztag 1956, niemals zu vergessen, wo der wahre Ursprung des Reichtums so manches Herrn im Saal lag.
Mit überschwänglichen Worten versuchten die Redner, die vergangenen Tage des großartigen Hamburger Kaffeehandels heraufzubeschwören. Wie viele im Saal, so hoffte auch Kurt Ehmke, die Zeiten vor dem ersten großen Krieg mögen zurückkehren. Doch die Welt hatte sich unwiederbringlich verändert.
Kurt saß in der dritten Reihe. Sein Bein schmerzte heute noch mehr als üblich. Unauffällig rieb er den Oberschenkel, versuchte, den Fuß zu strecken, der nicht minder wehtat, ohne dabei seinen Stock zu Boden zu schubsen. Er war knapp sechzig, doch heute fühlte er sich wieder einmal, als hätte er die hundert Jahre längst überschritten.
»Schmerzen?«, raunte Behrens, der neben ihm saß. Er war ebenso alt wie Kurt, doch noch immer Juniorchef im väterlichen Kontor. Dies würde wohl auch noch eine Weile so bleiben, denn der alte Behrens erfreute sich mit Ende achtzig noch immer bester Gesundheit und dachte nicht im Geringsten daran, seinem längst erwachsenen Sohn endlich das Ruder zu überlassen. Der junge Behrens teilte das Schicksal vieler Männer in der Speicherstadt, die über die Jahre alt und älter wurden, aber weiterhin am Gängelband der Väter hingen.
Kurt jedoch hätte einem Sohn nur zu gerne die Firma überlassen, denn mit jedem neuen Jahr merkte er, wie seine Kräfte nachließen. Als er damals beim Angriff der britischen Bomber im Keller von Block R verschüttet worden war, hatte er bereits mit dem Leben abgeschlossen. Erst Tage später hatten sie ihn aus den Trümmern gezogen. Aber ein Teil von ihm war dort unten in der Dunkelheit geblieben.
Endlich klatschten die Herren, und Senator Luigs löste sich vom Pult, um dem Vorsitzenden des Vereins der am Caffeehandel betheiligten Firmen Platz zu machen. Der Kaffeeverein oder auch th-Verein, wie ihn seine Mitglieder wegen der alten Schreibweise liebevoll nannten, wollte mit dem Neubau der Kaffeeterminbörse am Pickhuben, gleich hinter dem Sandtorkai, Hamburg wieder zum bedeutendsten Umschlagplatz für Rohkaffee weltweit machen. Ganz so, wie es früher einmal gewesen war. Doch seit der Kaiser vor über vierzig Jahren Europa in die erste Katastrophe manövriert hatte, war der Hamburger Kaffeehandel von Jahr zu Jahr mehr ins Trudeln geraten. Ob das noch zu richten war, wusste keiner.
Früher war der traditionelle Hamburger Kaffeehandel ein über Jahrzehnte hinweg erprobtes, gut geöltes Uhrwerk gewesen, bestehend aus unzähligen kleinen und großen Rädern, die stets zum Wohle des Ganzen und des Einzelnen effizient ineinandergegriffen hatten. Die Rohkaffeehändler, die Ursprungsländer des Kaffees, Makler, Zwischenhändler, Röster, Quartiersleute … sie alle hatten ihren Platz im Gefüge gekannt. Man hatte noch Ehre, und ein Handschlag zählte mehr als Verträge. Doch Kriege, Willkür und ideologieübergreifende Inkompetenz ruinierten alles, und der Hamburger Kaffeehandel verlor den Anschluss an die Welt. Jetzt hatten andere Länder den Rohkaffeehandel in ihren Händen, und in Amsterdam, London und New York wurden heute all jene Geschäfte gemacht, die früher über die Kontore am Sandtorkai liefen.
Ein schickes und modernes Börsengebäude zwischen die hohen Speicher zu quetschen, würde kaum reichen, um Hamburg zu altem Ruhm zu verhelfen. Das war Kurts Meinung. Dass er damit nicht alleinstand, konnte jeder sehen, der sich heute im neuen Saal der Kaffeebörse genauer umschaute. Nicht alle Plätze in den Reihen waren besetzt, und auf der Rednerliste standen nicht einmal der Name des Bürgermeisters oder eines bedeutenden Vertreters aus den Anbauländern, dem Ursprung.
Unauffällig blickte Kurt die Reihen entlang. Viele alte und neue Gesichter schauten geduldig zum Redner hinauf. Darunter eine erkleckliche Zahl von Männern, die bis ’45 SS-Uniformen getragen hatten und bei Reichsstatthalter Karl Kaufmann im Budge-Palais an der Alster ein und aus gegangen waren. Wie diese strammen Nazis es geschafft hatten, sich aus der Verantwortung zu stehlen, war Kurt bis heute ein Rätsel.
Vor allem jener Herr, der in der ersten Reihe neben Senator Luigs saß, weckte Kurts Interesse. Unter dem maßgefertigten Jackett konnte Kurt breite Schultern erahnen. Die früher kurz geschorenen blonden Haare waren nun grau und ausgedünnt. Selbst von hier hinten meinte Kurt, die bullige Selbstgefälligkeit des Herrn Obersturmbannführers Herbert Staller spüren zu können. Jener Mann, der Cläre hatte verhaften lassen. Jener Mann, dessen zweite Haut Lüge hieß.
Kurts Blutdruck stieg.
Aber Staller war auch jener Mann, dem er es verdankte, heute mit Cläre verheiratet zu sein. Stallers damaliges Kalkül, dank Cläre die Firma und einen Platz in der Hamburger Gesellschaft zu bekommen, war gescheitert. Ein gieriger Emporkömmling wie Staller aber ließ sich von einem Rückschlag nicht aus der Bahn bringen. Als er seine Niederlage erkannte, verlegte er seine Ambitionen auf die NSDAP. Dort stieg er bis in den inneren Kreis von Karl Kaufmann auf und galt in Berlin bereits als aufgehender Stern um Göring und Hitler. Die Niederlage Deutschlands machte ihm einen weiteren Strich durch die Rechnung, und Staller verschwand für einige Jahre. Kurt hatte geglaubt, er hätte sich wie so manch anderer Nazi nach Südamerika abgesetzt, doch er hatte sich offensichtlich geirrt. Denn Staller saß dort vorn, gleich in der ersten Reihe.
Kurt beugte sich zu Behrens. Die Schmerzen im Bein hatte er vergessen. »Was macht denn der hier?«, raunte er, und sein Kinn wies zu Staller.
Behrens zuckte kurz mit den Achseln. »Geschäfte, nehme ich an.«
»Er ist wieder im Kaffeehandel?« Ungläubig lugte Kurt zu Staller hinüber, der sich gerade zum Senator beugte und leise mit ihm sprach.
Behrens rückte ein wenig dichter an Kurt heran. »Na ja, wenn es stimmt, was ich gehört habe, war er seit ’45 nie wirklich draußen. Es heißt, er hätte Kaffee geschmuggelt. Erst über die grüne Grenze bei Aachen, mit gepanzerten Wagen und allem Pipapo. Dann soll er in Bergen-Belsen mit den Displaced Persons Geschäfte gemacht haben und gleichzeitig den GIs ihre Kaffeeration gegen alles Mögliche eingetauscht haben. Auch gegen Frauen, wenn du verstehst, was ich meine. Den Kaffee verkaufte er dann auf dem Schwarzmarkt mit Gewinn. Jetzt ist der Hund reich.«
Der Grund für den regen Kaffeeschmuggel der Nachkriegsjahre war die exorbitant hohe Steuer, die das Parlament in Bonn – wieder einmal diese Politiker – ohne nachzudenken in zweiter Lesung durchgewinkt hatte. Zehn Mark Steuer auf ein Kilo gerösteten Kaffee, der im Verkauf fünfunddreißig Mark kostete! Da mussten ja kriminelle Subjekte ihre Chancen sehen, zumal der Kaffee in Belgien oder den Niederlanden erheblich billiger war. Viele, die rechnen konnten, machten sich auf den Weg, das schwarze Gold zu schmuggeln. Da wurden Hunde mit Taschen auf dem Rücken über die Grenzen geschickt, Kinderwagen präpariert und die Rucksäcke ganzer Wandergesellschaften befüllt.
Erst als gut organisierte Verbrecher auf der Bühne erschienen, die mit gepanzerten Wagen und Maschinengewehren ihre Fracht lastwagenweise transportierten, rüstete der Zoll mit speziell ausgestatteten Sportwagen und Stacheldraht auf.
Die ehrlichen Kaffeehändler im Land indes mussten um ihre Existenz fürchten, denn sie blieben auf dem ehrlichen, aber teuren Kaffee sitzen, den keiner haben wollte. Fast zu spät wurde die Kaffeesteuer auf drei Mark gesenkt, und der Schmuggel kam zum Erliegen.
Und jetzt war Staller wieder in der Stadt. Was der Kerl wohl nun vorhat?, überlegte Kurt gerade, als Applaus ihn aus seinen Gedanken riss.
»Bleiben Sie noch, Ehmke?«, fragte Behrens. »Dass Sie die Barkassenfahrt mitmachen werden, nehme ich ja nicht an.« Er grinste. »So richtig ins Zeug gelegt hat sich der Vorstand mit dem Programm ja nicht gerade.«
Kurt nickte. »Wem sagen Sie das, aber man muss eben der Zeit Rechnung tragen. Solange nur wenige Mitglieder im Verein sind, ist es vernünftig, sich in Bescheidenheit zu üben.«
»Ach, die Mitglieder werden in Scharen herbeiströmen, wenn unsere neue Börse erst wieder lohnende Geschäfte verspricht. Passabel ist das Gebäude ja.«
»Für meinen Geschmack etwas zu modern«, widersprach Kurt. Sie reihten sich in die Menge ein, die Richtung Foyer strebte, wo man sich drängte, um ein Lachsschnittchen zu ergattern.
Eigentlich hatte Kurt sich baldigst verabschieden wollen, weil er im Kontor gebraucht wurde, aber Wolter drückte ihm ein kühles Bier in die Hand. »Die hätten auch Kaffee gehabt«, meinte er und nahm einen Schluck, »ich dachte mir aber, dass bei der trockenen Politikerluft da drinnen etwas Nasses und Kühles angemessener wäre.«
Sie prosteten sich zu. Einer der Einkäufer von Darboven trat zu ihnen. »Moin, Ehmke. Wann erwarten Sie die Santa Catarina mit dem Santos? Ich hörte etwas von Superior und einem guten Preis.«
Schon waren die Herren in ihrem Metier. Während sie über CIF-Preise und Versicherungsprämien plauderten, beobachtete Kurt unauffällig Herbert Staller, der sich angeregt unterhielt. Offenbar hatte der Kerl keine Hemmungen, in jene Stadt zurückzukehren, wo man nur zu gut um seine braune Vergangenheit wusste. Er schien sich sicher zu fühlen.
»Sie kennen Herbert Staller?«, wollte Behrens wissen, der gerade mit zwei Gläsern Bier zurückkam.
»Flüchtig«, log Kurt. »Er scheint hier noch immer eine Menge Freunde zu haben.«
Behrens lachte. »Freunde? Na ja, wenn man es so nennen will. Dem Staller gehört die Im- und Exportfirma Globaltrans. Die wollen ihren Hauptsitz von Münster nach Hamburg verlegen, meinte jemand.« Sie schauten zu Staller und dem Staatsrat. »Da ergeben sich Freundschaften von ganz allein.«
Man würde also von nun an damit rechnen müssen, Herbert Staller öfter in der Stadt zu sehen. Das gefiel Kurt absolut nicht.
»Ach! Sieh mal, wer da hereinschneit!«, rief Behrens aus. »Das werte Fräulein Tochter.«
Kurt drehte sich um und sah Anna, wie sie elegant an den Herren im Foyer vorbeischlüpfte. Ihr roter Mantel leuchtete im Grauschwarz der anwesenden Kaffeehändler wie ein Versprechen auf sonnige Tage.
»Hallo, Papilein!«, rief sie munter und nickte in die Runde. »Ich hatte gehofft, dass der Festakt schon vorbei ist und du mit mir ins Kontor zurückgehen möchtest. Ich war gerade in der Gegend.«
Kurt wollte noch ein wenig bleiben und sein Bier austrinken, da er sich so etwas vor dem Mittagessen eher selten gönnte, als ihm die wohlwollenden Blicke einiger Herren im Foyer zu Anna hinüber auffielen. Mit Anfang zwanzig war sie ein wirklich hübsches Ding, aber der Gedanke …
»Du hast recht, Kind. Man erwartet uns sicherlich schon.« Er stellte das Glas ab, nahm sie am Arm und verabschiedete sich rasch. Dann schob er sie zur Tür. »Du weißt, dass ich es nicht mag, wenn du hierherkommst, Anna.« Er griff nach seinem Wintermantel am Garderobenhaken, während Anna mit schmalem Mund wartete. »Regnet es?«, fragte er, als er seinen Hut aufsetzte.
»Nein, ausnahmsweise nicht.« Sie reichte ihm seinen Stock und hielt die Glastür auf, als jemand hinter ihnen herkam.
»Na, das muss doch das Fräulein Anna sein.« Mit großen Schritten und ausgestreckter Hand lief Herbert Staller auf Anna zu. Ganz automatisch nahm Kurts Tochter die ihr dargebotene Hand. Fragend sah sie zu ihrem Vater.
»Das ist Herbert Staller«, stellte Kurt die beiden einander knapp vor. »Er lebte früher in Hamburg.« Er drehte sich zu Staller, der einen schweren Schurwollmantel mit Pelzkragen trug. »Und jetzt ist er zurück.«
»Sie scheinen nicht erfreut darüber zu sein, lieber Kurt.«
»Bleiben wir beim Sie, Herr Staller«, presste Kurt hervor und wollte schon gehen.
»Vergangenes ist vergangen, Herr Ehmke. Wir sollten in die Zukunft blicken. Ich werde übrigens mit meiner Frau und unseren beiden Söhnen Uwe und Wolfgang nach Hamburg zurückkehren. Freut Sie das nicht?«, hörte Kurt die Stimme von Staller hinter sich, als er die Stufen zur Straße hinunterging, wobei er sich am kalten Metallgeländer festhalten musste.