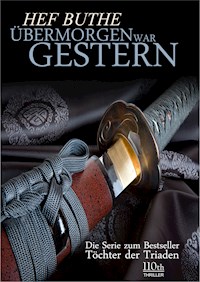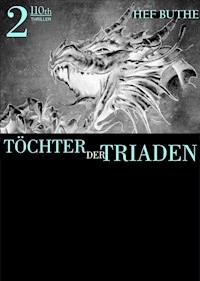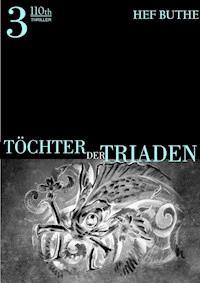Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 110th
- Kategorie: Krimi
- Serie: Töchter der Triaden
- Sprache: Deutsch
Der junge Jurist Perkin ist Spross einer angesehenen Anwaltsfamilie in Singapur. Nach dem Unfalltod seines Vaters muss er dessen Kanzlei übernehmen und erfährt, mit welchem Klientel dieser reich wurde ... eine mächtige Triade, die asiatische MAFIA. Zu spät für Perkin, um weitere Aufträge der "Ehrenwerten Gesellschaft" abzulehnen. Diese beharrt darauf, dass Perkin die Zusammenarbeit so fortführt, wie es mit seinem Vater abgemacht war. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, werden zwei Morde konstruiert, die Perkin als Täter in der Öffentlichkeit darstellen. Perkin hat keine Chance, seine Unschuld zu beweisen. Auf der Fahrt zum Haftrichter wird er von einer anderen Triade entführt, was ihm die lokale Justiz als Flucht und Schuldeingeständnis auslegt... Es beginnt für ihn eine Odyssee in den Fängen zweier rivalisierender Triaden, die beide Perkin brauchen, um die Lizenzen für das Spielerparadies Macau zu bekommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Töchter der Triaden
Teil 1
Kidnapped
Asien-Trilogie
Impressum:
Cover: Karsten Sturm, Chichili Agency
Foto: fotolia.de
© 110th / Chichili Agency 2014
EPUB ISBN 978-3-95865-026-8
MOBI ISBN 978-3-95865-027-5
Urheberrechtshinweis:
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur „Chichili Agency“ reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
VORWORT
Guten Tag!
Schön, dass Sie sie sich für die „Töchter der Triaden“ interessieren. Aber, ich muss Sie warnen. Bevor ich Sie mit meiner Geschichte enttäusche, sage ich Ihnen gleich, was Sie erwartet: Eine für Sie womöglich völlig fremde Welt der Superreichen, Mord, Korruption, Menschenhandel, Glücksspiel, Macht, Gier und ... die chinesische Mafia, auch als Triaden bekannt.
Ach, kennen Sie alles aus dem Fernsehen? Ich glaube nicht. Ich bin einer aus dieser Welt. Na ja, wenigstens ein kleiner Mosaikstein im großen Spiel. Ich sage „bin“, weil ich noch lebe. Ist das ein Widerspruch? Für mich nicht. Man verlässt die ehrenwerte Gesellschaft der Triaden nur durch den Tod. Aber ich rede und schreibe darüber. Wie lange noch? Ich habe keine Ahnung. Wenn Sie nächstes Jahr kein Buch mehr von mir kaufen können, wissen Sie, was passiert ist.
Oh, ich bin unhöflich. Darf ich mich vorstellen? Perkin, Elmar. In Asien kommt der Familienname immer zuerst. Ich bin Erbe eines beachtlichen Vermögens meiner Eltern. Mein Vater war Chinese, meine Mutter deutsch-russischer Abstammung. Beide wurden im chinesischen Boxeraufstand 1900 durch meine Großeltern gezeugt, die ihrerseits nicht unterschiedlicher sein konnten. Aber das ist eine Geschichte für sich. Nehmen Sie es einfach so, wie ich es nehmen musste. Meine Eltern ließen mich mehrsprachig aufwachsen und schickten mich auf die besten Universitäten Europas, um Jura und Wirtschaftswissenschaft zu studieren.
Erst nach dem Tod meiner Eltern, der an sich schon ein seltsamer war und nie richtig aufgeklärt wurde, musste ich schnell lernen, womit mein Vater sein Geld gemacht hatte. Er war juristisch-wirtschaftlicher Berater einer Triade, die versucht gegen einen anderen Clan den wirtschaftlichen Bereich der jetzt sogenannten kleinen Tigerstaaten, Hongkong, Singapur, Malaysia und Indonesien zu verteidigen.
Ach ja, bevor ich etwas vergesse, ich habe außer dem Vermögen meines Vaters noch etwas geerbt ... das Erbe heißt Lu Hong und ist weiblich. Aber nicht verwandt oder verschwägert mit mir. Sie kann einem ganz schön auf die Nerven gehen.
Was ist? Sie haben mich nicht zurückgelegt? Dann folgen Sie mir bitte in die Hölle. Aber auf eigene Gefahr ... und führen Sie sich vor Augen, dass Sie nie mehr sehen, hören, fühlen und schmecken als ich. Sie als Leser, Leserin sind jetzt ich!
Meine Welt in Asien:
Singapur, Hongkong, Macau und irgendwo in Südchina.
Beginn der Handlung: 13. Oktober 1998 in Singapur.
Ocean Building, 40. Stock, im Bankenviertel mit einem guten Blick auf den alten Hafen und Harry’s Bar. Zahlen und Fakten in Singapur … bezogen auf die einheimische Bevölkerung (nicht auf Hilfspersonal im Service von Hotels und Verwaltung).
Das durchschnittliche Jahreseinkommen beträgt 150.000 Dollar. Eine 50-qm-Wohnung kostet ca. 500.000 Dollar beim Kauf oder ca. 4.000 Dollar Miete pro Monat.
Ein VW-Golf neu (gebrauchte Wagen werden nicht gehandelt und dürfen auch nicht eingeführt werden) kostet in Vollausstattung 120.000 Dollar plus ca. 20.000 Dollar pro Jahr für einen virtuellen Parkplatz.
Der Steuersatz ist mit maximal 30% für Unternehmer recht gering. Dafür sind die Nebenkosten entsprechend hoch. Eine technische Produktion lohnt sich also nicht. Geld wird am Finanzmarkt oder sonstigen Dienstleistungen wie Handel etc. verdient. Die Kriminalitätsrate beträgt 0,01%.
Singapur ist offiziell eine parlamentarische Demokratie. Real ein sozialistisch-demokratischer Polizei-Überwachungsstaat.
Die Amtssprachen sind Tamil, Malaiisch, Chinesisch und Englisch.
Ocean Building, Bankenviertel, Singapur
„Perkin, du hast Besuch“, schreckte mich Lu aus meinen Gedanken, die weit draußen über dem in der Abendsonne glitzernden Meer schwebten. „Urlaubsreif“, war die einzige Erkenntnis, die sie daraus zogen. Ja, das war ich wirklich. So konnte das nicht weiter gehen. Lu gab sich als meine rechte Hand jede Mühe die Arbeit zu bewältigen. Es wurde auch ihr zu viel. Das war ihr deutlich anzusehen. Sie wurde immer magerer und ich durch meine berufsbedingten Reisen immer fetter. Ich will heute niemand mehr sehen. Mach du auch Schluss und kümmere dich um zwei zusätzliche Leute, die uns bei der Arbeit helfen können. So kann das nicht weiter gehen.“
Lu zog kurz die Schultern hoch und die Stirn in Falten. „Wenn du das mal endlich einsiehst? Ich habe zwei Studienkolleginnen, die brennend gerne für uns arbeiten würden ...“, sie setzte sich auf die Kante meines Schreibtisches und rieb sich den linken Schenkel. „Aber den Mann habe ich schon zweimal abgewiesen. Er kennt dich und du kennst ihn. Ich weiß nicht, ob der sich das noch lange gefallen lässt. Er macht nicht den Eindruck, als verstünde er Spaß.“
„Wenn du deinen Studienkolleginnen vertraust, dann stell sie ein“, überging ich die unterschwellige Drohung mit dem möglichen Mandanten, von dem ich wusste, wer er war. Groß, hager, immer schwarz gekleidet mit einer Narbe im Gesicht, die nicht durch ein ausgerutschtes Rasiermesser kam. Der Monat stimmte, der Tag auch. 13.10. Sie hatten es mir vorausgesagt und hielten sich sklavisch an ihre Drohungen. „Und ja, frage mal bei Helen in Köln nach, wie weit sie mit dem Fall der Donnerflug ist. Kannst du mich nachher im Harry‘s auflesen? Sonst nehme ich ein Taxi.“
Lu schüttelte ihre braune Mähne und verkniff die Lippen. Warum diese bildhübsche Frau, mit der ich fast wie eine Schwester aufgewachsen war, keinen Mann fand? Lag es an ihrer Gehbehinderung, die ihr mein Vater im betrunkenen Zustand in Chinatown mit dem Auto beigebracht hatte? Oder lag es an ihrem verbissenen Willen und ihrer überlegenen Intelligenz allem Männlichen gegenüber? Oder war eines die Konsequenz des anderen? Ich war in zwanzig Jahren nicht dahinter gekommen, oder wollte es auch nicht. Lu war ein Bestandteil meines Lebens. So wie eine Schwester eben zur Familie gehört. Nur, woher sie wirklich kam, das wusste nur mein Vater, und der hatte niemals etwas über ihre Herkunft verlauten lassen. Und so hatte ich als Sohn auch nie gefragt. Lu hatte eine Wohnung im Haus. Aber meist nutzte sie diese nicht und tauchte nur zur Arbeit auf, um abends wieder zu verschwinden.
„Du weißt genau, wer dieser Mann ist. Warum kneifst du schon wieder. Empfange ihn und hör dir an, was er zu sagen hat. Du kannst nicht bei der ehrenwerten Gesellschaft der Grünen Drachen aussteigen, wie es dir passt. Dein Vermögen beruht schließlich darauf, dass deine Familie zu ihnen gehört.“
Ich reagierte nicht und sah in den Hafen hinunter.
Sie winkte wütend ab und hinkte aus dem Zimmer. „Dickschädel, verfluchter! Du bist wie dein Vater. Nein, will ich nicht, mache ich nicht, passt mir nicht. Es ist jetzt Zeit für den Club und basta. Bäh, sage ich jetzt auch einmal. Geh in deine beschissene Bar, in der sich genau solche Pfauen wie du Abend für Abend treffen, um sich noch größer zu machen, als sie jemals werden können. Sieh zu, wie du nach Hause kommst. Ich habe noch etwas vor. Und denk dran, du hast um 20.00 Uhr Gäste. Wenn du zu spät kommst, erschlägt dich Ti Wu mit der dicksten Pfanne, die sie findet ... und Helen wird ihr dabei noch Beifall klatschen, wie ich sie kenne.“
Das saß und verletzte, obwohl sie mal wieder nicht ganz unrecht hatte. Aber ich musste aus diesem Kreislauf von Pflicht gegenüber einer Triade, nach dem Recht eine ungesetzmäßige Interessengruppe, herauskommen. Mit Lu und Helen in Köln hatte ich mir eine weniger gefährliche Klientel aufgebaut, dessen Interessen ich als Einheimischer mit gutem Namen vertrat. Das war nicht ganz so einträglich, reichte aber um meinen Standard zu halten. Aber die Taipane der Triaden, diese Giftnattern, vergaßen nicht. Sie ließen mich nur in Ruhe, wenn ich so devot wie mein Vater wurde. Und genau das war ich nicht.
„Also nicht!“, knurrte ich. „Dann rufe ich eben ein Taxi. Weiber, blöde. Und warum sagst du mir nicht, dass Helen hier ist?“
„Weil du ein Arschloch bist - darum!“, kam es zurück.
Na gut, dann war ich eben eins. Wir waren beide gereizt und urlaubsreif. Die letzen Monate hatten uns mit Aufträgen und Terminen überhäuft, die mich wirklich zu einer Umorganisation meines Büros zwangen. Außerdem hatte sich die Finanzbehörde auf mich eingeschossen. Das Vermögen meines Vaters war von ihm zu niedrig angegeben worden und der Staat hatte sich eine rechnerische Nachforderung von nahezu 10 Millionen Dollar ausgedacht. Zahlbar übermorgen.
Wenn Helen ohne Vorwarnung von Köln hierher kam, dann stank etwas mit unserem Auftrag in Deutschland. „Na ja.“ Ich schloss mein Büro ab. „Wenn eine Fliege stirbt, kommen tausend zur Beerdigung.“ Oder hatte noch ein Erbstück meines Vaters recht? Ein kleiner buddhistischer Mönch namens Cho Li, der sagte: „Ein Scheißhaufen wird nicht dadurch besser, wenn ihn eine Million Fliegen zum Fressen finden. Aber, das ist alles eine Geschmacksfrage.“
Im Lift stieg ein Mann zu, dessen schwarze Uniform ihn als Mitglied des Sicherheitsdienstes auswies, der für das Ocean Building mit seinen 60 Stockwerken zuständig war. Hier arbeiteten fast fünftausend Menschen, die es zu koordinieren, kontrollieren und zu schützen galt. Ich hatte ihn noch nie gesehen.
„Sind Sie neu hier? Ich kenne Sie nicht“, fragte mein an sich zuverlässiges Misstrauen. „Ja Sir, ich meine Mr. Perkin. Ich mache mich gerade mit den Örtlichkeiten vertraut, Sir.“
Der Mann gefiel mir. Er hatte Benehmen und drängte sich nicht auf. „Haben Sie auch einen Namen?“
Der Mann deutete auf den Kragenspiegel, auf dem silberne Ziffern prangten. „Nummer 1310, Sir. Wenn Sie mehr über mich wissen wollen, fragen Sie bitte in der Verwaltung nach. Reine Sicherheitsmaßnahmen ... Sie verstehen, Sir?“ Damit verließ er den Lift in der zehnten Etage.
Harry’s Bar, Boat Quai, alter Hafen, Singapur
Harry’s war eine Institution, die auf dem Film Casablanca basierte. Nur trafen sich hier kaum Gestrandete, was die Preise nicht zuließen. Hier traf man sich aus der Geschäftswelt der nahe gelegenen Börse und prahlte über Erfolge. Misserfolge gab es nicht. Jeder übertrumpfte jeden mit seinen Tagespekulationen. Und, die Bar hatte einen unbezahlbaren Vorteil: hier durfte noch geraucht werden.
Wie Jean, eigentlich ein Belgier und Inhaber, das bewerkstelligt hatte, verriet er niemandem. Seine füllige Frau Babette führte die Küche und wohl auch Jean, der sich selbst gerne mal der beste Gast war. Beide waren vor etwa zwanzig Jahren hier hergekommen und hatten aus einer Seemannsspelunke ein „In-Lokal“ gemacht, das einfach zum Bild vom alten Singapur gehörte. Und noch jemand war da, auf den ich heute gerne verzichtet hätte. James Cheer.
Jean stellte unaufgefordert ein kleines Gedeck an meinen Platz an der Bar und verdrehte die Augen in Richtung James.
„Der sucht wieder einen, den er anpumpen kann. Diesmal ein ganz dickes Geschäft. Garantiert fünfundzwanzig Prozent Gewinn im halben Jahr. Der wird nie schlau.“ Jean schüttelte den Kopf. „Warum den noch niemand erschlagen hat, ist mir ein Rätsel. Irgendetwas mache ich hier falsch.“ Er zwirbelte seinen schwarzen Schnauzbart und prostete mir so zu, dass Babette ihn nicht sah.
Die Bar füllte sich mit den Schlipsträgern. Es war Börsenschluss und in wenigen Minuten kein Stehplatz mehr zu bekommen. Ich nannte es das Ritual der Lemminge, das in ziemlich genau sechzig Minuten vorüber sein würde. Dann warteten die Ehepartner und/oder Taxis, um die Fuhre nach Hause zu karren. Der Weg war dann frei für die niedrigen Angestellten, die billigere Getränke bestellten, an denen sie sie sich länger festhielten. Aber, das kannte und mochte ich. Hier war ich unter Lebenden mit meinen Gedanken allein, die versuchten aus meiner Schädeldecke ein Schiebedach zu machen. Die Menge ließ mich fühlen, dass ich noch ein Mensch und noch kein Roboter war, den irgendwer programmierte und nur das Ergebnis gegen den Anschaffungspreis hochrechnete. Irgendwie lief zurzeit bei mir alles schief. Es war, als mache jemand Treibjagd auf mich. Aber wer? Es gab verschiedene Möglichkeiten, die sich alle verdammt viel Zeit ließen, mich vor eine endgültige Forderung zu stellen.
Dass das Erbe meines Vaters kein Zuckerlecken sein würde, hatte ich geahnt. Aber dass es derartige Konsequenzen nach sich zog, davon war ich nicht ausgegangen.
„Perkin ...“, quiekte James Cheer und quetschte sich durch die Menge.
Ich legte das Geld auf den Tresen und versuchte, den Ausgang zu erreichen.
James war schneller. „He, du wirst mir doch nicht abhauen. Komm ich gebe noch einen aus, Jean!“
James war ein Windhund und ständig voller Ideen, wie er reich werden konnte. Ein mittelgroßer Ire, mit feuerrotem Schopf, einer blassen, fast weißen Haut, die eine Million Sommersprossen gnädig übertünchten. Aber schlimm war an ihm, außer seiner permanenten Selbstüberschätzung, seine kastratenhafte Quiekstimme, die einem das Knochenmark gefrieren ließ.
„Ich habe kein Geld und auch keine Nerven für deine Geschäfte“, versuchte ich eine Abwehr. Es war sinnlos. James hatte sich wieder etwas in den Kopf gesetzt und quiekte weiter drauf los. „Weiß ich doch, alter Kumpel. Das pfeift ja schon die Presse von den Dächern, dass dich das Finanzamt am Arsch hat.“ Er pulte in der Nase und besah sich das Ergebnis. „Ich will doch kein Geld von dir. Ganz im Gegenteil. Ich bezahle dich.“
Das war in mehr als zwanzig Jahren das erste Mal, dass mich James bezahlen wollte. Das stank bereits zum Himmel und war bestimmt wieder einer seiner Tricks, die sich gut anhörten, aber im Nachhinein so viele Fallen enthielten, in die er gerne andere laufen ließ.
„Na schön“, prostete ich ihm zu. „Du hast noch 45.000 Dollar Schulden vom letzten Geschäft bei mir. Ich nehme es gerne bar. Du weißt, das Finanzamt liest mit.“
James lachte wie eine Krähe und wedelte mit den Händen wie ein Teppichhändler, dem das Loch im neuen Afghanen erst bei der Reklamation des Kunden aufgefallen war. „Du weißt doch, dass Spekulationen mal schief gehen können. Nimm es nicht so ernst. Es war ein Versuch und du wärst nicht darauf eingestiegen, wenn du nicht ein Perkin wärst, die schon immer eine Vorliebe für riskante Geschäfte hatten. Sonst wäre dein Vater nicht so reich geworden. Oder leugnest du das ab?“
Nein, das abzuleugnen war sinnlos. Mein Vater war spielsüchtig gewesen. Er gönnte sich einen freien Tag im Monat, um nach Macau zu fliegen und die Spielcasinos auf der Insel unsicher zu machen. Wenn er zurückkehrte, vergrub sich Mutter im Gewächshaus und wartete seine Laune ab. Hatte er gewonnen, half er Mutter bei der Blumenpflege, gab ihr ein Klaps auf den Hintern und ein sündhaft teures Schmuckstück.
Bei Verlust vergrub er sich tagelang im Büro und drangsalierte das Personal bis zur Weißglut. Allerdings kamen dabei die genialsten Ideen zustande, um den Verlust möglichst schnell wieder auszugleichen. Er hasste es, zu verlieren. Das war aber auch alles, was ich von seinem Charakter geerbt hatte. Glücksspiele jeder Art waren mir zuwider. Das war nicht berechenbar und ich überließ ungern dem Zufall etwas.
James quiekte ohne Unterlass weiter auf mich ein. Ich nahm sein Gerede nur beiläufig wahr. Es ging um eine Ladung „gefundener“ ROLEX Uhren, die er weit unter Preis verkaufen könne. Mein Anteil daran sollte zweihunderttausend sein, wenn ich noch mal fünfzigtausend vorschoss. Es war wieder eines seiner windigen Geschäfte, bei dem ich nicht mehr im Traum daran dachte, mich zu beteiligen. Dafür kreisten meine Gedanken um Helen. Warum hatte sie ihre Ankunft nicht angemeldet, was nicht ihrer sonst üblichen Zuverlässigkeit entsprach? Das fühlte sich nach schlechten, sehr schlechten Nachrichten an.
„Jean, bestell mir ein Taxi“, unterbrach ich den Wirt bei einem Gespräch. Der sah kurz zum Fenster hinaus und schüttelte den Kopf. „Nicht nötig. Es wartet schon jemand auf dich.“
James hatte die bessere Beobachtungsposition und zog sich in die plaudernde Menge zurück. „Na, dann verabschiede ich mich besser. Aber wir sprechen uns noch.“
Ein flüchtiger Blick über die Schulter ließ in mir noch mehr Fragen aufkommen, als mich ohnehin schon quälten.
Helen liebte große Auftritte. Die Männer im Raum hielten für einen Moment den Mund, um gleich darauf über sie zu tuscheln. Sie würdigte keinen der Anwesenden eines Blickes, rauschte auf mich zu und hauchte mir einen Kuss auf den Mund.
„Jean, eine Cola bitte.“ Sie blickte sich suchend um.
Ein junger Börsianer bot ihr seinen Barhocker an und konnte sich nicht von ihr losreißen. Es war sinnlos, sie zu fragen, woher sie wusste, dass ich hier war. Lu hatte mal wieder gequatscht.
„Du hast eine neue Frisur. Wo sind deine Locken geblieben?“ Ich bestellte mir einen Whiskey. „Warum meldest du dich nicht an, und was ist mit dem Auftrag wegen der Donnerflug Firma?“
Helen ließ das goldene Feuerzeug klicken und sog den Rauch der Zigarette tief ein. Sie war wirklich das, was „Mann“ als Schönheit bezeichnete. Groß, schlank, blond, blaue Augen, schmale lange Finger, die sehr zärtlich sein konnten. Aber eine Smaragdotter war auch schön und doch sehr gefährlich. „Oh, oh. Mister Perkin ist übelster Laune. Aber da hat mich Lu schon vorgewarnt“, lächelte sie und schlug die langen Beine übereinander. „Du hast eine Gesellschaft in drei Stunden. Vergiss das nicht. Und über den geschäftlichen Mist reden wir morgen. Einverstanden?“ Sie gab mir einen Kuss und lächelte.
James Cheer hatte sich in eine Ecke zurückgezogen und kaute an den Fingernägeln, wie er es immer tat, wenn er etwas ausheckte, und ließ uns nicht aus den Augen. Er sah auf seine teure Uhr, die sein Heiligtum war ... und verschwand, als verpasse er einen Termin.
„Was willst du hier so überraschend? Wochen höre ich nichts von dir. Dr. Habibi nervt. Er will wissen, was mit dem Auftrag ist. Haben ihn die Deutschen betrogen oder nicht?“
Helen rollte die Augen. „Dass du eine derartig schlechte Laune hast, hat mir Lu allerdings nicht gesagt. Also gut ... fangen wir noch einmal an.“ Sie stand auf und verließ die Bar, um wieder hereinzukommen.
Die Männer verstummten, als erwarteten sie einen handfesten Krach zwischen ihr und mir.
„Guten Abend, Mister Perkin. Schön, Sie nach so langer Zeit einmal wieder zu sehen. Wie gefällt Ihnen meine neue Frisur? Ist sie nicht etwas zu kurz geraten? Ich finde, sie steht mir so, wie sie ist. Was meint ihr, Männer?“ Sie schwang sich auf die Bar und prostituierte sich wie ein Modell. Die Anwesenden jaulten vor Freude. Mir war nur noch danach ein Mauseloch zu finden. Jean klatsche einen Cha-Cha-Cha Takt und alle folgten. „Jean, jeder bekommt ein Freigetränk!“, jubelte Helen und schwang ihre weiße Kostümjacke wie ein Torero das rote Tuch. Die Männer johlten, der Takt wurde immer schneller, fordernder. Bevor er in „Ausziehen“ mündete, stieg Helen von der Bar und befahl Jean mit einer wirschen Handbewegung, mit dem Klatschen aufzuhören.
„So Männer“, Helen stemmte sich die Fäuste in die Hüfte. „Jetzt ist Schluss mit lustig. Das war mein Einstand in eine Männergesellschaft. Ihr findet mich als Partnerin der Anwaltskanzlei Perkin im Ocean Building. Und es würde doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir euch nicht aus jedem Scheiß, den ihr baut, beruflich bauen müsst, raushauen. Gute Nacht, Jungs!“
„Hast du noch alle Tassen im Schrank?“ Ich kauerte mich auf den Beifahrersitz meines weißen Porsche Cabrio.
Helen nickte und schmunzelte. „Ja. Und die wackeln nicht so bedenklich, wie bei dir.“ Sie bog in die City.
„Wir haben hier Linksverkehr. Verdammt noch mal!“ Ich fiel ihr ins Lenkrad, bevor wir zu Geisterfahrern wurden.
„Ups. Daran muss ich mich erst wieder gewöhnen“, sie schüttelte den Kopf. „Steckst du mir eine Zigarette an?“
„Nein. Beim Fahren wird nicht geraucht. Es ist hinderlich für deine Konzentration. Außerdem wird in meinen Wagen überhaupt nicht geraucht“, maulte ich. Von wegen nicht alle Tassen im Schrank. Ihren Auftritt bei Harry´s würde sie mir noch erklären müssen, wie einiges der Klärung bedurfte. „Du sollst dich links halten“, brüllte ich und krampfte mich in den Rahmen der Frontscheibe. Der Bus hupte und donnerte gerade noch an uns vorbei.
„Du gehst jetzt sofort auf den Bukit Tima Expressway. Da ist wenigsten kein Gegenverkehr mehr.“ Ich ließ mich schwitzend in den Sitz fallen. Es war ein Wunder oder ihre Frechheit, dass sie es überhaupt von meinem Anwesen bis in die Innenstadt geschafft hatte, ohne den Wagen zu Schrott zu fahren.
„Sklaventreiber“, kam es zurück„Nein, ich bin nur kein Selbstmörder, noch nicht.“ Ich steckte ihr eine Zigarette an. „Das nächste Mal bittest du den Fahrer, dich in die Stadt zu bringen. Dazu ist er da. Meine Wagen sind mir zu wertvoll, um von dir als Kampfmittel im Gegenverkehr benutzt zu werden.“
Perkins Anwesen, Singapur
Mein zu Hause? Das war ein weiteres Objekt, das mir mein Vater hinterlassen hatte, und das zu nichts nutze war als reichlich Geld zu verschlingen. Hunderttausend Quadratmeter, die der Alte sich durch irgendwelche Tricks verschafft hatte, bevor die ganze Umgebung zum Naturschutzgebiet erklärt werden konnte.
Ein Herrenhaus im Kolonialstil mit Säulen vor dem Haupteingang, die eine Terrasse trugen. Zum Haus gehörten vierzig Zimmer, eine Garage für einen Fuhrpark, ein Gesindehaus für die Bediensteten und ein Gewächshaus, das in jeden botanischen Garten passen würde. Mutter hatte darauf bestanden, dass die Familie hier ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen konnte, um von Zulieferungen unabhängig zu sein. Das war ihr wirkliches Reich gewesen. Nicht die Welt da draußen. Ich hatte diesen riesigen Glaskasten seit ihrem Tod nicht mehr betreten. Obst und Gemüse brachte der Lieferant. Um den Rest kümmerte sich die Haushälterin und Köchin Ti Wu und das andere Faktotum, der buddhistische Mönch Cho Li, der im Gewächshaus wohnte und dort seine Heilkräuter züchtete, die er an chinesische Apotheken lieferte.
Woher beide kamen, wusste ich nicht. Sie waren schon immer da und gehörten einfach zur Familie. Sie waren aber auch die Einzigen, die mich mit meinem Vornamen Elmar ansprachen. Alle anderen beließen es bei Perkin und dem Du. Vielleicht wurde noch ein halbfreundliches „Mister“ vorangesetzt. Ein weniger unsensibler Mensch mit Autoritätsproblemen hätte sich das verbeten. Mir gefiel es, wie es war. Damit hoffte ich, eine menschlichere Ebene als mein Vater zu erreichen. Und, wie es aussah, klappte das ganz gut. Wir aßen zu den Mahlzeiten alle zusammen, plauderten und bei Festen waren alle eingebunden, wenn auch nur als Bedienstete. Eine gewisse Distanz musste bleiben.
Bevor der Fahrer Helen aus dem Porsche half, umrundete er misstrauisch den Wagen und zog erst sein freundlichstes Gesicht auf, nachdem er keinen Kratzer gefunden hatte. Mein kleiner Fahrzeugpark war sein Lebensinhalt. Ein Schaden an einem der Fahrzeuge raubte ihm den Schlaf. Das war, als habe er selbst eine schwere Verletzung erlitten und er schmollte so lange, bis dieser Makel behoben war. Einen seiner Wagen selbst fahren zu wollen, bedeutete so viel wie einen Nagel in eine uralte Eiche schlagen zu wollen. Nur bei einem Fahrzeug war er unerbittlich: einem Rolls-Royce Phantom V aus dem Jahr 1960. Dessen Zündschlüssel gab er nicht aus der Hand. Es war der gleiche Rolls, den die Queen für offizielle Auftritte nutzte. Mir war das Ding zu groß und unhandlich.
Die Sonne war untergegangen. Die Zikaden spielten im Park auf. Es versprach, ein ruhiger Abend zu werden.
Ti Wu hackte Kräuter in der Küche und fluchte. Es roch verführerisch. „Irgendwer hat mir mein Lieblingsmesser entwendet. Du warst es nicht zufällig?“
Ich schüttelte den Kopf. Ich wusste nicht einmal, wo sie ihre Messer in dieser Riesenküche von mehr als 50 Quadratmetern aufbewahrte. Auf dieser Fläche bereiteten Köche eines 200 Betten Hotels vom Frühstück bis zum Dinner alles vor.
„Die Klinge ist die schärfste der asiatischen Schmiedekunst und etwa dreißig Zentimeter lang. Damit kann ich alles machen. Fleisch, Fisch, Gemüse ...“, missmutig schüttelte sie den Kopf. „Das war bestimmt einer der Gärtner. Wenn ich den erwische, rasiere ich ihn damit.“
„Hat hier jemand eine Ahnung, wer heute eingeladen ist?“, lenkte ich auf das eigentliche Thema, nahm mir ein Bier und setzte mich zu ihr. Sie war eine kleine dralle Frau mit flinken Fingern und ewig lustig blinzelnden Augen.
„Soweit ich von Lu weiß, ist es eine Gruppe von sechs Bürgern, die für die Erhaltung und Renovierung von Chinatown bei den Unternehmen sammeln“, hackte sie weiter.
„Aha, sammeln.“ Ich schob missmutig das Kinn vor. „Dafür, dass ich zahlen soll, müssen wir die auch noch verpflegen? Nicht mit mir. Das soll mal schön Helen übernehmen. Ich habe noch zu tun.“
Ti Wu schüttelte den Kopf mit ihrem vom Alter gegerbten Gesicht. „Manchmal kommt immer noch dein Vater bei dir durch. Sag´ das Helen bitte selbst. Ich habe Gäste zum Essen, mehr nicht.“
Bei meinem Abgang murmelte sie noch etwas, das sich wie „wird mal Zeit, dass hier eine vernünftige Frau ins Haus kommt“ anhörte.
Auf der Treppe zu meinen Zimmern fing mich der Mönch Cho Li ab. „Elmar, darf ich dich einen Moment sprechen?“ Er steckte seine vom Wühlen in den Beeten verschmutzten Hände in die orangene Kutte. „Wir haben ein Problem. Würdest du bitte mit ins Gewächshaus kommen.“
Der Mönch hatte, seit ich ihn bewusst kannte, nie Probleme. Im Gegenteil. Er war immer der, der sie mit Witz und Weisheit so lange verkleinerte, bis der eigentliche Kern zutage trat. Alle hatten immer erleichtert gelacht und den ganzen möglichen Rattenschwanz, den sie sich selbst dazu gedichtet hatten, beiseite geworfen. Nur heute schien seine Weisheit ein Ende zu haben. Seine Aura von Ruhe und Zuversicht war einer Unruhe gewichen, die er mühsam zu unterdrücken suchte.
Das Gewächshaus war wirklich das, was man als Haus bezeichnen konnte. Zehn Meter hoch und fünfzig Meter lang. Wenn es richtig bewirtschaftet würde, könnte man von hier viele Märkte Singapurs beliefern. Aber der größte Teil war verwildert, bis auf einen kleinen Teil, den Cho Li bearbeitete. In seinem kleinen Acker hatte er eine eigene Hütte gebaut.
In einer Voliere zwitscherten und sangen Dutzende von Ziervögeln um die Wette.
„Warum lässt du die armen Tiere nicht mal frei? Vögel einzusperren ist doch kein Leben im Sinne deines Glaubens.“
Cho Li zog die grauen Augenbrauen in die kahle Stirn, als zweifle er an meinem Verstand. „Weil sie nicht wissen, dass sie Vögel sind und mir und sich viel Geld einbringen. Sie sind alles Seelen Verstorbener und fühlen sich wohl so.“
„Aha. Und wie macht man mit den fliegenden Seelen Geld? Wolltest du mir nicht etwas anderes zeigen?“
Der Mönch hob kurz die Schultern. „Du hast zuerst nach den Vögeln gefragt. Also werde ich dir das auch zuerst beantworten. Das „Andere“ kann nicht mehr weglaufen.“ Er öffnete den Käfig und ließ die Tür auf.
„Suche dir einen Vogel aus, den du freilassen willst“, deutete er in die Runde. „Es ist völlig egal, welchen. Ob nach Schönheit, Farbe oder Größe.“ Der Mönch steckte die Hände bis zu den Ellenbogen zurück in seine Kutte und wartete.
Wie zum Teufel sollte ich mich hier für einen Vogel entscheiden, wenn mir der Sinn nicht klar wurde? „Ich nehme den“, deutete ich auf einen im Neonlicht bläulich schwarz schimmernden Vogel, der etwas abseits der anderen saß.
Cho Li nickte. „Das ist eine gute Wahl. Er ist ein Sonderling wie du und dein Vater. Stell dir also vor, du lässt die Seele deines Vaters frei.“ Er spitzte die Lippen und trillerte eine kleine Melodie. Der Vogel horchte, putzte sich kurz das Gefieder und flatterte dem Mönch auf die Schulter. Der nahm ihn in die Hand und kraulte das Tier sanft am Bauch und hinter dem Kopf. „Jetzt gibst du mir zwanzig Dollar! So, dass es der Vogel sieht.“
Ich rollte den Schein und steckte ihn dem Mönch hinter das Ohr. Der nickte. „Gut, jetzt nimmst du ihn in beide Hände. Aber sei sanft, nicht dass du der Seele wehtust, und blase in sein Gefieder.“
Ich tat wie geheißen. Der Vogel fühlte sich gut an und sträubte sich nicht, als wolle er meine Handflächen als sein zukünftiges Nest adoptieren.
„Jetzt blase von hinten unter das Gefieder“, murmelte Cho Li mit ruhiger Stimme. Der Vogel hob ab und schraubte sich unter das Glasdach, bis er eine Öffnung gefunden hatte und verschwand in der Dunkelheit.
„Fühlst du dich jetzt gut, einer Seele die Freiheit zurückgegeben zu haben?“
Ich wusste es nicht, da ich mich nicht erinnern konnte, jemals einen Vogel in der Hand gehabt zu haben. Der Vogel hatte einen Vorteil, er konnte selbst bestimmen wann und wohin er flog, wenn man ihn ließ.
Der Mönch grinste verschmitzt und schloss die Voliere. „So, jetzt zu dem Anderen. Das ist ärgerlich für uns alle und besonders für mich. Schau dir das an!“ Er schob die Blätter einer Bananenstaude zur Seite. „Der liegt ausgerechnet in meinem gerade wachsenden Petersilienbeet. Der muss da weg, sonst zerdrückt er mir alle Jungpflanzen.“
Es war der junge Mann vom Sicherheitsdienst mit der Nummer 1310 am Kragen, der mir im Lift begegnet war.
„Er ist noch keine zwei Stunden tot. Erstochen, aber nicht hier, und man hat ihm die Zunge herausgeschnitten. Sagt dir das etwas?“, kommentierte der Mönch die Leiche.
„Wie, zum Teufel, und warum kommt die Leiche hierher?“, grollte ich. „Ich kenne den Mann nicht.“
„Aber das Zeichen der abgeschnittenen Zunge kennst du? Das Woher ist damit schon geklärt. Das Wie ist nicht wichtig. Wenn SIE das so wollen, tun sie es auch und ..“, er kratzte sich an seinem kahl rasierten Kopf, „... und somit bleibt nur die Frage, warum man eine dir völlig fremde Leiche aufs Gelände praktiziert.“
Es rauschte leicht und der von mir freigelassene Vogel landete auf Chao Lees Schulter. Der grinste. „Begreifst du jetzt, wie man damit auf dem Wochenmarkt Geld verdient? Ich kann die Vögel an hundert Touristen mit einer kleinen Geschichte verkaufen und hundertmal kommen sie zurück. Alle ... es sind liebe Seelen, und nur ich verstehe sie. Nicht ich habe ihnen das beigebracht, sondern sie mir. Ich habe ihre Sprache gelernt.“
„Ja, ich habe schon begriffen. Du bist ein alter Gauner.“ Ich durchsuchte die Taschen des Wachmannes. „Sag mir lieber, wo wir ihn verschwinden lassen können, oder soll ich den Vorfall der Polizei melden?“
Der Mönch überlegte und kraulte den Vogel. „Du wirst mit den Steuerschulden deines Vaters schon genug durch die Presse geschmiert. Nein, nein. Da kannst du dir eine Leiche nicht auch noch leisten. Du verlierst dein Gesicht, wenn das bekannt wird, dass dieser Tote das Warnzeichen, die abgeschnittene Zunge, der Grünen Drachen trägt. Geh du dich um die Gesellschaft kümmern. Ich werde den Kerl schon aus meinem Petersilienbeet verschwinden lassen.“
Cho Li meinte es ernst und zog eine Schubkarre hinzu. „Wenn du mir eben aufladen hilfst ... um den Rest kümmere ich mich.“
Mein Handy knurrte in der Tasche.
„Mister Perkin?“, meldete sich eine männliche Stimme. „Hier ist der Sicherheitsdienst vom Ocean Building. Können Sie bitte sofort in Ihrem Büro vorbeikommen. Bei Ihnen ist eingebrochen worden, und wir wissen nicht, ob es nötig ist die Polizei zu alarmieren.“ Die Stimme klang, als unterdrückte sie ein Lachen. „In Anwaltsbüros lagern manchmal sensible Daten. Da rufen wir nicht gerne sofort die Polizei ... wenn Sie verstehen.“
„Wie ist ihr Name?“
„Sir, Sie wissen doch, dass wir Nummern tragen. Das ist Vorschrift.“
„Ja, ja, ich weiß“, brach ich weitere Erklärungen über Sicherheitsbestimmungen ab. „Also, Ihre Nummer bitte. Ich komme sofort.“
„1310, Sir. Fragen Sie bitte nach mir.“ Das Gespräch brach ab.
1310? Der lag doch im Petersilienbeet. „Den hatte man aber schnell neu besetzt“, grübelte ich und half dem Mönch, den Körper in die Schubkarre zu wuchten.
Zehn Minuten später stürmte ich in die Küche. „Wo ist Helen? Ich muss sofort ins Büro. Sie muss die Gäste übernehmen.“
Ti Wu rührte weiter Teig und sah an mir hinab. „Der Teig muss fünfzehn Minuten gerührt werden, sonst wird das nichts. Und Helen wird wie üblich den ganzen Abend entweder im Bad verbringen oder über ihrer Zulassung morgen als Rechtsanwältin in Singapur brüten. Die kannst du vergessen. Und dich lasse ich so auch nicht gehen. Wie siehst du überhaupt aus? Voller Vogelscheiße. So gehst du mir nicht aus dem Haus. Warst du etwa beim Mönch und in seiner Firma, der Voliere?“
Bevor ich nur den geringsten Gedanken daran verschwenden konnte, nur die Jacke zu wechseln, holte sie mit dem Rührlöffel voll Teig aus. Sie betrachtete das Ergebnis zufrieden und rührte lächelnd weiter. „Habe ich dich überredet? Als Geschäftsmann geht man nicht wie ein Schwein in die Stadt.“
Mit einer, wie im Tennis, perfekten Rückhand hatte sie mich von den Haaren bis zu den Schuhen mit Teig bekleckert. Da half nur eine Grundreinigung, die Zeit kostete.
„Na schön“, grollte ich. „Dafür überredest du Helen, die Gesellschaft zu empfangen und sag dem Fahrer Bescheid. In fünfzehn Minuten hat er vor der Tür zu stehen. Egal mit welchem Wagen. Ob gewaschen oder nicht.“ Ich hielt inne. „Habe ich das richtig verstanden? Helen hat eine Zulassung hier beantragt? Was soll das denn werden? Warum weiß ich nichts davon?“
Sechzig Minuten später. Ocean Building
„Guten Abend Mr. Perkin. So spät noch?“, lächelte der alte Nachtportier. „Na ja, warum soll es Ihnen besser gehen, als mir?“ Er stocherte mit Stäbchen in einem Fastfood aus Reis, Curry und Hühnchen.
„Können Sie feststellen, ob im 40. Stock eingebrochen wurde?“
Der Mann legte bedächtig seine Holzstäbchen beiseite. „Eingebrochen? Wie kommen Sie darauf? Wenn Büros verschlossen sind und mutwillig geöffnet werden, gibt das System sofort Alarm.“ Er tastete das Sicherheitssystem durch und schüttelte den Kopf. „Nein, Sir. Da war kein Einbruch. Vielleicht ist ihre Sekretärin noch oben. Ihr Büro ist noch nicht als gesichert gemeldet. Soll ich mal anrufen?“
Dass Lu noch im Büro war, konnte ich mir nicht vorstellen. Sie hatte selbst etwas vorgehabt. „Ja, bitte versuchen Sie es.“ Ich schielte auf die Positionszeiger der Fahrstühle.
„Tut mir leid, Sir, da nimmt niemand ab“, zuckte der Mann mit den Schultern.
„Dann verbinden Sie mich mit dem Sicherheitsmann 1310.“ Etwas stimmte nicht. Das schrie mein Instinkt geradezu.
Der Alte suchte im Computer. „Auch da muss ich passen, Sir“, murmelte der Alte. „Die Position von 1310 ist seit Tagen nicht besetzt. Ich verstehe das nicht. Das muss ich sofort melden. Es können doch nicht fünfzehn Stockwerke unbesetzt sein. Warum merkt das niemand?“
Das Ergebnis seiner Verwunderung konnte ich nicht abwarten. Es stank. 1310 war seit Tagen nicht besetzt. Dabei lag er in meinem Gewächshaus, und ich hatte ihn heute Nachmittag selbst im Lift gesprochen. Wer hatte mich dann angerufen?
Es war wie immer. Wenn man es eilig hatte, waren alle zehn Lifte im sechzigsten Stockwerk. Wer zum Teufel machte die Programme dafür, dass die Dinger immer ganz oben in Ruhestellung gingen? Nervös trommelte ich auf die Anzeigetafel, als ließe sich der Lift dadurch beeinflussen, schneller in den Keller zu gleiten. Im 39sten hielt er kurz, um dann ohne Stopp seinen Weg abwärts zu nehmen. Die Tür fuhr leise in die Öffnungsposition, ein junger Mann grüßte kurz und strebte dem Ausgang zu.
„Vierzigster, aber schnell“, gab ich mein Fahrziel an. Auf dem Boden lag ein Zettel. Ich hob ihn auf und entknitterte das Papier. Es war ein karierter Fetzen, wie von einem Notizblock abgerissen. Mit einer einzigen Botschaft: 1310, 40th floor office Perkin in blutroten Lettern geschrieben. Hatte den der junge Mann verloren? Oder lag der dort schon länger? Jetzt konnte der Lift nicht schnell genug aufwärtsfahren. Aber, als habe sich alles gegen meine Ungeduld verschworen, hielt das Gefährt nun in jedem Stock. Die Tür fuhr auf, niemand stieg ein, die Tür fuhr zu. Er fuhr weiter um die Prozedur zu wiederholen. „Mann, da bin ich ja schneller zu Fuß“, hieb ich auf die Tastatur ein.
Es war sinnlos. Das Ding war dazu programmiert, mich zu ärgern. Endlich. 40. Stock. Es waren bestimmt nur zwei Minuten gewesen. Aber die waren mir wie ein ganzer Tag vorgekommen. Bis auf die Notbeleuchtung war der Flur dunkel. Nur aus meinem Büro drang Licht. Die Tür stand halb offen. Deshalb schlug das Sicherheitssystem nicht an, und das Telefon auf Lus Schreibtisch summte. Und da war noch etwas, das da absolut nicht hingehörte.
„Ja, verdammt, ich habe keine Zeit“, brüllte ich in den Hörer und versuchte, das tropfende Blut nicht vom Schreibtisch auf den Teppichboden laufen zu lassen. Ich griff mir alles, was an Papier erreichbar war, um eine Blutsperre um die Leiche zu errichten.
„Perkin, dein Vater war nicht so unhöflich. Wenn ich am 13.10. sage, dann gebietet es deine Höflichkeit, meiner Einladung folge zu leisten.“ Die Stimme lachte fast zynisch. „Jetzt muss ich dir leider Manieren auf die Art beibringen, die sich eigentlich unter Gentlemen nicht gehört. Das hast du dir selbst zuzuschreiben.“
Die Verbindung brach ab. Das Blut war nicht aufzuhalten. Heute hatte sich alles gegen mich verschworen. Als wenn ich es schon beim Aufstehen geahnt hätte. Der 13.10. schien dieses Jahr stark schicksallastig zu sein. Und ich hatte vergessen, den Mönch nach meinem Tageshoroskop zu fragen, und nun lag dieser Mann da. Ausgestreckt wie ein zur letzten Ehrenbezeugung aufgebahrter Leichnam. Auf Lus Schreibtisch gebettet, seine Zunge lag wie ein abgebrannter Kerzenstummel in seinen Händen und ein überdimensionales Messer steckte in der Brust, das mich stark an das Messer erinnerte, das Ti Wu vermisste.
Fünf Stunden später. Präfektur der Stadtpolizei Singapur
„Perkin. Stehen Sie auf. Sie werden verhört“, schnauzte ein Leutnant und ließ die Zelle aufschließen.
„Mister Perkin, bitte. So viel Zeit muss sein“, maulte ich zurück. Meine Habseligkeiten hatte man mir bei der Verhaftung abgenommen. Nicht einmal die Schnürsenkel der Schuhe hatten sie mir gelassen. Meine Hose rutschte ohne Gürtel, meine Hände waren frei, um sie festzuhalten. Aber Fesseln um meine Fußgelenke hatte man gelegt, die nur Trippelschritte zuließen.
Wie spät war es überhaupt? Ohne Uhr war mir jedes Zeitgefühl verloren gegangen, und ich hatte den Schock immer noch nicht überwunden. Woher war die Polizei so schnell gekommen, die genau in dem Moment in der Tür gestanden hatte, als ich James Temperatur am Hals gefühlt hatte? Das war doch ein Komplott.
Und wer war der Anrufer gewesen, der sich über meine Unhöflichkeit beschwert hatte? War ER es? Lebte dieser Verbrecher noch? Das Datum war der einzige Anhaltspunkt, der mich seit Wochen grübeln ließ. Jede Woche war im letzten Monat ein Einschreiben im Büro abgeben worden. Der Inhalt war immer der gleiche: ein Blatt Papier, auf das nur aus der Zeitung die ausgeschnittenen Ziffern 13 10. aufgeklebt waren. Bis auf das letzte Schreiben. Es hatte den Zusatz EINLADUNG zum 13.10.86 enthalten. An das Datum erinnerte ich mich. Es war nur eine Vermutung von mir, aber genau dieser Stichtag markierte den Tod meiner Eltern vor 13 Jahren. Und wenn ich nochmals zwei Jahre zurückdachte, noch ein anderes Ereignis.
Lt. Colonel M. Chow, Commander, wies das Messingschild an der Teakholztür das Büro aus. Ich lächelte seit Stunden erstmals wieder. Wenn Chow sich des Falls annahm, war Hoffnung, mich mit einem vernünftigen Menschen in dieser Polizeimaschinerie zu unterhalten. Andererseits kamen mir Bedenken. Wenn mich schon der Polizeichef verhörte, dann zog der Mord schon politische Kreise, die die Obrigkeit unter allen Umständen unterbinden musste. Es standen Präsidentschaftswahlen an. Da passte in die nahezu gewaltfreie Statistik des Staates kein Gewaltverbrechen. Auf keinen Fall jetzt und hier. Die Sicherheit durfte keinen Flecken auf der geschönten weißen Weste bekommen.
„Commander, Sir, wie befohlen, der Gefangene Perkin zum Verhör“, salutierte der Leutnant. Der grauhaarige Mann hinter einem viel zu großen Schreibtisch in einem viel zu kleinen Zimmer nahm die Brille von der Nase und nickte. „Lassen Sie ihn herein und dann machen Sie die Tür von außen zu.“
„Ähm, verzeihen Sie, Commander“, rang der junge Offizier mit sich. „Darf ich darauf aufmerksam machen, dass Verhöre nur im Beisein eines weiteren Beamten stattfinden dürfen.“
Chow wackelte mit den Kinnlappen seines fülligen Gesichts.
„Wo steht das, Leutnant?“
„In der Dienstvorschrift, Sir.“
„So, so. In der Dienstvorschrift.“ Der Commander blätterte in einer dünnen Mappe und ging einen Bericht durch. „Warum finde ich in Ihrem Protokoll über die Festnahme keinen von der Dienstvorschrift zwingend vorgeschriebenen Vermerk, dass der vorläufig festgenommene Mister Perkin auf seine Rechte aufmerksam gemacht wurde?“
Chow schloss die Mappe.
Der Offizier trat nervös von einem Bein aufs andere. „Ich dachte Sir, dass Mister Perkin als Anwalt ... ich meinte, er kennt doch die Vorschriften.“
Der Commander blies die Backen wie ein balzender Ochsenfrosch auf.
„Sie sollen nicht denken, sondern sich an die Vorschriften halten. Und das ganz besonders bei Anwälten. Die nehmen mich wegen solch eines dummen Fehlers auseinander. Geht das in ihren blöden Schädel? Und nun raus. Tür zu.“
Chow rieb sich die Nasenwurzel und griff in den Schreibtisch. „Ich glaube, das können wir beiden uns zu dieser Tageszeit genehmigen.“ Er stellte eine Flasche Whiskey und zwei Gläser zwischen die Akten.
„Perkin, du weißt, dass ich ein Freund deines Vaters war.“ Der Whiskey tat gut. Es fehlte noch eine Zigarre. Aber in Behörden durfte nicht geraucht werden. „Aber ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Du bist nicht so souverän wie dein Vater. Der wäre nicht so dumm gewesen, der Leiche in seinem Büro die Mordwaffe aus den Rippen zu ziehen, wenn die Polizei dabei zuschaut.“
Chow legte das Gewicht seines Oberkörpers auf die Schreibtischplatte und deutete mit dem Zeigefinger eine Pistole an, die man sich an die Schläfe setzte.
Und ich musste es zugeben. Das war wirklich ein Fehler gewesen, James Cheer das Messer aus der Brust zu ziehen. Es war einfach der unüberlegte Reflex des Anwalts, ein Beweisstück zu sichern, das womöglich aus seiner Küche stammte.
„Weiter im Text“, musterte Chow meine Reaktion und lehnte sich in den Ledersessel zurück. „Du kannst dir also vorstellen, was die Beamten für einen Eindruck der Situation hatten. Und das steht in diesem Protokoll.“
Er grinste flüchtig. „Mal abgesehen davon, dass kein Mensch diesem James Cheer eine Träne nachweinen wird ... er hatte Schulden bei dir, und du steckst momentan mit dem Finanzamt selbst in der Klemme, da kann man schon einmal ausrasten. Aber ...“, holte er tief Luft und wedelte mit einem Plastikbeutel. „Dies ist das Messer, das du unter Zeugen aus der Leiche gezogen hast. So weit so schlecht. Deine Köchin bestätigt, dass es das Messer ist, das sie vermisst. Es ist wirklich ein einzigartiges Werkzeug. Woher hast du das?“, bewunderte er die Machart der Klinge und den handgerecht geformten Griff aus Ebenholz. „Na, ist ja auch egal.“
Er legte das Messer zurück und blätterte in der Akte. „Dumm ist nur, dass wir auf deinem Gelände fast zur gleichen Zeit deinen Mönch finden, der gerade dabei ist eine Leiche verschwinden zu lassen. Und rate mal, mit was die erstochen wurde?“ Er hielt das Messer hoch und zog die Stirn in Falten.
„Zur gleichen Zeit kann ich nicht an zwei Tatorten gewesen sein. Woher kamen deine Leute überhaupt so schnell? Konnten die den Mord nicht im Vorfeld verhindern?“, besann ich mich auf meinen Beruf. „Wer ist der Tote auf meinem Grundstück? Und von wem habt ihr überhaupt so überraschend schnelle Informationen? Sonst dauert das Stunden bei euch, bis ihr mal auf etwas reagiert. Die tatsächliche Todesursache meiner Eltern habt ihr derart schleppend behandelt, bis sie sich von selbst erledigt hatte. Und bei mir läuft alles minutiös ab. Chow, was ist hier los? Wird hier jetzt das umgekehrte Spiel gespielt?“
Langsam musste ich mich zusammenreißen, um nicht die Geduld zu verlieren, atmete tief durch und nahm einen Schluck. „Hast du eine Zigarre?“
Chow schob das Kinn und die Unterlippe vor und mir eine Zigarre zu. Wenn er jetzt noch mahnte, dass hier nicht geraucht werden durfte, würde ich ausrasten. Aber er tat es nicht, reichte Feuer und schenkte Whiskey nach.
„Hast du dich jetzt abgeregt?“ Er faltete beruhigend die Hände über dem Bauch.
„Ich versuche es, sonst lasse ich meinen juristischen Verstand sprechen“, drohte ich. Wohl wissend, dass sich in diesem System niemand drohen ließ. Aber es tat gut, mal seinen Zorn bei jemandem ablassen zu können, der nicht sofort die Obrigkeit heraushing, um den Gegenüber einzuschüchtern.
„Deine Eltern sind 1986 umgekommen. Da waren noch andere politische und wirtschaftliche Belange wichtig, als den Tod eines Querkopfes wie deinen Vater aufzuklären, der eine ganze Reihe von unliebsamen Triadenfürsten vertrat.“
Ich verstand, worauf das hinauslief. Mein Vater musste weg. Die Triadenfürsten sollten keinen Zugang an die Singapurbörse erhalten. Und genau dafür hatte Vater gekämpft. „Und jetzt, wo Hongkong wieder an China gefallen ist, habt ihr ein dickes Problem. Die Triaden brauchen euch plötzlich nicht mehr. Sie haben ihre eigene Börse und machen euch auf dem Kapitalmarkt schwer zu schaffen. Stimmt das?“
Chow zuckte mit den Schultern. „Ich habe davon keine Ahnung. Aber genau das könnte deine Rettung vor dem Strick sein.“
„Ist das eine Drohung oder ein Kuhhandel?“, wurde ich misstrauisch. „Warum war deine Polizei so schnell in meinem Büro und gleichzeitig bei mir zu Hause. Das stinkt doch zum Himmel.“
Chow blies die Backen auf und zuckte mit den Schultern. „Wir erhielten zwei Anrufe. Einer sagte, dass in deinem Büro gerade ein Mord stattfindet, und der andere, dass auf deinem Gelände gerade einer stattgefunden hat. Was sollen wir da machen, als sofort zu reagieren? Pflicht ist Pflicht. Und ihr Anwälte seid die Ersten, die uns das Fell über die Ohren zieht, wenn wir die nicht erfüllen.“
Ich nickte mechanisch. Wie recht er hatte … schnell koppelte ich meinen logischen Gehirnpart vom visuellen ab, um die gehörten Informationen zu einer für mich gültigen Information zusammenzufügen. Demnach war mein Vater liquidiert worden. Dass Mutter zufällig im Wagen gesessen hatte, den er auch zufällig mal selbst gefahren hatte, war billigend in Kauf genommen worden. Meine Augen tasteten die Medaillen und Urkunden an der Wand hinter dem Commander ab. 1. Preis im Scharfschießen 1985. 1. Preis im Scharfschießen 1986. Beförderung mit Auszeichnung zum Major 1986. Auszeichnung mit Goldmedaille für den besten Polizeioffizier 1987. Beförderung zum Lt. Colonel 1988.
„Und, wie geht das jetzt hier weiter?“ Ich rasselte mit den Fußfesseln. „Willst du mich jetzt vierundzwanzig Stunden hier behalten und dir etwas überlegen, bevor du mich dem Haftrichter vorführen musst, wozu ich dich zwingen kann, oder ...“
Chow winkte ab. „Dass dich jemand reingelegt hat, ist mir schon klar. Aber Gesetz ist Gesetz. Und da kann und darf ich gerade bei Prominenten wie dir keinen Unterschied machen. Die Sachlage spricht gegen dich. Das siehst du doch ein?“
Ja, das musste ich einsehen. Die Morde waren perfekt eingefädelt und dieses blöde Messer in meiner Hand konnte mich den Kopf kosten.
„Ich kann dir nur eines anbieten …“, er schenkte noch einmal nach und nickte gedankenverloren, „Um dir möglichst wenig Haft angedeihen zu lassen, werde ich dich jetzt und sofort dem Haftrichter vorführen lassen. Ich habe ihn überredet, seine Nachtruhe für dich zu opfern. Meine Vermutung habe ich ihm geschildert. Mehr kann ich nicht tun.“
Er ließ die Flasche im Schreibtisch verschwinden und rief den Leutnant. „Nehmen Sie Mr. Perkin die Fußfesseln ab und bringen sie ihn zum Haftrichter.“
Der Officer versuchte einen Einwand. Irgendetwas war wieder gegen die Vorschrift. Aber er tat wie befohlen, und ich konnte meine Beine endlich ausschütteln.
„Stand im Unfallprotokoll meiner Eltern nicht etwas von einem Reifenplatzer? Und das bei fünfzig Meilen? Und bei der Geschwindigkeit überschlägt sich ein Auto derart, dass beide Insassen sofort tot waren? Findest du das nicht auch etwas seltsam?“ Ich deutete auf die Urkunden des Scharfschützen.
Chow reagierte nicht auf meine Anspielung. „Wenn du Glück hast, lässt dich der Haftrichter bis zur Verhandlung gegen Kaution frei. Dann kannst du dich wenigstens in Singapur frei bewegen. Wenn nicht, weißt du, was dir droht. Leutnant, Sie können Mr. Perkin mitnehmen.“
„Weißt du, was dir droht?“ Allein dieser Hinweis war Drohung genug. Bei Mord standen in diesem Staat nur zwei Alternativen zur Verfügung: kompletter Freispruch oder Tod. Dazwischen gab es keine Grauzone, die auf eventuelle Notwehr, verminderte Zurechnungsfähigkeit bis zum Todschlag im Affekt ausweichen ließ. Schuldig oder nichtschuldig. Bei schuldig wurde das Urteil innerhalb von vierundzwanzig Stunden durch den Strang vollstreckt. Einspruchs- oder Revisionsmöglichkeiten sah das Gesetz nicht vor. Bevor es soweit kam, konnten Monate und Jahre der Untersuchungshaft vergehen, die jeden Geschäftsmann ohnehin dazu trieben, sich nichts sehnlicher als den Tod zu wünschen, da er binnen weniger Wochen vom Milliardär finanziell zum Asozialen gemacht wurde. Der Staat zog jedes Vermögen ein und tat alles, um die Familie und deren Familien möglichst schnell aus dem Land zu ekeln. Es war die Todesstrafe in Sippenhaft. Gegen eine Kaution bis zur Verhandlung auf freiem Fuß bleiben zu können, war wie bei einem Krebskranken, dem die Ärzte sagten, dass er womöglich nicht heilbar sei, aber noch Zeit genug hätte, sein Leben in Ruhe ordnen zu können.
Singapurs Straßen galten weltweit als die besten und gut geordnet. Selbst in der Rush Hour gab es selten Verkehrsstaus. Dafür sorgten mehrspurige Stadtautobahnen und die innerörtlichen Verkehrswege unterlagen einer strikten Einbahnregelung, die einen Ortsunkundigen zur Verzweiflung treiben konnte.
Aber das ließ meine beiden Polizisten kalt. Der Leutnant hatte es sich nicht verkneifen können, mir die Handschellen besonders eng zu schließen. „Ich lasse mir vom Commander nicht noch einmal eine Dienstordnungsverletzung unter die Nase reiben.“ Damit hatte er mich in den Streifenwagen auf den Rücksitz komplimentiert, in dem die beiden Beamten nur einen Befehl bekommen hatten, mich von A nach B zu bringen. Mehr interessierte sie nicht, und sie unterhielten sich angeregt über Pferdewetten, ihr mieses Gehalt, das von den Preissteigerungen gefressen wurde. Und über die Sorgen mit den Kindern, und was Familienväter sonst noch alles beschäftigte.
Meine Gedanken kreisten um Ziel B. Wenn Chow schon ein Freund meines Vaters gewesen war, und er den Richter zu nachtschlafender Zeit zu einer Entscheidung über Wohl und Weh an einem gewissen Perkin Elmar hatte bewegen können, dann kannte ich den Richter auch. Ein linientreuer Mann, der sich in Ermanglung schwerer Delikte in Singapur nur noch der Pensionierung beim Golfen entgegen träumte. Die beste Erfindung nach Whiskey war für ihn das Handy. Wenn es irgendwo dienstlich brannte, dann war er überall zu erreichen und konnte entscheiden, ob sich der Abschlag oder das Einlochen noch lohnte, dann hatte seine Entscheidung im Gericht zu warten, oder er auf der Verliererstraße war. Dann war der Anruf eine gute Gelegenheit, sich bei seinem Gegenspieler sofort zu verabschieden, ohne sein Gesicht zu verlieren. Aber, das war alles nur eine Vermutung, die auf der kleinen Flamme meiner Hoffnung köchelte.
Kidnapping I - Singapur
Ein Krankenwagen blockierte die kleine Straße. Die Ladetür stand auf, das Blaulicht flackerte. Meine Begleiter gähnten und meldeten eine mögliche Verspätung in die Zentrale, packten ihre Sandwiches aus und warteten. Sie sahen nicht, was ich sah. Zwei Sanitäter mit Schutzmasken tauchten aus dem Nichts auf. Einer klopfte an die Scheibe vom Fahrer, der andere vom Beifahrer. Sie deuteten an, die Fenster herunterzulassen.
„Himmel, können die einen erschrecken.“ Der Fahrer verschluckte sich. Dann zischte es kurz und beide Polizisten sackten zusammen. Elektroschocker hatten sie kampfunfähig gemacht.
Nun lief alles ab, als sei das eine weit vorausgeplante Routine. Ich wurde aus dem Wagen gezogen, der andere Sanitäter zog den Fahrzeugschlüssel ab und zerstörte das Sprechfunkgerät. Mit zwei Handschellen wurden die Beamten am Lenkrad gefesselt und ich in den Krankenwagen geschoben, der sofort mit Sirene Fahrt aufnahm, als gelte es einen Schwerstkranken ohne Verzögerung in den nächsten Operationssaal zu transportieren.
Ich setzte mich auf die Trage und schwitzte. Verzweiflung kroch vom Sonnengeflecht über die Nervenstränge des Rückenmarks in mein Gehirn. Ich wurde entführt. Nur würde mir das kein Gericht der Welt glauben. Für jeden Außenstehenden war das die wohl geplante Flucht eines Mörders auf dem Weg zu seinem Richter und gleichzeitig das Eingeständnis seiner Schuld. Ich wollte mich nicht verteidigen müssen. Solche aussichtslosen Fälle würde ich gleich ablehnen. Und nun war ich selbst einer.
Wohin der Wagen fuhr, war durch die mattierten Scheiben nicht festzustellen, und mein Magen knurrte wie ein Raubtier. Einzig mein Gehirn verdaute langsam die Erkenntnis, dass ich jetzt erst richtig in der Falle saß, und weichte die Schockstarre in mir auf, gab den Befehl: „Tu was! Verschaffe dir einen Überblick, wo wir sind!“
Ich versuchte es und sah mich um. Eine Scheibe musste raus. Aber mit was? Verbandszeug half mir wenig. Die Hecktür war verschlossen, und die Handschellen schmerzten. Nur ein kleiner Feuerlöscher in der Ecke winkte mit seiner roten Farbe ... nimm mich, nimm mich.
„Danke mein Freund.“ Ich nahm ihn aus der Halterung und wog ihn, ob er reichen würde, das Heckfenster einzuschlagen. Und es reichte. Endlich. Seit meiner Trotzphase als Jugendlicher hatte ich immer davon geträumt, mal mit aller Kraft und Wut ein Fenster einzuwerfen. Und jetzt? Die Glassplitter stieben auf die Fahrbahn und verschwanden in der Nacht. Jetzt sah ich zwar, wohin wir fuhren, aber was konnte ich mit diesem Wissen anfangen? An ein Abspringen war bei diesem Tempo nicht zu denken und wie sah ein Flüchtling mit einem gebrochenen Bein in Handschellen auf der Schnellstraße zum Flughafen aus? So wurde das auch nichts.
Also war Abwarten angesagt, was mir Vater eingebläut hatte, wenn es schwierig und unübersichtlich zu werden drohte. „Ich seufzte. Vaters Sprüche und Lebensweisheiten waren ja gut und weise gewesen, wenn mir nicht der 13.10.84 dazwischen gekommen wäre. Dieser Tag war letztendlich auch der Anfang vom Ende meiner Eltern gewesen. Und gegen die Rache eines Triadenfürsten half nur, dass er starb, bevor andere seinem Zorn anheimfielen. Sonst gab es nur die Möglichkeit sich in Luft aufzulösen. Offensichtlich hatte beides für mich nicht funktioniert. Ich wähnte damals das Gesetz auf meiner Seite und hatte in gutem Glauben gehandelt. Aber, glauben war nicht wissen.
Der Krankenwagen passierte eine Sicherheitszone in der unteren Ebene des Flughafengebäudes. Die Sirene verstummte, das Blaulicht flackerte weiter. Wir wurden durchgewunken, der Fahrer suchte sich einen Parkplatz in der Reihe der wartenden Lieferanten. Hier war der Service und Cateringbereich. Dann wurde es dunkel. Der Motor wurde abgeschaltet. Was wollten die mit mir am Flughafen? Sollte ich mit einer Privatmaschine ausgeflogen werden? Oder gar einem Hubschrauber?
Irgendwie musste ich meine Hose befestigen, die ohne Gürtel nicht hielt. Warum fiel mir jetzt so ein blödsinniges und banales Problem ein? Gut, dass die Handfesseln mit einer längeren Kette verbunden waren. So konnte ich mir aus einer Rolle Mullbinden aus dem Bereitschaftskoffer mit einer Schere die geeignete Länge schneiden und zog die Binde durch die Gürtelschlaufen. Dann zog ich alles zusammen und machte vorne eine Schleife darauf. Wenn ich jetzt noch diese Handschellen loswurde, war ich fast wieder ein freier Mann. Aber nur fast.
Ich saß auf der Trage und sah durch die zertrümmerte Scheibe. Nichts tat sich. Meine Sanitäter machten keine Anstalt, sich um mich zu kümmern. Waren die weg? Dann musste ich etwas tun. Hier war mit Sicherheit ein Mensch der Security zu finden, der sich meine Misere anhörte. Der bestätigte, dass ich mich in Handschellen selbst befreit hatte. Ich hangelte mich durch die Öffnung und ging um den Wagen. Die Führerhaustüren standen offen. Die beiden Sanitäter hingen in den Sicherheitsgurten, als schliefen sie. Ich zog dem Fahrer die weiße Maske vom Gesicht und schnell meine Hände zurück. Es war der Typ mit dem Narbengesicht, der seit Wochen einen Termin bei mir haben wollte. Nun hatte er ein kleines Loch in der Schläfe. Nur hatte ich keinen Schuss gehört. Den Beifahrer untersuchte ich erst gar nicht, drückte die Tür zu und sah um mich. Es gab nur eine Möglichkeit innerhalb des Gebäudes unentdeckt zu bleiben und eine Möglichkeit zum Telefonieren zu suchen.
„Brauchen Sie Hilfe?“ Ein schwarzer Lieferwagen hielt an. Der Fahrer war kein Asiate und hatte einen schrecklichen Dialekt irgendwo aus den Südstaaten der USA.
„Nein, danke. Ich komme schon allein zurecht. Die Jungs sind nur müde und machen eine Pause“, versuchte ich ihn loszuwerden. Der Mann lächelte, als wisse er mehr als ich.
„So kann man es auch sehen. Mit einem Loch im Kopf schläft man ohne Kopfschmerzen. Würden Sie bitte auf die Ladefläche steigen und das Ladetor hinter sich schließen?“
Die Mündung eines Schalldämpfers zielte auf mich. Der Mann lächelte nicht mehr. Ich war unschlüssig, was jetzt zu tun war und schüttelte den Kopf. „Nein danke. Mir ist nicht nach Obst und Gemüse. Wer sind Sie überhaupt?“
Die Antwort war ein abgrundtiefes Lachen. Es klang, wie das Röhren der Triebwerke der auf dem Taxi Way anrollenden Flugzeuge. Es war die Zeit, in der Fracht und Passagiere Richtung Amerika starteten und aus Europa landeten.
„Mein Name tut nichts zur Sache. Es reicht, dass Sie Perkin heißen und mir als reichlich arroganter Schnösel geschildert wurden, der gerne Probleme macht. Also, steigen Sie endlich auf, sonst kommt der ganze Zeitplan Ihrer Rettung durcheinander.“
„Rettung? Von was? Ich bin entführt worden. Und das stelle ich selbst klar“, stellte ich mich stur. Der Mann drehte das Radio lauter und grinste.
„Die Staatsanwaltschaft bittet alle Taxifahrer und privaten Sicherheitskräfte um Mithilfe. In den Nachtstunden ist ein vermutlicher Doppelmörder auf der Fahrt vom Polizeipräsidium zum Gericht entkommen. Der Mann hört auf den Namen Perkin, Elmar. Er ist einen Meter fünfundachtzig groß, schlank, hat braunes Haar und grüngraue Augen. Vorsicht, der Flüchtling könnte bewaffnet sein, da den begleitenden Beamten die Waffen abgenommen wurden. Wenn Sie diesem Mann sehen, versuchen Sie auf keinen Fall, ihn alleine zu stellen. Rufen Sie bitte sofort die Ihnen bekannten Notrufnummern ...„
Der Mann stellte das Radio ab. „Nun? Wollen sie mit mir hier noch so lange diskutieren, bis es hell wird und Sie jede Putzfrau erkennt?“
Mein Gehirn spielte alle Möglich- und Unmöglichkeiten durch und kam zu einem niederschmetternden Ergebnis: „Die Sicherheitskräfte schießen dich nieder, bevor du den Mund aufmachen kannst. Das „vermutlichen“ haben sie beim Doppelmörder überhört. Für jeden, der dich umlegt, winkt eine Belobigung, Sonderurlaub, vielleicht eine Beförderung.“
„Na schön“, gab ich klein bei. „In wessen Auftrag handeln Sie?“
Der Fahrer ließ den Motor an und lachte. „Der Auftraggeber hat den Namen „Fünfzigtausend Dollar“. Mehr hat er mir nicht verraten. Los, machen Sie die Luke hinter sich zu, und lassen Sie meine Ladung in Ruhe.“
„So eine Scheiße“, fluchte ich. Nebel kam mir entgegen, als ich das Tor nur soweit angehoben hatte, um hineinzukriechen. Es war Kältenebel. Das war ein Kühlraum, der leicht nach Fisch roch. Draußen waren noch - oder schon wieder - 28 Grad bei 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Hier drinnen tendierte das Thermometer eher gegen null Grad. In wenigen Minuten würden meine verschwitzten Kleider einen Eispanzer um mich bilden. In der Dunkelheit tastete ich um mich. Der Wagen fuhr an, ich fiel auf eine Kiste. Fühlte das Gebilde ab, es war Holz. Tastete weiter, wieder Holz. Das war schon eine kleine Hoffnung und ich blieb sitzen. Holz fror nicht und war ein guter Wärmetauscher zwischen meinem Hintern und der nassen Hose. An der Stelle würde ich wenigstens keine Erfrierungen bekommen. Den Rest musste ich mit „Arme um mich schlagen“ verbringen. Nur das ging nicht. Ich war gefesselt. Also eine andere Bewegung, wie sie Golfspieler beim Abschlag nutzen. Beide Hände um einen imaginären Schläger legen und kräftig ausholen. Und jetzt die andere Seite. Irgendwie musste ich mich in Bewegung halten. Weit konnten wir nicht fahren. Auf der Flanke des Wagens stand „Catering Yacht Club Singapur“.
Der Wagen hielt. Der Motor wurde abgeschaltet. Ich stockte in meiner Leibesertüchtigung.
„Morgen, Jack. Hast du für den Club wieder das sündhaft teure Fischzeug abgeholt, dass ihr den Millionären mit tausendfachem Aufpreis andreht?“ Die Stimme musste von einem der Sicherheitsleute bei der Ausfahrt kommen.
„Na klar“, kam es von meinem Fahrer. „Wie soll man sonst in diesem teuren Land überleben, als das Geld denen aus der Tasche zu ziehen, die nicht einmal wissen, wie teuer ihre Yachten sind, die bei uns liegen?“