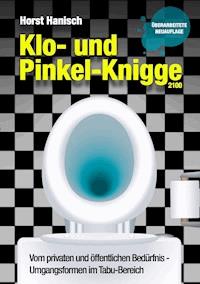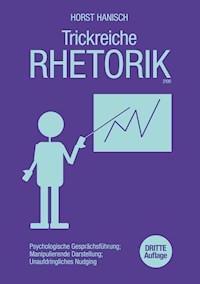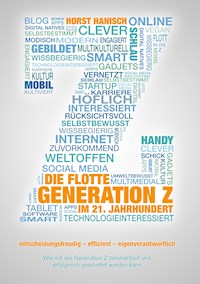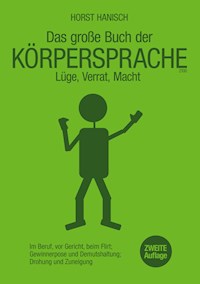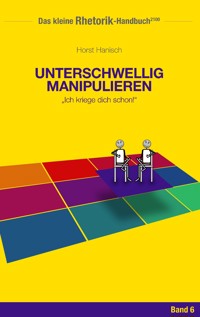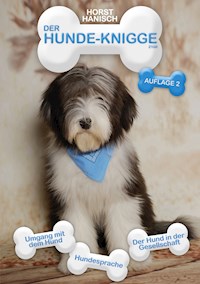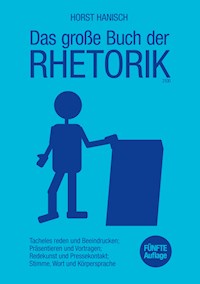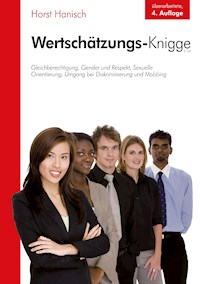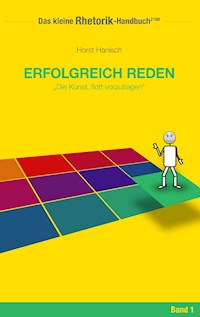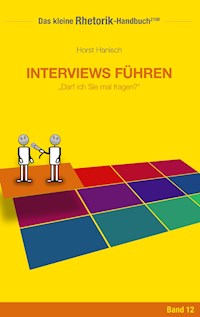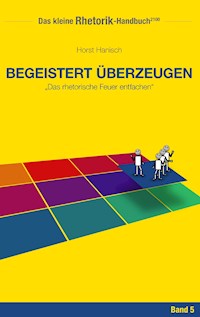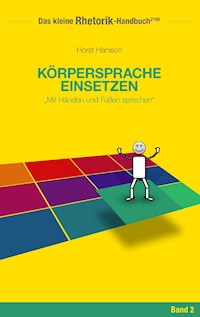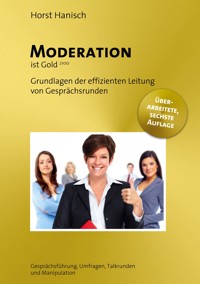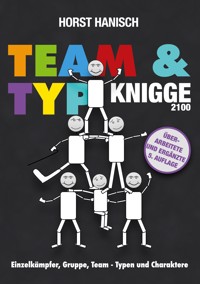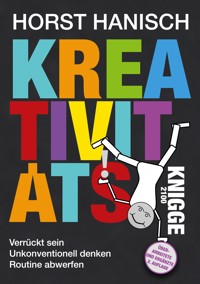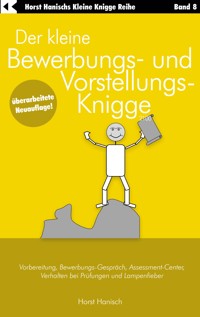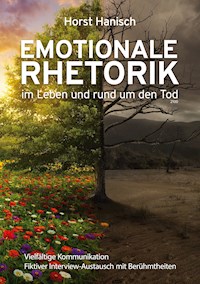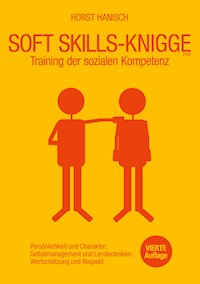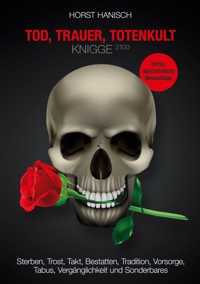
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Umgang mit dem Tabuthema Tod. Eine lebendige und bildhafte Beschreibung trauriger Themen rund um das unausweichliche Sterben und den Tod. Es ist erstaunlich, wie viele Aspekte das Thema Tod - oft als Tabuthema behandelt - berühren: Suizid, Trauerstaatsakt, Beisetzung, Kondolenz, Totenkult und vieles andere mehr. Im vorliegenden Text 'hören' wir die Gedanken eines scheintot Begrabenen, eines Sargträgers, eines Klageweibes und weiteren fiktiven Personen. Mit einigen können wir uns auch in Form eines Interviews austauschen und damit sogar die Gedanken des Todes erfahren. Kursiv geschriebene Texte zeigen weiterhin die Überlegungen und Vorgehensweisen fiktiver Personen, wie beispielsweise die des Arztes Dr. Herzing, der seinem Patienten die unheilbare und todbringende Krankheit verständlich machen und mitteilen muss. Oder das vom Inka-Mädchen Juanita, das zur Freude und ganzem Stolz der Familie als Menschenopfer ausgewählt wurde. Das Thema ist in elf Kapitel unterteilt. Die Überschriften der drei Hauptteile sind: Tod und Trennung - Trauer und Takt - Totenkult und Tabus. Widmen wir uns dem riesigen Bereich rund um das Sterben. In Deutschland sterben jährlich zwischen 850.000 und 900.000 Menschen. Es gibt also genügend Gründe, sich Gedanken über Vorsorge, Bestattungsarten und Trösten zu machen. Viele der Themen mögen berühren und Emotionen auslösen. Deshalb wird auch über Humorvolles und Sonderbares berichtet, um eine gefühlte Ausgewogenheit rund um den Tod, die Trauer und den Totenkult zu erreichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS
PROLOG ZUR EINLEITUNG
HINLEITUNG
DIE ZÄSUR IM LEBEN
Gedanken von ‚Jürgen‘
TEIL 1 – TOD UND TRENNUNG
1. KAPITEL – DAS LEBEN IST ENDLICH
ERKENNTNIS DER STERBLICHKEIT
Der Tod ist unvermeidlich
DER TOD HÄLT EINZUG
Das biologische Aus
Der Tod bedeutet die Trennung von Leib und Seele
Der Tod kennt keine Zeit
Todesengel
TODESANGST
Der Tod derzwischenmenschlichen Kommunikation
Ich habe Angst vor dem Tod
Ich habe tödliche Angst
Todesdrohung
Das Leben hängt am seidenen Faden
ANGST VOR DER UNGEWISSHEIT
Was kommt nach dem Tod?
Angst vorm Sterben
Der Schwarze und der WeißeTod
Interview mit dem Tod
Nekrophobie – Pathologische Angst vorm Tod
Nekrophilie – Zuneigung zum Toten
TOT ODER NICHT?
Scheintod – der Untote
Lebendig begraben werden – Taphephobie
„Tot, toter, am totesten“
Nahtod – Nahtoderfahrung
Der klinische Tod
Der Hirntod
Der biologische Tod
Die Todesart
2. KAPITEL – STERBEN
WIE WOLLEN WIR STERBEN?
Wunsch und Wirklichkeit
WIE STERBEN WIR?
Phasen des Sterbens
STERBEZIMMER
Sterben ist ein Prozess
Sterbende im Hospiz – Würdigung des Sterbenden
Todessehnsucht
Sterbehilfe
Agonie – Todeskampf
EINSAMKEIT
Allein Sterben – einsam und ohne Begleitung
Sinn des Lebens
1.000 TODE STERBEN
Mehr als einmal sterben?
Zu Tode betrübt sein
Zu Tode lachen
In Schönheit sterben
Vor Langeweile sterben
Vor Hunger sterben
Dem Tod geweiht sein
Weder leben noch sterben können
Mit dem Tod kämpfen
DIE LETZTEN WORTE
Was bleibt von einem Menschen?
… nur noch wenige Augenblicke
Sterbenswort
„Auf ein letztes Wort“
Vergängliches Wissen und verlorene Erfahrung
3. KAPITEL – SELBST- UND FREMDTÖTUNG
SUIZID
Sich das Leben nehmen
Menschen, die sich selbst das Leben nahmen
Hungertod
Harakiri – Seppuku
Kamikaze
Menschen, die nicht sterben können
Interview Graf Draculae
OPFER
Menschen, die sich das Leben nehmen mussten
Menschen, die getötet wurden
Hexen
Gottesurteile
Todesurteile
Guillotine
Der Blaue Stein
Interview William – Der Henker/Scharfrichter Maria Stuarts
TÄTER
Selbstmordattentäter
Amokläufer
Ehrenmord
Serienmörder
Attentäter
Heldentod
Scharfschütze – Präzisionsschütze
Mordsspaß
MENSCHENOPFER UND KANNIBALISMUS
Ein Mensch wird geopfert
Kannibalismus
Menschen, die nicht sterben dürfen
TOTE DINGE
Tote Sprache
Totes Kapital
Tote Leitung
TOTE SITUATION
Totes Gefühl
Toter Mann
Alles ist tot
„Ich bin tot“
„Heute rot, morgen tot“
„Klappe zu, Affe tot“
Zeit totschlagen
„Schlag mich tot!“
4. KAPITEL – VERSTORBEN
GETRENNT VOM LEBEN
Trennung
Totenfürsorge
Vorgehen beim Sterbefall
Aufgabe des BestattersKassen und Versicherungen
Sterbeurkunde
Bestattungskosten
Leichenwagen
Interview mit einem Bestatter
BESTATTUNGSARTEN
Wie wollen Sie bestattet werden?
Erdbestattung
Feuerbestattung
Seebestattung – das Seegrab
Anonyme Bestattung aus eigenem Willen
Anonyme Beisetzung von Mördern
Massenbeerdigung – Massengrab
TRAUERBEKUNDUNGEN
Traueranzeige – Todesanzeige
Danksagung
Gestorben oder Verstorben?
TEIL 2 – TRAUER UND TAKT
5. KAPITEL – TRAUER UND TROST
TRAUER
Traurigkeit
Phasen der Trauer
DIE NICHT MÖGLICHE VORBEREITUNG AUF DEN TOD
Aus dem Leben gerissen
Katastrophe in Pompeii
ZU FRÜH GESTORBEN
Plötzlicher Kindstod
Sternenkinder
FÜRCHTERLICHE NACHRICHTEN
ÜBERBRINGEN
Die Angehörigen über den Tod des Partners informieren
Den Betroffenen über seinen bevorstehenden Tod informieren
Schuldig oder unschuldig?
TROST
Traurigkeit zeigen und Trost spenden
Weinen
Totenwache
Gedenktage
Kranzniederlegung
Sepulkralkultur
Trauerweg
6. KAPITEL – DER LETZTE UMGANG
LEICHENBESCHAU
Leiche – Leichnam
Totenbeschau
Totenstarre – Leichenstarre
Totenflecken – Leichenflecken
Leichenart
REINKARNATION – DIE WIEDERGEBURT
Ich gehe und ich komme
wieder
HERRICHTEN DES LEICHNAMS
Das letzte Hemd
Totenhemd
HERRICHTEN FÜR DIE EWIGKEIT
Mumifizierung und Mumifikation
Mellifikation
Einbalsamierung
Totenmaske
Der Fährmann zur Unterwelt
Interview Charon
7. KAPITEL – BEERDIGUNG UND RUHESTÄTTE
DIE WEGE DER BEISETZUNGFriedhof
Berühmte Friedhöfe
Friedhofsordnung
AUFBAHRUNG
Abschiednahme am offenen Sarg
Trauerfeier im Raum der Abschiednahme
TRAUERFLORISTIK
Beerdigungsblumen
Blumenkranz – Symbol der guten Mächte
Trauerschleife – Kranzschleife
Grabbrett – Leichenbrett
SARKOPHAG
Sarg
Sargformen
Sarg in Übergröße
Sarg in kleiner Größe – Kindersarg
Sargträger
BESTATTUNGSURNE
Kremation – Krematorium
Urne
Urnenwand – Kolumbarium
Mausoleum
Gruft
BEILEID AUSDRÜCKEN
Trauerkleidung
Trauerflor
Kondolenz
Beileidsschreiben – Kondolenzschreiben
Mitgefühl ausdrücken
VON DER TRAUERHALLE BIS ZUM GRAB
Der letzte Weg
REDEN AM OFFENEN GRAB
Die Leichenrede, Trauerrede
Beileidsbekundung am offenen Grab
TRAUERMAHL
Der Leichenschmaus
STAATSAKT
Staatsbegräbnis – Trauerstaatsakt
Ehrenwache
Trauerbeflaggung – Flagge auf Halbmast
Trauerzeit
DIE LETZTE RUHESTÄTTE
Grabstein – Leichenstein
Ruhe in Frieden
Seychellen – Inselwelt für Piraten
Pyramiden – Ägypten
Katakomben
Privatfriedhof
TEIL 3 – TOTENKULT UND TABUS
8. KAPITEL – (SCHWARZER) HUMOR ODER VERZWEIFLUNG?
DEN LÖFFEL ABGEBEN – UND ANDERE REDEWENDUNGEN
Die Angst vor fürchterlichen Qualen im Diesseits und im Jenseits
Aus Traurigem wird Schönes
Verschollen und für tot erklärt
Totgesagte und Totgeglaubte leben länger
Darf es um das Thema Tod auch Lustiges geben?
LEBENSERWARTUNG
Das Leben in Zahlen
Armut lässt früher sterben
100 Jahre und mehr
Alterspyramide
Gespräch über den Tod
9. KAPITEL – DER LETZTE WILLE
VORBEREITUNG UND DIE LETZTEN WÜNSCHE
Klären vor dem Tod
Die Erbfolge
VORSORGE
Vorausblicken
Vollmacht
Patientenverfügung
Der letzte Wille – das Testament
10. KAPITEL – EXOTISCHES UND UNGEWÖHNLICHES
ES GIBT NICHTS, WAS ES NICHT GIBT
Computer-Dialog mit dem verstorbenen Partner
Trauertänzer
Piratenflagge – Totenkopfflagge
Todesgefahr
TABUS UND ABERGLAUBE
Organspende
Leichengeld
Unglücksbringer – Todbringer
Die wilde Jagd – der Geisterzug
Hochzeittorte
ÜBERSINNLICHES
Totengeist
Traumdeutung
Okkultes – Kontaktaufnahme mit Verstorbenen
Carpenter-Effekt – Mein Arm denkt mit
DER TIERISCHE BEGLEITER DES
MENSCHEN
Wie ist die Lebenserwartung bei Tieren?
Totstellung bei TierenDer treue Freund des Menschen – bis in den Tod hinein
Tiere empfinden Trauer
Der Mensch trauert um seinen Hund
Der Hundefriedhof
11. KAPITEL – TOTENKULT UND TRADITION
DER SÜNDENBOCK IST TOT!
Tradition – Ertränken, Verbrennen, Verstoßen
BLICK ZU DEN NACHBARN
Das Fest der hungrigen Geister – China
Asche in den Ganges – Indien
Día de los Muertos – der fröhliche Tag der Toten – Mexiko
Famadihana – Umbettung der Toten in Madagaskar
Egoun Egoun – die Geister der Verstorbenen in Benin
Begraben und später verbrannt – Indonesien
Verstorbene um Vergebung bitten – Thailand
Mitama – Ehrenhafter Geist in Japan
Eingefroren bis zur Umbettung – Grönland
DIE ALLGEGENWÄRTIGKEIT DES TODES
Macht der Tod das Leben lebenswerter?
EPILOG ZUR AUSLEITUNG
Das glückliche Leben
STICHWORTVERZEICHNIS
KNIGGE ALS SYNONYM UND ALS NAMENSGEBER
UMGANG MIT MENSCHEN
Adolph Freiherr Knigge
Prolog zur Einleitung
„Wir müssen immer lernen, zuletzt auch noch sterben lernen.“
Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach, österr. Schriftstellerin (1830 - 1916)
Erkennen der Vergänglichkeit
Es war ein völlig unerwarteter, sehr heftiger Schlag aus heiterem Himmel. Karls Stimme am Telefon war dünn, brüchig, stockend, verzweifelt. Mit Mühe konnte herausgehört werden „… Dorothea … tot … Notarzt hier …“
Die Mutter tot? Konnte das sein? Nein, das musste ein Hörfehler sein. Der Sohn setzte sich mit Begleitung sofort ins Auto, um eine halbe Stunde später beim Vater einzutreffen.
Die Wohnungstür stand sperrangelweit offen, Teppiche und Läufer lagen unordentlich vor der Eingangstür. „Karl, wo bist du?“ Totenstille in der Wohnung, bis auf ein leises, kaum vernehmbares „Hier!“
Der 82-jährige Karl klammerte sich weinend in seinem Büro am Telefonhörer fest, um auch die anderen Kinder zu erreichen.
Eine echte Schocksituation. Wie soll sich hier richtig verhalten werden? Erst einmal in die Arme nehmen. Die Tränen und das laute Schluchzen machten eine verbale Kommunikation sowieso unmöglich.
Eins stand fest: Dorothea war nicht mehr hier. Ein blaues Blinklicht um die Ecke zog kurz die Aufmerksamkeit auf sich.
Der Sohn geht nach draußen. Tatsächlich. Ein Notarztwagen steht noch dort. Die Ärztin telefoniert, der Kollege fertigt Notizen an.
Satzfetzen des Telefonats werden aufgefangen: Die Zustandsbeschreibung der Mutter, die vorgenommenen Wiederbelebungsversuche und so weiter.
Bestand doch noch Hoffnung? Endlich kann sich die Notärztin dem Sohn zuwenden.
In einfühlsamer Zuwendung übermittelt sie die sachlichen Informationen: „… Rettungswagen … zwei Notärzte-Teams … Wiederbelebungsversuche … Transport in die Uni-Klinik …“
Gibt es eine Hoffnung? „Eher nicht. Und wenn … das Gehirn … wie lange war es wohl ohne Sauerstoffzufuhr? …“ Todesursache? „Wir wissen es nicht. … 80 Jahre … Herz-Kreislauf-Versagen?“
Karl hatte die direkt hinter der Wohnungstür bereitliegende Patientenverfügung einem der Ärzte überreicht. In der Aufregung hatte er allerdings seine eigene gegriffen. So versuchten die Ärzte etwa 45 Minuten lang – die nicht gewünschte – Wiederbelebung.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt – der Tod war schneller. Durch Dorotheas Herzschrittmacher war immer wieder eine scheinbare Bewegung im Körper wahrzunehmen. Deshalb konnten die Ärzte mit ihrer Arbeit nicht aufhören.
Eine Stunde nach dem Abtransport erfolgte das Telefonat mit dem behandelnden Arzt in der Uniklinik. Behutsam übermittelte er die befürchtete Nachricht.
„Wir haben den Tod festgestellt … nein, es ergibt keinen Sinn, jetzt vorbeizukommen … am besten ist: ‚begreifen’ Sie erst einmal die Situation …“
Umgang mit dem Tabuthema Tod
Eine lebendige und bildhafte Beschreibung trauriger Themen rund um das unausweichliche Sterben und den Tod.
Es ist erstaunlich, wie viele Aspekte das Thema Tod – oft als ‚Tabuthema‘ behandelt – berühren: Suizid, Trauerstaatsakt, Beisetzung, Kondolenz, Totenkult und vieles andere mehr.
Im vorliegenden Text ‚hört‘ der Leser/die Leserin die Gedanken eines scheintot Begrabenen, eines Sargträgers, eines Klageweibes und weiteren fiktiven Personen.
Mit einigen wird sich auch in Form eines Interviews ausgetauscht und so die Gedanken zum Tod erfahren.
Kursiv geschriebene Texte zeigen weiterhin die Überlegungen und Vorgehensweisen fiktiver Personen, wie beispielsweise die des Arztes Dr. Herzing, der seinem Patienten die unheilbare und todbringende Krankheit verständlich machen und mitteilen muss.
Oder die Geschichte vom Inka-Mädchen Juanita, das zur Freude und ganzem Stolz der Familie als Menschenopfer auserwählt wurde.
Vier Interviews sind aus dem Buch ‚Emotionale Rhetorik – im Leben und rund um den Tod 2100‘ vom selben Autor entliehen.
Das Thema ist in elf Kapitel unterteilt. Die Überschriften der drei Hauptteile sind:
Tod und Trennung
Trauer und Takt
Totenkult und Tabus
Es wird sich dem riesigen Bereich rund um das Sterben gewidmet.
In Deutschland sterben jährlich rund 1.000.000 Menschen. So gibt es genügend Gründe, sich Gedanken über Vorsorge, Bestattungsarten und Trösten zu machen.
Viele der Themen mögen berühren und Emotionen auslösen. Deshalb wird auch über Humorvolles und Sonderbares berichtet, um eine gefühlte Ausgewogenheit rund um den Tod, die Trauer und den Totenkult zu erreichen.
Ich wünsche viele Erkenntnisse bei dem Thema, dass das komplette Leben begleitet.
Horst Hanisch
Hinleitung
Die Zäsur im Leben
„Für sich selbst ist jeder unsterblich; er mag wissen, dass er sterben muss, aber er kann nie wissen, dass er tot ist.“
Samuel Butler, engl. Philosoph (1835 - 1902)
Gedanken von ‚Jürgen‘
Die Person, die die folgenden Erinnerungen schildert, soll Jürgen heißen. Seine Gedanken sollen gedanklich auf die Themen des Buches einstimmen.
Das Alter lag fern
An meine allerfrüheste Jugend kann ich mich nicht erinnern. Es wird behauptet, dass Menschen vereinzelt Erinnerungen an ihr zweites, drittes oder viertes Lebensjahr haben.
Ich kann mich lediglich daran erinnern, dass ich auf der Rückbank eines Fahrzeugs saß, durch das Heckfenster schaute und die regungslos dort stehenden Kinder sah, die uns beim Wegfahren an einen neuen Wohnort nachschauten. Ich muss damals 4, vielleicht 5 Jahre alt gewesen sein.
Meine Mutter war etwa 20 Jahre älter als ich. Aus meiner Sicht eine erwachsene Frau. Mein Vater war drei Jahre älter. Damals habe ich mir keinerlei Gedanken über das Alter gemacht oder mich gar gewundert, weshalb andere älter waren als ich.
Ich nahm es als gegeben hin, dass meine Mutter eine erwachsene Frau und meine Großmutter eine alte Frau war. Sie muss damals Mitte 50 gewesen sein. In meinen damaligen Augen war sie alt.
Aus heutiger Sicht erscheint mir diese Meinung lächerlich. Wer würde sich als 55-Jähriger als alt bezeichnen?
Als Jugendlicher erkannte ich dann, dass ich im Vergleich zu meinen Klassenkameraden eine relativ junge Mutter hatte. Das bereitete mir einen gewissen Stolz.
Erste Gedanken zum Älterwerden
Richtige Gedanken zum Alter kamen mir, als ich selbst 12 oder 13 Jahre alt war. Damals war ich der felsenfesten Überzeugung, würde meinem Vater etwas passieren, könnte ich problemlos dessen berufliche Position einnehmen. Wie kann ein 13-Jähriger so denken?
Ich war in diesen und den nächsten Jahren in der Jugend–Gemeindearbeit als Gruppenleiter aktiv. Ein 18-Jähriger war für unseren Bereich der Ansprechpartner. Für mich war der 18-Jährige alt. Tatsächlich alt. Ich betrachtete ihn als richtigen Erwachsenen.
Felsenfest war ich damals der Meinung, dass ein 18-Jähriger alles weiß. Ich ging davon aus, dass er sozusagen alles Wissen, das verfügbar ist, gelernt haben würde. Aus heutiger Sicht kann ich nur noch milde darüber lächeln.
Sehe ich heute 18-Jährige, wundere ich mich, mit welcher jugendlichen Naivität viele von ihnen durchs Leben schreiten. Seit langem habe ich erkannt, dass es wohl kaum einem gelingen wird, alles Wissen dieses Planeten im Kopf speichern zu können. Inzwischen bin ich der Meinung, dass dies auch gar nicht notwendig ist. Wichtiger ist es zu wissen, wie ich an Wissen gelangen kann.
Reflexion
Ich fing an, mein eigenes Leben und Dasein zu durchdenken. So versuchte ich mir vorzustellen, wie es wäre, wäre ich älter als gerade in diesem Augenblick. Diese Vorstellung gelang mir einigermaßen, obwohl ich damals nicht im Geringsten absehen konnte, was es bedeuten würde 20, 40 oder gar 60 Jahre alt zu sein.
Und was würde danach geschehen? Irgendwann würde ich sterben. Nun, die ersten Monate nach meinem Tod konnte ich mir noch ausmalen. Vielleicht auch noch die unmittelbaren Jahre danach.
Was würde aber danach passieren? Nach 20 Jahren? Nach 100, nach 1.000? Hier gelangte ich an die Grenzen meines Denkvermögens. Ich schaffte es einfach nicht, mir vorzustellen, wie es ‚dann‘ aussähe.
Klar hatte ich eine Vorstellung, wie es auf der Welt aussehen könnte. Was aber würde mit mir sein? Wo wäre ich dann? Läge mein Körper noch auf einem Friedhof? Was wäre noch von mir übrig?
Ich kam zu der Erkenntnis, dass mich der Versuch des Weiterdenkens hier in eine verzweifelte Situation brächte, die mein Gehirn nicht verarbeiten könnte. Drohte ich sonst verrückt zu werden?
Ich nahm mir vor, diese Art Gedanken zu unterdrücken. Ich hatte erkannt, dass ich selbst keine Antwort auf meine vielen offengebliebenen Fragen fände. Die eigene Zukunft nach meinem Versterben blieb unbeantwortet.
Wohl wissend, dass es irgendwann einmal soweit ist, verneinte und vermied ich die Gedanken hierzu.
Ich fing an zu verstehen, weshalb manche Menschen sich hier regelrecht in einen Glauben flüchten. Scheint es doch angenehmer zu sein, sich vorzustellen im Himmel oder, falls es denn sein muss, in der Hölle seine Zukunft zu verbringen.
Relatives Älterwerden
Als Teenager rechnete ich aus, dass ich 23 Jahre alt sein müsste, um genau die Hälfte des Alters meines Vaters erreicht zu haben. Danach versuchte ich rauszufinden, wann ich ihn mit meinem Erwachsenwerden endlich einholte.
Dabei stellte ich fest, dass die relative Differenz meines Alters zum Alter meines Vaters immer geringer werden würde. Allerdings würde sie nie auf ‚Null‘ schrumpfen können. Erst dann, wenn mein Vater nicht mehr lebte. Dann hätte ich zumindest rechnerisch die Chance, ihn ‚einzuholen‘.
Diese Erkenntnis war für mich erschreckend, zeigte sie doch zugleich, dass diese Rechnung erst nach dem Versterben meines Vaters aufgehen könnte. Solange mein Vater lebt, wird die Differenz immer 23 Jahre bleiben.
Heute freue ich mich über jedes Jahr, das mein Vater älter wird. Ich gebe mich dabei der naiven Vorstellung hin, auch mein eigenes Leben würde sich dadurch gleicherweise verlängern.
Ich war 18 – und erwachsen
Irgendwann war ich dann 18 Jahre alt. Jetzt war ich erwachsen. Zumindest der Alters-Zahl nach. Ich durfte tun und lassen, was ich wollte.
Ein interessantes und gleichzeitig erbauendes Gefühl.
Auch wurde mir deutlich bewusst, dass ich ab sofort als ‚voll geschäftstüchtig‘ im juristischen Sinne anzusehen war. Ich war demnach für mich selbst und mein Handeln verantwortlich.
Allerdings konnte ich mir noch nicht so genau vorstellen, wie es sein würde, allein und voll verantwortlich leben zu dürfen – oder vielleicht leben zu müssen. Konnten mir bis dato meine Eltern immer hilfreiche Informationen geben, waren sie ab jetzt bestenfalls noch moralisch dazu verpflichtet.
Wie würde es sein, allein und selbst verantwortlich leben zu dürfen/können? Wie ist das mit den Versicherungen, dem Arbeitsplatz, dem Aufbau einer eigenen Partnerschaft? Wem gegenüber muss ich jetzt noch Verantwortung zeigen? Das waren Fragen, die in der Schule weder gestellt noch beantwortet wurden.
War ich mit 18 Jahren fit fürs Leben? Ein kleiner Trost war mir, dass es vielen anderen, vielleicht sogar allen anderen, ähnlich gehen musste wie mir. Schaute ich mir ältere Personen an, konnte ich feststellen, dass es wohl jeder ‚irgendwie‘ geschafft hatte, selbstständig durchs Leben zu gehen.
Also konnte es so schlimm ja nicht sein. Es würde sich schon irgendwie ergeben. Und es ergab sich ‚irgendwie‘.
Kein Plan des Lebens
Genau genommen gab es keinen Plan, wie das Leben aussehen sollte.
Selbst wenn ich den Eindruck gewinnen konnte, alle um mich herum hätten die Struktur des Lebens begriffen, war es bei meinem eigenen Denken noch nicht so weit. Bestenfalls gelang es mir zwei, vielleicht auch drei Jahre vorauszuplanen beziehungsweise zu denken.
Ich war mir nicht im Geringsten darüber bewusst, welche Weichen ich für mein zukünftiges Leben durch mein aktives Handeln stellen würde. Sogenannte gutgemeinte Ratschläge älterer Verwandten konnte ich sowieso nicht nachvollziehen, geschweige denn wertschätzen.
So richtig blühte ich erst auf, als ich etwas über 20 Jahre alt wurde. Ich lebte für meine berufliche Weiterbildung ein Jahr lang weit weg von meinem Geburtsort. Dort schaffte ich es, mir ein erstes vernünftiges Netzwerk unter Gleichaltrigen zu knüpfen.
Ich habe das Leben richtig genossen, jeden Tag bewusst gelebt und viel gelacht. So ganz nebenbei habe ich auch unglaublich viel gelernt und spürte regelrecht, dass ich wohl eine Art ‚Spätzünder‘ sein müsste. Dieses Jahr hat mir unglaublich viel für mein späteres Leben gebracht.
Plan der beruflichen Zukunft
Ich war gerade mal 25 oder 26 Jahre alt, als ich erstmals im Ausland arbeitete. Diese Art der Arbeit gab mir volle Befriedigung. Ich war glücklich und freute mich tatsächlich über jeden Tag, den ich leben konnte. So hätte das Leben theoretisch immer weitergehen können.
Allerdings machte ich mir auch jetzt keinerlei Gedanken über meine Zukunft beziehungsweise mein Älterwerden; oder vielleicht doch?
‚Irgendwann‘ kam mir nämlich der Gedanke, dass ich in dem mir gewählten Beruf zwar hierarchisch betrachtet recht schnell bis in Spitzenpositionen vordringen würde. Gleichzeitig wurde mir bewusst, dass die ‚Luft dort oben‘ immer dünner werden würde. Achtung: In meinen Gedanken dachte ich an einen 40-Jährigen.
Was würde mit mir als 45-Jähriger oder 50-Jähriger geschehen? Die alternativen beruflichen Positionen wären dann verständlicherweise seltener vorhanden. Was wäre, könnte ich diese nicht mehr in Anspruch nehmen? Wäre dann das berufliche Leben bereits vorbei?
Ganz rational entschied ich mich, für diesen eventuellen Fall vorzubauen. Ich brachte ein Fachbuch heraus, das heute noch erfolgreich vermarktet wird. Emotionslos überlegt und strategisch vorgehend wollte ich mir damals bereits die Basis für ein zweites Standbein aufbauen, sollte die berufliche Karriere irgendwann einmal kippen und mich zwingen, einen anderen Berufsweg einzuschlagen.
Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich einen entscheidenden Schritt für meine eigene Zukunft plante und umsetzte.
Aufgehen in der und für die Arbeit
Obwohl es mir damals ausgezeichnet gut ging, gesundheitlich, privat wie beruflich, entschied ich mich aus privaten partnerschaftlichen Gründen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich war damals etwa 28 Jahre alt.
Aus heutiger Sicht fast unverantwortlich, einen sicheren und sehr gut bezahlten Beruf einfach mal so wegen einer gewünschten Selbstständigkeit an den Nagel zu hängen. Vor allem deswegen, weil kein Businessplan vorlag und die Entscheidung ‚eben einfach mal so‘ erfolgte.
Ich kann von wirklichem Glück reden, dass ich mit meiner gewählten Selbstständigkeit sehr erfolgreich wurde. Ich hatte nach finanziell bedrohlicher Übergangszeit viel zu tun. Und zwar so, dass ich nach einigen Jahren anfangen konnte, die Anfragen auszusuchen.
Ich ging in der Arbeit auf. Ausgedehnte Arbeitszeiten von sehr früh morgens bis sehr spät abends, regelmäßige Einsätze an Wochenenden inklusive sonntags, waren die Regel. Ich musste aufpassen, nicht zu einem Workaholic zu werden.
Die Zeit und das Leben rasen vorbei
So rasten die Jahre an mir vorbei. An meinen 40-jährigen Geburtstag kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Der 50-jährige wurde großartig gefeiert.
Versuche ich mir heute Erinnerungen dazu aufzurufen, was in den einzelnen Jahren dieser Jahrzehnte wirklich geschah, sehe ich ein unbeschriebenes, blankes Blatt vor mir.
An Einzelheiten kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Wohlwissend, da ich ja diese Zeit aktiv gelebt hatte, machte sich mein Gedächtnis wohl nicht die Mühe, sich Besonderes herauszupicken.
Oder gab es nichts Besonderes? Glich ein Tag dem anderen? Ich kann mich sehr wohl daran erinnern, dass ich mich eher als pingelig, als genau, als ausgesprochen kritisch betrachtete.
Absprachen mussten unbedingt eingehalten werden und es war mir damals (und ist es heute auch noch) ein Ärgernis, wenn Vereinbarungen nicht erfüllt wurden oder andere die vereinbarte terminliche Zielsetzung sehr flexibel ausdehnten. Ich betrachtete dieses Vorgehen als vergeudete Zeit.
Auch maß ich mir an, die Art und Weise, wie mancher Zeitgenosse lebte, kritisch zu betrachten. Hierbei meine ich, negativ zu werten. Das mache ich heute (fast) nicht mehr. Ich bin immer deutlicher der Meinung, dass jeder ein fast absolutes Recht hat, so leben zu dürfen, wie er will.
Selbstverständlich mit der kleinen Einschränkung, solange ich anderen keinen körperlichen oder seelischen Schaden zufüge.
So gehe ich heute viel geschmeidiger oder wohlwollender damit um, wenn ich sehe, wie andere Menschen ihr Leben gestalten. Das ist mir als junger Mensch nicht gelungen. Damals dachte ich eher in ‚richtig‘ und ‚falsch‘.
Mittlerweile weiß ich, dass das Leben aus unendlich vielen ‚Grautönen‘ zwischen falsch und richtig besteht. Das ist es ja gerade, was das Leben so reizvoll gestaltet.
Heftige Zäsur
Den ersten richtigen ‚Schlag‘ in meinem Leben musste ich erleben, als meine Mutter kurz vor dem Erreichen ihres 80sten Geburtstags unerwartet und binnen Sekunden schlagartig verstarb.
Es gab keinerlei Hinweise auf das anstehende Ende ihres Lebens. Sie war weg – einfach so; im wahrsten Sinne von jetzt auf gleich.
Ich denke, dass es einige Stunden dauerte, bis ich wirklich begriffen hatte, was das bedeutete. Es kostete mich fast zwei Jahre, diesen Verlust zu verkraften. Im ersten Jahr nach ihrem Tod musste ich jeden Tag ihrer gedenken. Jeden Tag (!).
Dabei würde ich das Verhältnis zu meiner Mutter nicht gerade als besonders innig beschreiben wollen. Es verwunderte mich deshalb möglicherweise umso mehr, weshalb ich plötzlich diese emotionalen Gefühlsempfindungen verspürte.
Auch nach dem Ablauf der ersten beiden Jahre kam ich immer wieder in Situationen, in denen mir scheinbar grundlos die Tränen in die Augen schossen. Beispielsweise bei verschiedenen Filmszenen mit ‚tödlichen‘ Situationen oder tragische Familiengeschichten fremder Familien, die mir zugetragen wurden.
Begreifen der Endlichkeit
In diesen Jahren, es war demnach rund um meinen 60-jährigen Geburtstag, hatte ich tatsächlich erfahren, was Endlichkeit bedeutete. Dabei betone ich das Wort erfahren, denn rationell erfasst hatte ich es natürlich schon viel früher. Es wurde mir wieder einmal klar, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen dem Wissen und der Erfahrung gibt.
Seit dieser Zeit machte und mache ich mir wieder verstärkt Gedanken über meine nächsten Lebensjahre. Schmerzlich wurde mir bewusst, dass es ‚irgendwann‘ auch mich direkt betreffen würde. Wie auch früher schon stellte ich mir hin und wieder die Frage nach dem Sinn des Lebens. Was ist wichtig? Was ist wirklich wichtig im Leben? Ich entschied, weniger Zeit in das berufliche Leben zu stecken zugunsten der Partnerschaft. Ich darf mich zu den Glücklichen zählen, die behaupten dürfen, in einer wundervollen Partnerschaft leben zu dürfen.
Weniger berufliche Aufträge bedeuteten weniger Umsatz. Das war und ist in Ordnung für mich. Gerne beruhigte ich mein eigenes Gewissen mit Sprüchen wie „es ist eh alles nur geliehen auf dieser Welt“ oder „das letzte Hemd hat keine Taschen“. Also blieb nur ein gewisses Abwägen, im Management heißt das wohl Life-Balance, die Schwerpunkte im täglichen Leben zu setzen. Sein wurde wichtiger als Haben.
Der Tod rückt näher
Der nächste runde Geburtstag – wenn ich ihn erleben darf – wird eine 7 in der Jahreszahl haben. Immer wieder habe ich nun die Zeit, das Leben anders zu betrachten, als es mir als junger Mensch möglich war. Sehe ich, was auf dieser Welt und in unserem Land alles geschieht, sei es politisch, wirtschaftlich und religiös, kann ich nur den Kopf schütteln.
Ist das wirklich das Leben? Was tun Menschen einander an? Weshalb gibt es so viel Neid, soviel Unrecht, soviel Verbrechen und Krieg? Müsste unser Verstand in den Jahrtausenden der Evolution nicht so weit gediehen sein, um erkennen zu können, dass es einen friedlichen Weg geben müsste, miteinander zu leben?
Immer mehr kann ich verstehen, wenn ich von alten Menschen – und jetzt meine ich Menschen, die deutlich über 80 Jahre alt sind – höre, wenn sie sagen „ich will nicht mehr“.
Früher konnte ich solche Aussagen überhaupt nicht verstehen, sollte doch jeder froh und stolz darauf sein, leben zu dürfen.
Heute fällt es mir viel leichter, solche Aussagen nachvollziehen zu können. Besonders auch dann, wenn ich in Berichten oder auch Live erleben darf/muss, unter welchen Bedingungen manch alter Mensch leben muss. Dann kann ich nicht mehr sagen, dass er leben darf.
Das Ende?
Ich hoffe so, wie viele andere auch, dass ich noch viele glückliche Jahre erleben darf und dass das Ende meines Lebens unspektakulär verläuft. Damit meine ich, dass ich mich nicht gesundheitlich oder finanziell quälen muss.
Ich hoffe ebenso darauf, dass es jemanden geben wird, der mich liebevoll in den letzten Wochen meines Lebens betreuen wird.
Vielleicht ist es ein realitätsferner Wunsch anzunehmen, dass junge Leute die alten Menschen wieder so wertschätzen, wie es in früheren Generationen üblich war.
Wie heißt es so verzweifelt schön? „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“
„Wenn eena dot is, kriste'n Schreck. Denn denkste: ick bin da, un der is weg. Un hastn jern jehabt, dein Freund, den Schmidt, dann stirbste'n kleenet Sticksken mit.“
Kurt Tucholsky, dt. Schriftsteller, (1890 – 1935)
Teil 1 – Tod und Trennung
1. Kapitel – Das Leben ist endlich
Erkenntnis der Sterblichkeit
„Die Welt ist ein Schauplatz. Du kommst, siehst und gehst vorüber.“
Matthias Claudius, dt. Dichter (1740 - 1815)
Der Tod ist unvermeidlich
Der österreichische Neurologe Sigmund Freud (1856 – 1939) meinte: „… so wären wir natürlich bereit zu verstehen, dass der Tod der notwendige Ausgang alles Lebens sei, […] dass der Tod natürlich sei, unabdingbar und unvermeidlich. In Wirklichkeit pflegen wir uns aber zu benehmen, als ob es anders wäre.“
108 Milliarden Tote
Welche Gemeinsamkeiten haben folgende Persönlichkeiten? Kleopatra, Gaius Julius Caesar, Mutter Theresa, Napoleon Bonaparte, die russische Zarin Katharina, Papst Pius VI., der erste Mensch namens Lucy, Geheimrat Wolfgang von Goethe, Marie Curie, Leonardo da Vinci, Bertha Benz, Michael Jackson?
Sie sind alle tot!
Jeder von ihnen hat Großes geleistet. Viele andere Menschen haben mehr geleistet als ein Durchschnittsmensch und damit dafür gesorgt, dass sich die Menschheit weiterentwickeln konnte.
Neben diesen bekannten Persönlichkeiten gibt es noch viel, viel mehr, deren Namen heute vergessen sind. Angeblich sollen auf der Welt bisher weit über 108 Milliarden Menschen gelebt haben. 108 Milliarden Menschen!
Im Jahr 1800 lebten rund 1 Milliarde Menschen auf der Erde. Im Jahr 2000 waren es schon 6,15 Milliarden. Das Jahr 2025 beherbergt mehr als 8 Milliarden auf diesem Planeten.
Ein steiler Anstieg in den letzten Jahrhunderten. Jede dieser Milliarden Menschen muss/te sterben.
Was geschieht mit all den Verstorbenen?
Plötzlich da
Irgendwann realisiert die kleine Lisa, dass sie existiert. Das geschieht so etwa um das zweite Lebensjahr. Lisa ist einfach da. Sie erfreut sich ihres Lebens, ist neugierig auf das, was es alles zu entdecken gibt. Sie lacht und weint; sie freut sich und sie ist traurig.
Wird sie später über die ersten Lebensjahre befragt, fällt ihr auf, dass ihre erste Erinnerung in ihr drittes, viertes, eventuell fünftes Lebensjahr zurückreicht.
Obwohl sie auch die allerersten Monate gelebt hat, hat sie keine Erinnerung an diese Zeit. Sie kann sich auch überhaupt nicht erinnern, wie sie auf die Welt kam.
Dass sie auf die Welt kam, ist natürlich nachvollziehbar, sonst wäre sie ja nicht hier.
Plötzlich weg
Lisa wird älter. Irgendwann in der Pubertät beginnt Lisa sich Gedanken zu machen. Nämlich über ihr eigenes Ich.
Woher sie kommt, kann sie zumindest ungefähr nachvollziehen. Was wird in der Zukunft geschehen? Klar, sie wird älter werden, noch viel älter.
Der Tod liegt noch in ungreifbarer und unvorstellbarer Ferne.
Aber irgendwann wird er da sein. Lisa wird bewusst, dass auch sie eines Tages mit dieser Situation konfrontiert wird.
Das bereitet ihr großes Unbehagen, findet sie doch keine Erklärung, was nach ihrem Versterben mit ihr passieren wird.
Klar, sie kann sich vorstellen, dass das Leben erst mal weiterläuft – ohne sie. Und dann? Gut, dann läuft es weiter und weiter und weiter. Und was geschieht mit ihr?
Sie weiß es nicht. Es gibt auch niemanden, der ihr eine eindeutige und nachvollziehbare Antwort geben kann. Dieser Gedanke bringt sie an den Rand der Verzweiflung.
Es kann doch nicht sein, dass irgendwann einfach nichts mehr ist. Niemals mehr irgendetwas sein wird. Das menschliche Gehirn kann sich das nicht vorstellen.
Es kann sich die Zeit eines Tages, eines Jahres, eventuell auch eines Lebens vorstellen.
Aber es kann sich nicht den zeitlichen Abstand von 10.000, 100.000 Jahren oder gar der Ewigkeit vorstellen.
Für Lisa ist es hilfreich, dass es in diesem Zusammenhang den Glauben gibt. Der sagt ihr, dass sie beziehungsweise ihre Seele in den Himmel oder in die Hölle kommt; und dort ewig weiterleben könne.
Eine gewisse Beruhigung macht sich breit. Ist es wirklich so? Niemand weiß es, niemand kehrte von dort je zurück, um zu berichten.
Ein Leben nach dem Leben?
Der Glaube an ein Leben im Jenseits ermöglicht es, das Leben einigermaßen zuversichtlich weiterleben zu können. Viele suchen Unterstützung im religiösen Glauben, andere haben weitere Vorstellungen zum Sein nach dem Tod.
Soweit es Forscher zurückverfolgen können, gab es schon immer eine Art Totenkult. Zumindest gibt es genügend Funde, die darauf hinweisen, dass es schon zu sehr frühen Zeiten eine Art Aufbewahrungsstelle für die Verstorbenen gab.
Andererseits kann dieser Ort auch lediglich als Plattform dazu gedient haben, in eine andere Welt überzutreten.
Wer Angst vor der Zukunft nach seinem Versterben hat, findet im buddhistischen Glauben möglicherweise eine befreiende Denkweise.
Viele nehmen an, dass sie eine Wiedergeburt, eine Reinkarnation (als anderes Leben) erfahren werden. Deshalb ist für sie der Tod, der das aktuelle Leben beendet, nichts Trauriges, sondern ganz einfach ein Schritt in ein weiteres, neues Leben.
Es muss den Tod geben, wie es das Leben gibt
Der großartige Philosoph Sokrates (469 – 399 v. Chr.) schaffte es, noch an seinem Todestag seinen anwesenden Schülern logisch aufzuzeigen, dass das Leben aus Gegensätzen besteht.
Er meinte: Es kann nur ein Klein geben, wenn es auch ein Groß gibt. Schnell benötigt das Gegenstück Langsam und so weiter.
Demnach, so Sokrates‘ Logik, muss es Leben und Tod geben. Er trank ohne Angst das Gift aus dem Schierlingsbecher, wozu er ja genötigt worden war.
Er sah den Tod lediglich als Gegensatz zum Leben so an, wie Klein im Gegensatz zu Groß zu sehen ist. Seine Zuhörer berichteten von den letzten Stunden des Sokrates und erwähnten auch die Frage nach der Seele.
Obwohl Sokrates vorher logisch dank vieler Beispiele über notwendige Gegensätze argumentierte, konnte er nun argumentativ darlegen, dass die Seele unsterblich sein muss. Es könne keine sterbliche Seele geben.
Nachzulesen ist das im Handbuch ‚Platon Hauptwerke‘ vom Alfred Kröner Verlag Stuttgart, 1973, bearbeitet von Wilhelm Nestle.
Die eigene Endlichkeit
Der Jugendliche ist glücklich mit seinem Leben. Es bietet ihm eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten, Perspektiven und Varianten der Entfaltung.
„Denke an die Vorsorge in deinem Alter“, meinen die ‚Alten'. „Ja, ja“, denkt der ‚Junge'. „Eilt nicht, hat Zeit.“
Dann gibt es die erste Konfrontation mit dem Tod: Opa stirbt.
Inzwischen wurde aus dem Jugendlichen ein junger Mann, der erfolgreich mitten im Leben steht. Er hat viel zu tun. Gedanken an den Tod werden verdrängt.
Dann stirbt der eigene Vater. „Wow, jetzt schon?“ Und: „Ich hätte noch so viel mit ihm besprechen wollen.“
Zum ersten Mal schlägt die Trauer mit voller Wucht zu. Ein wenig mehr als 20, 25 Jahre trennen den Mann vom Vater.
„Habe ich nur noch 25 Jahre zu leben?“
Diese Frage stellt sich der älter gewordene Mann. Er steht kurz vor dem Rentenalter. Seine eigene Vergänglichkeit und Sterblichkeit wird ihm gnadenlos bewusst.
Unaufhaltsam tickt die Lebensuhr.
Siebzig Jahre, achtzig Jahre. „Was sagt die Statistik über die Sterblichkeit?“ „Wie lange habe ich noch?“ „Mein Gott, wie lange ist es her, als ich 18 Jahre alt wurde?“ „Eine halbe Ewigkeit.“
„Ich will meine letzten Jahre genießen.“
Die Jugend währt nicht ewig
Aus einem Volkslied mit Wurzeln im 18. Jahrhundert stammt dieser Refrain: „Lasst doch der Jugend, der Jugend ihren Lauf.“
Es sollte schon damals der Jugend das Recht einräumen, eigene Erfahrungen zu sammeln und das Leben vergnügt zu gestalten.
Die Zeit, in der die Jugend Aufgaben und Pflichten zu erledigen hat, würde noch früh genug kommen. Also sollen sie vorher die jugendliche Lebensfreude genießen.
„Genießt das Leben!“
Der Tod hält Einzug
„Jeder von uns hat nur ein Leben.“
Mark Aurel auch Marcus Aurelius, röm. Kaiser (121 - 180)
Das biologische Aus
„[Der Tod] ist ein holder, niedlicher Knabe“ meinte Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759 – 1805). Ob er da richtigliegt?
Tod findet sich im Mittelhochdeuten ‚tōd‘ und im Althochdeutschen ‚tōt‘. Der Tod bedeutet das biologische Aus.
Es ist der endgültige Verlust der lebensnotwendigen Funktionen. Der Tod hat eine starke Wirkung auf das Leben. Denn ohne ihn gibt es kein Leben.
Der Tod, häufig verhüllt und oft mit einer Sense in der Hand, wird seit dem Mittelalter als Figur und im Bild dargestellt. Er strahlt eine unterschwellige Stärke und Dominanz aus, weshalb er dem Menschen Respekt abverlangt.
Er hört auf verschiedene Namen. So wird er auch Gevatter Tod, Knochenmann, Freund Hein, Thantanos, Schnitter oder Sensenmann genannt.
So viele Varianten – und das nur für ein Wesen.
Und oft eines, das nicht aus Haut und Blut besteht, sondern als Skelett erscheint. Damit der Tod nicht sofort von jedem erkannt wird, trägt er meist eine Kutte mit Kapuze.
Hin und wieder zeigt er sich mit einem Stundenglas, das den Ablauf der Zeit und so die Vergänglichkeit des Lebens symbolisiert.
Der Tod bedeutet die Trennung von Leib und Seele
„Der Tod ist kein Schnitter, der Mittagsruhe hält; er mäht zu allen Stunden und schneidet sowohl das dürre wie das grüne Gras.“ (Miguel de Cervantes Saavedra, span. Schriftsteller 1547 – 1616).
Der Tod beraubt uns (nach Dr. Bernard N. Schumacher, Lehr- und Forschungsrat in Philosophie an der Universität Freiburg)
unserer Wünsche und Ziele
unserer Fähigkeiten
unseres Wissens
unseres Hab‘ und Guts
unseres Selbst
Der christliche Auferstehungsglaube hilft vielen Gläubigen, den Schrecken des Todes zu verarbeiten.
Wer nicht an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben glaubt, dem muss klar sein, dass der Tod ein absolutes Ende bedeutet.
Ist jemand verstorben, greifen bestimmte Rituale. So wird ein Wandspiegel verhängt. Wenn die Seele des Verstorbenen den Raum verlässt, soll sie sich nicht im Spiegel sehen. Sie könnte sich sonst erschrecken.
Andere meinen, ein unverhängter Spiegel würde einen neuen Todesfall herausfordern. Außerdem nicht vergessen, das Fenster des Sterbezimmers zu öffnen.
Weiterhin vermeiden, Türen zuzuschlagen; das tut der noch nicht entwichenen Seele weh.
So wird auch empfohlen, das Licht einzuschalten, um mögliche störende Geister zu vertreiben.
Der Tod kennt keine Zeit
Bleibt das Pendel der Uhr stehen, obwohl sie aufgezogen war, stirbt jemand aus dem nahen sozialen Umfeld. Andererseits: Ist jemand gestorben, wird die Uhr angehalten.
Da der Tod keine Zeit kennt, spielt die Uhrzeit für ihn keine Rolle mehr. Abgesehen davon wird dadurch die Todesstunde festgehalten.
Die Uhr wird auch angehalten, weil das regelmäßige Ticken der Uhr dem Herzschlag eines Menschen entspricht. Da dieser nun verstorben ist, ist sein Herzschlag nicht mehr wahrzunehmen.
Aberglaube oder Tradition?
Der Ehering wird dem Verstorbenen vom Finger abgenommen. Ansonsten wird der Partner innerhalb eines Jahres ins Grab folgen.
Früher wurde dem Verstorbenen eine Münze mitgegeben oder auf das geschlossene Auge gelegt.
Mit diesem Geld konnte der Fährmann bezahlt werden, der den Verstorbenen jetzt in die Welt der Toten übersetzte.
Wird der Verstorbene aus dem Haus getragen, immer so, dass die Füße vorauszeigen.
Das soll verhindern, dass der Verstorbene als Untoter wiederkehrt.
Aberglaube(n) oder nicht – sicher ist sicher.
Fällt dummerweise jemandem bei der Beerdigung unabsichtlich ein Gegenstand ins offene Grab, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Betreffende bald sterben wird.
Es empfiehlt sich, beim Leichenschmaus einen Platz für den Verstorbenen freizulassen. Ebenso wird für ihn eingedeckt, so als wäre er anwesend.
Übrigens: Wer an Karfreitag stirbt, wird selig.
Dass sich nur Mutige in ihrer Freizeit auf den Friedhof wagen, ist bekannt. Speziell nachts, rund um Mitternacht, treiben sich die Geister herum. Bekanntlich spukt es dann.
Auch die Mittagszeit um 12:00 Uhr gilt für einen Spaziergang auf dem Friedhof als kritisch.
Todesengel
Ein Engel erscheint. „Fürchtet Euch nicht!“ ruft er aus (Lukas 2). War seine Erscheinung vielleicht doch mit Schrecken begleitet?
Der Begriff Todesengel drückt einen Widerspruch in sich selbst aus. Engel steht für etwas Positives, Tod eher für das Gegenteil.
Umso gruseliger wird die Zusammensetzung dieser beiden Wörter zu dem Wort Todesengel.
Der Todesengel taucht an verschiedenen Stellen der Literatur auf. Je nach Quelle verfolgt er eine der drei Aufgaben.
Er ist ein Engel, der dem Lebenden den Tod bringt.Das bedeutet, dass der Mensch, sobald der Todesengel Kontakt mit ihm aufgenommen hat, sehr bald sterben wird.
Nicht ganz so schlimm scheint die zweite Variante.Der Engel begleitet den Menschen ins Jenseits. Er selbst tut ihm nichts, achtet aber darauf, dass der Mensch auf jeden Fall sein Ziel erreicht; nämlich den Tod beziehungsweise den Übergang in die Totenwelt.
Dritte Variante zur Aufgabe des Todesengels:Er empfängt den bereits verstorbenen Menschen am Eingang des Jenseits.
Obwohl der Todesengel nicht als aggressive Figur auftaucht, flößt er Furcht und Respekt ein.
Es bleibt zu hoffen, dass das Treffen mit ihm noch in weiter Ferne liegt.
Der böse Todesengel im Kittel
Allerdings gibt es noch eine ganz andere Bedeutung des Begriffes Todesengel.
Damit wird nämlich eine Person bezeichnet, oft jemand, der im Krankenhaus arbeitet und sich intensiv um die Kranken kümmert. Dabei erkennt er einige, die stark unter Schmerzen oder der Erkrankung leiden.
Seine ‚Hilfe‘: Er wird dort die Menschen – seiner Meinung nach – von seinen Qualen erlösen und töten.
Todesangst
„Mit dem Tod habe ich nichts zu schaffen. Bin ich, ist er nicht. Ist er, bin ich nicht.“
Epikur, gr. Philosoph (341 - 271/270 v. Chr.)
Der Tod der zwischenmenschlichen Kommunikation
Wer in Dialogen, bei Gesprächen oder in Vorträgen sehr gut aufpasst, kann merken, dass relativ häufig der Tod beziehungsweise die Eigenschaft tot in Redewendungen, Redensarten oder Zitaten eingebracht werden.
Der deutsche Wortschatz gibt eine Menge Wörter her, die ‚tot oder ‚tod‘ enthalten.
Durch das Voransetzen der Vorsilbe ‚tod‘ verstärkt sich das angehängte Wort. Dabei ist zu verstehen, dass ‚tod' im Sinne von völlig, äußerst, extrem gemeint ist.
Hier einige Beispiele von Adjektiven:
todernst
todkrank
todelend
todmüde
todstill
todbleich
todunglücklich
todtraurig
todsterbenskrank
todsicher
todschick
Jemand ist nicht nur krank, sondern todkrank.
Anders bei ‚tot‘, mit dem Buchstaben t am Ende, was einen Zustand oder ein Verhalten kennzeichnet und zum Tod führen kann.
totarbeiten
totschuften
totlachen
totsaufen
totärgern
totbeißen
totgehen
totschlagen
totreden
Folge: Der Bezeichnete stirbt.
Und schließlich gibt es noch eine ganze Reihe Wörter, die mit dem Nomen ‚Tod‘ beginnen. Hier ein Auszug:
Todesjahr
Todesdatum
Todesblässe
Todesmut
Todesflug
Todesfahrer
Todeserfahrung
Todesengel
Todesängste
Todeskuss
Todesacker
Todesfall
Todesfasten
Todesfurcht
Todesgefahr
Todesdrohung
Todeskampf
Todesschütze
Todeskandidat
Todessehnsucht
Interessant, dass alle Beispiele mit ‚Todes‘ beginnen. Der Todesfall ist der (mögliche) Fall des Todes. Alle Begriffe haben tatsächlich mit dem Tod zu tun.
Zwei Beispiele ohne ‚es‘: Todsünde und Todfeind. Der Todfeind ist nicht der Feind des Todes, sondern der eigene Feind. Der extrem eingestellt ist und den (eigenen) Tod einkalkuliert.
Gesprochenes drückt aus, was der Mensch denkt. Zeigt sich, dass häufig das Wort ‚Tod‘ mit seinen Varianten auftritt, ist es nachvollziehbar, dass das Thema rund um den ‚Tod‘ untrennbar zum Leben gehört.
Ich habe Angst vor dem Tod
„So ist also der Tod, das schrecklichste der Übel, für uns ein Nichts.“ Aus Epikurs (um 341 – 271 v. Chr.) Brief an Menoikeus. Epikur, siehe auch das Zitat oben bei der Überschrift, scheint dem Tod gegenüber angstfrei zu sein.
Andere aber nicht: Das Wort Todesangst allein kann einem schon Angst einjagen. Tatsächlich drückt das Wort ja aus, dass der Mensch Angst vor dem Tod hat.
Demnach wird er sich nicht unnütz in Gefahrensituationen begeben, die das Risiko des eigenen Todes nach sich ziehen.
Aus anderem Blickwinkel ist die Todesangst als generelle Angst vor dem Tod zu sehen. Werden Menschen hierzu befragt, äußern viele ein Angstgefühl.
Andererseits ist es wohl allen ziemlich klar, dass kein Mensch dem Tod entgehen kann. Es kann hier von einem Generalisierungsverhalten gesprochen werden.
Das bedeutet: Da ja alle über kurz oder lang mit dem eigenen Tod konfrontiert werden, gibt es keine allzu große Notwendigkeit vor dem eigenen Tod wirklich Angst zu haben.
Abgesehen davon: „Es bringt ja sowieso nichts.“ Am besten: Der Tod wird akzeptiert und die Angst davor meistens auch.
Ich habe tödliche Angst
Das Wort Todesangst wird auch in anderem Zusammenhang verwendet.
Frau Schubert schreckt mitten in der Nacht aus dem Schlaf auf. Hatte sie nicht ein verdächtiges Geräusch wahrgenommen? Da! Da war es wieder! Der Schreck lässt fast das Blut in ihren Adern gefrieren. Schlagartig kombiniert Frau Schubert: Da ist ein Einbrecher in der Wohnung.
Starr vor Schreck und mit weit aufgerissenen Augen sieht sie zur Schlafzimmertür.
In diesem Augenblick wird von außen die Klinke nach unten gedrückt – die Tür öffnet sich langsam. Frau Schubert spürt Todesangst, die ihr förmlich den Hals zuschnürt.
Diese Konfrontation kann als Todesangst bezeichnet werden. Findet die Begegnung tatsächlich statt, ist das natürlich eine äußerst gefahrenvolle Situation.
Besteht die Angst allerdings ‚nur‘ diffus beziehungsweise generell, ist sie nicht greifbar.
Treten Ängste dieser Art häufiger auf, ist es sicherlich sinnvoll, sich Rat bei einem Profi zu holen und/oder sich mit anderen darüber auszutauschen.
Vielleicht gab es einmal ein Erlebnis in früheren Jahren, das diese Angst entstehen ließ.
Todesdrohung
Jens Mertens öffnet seinen Briefkasten. Ein Briefumschlag fällt ihm in die Hand. Er bemerkt gar nicht, dass kein Absender darauf vermerkt ist. Er reißt den Umschlag auf und zieht einen zusammengefalteten Zettel hervor.
Überrascht liest er einen kurzen Text, der aus ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben zusammengesetzt wurde.
„Wenn du nicht bis morgen Mittag um 12:00 Uhr im Papierkorb an der roten Bank am Flamingo-Teich 10.000 Euro deponierst, bist du ein toter Mann.“