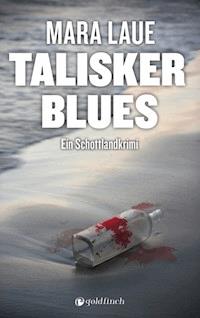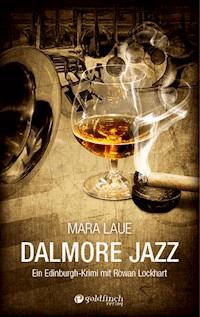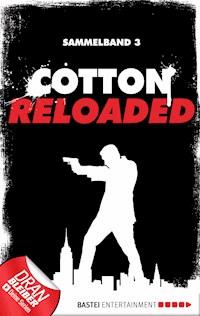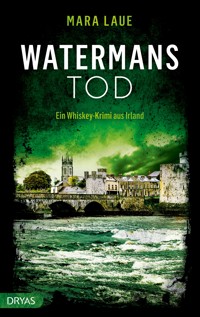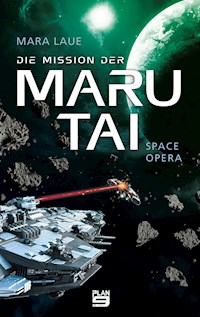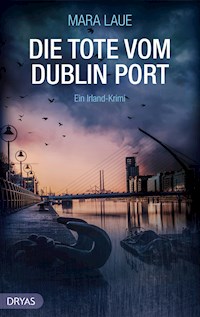Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag edition krimi
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kavi Shan verdient ihren Lebensunterhalt als Meisterdiebin in Dublin und wurde noch nie erwischt. Doch als sie im Auftrag ihres Hehlers eine Figurine stiehlt, geht alles schief: Der Eigentümer wird ermordet, kurz darauf auch Kavis Hehler. Die Aufzeichnung seiner Überwachungskamera zeigt Kavi als seine letzte Kundin, die nun des zweifachen Mordes verdächtigt wird. Doch nicht nur die Polizei ist hinter ihr her, sondern noch andere Parteien, die die Figurine haben wollen. Um ihre Haut zu retten, bleibt Kavi nur eine Möglichkeit: Sie muss mit der Polizei zusammenarbeiten. Doch damit riskiert sie nicht nur ihre Freiheit, denn für sie steht noch sehr viel mehr auf dem Spiel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mara Laue
Todesgruß aus Dublin
Irland-Thriller
Irland-Thriller
1.
Dienstag, 27. September
Das Schloss starrte Kavi an. Kavi starrte zurück. Knack mich doch, wenn du kannst!, glaubte sie im Geist zu hören, wie das Ding sie herausforderte. Sie lächelte. „Nichts leichter als das“, flüsterte sie und griff zu ihrem Universaldietrich.
Fünf Sekunden später war das Schloss offen und die dazugehörige Tür ebenfalls. Kavi schob sie lautlos auf und lauschte. Die Alarmanlage schwieg. Etwas anderes hätte Kavi auch gewundert; schließlich hatte sie die Anlage lahmgelegt. Aber Vorsicht war die Mutter der Überlebenden; ganz besonders des unerkannten Entkommens aller Mitglieder der Diebeszunft, die etwas auf sich hielten. Und Kavi war eine Meisterin ihres Faches, die sich rühmen konnte, noch niemals erwischt worden zu sein. Sie lächelte bei dem Gedanken daran, dass sie nicht nur in ihren Kreisen, sondern erst recht bei der Polizei als ein Geist galt, von dem man zwar wusste, dass er existierte, weil die Bestohlenen selbstverständlich entdeckten, dass ihnen etwas gestohlen worden war. Weil sie aber niemals Spuren hinterließ, gab es nicht den geringsten Hinweis auf sie. Man wusste nicht einmal, ob der Geist ein Mann oder eine Frau war.
Kavi schlüpfte in den Flur hinter der Tür und schloss sie so leise, wie sie sie geöffnet hatte. Das Nachtsichtgerät vor ihren Augen machte ihr die Bewegung im Haus leicht und verhinderte, dass von außen jemand den Schein einer Taschenlampe bemerkte und die Polizei rief. Die Beute, auf die sie es heute abgesehen hatte, befand sich im Schlafzimmer des Besitzers im ersten Stock. Kavi schlich nahezu lautlos die Treppe hinauf. Die Lautlosigkeit war nicht nur ihrer jahrelang trainierten Kunst des Schleichens geschuldet, sondern auch einer Sonderbeschichtung ihrer Schuhsohlen, die auch ohne Schleichmodus kaum ein Geräusch auf dem Untergrund verursachten; erst recht nicht auf dem Teppichläufer, mit dem die Stufen belegt waren.
Sie erreichte den Flur vor den Schlafzimmern, blieb stehen und lauschte. Alles war still. Unter der Tür des fraglichen Zimmers schimmerte kein Licht hindurch. Demnach schlief das Opfer ahnungslos. Kavi hatte die Räumlichkeiten des Hauses über zwei Wochen lang von außen ausgekundschaftet – eine Leichtigkeit, denn wie so viele in Kavis Augen extrem sorglose Menschen hatte der Mann, dem das Haus gehörte, riesige Panoramafenster und keine blickdichten oder überhaupt Gardinen davor. Jeder konnte von draußen alles sehen, was er tat. Einschließlich der Schublade, in der er seine Brieftasche mit allen Kreditkarten über Nacht aufbewahrte.
So viel Leichtsinn musste bestraft werden. Und nicht nur der. Tom Hogan besaß mehrere Schneidereien, in denen er Näherinnen zu Dumpinglöhnen im Akkord schuften ließ. Sie lebten im Elend in einer Massenunterkunft, die ebenfalls Hogan gehörte und für die er seinen Sklavinnen einen Teil ihres ohnehin nicht nennenswerten Lohns als Miete abzog. Aber er verdiente sich durch ihre Arbeit eine goldene Nase. Und teure Uhren, die er sammelte wie andere Leute Briefmarken. Kavi würde ihn um ein paar davon erleichtern.
Sie drückte die Klinke der Schlafzimmertür hinunter und schob sie Zentimeter für Zentimeter auf, gerade weit genug, dass sie ins Zimmer schlüpfen konnte. Diesmal lehnte sie die Tür nur an, statt sie vollständig zu schließen, denn das hätte ein wenn auch leises Geräusch verursacht. Und man konnte nie wissen, wie tief der Schlaf eines Menschen war, in dessen Zimmer man eindrang. Manche Leute schliefen beim größten Lärm weiter, aber wachten bei leisen Geräuschen auf, weil ihr Unterbewusstsein damit eine Bedrohung verband: einen sich anschleichenden Feind. Was in Kavis Fall in gewisser Weise durchaus zutraf.
Tom Hogan wachte nicht auf. Er lag auf der Seite mit dem Rücken zur Tür, hatte sich bis zum Hals in die Bettdecke gewickelt und schnarchte leise. Gut. Wer schnarchte, schlief fest.
Kavi huschte zum Mondrian-Gemälde an der Wand gegenüber dem Panoramafenster. „Der rote Baum“ war eins der frühen Werke des Künstlers, als er noch nicht farbigen Flächen in Rechteckmustern den Vorzug gegeben hatte, und von entsprechendem Wert – wenn es echt gewesen wäre. Hogan besaß eine sehr gut gemachte Nachahmung, denn das Original hing in einem Museum in Den Haag. Doch Kavi hatte es ohnehin nicht auf Gemälde abgesehen. Und auch nicht auf Hogans Kreditkarten.
Sie schob ihre Hand unter den Rahmen und klappte es zur Seite. Kein Alarm schrillte los. Kavi lächelte. Wenn alle Alarmgeräte ans Stromnetz angeschlossen waren, fielen auch alle gleichzeitig aus, wenn dessen Zufuhr gekappt wurde. Hinter dem Bild – wenig einfallsreich – verbarg sich der Safe, ein Modell mit einem mechanischen Drehschloss, das Hogan für den Fall eines Stromausfalls gewählt hatte, um auch dann noch an seinen Inhalt zu gelangen. Schlau gedacht, aber der Mann war dennoch leichtsinnig gewesen. Wann immer er den Safe öffnete, hatte er sich nicht mal die Mühe gemacht, das Drehschloss mit seinem Körper zu verdecken, um ein Ausspähen zu verhindern. An Leichtsinn und bodenloser Sorglosigkeit kaum noch zu überbieten. Kavi hatte die Kombination problemlos von ihrem Beobachtungsplatz gegenüber dem Fenster mit dem Fernglas sehen können.
Das leise Klicken der Drehbewegungen weckte Hogan nicht. Fast lautlos entriegelte die Tür, und Kavi zog sie auf. Vor ihr lagen die Schätze, auf die sie es abgesehen hatte, in einem Sammelkasten mit Glasdeckel: Uhren. Fünfzehn Stück. Und um ihr die Auswahl zu erleichtern, klebte an jedem Fach ein Label, das ihr die Marke verriet. Nicht, dass das nötig gewesen wäre; Markenuhren und ihren Wert zu kennen, gehörte zu ihrem Beruf. Das preiswerteste Stück in Hogans Sammlung kostete schlappe dreißigtausend Euro, das teuerste hundertachtzigtausend. Kavi nahm die Patek Philippe für hundertzwanzigtausend Euro, die Omega Speedmaster Moonwatch für zweiundsechzigtausend und die Vacheron Constantine für hunderttausend. Hogan trug sowieso immer nur dieselbe Uhr, die auf seinem Nachttisch lag. Weil die Audemars Piguet Royal Oak ihr persönlich gefiel, nahm sie die auch noch mit. Schließlich war sie mit hunderttausend Euro Wert auch nicht zu verachten.
Eine etwa dreißig mal zwanzig mal zehn Zentimeter große Holzschatulle neben der Uhrenbox erregte Kavis Neugier. Ein Blick zum Bett zeigte ihr, dass Hogan sich nicht gerührt hatte. Außerdem schnarchte er immer noch rhythmisch vor sich hin. Sie nahm die Schatulle, die nicht einmal ein Schloss besaß und klappte den Deckel hoch. Das Ding war bis zum Rand gefüllt mit Banknoten, sauber gebündelt und mit Banderolen versehen. Sie zählte die darauf gedruckten Werte zusammen und kam auf zweihunderttausend Euro. Ein netter Bonus, denn das Geld war garantiert nicht zum Bezahlen des Hungerlohns von Hogans Angestellten gedacht. Kavi steckte die gesamte Summe zu den Uhren in ihren „Beutesack“ und wollte die leere Schatulle an ihren Platz zurückstellen.
Darunter stand noch eine weitere Box, etwas größer als die Geldschatulle. Kavi zögerte. Lass es, Kavi! Nur nicht gierig werden! Aber ein Blick hinein konnte nicht schaden. Sie stellte die leere Schatulle auf den Uhrenkasten, nahm die Box und sah hinein. Sie war gefüllt mit Pässen, deren Aufdrucke ihre Herkunft aus verschiedenen asiatischen Ländern verrieten. Kavi presste die Lippen zusammen und hatte Mühe, ihre Wut zu beherrschen. Sie hatte zwar geahnt, dass Hogans Lohnsklavinnen nicht unbedingt freiwillig für ihn arbeiteten und einige wohl auch nicht legal im Land waren, aber hier war der Beweis. Und mit dem konnte – würde sie dem Kerl das dreckige Handwerk legen. Aber das wollte sorgfältig geplant und vorbereitet sein.
Sie steckte auch die Pässe ein, stellte alles im Safe wieder so hin, wie sie es vorgefunden hatte, und schloss dessen Tür. Sie klappte den Mondrian an seinen Platz zurück und vergewisserte sich mit einem letzten Blick, dass Hogan immer noch schlief. So lautlos, wie sie gekommen war, schlich sie zur Schlafzimmertür, schlüpfte hinaus, schloss sie geräuschlos und ging langsam zur Haustür. Langsam, weil für Eile kein Grund vorlag und die unter Umständen dazu geführt hätte, dass sie vielleicht stolperte oder irgendwo gegen stieß und Lärm verursachte. Musste nicht sein. An der Haustür blieb sie stehen und spähte durch deren Glasscheibe nach draußen. Die Straße lag verlassen da und niemand führte mitten in der Nacht seinen Hund aus.
Sie verließ das Haus und schloss die Tür wieder ab. Eine Meisterin wie sie konnte das problemlos mit einem Dietrich erledigen. War nur eine Frage der Übung. Hogan würde alles unverändert vorfinden, wenn er am Morgen erwachte. Je nachdem, wann er wieder in seinen Safe blickte, was er nach Kavis Beobachtungen nur einmal, höchstens zweimal die Woche tat, würde er den Diebstahl erst in ein paar Tagen bemerken und nicht sagen können, wann der passiert war. Oder wie. Kavi lächelte, nahm das Nachtsichtgerät und die Sturmhaube ab, zog die Handschuhe aus und steckte alles in ihre Tasche. Wie eine normale Spätheimkehrerin schlenderte sie die Straße hinunter. Als sie weit genug von Hogans Haus entfernt war, um nicht mehr von dessen Überwachungskameras erfasst zu werden, nahm sie ihr Smartphone und aktivierte wieder dessen Alarmanlage und die Kameras, in die sie sich gehackt hatte.
Sie ging zu ihrem Fahrrad, das sie ein paar Straßen weiter abgestellt hatte, und fuhr nach Hause.
Der Raubzug hatte sich mal wieder gelohnt.
* * *
Kavi schloss ihre Wohnungstür auf und bedauerte, dass ihr weder Hund noch Katze freudig entgegen kamen. Doch abgesehen davon, dass ihr die Zeit für die artgerechte Haltung eines Tieres fehlte, konnte sie sich ein Haustier nicht leisten. Nicht einmal einen Vogel. Ein Aquarium wäre möglich gewesen, aber Kavi konnte Fischen nichts abgewinnen. Und auch die waren nicht völlig sicher. Haustiere hatten die Angewohnheit, Haare, Federn und Schuppen zu hinterlassen, die, ganz gleich wie vorsichtig sie war und wie sorgfältig sie die abzubürsten versuchte, an ihrer Kleidung hafteten. Die Gefahr, dass sie ein übersehenes Haar oder ein Federhärchen bei einem Einbruch zurückließ, war zu groß.
Selbstverständlich bedeutete das nicht zwangsläufig eine Entdeckung. Dafür hätte das Corpus Delicti überhaupt erst einmal gefunden werden müssen. Und wenn es gefunden wurde, gab es etliche Möglichkeiten, wie die Hausbewohner selbst es eingeschleppt haben könnten. Außerdem nützte das Ding nichts, wenn man keine Vergleichsprobe hatte, die das Tier eindeutig seiner Besitzerin zuordnen konnte. Aber um die zu bekommen, hätte Kavi in Verdacht geraten müssen, vor Ort gewesen zu sein. Und das war bisher unmöglich. Sie plante ihre Coups zu sorgfältig und hinterließ keine Spuren. Aus diesem Grund trug sie bei ihren Einbrüchen immer schwarze Latexhandschuhe und eine Sturmhaube, unter der sie ihr Haar verbarg, damit auch nicht eines herausfallen konnte. Und für manche Coups verkleidete sie sich mit Perücken und Masken, damit man sie nicht identifizieren konnte; was obendrein richtig Spaß machte.
Doch auch die sorgfältigste Planung konnte nicht verhindern, dass alle Vorsichtsmaßnahmen durch einen dummen und unvorhersehbaren Zufall ausgehebelt wurden. Ein Haustier zu halten war ein Risiko, und mochte es noch so winzig sein, das sie sich nicht leisten konnte.
Das Blinken ihres Festnetzanschlusses signalisierte einen Anruf in ihrer Abwesenheit. Sie hörte die hinterlassene Nachricht ab.
„Hi, hier ist Onkel Gordon. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich habe Sehnsucht nach einer netten Plauderei mit meiner Lieblingsnichte bei Tee und Scones. Wann immer du kommst, ich freue mich drauf.“
Kavi lächelte. Gordon Dempsey war nicht ihr Onkel, sondern ihr Hehler. Diese unverfängliche Einladung war der Code dafür, dass er einen Auftrag für sie hatte, der gemäß dem Schlüsselwort „Sehnsucht“ dringend war. Dublins Diebesgilde war hervorragend organisiert und vor allem vernetzt. Schon seit dem Mittelalter. Zwar betätigten sich heutzutage unzählige Kleinkriminelle als Diebe und Taschendiebe auf eigene Rechnung, aber die alte, tatsächlich wie eine Gilde organisierte Verbindung existierte immer noch. Ihre Mitglieder waren stolz darauf, ihr anzugehören, denn die Gilde nahm nicht jeden auf.
Kavi legte ihre Tasche auf den Tisch und zog sich neue Einweghandschuhe an, bevor sie ihre Beute herausnahm und begutachtete. Ja, die Aktion hatte sich gelohnt. Die Uhren waren nahezu neu. Falls Tom Hogan eine von ihnen jemals getragen hatte, dann vermutlich nur einmal oder wenige Male. Natürlich würde „Onkel“ Gordon Kavi nicht den vollen Wert bezahlen, denn er musste schließlich auch leben und verdienen, wie er nie müde wurde zu betonen. Aber zweihunderttausend Euro würde sie rausschlagen können, vielleicht zweihundertfünfzigtausend. Das reichte mehr als ein ganzes Jahr zum Leben. Doch den größten Teil würde sie in ihre „Altersvorsorge“ stecken, für die sie ein Polster ansparte, um eines nicht allzu fernen Tages ein gutes und vor allem sorgloses Leben führen zu können. Dazu noch die Zweihunderttausend in bar ... Aber die würde Kavi nicht behalten; zumindest nicht vollständig.
Sie nahm die Pässe und sah sie durch. Alle dreiunddreißig enthielten einen Einreisestempel, also waren die Besitzerinnen – ausnahmslos Frauen – legal eingereist. Offenbar hatte Hogan die Pässe einkassiert, um sie damit zu erpressen und zu verhindern, dass sie seiner Tretmühle den Rücken kehrten und sich besser bezahlte Arbeit suchten. Nun, diese Möglichkeit würde Kavi ihnen geben.
Sie kopierte die Pässe. Einen Kopierer, Scanner und mehr als einen Drucker zu haben, gehörte mit zu ihrem Equipment. Ebenso ein Laptop und ein Notebook, deren IP-Adressen nicht mit ihr in Verbindung gebracht werden konnten. Sie nahm den Laptop und hackte sich in die Überwachungskameras von Hogans drei Schneidereien ein.
Zu ihrer Überraschung wurde dort gearbeitet. Ein Blick auf die Uhr zeigte drei Uhr siebenundzwanzig morgens. Der Kerl ließ die Sklavinnen rund um die Uhr schuften. Und unter üblen Bedingungen. Ein Schwenk in die Runde offenbarte eklatante Sicherheitsmängel. Nirgends gab es Feuerlöscher, nackte Kabel verliefen an Stellen, wo ein Brand fast schon programmiert war, ein Notausgang existierte nicht. Obendrein waren die Fenster vergittert und diese Gitter mit Vorhängeschlössern abgeschlossen. Zusätzlich waren die Fenster von außen mit etwas bedeckt, das wie Spanholzplatten aussah, die von innen nicht entfernt werden konnten. Lüften unmöglich. Die Luft in den Räumen, in denen acht bis zwölf Frauen arbeiteten, musste höllisch sein. Und das Tageslicht sahen sie auch erst nach Feierabend wieder, falls dann schon die Sonne aufgegangen war. Gäbe es nicht wenigstens die Deckenbeleuchtung, wäre das verbotene Dunkelhaft reinsten Wassers.
Die Gesichter der Frauen zeigten ausnahmslos Müdigkeit und Erschöpfung, die sich auch in ihrer Körperhaltung ausdrückte. Sie erinnerten Kavi an den Zustand ihrer Mutter, die auch im Hauptberuf als Näherin gearbeitet hatte, wenn auch nicht für einen Sklaventreiber wie Hogan. Nach dem Tod ihres Vaters hatte sie drei Jobs angenommen, um nicht nur Kavi und sich durchzubringen, sondern um auch genug Geld zu sparen, damit Kavi die beste Ausbildung bekam, die Geld kaufen konnte, natürlich am renommierten Trinity College. Jeden Abend war ihre Mutter total erschöpft nach Hause gekommen, und ihr Leben hatte nur aus Arbeit, Schlafen und die Fürsorge für Kavi bestanden.
Doch wann immer Kavi ihr versichert hatte, sie brauche keine Topausbildung, kein Studium, sondern könne einen guten Beruf erlernen und frühzeitig Geld verdienen, damit die Mutter nicht mehr so viel schuften musste – ihre Mutter hatte das kategorisch abgelehnt: „Nur durch eine gute Ausbildung und einen guten Beruf bringst du es zu etwas. Oder willst du so enden wie ich?“
Das wollte Kavi nicht. Also hatte sie sich gefügt und sich alle Mühe gegeben, ihr Studium Computer Engineering und Informatik bestmöglich und vor allem schnellstmöglich abzuschließen. Anschließend hatte sie einen Job als Software-Entwicklerin für eine Firma angenommen, die Computerspiele herstellte, und mit ihrem Verdienst ihrer Mutter ein besseres Leben verschafft. Aber die hatte sich nur schwer von den allzu arbeitsreichen Jahren der Vergangenheit erholt. Kein Wunder, denn sie hatte vor ihrem Arbeitsbeginn in der Schneiderei noch einen Putzjob erledigt und am Wochenende in einem Pub gearbeitet. Vor ein paar Jahren hatte sie sich neu verliebt und war mit ihrem neuen Mann, einem reichen Schafzüchter, auf seine riesige Farm in Australien gezogen. Seitdem blühte sie auf, und es ging ihr gut.
Aber sie hätte durchaus eine von Hogans Nähsklavinnen sein können. Angesichts der Zustände in seinen Schneidereien bereute Kavi, dass sie ihm nur vier Uhren gestohlen hatte und nicht alle. Sie nahm einen jungfräulichen USB-Stick aus seiner Verpackung und kopierte die Aufnahmen darauf. Mit besonders schönen Großaufnahmen der männlichen Aufseher, die einen von ihnen zeigten, wie er eine der Näherinnen begrapschte, die ihn weinend abzuwehren versuchte. Kavi bedauerte, dass sie nicht vor Ort war, um dem Kerl so kräftig in die Eier zu treten, dass er danach im Knabenchor singen konnte. Sie musste sich damit begnügen, dass er sein Fett abbekam, sobald diese Bilder bei den Behörden ankamen.
Sie holte einen großen Briefumschlag aus der Mitte der Lagerbox, um nicht zu riskieren, dass vielleicht ihre Fingerabdrücke schon auf dem obersten Umschlag waren, steckte die Kopien und den Stick hinein und druckte einen an die Garda Síochána, Abteilung Wirtschaftsverbrechen adressierten Aufkleber mit dem Vermerk „Dringend!“ aus und pappte ihn auf den Umschlag. Da Hogan für seine Lohnsklavinnen garantiert keine Steuern oder Sozialabgaben zahlte, erschien ihr dieses Ressort die richtige Abteilung zu sein. Falls nicht, würde man dort den Brief weiterleiten. Kavi hoffte, dass sich die Leute damit nicht allzu viel Zeit ließen.
Sie druckte noch ein Blatt aus mit Hogans Adresse, den sie als Betreiber der Schneidereien nannte, und die Adressen der Arbeitsstätten und legte es dem Brief bei, klebte den Umschlag zu und frankierte ihn ausreichend. Nachher würde sie ihn auf dem Weg zur Arbeit in einen Briefkasten werfen – ebenfalls mit behandschuhten Händen, damit nirgends eine DNA-Spur oder gar Fingerabdrücke von ihr zu finden waren. Keine Spuren zu hinterlassen war in ihrem Job überlebenswichtig und die Benutzung von Handschuhen, nicht nur Einweghandschuhen, zu ihrer zweiten Natur geworden.
Nächster Schritt. Sie nahm sich die Pässe noch mal vor und schrieb Adressetiketten mit jedem Namen einer Frau, die sie ausdruckte und auf Briefumschläge klebte, in die sie die Pässe steckte. Zusammen mit jeweils sechstausend Euro von den Zweihunderttausend, um die sie Hogan erleichtert hatte. Zweitausend Euro blieben übrig. Kavi behielt sie als Aufwandsentschädigung. Sie klebte die Umschläge zu und steckte sie in eine Plastiktüte. Da sie wusste, wo Hogan die Frauen untergebracht hatte – zum Glück in einer Gegend ohne Verkehrskameras –, würde sie die Umschläge nachher in den dortigen Hausbriefkasten werfen. Wenn die Frauen klug waren, benutzten sie das Geld, um in ihre Heimat zurückzukehren. Hoffentlich aber zumindest dafür, Hogan zu entfliehen.
Letzter Schritt für diese Nacht. Kavi verstaute die Beute, ihre „Arbeitskleidung“ und die zweitausend Euro in ihrem Geheimversteck. Sie hatte der Fußblende um den hohlen Boden ihres Kleiderschranks eine Schublade verpasst, die so mit Zierklemmen arretiert war, dass niemand auf den Gedanken käme, man könnte diese Klemmen lösen und eine Schublade aufziehen. Die wiederum war in mehrere Fächer unterteilt, die alle mit Polstermaterial oder Kleidung gefüllt waren, und zwar in einer Weise, dass ein „Klopftest“ keinen Hohlraum verriet, falls sich jemand bemüßigt fühlen sollte zu prüfen, ob sich hinter der Blende einer verbarg.
Das hinterste Fach enthielt einen Stapel von Geldbündeln, das daneben verschiedene gefälschte Pässe, Geburtsurkunden und andere Unterlagen für falsche Identitäten sowie Kreditkarten für Konten auf diese falschen Namen. Aber das waren nicht nur Pseudonyme, sondern vollständige falsche Persönlichkeiten, deren Aussehen auf den Ausweisfotos dem von Kavi nicht ähnelte. Sie ging kein Risiko ein und hatte in mühevoller Kleinarbeit und nach einem entsprechenden Lehrgang Theatermasken angefertigt, die ihr ein völlig anderes Gesicht gaben. Verschiedene Perücken dazu und ausgestopfte Kleidungsstücke, die sie dicker machten als sie war – und perfekt waren die neuen Identitäten.
Mit denen hatte sie die anderen Konten eröffnet und zahlte jeden Monat mit der einen Identität einen regelmäßigen Betrag auf das Konto der anderen ein. Auf den einen Einzahlungsbeleg schrieb sie als Verwendungszweck „Miete“, auf den anderen „Kreditrückzahlung“, auf einen weiteren „x-te Rate Möbelkauf“ und so weiter. Selbstverständlich hatte sie für jede dieser Überweisungen in bar eine eigene Bankfiliale; nur für alle Fälle. Auf die Weise ließ sie das Geld für die Beute ihrer Raubzüge sauber verschwinden, und auf dem Konto von Kavindra Shan gab es nur die Einzahlungen des Gehalts und der Boni aus ihrem regulären Job.
Kavi verstaute ihre Beute in einem der Fächer, die zweitausend Euro im Geldfach und verriegelte die Schublade. Sie zog die Einweghandschuhe aus und vergrub sie im Abfalleimer unter anderen Abfällen. Für heute Nacht war ihre Arbeit getan. Zeit ins Bett zu gehen. Mit etwas Glück würde sie von dem Leben in Reichtum träumen, das sie sich wünschte.
* * *
2.
Gordon Dempseys Pfandleihhaus lag in der Marlborough Street gegenüber dem Department of Education und Tyrone House mit Blick auf die Skulptur „The Wishing Hand“ von Linda Brunker. Weil die Skulptur einer Riesenhand auch eine Touristenattraktion und ein beliebtes Fotomotiv war und man vom dortigen Standort aus Gordons Geschäft sehen konnte, lockten die Auslagen so manche Kunden an. Gordon hatte sie zudem so ausgestellt, dass sie in ihrer Gesamtheit wie ein Stillleben wirkten: Schmuck zu Füßen von Musikinstrumenten, Perlenketten um den Hals einer Mandoline wie um den Hals einer Frau drapiert, Kelche, die mit einer Sammlung von Gold- und Silberringen gefüllt waren, und Bilder, die so aufgehängt waren, dass sie nicht nur den Hintergrund zu diesen Kostbarkeiten bildeten, sondern auch als Blickschutz von außen dienten. Der originelle Name „The Pawn’s Shop“, der mit der Doppelbedeutung des Wortes „Pawn“ für ein Pfand und die Bauernfigur im Schach spielte, und das Bild einer weißen und einer schwarzen Bauernfigur auf einem Schachbrettausschnitt als Wahrzeichen auf dem Namensschild taten ein Übriges, um Kunden anzulocken.
Kavi öffnete die Tür und wurde durch ein Glockenspiel angekündigt. Gordon saß an seinem Arbeitstisch einem Kunden gegenüber, der eine Perlenkette begutachtete. Er blickte beim Klang des Glockenspiels auf.
„Kavi!“ Mit ausgebreiteten Armen kam er zu ihr und umarmte sie. „Wie schön, dass du mich mal wieder besuchst!“ Er legte den Arm um sie und schob sie zum Tisch. „Meine Nichte“, erklärte er dem Kunden. „Geh schon mal vor.“ Er deutete auf die Tür hinter dem Tisch, die in seinen privaten Raum führte, der auch als Büro fungierte. „Ich komme gleich. Tee steht auf dem Stövchen und die Scones auf dem Tisch.“
Kavi nickte dem Kunden zu, der zurücknickte, und ging in das Hinterzimmer. Gordons Show, dass sie eine Verwandte, sei, galt nicht nur etwaiger Kundschaft, sondern auch der Aufzeichnung der Überwachungskameras. Er gab sich nicht nur seriös, was sein Auftreten – immer im Anzug – und das penible Aussehen seines Shops betraf, sondern auch hinsichtlich der Sicherheit und vor allem der Lauterkeit seines Geschäfts, vielmehr seiner Geschäfte. Die Kameras waren so ausgerichtet, dass eine den Eingang im Visier hatte, eine Rundum-Kamera den gesamten Raum überblickte und eine speziell auf den Arbeitstisch zoomte. Das sollte nicht nur verhindern, dass jemand etwas einsteckte oder einen Gegenstand gegen eine Fälschung austauschte, wenn Gordon nicht hinsah, es sollte auch der Polizei seine Seriosität beweisen, denn er hob die Aufzeichnungen ein ganzes Jahr lang auf.
Ins Hinterzimmer ließ er nur Leute, die er wie Kavi als Verwandte deklarierte, was er durch betont freundliche Begrüßungen mit Umarmungen demonstrierte. Sollte die Polizei mal wieder bei ihm vorstellig werden und Einsicht in die Überwachungsaufzeichnungen verlangen, war Gordon gerne bereit, ihnen den auch ohne richterlichen Beschluss zu gewähren. Und seine darauf erfassten „Lieferanten“ konnte er aufgrund der überschwänglichen Begrüßung glaubhaft als Verwandte und Freunde deklarieren. Sollte einer von ihnen jemals auffliegen und in den Fokus der Garda geraten, ließ Gordon ihn oder sie sofort fallen, erteilte Hausverbot und distanzierte sich bei Nachfragen der Polizei nachdrücklich von dieser Person. Kavis Wissens nach war das aber erst ein einziges Mal passiert.
Sie nahm einen Becher vom Regal, schenkte sich Tee ein und nahm sich einen Scone. Gordon und sie kannten sich schon lange. Genau genommen verdankte sie ihm indirekt ihre hervorragende Ausbildung, die sie zum „Geist“ hatte werden lassen.
Als sie ihm ihre erste Beute zum Verkauf angeboten hatte, hatte er sie gefragt, warum sie Menschen bestahl. Sie hatte ihm die Wahrheit gesagt, dass dem ein Hass auf Leute wie Tom Hogan zugrunde lag, weil sie schon als Kind immer wieder erleben musste, dass sie, ihre Mutter und sogar ihr Vater trotz seines Berufs als Garda-Beamter für allzu viele Leute Menschen zweiter Klasse waren, weil ihre Haut nicht „weiß“ war. Diejenigen, die sich mit Diskriminierung und Verachtung besonders hervorgetan hatten, gehörten nach Kavis Erfahrung größtenteils zur „gehobenen Klasse“, führten ein privilegiertes Leben, hatten Geld ohne Ende – und eine Scheißangst, dass „die Fremden“ auch ein Stück vom Kuchen beanspruchen könnten und dadurch ihr Reichtum und ihre Privilegien geschmälert wurden.
Schwachsinn! Besonders hinsichtlich der „Fremden“. Kavis Vater war Ire in der dritten Generation und hatte sein Leben für die Sicherheit von Irlands Bürgerinnen und Bürgern gegeben. Und die Familie ihrer Mutter war bereits 1877 als Bedienstete eines irischen Offiziers aus dem Punjab eingewandert. Irischer ging es kaum. Aber für manche Leute, die sich als „Vollblut-Iren“ verstanden, genügte das nicht. Sie sprachen jedem Menschen die irische Identität ab, der nicht ihren Vorstellungen davon entsprach, wie „echte Iren“ zu sein und auszusehen hatten.
So wie für ihr erstes Opfer. Kavi erinnerte sich noch genau an jenen Tag, als sie mit ihrer Mutter in einem Feinkostgeschäft eingekauft hatte. Ihre Mutter hatte ihr anlässlich ihres Abschlusses am Trinity ein ganz besonderes Essen mit ganz besonderen Zutaten kochen wollen und diese in besagtem Geschäft besorgt. Dafür hatte sie noch mehr Überstunden absolviert und eisern gespart, um dieses Essen zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen. Was ihr gelungen war.
Aber schon beim Betreten des Geschäfts hatten nicht nur die Angestellten sie beide verächtlich gemustert. Ein Kunde im Businessanzug mit einer aufgedonnerten Frau an seiner Seite, die mit Schmuck behängt war wie ein Weihnachtsbaum, fragte mit Blick auf Kavi und ihre Mutter, laut in die Runde, seit wann „solche Leute“ denn in diesem „noblen Geschäft“ bedient würden. Kurz darauf hatte er festgestellt, dass ihm seine Brieftasche fehlte und sofort Kavi und ihre Mutter des Diebstahls beschuldigt. Die Polizei kam, durchsuchte sie beide und fand natürlich nichts. Stattdessen entdeckte eine Shopangestellte die Brieftasche neben einem Regal, wo der Mann sie offenbar verloren hatte, denn Kavi und ihre Mutter waren nicht einmal in der Nähe des Regals gewesen.
Trotzdem beschuldigte der Kerl sie weiter, behauptete, sie beide hätten die Brieftasche dorthin geworfen, damit man sie nicht bei ihnen fand, und verlangte ihre Festnahme, was die Beamten verweigert hatten. Nicht nur wegen Mangels eines Beweises für den Diebstahl, denn einer der Beamten war ein früherer Kollege von Kavis Vater und hatte dem Mann in eisigem Ton versichert, dass die ehrbare Witwe und Tochter „eines der besten Garda-Beamten, mit dem zusammenzuarbeiten ich je die Ehre hatte“ ganz sicher keinen Diebstahl beging. Was den Kerl nicht daran hinderte, sie weiter zu beschimpfen. Erst als der Kollege sie beide fragte, ob sie gegen ihn Anzeige wegen Beleidigung und falscher Beschuldigung erstatten wollten, hielt er den Mund.
Kavi hatte ihre Mutter wieder einmal wegen ihrer schlagfertigen Antwort bewundert, mit der sie eine Anzeige abgelehnt hatte: „Lassen Sie nur, Sergeant. Der arme Mann ist gestraft genug damit, sich selbst jeden Tag ertragen zu müssen.“
Kavi hatte diese Souveränität damals nicht besessen und vor Wut geschäumt, dass dieser Scheißkerl ungestraft davonkommen sollte. Trotzdem war sie kaltblütig genug, nichts zu überstürzen oder ihrer Wut nicht das Regiment zu überlassen. Sie brachte zunächst alles über den Mann in Erfahrung; nicht schwer, denn er fühlte sich bemüßigt, in den sozialen Medien mit seinem Reichtum und seiner schönen Freundin zu protzen, was Kavi die Gelegenheit gab zu erfahren, welche Wertgegenstände er besaß. In der Verkleidung einer Straßenreinigungskraft hielt sie sich lange genug und oft genug vor seinem Haus auf, um dessen Sicherungen herauszufinden.
Danach wartete sie geduldig, bis er wieder einmal verreiste, legte die Alarmanlage lahm, brach in sein Haus ein und stahl ihm nahezu alles, was er an Wertsachen in einem Safe aufbewahrte, den er für sicher hielt. Weil ihr das aber nicht genügte, hackte sie sich in seine Bank Accounts und räumte seine Konten leer bis auf den letzten Cent. Das Geld überwies sie auf nicht rückverfolgbaren Wegen als Spenden ans Trinity College, an den Polizeifonds der Witwen und Waisen, das Rote Kreuz, Flüchtlingshilfen und andere Einrichtungen, die es gut gebrauchen konnten. Eine äußerst befriedigende Angelegenheit, die sich einfach gut angefühlt hatte.
Natürlich hatte der Kerl die gestohlenen Dinge von seinen Versicherungen ersetzt bekommen. Kavi hatte auch diese Beträge von seinen Konten verschwinden lassen und das noch zwei weitere Male durchgezogen, bis die Bank und die Versicherungen ihn des Betrugs verdächtigt hatten. Erst da hatte sie ihn vom Haken gelassen, denn nun wusste er aus eigener Erfahrung, wie sich das anfühlte, eines Verbrechens beschuldigt zu werden, das man gar nicht begangen hatte. Allerdings bezweifelte sie, dass er daraus eine Lehre gezogen oder gar seine rassistische Einstellung aufgegeben hatte. Leute mit so einer Denkweise waren in der Regel in diesem Punkt komplett vernagelt; und nicht nur in dem.
Im Anschluss an die ganze Aktion hatte sie Gordon kennengelernt. Nach vorsichtigen Recherchen und Knüpfen erster Kontakte mit der Diebesgilde hatte die sie an ihn verwiesen. Gordon hatte wohl ein Potenzial in ihr gesehen, das er für förderungswürdig hielt, und sie mit dem „King“ bekannt gemacht, dem heimlichen Anführer der Gilde. Der hatte ihr alle Tricks und Kniffe des Schlösserknackens und die sonstigen Feinheiten des Gewerbes beigebracht, sofern es sich um analoge Dinge handelte. Was Computer betraf, gab es niemand Besseren in der Gilde als Kavi. Gerade deshalb hielten Gordon und der King ihre Identität geheim. Und natürlich auch, um im Zuge dieser Geheimhaltung Vermittlungsprovisionen zu kassieren. Eine Hand wusch die andere. Kavi war das recht. Sie hatte sowieso nicht vor, den Job so lange zu machen wie der King und erst aus Altersgründen aufzuhören.
Auf den Bildschirmen der Kameras beobachtete sie Gordons Geschäftsabwicklung mit dem Kunden, der die Perlenkette schließlich kaufte. Gordon begleitete ihn zur Tür, die er ihm höflich aufhielt, und ihn freundlich verabschiedete. Sekunden später betrat er das Hinterzimmer, schenkte sich ebenfalls Tee ein und setzte sich in einen Sessel, von dem aus er die Bildschirme im Blick hatte. Eigentlich unnötig, denn wenn jemand den Laden betrat, ertönte ein Warnton. Kavi wusste das, denn sie hatte Gordon geholfen, die Anlage zu installieren und zu programmieren.
„Schön, dass du so schnell gekommen bist, Kavi.“
Sie winkte ab. „Ich hätte dich in den nächsten Tagen ohnehin aufgesucht, denn ich habe was für dich: vier hochwertige Markenuhren. Interessiert?“
Eine überflüssige Frage, denn Kavi kannte Gordons Antwort: „Immer. Zeig her.“
Kavi zog sich ihre Biker-Handschuhe an, holte die Uhren aus der Bodentasche ihres Rucksacks und legte sie vor Gordon auf den Tisch. Der zog sich ebenfalls Handschuhe an, nahm eine nach der anderen auf und besah sie sich von allen Seiten.
„Gesamtwert im normalen Verkauf dreihundertachtzigtausend Euro“, resümierte er. „Ich gebe dir zweihunderttausend.“ Er blickte sie wohlwollend an. „Weil du es bist: zweihundertfünfzigtausend.“
„Einverstanden.“ Wenn er sich mit einem Gewinn von nur hundertdreißigtausend Euro oder weniger zufriedengeben wollte, hatte Kavi keine Einwände.
„Ich habe aber nicht so viel im Haus. Genügen dir fünfzigtausend als Anzahlung? Den Rest kann ich dir Ende der Woche oder zusammen mit dem Honorar geben, falls du meinen Auftrag annimmst.“
Sie nickte. „Worum geht es?“
Er zog ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus der Innentasche seines Jacketts und reichte es ihr. Kavi faltete es auf und blickte auf das Foto einer aus Halbedelsteinen zusammengefügten Figurine. Sie identifizierte Lapislazuli, Tigerauge, Amethyst, Howlith, Türkis, Jaspis, Bergkristall, Moosachat und Aventurin oder Jade. Sie waren in einer Weise zusammengefügt, dass sie die Form der riesigen Inuksuk-Steinfiguren der Inuit besaßen, nur im Kleinformat.
„Ist das nicht eine von Tulok Kalliks Arbeiten?“
Tulok Kallik war ein aufstrebender Inuit-Künstler, der in den letzten Jahren mit Kunstwerken von sich reden gemacht hatte, die den traditionellen Künsten seiner Vorfahren nachempfunden waren. Darunter befanden sich Schnitzereien aus Wal- und Robbenknochen und -zähnen, die er zu riesigen Skulpturen zusammengefügt hatte, Malereien auf Robbenfell und ähnliche Dinge. Irgendwann hatte er angefangen, Mini-Inuksuks aus Halbedelsteinen anzufertigen, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuten. Soweit Kavi wusste, hatte er bisher zweiundzwanzig Einzelstücke hergestellt, die mit durchschnittlich fünf- bis achttausend Euro gehandelt wurden.
„Ist sie“, stimmte Gordon ihr zu. „Mein Auftraggeber möchte das Original haben. Er besitzt alle anderen Originale und will dieses unbedingt auch. Leider wurde es bereits an jemanden verkauft, der nicht gewillt ist, es wieder herzugeben.“
„Weshalb ich es besorgen soll.“
Gordon nickte und lächelte. „Ich habe ihm gesagt, ich kenne eine Person, die das möglich macht.“ Er deutete eine Verbeugung vor Kavi an.
Sie lächelte. „Kein Problem. Wie viel ist für mich drin?“
„Fünfzigtausend.“
„Wie viel?“ Kavis Alarmglocken klingelten Sturm. „Das Ding ist maximal zehntausend wert, und du willst auch was verdienen, ich schätze mal: mindestens ebenfalls fünfzigtausend. Und der Auftraggeber will das Ding für hunderttausend haben? Sind wir sicher, dass er kein Polizeispitzel ist?“
„Der King bürgt für ihn.“
Der King war zwar nicht mehr in dem Geschäft tätig, nachdem er sich reich zur Ruhe gesetzt hatte, aber er kannte alle und hatte Kontakte zur Polizei, durch die er jederzeit prüfen konnte, ob jemand, der einen Auftrag zu vergeben hatte, echt oder ein Peeler undercover war. Wenn der King für jemanden bürgte, war er sauber. Trotzdem hatte Kavi ein ungutes Gefühl.
Gordon zuckte mit den Schultern. „Du weißt doch, dass manche Sammler ruinöse Preise für objektiv wertloses Zeug zahlen. Ich erinnere nur an dieses Stück von Lady Dis Hochzeitstorte, das für gut zweitausend Euro versteigert wurde – nur damit irgendein verrückter Fan sich das eingeschweißte Ding in eine Vitrine legen und zusehen kann, wie es verstaubt.“ Gordon schüttelte den Kopf. „Aber dieser Auftrag ergibt durchaus einen wirtschaftlichen Sinn. Rechne dir aus, wie viel die gesamte Sammlung wert ist, wenn alle Originale in einer Hand zusammenkommen und sie als Gesamtheit verkauft, vielmehr versteigert wird.“
„Millionen“, war Kavi überzeugt. Und so gesehen war eine Investition von hunderttausend Euro für eine nur das Zehntel werte Figurine durchaus nachvollziehbar. Besonders wenn der Kunde die anderen für erheblich weniger Geld bekommen hatte, was erst recht für Kalliks erste Inuksuk-Figurinen galt, die noch im oberen dreistelligen bis maximal unteren vierstelligen Bereich gehandelt worden waren.
„Weiß dein Kunde zufällig auch, wer die Figurine hat?“ Sie nahm ihr Smartphone und fotografierte das Bild.
„Brennan O’Keefe, The Paddock vierundzwanzig C in Ashtown.“
Kavi kannte sich zwar im Stadtteil Ashtown nicht aus, aber wofür gab es Stadtpläne? Sie würde jedoch nicht den Fehler begehen, die Adresse auf einem Internetplan zu suchen. Das hinterließ Spuren auf dem Computer. Obwohl Kavi für solche Dinge den Laptop benutzte, dessen IP-Adresse sich nicht zu ihr zurückverfolgen ließ und sie durchaus in der Lage war, die Spuren so zu tilgen, dass niemand ihr den Besuch der entsprechenden Seite nachweisen konnte, war eine Internetnutzung ein vermeidbares Risiko, das sie nicht einging. Schließlich war sie nicht der einzige Computercrack auf der Welt. Und irgendwo gab es garantiert jemanden, die oder der besser war als sie.
„Gibt es ein Zeitlimit?“, wollte sie wissen.
„So schnell wie möglich. Wie immer.“ Gordon lächelte und hob abwehrend die Hände. „Ich weiß, du arbeitest immer so schnell wie möglich. Aber der Kunde ist sehr besorgt, dass der Besitzer die Figurine vielleicht weiterverkauft oder verschenkt, bevor du Gelegenheit hattest, sie ihm zu beschaffen.“
„Verständlich für einen Hardcore-Sammler.“ Kavi nickte. „Du weißt, wie ich arbeite und dass ich deshalb mindestens drei Tage brauche. Länger, wenn ich eine Alarmanlage austricksen muss.“
Gordon nickte. „Mach einfach nur so schnell es geht.“
Er vergewisserte sich mit einem zusätzlichen Blick auf die Bildschirme, die er sowieso kaum aus den Augen gelassen hatte, dass sein Laden kundschaftsfrei war, stand auf, schob den Sessel zur Seite und rollte den Teppich auf. Darunter kam ein in den Boden eingelassener Safe zum Vorschein. Normalerweise hätte er dieses Versteck niemandem offenbart, aber Kavi hatte ihm beim Einbau geholfen, weil er das keinen gewöhnlichen Handwerkern überlassen wollte. Fremde Handwerker mochten den ungewöhnlichen Standort des eingebauten Safes mit Kollegen diskutieren oder bewusst an jemanden wegen einer „Bonuszahlung“ für solche Auskünfte verraten, der dann nichts Eiligeres zu tun gehabt hätte, als bei Gordon einzubrechen und ihm den Inhalt des Safes zu stehlen. Für Kavi stellte seine damalige Bitte um Hilfe einen Vertrauensbeweis dar. Sie würde sein Vertrauen nicht enttäuschen.
Gordon holte ein paar Geldbündel aus einer Kassette und reichte sie Kavi. „Fünfzigtausend. Hunderttausend kann ich dir übermorgen geben, den Rest Freitag oder Samstag. Zähl nach.“
Kavi musste nicht nachzählen, denn unabhängig von ihrer Freundschaft konnte Gordon sich nicht leisten, seine „Lieferanten“ übers Ohr zu hauen. Ein einziger derartiger Versuch und der oder die Betreffende würde nie wieder für ihn arbeiten. Mehr noch: Das würde sich herumsprechen, und Gordon wäre danach nicht nur sehr schnell seine Bezugsquellen los, er würde auch vom King eins aufs Dach bekommen. Betrug innerhalb der Diebesgilde galt als schändliche Tat. Die nach Kavis Wissen den sofortigen Ausschluss aus der Gilde zur Folge hatte. Aber sie tat Gordon den Gefallen und zählte das Geld nach.
Gordon knüllte das Foto der Figurine zusammen, legte es in einen Aschenbecher und zündete es an. Mit einem fast meditativen Gesichtsausdruck beobachtete er, wie das Papier zu Asche verbrannte.
Kavi steckte das Geld ein. „Die Firma dankt“, sagte sie mit einer leichten Verbeugung. „Ich mache mich an die Arbeit und gebe dir über den voraussichtlichen Liefertermin Bescheid.“
„Tu das. Viel Glück.“
Kavi schüttelte den Kopf. „Ich bin Profi, wie du weißt. Glück ist was für Anfänger.“
Er lachte und winkte sie hinaus.
Kavi fuhr nach Hause, verstaute das Geld in ihrem Geheimversteck und nahm ihren Speziallaptop, den man nicht mit ihr in Verbindung bringen konnte; vorausgesetzt, die Geheimschublade im Kleiderschrank wurde nicht entdeckt und mit ihr die falschen Identitäten. Sie googelte Brennan O’Keefe und fand mehrere Einträge, aber nur einen für einen Mann, der in Dublin-Ashtown wohnte. Wieder einmal staunte sie, wie leichtsinnig die Leute in den sozialen Medien mit persönlichen und privatesten Informationen umgingen.
Was O’Keefe über sich gepostet hatte, war geradezu eine Einladung für Diebe, sich bei ihm zu bedienen. Er besaß ein teueres E-Bike und einen relativ neuen Mittelklassewagen, der auch seine vierzigtausend Euro wert war. Er prahlte mit einem guten Einkommen und einem Ferienhaus an der Riviera, betonte, dass er sich dort hauptsächlich im Winter aufhielt – ein Wink mit dem Zaunpfahl, das Ashtown-Haus im Frühjahr oder Herbst leerzuräumen – und dass er Kunst sammelte und über ein gut bestücktes Portfolio verfügte. Zwar betonte er, dass alle Kunstwerke Repliken waren, aber selbst die konnte man für ein paar Hundert oder einige Tausend Euro gut verkaufen, wenn es sich um limitierte Auflagen handelte.
Kavi hielt diese Behauptung jedoch für Augenwischerei. Er besaß mit der Figurine von Tulok Kallik mindestens ein Original – das er als seine neueste Errungenschaft aller Welt per Foto zeigte – und vermutlich noch andere Originale. Um aber einerseits mit seiner Sammlung anzugeben, gleichzeitig aber Einbrecher abzuschrecken, täuschte er vor, ausschließlich Repliken zu besitzen. Als ob Profis darauf hereinfallen würden.
Kavi interessierte das jedoch weniger. Die Informationen, die sie zunächst brauchte, lieferte O’Keefe ebenfalls in unzähligen Postings. Er war unverheiratet, lebte allein und hatte keinen Hund, der unautorisierte Besucher im Haus seines Herrchens bellend und beißend vertreiben würde. Auch keine Katze, über die sie stolpern könnte. Und noch etwas für sie Wichtiges ließen die Postings erkennen. O’Keefe hatte sich seinen Besitz durch seine eigene Arbeit als Pilot bei der Air Lingus erwirtschaftet, die bestens bezahlt wurde. Das Haus, in dem er wohnte, hatte er von seinen Eltern geerbt. Er gehörte also nicht zum Kaliber von Menschen wie Tom Hogan, der andere ausbeutete. Kavi würde deshalb darauf verzichten, ihm mehr als nur die Kallik-Figurine zu stehlen.
Sie las den nächsten seiner Posts und lächelte. In dem teilte er aller Welt voller Stolz mit, dass er übermorgen einen dreitägigen Flug nach Rio antrat. Wenn das keine Einladung war, sein Haus in genau dieser Zeit heimzusuchen! Kavi holte ihren analogen Stadtplan von Dublin und suchte die Straße The Paddock heraus. Sie zweigte von der Blackhorse Avenue ab, die am Phoenix Park entlang verlief. Überaus günstig für Kavi.
Sie hatte am Heuston Bahnhof unter einer ihrer Tarnidentitäten eine Fahrradbox gemietet, in der ein Sportrad auf seinen sporadischen Einsatz wartete. Der Bahnhof lag etwa fünf Kilometer von ihrer Wohnung 165 P Whitehall Road in Perrystown entfernt und nur ein paar Hundert Meter vom Phoenix Park am südlichen Ufer der Liffey. Die St John’s Road, an der der Bahnhof lag, überquerte auf der Frank Sherwin Bridge die Liffey und bog nach links ab und ein paar Meter weiter nach rechts in die Infirmary Raod, die am Criminal Court of Justice am Phoenix Park vorbei führte. Ein paar Straßeneinmündungen weiter wurde sie nach einer Linkskurve zur North Road, die zunächst am Park entlang und schließlich in ihn hinein führte. Ungefähr drei Kilometer weiter konnte man über die Ashton Gate Road, die auf die Blackhorse Avenue mündete, den Park verlassen. Viele Dubliner nutzten diese Wege zum Bike-Work-out oder zum Joggen.
Kavi hielt sich sowieso fit und trainierte fast jeden Tag; schließlich erforderten manche Einstiege in die lukrativen „Schatzkammern“ akrobatisches Geschick und die Kunst des Fassadenkletterns. Sich in eine ihrer Tarnidentitäten zu verwandeln und im farbenfrohen Bikerdress die Strecke abzufahren und nebenbei die Örtlichkeit auszubaldowern, verband Nützliches mit Nützlichem. Ein Blick auf die Uhr zeigte ihr, dass der Feierabendverkehr bereits vorüber war. Und draußen war noch genug Licht, dass sie sehen konnte, was sie sehen musste.
Sie packte ein, was sie brauchte, fuhr zum Bahnhof, ging dort auf die Toilette und verwandelte sich. Sie zog einen farbenfrohen Trainingsdress und Bikerhandschuhe an und setzte sich eine blonde Perücke und eine Sportkappe auf. Auch mit diesen vergleichsweise einfachen Mitteln blickte ihr anschließend aus dem Spiegel eine völlig andere Person entgegen.
Kavi lächelte. Sie liebte Verkleidungen, seit sie als Kind im Schultheater eine alte Märchenhexe in einer so fantasievoll geschminkten Maske und einem die Körperform verhüllenden Kostüm gespielt hatte, dass nicht einmal ihre Eltern sie erkannt hatten. Das Schönste daran war das Gefühl gewesen, verborgen zu sein, obwohl sie sich mitten unter Menschen befand – in aller Öffentlichkeit versteckt und unerkannt zu sein. Unsichtbar vor aller Augen.
Das Zweitschönste war das Gefühl, durch die Verkleidung in eine andere Haut zu schlüpfen und ein anderer Mensch zu werden. Dieser Effekt entstand nicht nur durch die Theaterkurse in der Schule, bei denen sie gelernt hatte, bewusst eine andere Persönlichkeit zu verkörpern, sondern allein schon dadurch, dass Kavi sich äußerlich verwandelte. Und sei das nur wie heute mit geringfügigen Veränderungen. Sobald sie eine Maske trug, auch wenn die nur aus einer anderen Art von Kleidung bestand, fühlte sie sich als jemand anderes und nicht mehr wie sie selbst. Eine erregende, ja berauschende Empfindung, die sie jedes Mal aufs Neue genoss.