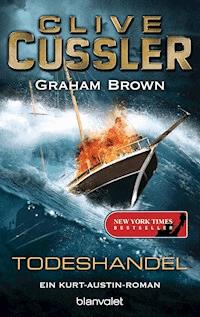
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Kurt-Austin-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Actiongeladen und topaktuell: der Cyberthriller vom Meister des Genres
Der mysteriöse Tod einer alten Freundin treibt Kurt Austin von der NUMA immer tiefer in die schattengleiche Welt der staatlichen Cyberkriminalität. Dabei stößt er auf weitere Fälle, bei denen Wissenschaftler verschwunden sind, und sie alle waren verbunden mit seltsamen Unfällen. Sind diese Menschen vielleicht gar nicht tot, sondern wurden entführt? Mit der Hilfe von Joe Zavala entdeckt Kurt Austin einen Menschenhändlerring von unfassbaren Ausmaßen. Da wird ihm klar, dass seine Freundin wahrscheinlich noch lebt – und dass nur er sie retten kann …
Jeder Band ein Bestseller und einzeln lesbar. Lassen Sie sich die anderen Abenteuer von Kurt Austin nicht entgehen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Autoren
Seit er 1973 seinen ersten Helden Dirk Pitt erfand, ist jeder Roman von Clive Cussler ein »New-York-Times«-Bestseller. Auch auf der deutschen SPIEGEL-Bestsellerliste ist jeder seiner Romane vertreten. 1979 gründete er die reale NUMA, um das maritime Erbe durch die Entdeckung, Erforschung und Konservierung von Schiffswracks zu bewahren. Er lebt in der Wüste von Arizona und in den Bergen Colorados.
Der leidenschaftliche Pilot Graham Brown hat Abschlüsse in Aeronautik und Rechtswissenschaften. In den USA gilt er bereits als der neue Shootingstar des intelligenten Thrillers in der Tradition von Michael Crichton. Wie keinem zweiten Autor gelingt es Graham Brown, verblüffende wissenschaftliche Aspekte mit rasanter Nonstop-Action zu einem unwiderstehlichen Hochspannungscocktail zu vermischen.
Liste der lieferbaren Bücher
Von Clive Cussler im Blanvalet-Taschenbuch(die Dirk-Pitt-Romane):
Eisberg, Das Alexandria-Komplott, Die Ajima-Verschwörung, Schockwelle, Höllenflut, Akte Atlantis, Im Zeichen der Wikinge, Die Troja-Mission, Cyclop, Geheimcode Makaze, Der Fluch des Khan, Polarsturm, Wüstenfeuer, Unterdruck
Von Clive Cussler und Paul Kemprecos im Blanvalet-Taschenbuch(die Kurt-Austin-Romane):
Tödliche Beute, Brennendes Wasser, Das Todeswrack, Killeralgen, Packeis, Höllenschlund, Flammendes Eis, Eiskalte Brandung
Von Clive Cussler und Graham Brown im Blanvalet-Taschenbuch(die Kurt-Austin-Romane):
Teufelstor, Höllensturm), Codename Tartarus, Todeshandel
Von Clive Cussler und Craig Dirgo im Blanvalet-Taschenbuch (die Juan-Cabrillo-Romane):
Der goldene Buddha, Der Todesschrein
Von Clive Cussler und Jack DuBrul im Blanvalet-Taschenbuch (die Juan-Cabrillo-Romane):
Todesfracht, Schlangenjagd), Seuchenschiff, Kaperfahrt, Teuflischer Sog, Killerwelle, Tarnfahrt
Von Clive Cussler und Grant Blackwood im Blanvalet-Taschenbuch (die Fargo-Romane):
Das Gold von Sparta, Das Erbe der Azteken, Das Geheimnis von Shangri La, Das fünfte Grab des Königs, Das Vermächtnis der Maya
Von Clive Cussler (die Isaac-Bell-Romane):
Höllenjagd
Von Clive Cussler und Justin Scott (die Isaac-Bell-Romane):
Sabotage, Blutnetz, Todesrennen, Meeresdonner, Die Gnadenlosen
Clive Cussler& Graham Brown
TODESHANDEL
Ein Kurt-Austin-Roman
Aus dem Englischen von Michael Kubiak
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Ghost Ship« bei Putnam, New York.
Copyright © 2014 by Sandecker RLLLP By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc. 551 Fifth Avenue, Suite 1613 New York, NY 10176 – 0187 USA Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Redaktion: Jörn Rauser HK · Herstellung: sam Satz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN: 978-3-641-16926-8 V002
www.blanvalet.de
PROLOG
Vom Erdboden verschlucktDurban, Südafrika, 25. Juli 1909
Sie fuhren mitten in ein Nichts hinein, zumindest kam es Chief Inspector Robert Swan vom Durban Police Department so vor.
In einer mondlosen Nacht unter einem Himmel, so dunkel wie Zeichentusche, saß Swan als bewaffneter Begleitschutz im Führerhaus eines Motorlastwagens, der in der ländlichen Gegend nördlich von Durban gerade über eine staubige Piste rumpelte. Die gelben Lichtstrahlen aus den Scheinwerfern des großen Packard flackerten und hüpften und schafften es nur unzureichend, den Weg vor ihnen zu erhellen. So angestrengt er auch in die Dunkelheit starrte, Swan konnte niemals mehr als vierzig Meter von der mit Spurrillen durchzogenen Landstraße erkennen.
»Wie weit ist es noch bis zum Farmhaus?«, fragte er und drehte sich halb zu einem schlanken, drahtigen Mann namens Morris um, der neben ihm und dem Chauffeur eingezwängt in der Mitte der Sitzbank saß.
Morris sah auf seine Uhr, beugte sich zum Fahrer und warf einen Blick auf den Kilometerzähler des Lastwagens. Nach einigen im Kopf ausgeführten Berechnungen schaute er auf die Landkarte, die er auf seinem Schoß ausgebreitet hatte. »Wir sollten bald da sein, Inspector. In zehn Minuten höchstens, meine ich.«
Der Chief Inspector nickte und suchte mit der Hand am Türrahmen Halt, während der Lastwagen seine schwankende Fahrt fortsetzte. Der Packard, auch bekannt als Three Ton, war das neueste Modell aus Amerika und eines der ersten Motorfahrzeuge, die das Durban Police Department angeschafft hatte. Er war per Schiff geliefert worden, mit umgebautem Führerhaus und Windschutzscheibe. Einfallsreiche Mechaniker des neu gegründeten Fuhrparks hatten eine Rahmenkonstruktion auf die Ladefläche montiert und eine Segeltuchplane darüber gezogen. Allerdings hatte niemand daran gedacht, für mehr Bequemlichkeit zu sorgen.
Während der Lastwagen über die von Pferdefuhrwerken zerfurchte Piste hüpfte und schlingerte, kam Swan zu dem Schluss, dass er in diesem Moment lieber auf einem Pferd gesessen hätte. Aber was dem großen Laster an Komfort fehlte, machte er mit Transportvolumen wett. Außer Swan, Morris und dem Fahrer im Führerhaus gehörten acht Polizisten auf der Ladefläche zur Besatzung.
Swan lehnte sich über den Türrand und schaute nach hinten. Vier Scheinwerferpaare folgten. Drei Personenwagen und ein zweiter Packard. Insgesamt hatte Swan fast ein Viertel der gesamten Polizeistreitmacht Durbans im Schlepptau.
»Sind Sie sicher, dass wir so viele Männer brauchen?«, fragte Morris.
Vielleicht war es wirklich ein wenig übertrieben, dachte Swan. Andererseits waren die Kriminellen, auf die sie es abgesehen hatten – ein Verein, der von den Zeitungen Klaar River Gang genannt wurde –, zahlenmäßig nicht zu unterschätzen. Die Rede war von immerhin dreißig bis vierzig Männern, je nachdem welcher Angabe man Glauben schenkte.
Obwohl sie als gewöhnliche Wegelagerer begonnen und jeden beraubt und erpresst hatten, der versuchte, im Veld auf anständige Art und Weise seinen Lebensunterhalt zu verdienen, waren sie während des vorangegangenen halben Jahres hinterlistiger und brutaler geworden. So wurden die Farmhäuser derer, die sich weigerten, Schutzgeld zu zahlen, einfach niedergebrannt. Goldgräber, Diamantensucher und Reisende verschwanden spurlos. Die Wahrheit kam ans Licht, als mehrere Angehörige der Bande bei einem versuchten Bankraub ertappt wurden. Sie wurden zum Verhör nach Durban gebracht, nur um während eines dreisten Überfalls ihrer Komplizen wieder befreit zu werden. Dabei wurden drei Polizisten getötet und vier weitere verletzt.
Dies war eine Grenze, die sie nie hätten überschreiten dürfen. »Ein fairer Kampf interessiert mich nicht«, erklärte Swan. »Muss ich Sie daran erinnern, was vor zwei Tagen geschehen ist?«
Morris schüttelte den Kopf, und Swan schlug mit der Hand gegen die Wand, die das Führerhaus von der Ladefläche des Lastwagens trennte. Eine Klappe wurde aufgeschoben, und das Gesicht eines vierschrötigen Mannes erschien und füllte die Öffnung aus.
»Sind Ihre Männer bereit?«, fragte Swan.
»Wir sind bereit, Inspector.«
»Gut«, sagte Swan. »Denken Sie daran, keine Gefangenen heute Nacht.«
Der Mann nickte kommentarlos, aber die Worte veranlassten Morris zu einem vielsagenden Seitenblick.
»Haben Sie ein Problem damit?«, blaffte Swan.
»Nein, Sir«, sagte Morris und schaute wieder auf seine Landkarte. »Es ist nur, dass … wir sind fast da. Gleich hinter diesem Hügel.«
Swan richtete seine Aufmerksamkeit erneut auf die Straße und atmete tief durch, um sich für das Kommende zu wappnen. Fast gleichzeitig nahm er den Brandgeruch wahr. Er war unverkennbar, wie von einem Lagerfeuer.
Sekunden später erreichte der Packard den Scheitelpunkt des Hügels, und die kohlrabenschwarze Nacht wurde von einem wabernden orangefarbenen Lodern auf dem Feld unter ihnen aufgerissen. Das Farmhaus brannte von einem Ende bis zum anderen. Flammen hüllten es ein und leckten bis in den Himmel hinauf.
»Verdammt!«, fluchte Swan.
Die Fahrzeuge rasten den Hügel hinab und fächerten sich auf. Die Männer stiegen aus und umzingelten das Haus.
Niemand wehrte sich. Niemand schoss auf sie.
Morris führte den Trupp näher heran. Dabei achteten sie darauf, dass sie den Wind im Rücken hatten, und drangen in den letzten Teil der Scheune ein, der noch nicht Feuer gefangen hatte. Mehrere Pferde wurden gerettet, aber die einzigen Bandenmitglieder, die sie fanden, waren bereits tot. Einige waren halb verbrannt, andere angeschossen und sterbend zurückgelassen worden.
Das Feuer löschen zu wollen war hoffnungslos. Das alte Holz und die Ölfarbe knisterten und brannten wie Petroleum. Dabei entstand eine derartige Hitze, dass sich Swans Männer zurückziehen mussten, wenn sie nicht bei lebendigem Leib gegrillt werden wollten.
»Was ist passiert?«, fragte Swan einen seiner Leutnants.
»Sieht so aus, als hätten sie Streit gehabt«, sagte Morris.
Swan überlegte. Bereits vor den Verhaftungen in Durban waren Gerüchte aufgekommen, die darauf hindeuteten, dass die Bande im Begriff war, sich aufzulösen. »Wie viele Tote?«
»Gefunden haben wir fünf. Einige von den Jungs meinen, sie hätten noch zwei weitere im Haus gesehen, kamen jedoch nicht an sie heran.«
In diesem Moment knatterten Schüsse.
Swan und Morris gingen hinter dem Packard in Deckung. Aus geschützten Positionen schossen die Beamten zurück und feuerten blindlings in das Flammeninferno hinein.
Die Schüsse dauerten an, mit seltsamen Pausen zwischen den Salven, aber Swan sah keine einzige Kugel in seiner Nähe einschlagen.
»Feuer einstellen!«, rief er. »Und die Köpfe unten behalten!«
»Aber sie schießen auf uns!«, rief einer der Männer.
Swan schüttelte den Kopf, auch wenn das Stakkato des Gewehrfeuers andauerte. »Das ist nur die Munition, die in der Hitze explodiert!«
Der Befehl wurde weitergegeben und von einem Mann zum nächsten gerufen. Trotz seiner eigenen Anweisung richtete sich Swan auf und schaute über die Motorhaube des Lastwagens hinweg.
Mittlerweile hüllten die Flammen das gesamte Farmgebäude ein. Die massiven Balken sahen aus wie das Gerippe eines Riesen auf dem Scheiterhaufen eines Wikingerstamms. Die Flammen leckten an ihnen, züngelten um sie herum und brannten grellweiß und orange mit gelegentlichen grünen und blauen Blitzen dazwischen. Es sah aus, als habe sich die Hölle geöffnet, die die Bande und ihr Versteck jetzt von innen verschlang.
Eine mächtige Explosion innerhalb des Gebäudes zerfetzte das gesamte Anwesen. Durch die Druckwelle wurde Swan zurückgeschleudert und landete hart auf dem Rücken, während Trümmer gegen die Seitenwand des Packards prasselten.
Nur wenige Augenblicke nach der Explosion fiel brennendes Konfetti vom Himmel. Tausende von winzigen Papierfetzen wirbelten durch die Luft und formten vor dem schwarzen Nachthimmel eine Wolke aus Rauch und Asche. Dort, wo nicht vollständig verglühte Feuerflocken den Erdboden berührten, setzten sie das ausgedörrte Gras in Brand.
Sofort versuchten Swans Männer die kleinen Brandherde auszutreten, um zu verhindern, dass sie von einem Buschfeuer eingeschlossen wurden.
Swan bemerkte, dass einige Papierfetzen ganz in der Nähe landeten. Er rollte sich auf dem Boden dorthin, streckte sich nach einem Teilchen aus und löschte die Glut mit der Hand. Zu seiner Überraschung erkannte er Zahlen, Buchstaben und das ernste Gesicht von König George.
»Zehner«, stellte Morris aufgeregt fest. »Zehn-Pfund-Noten. Tausende davon.«
Als die Männer begriffen, was da vom Himmel herabregnete, verdoppelten sie ihre Anstrengungen, rannten herum und sammelten die angeschmorten Reste mit einer freudigen Begeisterung, die sie beim Einsammeln von Beweisen sonst nie an den Tag legten. Einige Banknoten waren noch gebündelt und nur an den Rändern angesengt. Andere wirkten wie Laub in einem Kamin – zusammengerollt und bis zur Unkenntlichkeit verkohlt und schwarz.
»Das verleiht dem Begriff ›die Beute verpulvern‹ eine ganz neue Bedeutung«, stellte Morris fest.
Swan lachte verhalten, aber er hörte gar nicht richtig zu. Seine Gedanken waren woanders. Er betrachtete das Feuer, zählte die Leichen und entwickelte im Kopf einen Fall, so wie er es auf der Polizeischule gelernt hatte und als Polizeiinspektor gewöhnt war.
Irgendetwas stimmte nicht. Ganz und gar nicht.
Anfangs schrieb er diesen Eindruck dem widersprüchlichen Verlauf des Abends zu. Die Bande, die zu zerschlagen er ausgerückt war, hatte ihm diese Arbeit selbst abgenommen. Damit konnte er sich noch abfinden. Ähnliches hatte er auch schon früher gesehen. Kriminelle stritten sich häufig wegen ihrer Beute, vor allem wenn die Mitglieder nur locker miteinander verbunden und praktisch führerlos waren, wie es bei dieser Bande angeblich der Fall war.
Nein, dachte Swan, das war auf einer viel tieferen Ebene verdächtig.
Morris hatte anscheinend ebenfalls Bedenken. »Was ist falsch?«
»Es ergibt keinen Sinn«, erwiderte Swan.
»Welcher Teil?«
»Die gesamte Geschichte«, sagte Swan. »Der riskante Banküberfall am helllichten Tag. Dann der Überfall, um die Männer rauszuholen. Und schließlich die Schießerei auf der Straße.«
Morris sah ihn verständnislos an. »Ich kann Ihnen nicht folgen.«
»Sehen Sie sich doch um«, sagte Swan. »Der Menge der verbrannten Geldscheine nach zu urteilen, die vom Himmel regnen, müssen diese Kerle auf einem Vermögen gesessen haben.«
»Richtig«, stimmte Morris ihm zu. »Und weiter?«
»Warum eine schwer gesicherte Bank mitten am Tag überfallen, wenn ich die Taschen bereits bis zum Platzen mit Bargeld gefüllt habe? Warum ein riskantes Feuergefecht in Durban veranstalten, um die Komplizen rauszuholen, nur um sie wenig später hier unten zu erschießen?«
Lange starrte Morris Swan schweigend an, ehe er zustimmend nickte. »Ich habe keine Ahnung«, sagte er. »Aber Sie haben recht. Es ergibt überhaupt keinen Sinn.«
Das Feuer brannte bis in die Morgenstunden und erlosch erst, als die Farmgebäude vollständig abgebrannt waren. Die Operation endete ohne Verluste auf Seiten der Polizei, und niemand hörte jemals wieder etwas von der Klaar River Gang.
Die meisten betrachteten es als einen großen Glücksfall, aber Swan glaubte niemals, dass es tatsächlich ein solcher war. Er und Morris diskutierten in den folgenden Jahren bis zu ihrer Pension noch des Öfteren über diesen Abend. Trotz vieler Theorien und Vermutungen über das, was tatsächlich vorgefallen war, blieb dies eine Frage, die sie niemals beantworten konnten.
1
27. Juli 1909170 Meilen westsüdwestlich von Durban
Auf einer Fahrt von Durban nach Kapstadt pflügte die SSWaratah durch die Wellen und rollte deutlich mit der zunehmenden Dünung. Dunkler Qualm aus den Kohlefeuerungen unter den Dampfkesseln wälzte sich aus dem einzelnen Schornstein und wurde von einem Gegenwind weggedrängt.
Gavin Brèvard, einundfünfzig Jahre alt, der allein im Hauptsalon des fünfhundert Fuß langen Dampfers saß, spürte, wie sich das Schiff nach Steuerbord neigte. Er beobachtete, wie Tasse und Untertasse vor ihm zur Tischkante rutschten, zuerst langsam, dann immer schneller, da die Neigung des rollenden Schiffes stetig zunahm. Im letzten Moment ergriff er die Tasse und bewahrte sie davor, über den Tischrand zu gleiten und auf dem Fußboden zu zerschellen.
Die Waratah verharrte in dieser extremen Seitenlage und brauchte volle zwei Minuten, um sich wieder aufzurichten. Brèvard fragte sich, ob es richtig gewesen war, die Überfahrt ausgerechnet auf diesem Schiff zu buchen.
In einem früheren Leben hatte er zehn Jahre auf See an Bord verschiedener Dampfschiffe zugebracht. Auf diesen Schiffen fand der Rückschwung weitaus schneller statt, und die Fähigkeit des Rumpfs, sich aufzurichten, war stärker ausgeprägt. Die Waratah dagegen kam ihm stark topplastig vor. Er fragte sich, ob etwas mit ihr nicht stimmte.
»Mehr Tee, Sir?«
In Gedanken versunken bemerkte Brèvard kaum den Kellner in der Uniform der Blue Anchor Line.
Er hielt die Tasse hoch, die er vor dem Absturz gerettet hatte. »Merci.«
Der Kellner füllte sie und ging weiter. Während er den Salon verließ, betrat eine andere Gestalt den Raum. Es war ein breitschultriger Mann um die dreißig, mit rötlichem Haar und rotem Gesicht. Er kam direkt auf Brèvard zu und ließ sich ihm gegenüber in den Sessel sinken.
»Johannes«, begrüßte ihn Brèvard. »Freut mich zu sehen, dass du dich nicht in deiner Kabine verkriechen musstest, so wie die anderen.«
Johannes’ Teint hatte zwar einen grünlichen Schimmer, aber er schien sich tapfer zu halten. »Weshalb hast du mich gerufen?«
Brèvard trank einen Schluck Tee. »Ich habe nachgedacht. Und bin zu einer wichtigen Erkenntnis gelangt.«
»Und?«
»Wir sind weit davon entfernt, in Sicherheit zu sein.«
Johannes seufzte und senkte den Blick. Brèvard verstand. Johannes hielt ihn für einen notorischen Schwarzseher. Einen Angsthasen. Aber Brèvard war nur vorsichtig. Jahrelang hatten Leute ihn verfolgt, hatte er mit der ständigen Bedrohung gelebt, gefangen genommen zu werden oder vorzeitig den Tod zu finden. Er musste stets fünf Schritte vorausdenken, nur um am Leben zu bleiben. Das hatte seinen Geist in einen Zustand äußerster Wachsamkeit versetzt.
»Natürlich sind wir in Sicherheit«, erwiderte Johannes. »Wir haben neue Identitäten angenommen. Wir haben keine Spuren hinterlassen. Die anderen sind allesamt tot, und das Farmhaus ist vollständig abgebrannt. Nur unsere Familie ist noch übrig.«
Brèvard trank einen weiteren Schluck Tee. »Aber was ist, wenn uns irgendetwas entgangen ist?«
»Das macht nichts«, sagte Johannes. »Wir sind hier draußen außerhalb der Reichweite jeder Polizei. Dieses Schiff hat keinen Sprechfunk. Wir könnten genauso gut auf einer einsamen Insel sein.«
Das traf zu. Solange sich das Schiff auf See befand, konnten sie beruhigt und entspannt sein. Aber irgendwann würde auch diese Reise zu Ende gehen.
»Wir sind nur in Sicherheit, bis wir in Kapstadt anlegen«, stellte Brèvard klar. »Falls wir unsere Spuren nicht so perfekt verwischt haben, wie wir glauben, es getan zu haben, werden wir dort vielleicht schon von wütenden Polizisten oder von den Soldaten Seiner Majestät erwartet.«
Johannes ließ sich mit einer Erwiderung Zeit. Er dachte nach und verarbeitete das Gehörte. »Was schlägst du vor?«, fragte er schließlich.
»Wir müssen dafür sorgen, dass diese Reise ewig dauert.«
»Und wie sollen wir das tun?«
Doch Brèvard hatte es metaphorisch gemeint. Er wusste, dass er bei Johannes konkreter werden musste. »Wie viele Waffen haben wir?«
»Vier Pistolen und drei Gewehre.«
»Und was ist mit dem Sprengstoff?«
»Zwei Kisten sind noch voll«, sagte Johannes mit einem Stirnrunzeln. »Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es klug war, sie mit an Bord zu nehmen.«
»Das war schon gut so. Ihnen passiert nichts«, sagte Brèvard. »Weck die anderen, ich habe einen Plan. Allmählich wird es Zeit, dass wir unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen.«
Kapitän Joshua Ilbery stand auf der Kommandobrücke der Waratah, obwohl längst Zeit war, dass die dritte Wache den Dienst übernahm. Das Wetter bereitete ihm Sorgen. Der Wind erreichte in Böen bis zu fünfzig Knoten, und dabei wehte er gegen den Gezeitenrhythmus und gegen die Strömung. Durch diese seltsame Kombination buckelten sich die Wellen zu spitzen Pyramiden auf, ungewöhnlich hoch und steil, wie Sandmassen, die aus zwei Richtungen angeblasen und aufgehäuft wurden.
»Ganz ruhig jetzt«, sagte Ilbery zum Steuermann. »Nur so weit korrigieren wie nötig, damit wir nicht breitseits erwischt werden.«
»Aye«, antwortete der Rudergänger.
Ilbery setzte das Fernglas an die Augen. Das Licht ließ mit fortschreitendem Abend nach, und er hoffte, dass der Wind in der Nacht einschlief.
Während sein Blick über die weißen Schaumkronen vor dem Schiff wanderte, hörte er, wie die Tür der Kommandobrücke geöffnet wurde. Zu seiner Überraschung erklang ein Schuss. Er ließ das Fernglas fallen, fuhr herum und sah, wie der Rudergänger aufs Deck sackte und die Hände in Magenhöhe auf seinen Bauch presste. Hinter ihm stand eine Gruppe von Passagieren – mit Waffen. Einer von ihnen kam heran und übernahm das Ruder.
Ehe Ilbery ein Wort hervorstoßen oder nach einer Waffe greifen konnte, rammte ihm ein rotgesichtiger Passagier den Kolben eines Enfield-Gewehrs in den Leib. Ilbery klappte vornüber, taumelte zurück und prallte gegen die Stahlwand der Kommandobrücke.
Der Mann, der ihn angegriffen hatte, richtete den Lauf des Enfields auf sein Herz. Ilbery registrierte, dass das Gewehr von rauen Händen gehalten wurde, die eher zu einem Farmer oder Rancher passten als zu einem Erster-Klasse-Passagier. Er blickte dem Mann in die Augen und sah dort keine Gnade. Er konnte natürlich nicht sicher sein, aber Ilbery zweifelte kaum daran, dass der Mann, der ihm gegenüberstand, schon früher geschossen und getötet hatte.
»Was soll das bedeuten?«, fragte Ilbery heiser.
Ein Mitglied der Gruppe trat vor. Der Mann war älter als die anderen und hatte graue Schläfen. Er trug einen eleganteren Anzug und hatte die lässige Haltung eines Anführers. Ilbery erkannte das Mitglied einer Gesellschaft Reisender in ihm, die in Durban an Bord gekommen war. Brèvard lautete sein Name, Gavin Brèvard.
»Ich verlange eine Erklärung«, sagte Ilbery.
Brèvard grinste ihn an. »Ich denke, das sollte eigentlich offensichtlich sein. Wir übernehmen dieses Schiff. Sie ändern den Kurs, weg von der Küste und zurück nach Osten. Wir legen nicht in Kapstadt an.«
»Das kann nicht Ihr Ernst sein«, sagte Ilbery. »Wir haben zurzeit große Probleme mit dem Wetter. Das Schiff reagiert kaum. Jetzt zu wenden hieße …«
Gavin richtete die Pistole, die er in der Hand hatte, auf einen Punkt zwischen den Augen des Kapitäns. »Ich habe früher selbst auf Dampfern gearbeitet, Käpt’n. Und zwar lange genug, um zu wissen, dass dieses Schiff topplastig und schwerfällig ist. Aber es wird nicht untergehen, also hören Sie auf, mir irgendwelchen Unsinn zu erzählen.«
»Diese Schiff wird ganz sicher sinken«, gab Ilbery zurück.
»Geben Sie den Befehl«, verlangte Brèvard. »Sonst blase ich Ihnen ein Loch in den Schädel und lenke das Schiff selbst.«
Ilbery kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. »Möglich, dass Sie ein Schiff steuern können, aber was ist mit den anderen Aufgaben? Wollen Sie und Ihre Handvoll Leute etwa die Mannschaft ablösen?«
Brèvard lächelte schief. Er hatte von Anfang an gewusst, dass dies sein Schwachpunkt war, die verwundbare Stelle in seiner Rüstung. Er hatte acht Leute bei sich, drei davon im Kindesalter. Selbst wenn sie erwachsen wären, neun Leute konnten niemals die Feuer unter den Kesseln lange genug in Gang halten, geschweige denn die Passagiere und die Mannschaft bewachen und gleichzeitig das Schiff steuern.
Aber Brèvard war daran gewöhnt, die Dinge stets nach seinem Gutdünken zurechtzudrehen. Sein ganzes bisheriges Leben war eine einzige Demonstration, wie er andere dazu brachte, zu tun, was er verlangte, und zwar entweder gegen ihren Willen oder sogar, ohne dass sie ahnten, wie sehr sie seinen Wünschen entsprachen. Er hatte gewusst, dass er Druck ausüben müsste, und der Sprengstoff in den beiden Kisten versetzte ihn in die Lage, die Chancen zu seinen Gunsten zu verbessern.
»Bringt den Gefangenen«, sagte er.
Ilbery verfolgte, wie die Tür zur Kommandobrücke geöffnet wurde und ein ungekämmter Halbwüchsiger erschien. Er schob einen mit Kohlenstaub bedeckten Mann vor sich her. Blut tropfte sowohl aus seiner Nase als auch aus einer Platzwunde an der Stirn.
»Chief?«
»Tut mir leid, Käpt’n«, sagte der erste Maschinist. »Wir wurden ausgetrickst. Sie haben die Kinder benutzt, um uns abzulenken. Und dann haben sie uns überwältigt. Drei von meinen Männern wurden erschossen. Aber da unten ist es so laut, dass niemand was bemerkt hat, bis es dann zu spät war.«
»Was haben sie getan?«, fragte der Kapitän, dessen Augen immer größer wurden.
»Dynamit«, sagte der erste Maschinist. »Ein Dutzend Stangen an den Kesseln drei und vier.«
Ilbery fuhr zu Brèvard herum. »Sind Sie wahnsinnig? Sprengstoff gehört nicht in eine solche Umgebung! Die Hitze, das Feuer. Ein Funke genügt, und …«
»Und wir fliegen alle in die Luft«, beendete Brèvard den Satz für ihn. »Ja, ich bin mir über die Folgen durchaus im Klaren. Der Punkt ist nur: An Land wartet der Strick auf mich, und zwar die Sorte, die einem den Hals lang macht. Wenn ich schon sterben muss, dann lieber schnell und glorios statt langsam und qualvoll. Also testen Sie lieber nicht, ob ich es ernst meine. Drei meiner Leute hier unten haben solche Gewehre wie diese, um dafür zu sorgen, dass niemand den Sprengstoff entfernt, zumindest so lange nicht, bis ich das Schiff in einem Hafen meiner Wahl verlasse. Und jetzt tun Sie gefälligst, was ich sage, und lenken Sie das Schiff von der Küste weg aufs offene Meer.«
»Und was dann?«, fragte Ilbery.
»Wenn wir unseren Bestimmungsort erreicht haben, nehmen wir ein paar von Ihren Rettungsbooten, einen Haufen Vorräte, Bargeld und Schmuck von jedem Ihrer Passagiere, und dann verlassen wir das Schiff und verschwinden. Sie und Ihre Mannschaft können später Kurs auf Kapstadt nehmen und der Welt eine phantastische Geschichte erzählen.«
Während er sich an der Wand hinter ihm abstützte, stemmte sich Kapitän Ilbery hoch, bis er aufrecht stand. Er starrte Brèvard hasserfüllt an. Der Mann hatte ihn in seiner Gewalt, und er konnte nichts dagegen tun.
»Chief«, sagte er, ohne den Blick von dem Piraten zu lösen. »Gehen Sie ans Ruder, und bringen Sie uns auf Gegenkurs.«
Der erste Maschinist stolperte zum großen Rad, schob den Piraten beiseite und führte den Befehl des Kapitäns aus. Langsam begann die Waratah zu wenden.
»Gute Entscheidung«, sagte Brèvard.
Ilbery war zwar anderer Meinung, aber er wusste, dass er keine Wahl hatte.
Brèvard hingegen war zufrieden. Er setzte sich auf einen Lehnstuhl und studierte den Kapitän eingehend. Nachdem er sein Leben lang andere – von Polizisten bis hin zu Richtern mit sorgfältig gepuderten Perücken – in die Irre geführt hatte, wusste Brèvard, dass einige Menschen leichter zu durchschauen waren als andere. Bei den ehrlichen war es gewöhnlich am einfachsten.
Während er diesen Kapitän betrachtete, schätzte er ihn als einen solchen ein. Einen Mann mit Stolz im Herzen, gescheit und pflichtbewusst und voller Sorge für seine Mannschaft und seine Passagiere. Gerade dieses Pflichtbewusstsein bewirkte, dass er Brèvards Forderungen nachkam, um das Leben der Leute an Bord zu schützen. Aber es machte ihn auch zu einer Gefahr.
Selbst im Moment seiner Kapitulation stand er hoch aufgerichtet und stocksteif da. Obgleich er eine Hand an der Stelle auf seinen Leib presste, wo ihn der Gewehrkolben getroffen hatte, brannte in seinen Augen ein Feuer, das man bei jemandem, der sich geschlagen gab, niemals sehen würde. All das deutete daraufhin, dass der Kapitän noch nicht bereit war, sein Schiff aufzugeben. Ein Gegenzug würde erfolgen, und zwar eher früher als später.
Brèvard nahm es dem Kapitän nicht übel. Wenn er ganz ehrlich war, empfand er sogar eine gewisse Hochachtung vor dem Mann. Gleichwohl nahm er sich vor, wachsam und auf alles vorbereitet zu sein.
SS Harlow – zehn Meilen vor der Waratah
Ebenso wie der Kapitän der Waratah hielt sich der Kapitän der Harlow auf der Kommandobrücke auf. Bei zehn Meter hohen Wellen und Fünfzig-Knoten-Windböen war das erforderlich. Er und seine Mannschaft nahmen ständig Korrekturen vor, um die Harlow auf Kurs zu halten. Sie pumpten sogar erhebliche Wassermengen in die Rumpftanks, um die Rollbewegungen des Schiffes zu reduzieren.
Als der Erste Offizier nach einem Inspektionsrundgang auf die Kommandobrücke zurückkehrte, sah ihn der Kapitän fragend an. »Wie machen wir uns?«
»Bestens, Sir. Vom Bug bis zum Heck alles tipptopp.«
»Hervorragend«, sagte der Kapitän, trat hinaus auf die Brückennock und blickte auf das Meer hinter ihnen. Die Lichter eines anderen Schiffes waren am Horizont zu sehen. Es war ihnen bisher im Abstand von mehreren Meilen gefolgt und stieß jetzt mächtige Rauchwolken aus.
»Was halten Sie davon?«, fragte der Kapitän. »Sie haben den Kurs geändert und entfernen sich von der Küste.«
»Vielleicht um nicht in die Untiefen vor der Küste zu geraten«, sagte der Erste Offizier. »Oder vielleicht weil sie von Wind und Strömung abgedrängt werden. Haben Sie eine Ahnung, wer das ist?«
»Ich weiß es nicht genau«, sagte der Kapitän. »Könnte die Waratah sein.«
Kurz darauf flackerten zwei Lichtblitze im Abstand von wenigen Sekunden an der angenommenen Position des Schiffes auf. Sie waren erst grellweiß und dann orange, aber bei dieser Distanz war kein Ton zu hören, und es war, als beobachte man ein fernes Feuerwerk. Als die Lichtblitze verblassten, war der Horizont wieder dunkel.
Sowohl der Kapitän als auch der Erste Offizier blinzelten verblüfft und starrten in die Finsternis
»Was war das?«, fragte der Erste Offizier. »Eine Explosion?«
Der Kapitän war sich nicht sicher. Er setzte das Fernglas wieder an die Augen und brauchte ein paar Sekunden, um es auf den Punkt zu richten. Von einem Feuer war zwar nichts zu sehen, aber ein eisiger Schauer lief doch über seine Wirbelsäule, als er erkannte, dass jetzt auch die Lichter des geheimnisvollen Schiffes verschwunden waren.
»Es könnte das Auflodern eines Buschfeuers an Land hinter ihnen gewesen sein«, meinte der Erste Offizier. »Oder ein Wärmegewitter.«
Der Kapitän schenkte sich einen Kommentar, schaute durch das Fernglas und schwenkte es hin und her, um den gesamten Horizont abzusuchen. Er hoffte, dass der Erste Offizier mit seiner Vermutung recht hatte, aber wenn die Lichtblitze an der Küste oder am Himmel aufgeflammt waren, was war dann mit den Lichtern des Schiffes geschehen, die kurz vorher noch zu sehen waren?
Im Hafen erfuhren beide Männer, dass die Waratah überfällig war und vermisst wurde. Weder traf sie in Kapstadt ein, noch war sie nach Durban zurückgekehrt oder hatte irgendwo anders angelegt.
Kurz hintereinander ließen die Royal Navy und die Blue Anchor Line Schiffe auslaufen, um die Waratah zu suchen. Doch sie kehrten mit leeren Händen zurück. Kein Rettungsboot tauchte auf. Kein Wrack. Keine Trümmer. Keine Leichen trieben im Meer.
In den darauffolgenden Jahren forschten Seefahrtsvereine, Regierungsorganisationen und Schatzsucher nach dem Wrack des vermissten Schiffs. Dazu nahmen sie Sonare, Magnetometer und Satellitenbilder zu Hilfe. Sie setzten Taucher, Unterseeboote und ferngesteuerte Tauchsonden ein, um verschiedene Wracks entlang der Küste zu inspizieren. Aber alles war vergebens. In den mehr als einhundert Jahren nach ihrem Verschwinden wurde nicht eine einzige Spur von der Waratah gefunden.
2
September 1987Maputo-Bucht, Mosambik
Die Sonne sank dem Horizont entgegen, als ein vom Alter gezeichneter Fünfzig-Fuß-Trawler aus der Straße von Mosambik kommend in die Bucht einlief. Für Cuoto Zumbana war es ein guter Tag gewesen. Der Laderaum seines Bootes war mit frischen Fischen gefüllt, kein Netz war zerrissen oder verloren gegangen, und der alte Motor hatte wieder einmal durchgehalten – obwohl er nach wie vor grauen Rauch aushustete.
Mit seinem Leben zufrieden, schloss Zumbana die Augen und wandte sich zur Sonne, um sich die verwitterten Falten seines Gesichts wärmen zu lassen. Es gab nur wenig, das er mehr genoss als dieses wunderbare Gefühl. Es erfüllte ihn mit einem so umfassenden inneren Frieden, dass er die aufgeregten Rufe seiner Mannschaft nicht sofort wahrnahm.
»Mashua!«, rief einer der Männer.
Zumbana schlug die Augen auf und musste im grellen Sonnenlicht, das wie flüssiges Feuer von der See reflektiert wurde, heftig blinzeln. Während er dann mit der Hand die Augen überschattete, sah er, worauf die Männer deuteten. Es war ein kleines Dingi, das in der leichten Brise des späten Nachmittags auf den Wellen schaukelte. Anscheinend trieb es führerlos durchs Wasser, da an Bord niemand zu erkennen war.
»Das müssen wir uns ansehen«, entschied er. Ein kleines Boot zu finden, das er vielleicht verkaufen konnte, würde den Erfolg dieses Tages noch erheblich steigern. Er war sogar entschlossen, den möglichen Gewinn mit seiner Mannschaft zu teilen.
Der Trawler änderte den Kurs, und die alte Maschine stampfte ein wenig lauter. Langsam, aber stetig schrumpfte der Abstand zu ihrem Fund.
Zumbana runzelte die Stirn. Das kleine Boot sah arg mitgenommen aus und war offenbar hastig geflickt worden. Selbst aus zwanzig Metern Entfernung war zu erkennen, dass es größtenteils verrottet war.
»Jemand wollte es loswerden«, sagte einer seiner Männer.
»Vielleicht finden wir noch was Wertvolles an Bord«, meinte Zumbana. »Bring uns längsseits.«
Der Steuermann gehorchte, und der Trawler hielt neben dem treibenden Boot an. Als es mit einem Rumpeln an der Bordwand entlangschrammte, sprang ein anderer Mann hinüber. Zumbana warf ihm eine Leine zu, und die beiden Boote wurden miteinander vertäut.
Von seinem Platz aus konnte Zumbana leere Kochtöpfe und einen Haufen Lumpen erkennen, ganz gewiss nichts von Wert, aber als der Matrose eine mottenzerfressene Decke anhob und wegzog, verflüchtigte sich schlagartig jeder Gedanke an ein mögliches gutes Geschäft.
Unter der Decke kamen eine junge Frau und zwei kleine Jungen zum Vorschein. Zweifellos waren sie tot. Ihre Gesichter waren sonnenverbrannt, die Körper steif. Die Kleidung war zerfetzt, und ein mit Blut getränkter Lappen bedeckte die Schulter der Frau. Bei näherem Hinsehen waren an den Handgelenken und den Fußknöcheln der Toten Hautabschürfungen zu erkennen. Es schien, als wären die drei für längere Zeit gefesselt gewesen.
Zumbana bekreuzigte sich hastig.
»Wir sollten das Boot in Ruhe lassen«, riet einer seiner Männer.
»Das ist ein böses Omen«, fügte ein anderer hinzu.
»Nein. Wir müssen die Toten melden«, entgegnete Zumbana. »Vor allem die beiden Kinder.«
Die Männer warfen ihm zweifelnde Blicke zu, führten jedoch seinen Befehl aus. Nachdem sie das Boot mit einem Tau in Schlepp genommen hatten, schwenkte der Trawler wieder auf seinen alten Kurs zur Küste um und zog das Boot hinter sich her.
Zumbana ging zum Heck, von wo aus er das Boot ständig im Auge hatte. Sein Blick wanderte von dem Dingi zum Horizont. Er dachte über die Insassen nach. Wer mochten sie sein? Woher kamen sie? Welcher Gefahr waren sie entronnen, um am Ende auf dem offenen Meer zu sterben? So jung, dachte er, während er die drei Leichen betrachtete. So zerbrechlich.
Das Boot selbst war ein weiteres Rätsel. Die oberste Planke des Rumpfs sah aus, als habe sie früher einen Namen getragen, der jedoch nicht mehr zu lesen war. Er fragte sich, ob das Boot die Fahrt bis zum Hafen überstehen würde. Im Gegensatz zu seinen drei Insassen machte es einen uralten Eindruck. Ganz sicher war es deutlich älter als die Toten. Genau genommen sah es aus, als stammte es aus einer vollkommen anderen Epoche.
3
März 2014Indischer Ozean
Ein bläulicher Blitz zuckte über den Horizont. Für ein oder zwei Sekunden erhellte er die graue Dunkelheit, wo See und Sturm aufeinandertrafen.
Kurt Austin blickte aus dem hinteren Abteil eines Sikorsky Jayhawk in diese Dunkelheit, während sich der Helikopter einen Weg durch die Regenmassen bahnte. Turbulenzen schüttelten die Maschine durch, und zehn Meter hohe Wellen türmten sich unter ihnen auf, deren Kämme vom heulenden Sturm zu Gischtwolken zerfasert wurden.
In den Pausen zwischen den Blitzen sah Kurt sein Spiegelbild auf der Fensterscheibe. Knapp über vierzig, mit silbergrauem Haar, war er bei richtigem Licht betrachtet eine attraktive Erscheinung. Dafür sorgten sein markantes Kinn und die intensiven blauen Augen. Aber wie ein Lastwagen, der auf diversen Baustellen zum Einsatz kommt, anstatt in der Garage zu stehen, war seinem Gesicht die zurückgelegte Strecke jetzt deutlich anzusehen.
Die Falten um seine Augen waren ein wenig tiefer als die meisten anderen. Eine Kollektion verblasster Narben – von Faustkämpfen, Autounfällen und anderen Geschehnissen – zierten Stirn und Kinn. Es war das Gesicht eines Mannes, der zu allem bereit war, entschlossen und unnachgiebig, sogar in diesem Moment, während sich der Helikopter der Grenze seiner Maximalreichweite näherte.
Er schaltete die Gegensprechanlage ein und schaute zu seinem Freund Joe Zavala hinüber, der den Platz des Kopiloten einnahm. »Gibt es schon was?«
»Nein. Nichts«, antwortete Joe.
Kurt und Joe arbeiteten für die National Underwater Marine Agency, kurz NUMA, eine Abteilung der amerikanischen Regierung, die sich dem Studium und der Erhaltung der Ozeane verschrieben hatte. In diesem Augenblick gehörten sie jedoch zu einem eilig zusammengestellten Rettungsteam, das einer kleinen Flotte gefährdeter Schiffe behilflich sein sollte, die unvorbereitet in einen heftigen Sturm geraten waren.
Teilweise vom Motorenlärm überdeckt, drangen das Knistern atmosphärischer Störungen sowie hektische Funksprüche zwischen der südafrikanischen Küstenwache und der kleinen Rettungsflotte aus dem Lautsprecher des Funkgeräts.
»Sapphire Two, wie lautet Ihre Position?«
»Sapphire Two hat Kontakt mit der Endless Road. Sie ist anscheinend steuerlos, hat jedoch kein Leck. Vier Mannschaftsmitglieder sind zu sehen. Begeben uns in Position für den Einsatz des Rettungskorbs.«
»Roger, Sapphire Two. Sapphire Three, wie ist Ihr Status?«
»Sind mit drei Schiffbrüchigen unterwegs zur Basis. Zwei stark unterkühlt, der dritte stabil.«
Der Sturm war von Südosten gekommen und hatte auf seinem Weg zum Kap der Guten Hoffnung an Stärke zugenommen. Er hatte mehrere Frachter und ein über dreihundert Meter langes Containerschiff angehalten, war dann nach Norden umgeschwenkt und hatte dort eine Ansammlung von Segelyachten und anderen Freizeitbooten, die eine Freundschaftsregatta von Durban nach Australien veranstalteten, ins Visier genommen.
Die Heftigkeit des Sturms und sein plötzliches Aufkommen hatten die südafrikanische Küstenwache bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit beansprucht. Sie hatte um jede mögliche Unterstützung gebeten und sich die Hilfe einer Fregatte der Royal Navy, zweier amerikanischer Versorgungsschiffe und des Forschungsschiffs Condor der NUMA gesichert.
Siebzig Meilen östlich der Condor näherten sich Kurt Austin, Joe Zavala und der Pilot des Jayhawk den GPS-Koordinaten, die man ihnen genannt hatte. Aber erst mussten sie das Objekt ihrer Suche präzise orten.
»Wir müssten eigentlich genau darüber sein«, stellte Kurt fest.
»Vielleicht ist die Yacht schon gesunken«, erwiderte der Pilot.
Daran wollte Kurt nicht einmal denken. Durch eine seltsame Fügung des Schicksals kannte er die Familie auf der Yacht, der sie helfen wollten. Zumindest kannte er ein Mitglied der Familie.
»Wie viel Treibstoff haben wir noch?«
»In zehn Minuten heißt es Bingo.«
An diesem Punkt hatten sie nur noch genug Benzin, um zur Condor zurückzukehren, und müssten sogar sofort umkehren, wenn sie nicht riskieren wollten, kurz vor ihrem Ziel abzuschmieren und selbst um Hilfe bitten zu müssen.
»Legen Sie noch ein paar Minuten zu«, sagte Kurt.
»Der Gegenwind macht uns ziemlich zu schaffen.«
»Dafür werden wir auf dem Rückweg geschoben«, sagte Kurt. »Fliegen Sie weiter.«
Der Pilot verstummte, und Kurt konzentrierte sich wieder auf den Ozean.
»Ich habe etwas«, rief Joe und drückte einen Kopfhörer auf sein Ohr. »Ganz schwach, aber ich glaube, es ist ihr automatisches Notsignal. Kurs null sieben null.«
Der Helikopter legte sich in die Kurve, und mehrere Minuten später sichtete Kurt den Rumpf einer Einhundertsechzig-Fuß-Yacht mit starker Schlagseite. Sie war zwar noch schwimmfähig, aber der Bug wurde bereits von den Wellen überspült.
»Bringen Sie uns hin«, befahl Kurt.
Mit einem Ruck zog er die Tür zum Frachtraum auf und verriegelte sie in ihrer Position. Wind und Regen peitschten in die Kabine.
Ein Windensystem und einhundertdreißig Meter Kabel erlaubten ihnen, Überlebende an Bord zu hieven, aber sie hatten keinen Rettungskorb, daher müsste Kurt selbst hinuntergehen und sich mit einem Überlebenden nach dem anderen in den Hubschrauber hinaufziehen lassen. Er befestigte das Kabel an dem Brustgeschirr, das er vorsorglich schon beim Start des Hubschraubers angelegt hatte, und setzte sich auf den Rand des Kabinenbodens, so dass seine Beine im Freien baumelten.
»Ich sehe niemanden«, meldete der Pilot.
»Vielleicht schwimmen sie im Wasser und halten sich seitlich am Rumpf fest«, erwiderte Kurt. »Drehen Sie mal eine Runde.«
Kurt spürte, wie das Adrenalin durch seinen Körper pulsierte. So geschah es seit dem Moment, als die Details des beschädigten Bootes von der zuständigen Station der südafrikanischen Küstenwache durchgegeben wurden.
»Motoryacht Ethernet meldet schweren Wassereinbruch«, hatte sie der südafrikanische Beamte informiert. »NUMA Jayhawk, bitte kommen Sie zu Hilfe. Sie sind das einzige Rettungsteam in Reichweite.«
»Würden Sie die Identität des Schiffes bitte bestätigen?«, hatte Kurt geantwortet, weil er kaum glauben konnte, was er gehört hatte.
»Ethernet«, wiederholte der Beamte der Küstenwache. »Heimathafen San Francisco. Sieben Personen an Bord. Darunter Brian Westgate, seine Ehefrau und zwei Kinder.«
Brian Westgate war ein Internetmilliardär. Seine Frau, Sienna, war eine alte Freundin von Kurt Austin. Viele Jahre zuvor war sie die große Liebe seines Lebens gewesen.
Die Nachricht hatte Kurt in einer Weise getroffen, wie nur wenige Dinge es je getan hatten, aber er war der Typ, der sich von so etwas schnell erholte. Er verdrängte jeden Gedanken an die Vergangenheit oder an die Möglichkeit, die Yacht nicht rechtzeitig zu finden, und konzentrierte sich ausschließlich auf die bevorstehende Aufgabe.
»Schalt den Scheinwerfer an, Joe!«
Während der Helikopter das treibende Schiff umkreiste und in den Sinkflug ging, konnte Kurt sehen, wie die Wellen über den Bootsrumpf leckten. Das Einzige, was Anlass zur Hoffnung gab, war, dass der vordere Deckaufbau vom Heckabschnitt der Yacht einigermaßen wirkungsvoll abgeschirmt wurde.
Joe schaltete den Suchscheinwerfer an, und der Regen verwandelte sich in einen dichten Wald leuchtender Schnüre. Für einen Moment wurde Kurt von den Lichtreflexen geblendet, doch sobald Joe den Lichtstrahl justiert hatte, konnte Kurt ein wenig mehr vom Bootsrumpf erkennen. Dabei nahm er ein orangefarbenes Leuchten wahr.
»Da! In der Nähe der Kommandobrücke!«
Der Pilot sah es ebenfalls. Er lenkte die Maschine heran, während Joe seinen Sicherheitsgurt öffnete und nach hinten ins Frachtabteil kam, um die Winde zu bedienen.
»Dieses Kabel ist nicht dafür gedacht, Menschen zu tragen«, gab er Kurt zu bedenken.
»Ich weiß. Normalerweise schleppt es eine Sonar-Sonde«, sagte Kurt.
»Dieser Fisch wiegt aber nur höchstens neunzig Pfund.«
»Es wird schon halten«, sagte Kurt, »und jetzt lass mich runter.«
Joe zögerte jedoch, und sobald Kurt nach unten geschaut und ihre Position überprüft hatte, reichte er über seinen Kopf und löste eigenhändig die Seilbremse. Ehe Joe ihn davon abhalten konnte, rutschte er vorwärts und ließ sich fallen.
Während er sich eine Tauchmaske vors Gesicht presste und die Beine gestreckt hielt, traf Kurt auf einen Wellenkamm und tauchte hindurch. Für mehrere Sekunden war er von der seltsam gedämpften Stille des Meeres umgeben. Es war beruhigend und friedlich.
Und dann tauchte er auf und fand sich mitten in einem Mahlstrom wieder.
Die Dünung war wie eine Landschaft wogender Berge, unzählige Tropfen des Wolkenbruchs prallten davon ab und tanzten in jede Richtung.
Kurt orientierte sich und nahm mit kräftigen Schwimmzügen Kurs auf die Yacht, die da vor sich hin dümpelte.
Er erreichte sie mittschiffs und streckte sich nach der Reling. Ehe er sie zu fassen bekam, sackte er in ein Wellental ab und rutschte am Bootsrumpf entlang. Er kämpfte gegen den Sog der Wassermassen, um in Position zu bleiben, bis der nächste Wellenberg anrollte. Der hob ihn auf gleiche Höhe mit dem Bootsdeck. Diesmal packte er schnell die Reling und zog sich an Bord. Er tastete sich über das Deck und konnte noch im letzten Moment vermeiden, von der nächsten Welle heruntergerissen zu werden.
Dann gelangte er zur Kommandobrücke, deren Fenster, wie er feststellen musste, zertrümmert waren. Das orangefarbene Leuchten, das er für eine Schwimmweste gehalten hatte, war nirgendwo zu sehen.
»Sienna!«, rief er. Bei dem Toben des Sturms war das aber völlig sinnlos.
Er schaute hinein. Fast ein halber Meter Wasser schwappte in der Brückenkabine hin und her. Für einen kurzen Moment glaubte er, einen Körper erkennen zu können, aber das Stromnetz war ausgefallen, und in der herrschenden Dunkelheit hätte es alles Mögliche sein können. Er fasste nach der Klinke der Kajütentür und riss sie auf.
Das Schiff ächzte unheilvoll, während es sich im Sturm herumwälzte. Alles in Kurts nächster Umgebung schien in Bewegung zu sein. Er hob einen Arm und schaltete die wasserdichte Stablampe an, die mit Gurten befestigt war.
Der Lichtstrahl glitt über das Wasser und verbreiterte sich, als er von einer Glaswand hinter der Brücke reflektiert wurde. Kurt konnte sich vage erinnern, etwas über die Konstruktion der Yacht gelesen zu haben. Jede Wand des Oberdecks bestand aus Acrylglas. Damit sollte im Innern der Yacht die Illusion von Geräumigkeit geschaffen werden. Die Glaswände konnten durch das Betätigen eines Schalters verdunkelt werden.
Die nächste Welle traf das Schiff, sodass es sich weiter zur Seite neigte. Kurt stellte fest, wie er auf die Glaswand zurutschte, während grünes Meerwasser durch die offene Luke hereinströmte.
Möbel, Karten, Schwimmwesten und alles mögliche andere Gerümpel trieben im Wasser ringsum. Kurt richtete sich auf und suchte sich einen festen Stand. Sein Arm tauchte aus dem Wasser auf, und der Lichtstrahl traf erneut die Glaswand. Für einen kurzen Moment blendete ihn das reflektierte Licht, aber als er seinen Arm bewegte, entdeckte er auf der anderen Seite der Glaswand ein Gesicht. Es war das Gesicht einer Frau, umrahmt von nassem blondem Haar. Ein Kind trieb neben ihr – ein flachsblondes Mädchen, nicht älter als sechs oder sieben Jahre. Seine Augen waren offen, aber leblos.
Kurt wollte ihm zu Hilfe kommen, stieß jedoch gegen eine gläserne Trennwand.
»Sienna!«, rief er.
Keine Antwort, überhaupt keine Reaktion.
Das Wasser stieg jetzt schneller. Es wogte um Kurts Brustkorb, während er seine Faust gegen die Glaswand schmetterte und dann versuchte, sie mit einem Stuhl zu zertrümmern, der neben ihm im Wasser getrieben hatte. Die Trennwand hielt zwei wuchtigen Schlägen stand. Und während Kurt zu einem dritten Schlag ausholte, rollte das Schiff weiter herum, so dass ihm das Wasser ihm bis zum Hals stieg.
Die Yacht war im Begriff umzukippen. Er konnte es deutlich spüren.
Ohne Vorwarnung verengte sich sein Brustgeschirr und schnürte seinen Brustkorb ein. Kurt spürte, wie er nach hinten gezogen wurde.
»Nein!«, rief er, nur um einen Mundvoll Wasser zu schlucken.
Er wurde weiter rückwärts gezogen gegen eine Wasserflut, die in die Brückenkabine strömte. Es war, als werde er durch einen Wasserfall geschleift. Für einen kurzen Moment sah er ihre Gesichter noch einmal, dann wurde ihm die Maske vom Gesicht gerissen, und die Welt verwandelte sich in einen verschwommenen grünen Wirbel. Das Kabel ruckte noch einmal, zerrte an ihm so, dass er mit dem Kopf gegen den Türrahmen knallte.
Geblendet und nur halb bei Bewusstsein spürte Kurt, dass er in die Freiheit gezogen worden war. Aber er bewegte sich jetzt deutlich langsamer durchs Wasser. In irgendeinem Winkel seines Bewusstseins fand er die Lösung: Joe und der Pilot mussten die Position des Hubschraubers verändert haben, um ihn aus dem sinkenden Schiff herauszuhieven. Sie hatten ihn zwar freibekommen, aber das Kabel musste dabei gebrochen sein – vielleicht als er mit der Kabinenwand kollidiert war.
Er versuchte zu schwimmen, schlug schwach mit den Beinen, aber sein Geist war vollkommen benebelt, und seine Muskeln reagierten nicht. Anstatt aufzusteigen, wurde er vom Sog der sinkenden Yacht abwärts gezogen, tiefer und tiefer. Er sah sie unter sich, ein grauer Schatten, der sich langsam aus dem Lichtstrahl seiner Lampe entfernte.
Nur noch an seinem eigenen Überleben interessiert, legte er jetzt den Kopf in den Nacken und schaute nach oben. Über sich erkannte er einen Ring aus silbrigem Licht. Und dann, nichts anderes empfindend als namenloses Erstaunen, sah er, dass sich der Ring schloss – wie die Pupille eines riesigen allwissenden Auges.
4
Mit einem Ruck fuhr Kurt in seinem Bett hoch. Er war in Schweiß gebadet und schnappte gierig nach Luft. Sein Kopf pochte und dröhnte, als sei er soeben einen steilen Berg hinaufgerannt. Für einen Moment rührte er sich nicht, starrte nur in die Dunkelheit und versuchte, sich aus den Klauen des Albtraums und den aufwühlenden Empfindungen zu lösen, die sich im Gefolge eines Traums einstellen und ein Wiedereinschlafen unmöglich machen.
Der Prozess war immer der gleiche, ein schnelles Erkennen, wo er sich befand, und dann ein kurzer Moment der Unsicherheit, als könne sein Geist nicht entscheiden, welche Welt real und welche eine Illusion war.
Donner grollte da draußen, begleitet vom matten Aufleuchten eines Blitzes und dem Geräusch von Regen, der auf seine Terrasse prasselte.
Er war zu Hause, im Schlafzimmer seines Bootshauses am Ufer des Potomac River. Er war nicht in Gefahr, bei einem Rettungsversuch zu ertrinken, der Monate zuvor und eine halbe Welt weit entfernt stattgefunden hatte.
»Alles in Ordnung?«, fragte eine trostvolle weibliche Stimme.
Kurt kannte die Stimme. Sie gehörte Anna Ericsson, freundlich und mitfühlend und mindestens genauso hübsch. Naturblond – mit aufregenden grünen Augen, den hellsten Augenbrauen, die er je gesehen hatte, und einer perfekt geformten zierlichen Nase mit dezentem Aufwärtsschwung an der Spitze. Aus irgendeinem Grund wünschte er sich, dass sie in diesem Moment woanders wäre.
»Nein«, sagte Kurt und schlug die Laken zurück. »Es ist alles andere als in Ordnung.«
Er schwang sich aus dem Bett und ging zum Fenster.
»Das ist nur ein Albtraum«, sagte sie. »Unterdrückte Erinnerungen, die sich bemerkbar machen.«
Kurt spürte ein dumpfes Pochen in seinem Kopf, nicht von Kopfschmerzen, sondern im hinteren Teil seines Schädels, wo er sich einen winzigen Haarriss zugezogen hatte, als Joe ihn aus der sinkenden Yacht herausgezogen hatte. »Sie sind nicht unterdrückt«, sagte er. »Um ganz ehrlich zu sein, ich wünschte, sie wären es.«
Sie blieb ruhig und ließ sich von seiner Unruhe nicht anstecken. »Hast du sie gesehen?«, fragte sie.
Der Donner grollte da draußen, und der Regen trommelte mit neuer Kraft gegen die Glasschiebetür. Kurt fragte sich, ob wohl der Regen den Albtraum ausgelöst hatte. Andererseits brauchten diese Träume durch nichts Besonderes ausgelöst zu werden. Auch so kamen sie fast jede Nacht.
»Hast du sie diesmal gesehen?«, wiederholte sie ihre Frage.
Missmutig schüttelte Kurt den Kopf, winkte ab und ging zur voll ausgestatteten Bar im Wohnzimmer. Anna folgte ihm Sekunden später, bekleidet mit Yogahose und einem seiner T-Shirts. Wieder einmal bewunderte er, wie schön sie war. Sogar mitten in der Nacht. Sogar ohne eine Spur von Make-up.
Er knipste das Licht an. Für einen Moment schmerzte es in seinen Augen, gestattete ihm jedoch, eine halbvolle Flasche Jack Daniels vom Tablett zu nehmen. Er bemerkte, dass seine Hand zitterte – und schenkte sich einen Doppelten ein.
»Du weißt, dass das etwas bedeutet«, bohrte sie.
Er trank einen Schluck von dem Whiskey. »Können wir die Psychoanalyse auf die Bürostunden beschränken?«
Sie sollte eigentlich seine Therapeutin sein. In Folge der Schädelverletzung hatte er Zitteranfälle gehabt und noch andere Reaktionen bei sich beobachtet. Die Albträume kamen zuerst, dann machten sich Gedächtnislücken bemerkbar, und schließlich kam es zu mühsam unterdrückten Wutanfällen, die all jene, die ihn kannten, als völlig untypisch und mit seinem Charakter nicht vereinbar betrachteten.
Infolgedessen hatte die NUMA Ms. Ericsson als Therapeutin und Beraterin für ihn engagiert. Aus reiner Bosheit gegenüber denen, die ihm zu helfen versuchten, hatte Kurt wochenlang den unverbesserlichen Miesepeter gespielt. Es war ihm nicht gelungen, sie zum Rückzug zu bewegen, und am Ende trafen sie sich auf einer anderen als ausschließlich professionellen Basis.
Kurt trank einen weiteren Schluck von seinem Whiskey und zuckte vor Schmerz zusammen. Er bemerkte eine Packung Aspirintabletten neben den Schnapsflaschen und griff danach. Wie viele Nächte waren in dieser Woche auf die gleiche Art und Weise verlaufen? Vier? Fünf? Er versuchte, sie zusammenzuzählen, konnte sich aber nicht mehr genau erinnern. Sie waren zu sehr zu einem Normalzustand geworden.
»Bist du in letzter Zeit zur Arbeit gegangen?«, fragte sie und ließ sich neben ihm auf die Couch fallen.
Kurt schüttelte den Kopf. »Ich werde erst dann wieder zur Arbeit gehen, wenn du mich zusammengeflickt hast. Schon vergessen?«
»Du bist nicht zerbrochen, Kurt. Aber du leidest. Ganz gleich, wie sehr du dich dagegen wehrst und so tust, als sei es nicht der Fall. Du hast eine schwere Gehirnerschütterung, einen Schädelbruch und ein emotionales Trauma erlitten, und zwar alles gleichzeitig. Monatelang hast du sämtliche Symptome einer traumatischen Hirnverletzung gezeigt. Und einige Symptome zeigst du noch immer. Darüber hinaus bist du ein Paradebeispiel für das Überlebenden-Syndrom.«
»Ich habe nichts, weshalb ich mich schuldig fühlen sollte«, wehrte er sich. »Ich habe sogar alles getan, was ich konnte.«
»Das weiß ich«, sagte sie. »Das wissen alle Beteiligten. Aber du selbst glaubst es nicht.«
Er wusste nicht, was er glauben sollte. Im wahrsten Sinne des Wortes.
»Sogar Brian Westgate weiß, dass das, was du getan hast, geradezu heldenhaft war.«
»Brian Westgate«, murmelte Kurt geringschätzig.
Sie nahm den Unterton in seiner Stimme wahr. Er signalisierte, dass er alles andere als bereit war, sich zu beruhigen. Trotzdem blieb sie bei dem Thema.
»Er will sich noch immer mit dir treffen, weißt du. Dir die Hand drücken. Sich bei dir bedanken.« Sie hielt für einen Moment inne. »Hast du wenigstens mal seine Anrufe beantwortet?«
Natürlich hatte er das nicht getan. »Ich war beschäftigt.«
Sie studierte ihn eingehend, dann nickte sie kaum merklich. »Das ist es also, nicht wahr?«
»Was soll was sein?«
»Eigentlich hattest du Sienna heiraten wollen, aber dann hast du sie weggestoßen. Wäre es nicht dazu gekommen, hätte sie Westgate niemals kennengelernt. Kein Westgate, keine Yacht – und kein gescheiterter Versuch, sie zu retten. Deshalb machst du dir Vorwürfe.«
Das Überlebenden-Syndrom war sehr kompliziert. Kurt wusste das. Er hatte Freunde, die aus dem Irak und aus Afghanistan zurückgekommen waren. Sie hatten heldenhafte Dinge getan, heldenhafter als alles, zu was er je in der Lage gewesen war, und trotzdem gaben sie sich selbst die Schuld für vieles, das schiefgegangen war.
Er holte tief Luft und wich ihrem Blick aus. An dem, was sie sagte, war zu viel Wahres, als dass er hätte widersprechen können. Aber aus Gründen, die näher zu erläutern er nicht bereit war, half ihm das nicht wesentlich weiter. Er kam auf die Aspirintabletten zurück, schraubte die Flasche auf und kippte sich ein paar Tabletten in den Mund. Mit einem weiteren Schluck Whiskey spülte er sie hinunter.
Zufrieden, dass seine Kopfschmerzen angemessen behandelt worden waren, schaute er Anna wieder an und bemühte sich, ein wenig umgänglicher zu sein. »Warum, ist das wichtig?«, fragte er. »Warum bedeutet es dir so viel?«
»Weil es mein Job ist«, sagte sie. »Und weil ich so idiotisch gewesen bin, in dir mehr zu sehen als nur einen Patienten.«
»Nein«, sagte er und korrigierte sie. »Warum ist es für dich so wichtig, ob ich sie im Traum sehe oder nicht? Du fragst mich das immer wieder. Was soll daran so bedeutsam sein?«
Sie schwieg und schaute zu ihm hoch. Ihr Blick war eine Mischung aus Anteilnahme und Hilflosigkeit. »Für mich ist es nicht wichtig«, sagte sie. »Sondern für dich.«
Kurt starrte sie wortlos an.
»Nach allem, was du mir erzählt hast, sind es immer die gleichen Träume«, erklärte sie. »Außer dass du in der Hälfte der Träume diese blonde Frau und eins ihrer Kinder siehst, während du in den restlichen Träumen ausschließlich auf Trümmer und leere Schwimmwesten stößt. Du kannst dir noch nicht einmal sicher sein, ob die Frau tatsächlich Sienna ist. Aber egal, wie oder was, real oder eingebildet, du bist nicht an sie herangekommen, das Schiff ging unter und sie unglücklicherweise mit ihm. Ende der Geschichte.«
Sie neigte den Kopf ein wenig zur Seite. Ein mitfühlender Ausdruck stahl sich in ihr Gesicht. »Für den Rest der Welt macht es keinen Unterschied, denn am Ende kommt das Gleiche heraus. Aber diese wechselnden Träume – diese wechselnden Realitäten – sie müssen eine Bedeutung für dich haben, sonst wiederholten sie sich nicht immer wieder. Je eher du erklären kannst, weshalb du sie hast, desto schneller fühlst du dich besser.«
Er konnte sie nur wortlos anstarren. Sie war näher an der Wahrheit, als sie ahnte.
»Ich verstehe«, war alles, was er dazu sagen konnte.
Sie seufzte. »Ich hätte gar nicht erst hierherkommen sollen«, sagte sie, griff nach ihren Turnschuhen und schlüpfte mit den Füßen hinein. »Eigentlich hätte ich dich auch niemals küssen sollen. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich es getan habe.«
Sie stand auf und nahm ihren Mantel von einer Garderobe neben der Haustür. »Ich verschwinde wieder nach Hause«, sagte sie. »Geh wieder arbeiten, Kurt. Es ist vielleicht gut für dich. Und verabrede dich mit Westgate. Er ist zurzeit in Washington. Morgen gibt er auf den Stufen des Smithsonian etwas Wichtiges bekannt. Wahrscheinlich ist er gar nicht der Mistkerl, für den du ihn hältst. Und vielleicht löst das einige deiner Probleme.«
Sie schlüpfte in den Mantel, öffnete die Tür, so dass das Prasseln des Regens auf der Auffahrt zu hören war, dann trat sie hinaus und schloss die Tür hinter sich. Sekunden später sprang der Motor ihres Ford Explorer an, gefolgt von den Geräuschen, die das Zurücksetzen eines Autos begleiten. Dann bog der Wagen auf die Straße am Fluss ein und entfernte sich weiter.
Eine geschlagene Minute lang starrte Kurt ins Leere. Dann trank er in einem Zug das Glas aus und überlegte, ob er sich noch einen zweiten Drink einschenken solle. Doch er stellte das Glas zurück auf den Tresen. Es würde ihm kaum weiterhelfen.
Anstatt sich einen frischen Drink einzuschenken, durchquerte er den Wohnraum und öffnete die Schiebetür, die auf die Terrasse hinausführte. Der Regen wollte nicht versiegen und perlte über das frisch imprägnierte Holz wie Quecksilber auf einem Labortablett. Der Fluss verschwand unter einer Dunstschicht tanzender Regentropfen wie die See in seinem Traum.
Weshalb war es wichtig?
Er trat ans Geländer. Während ihn der Regen durchnässte, schien es, als wasche er einen Teil der Qual aus ihm heraus. Zu seiner Linken konnte er die roten Rücklichter von Annas Ford erkennen, mit dem sie nach Hause fuhr.
Weshalb bemühte er sich jedes Mal, wenn dieser Traum begann, heftiger, die Wahrheit zu erkennen?
Er kannte die Antwort auf dieses Rätsel, sie war ihm schon vor Wochen eingefallen, aber er behielt sie für sich. Er konnte mit niemandem darüber sprechen, und ganz gewiss nicht mit seiner Therapeutin.
Triefnass kehrte er ins Haus zurück, nahm ein Handtuch, um sich Hände und Gesicht abzutrocknen, und ließ sich in den Sessel hinter seinem Schreibtisch fallen.
Er legte das Handtuch beiseite, schaltete den Computer ein und wartete darauf, dass sich der Bildschirm aufhellte. Nachdem er sein Hauptpasswort eingegeben hatte, klickte er auf ein Symbol, dann wurde er aufgefordert, ein zweites Passwort zu tippen. Danach öffnete sich eine Liste chiffrierter E-Mails.
Die jüngste war von einem ehemaligen Mossad-Agenten gesendet worden, an den Kurt durch einen gemeinsamen Bekannten gekommen war. Geld wurde überwiesen und empfangen, und der Mann erklärte sich bereit, einem Gerücht nachzugehen.
Die E-Mail war sachlich und unmissverständlich.
Kann die Anwesenheit von Sienna Westgate in Mashhad weder bestätigen noch verneinen.
Mashhad war eine Stadt im nördlichen Iran, die im Verdacht stand, die Zentrale einer neuen technischen Entwicklungsabteilung zu beherbergen, die für das iranische Militär arbeitete. Niemand wusste genau, welche Ziele diese Abteilung verfolgte, aber die Iraner schienen verzweifelt bemüht, ihre Internetsicherheit und ihre Sturmtruppen zu verstärken. Zutiefst darüber verärgert, dass die Vereinigten Staaten es irgendwie geschafft hatten, einen Virus namens Stuxnet in ihre nuklearen Forschungsanlagen einzuschleusen und zu bewirken, dass rund eintausend sündhaft teure Zentrifugen regelrecht durchdrehten, bis sie explodierten, unternahmen die Iraner nicht nur alles Menschenmögliche, um sich zu schützen, sondern sie planten außerdem zurückzuschlagen.
Zu diesen Bemühungen gehörte auch, sich der Mitarbeit von Ausländern zu versichern, die man in regelmäßigen Abständen erst in Mashhad eintreffen und dann wieder aus Mashhad abreisen sah, manchmal unter Bewachung.
Kurt las den Rest der E-Mail.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren, dass sich drei Personen westlicher Herkunft – zwei männlich, eine weiblich – eine ganze Zeit in Mashhad aufgehalten haben. Sie waren dort mindestens neunzehn Tage und möglicherweise sogar dreißig Tage. Es ist unklar, ob diese Personen Gefangene oder bezahlte Experten waren. Die Beschreibung der Frau passt auf Mrs. Westgate, was Körpergröße und geschätztes Alter betrifft, aber nicht ihre Haarfarbe. Fotografien sind keine vorhanden. Person schien nicht verletzt zu sein oder eine ihrer Hände bei täglichen Aktivitäten zu bevorzugen.
Sie betrat und verließ das vermutlich von der Landesverteidigung benutzte Gebäude in Nord-Mashhad unter leichten Sicherheitsvorkehrungen. Zwang wurde nicht ausgeübt. Spuren von Misshandlungen waren keine zu sehen.
Alle drei Personen wurden dabei beobachtet, wie sie vor einundzwanzig Tagen das Land mit kleinen Flugzeugen verließen. Keinerlei Informationen wurden gefunden, die sichere Rückschlüsse auf das Reiseziel des Flugzeugs und den derzeitigen Aufenthaltsort der Personen an Bord der Maschine zulassen.
Kurt schloss die Datei.
Weshalb war so wichtig, was er in den Träumen gesehen hatte? Weil er, trotz aller Beweise für das Gegenteil, zu der Überzeugung gelangt war, dass Sienna am Leben war. Und wenn sie tatsächlich am Leben war, konnte er sich nur einen einzigen Grund denken, weshalb sie für die Iraner arbeitete: ihre Kinder, Tanner und Elise. Jemand musste sie als Geiseln genommen haben und als Druckmittel gegen sie benutzen.
Er wusste, dass diese Begründung weit hergeholt war und alles auf reinen Vermutungen beruhte. Betrachtete man die Fakten, war das Szenario nicht nur irrational, sondern sogar völlig unsinnig, und dennoch war er mit jeder Faser seines Seins von der Richtigkeit überzeugt.
Nur die Träume ließen ihn zweifeln.
Wenn der leere Salon und die verlassene Yacht die richtigen Erinnerungen waren, dann hatte er Grund, seinen Instinkten zu glauben, zu vertrauen und daraus Hoffnung zu schöpfen.
Aber wenn er Zeuge geworden war, dass Sienna und ihre Tochter ertrunken waren – und im Unterbewusstsein versuchte er offenbar, seine Erinnerungen umzudeuten und das, was er wusste, durch das zu ersetzen, was er sich wünschte –, dann balancierte er am Rand des Wahnsinns entlang, nur einen winzigen Schritt vom Absturz in die geistige Umnachtung entfernt.
5
Juni 2014West-Madagaskar
Die Frau auf dem Pferd bewegte sich langsam und tauchte im Flimmern der Mittagshitze wie eine Geistererscheinung auf. Ende zwanzig und topfit, hielt sie lässig, aber mit sicherer Hand die Zügel eines gescheckten Appaloosa-Hengstes, während dieser gemächlich durch den Sand am Rand eines lehmbraunen Flusses trottete.
Sie war von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Hinzu kamen elegante Reitstiefel und ein breitkrempiger Caballero-Hut, um ihren hellen Teint vor der Sonne zu schützen.
Sie lenkte das Pferd mühelos und passierte eine enge Stelle der Flussrinne, wobei sie das Ufer wachsam im Auge behielt, falls Krokodile im seichten Wasser lauerten. Als die Rinne sich verbreiterte, traf sie auf eine kleine Herde Zebus – Brahman-Rinder mit spitzen, v-förmigen Hörnern und ausgeprägten Schulterwülsten.
Die Rinder waren Teil des unermesslichen Reichtums ihrer Familie, ein Symbol der Macht und des Wohlstands, obgleich ihnen zurzeit nur geringe Fürsorge zuteil wurde. Sie wanderten meist unbewacht herum und ernährten sich von der Vegetation, die während der Regenzeit Madagaskars im Überfluss nachgewachsen war.
Sie ließ die Viehherde hinter sich und folgte einer Biegung des Flusses. Dabei gelangte sie in eine Region, in der das zerstörerische Werk der entfesselten Elemente zu besichtigen war. Wochenlange Regenfälle hatten zu Überschwemmungen geführt, wie dieser Teil der Insel sie noch nie hatte ertragen müssen.
Als die Flüsse sich vereinigt hatten, war die Strömung so stark geworden, dass sie große Uferabschnitte einfach mitriss, stellenweise das Land unterspülte und parkplatzgroße Teile abbrach. Umgestürzte Bäume waren wie Zahnstocher flussabwärts mitgenommen worden, während sich die entwurzelten Baumstämme, die zurückgeblieben waren, mit ihrem freiliegenden Wurzelwerk zu einem undurchdringlichen Pflanzengewirr verknotet hatten.





























