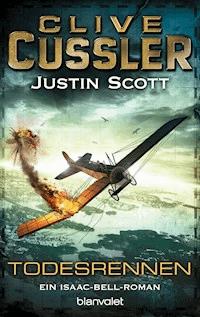
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Isaac-Bell-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
1910 steckt der Traum vom motorisierten Fliegen noch in den Kinderschuhen, als Zeitungsmogul Preston Whiteway ein bahnbrechendes Flugzeugrennen quer durch die USA organisiert. Den Sieger erwarten 50.000 Dollar Preisgeld und ewiger Ruhm.
Isaac Bell, der beste Ermittler der berühmten Van Dorn Detektei, wird engagiert, um während des Rennens für Recht und Gesetz einzustehen. Und das aus gutem Grund! Denn 50.000 Dollar rufen nicht nur Betrüger auf den Plan, sondern auch eiskalte Gangster, die über Leichen gehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
& Justin Scott
Todesrennen
Ein Isaac-Bell-Roman
Aus dem Englischen von Michael Kubiak
Die englische Originalausgabe erschien
unter dem Titel »The Race« bei G.P. Putnam’s Sons, New York.
1. Auflage
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen
der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © 2011 by Sandecker, RLLLP
by arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176-0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013 by
Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagillustration: © Johannes Wiebel | punchdesign
Redaktion: Jörn Rauser
HK · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-15205-5
www.blanvalet.de
Prolog
»The moon is on fire«
Chicago
1899
Der hochgewachsene Mann war allein und betrunken. Er sang ein Lied von Stephen Foster, das besonders bei der Anti-Saloon-League beliebt war, und tanzte dazu im Rinnstein. Es war eine klagende Melodie, die an den Klang schottischer Dudelsäcke erinnerte, ein langsamer Walzer. In seiner Stimme, einem warmen Bariton, schwang die tiefe Reue über gebrochene Vorsätze und nicht eingehaltene Gelübde mit.
»Oh! Comrades, fill no glass for me
To drown my soul in liquid flame…«
Er hatte eine strohblonde Mähne und ein markantes Profil. Dass er so besonders jung war – höchstwahrscheinlich nicht älter als zwanzig –, ließ seinen desolaten Zustand noch viel trauriger erscheinen. Seine Kleider, die aussahen, als hätte er darin geschlafen, waren verfilzt und voller Strohreste. Außerdem waren Ärmel und Hosenbeine zu kurz, als stammten die Sachen aus einer kirchlichen Kleiderkammer oder von einer Wäscheleine, von der er sie hatte mitgehen lassen. Der Leinenkragen seines Oberhemdes hing völlig schief, an einem der Ärmel fehlte die Manschette, und trotz der Kälte hatte er keinen Hut auf dem Kopf. Von den Kostbarkeiten eines Gentlemans, die er gegen Hochprozentiges hätte eintauschen können, waren ihm lediglich ein Paar maßgefertigter Kalbslederstiefel geblieben.
Er prallte gegen einen Laternenpfahl, und auf einmal fehlte ihm der Text des Liedes. Während er die ergreifende Melodie weiter vor sich hin summte und dabei einige unsichere Tanzschritte ausführte, wich er einem Leichenwagen des Armenfriedhofs aus, der am Bordstein anhielt. Der Kutscher band die Pferde an und verschwand eilig durch die Schwingtüren des nächsten der zahlreichen Saloons, aus denen gelbliches Licht auf das Kopfsteinpflaster fiel.
Der betrunkene junge Mann taumelte gegen den düsteren schwarzen Pferdewagen und hielt sich daran fest.
Er studierte den Saloon. Ob er dort willkommen war? Oder war er da schon mal hinausgeworfen worden? Er klopfte seine leeren Taschen ab und zuckte bedauernd die Achseln. Sein Blick wanderte über die Ladenfronten. Fünf-Cent-Absteigen, Bordelle, Pfandhäuser. Sinnend betrachtete er seine Stiefel. Dann schaute er zum Zeitungsauslieferungslager an der Straßenecke hinüber, wo Pferdefuhrwerke die Frühausgaben für Chicago heranschafften.
Ob er sich ein paar Pennys beim Abladen der gebündelten Zeitungen verdienen konnte? Er straffte die Schultern und ging im langsamen Walzerschritt zum Depot hinüber.
»When I was young I felt the tide
Of aspiration undefiled.
But manhood’s years have wronged the pride
My parents centered in their child.«
Bei den Zeitungsjungen, die dort Schlange standen, um sich ihre Zeitungen zu besorgen, handelte es sich um straßenkampferprobte Zwölfjährige. Als er sich näherte, machten sie sich gerade über den Betrunkenen lustig, bis einer von ihnen dem jungen Mann in die seltsam weichen blau-violetten Augen blickte. »Lasst ihn in Ruhe!«, sagte er zu seinen Freunden, und der hochgewachsene Mann flüsterte: »Danke, Shonny. Wie heiss’n du?«
»Wally Laughlin.«
»Bis’ ’ne gute Seele, Wally Laughlin. Sieh zu, dasse nich so endes’ wie ich.«
»Ich hatte euch doch befohlen, den Säufer loszuwerden«, sagte Harry Frost, ein Riese von einem Mann, mit kantigem Kinn und grausamen Augen. Er saß im Leichenwagen rittlings auf einer Kiste Vulcan-Dynamit. Zwei ehemalige Preisboxer aus seiner West-Side-Gang kauerten vor ihm. Sie beobachteten das Zeitungsdepot durch Gucklöcher, die in die Seitenwand des Wagens gebohrt worden waren, und warteten darauf, dass der Eigentümer von seinem Abendessen zurückkam.
»Ich hab ihn weggejagt. Aber er ist zurückgekommen.«
»Treibt ihn in diese Gasse. Ich will ihn nicht mehr sehen, es sei denn, er wird auf einem Fensterladen weggetragen.«
»Er ist doch nur betrunken, ein harmloser Säufer, Mr. Frost.«
»Ja, wirklich? Und wenn dieser Zeitungshändler Detektive angeheuert hat, die sein Depot bewachen?«
»Sind Sie verrückt geworden? Das ist kein Detektiv.«
Harry Frosts Faust schoss mit der konzentrierten Wucht eines Schmiedehammers vierzig Zentimeter vorwärts. Der Mann, den die Faust traf, fasste sich schmerzgepeinigt und ungläubig an die Seite. In der einen Sekunde hatte er noch neben seinem Boss gekauert, in der nächsten wälzte er sich schon auf dem Boden und versuchte, einen Atemzug zu machen, während sich gesplitterte Kochen in seine Lunge bohrten. »Sie haben mir die Rippen gebrochen«, keuchte er.
Frosts Gesicht war rot angelaufen. Sein eigener Atem raste vor Wut. »Ich bin nicht verrückt.«
»Sie wissen wohl nicht, wie stark Sie sind, Mr. Frost«, protestierte der andere Boxer. »Sie hätten ihn töten können.«
»Wenn ich ihn hätte töten wollen, hätte ich härter zugeschlagen. Schaff diesen Säufer weg!«
Der Boxer kletterte hinten aus dem Leichenwagen, schloss die Tür hinter sich und drängte sich durch die Gruppe der schläfrigen Zeitungsjungen, die darauf warteten, endlich ihre Zeitungen kaufen zu können.
»Heh, du!«, rief er den Betrunkenen, der ihn nicht hörte, sondern ihm den Gefallen tat, aus eigenem Antrieb in die Gasse einzubiegen, und ihm damit die Mühe ersparte, ihn um sich schlagend, tretend und laut schreiend hinter sich herzuzerren. So rannte er ihm nur nach und holte einen Totschläger aus der Tasche. Es war eine schmale Gasse mit nackten Mauern auf beiden Seiten, kaum breit genug für eine Schubkarre. Der Betrunkene stolperte auf eine Tür an deren Ende zu, die von einer über ihr hängenden Laterne beleuchtet wurde.
»Heh, du!«
Der Betrunkene wandte sich um. Sein goldblondes Haar schimmerte im Licht der Petroleumlampe. Ein zaghaftes Lächeln glitt über sein hübsches Gesicht.
»Kennen wir uns, Sir?«, fragte er, als erwachte plötzlich die Hoffnung in ihm, sich ein wenig Geld leihen zu können.
»Wir werden uns gleich kennenlernen.«
Mit dem Totschläger holte der Boxer zu einem hinterlistigen Schlag aus. Es war eine brutale Waffe, die aus einem Ledersack bestand, der mit Bleischrot gefüllt war. Durch das Bleischrot war er verformbar, so dass er sich an sein Ziel anschmiegen und Fleisch und Knochen zertrümmern und das attraktive und markante Profil des jungen Mannes so platt wie ein Beefsteak klopfen konnte. Zur Überraschung des Boxers bewegte sich der Betrunkene jedoch plötzlich sehr schnell. Mit einem Schritt kam er in die Reichweite des Totschlägers und holte den Boxer so gekonnt wie kraftvoll mit nur einer geraden Rechten von den Füßen.
Die Tür sprang auf.
»Gut gemacht, Kid.«
Zwei Van-Dorn-Privatdetektive – Mack Fulton mit seinen Eisaugen und Walter Kisley in einem karierten dreiteiligen Straßenanzug – packten die Arme und Beine des gefallenen Mannes und zogen ihn herein. »Versteckt sich Harry Frost in diesem Leichenwagen?«
Aber der Boxer konnte nicht antworten.
»Der ist nicht mehr zu gebrauchen«, sagte Fulton, versetzte ihm eine Ohrfeige, erzielte aber keine Reaktion.
»Isaac, junger Freund, du kennst deine eigene Kraft nicht.«
»So viel zur ersten Lektion in Sachen ›Verhören von Tatverdächtigen‹«, sagte Kisley.
»Und wie lautet diese erste Lektion?«, fragte Fulton. Sie hatten in der Van Dorn Detective Agency den Spitznamen »Weber and Fields«, in Anlehnung an die berühmten Varieté-Komiker.
»Gestatte deinem Verdächtigen stets, bei Bewusstsein zu bleiben«, antwortete Kisley.
»Damit er«, deklamierten sie im Chor weiter, »deine Fragen beantworten kann.«
Detektivlehrling Isaac Bell ließ betrübt den Kopf hängen.
»Tut mir leid, Mr. Kisley, Mr. Fulton. Ich wollte gar nicht so hart zuschlagen.«
»Man lernt nie aus, Kleiner. Deshalb hat Mr. Van Dorn einen College-Absolventen wie dich ja auch mit solchen weisen alten Ignoranten, wie wir es sind, zusammengetan.«
»Durch unser grauhaariges Beispiel hofft der Chef, dass sich vielleicht sogar ein reiches Jüngelchen von der richtigen Bahndammseite zu einem brillanten Detektiv entwickeln kann.«
»Was hältst du davon, wenn wir in der Zwischenzeit mal an diesem Leichenwagen anklopfen und nachschauen, ob Harry Frost zu Hause ist?«
Die Partner zückten ihre schweren Revolver, während sie sich durch die Gasse in Richtung Straße auf den Weg machten.
»Bleib zurück, Isaac. Du solltest Harry Frost niemals ohne eine Waffe in der Hand auf die Pelle rücken.«
»Die du, weil du noch Lehrling bist, eigentlich gar nicht bei dir haben darfst.«
»Ich habe mir einen Derringer gekauft«, sagte Bell.
»Sehr einfallsreich. Sieh bloß zu, dass der Boss nicht Wind davon bekommt.«
Sie bogen um die Ecke und gelangten auf die Straße. Ein Messer blitzte im Licht der Straßenlaterne auf und durchtrennte die Zügel, mit denen die Pferde des Leichenwagens angebunden waren. Gleich darauf ließ eine untersetzte Gestalt eine Kutscherpeitsche gegen ihre Rümpfe knallen. Die Tiere stürmten los, vorbei an den Wagen, die sich vor dem Depot aufgereiht hatten. Als der führerlose Wagen das Depot erreichte, explodierte er mit lautem Donner und einer grellen Stichflamme. Die Druckwelle erwischte die Detektive und schleuderte sie durch die Schwingtüren und das Schaufenster des nächsten Saloons.
Isaac Bell raffte sich auf und rannte auf die Straße zurück. Flammen schlugen aus dem Zeitungslager. Die Wagen waren auf die Seite geworfen worden, und ihre Pferde stolperten auf zerschmetterten Beinen umher. Die Straße war voller Glasscherben und brennendem Papier. Bell schaute zu den Zeitungsjungen hinüber. Drei von ihnen kauerten in einem Hauseingang, die Gesichter bleich vor Schreck. Drei andere lagen leblos auf dem Gehsteig. Der erste, neben dem er niederkniete, war Wally Laughlin.
COMEJOSEPHINE, INMYFLYINGMACHINE
von ALFREDBRYAN & FREDFISCHER
Oh! Say! Let us fly, dear
Where, kid? To the sky, dear
Oh you flying machine
Jump in, Miss Josephine
Ship ahoy! Oh joy, what a feeling
Where, boy? In the ceiling
Ho, high, hoopla we fly
To the sky so high
Come Josephine, in my flying machine,
Going up, she goes! Up she goes!
Balance yourself like a bird on a beam
In the air she goes! There she goes!
Up, up, a little bit higher
Oh! My! The moon is on fire
Come Josephine, in my flying machine,
Going up, all on, good-bye!
Buch eins
»Come
Josephine,
in my flying
machine«
1
ADIRONDACK MOUNTAINS, UPPER NEW YORK STATE1909
Mrs. Josephine Josephs Frost – eine zierliche junge Frau mit rosigen Wangen und vorwitzig burschikosem Auftreten, mit zupackenden kräftigen Händen, die an Landarbeit gewöhnt waren, und lebhaften haselnussbraunen Augen – lenkte ihren Celere-Twin-Pusher-Doppeldecker in achthundert Fuß Höhe über die dunkel bewaldeten Hügel der Ländereien ihres Mannes in den Adirondacks. Vorn sitzend, in einem niedrigen Korbsessel im Freien, trug sie zum Schutz gegen den eisigen Gegenwind einen gefütterten Mantel und eine Reithose, einen Lederhelm sowie Wollschal, Handschuhe, Schutzbrille und Stiefel. Der Motor brummte hinter ihr eine stetige Melodie, untermalt von dem Ragtime-Klappern, das die Antriebsketten der rotierenden Propeller verursachten.
Ihre Flugmaschine war ein leichtes Gitterwerk aus Holz und Bambus, das mit Draht zusammengehalten wurde und mit Stoff bespannt war. Die gesamte Konstruktion wog zwar weniger als eintausend Pfund, war jedoch weitaus stabiler, als ihr Aussehen vermuten ließ. Aber nicht so stark wie die heftigen Aufwinde, die die Felswände und tiefen Schluchten in die Atmosphäre schleuderten. Aufwärtsrauschende Luftsäulen würden sie auf den Rücken drehen, wenn sie es zuließ. Luftlöcher würden sie verschlucken.
Eine Windböe schlich sich von hinten an sie heran und schnappte die Luft weg, die ihre Tragflächen bis eben gestützt hatte.
Wie ein Amboss stürzte der Doppeldecker ab.
Josephines ausgelassenes Grinsen reichte von Ohr zu Ohr.
Sie drückte das Höhenruder nach unten. Die Maschine nickte abwärts, wodurch sich ihre Fluggeschwindigkeit erhöhte, und Josephine spürte sofort, wie die Luft unter den Tragflächen sie und ihre Maschine wieder in eine sichere horizontale Lage brachte.
»Gut gemacht, Elsie!«
Flugmaschinen blieben oben, indem sie Luft nach unten drückten. Das hatte sie bereits herausgefunden, als sie das erste Mal den festen Boden verlassen hatte. Luft war stark. Geschwindigkeit machte sie noch stärker. Und je besser die Maschine war, desto größer wurde ihr Wunsch zu fliegen. Diese »Elsie« war schon ihr dritter Flugapparat, aber ganz gewiss nicht der letzte.
Die Leute nannten sie wegen ihrer Neigung zum Fliegen mutig, aber sie selbst sah sich keineswegs so. In der Luft fühlte sie sich lediglich vollkommen zu Hause, mehr zu Hause als unten auf dem festen Boden, wo sich die Dinge nicht immer auf die Art und Weise entwickelten, die sie sich erhoffte. Hier oben wusste sie, was sie tun musste. Und, was noch besser war, sie wusste, was geschähe, wenn sie es nicht tat.
Ihre Augen waren überall. Sie blickte voraus auf die blauen Berge am Horizont, dann wiederholt nach oben auf das Dosenbarometer, das sie an der oberen Tragfläche befestigt hatte, um ihre jeweilige Flughöhe feststellen zu können, und nach unten auf den Öldruckmesser, der sich zwischen ihren Beinen befand. Außerdem hielt sie ständig Ausschau nach Lichtungen in dem dichten Wald unter ihr, die groß genug waren, um dort zu landen, falls ihr Motor plötzlich streiken sollte. Sie hatte sich eine Damenanhängeuhr auf den Ärmel genäht, um mit Hilfe der Flugzeit berechnen zu können, wie viel Treibstoff ihr noch zur Verfügung stand. Die Kartentasche und den Kompass, den sie sich gewöhnlich um den Oberschenkel schnallte, hatte sie zu Hause gelassen. Da sie in diesen Bergen geboren war, orientierte sie sich an Seen, Eisenbahngleisen und am North River.
Vor sich gewahrte sie eine dunkle Schlucht, so tief und mit derart steilen Seitenwänden, dass es aussah, als hätte ein zorniger Riese den Berg mit einer Axt gespalten. Eine Lücke zwischen den Bäumen neben der Schlucht entpuppte sich als goldene Wiese und die erste große Lichtung, die sie seit ihrem Start zu Gesicht bekam.
Sie entdeckte einen winzigen roten Fleck, der wie die Haube eines Spechts aussah.
Es war ein Jagdhut auf dem Kopf von Marco Celere, dem italienischen Erfinder, der ihre Flugmaschinen baute. Marco saß auf einem hohen Felsen und suchte mit Hilfe eines Fernglases nach Bären. Auf der anderen Seite der Wiese, zwischen den Bäumen, die an ihrem Rand standen, entdeckte sie auch die massige Silhouette ihres Ehemannes.
Harry Frost hatte das Gewehr im Anschlag und zielte damit auf Marco.
Josephine hörte den Schuss. Er war lauter als der Motor und das Klappern der Antriebsketten hinter ihr.
Harry Frost hatte das seltsame Gefühl, dass er den Italiener verfehlt hatte.
Er war ein erfahrener Großwildjäger. Seit er mit großem Reichtum in den Ruhestand übergewechselt war, hatte er Elche und Bighornschafe in Montana, Löwen in Südafrika und Elefanten in Rhodesien geschossen, und er hätte schwören können, dass die Kugel hoch über das Ziel hinweggegangen war. Doch da lag der dunkelhäutige Freund seiner Frau am Rand der Felsklippe und krümmte sich, zwar getroffen, aber nicht tot.
Frost hebelte eine frische Patrone in die Kammer seiner Marlin 1895 und fand ihn im Zielfernrohr. Er hasste den Anblick von Marco Celere – das ölige schwarze Haar, mit Pomade an den Schädel geklatscht, die hohe Stirn wie ein Varieté-Julius-Cäsar, die buschigen Augenbrauen, die tief liegenden dunklen Augen, der gewachste Schnurrbart, der sich an den Enden wie das Ringelschwänzchen eines Schweins hochkräuselte –, und er genoss es, den Abzug zu drücken, als plötzlich ein seltsames Rasseln seinen Kopf ausfüllte. Es klang wie die Dreschmaschine im Heim für geisteskranke Straftäter in Matawan, wo ihn seine Feinde eingesperrt hatten, weil er seinen Chauffeur im Country Club erschossen hatte.
Die Klapsmühle war schlimmer gewesen als das monströseste Waisenhaus, an das er sich erinnern konnte. Einflussreiche Politiker und teure Anwälte konnten sich zugutehalten, ihn herausgehauen zu haben. Aber es war völlig richtig gewesen, ihn zu entlassen. Schließlich hatte dieser Chauffeur mit seiner ersten Ehefrau ein Verhältnis gehabt.
Unglaublicherweise war ihm das mit seiner zweiten Frau jetzt ebenfalls passiert. Er konnte es jedes Mal in ihren Gesichtern lesen, wenn Josephine ihn um noch mehr Geld für Marcos Erfindungen bat. Zurzeit bettelte sie ihn an, die jüngste Flugmaschine des Italieners von seinen Gläubigern zurückzukaufen, damit sie das Atlantic-to-Pacific Cross-Country Air Race gewinnen konnte und den mit fünfzigtausend Dollar Preisgeld dotierten Whiteway Cup errang.
Wäre das nicht großartig? Ein Sieg bei dem größten Luftrennen der Welt würde seine flugbegeisterte Frau und ihren Erfinder-Freund berühmt machen. Preston Whiteway – der hochnäsige, mit einem silbernen Löffel im Mund geborene Zeitungsverleger aus San Francisco, der das Rennen sponserte – würde sie zu Stars machen und gleichzeitig fünfzig Millionen Zeitungen verkaufen. Der trottelige Ehemann würde ebenfalls berühmt werden, ein berühmter, gehörnter, fetter, alter, reicher Ehemann – und zur Witzfigur für alle, die ihn hassten.
Reich war er, sogar einer der reichsten Männer in Amerika, der allerdings jeden verdammten Dollar selbst verdient hatte. Aber Harry Frost war noch nicht alt. Knapp über vierzig war wirklich nicht so alt. Und jeder, der behauptete, er bestünde mehr aus Fett als aus Muskeln, hatte nicht gesehen, wie er ein Pferd mit einem einzigen Schlag tötete – ein Trick, den er in seiner Jugend des Öfteren vorgeführt hatte und der mittlerweile zu einem Geburtstagsritual geworden war.
Anders als bei dem Verrat im Zusammenhang mit seinem Chauffeur würden sie ihn diesmal aber nicht schnappen. Kein Aus-der-Haut-Fahren mehr. Diese Sache hatte er bis ins kleinste Detail geplant. Indem er seine Rache zelebrierte und das Ganze wie eine geschäftliche Transaktion behandelte, hatte er sich seiner außerordentlichen Begabung für Organisation und Täuschung bedient, um den völlig ahnungs- und arglosen Celere zur Teilnahme an einer Bärenjagd zu überreden. Bären konnten schließlich nicht reden. Tief in den Wäldern des North Country würde es keine Zeugen geben.
Überzeugt, dass sein Schuss höher gelegen hatte als beabsichtigt, zielte Frost diesmal ein wenig niedriger und schoss abermals.
Josephine sah, wie Celere durch die Wucht einer Gewehrkugel von der Felskante gepeitscht wurde.
»Marco!«
Das Rasseln in Harry Frosts Schädel wurde laut. Während er am Lauf seines Gewehrs entlang auf die wunderbar freie Stelle blickte, wo soeben noch Marco Celere gewesen war, erkannte er plötzlich, dass der Lärm keine Erinnerung an das Sanatorium in Matawan war, sondern genauso real wie die 405-grain-Bleikugel, die den Dieb der Ehefrau soeben in den Abgrund gestürzt hatte. Er schaute hoch. Josephine kreiste in ihrem verdammten Doppeldecker über ihm. Also hatte sie gesehen, wie er den Flugzeugerfinder erschossen hatte.
Frost hatte noch drei Patronen im Magazin.
Er hob das Gewehr.
Aber er wollte nicht auch noch sie töten. Jetzt, da Marco nicht mehr im Weg war, würde sie bei ihm bleiben. Aber sie hatte gesehen, wie er Marco eben gerade getötet hatte. Sie würden ihn wieder in ein Irrenhaus einsperren. Und ein zweites Mal würde er wohl nicht mehr herauskommen. Das wäre nicht fair. Er war kein Betrüger. Betrogen hatte allein sie.
Frost riss das Gewehr hoch und schoss zwei Mal.
Er hatte ihre Geschwindigkeit falsch eingeschätzt. Mindestens ein Schuss ging an ihr vorbei. Mit nur noch einer einzigen Kugel sammelte er seine fünf Sinne, beruhigte seine Nerven und verfolgte den Doppeldecker wie einen Fasan auf der Jagd.
Volltreffer!
Er hatte sie erwischt, ganz sicher. Ihre Flugmaschine legte sich schwankend in eine weite, schwerfällige Kurve. Er wartete nur noch darauf, dass sie abstürzte. Aber sie vollendete die Kurve und ging wackelnd auf Kurs zurück zum Lager. Sie war jetzt zu hoch, um mit einer Pistole beschossen zu werden, aber Frost zog trotzdem eine aus dem Gürtel. Er legte den Lauf auf seinen massigen Unterarm und feuerte, bis das Magazin leer war. Mit Augen, die vor Wut hervorquollen, angelte er einen stupsnasigen Derringer aus dem Ärmel. Er schickte auch diese beiden Kugeln vergebens in ihre Richtung und tastete nach seinem Jagdmesser, um ihr das Herz herauszuschneiden, wenn sie zwischen die Bäume krachte.
Das Rasseln und Klappern wurde leiser und leiser, und Harry Frost konnte nichts anderes tun, als hilflos zuzuschauen, wie seine betrügerische Frau hinter den Bäumen verschwand und sich seinem berechtigten Zorn entzog.
Wenigstens hatte er ihren Liebhaber ins Verderben gestürzt.
Er stapfte über die Wiese und hoffte, Celeres Körper zerschmettert auf den Flussfelsen zu sehen. Doch auf halbem Weg zur Felskante blieb er stocksteif stehen, von einer entsetzlichen Erkenntnis blitzartig getroffen. Er musste fliehen, ehe sie ihn wieder ins Irrenhaus brachten.
Josephine musste ihr gesamtes Können aufbieten, um die Maschine sicher zur Erde zu lenken.
Harry hatte sie zwei Mal getroffen. Eine Kugel hatte den Treibstofftank hinter ihr lediglich eingedellt. Der zweite Treffer war allerdings schlimmer. Die Kugel hatte die Verbindung zwischen dem Steuerknüppel und dem Kabel blockiert, mit dem sich die Form der Tragflächen verändern ließ. Da Josephine ihre Stellung nicht verändern konnte, um mit der Maschine eine Kehre auszuführen, konnte sie ausschließlich das Seitenruder zur Steuerung benutzen. Aber zu wenden, ohne die Maschine auf die Seite zu legen, war genauso, als säße sie in einem Gleiter, bevor die Gebrüder Wright die Flügelverwindung erfunden hatten – verdammt schwerfällig und durchaus geeignet, sie seitlich abrutschen und in ein tödliches Trudeln geraten zu lassen.
Mit zusammengepressten Lippen bediente sie das Seitenruder wie das Skalpell eines Chirurgen und bediente sich scheibchenweise von dem Fahrtwind. Ihre Mutter, eine hektische und nervöse Frau, die nicht fähig war, auch nur die einfachste Aufgabe in Ruhe zu lösen, hatte sie immer beschuldigt, »Eiswasser in den Adern« zu haben. Aber war in einer angeschlagenen Flugmaschine Eiswasser nicht genau das Richtige, Mutter? Allmählich brachte sie den Doppeldecker zurück auf Kurs.
Als eine Windböe ihren Rücken traf, roch sie Benzin. Sie suchte nach der Quelle und sah es tropfenweise aus dem Treibstofftank sickern. Harrys Kugel hatte seine Blechhülle also doch durchschlagen.
Was würde zuerst passieren, fragte sie sich kühl. Würde das Benzin vollständig auslaufen und der Motor stehen bleiben, ehe sie auf Harrys Rasen landen konnte? Oder würden Funken aus dem Motor und von den Ketten das Benzin in Brand setzen? Feuer war in einer Flugmaschine tödlich. Der Firnis aus salpeterhaltiger Stoffimprägnierung, der die Baumwollplane, die die Tragflächen bedeckte, steif und wasserfest machte, war genauso leicht brennbar wie Blitzpulver.
Das einzige näher gelegene Feld war eine Wiese. Aber wenn sie dort landete, würde Harry sie töten. Sie hatte keine Wahl. Sie musste die Maschine am Lager herunterbringen, sofern sie genug Treibstoff hatte, um es zu erreichen.
»Na los, Elsie. Bring uns nach Hause.«
Langsam wanderte der Wald unter ihr dahin. Aufwinde rüttelten an den Tragflächen und brachten den Flugapparat zum Schlingern. Da sie die Tragflächen nicht verwinden konnte, versuchte sie die Maschine mit Hilfe der Höhen- und Seitenruder auf geradem Kurs zu halten.
Schließlich kam Harrys Lager in Sicht.
Gerade hatte sie sich ihm weit genug genähert, um das Haupthaus und die Milchviehställe sehen zu können, als der Motor der Flugmaschine die letzten Benzindämpfe aushustete. Die Propeller blieben stehen. Der Doppeldecker verstummte, und nur noch der Wind strich flüsternd durch die Spannschnüre und Tragkabel.
Sie musste die Wiese im Gleitflug erreichen. Aber die Propeller, die sie geschoben hatten, waren jetzt eine hinderliche Last, da sie ihr Tempo drosselten. In wenigen Sekunden würde sich ihr Gleitflug derart verlangsamt haben, dass nichts sie mehr in der Luft halten konnte.
Sie griff hinter sich und zog an dem Kabel, das das Kompressionsventil des Motors öffnete, so dass sich die Zylinder frei bewegen konnten und zuließen, dass die Propeller sich im Wind drehten. Der Unterschied war frappierend. Sofort fühlte sich das Flugzeug viel leichter an – eher wie ein Gleiter.
Jetzt konnte sie auch die Weide sehen. Dicht mit Kühen bevölkert und kreuz und quer von Zäunen durchzogen, bot sie keinen Platz für eine sichere Landung. Da stand das Haus, eine kunstvoll verzierte Villa, aus Holz gebaut, und dahinter die leicht abfallende abgemähte Wiese, von der sie anfangs gestartet war. Aber zuerst musste sie heil über das Haus hinwegkommen, dabei sank sie sehr schnell. Sie suchte sich einen Weg zwischen den hohen Kaminen hindurch, hüpfte knapp über das Dach, betätigte das Seitenruder, um in den Wind zu drehen, wobei sie darauf achtete, eine Kreiselbewegung zu vermeiden.
Etwa drei Meter über der Grasnarbe erkannte sie, dass sie zu schnell unterwegs war. Das Luftpolster zwischen den Tragflächen und dem Erdboden hielt den Flugapparat in der Schwebe. Der Doppeldecker weigerte sich, den Flug abzubrechen. Und vor ihr ragte eine Wand aus Bäumen in die Höhe.
Das Benzin, das in das imprägnierte Tragflächentuch eingedrungen war, entzündete sich zu einem orangefarbenen Flammenteppich.
Einen Feuerschweif hinter sich herziehend und nicht mehr in der Lage, den Anstellwinkel der Tragflächen zu verändern, so dass die Maschine ausreichend abgebremst wurde, um auf der Grasnarbe aufzusetzen, griff Josephine hinter sich und zog abermals an der Kompressionsleine. Indem sie das Ventil wieder schloss, blockierte sie die fast drei Meter großen Propeller. Sie krallten sich geradezu in die Luft, und nun prallten die Räder und Gleitkufen der Flugmaschine hart auf die Grasnarbe.
Der brennende Doppeldecker rutschte etwa fünfzig Meter weit. Während er langsamer wurde, breitete sich das Feuer aus, und weitere Flammen züngelten hoch. Als Josephine die zunehmende Hitze an der Rückseite ihres Helms spürte, riskierte sie den Sprung. Sie landete auf dem Erdboden, streckte sich aus und machte sich so klein wie möglich, um die Maschine über sich hinwegrollen zu lassen. Dann sprang sie auf und rannte um ihr Leben, während die Flammen den Apparat einhüllten.
Harrys Butler kam angerannt. Ihm folgten der Gärtner, der Koch und Harrys Leibwächter.
»Mrs. Frost! Ist mit Ihnen alles in Ordnung?«
Josephines Blick klebte an der Säule aus Flammen und Rauch. Marcos wunderschöne Maschine brannte wie ein Scheiterhaufen. Armer Marco. Die innere Festigkeit, die ihr geholfen hatte, die Situation zu meistern, begann zu bröckeln, und sie spürte, wie ihre Lippen bebten. Das Feuer sah aus, als brenne es unter Wasser. Erst in diesem Augenblick begriff sie, dass sie am ganzen Leib zitterte und zu weinen begonnen hatte – und dass sich ihre Augen mit Tränen füllten. Sie konnte noch nicht einmal mit letzter Sicherheit entscheiden, ob sie wegen Marco oder wegen ihres eigenen Schicksals weinte.
»Mrs. Frost«, wiederholte der Butler. »Sind Sie unversehrt?«
Noch nie war sie dem Tod in einem Flugzeug derart nahe gewesen.
Sie wollte ein Taschentuch aus dem Ärmel ziehen, schaffte es jedoch nicht. Zuerst musste sie den Handschuh ausziehen. Dabei sah sie, dass ihre Haut schneeweiß war, als hätte sich sämtliches Blut daraus zurückgezogen. Alles hatte sich grundlegend verändert. Jetzt wusste sie, wie es war, wenn man Angst hatte.
»Mrs. Frost?«
Alle starrten sie an. Als sei sie soeben dem Tod entronnen oder als stünde sie wie ein Geist vor ihnen.
»Ich bin okay.«
»Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Mrs. Frost?«
Ihre Gedanken rasten. Sie musste irgendetwas tun. Sie presste das Taschentuch gegen ihr Gesicht. Tausend Männer und Frauen hatten gelernt zu fliegen, seit Wilbur Wright den Michelin Cup in Frankreich gewonnen hatte, und bis eben, bis zu diesem Moment hatte Josephine Frost nie daran gezweifelt, dass sie ein Flugzeug ebenso schnell und weit lenken konnte wie alle anderen. Von nun an müsste sie aber jedes Mal, wenn sie wieder in eine Flugmaschine stieg, mutig und tapfer sein. Na ja, es war allemal besser, als auf dem Erdboden herumzukrebsen.
Sie wischte sich die Wangen ab und putzte sich die Nase.
»Ja«, sagte sie. »Fahren Sie bitte in die Stadt und informieren Sie Constable Hodge, dass Mr. Frost soeben Mr. Celere erschossen hat.«
Dem Butler verschlug es den Atem. »Wie bitte?«
Sie musterte ihn streng. Wie konnte es ihn überraschen, dass ihr gewalttätiger Mann jemanden getötet hatte? Und das schon ein zweites Mal.
»Sind Sie sich dessen ganz sicher, Mrs. Frost?«
»Ob ich mir dessen ganz sicher bin?«, wiederholte sie die Frage. »Ja, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen.«
Der zweifelnde Gesichtsausdruck des Butlers erinnerte sie auf erschreckende Weise daran, dass es Harry war, der sein Gehalt zahlte, dass es Harry war, der für alles aufkam, und dass Mrs. Frost nun eine Frau war, die sich auf niemand anders verlassen konnte als auf sich selbst.
Die Leibwächter wirkten ganz und gar nicht überrascht. Ihre langen Gesichter sagten, dass sie ihrem mehr oder weniger gemütlichen Job wohl würden adieu sagen müssen. Auch der Butler schien sich allmählich damit abzufinden und fragte so gleichmütig, als hätte sie soeben ein Glas Eistee bestellt: »Haben Sie noch weitere Wünsche, Mrs. Frost?«
»Bitte tun Sie, um was ich Sie gebeten habe«, sagte sie mit leicht zitternder Stimme, während sie ins Feuer starrte. »Setzen Sie den Konstabler davon in Kenntnis, dass mein Mann Mr. Celere getötet hat.«
»Jawohl, Madam«, erwiderte er in neutralem Tonfall.
Josephine wandte sich vom Feuer ab. Ihre braunen Augen pflegten je nach Anlass zu Grün oder Grau zu wechseln. Sie brauchte nicht erst in einen Spiegel zu schauen, um zu wissen, dass sich in diesem Moment eine farblose Angst in ihnen spiegelte. Sie war allein und verletzlich. Da Marco Celere tot und ihr Ehemann ein wahnsinniger Mörder war, hatte sie niemanden in ihrer Nähe, an den sie sich wenden konnte. Dann fiel ihr Preston Whiteway ein.
Ja, er würde sie beschützen.
»Eine Sache noch«, sagte sie zu dem Butler, während er bereits Anstalten machte, sich zu entfernen. »Schicken Sie Mr. Preston Whiteway beim San Francisco Inquirer ein Telegramm. Teilen Sie ihm mit, dass ich ihn in der nächsten Woche besuchen werde.«
2
»Hoopla!«
Isaac Bell, Chef-Ermittler der Van Dorn Detective Agency, donnerte in einem feuerwehrroten benzingetriebenen Locomobile-Rennwagen mit – zwecks Leistungssteigerung – weit geöffnetem Auspuff-Bypass durch die Market Street von San Francisco. Bell war ein hochgewachsener Mann von dreißig Jahren mit einem buschigen Schnurrbart, der genauso golden glänzte wie sein sorgfältig frisiertes blondes Haar. Er trug einen fleckenlosen weißen Anzug und einen weißen Hut mit flacher Krone und breiter Krempe. Abgerundet wurde seine vollendete äußere Erscheinung durch seine drahtige Statur.
Während er den Wagen lenkte, bedienten seine sorgfältig gepflegten und auf Hochglanz polierten Stiefel kaum einmal die Bremse, ein berüchtigt unwirksames Locomobile-Accessoire. Seine langen, schlanken Hände und Finger sprangen flink zwischen Gasdrossel und Gangschalthebel hin und her. Die Augen, gewöhnlich von einem unwiderstehlichen violetten Blau, waren vor Konzentration dunkel geworden. Sein entschlossener Gesichtsausdruck und das energisch vorgereckte Kinn wurden durch ein Lächeln reinsten Vergnügens gemildert, während er mit dem Wagen in halsbrecherischem Tempo Autobusse, Lastwagen, Pferdefuhrwerke, Motorräder und langsamere Automobile überholte.
Links neben Bell saß auf dem rotledernen Beifahrersitz sein Chef, Joseph Van Dorn.
Der stattliche und dank seines roten Backenbarts unverwechselbare Gründer der überregionalen Privatdetektei war ein tapferer, mutiger Mann, der von allen Kriminellen auf dem gesamten Kontinent als lästige Landplage gefürchtet war. Er wurde jedoch blass, als Bell mit dem großen Fahrzeug auf die Lücke zwischen einem Kohlefuhrwerk und einem Buick-Motorlastwagen, beladen mit Kerosin- und Naphthafässern, zuhielt, die sich schnell schloss.
»Wir liegen gut in der Zeit«, bemerkte Van Dorn. »Wir sind sogar ein wenig zu früh.«
Anscheinend hörte ihn Isaac Bell gar nicht.
Erleichtert entdeckte Van Dorn ihr Ziel, das sich über seine kleineren Nachbarn erhob: Preston Whiteways zwölfstöckiges Zeitungsgebäude, das den San Francisco Inquirer beherbergte und die Zentrale des Zeitungsimperiums des extravaganten Herausgebers darstellte.
»Sehen Sie sich das mal an!«, erhob Van Dorn die Stimme über den Motorenlärm.
Ein riesiges gelbes Werbebanner zierte die oberste Etage und verkündete in meterhohen Lettern der Welt die Schirmherrschaft von Whiteways Zeitungen über das
WHITEWAYATLANTIC-TO-PACIFICCROSS-COUNTRYAIRRACE
Der Whiteway Cup und 50000 $
winken dem ersten
Flugzeugführer,
der Amerika in fünfzig Tagen überquert.
»Eine großartige Herausforderung«, rief Bell zurück, ohne den Blick von der verkehrsreichen Straße zu lösen.
Isaac Bell war von Flugmaschinen fasziniert. Er hatte deren schnelle Entwicklung aufmerksam verfolgt, und zwar mit der Absicht, selbst einen solchen Hochleistungsapparat zu erwerben. Unzählige verbesserte flugfähige Erfindungen hatten in den vorangegangenen zwei Jahren das Licht der Welt erblickt: der Wright Flyer III, die June Bug, die Silver Dart mit ihrem Bambusrahmen, die riesigen französischen Voisins und Antoinettes, von achtzylindrigen Rennbootmotoren angetrieben, Santos Dumonts zierliche Demoiselle, die Blériot XI, mit der ihr Konstrukteur den Ärmelkanal überquert hatte, dann die robuste Curtiss Pusher, die Wright-Signal-Corps-Maschine, die Farman III und der Celere-Eindecker mit seiner Spanndrahtkonstruktion.
Falls tatsächlich jemand eine Flugmaschine quer über die Vereinigten Staaten von Amerika lenken konnte – das war ein sehr großes Falls –, würde der Whiteway Cup zu gleichen Teilen vom Mut und der Geschicklichkeit der Flieger und der Genialität der Erfinder gewonnen werden, mit der sie die Leistungsfähigkeit ihrer Maschinen steigerten und die Systeme zur Verwindung der Tragflächen verbesserten, damit die Luftfahrzeuge wendiger manövrieren und schneller steigen konnten. Der Sieger müsste pro Tag achtzig Meilen zurücklegen und befände sich dabei zwei Stunden lang in der Luft, und das an jedem Tag. Jeder Tag, der durch Wind, Gewitter, Nebel und Unfälle verloren ging, würde die Anzahl der täglich zu leistenden Flugstunden dramatisch erhöhen.
»In Whiteways Zeitungen wird behauptet, dass der Pokal aus solidem Gold bestehe«, meinte Van Dorn lachend. »Vielleicht«, scherzte er, »ist das auch der Grund, weshalb er uns sehen will – weil er befürchtet, dass irgendein Gauner ihn stehlen könnte.«
»Im vergangenen Jahr haben seine Zeitungen behauptet, dass Japan die Große Weiße Flotte versenken wolle«, meinte Bell trocken. »Irgendwie hat sie es geschafft, unbehelligt und sicher nach Hampton Roads zurückzukehren. Ah, da ist Whiteway ja schon!«
Der blonde Verleger steuerte mit einem gelben Rolls-Royce-Sportwagen auf den einzigen noch freien Parkplatz vor seinem Verlagsgebäude zu.
»Sieht so aus, als würde Whiteway es schaffen«, sagte Van Dorn.
Bell trat entschlossen aufs Gaspedal. Der große rote Locomobile setzte sich zügig vor den gelben Rolls-Royce. Bell trat auf die schwindsüchtige Bremse, schaltete herunter und schwenkte mit qualmenden Reifen auf den Parkplatz.
»Hey!« Drohend schüttelte Whiteway die Faust. »Das ist mein Platz!« Als ehemaliger Collegefootballstar, der allmählich etwas aus dem Leim ging, war er immer noch eine imposante Erscheinung. Den Kopf hochmütig gereckt, ließ er keinen Zweifel daran, dass er nach wie vor attraktiv wirkte, ein Anrecht auf alles hatte, das er sich wünschte, und auch stark genug war, um es sich zu nehmen.
Isaac Bell schwang sich aus seinem Automobil und streckte dem Verlierer des Parkplatzduells mit freundlichem Lächeln eine kräftige Hand entgegen.
»Oh, Sie sind es, Bell. Das ist mein Parkplatz!«
»Hallo, Preston, lange nicht gesehen. Als ich Marion erzählte, wir würden Sie besuchen, bat sie mich, Sie von ihr zu grüßen.«
Whiteways mürrische Miene hellte sich bei der Erwähnung von Isaac Bells Verlobter, Marion Morgan, einer bildschönen Frau, die im Filmgeschäft tätig war, schlagartig auf. Marion hatte früher für Whiteway gearbeitet und sein Picture-World-Projekt aufgebaut und geleitet, das dem breiten Publikum mit großem Erfolg Filmsequenzen von wichtigen Ereignissen in Varietétheatern und Musikautomaten zugänglich machte.
»Bestellen Sie Marion, ich verlasse mich darauf, dass sie von meinem Luftrennen tolle Filme drehen wird.«
»Sicher kann sie es kaum erwarten. Dies ist übrigens Joseph Van Dorn.«
Der Pressezar und der Gründer der führenden Privatdetektei der Nation taxierten einander, während sie sich die Hand schüttelten. Van Dorn deutete zum Himmel. »Wir haben gerade Ihr Werbebanner bewundert. Das sollte ein Riesenereignis werden.«
»Deshalb habe ich Sie zu mir gebeten. Kommen Sie doch mit hinauf in mein Büro.«
Ein Kommando uniformierter Türsteher salutierte, als sei ein Admiral auf einem Schlachtschiff eingelaufen. Whiteway schnippte mit den Fingern. Zwei Männer rannten sofort los, um den gelben Rolls-Royce zu parken.
Im Foyer erwarteten Whiteway weitere salutierende Angestellte.
Ein vergoldeter Fahrstuhlkäfig trug sie in die oberste Etage hinauf, wo sich im Foyer eine Schar Redakteure und Sekretärinnen bereithielt, bewaffnet mit Bleistiften und Notizblöcken. Whiteway bellte Befehle und schickte einige los, um dringende Aufträge auszuführen. Andere rannten hinter ihm her und schrieben eifrig mit, während der Verleger die letzten Absätze des Leitartikels für die Nachmittagsausgabe diktierte, mit dessen Formulierung er bereits vor dem Mittagessen begonnen hatte.
»Der Inquirer prangert den erbärmlichen Entwicklungsstand der amerikanischen Luftfahrt an. Europäer haben sich einen festen Platz am Himmel erobert, während wir weiterhin auf der Erde herumkriechen und allenfalls den Staub der Innovation zusammenkehren dürfen. Aber der Inquirer prangert nicht nur an, der Inquirer handelt auch! Wir laden jeden amerikanischen Flieger und jede amerikanische Fliegerin mit entsprechendem Mumm in den Knochen ein, unsere Fahne am Himmel zu hissen und den amerikanischen Kontinent im Rahmen des Great Whiteway Atlantic-to-Pacific Cross-Country Air Race innerhalb von fünfzig Tagen zu überqueren. Sofort drucken.
Und nun …« Er zog einen Zeitungsausschnitt aus seinem Jackett und las laut vor. »›Der mutige Pilot dippte seine Tragflächen, um die Zuschauer zu grüßen, ehe das Horizontalruder und die rotierende Luftschraube die Schwerer-als-Luft-Flugmaschine des Aeronauten in den Himmel steigen ließen.‹ Wer hat das geschrieben?«
»Das war ich, Sir.«
»Sie sind gefeuert.«
Vierschrötige Angehörige der Vertriebsabteilung geleiteten den Unglücklichen zur Treppe. Whiteway zerknüllte den Zeitungsausschnitt in der Faust und funkelte seine Angestellten wütend an.
»Der Inquirer wendet sich an den Durchschnittsbürger, nicht an einen Techniker. Schreiben Sie sich Folgendes auf oder hinter die Ohren: Auf den Seiten des Inquirer werden ›Flugmaschinen‹ und ›Aeroplane‹ von ›Piloten‹, ›Vogelmännern‹, ›Aviatoren‹ und ›Aviatricen‹ ›gefahren‹ oder ›gelenkt‹ oder ›geflogen‹. Nicht von ›Lotsen‹, die die Lusitania an einen Kai bugsieren, und auch nicht von ›Aeronauten‹, was ja so klingt, als seien sie Griechen. Sie und ich, wir mögen wissen, dass ›Tragflächen‹ Komponenten von Flügeln und ›Horizontalruder‹ Höhenruder sind. Der Durchschnittsbürger möchte aber, dass seine Flügel auch Flügel sind, dass sich seine Ruder drehen und seine Höhenruder für den Aufstieg sorgen. Seine Luftschrauben sind ›Propeller‹. Er weiß sehr wohl, dass Flugmaschinen, die nicht schwerer sind als Luft, Ballons genannt werden. Und schon in Kürze wünscht er sich, dass im Osten und in Europa herumschwirrende ›Aeroplane‹ ganz einfach nur ›Flugzeuge‹ heißen. Sorgen Sie also dafür, dass er auch bekommt, was er haben will. An die Arbeit!«
Während des Vortrags sah sich Isaac Bell um und kam zu der Einschätzung, dass sich Joseph Van Dorns erhabener »Thronsaal« in Washington, D.C., neben Whiteways Privatbüro eher bescheiden ausnahm.
Der Verleger nahm hinter seinem Schreibtisch Platz und verkündete: »Gentlemen, Sie sollen als Erste erfahren, dass ich mich entschlossen habe, die Teilnahme eines eigenen Kandidaten am Great Whiteway Atlantic-to-Pacific Cross-Country Air Race um den Whiteway Cup und das Preisgeld von 50000 Dollar zu unterstützen.«
Er machte eine dramatische Pause.
»Ihr Name – ja, Sie haben richtig gehört, Gentlemen – ihr Name ist Josephine Josephs.«
Isaac Bell und Joseph Van Dorn wechselten einen Blick, den Whiteway fälschlicherweise als erstaunt und nicht als die Bestätigung einer getroffenen Entscheidung interpretierte.
»Ich weiß, was Sie jetzt denken, Gentlemen. Ich bin entweder ein mutiger Kerl, der eine Frau unterstützt, oder ein Narr. Keins von beidem, sage ich. Es gibt keinen Grund, weshalb eine Frau kein Überlandluftrennen gewinnen könnte. Es braucht eher Mut als Muskelkraft, um eine Flugmaschine zu lenken, und der Mut dieser jungen Frau reicht für ein ganzes Regiment.«
Isaac Bell fragte: »Sprechen Sie von Josephine Josephs Frost?«
»Wir werden den Namen ihres Ehemanns nicht nennen«, erwiderte Whiteway knapp. »Der Grund dafür dürfte ein enormer Schock für Sie sein.«
»Josephine Josephs Frost?«, fragte Van Dorn. »Die junge Frau, deren Mann im letzten Herbst in New York State ihre Flugmaschine beschossen hat?«
»Wo haben Sie das gehört?« Whiteway war sichtlich verärgert. »Ich habe es aus den Zeitungen herausgehalten.«
»In unserem Gewerbe«, erwiderte Van Dorn ruhig, »neigen wir dazu, Dinge zu hören, lange bevor sie an Ihre Ohren gelangen.«
Bell fragte: »Und weshalb haben Sie es aus den Zeitungen herausgehalten?«
»Weil meine Presseleute für Josephine trommeln, um das Interesse an dem Rennen zu steigern. Sie werben mit einem neuen Lied für sie, das ich in Auftrag gegeben habe, mit dem Titel ›Come Josephine, in My Flying Machine‹. Sie pappen ihr Bild auf Notenblätter, Edison-Walzen, Klavierrollen, Magazine und Plakate, damit die Leute dem Ausgang des Rennens gespannt entgegenfiebern.«
»Ich hätte angenommen, dass sie sich auf jeden Fall für das Rennen interessieren werden.«
»Wenn Sie dem Publikum nicht ständig etwas Neues anbieten, langweilt es sich sehr schnell«, erwiderte Whiteway verächtlich. »Um das Interesse der Leute an dem Rennen wachzuhalten, wäre es das Beste, die Hälfte der männlichen Konkurrenten würde noch vor der Ankunft in Chicago abstürzen.«
Bell und Van Dorn wechselten einen weiteren Blick, und Van Dorn meinte daraufhin missbilligend: »Wir nehmen an, dass dies eine vertrauliche Mitteilung war.«
»Eine natürliche Reduzierung des Teilnehmerfeldes steigert das Rennen zu einem Duell, in dem sich nur noch die besten Flieger mit der jungenhaften, unbekümmerten Josephine messen«, erklärte Whiteway, ohne sich für seine Bemerkung zu entschuldigen. »Zeitungsleser begeistern sich erfahrungsgemäß für Außenseiter oder scheinbar Unterlegene. Kommen Sie mit! Ich zeige Ihnen, was ich meine.«
Mit einer ständig wachsenden Entourage von Redakteuren, Sekretärinnen, Rechtsanwälten und Managern als Nachhut geleitete Preston Whiteway die Detektive zwei Stockwerke tiefer in die Grafikabteilung, einen hallenartigen Raum, durch große Fenster nach Norden erhellt und mit Künstlern vollgestopft, die sich über Zeichentische beugten und die Tagesereignisse illustrierten.
Bell zählte zwanzig Männer, die sich nach dem Verleger hereindrängten, einige mit Bleistiften und Füllfederhaltern in den Händen, jedoch alle mit nackter Panik in den Augen. Die Künstler duckten sich tiefer und zeichneten schneller. Whiteway schnippte mit den Fingern. Zwei Männer eilten mit Titelblattentwürfen für Notenhefte herbei.
»Was haben Sie für mich?«
Sie hielten eine Zeichnung von einer jungen Frau hoch, die in einer Flugmaschine über einer Kuhweide kreiste. »›Das fliegende Bauernmädchen‹.«
»Nein!«
Sichtlich beschämt hielten sie eine zweite Zeichnung hoch. Auf dieser war eine junge Frau in einem Overall zu sehen. Das Haar verschwand unter einer Kopfbedeckung, die Bell lebhaft an die Mütze eines Taxifahrers erinnerte. »›Der fliegende Wildfang‹.«
»Nein! Gott im Himmel! Was tun Sie hier unten bloß für Ihr Gehalt?«
»Aber, Mr. Whiteway, Sie sagten doch, dass unsere Leser Mädchen vom Land und tollkühnes junges Volk lieben.«
»Ich sagte, ›Sie ist ein Mädchen!‹ Zeitungsleser lieben Mädchen. Sie muss aber hübscher aussehen! Josephine ist eine Schönheit!«
Isaac Bell taten die Zeichner leid, die Gesichter machten, als wollten sie am liebsten aus dem Fenster springen, und er ergriff selbst das Wort. »Warum zeichnen Sie sie nicht so, dass sie aussieht, wie man sich seine Herzdame, eine Geliebte oder eine Freundin vorstellt?«
»Ich hab’s!«, brüllte Whiteway, breitete die Arme aus und blickte mit großen Augen zur Decke, als könnte er durch sie hindurchschauen und die Sonne sehen.
»›Amerikas Sweetheart der Lüfte‹.«
Die Augen der Künstler wurden groß. Sie blickten gespannt zu den Schreibern, Redakteuren und Managern hinüber, die ihrerseits Whiteway aufmerksam beobachteten.
»Wie finden Sie das?«, wollte Whiteway wissen.
Isaac Bell meinte leise zu Van Dorn: »Ich habe Männer gesehen, die in wilde Schießereien verwickelt waren und sich um einiges wohler gefühlt haben.«
Van Dorn sagte: »Sie können ruhig davon ausgehen, dass die Agentur Whiteway für ihre Idee zur Kasse bitten wird.«
Ein mutiger älterer Mann – und leitender Redakteur, der kurz vor der Pensionierung stand – wagte schließlich einen Kommentar. »Sehr gut, Sir«, sagte er. »Wirklich sehr gut.«
Whiteway strahlte.
»›Amerikas Sweetheart der Lüfte‹!«, krähte der Redakteur vom Dienst, und alle anderen stimmten in den Lobgesang mit ein.
»Zeichnen Sie das! Setzen Sie sie in eine Flugmaschine. Machen Sie sie hübsch – nein, machen Sie sie schön.«
Ein unsichtbares Lächeln ging zwischen den Detektiven hin und her. Für Isaac Bell und Joseph Van Dorn klang es so, als wäre Preston Whiteway von seinem eigenen Vorschlag begeistert.
Wieder in Whiteways Büro, wurde der Zeitungsverleger ernst. »Ich denke, Sie können sich gewiss vorstellen, was ich mir von Ihnen wünsche.«
»Das können wir«, antwortete Van Dorn. »Aber vielleicht ist es besser, es aus Ihrem Mund zu hören.«
»Ehe wir anfangen«, unterbrach Bell und wandte sich an den einzigen Angehörigen der Entourage, der ihnen in Whiteways Büro gefolgt war und sich auf einem Stuhl in einer entfernten Ecke niedergelassen hatte, »darf ich fragen, wer Sie sind, Sir?«
Der Mann trug einen braunen Anzug mit Weste, einen Stehkragen aus Zelluloid und eine Fliege. Sein Haar klebte dank reichlicher Pomade wie ein glänzender Helm auf seinem Schädel. Er reagierte auf Bells Frage mit einem erschrockenen Blinzeln. Whiteway antwortete für ihn.
»Das ist Weiner aus der Buchhaltung. Ich habe ihn von der American Aeronautical Society, die offiziell die Schirmherrschaft über das Rennen ausübt. Und habe ihn zum leitenden Kampfrichter ernennen lassen. Sie werden sehr oft mit ihm zusammentreffen. Weiner führt über die Flugzeit aller Konkurrenten Buch und regelt alle strittigen Fragen. Er hat die alleinige Entscheidungsgewalt. Sein Wort ist Gesetz. Nicht einmal ich kann ihn überstimmen.«
»Und er genießt Ihr Vertrauen und darf an dieser Besprechung teilnehmen?«
»Ich zahle sein Gehalt, und mir gehört das Anwesen, das er als Zuhause für sich und seine Familie gemietet hat.«
»Dann werden wir ganz offen reden«, sagte Van Dorn. »Willkommen, Mr. Weiner. Wir werden gleich erfahren, weshalb genau Mr. Whiteway meine Detektei engagieren will.«
»Als Schutz«, nahm Whiteway den Faden sogleich auf. »Ich möchte, dass Josephine vor ihrem Ehemann beschützt wird. Ehe Harry Frost auf sie geschossen hat, ermordete er Marco Celere, den Erfinder und Erbauer ihrer Flugzeuge, und zwar in einem Anfall von Eifersucht. Der gewalttätige Irre ist noch auf der Flucht, und ich befürchte, dass er sich heimlich an sie heranmacht. Sie ist nämlich die einzige Zeugin seiner Tat.«
»Es gibt Mordgerüchte«, sagte Isaac Bell. »Aber tatsächlich hat niemand den toten Marco Celere gesehen, und der Bezirksstaatsanwalt hat keine Klage erhoben, weil es keine Leiche gibt.«
»Suchen Sie sie!«, schoss Whiteway zurück. »Das Verfahren ist noch anhängig. Josephine hat gesehen, wie Frost Celere erschossen hat. Was denken Sie denn, weshalb Frost geflüchtet ist? Van Dorn, ich will, dass Ihre Agentur das Verschwinden von Marco Celere aufklärt und die Grundlagen für einen Mordprozess schafft, der diesen Provinzstaatsanwalt zwingt, Harry Frost für immer einzusperren. Oder ihn zu hängen. Tun Sie, was nötig ist, und denken Sie nicht über die Kosten nach! Hauptsache ist, dass die junge Frau vor diesem tollwütigen Irren geschützt wird.«
»Es wäre schön, wenn Harry Frost nicht mehr als ein tollwütiger Irrer wäre«, sagte Joseph Van Dorn.
»Was meinen Sie?«
»Harry Frost ist der gefährlichste Verbrecher, den ich kenne, der zurzeit frei herumläuft.«
»Nein«, protestierte Whiteway. »Harry Frost war ein erstklassiger Geschäftsmann, ehe er den Verstand verlor.«
Isaac Bell strafte den Zeitungsverleger mit einem eisigen Blick. »Vielleicht ist Ihnen nicht klar, wie Mr. Frost seine geschäftlichen Aktivitäten begonnen hat.«
»Ich weiß, dass er erfolgreich war. Frost war der führende Zeitungsvertriebshändler der Nation, als ich die Leitung über die Zeitungen meines Vaters übernahm. Als er sich zur Ruhe setzte – im Alter von fünfunddreißig Jahren, wie ich vielleicht hinzufügen darf –, kontrollierte er jeden Zeitungsstand auf jedem Bahnhof in diesem Land. Ganz gleich wie grausam er sich gegenüber der armen Josephine verhalten hat, es sollte nicht vergessen werden, dass Frost beim Aufbau seiner Kette, die inzwischen über den gesamten Kontinent reicht, großen Erfolg hatte. Offen gesagt, von Geschäftsmann zu Geschäftsmann würde ich ihn bewundern, wenn er nicht versuchen würde, seine Ehefrau umzubringen.«
»Eher würde ich einen tollwütigen Wolf bewundern«, entgegnete Isaac Bell grimmig. »Harry Frost ist ein brutales Superhirn. Er hat ›seine kontinentale Kette geschaffen‹, wie Sie es ausgedrückt haben, indem er jeden Konkurrenten, der ihm im Weg stand, vernichtete.«
»Und trotzdem – ich sage noch immer, dass er ein guter Geschäftsmann war, ehe er verrückt wurde«, widersprach Whiteway. »Anstatt von den Zinsen seines Wohlstands zu leben, nachdem er sich zur Ruhe gesetzt hatte, investierte er in Stahlwerke, Eisenbahnlinien und Postum Cereals. Er besitzt ein Vermögen, das sogar einem J. P. Morgan Ehre machen würde.«
Auflodernder Zorn rötete Joseph Van Dorns Wangen, so dass sie plötzlich intensiver leuchteten als sein Backenbart. Er reagierte mit heftigen Worten, und der sonst nur leichte irische Einschlag in seiner Stimme verstärkte sich zu dem schwerfälligen Dialekt eines irischen Fährenkapitäns.
»J. P. Morgan ist schon vieler Dinge beschuldigt worden, Sir, aber selbst wenn sie alle zuträfen, wäre er auf ein solches Vermögen gewiss nicht stolz. Harry Frost verfügt über die Managerfähigkeiten eines General Grant, die Kraft eines Grizzlybären und die Skrupel des Satans persönlich.«
Isaac Bell drückte es ein wenig schlichter aus. »Ich weiß, wie Frost operiert. Die Van Dorn Detective Agency hatte bereits vor zehn Jahren mit ihm zu tun.«
Whiteway kicherte. »Isaac, vor zehn Jahren waren Sie noch auf der Highschool.«
»Das war er nicht«, warf Van Dorn ein. »Isaac hatte soeben seine Lehre begonnen, und die gottverdammte Wahrheit ist, dass Harry Frost uns damals beide übertrumpft hat. Als sich der Staub gelegt hatte, hatte er die Kontrolle über jeden Zeitungsstand im Umkreis von fünfhundert Meilen um Chicago, und diejenigen unserer Klienten, die nicht bankrottgegangen waren, lebten nicht mehr. Nachdem er dieses bluttriefende Fundament seiner weiteren Unternehmungen vor unseren Augen etabliert hatte, expandierte er nach Osten und nach Westen. Er ist so glatt und schlüpfrig wie ein Aal. Wir konnten ihm niemals genug nachweisen, um damit vor Gericht bestehen zu können.«
Whiteway witterte sofort die Gelegenheit, das Honorar für die Dienste Van Dorns zu drücken.
»Habe ich vielleicht zu viel Vertrauen in das Van-Dorn-Motto ›Wir geben nicht auf. Niemals‹ gesetzt? Sollte ich mich lieber nach besseren Detektiven umschauen?«
Isaac Bell und Joseph Van Dorn erhoben sich wortlos und setzten ihre Hüte auf.
»Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Sir«, sagte Van Dorn. »Da Ihr Überlandrennen quer über den Kontinent verläuft, empfehle ich Ihnen allerdings, sich eine Ermittlungsagentur zu suchen, die eine ähnlich landesweite Präsenz zeigt wie die meine.«
»Einen Moment! Warten Sie! Brechen Sie unsere Verhandlungen nicht voreilig ab. Ich meinte doch nur …«
»Wir haben die Niederlage, die Frost uns bereitet hat, nur erwähnt, um Sie zu warnen, ihn nicht zu unterschätzen. Harry Frost ist vollkommen verrückt und so gefährlich wie ein Longhornbulle, aber im Gegensatz zu den meisten Irren kommt er stets eiskalt berechnend zur Sache.«
Bell sagte: »Angesichts der Wahl zwischen dem Irrenhaus und dem Henker hat Frost nichts zu verlieren, weshalb er als noch gefährlicher eingeschätzt werden muss. Glauben Sie nicht für eine Sekunde, dass er sich damit zufriedengeben wird, Josephine zu beseitigen. Da Sie diese Frau zur Heldin des ganzen Rennens aufgebaut haben, wird er das gesamte Projekt attackieren.«
»Ein Mann? Was kann ein einzelner Mann schon ausrichten? Zumal er auch noch auf der Flucht ist.«
»Frost hat in jeder größeren Stadt des Landes Banden von Gesetzlosen zusammengestellt, um sein Wirtschaftsimperium aufzubauen – Diebe, Brandstifter, zu allen Gewalttaten bereite Streikbrecher und Mörder.«
»Gegen Streikbrecher habe ich nichts einzuwenden«, sagte Whiteway unerschütterlich. »Jemand muss die Arbeit schließlich in Gang halten.«
»Sie werden aber sicher etwas dagegen haben, dass sie die Mechaniker Ihrer Flieger zusammenschlagen«, entgegnete Isaac Bell eisig. »Die Innenfelder von Pferderennbahnen und Jahrmarktsplätzen, wo Ihre Rennteilnehmer abends landen werden, sind gewöhnlich ein beliebter Treffpunkt für Spieler. Sie werden auch Ihr Rennen benutzen, um ihre Wetten abzuschließen. Und das Glücksspiel lockt Kriminelle an. Frost weiß genau, wo er sie finden kann, und sie werden ihm liebend gern behilflich sein.«
»Deshalb«, übernahm Van Dorn das Wort, »müssen Sie darauf vorbereitet sein, sich an jedem Zwischenstopp mit Frost herumschlagen zu müssen.«
»Das klingt teuer«, sagte Whiteway. »Entsetzlich teuer.«
Bell und Van Dorn hatten noch immer die Hüte auf dem Kopf. Bell streckte die Hand zur Tür aus.
»Warten Sie – wie viele Männer würden nötig sein, um die gesamte Route abzusichern?«
Isaac Bell sagte: »Ich bin ihr vergangene Woche auf dem Weg nach Westen gefolgt. Das sind insgesamt viertausend Meilen.«
»Wie konnten Sie meiner Route folgen?«, fragte Whiteway. »Ich habe sie doch noch gar nicht bekannt gegeben.«
Die Detektive wechselten ein weiteres unsichtbares Lächeln. Kein Van-Dorn-Agent, der nur halbwegs sein Geld wert war, traf sich mit einem potentiellen Klienten, ohne dessen Bedürfnisse zu kennen. Das galt aber im doppelten Maße für den Gründer der Agentur und seinen leitenden Ermittler.
Bell sagte: »Der Verlauf Ihrer Route ergibt sich aus einer notwendigen Logik: Flugmaschinen können so hohe Gebirge wie die Appalachen und die Rockies nicht überqueren, die Hilfszüge der Konkurrenten müssen den Eisenbahnlinien folgen, und Ihre Zeitungen wollen mit den Berichten über das Rennen möglichst viele Leser erreichen. Infolgedessen bin ich mit dem Twentieth Century Limited von New York City auf der Water Level Route den Hudson River hinauf und am Erie Canal und Lake Erie entlang nach Chicago gefahren. In Chicago bin ich dann in den Golden State Limited durch Kansas City und durchs südliche Texas umgestiegen, habe die Rocky Mountains am tiefsten Punkt der Continental Divide überquert, fuhr durch New Mexico und Arizona, danach durch Kalifornien nach Los Angeles und anschließend durch das Central Valley nach San Francisco hinauf.«
Bell hatte die Reise mit den zuschlagpflichtigen Expresszügen unternommen, getarnt als leitender Versicherungsmanager. Örtliche Van-Dorn-Agenten waren telegrafisch von seiner Durchreise informiert worden und teilten ihm während der Zwischenstopps mit, wo die Flieger allabendlich auf Jahrmarktsplätzen und Rennbahnen landen würden. Ihre Dossiers über Glücksspieler, Kriminelle, Informanten und Polizeibeamte hatten sich als eine interessante Lektüre erwiesen, und als der Zug auf der Oakland-Mole langsam auf die Fähre rollte, hatte Isaac Bell sein enzyklopädisches Wissen über die Kriminalität in Amerika auf den neuesten Stand gebracht.
Plötzlich meldete sich Weiner von seinem Stuhl in der Zimmerecke aus zu Wort.
»Die Regeln verlangen, dass der Sieger am Ende der letzten Etappe eine Runde um dieses Gebäude – das San Francisco Inquirer Building – fliegen muss, ehe er auf dem Gelände des Army Signal Corps auf dem Presidio landet.«
»Ein derart anspruchsvolle Route zu beschützen wird eine enorme Aufgabe sein«, sagte Van Dorn mit dem Anflug eines Lächelns. »Wie ich Ihnen vorhin schon geraten hatte, brauchen Sie eine Detektei mit Außenstellen, die sich quer über den Kontinent ziehen.«
Isaac Bell nahm den Hut ab und sagte mit ernster Stimme: »Wir sind durchaus der Auffassung, dass Ihr Überlandrennen wichtig ist, Preston. Die Vereinigten Staaten hinken, was den Langstreckenflug betrifft, weit hinter Frankreich und Italien hinterher.«
Whiteway nickte zustimmend. »Temperamentvolle Ausländer wie die Franzosen und die Italiener begeistern sich fast von Natur aus für die Fliegerei.«
»Aber die eher gemütlichen Deutschen und die schwerfälligen Briten sind auf diesem Gebiet mittlerweile ebenfalls erfolgreich«, stellte Bell mit einem Anflug von Spott fest.
»Da die Kriegsgefahr in Europa wächst«, fügte Van Dorn hinzu, »ist das Militär der verschiedenen Nationen inzwischen bereit, jeden Preis für eine Flugtechnik zu zahlen, die sich auf dem Schlachtfeld einsetzen lässt.«
Whiteway meinte salbungsvoll: »So ist es nun mal, zwischen kriegslüsternen Königen und Autokraten und uns friedliebenden Amerikanern liegen Welten.«
»Umso mehr ist das ein Anlass«, sagte Isaac Bell, »für ›Amerikas Sweetheart der Lüfte‹, unsere Nation auf eine neue, höhere Ebene über die heldenhaften Taten der Wright-Brüder und anderer fliegender Draufgänger, die an sonnigen Tagen die Zuschauermassen umkreisen, hinauszuheben. Und so wie Josephine die Vereinigten Staaten voranbringt, fördert sie auch das neue Feld der Luftfahrt.«
Bells Worte gefielen Whiteway, und Van Dorn bedachte seinen Chef-Ermittler mit einem bewundernden Blick, weil es ihm so grandios gelungen war, einem potentiellen Kunden Honig ums Maul zu schmieren. Aber Isaac Bell meinte durchaus, was er sagte. Um Flugzeuge zu einem schnellen, zuverlässigen Transportmittel zu machen, mussten sich ihre Lenker bei Wind und Wetter über die einsamen Weiten Amerikas kämpfen.
»Harry Frost darf dieses grandiose Rennen nicht zum Scheitern bringen.«
»Schließlich steht die Zukunft der Luftfahrt auf dem Spiel. Und natürlich das Leben der jungen Aviatrice.«
»Na schön!«, sagte Whiteway endlich. »Sorgen Sie dafür, dass die Nation von Küste zu Küste lückenlos überwacht wird. Und zum Teufel mit den Kosten.«
Van Dorn streckte die Hand aus, um das Geschäft mit einem Händedruck zu besiegeln. »Wir werden es sofort in Angriff nehmen.«
»Oh, da ist noch etwas …«, bemerkte Whiteway.
»Ja?«
»Die Truppe Detektive, die Josephine beschützt?«
»Handverlesen. Das versichere ich Ihnen.«
»Die Männer müssen alle verheiratet sein.«
»Natürlich«, sagte Van Dorn. »Das versteht sich von selbst.«
Als sie in Bells Automobil die Market Street hinunterröhrten, strahlte Van Dorn übers ganze Gesicht und kicherte belustigt. »Verheiratete Detektive?«
»Das klingt, als hätte Josephine einen eifersüchtigen Ehemann gegen einen eifersüchtigen Sponsor eingetauscht.«
Isaac Bell verkniff sich, den Gedanken auszusprechen, dass dieses angeblich naive Mädchen vom Land ganz gezielt von einem reichen Ehemann, der ihre Flugmaschinen bezahlt hatte, zu einem reichen Zeitungsverleger übergewechselt war, damit er ihr die nötigen Flugmaschinen finanzierte. Offenbar war sie eine klar denkende junge Frau, die stets bekam, was sie wollte. Er freute sich schon darauf, sie kennenzulernen.
Van Dorn sagte: »Ich hatte den Eindruck, dass Whiteway Frost lieber hängen als eingesperrt sehen würde.«
»Sie werden sich entsinnen, dass Whiteways Mutter – eine ausgesprochen energische Frau – Artikel über die Unmoral der Scheidung schreibt, die Whiteway in den Sonntagsbeilagen seiner Blätter veröffentlichen muss. Falls Preston tatsächlich von einer Ehe mit Josephine träumt, wird er das Hängen sicherlich vorziehen, um sich den Segen seiner Mutter – und damit sein Erbe – zu sichern.«
»Ich würde Josephine liebend gern zur Witwe machen«, knurrte Van Dorn. »Das ist das Mindeste, das Harry Frost verdient hätte. Nur müssen wir ihn dazu erst einmal fangen.«
Isaac Bell sagte: »Darf ich vorschlagen, dass Sie den Schutz Josephines in Archie Abbotts Hände legen? Es dürfte in ganz Amerika keinen Detektiv geben, der glücklicher verheiratet ist.«
»Er wäre ein Narr, wenn er es nicht wäre«, erwiderte Van Dorn. »Seine Frau ist nicht nur bemerkenswert attraktiv, sondern auch noch sehr reich. Ich frage mich oft, weshalb er überhaupt noch für mich arbeitet.«
»Archie ist ein erstklassiger Detektiv. Warum sollte er aufhören, das zu tun, was er hervorragend beherrscht?«
»In Ordnung, ich übertrage Ihrem Freund Archie das Kommando über die Schutztruppe.«
Bell sagte: »Ich nehme an, dass Sie Josephine Detektive zuteilen und keine PS-Leute.«
Der Van Dorn Protective Service war ein hoch profitabler Ableger der Agentur, der erstklassige Hausdetektive, Leibwächter, zuverlässige Begleiter und Nachtwächter bereitstellte. Aber nur wenige Angehörige des Service waren auch mit dem Geist, dem Eifer, dem Pflichtbewusstsein, dem Können und der Cleverness gesegnet, um in den Rang vollwertiger Detektive aufzusteigen.
»Ich werde so viele Detektive wie möglich abkommandieren«, erwiderte der Boss der Agentur. »Aber mir steht für diesen Job keine Armee von Detektiven zur Verfügung – jedenfalls nicht, solange so viele meiner besten Männer im Ausland sind, um unsere Überseebüros aufzubauen.«
Bell antwortete: »Wenn Sie nur eine begrenzte Anzahl Detektive für den Schutz Josephines erübrigen können, empfehle ich Ihnen, in der Agentur nach Detektiven zu suchen, die früher als Mechaniker gearbeitet haben.«
»Hervorragend! Getarnt als Mechaniker, kann eine kleine Truppe immer ganz nahe bei ihr bleiben und an ihrer Flugmaschine arbeiten …«
»Während ich mich auf Frost konzentriere.«
Van Dorn hörte einen scharfen Unterton in Bells Stimme. Er sah ihn fragend an. Im Profil betrachtet – und während er das schwere Automobil durch den dichten Verkehr lenkte –, sahen die Adlernase und das kantige Kinn wie aus Stahl gefräst aus.
»Schaffen Sie es, einen klaren Kopf zu behalten?«
»Natürlich.«
»Das letzte Mal hat er Sie übertrumpft, Isaac.«
Bell reagierte auf diese Bemerkung mit einem eisigen Lächeln. »Er hat eine ganze Menge Detektive übertrumpft, die damals älter waren als ich. Sie inklusive, Joe.«
»Wenn Sie mir versprechen, sich das ständig bewusst zu halten, dann können Sie diesen Job haben.«
Bell ließ den Schaltknüppel los, reichte den Arm über den Benzintank des Locomobile hinweg, um die Hand seines Chefs zu ergreifen. »Darauf haben Sie mein Wort.«
3
»Wurde von einem Bären aufgemischt«, sagte der Stadtpolizist von North River, John Hodge, als Isaac Bells Blick fragend über sein vernarbtes Gesicht, den verkrüppelten Arm und das Holzbein glitt. »War mal als Führer tätig und habe Gäste auf die Jagd und zum Angeln mitgenommen. Als der Bär mit mir fertig war, taugte ich allerdings nur noch für den Polizeidienst.«
»Wie ist es dem Bären ergangen?«, fragte Bell.
Der Konstabler grinste.
»In den Winternächten hält mich sein Fell warm. Anständig von Ihnen, dass Sie danach fragen – die meisten schauen mir nicht mal ins Gesicht. Willkommen im North Country, Mr. Bell. Was kann ich für Sie tun?«
»Was meinen Sie, weshalb die Leiche Marco Celeres nie gefunden wurde?«
»Aus dem gleichen Grund, weshalb wir keinen Körper finden, der in diese Schlucht stürzt. Es ist ein langer Weg bis auf ihren Grund, der Fluss hat eine reißende Strömung und ist tief, und außerdem gibt es zahlreiche hungrige Tiere – vom Vielfraß bis hin zu Hechten. Wer hier im Norden abstürzt, der ist ein für alle Mal weg, Mister.«
»Hat es Sie überrascht, als Sie hörten, dass Harry Frost Celere erschossen hat?«
»Könnte man sagen, ja.«
»Warum? Soweit ich hörte, war doch allgemein bekannt, dass Frost schon zuvor gewalttätig gewesen ist. Lange bevor er wegen Mordes an seinem Chauffeur eingesperrt wurde.«
»Schon früh an demselben Vormittag, an dem Mrs. Frosts Butler die Schüsse meldete, hatte Mr. Frost bereits den Diebstahl seines Gewehrs gemeldet und Anzeige erstattet.«
»Meinen Sie, er besaß noch ein zweites?«
»Er sagte, das gestohlene wäre seine Lieblingswaffe gewesen.«
»Meinen Sie, er hat die Unwahrheit gesagt, um den Verdacht von sich abzulenken?«
»Keine Ahnung.«
»Wurde das Gewehr jemals gefunden?«
»Jungen, die auf dem Bahndamm spielten, fanden es.«
»Wann?«
»Am gleichen Nachmittag.«
»Könnte es sein, dass Frost es verloren hat, als er auf einen Güterzug aufsprang, um zu fliehen?«
»Ich habe noch nie gehört, dass reiche Knöpfe so wie Hobos mit der Eisenbahn trampen.«





























