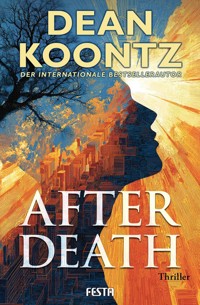2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Würdest du für deine Liebe töten?
„Wir haben deine Frau. Für zwei Millionen Dollar kriegst du sie wieder.“ Der mittellose Gärtner Mitch hält diesen Anruf zunächst für einen Scherz. Doch dann erschießt der Entführer einen zufälligen Passanten, um zu zeigen, wie ernst er es meint. 60 Stunden bleiben Mitch im Wettlauf gegen einen Feind, für den Erpressung nur der Anfang eines mörderischen Spiels ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
DAS BUCH
»Wir haben deine Frau. Für zwei Millionen in bar kriegst du sie zurück.« Landschaftsgärtner Mitch Rafferty war gerade dabei, im strahlenden Sonnenschein das Beet eines Kunden zu bepflanzen, als der Albtraum losbricht. Denn der Anrufer meint es todernst. So ernst, dass er einen Passanten erschießt, der gerade seinen Hund spazieren führt, um es Mitch zu beweisen. Wie der relativ mittellose Gärtner das Geld binnen sechzig Stunden auftreiben soll, scheint ihm egal. Wenn Mitch seine Frau genug liebt, wird er es schon schaffen …
Natürlich ist es ihm streng verboten, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. Nur leider nimmt die Polizei mit ihm Kontakt auf – schließlich wurde direkt neben ihm ein Mensch erschossen. Mitch schweigt und macht sich verdächtig. Er fühlt sich ständig von den Entführern beobachtet. Und er hat nach wie vor keinen Schimmer, wie er ihren Forderungen nachkommen soll. Doch er ist bereit, bis zum Letzten um Holly zu kämpfen.
»Lesen Sie dieses Buch. Es ist nicht nur das beste Werk von Koontz, sondern eines der besten Bücher überhaupt in diesem Jahr. Denken Sie erst gar nicht daran, dieses Buch wieder hinzulegen. Die allergrößte Empfehlung.«
Bookreporter
»Koontz ist zweifellos der beste amerikanische Thrillerautor dieser Tage. Und Todeszeit ist einer seiner stärksten Romane.«
Denver Post
DER AUTOR
Dean Koontz wurde 1945 in Pennsylvania geboren und lebt heute mit seiner Frau in Kalifornien. Seine zahlreichen Romane – Thriller und Horrorromane – wurden in 38 Sprachen übersetzt und sämtlich zu internationalen Bestsellern. Weltweit wurden bislang über 300 Millionen Exemplare seiner Bücher verkauft. Zuletzt bei Heyne erschienen: Seelenlos.
LIEFERBARE TITEL
Die Anbetung – Bote der Nacht – Chase – Frankenstein/Das Gesicht – Frankenstein/Die Kreatur – Der Geblendete – Geschöpfe der Nacht – Im Bann der Dunkelheit – Irrsinn – Kalt – Mitternacht – Seelenlos – Stimmen der Angst – Todesdämmerung – Trauma – Tür ins Dunkel – Das Versteck – Der Wächter – Die zweite Haut – Zwielicht
Inhaltsverzeichnis
Dieser Roman ist Andy und Anne Wickstrom sowie Wesley J. Smith und Debra J. Saunders gewidmet, zwei guten Ehemännern und ihren guten Ehefrauen, die zudem gute Freunde sind und die Welt dort, wo sie gerade sind, ein wenig heiterer werden lassen.
Mut ist Anmut unter Druck.
ERNEST HEMINGWAY
Dass Liebe alles ist, was ist, ist alles, was wir wissen von der Liebe …
EMILY DICKINSON
ERSTER TEIL
Was würdest du aus Liebe tun?
1
Bereits im Augenblick seiner Geburt fängt der Mensch an zu sterben. Dennoch leugnen die meisten Leute das geduldige Werben des Todes, bis sie spät im Leben schwer krank wahrnehmen, dass er an ihrem Bett sitzt.
Noch Jahre später war Mitchell Rafferty in der Lage, die Minute zu nennen, in der er zum ersten Mal erkannte, dass man dem Tod nicht entrinnen kann: Montag, der vierzehnte Mai, elf Uhr dreiundvierzig vormittags – drei Wochen vor seinem achtundzwanzigsten Geburtstag.
Bis dahin hatte er so gut wie nie ans Sterben gedacht. Als geborener Optimist, der sich an der Schönheit der Natur erfreute und sich gern über die Menschheit amüsierte, hatte er weder Grund noch Neigung, darüber nachzudenken, wann und wie seine Sterblichkeit sich erweisen würde.
Als es so weit war, lag er auf den Knien.
Dreißig Kisten mit roten und violetten Fleißigen Lieschen mussten noch gepflanzt werden. Die Blüten verströmten keinerlei Duft, aber der satte Geruch der Erde machte ihm Freude.
Seine Kunden, die in dem zum Garten gehörenden Haus wohnten, mochten kräftige Farben: rot, violett, dunkelgelb, grellrosa. Weiße oder pastellfarbene Blüten lehnten sie ab.
Mitch hatte Verständnis für sie. Arm aufgewachsen, hatten sie sich eine erfolgreiche Firma aufgebaut, indem sie schwer gearbeitet hatten und Risiken eingegangen waren. Sie führten ein bis zum Rand gefülltes Leben, und in satten Farben spiegelte sich die Leidenschaft der Natur.
An diesem scheinbar gewöhnlichen, tatsächlich jedoch schicksalhaften Morgen hing die kalifornische Sonne wie eine buttergelbe Kugel an einem seidig schimmernden Himmel.
Obwohl der Tag angenehm warm und es keineswegs brütend heiß war, brachte er Ignatius Barnes ordentlich zum Schwitzen. Iggys Stirn glänzte ölig, von seinem Kinn tropfte es.
Iggy, der drei Meter weiter im selben Blumenbeet arbeitete, sah aus, als wäre er in siedendes Wasser getaucht worden. Von Mai bis Juli reagierte seine Haut nicht mit Melanin auf die Sonne, sondern mit einer heftigen Röte. Deshalb machte er ein Sechstel des Jahres – bis er endlich braun wurde – den Eindruck, er würde sich ständig schämen.
Weil Iggy kein Verständnis für die Symmetrie und Harmonie hatte, die es bei der Landschaftsgestaltung brauchte, konnte man nicht von ihm erwarten, fachgerecht Rosenstöcke zu beschneiden. Dafür arbeitete er hart und war ein angenehmer, wenn auch nicht gerade intellektuell herausfordernder Gesprächspartner.
»Sag mal, hast du eigentlich gehört, was Ralph Gandhi zugestoßen ist?«, fragte Iggy.
»Wer ist Ralph Gandhi?«
»Der Bruder von Mickey.«
»Mickey Gandhi? Den kenne ich auch nicht.«
»Klar kennst du den«, sagte Iggy. »Der hängt doch manchmal im Rolling Thunder ab.«
Rolling Thunder war eine Surferkneipe.
»Da bin ich schon Jahre nicht mehr gewesen«, sagte Mitch.
»Jahre? Im Ernst?«
»Klar doch.«
»Ich hab gedacht, du schaust noch manchmal vorbei.«
»Also werde ich tatsächlich vermisst, was?«
»Zugegeben, einen Barhocker hat man nicht nach dir benannt. Sag mal, hast du etwa ’ne bessere Kneipe als den Rolling Thunder aufgetrieben?«
»Erinnerst du dich noch daran, wie wir vor drei Jahren bei meiner Hochzeit hier waren?«, fragte Mitch.
»Klar. Es gab klasse Tacos mit Meeresfrüchten. Die Band war allerdings ziemlich mau.«
»Die war überhaupt nicht mau.«
»Mensch, die Typen haben Tamburin gespielt!«
»Wir mussten eben sparen. Wenigstens hatten sie kein Akkordeon.«
»Weil sie zu schlecht waren, um mit ’nem Akkordeon umzugehen.«
Mitch schaufelte ein Loch in die lose Erde. »Zimbeln hatten sie auch keine.«
Iggy wischte sich mit dem Unterarm über die Stirn. »Offenbar hab ich Eskimos unter meinen Vorfahren«, klagte er. »Mir bricht schon bei zehn Grad plus der Schweiß aus.«
»Ich führe kein Kneipenleben mehr«, sagte Mitch, »sondern ein Eheleben.«
»Gut, aber das muss ja nicht unvereinbar sein.«
»Ich bin einfach lieber zu Hause als irgendwo anders.«
»Ach, Chef, das ist aber traurig«, sagte Iggy.
»Das ist nicht traurig, das ist gut so.«
»Selbst wenn man ’nen Löwen drei oder sechs Jahre in den Zoo steckt, vergisst er nie, wie sich die Freiheit angefühlt hat.«
Mitch pflanzte ein violettes Fleißiges Lieschen ein. »Woher willst du das denn wissen? Hast du ’nen Löwen etwa schon mal danach gefragt?«
»Ich muss gar keinen fragen. Ich bin ein Löwe.«
»Du bist ein hoffnungsloser Surffreak.«
»Und darauf bin ich stolz. Ich freue mich, dass du Holly gefunden hast. Sie ist ’ne tolle Frau. Aber ich hab meine Freiheit!«
»Gut für dich, Iggy. Und was tust du damit?«
»Womit?«
»Mit deiner Freiheit. Was fängst du mit deiner Freiheit an?«
»Alles, was ich will.«
»Zum Beispiel?«
»Irgendwas. Wenn ich mir zum Abendessen beispielsweise ’ne Salamipizza holen will, muss ich niemanden fragen, was er – ich meine sie – will.«
»Krass.«
»Und wenn ich im Rolling Thunder ein paar Bierchen kippen will, meckert niemand an mir rum.«
»Holly meckert nicht.«
»Wenn ich will, kann ich mich jeden Abend mit Bier zuschütten, und niemand ruft in der Kneipe an, wann ich nach Hause komme.«
Mitch begann, »Born Free« zu pfeifen.
»Wenn mich ’ne heiße Frau anmacht«, fuhr Iggy fort, »kann ich ungehindert in die Vollen gehen.«
»Dich machen ja auch ständig irgendwelche heißen Frauen an, was?«
»Die Frauen sind heutzutage ziemlich dreist, Chef. Wenn sie was sehen, was sie haben wollen, dann nehmen sie es sich einfach.«
»Iggy, als du das letzte Mal ’nen Stich gemacht hast, hat John Kerry noch gemeint, er wird Präsident.«
»Das ist gar nicht so lange her.«
»Also, was ist dem guten Ralph passiert?«
»Welchem Ralph?«
»Dem Bruder von Mickey Gandhi.«
»Ach ja. Ein Leguan hat ihm die Nase abgebissen.«
»Übel.«
»Am Wedge sind total geile Wellen angerollt, drei Meter hoch, also ist Ralph mit ein paar Kumpels in der Nacht zum Surfen rausgefahren.«
Der Wedge war ein berühmtes Surfrevier am Ende der Balboa-Halbinsel in Newport Beach.
»Sie hatten ein paar Kühlboxen mit Sandwichs und Bier dabei, und einer hat Ming mitgebracht.«
»Ming?«
»Das ist der Leguan.«
»Der war also ein Haustier?«
»Bis dahin war das Tierchen immer brav gewesen.«
»Ich hätte Leguane eher für launisch gehalten.«
»Nee, die sind total lieb. Das Problem war, irgendein Wichser, der nicht mal surft und bloß einfach so mitgekommen war, hat Ming ein Stück Salami mit ’ner Vierteldosis Meth untergeschoben.«
»Reptilien auf Speed«, sagte Mitch, »sind keine gute Sache.«
»Aber ehrlich. Auf Meth war Ming ein ganz anderes Tier als clean.«
Mitch legte seine Schaufel weg und ließ sich auf die Hacken seiner Arbeitsstiefel nieder. »Das heißt, Ralph Gandhi ist jetzt nasenlos?«
»Ming hat die Nase nicht gefressen. Er hat sie bloß abgebissen und wieder ausgespuckt.«
»Vielleicht mag er kein indisches Essen.«
»Die Typen hatten ’ne große Kühlbox mit Eiswasser und Bier dabei. Da haben sie die Nase reingetan und schleunigst ins Krankenhaus gebracht.«
»Haben sie Ralph auch mitgenommen?«
»Den mussten sie ja mitnehmen. Schließlich war es seine Nase.«
»Na ja«, sagte Mitch, »hier geht es um Surfer.«
»Es heißt, das Ding wäre schon ziemlich blau gewesen, als man es aus dem Eiswasser gefischt hat, aber ein plastischer Chirurg hat es wieder angenäht, und jetzt ist es nicht mehr blau.«
»Was ist aus Ming geworden?«
»Der ist einfach eingepennt. ’nen Tag lang war er völlig außer Gefecht, aber inzwischen ist er wieder ganz der Alte.«
»Gut so. Wahrscheinlich ist es ziemlich schwierig, eine Entziehungsanstalt für Leguane zu finden.«
Mitch stand auf, sammelte drei Dutzend leere Plastikblumentöpfe ein und trug sie zu seinem Pick-up mit der extra langen Ladefläche.
Der Wagen stand am Straßenrand im Schatten eines Indischen Lorbeers. Obwohl das Viertel erst vier Jahre zuvor saniert worden war, hatte der große Baum bereits den Gehsteig angehoben. Irgendwann würden die hartnäckigen Wurzeln die Drainage des Rasens blockieren und in die Kanalisation eindringen.
Die Entscheidung der Wohnbaugesellschaft, ganze einhundert Dollar zu sparen, indem man keine Wurzelsperre installierte, würde zu mehreren zehntausend Dollar Reparaturkosten zugunsten von Installateuren, Gärtnern und Straßenbaufirmen führen.
Wenn Mitch eine dieser riesigen Lorbeerfeigen pflanzte, verwendete er immer eine Wurzelsperre. Er hatte es nicht nötig, sich Aufträge für die Zukunft zu verschaffen. Die Natur war so üppig, dass sie von sich aus genügend Arbeit für ihn bereithielt.
Die Straße lag still da. Kein Auto kam vorbei. In den Bäumen regte sich nicht der leiseste Windhauch.
Von der nächsten Kreuzung her näherten sich auf der anderen Straßenseite ein Mann und ein Hund. Letzterer, ein Golden Retriever, verbrachte weniger Zeit mit Laufen als damit, die von seinen Artgenossen hinterlassenen Botschaften zu beschnuppern.
Die Stille war so eindringlich, dass Mitch fast glaubte, das Keuchen des weit entfernten Hundes hören zu können.
Golden: die Sonne und der Hund, die Luft und der noch frische Tag, die schönen Häuser hinter ihren gepflegten Rasenflächen.
Mitch Rafferty konnte sich ein Haus in dieser Nachbarschaft nicht leisten. Er war schon damit zufrieden, hier arbeiten zu dürfen.
Schließlich konnte man auch große Kunst lieben, ohne den Wunsch zu verspüren, in einem Museum zu leben.
Dort, wo der Rasen an den Gehsteig stieß, bemerkte Mitch einen beschädigten Sprinkler. Er holte sein Werkzeug aus dem Wagen und kniete sich aufs Gras, um sich darum zu kümmern.
Sein Handy läutete. Er zog es vom Gürtel und klappte es auf. Auf dem Display erschien nur die Zeit – elf Uhr dreiundvierzig – , nicht jedoch die Nummer des Anrufers. Mitch nahm trotzdem ab.
»Big Green«, sagte er. So hatte er seinen Zweimannbetrieb vor neun Jahren getauft. Er erinnerte sich jedoch nicht mehr daran, weshalb.
»Mitch, ich liebe dich«, sagte Holly.
»Hallo, Süße!«
»Was auch geschehen mag, ich liebe dich.«
Ein Schmerzensschrei. Polternde Geräusche, die auf einen Kampf hindeuteten.
Erschrocken sprang Mitch auf. »Holly?«
Irgendeine Männerstimme sagte etwas, ein Kerl, der jetzt das Telefon in der Hand hatte. Die Worte verstand Mitch nicht, weil er sich auf die Geräusche im Hintergrund konzentrierte.
Holly schrie auf. Einen solchen Schrei, so voller Angst, hatte er noch nie von ihr gehört.
»Scheißkerl«, sagte sie und wurde mit einem scharfen Klatschen zum Schweigen gebracht. Hatte man ihr etwa eine Ohrfeige verpasst?
Der Fremde am Telefon fragte: »Hörst du mich, Rafferty? «
»Holly? Wo ist Holly?«
Jetzt sprach der Kerl nicht mehr ins Telefon, sondern in den Raum hinein: »Mach keinen Blödsinn! Bleib auf dem Boden liegen!«
Im Hintergrund sagte ein anderer Mann etwas, was Mitch nicht verstand.
Der Kerl am Telefon sagte: »Wenn sie aufsteht, zieh ihr eins über. Willst du etwa ein paar Zähne verlieren, Schätzchen? «
Zwei Männer hatten Holly in der Gewalt. Einer der beiden hatte sie geschlagen. Sie geschlagen!
Mitch schaffte es nicht, die Lage zu erfassen. Mit einem Mal kam ihm die Wirklichkeit so schwer zu greifen vor wie die Handlung eines Albtraums.
Ein mit Meth gefütterter Leguan war jedenfalls realer als das, was gerade geschah.
In der Nähe des Hauses pflanzte Iggy Fleißige Lieschen. Schwitzend, rot von der Sonne, so real wie eh und je.
»Gut so, Kleine! Braves Mädchen.«
Mitch stockte der Atem. Ein gewaltiges Gewicht drückte auf seine Lunge. Er versuchte zu sprechen, brachte jedoch nichts heraus, wusste nicht, was er sagen sollte. Mitten in der hellen Sonne fühlte er sich, als steckte er in einem Sarg und würde lebendig begraben.
»Wir haben deine Frau«, sagte der Kerl am Telefon.
Mitch hörte sich fragen: »Warum?«
»Na, was meinst du wohl, du Trottel?«
Mitch meinte gar nichts. Er wollte nichts meinen. Er wollte sich keine logische Antwort ausdenken, denn jede mögliche Antwort hätte aus blankem Grauen bestanden.
»Ich pflanze Blumen«, sagte er stattdessen.
»Sag mal, stimmt was nicht mit dir, Rafferty?«
»Das ist mein Beruf. Blumen pflanzen. Sprinkler reparieren. «
»Bist du etwa bekifft?«
»Ich bin bloß Gärtner.«
»Also, wir haben deine Frau. Für zwei Millionen in bar kriegst du sie zurück.«
Mitch wusste, dass es kein Scherz war. Wäre es ein Scherz gewesen, dann hätte Holly mitgespielt. Aber sie hatte keinen grausamen Humor.
»Ihr habt einen Fehler gemacht«, sagte Mitch.
»Hast du nicht gehört, was ich gesagt hab? Zwei Millionen. «
»Mann, du hörst nicht zu. Ich bin ein Gärtner!«
»Das wissen wir.«
»Ich hab in etwa elftausend Dollar auf der Bank.«
»Wissen wir auch.«
Mitch war so voller Furcht und Verwirrung, dass kein Raum mehr für Zorn blieb. Gezwungen, die Sache klarzustellen, vielleicht mehr für sich als für den Anrufer, sagte er: »Ich hab bloß einen kleinen Zweimannbetrieb.«
»Du hast bis Mittwoch um Mitternacht Zeit. Sechzig Stunden. Die Einzelheiten erfährst du später.«
Mitch schwitzte. »Das ist völlig verrückt. Wie soll ich zwei Millionen Dollar auftreiben?«
»Du findest schon einen Weg.«
Die Stimme des Fremden klang hart und unerbittlich. In einem Film hätte man sie für den Tod verwenden können.
»Das ist nicht möglich«, sagte Mitch.
»Willst du sie noch mal schreien hören?«
»Nein. Bitte nicht.«
»Liebst du sie?«
»Ja.«
»Liebst du sie wirklich?«
»Sie ist mein Ein und Alles.«
Wie merkwürdig, dass Schweiß sich so kalt anfühlen konnte.
»Wenn sie dein Ein und Alles ist«, sagte der Fremde, »dann findest du einen Weg.«
»Es gibt keinen.«
»Wenn du zur Polizei gehst, schneiden wir ihr nacheinander die Finger ab und brennen ihr die Wunden aus, damit sie nicht verblutet. Wir schneiden ihr die Zunge aus dem Mund. Stechen ihr die Augen aus. Dann lassen wir sie irgendwo liegen, damit sie so schnell oder langsam krepieren kann, wie sie will.«
Der Fremde sprach ohne drohenden Unterton, ganz sachlich, so als würde er keine Drohung ausstoßen, sondern nur die Einzelheiten eines Geschäftsmodells erläutern.
Im Umgang mit solchen Menschen hatte Mitchell Rafferty keinerlei Erfahrung. Es kam ihm vor, als spräche er mit einem Besucher vom anderen Ende der Galaxis.
Wieder brachte er kein Wort heraus, weil er plötzlich den Eindruck hatte, er könnte ganz leicht und ungewollt das Falsche sagen und damit Hollys sofortigen Tod herbeiführen.
Der Kidnapper sagte: »Damit du weißt, dass wir es ernst meinen …«
Nach einer Pause fragte Mitch: »Was?«
»Siehst du den Typ auf der anderen Straßenseite?«
Mitch drehte sich um und sah einen einsamen Fußgänger, den Mann, der langsam seinen Hund spazieren führte. Die beiden waren erst bis zur Mitte der Häuserzeile gekommen.
Der sonnige Tag bekam einen Glanz wie von Porzellan. Gewehrfeuer erschütterte die Stille, dann stürzte der Mann mit einem Loch im Kopf zu Boden.
»Mittwoch um Mitternacht«, sagte der Mann am Telefon. »Wir meinen es verdammt ernst.«
2
Der Hund stand wie in Vorstehhaltung da, einen Vorderlauf gehoben, den Schwanz reglos ausgestreckt, die Nase in der Luft, um einen Geruch zu wittern.
Beim zweiten Blick wurde Mitch klar, dass der Golden Retriever den Schützen gar nicht wahrgenommen hatte. Durch den Zusammenbruch seines Herrn erschrocken, war der Hund mitten im Schritt erstarrt und stand nun verwirrt da.
Mitch, der sich direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite befand, war ebenso gelähmt. Obwohl der Kidnapper aufgelegt hatte, hielt Mitch sich immer noch sein Handy ans Ohr.
Ein völlig absurder Gedanke kam ihm in den Sinn: Wenn um ihn herum nichts geschah, wenn weder er noch der Hund sich bewegten, kehrte die Zeit sich vielleicht um, rief die Kugel in den Lauf zurück und machte die Gewalttat ungeschehen.
Vernunft siegte über Aberglauben. Er überquerte die Straße, zuerst zögernd, dann im Dauerlauf.
Wenn der auf dem Boden liegende Mann nur verwundet war, konnte man womöglich etwas tun, um ihn zu retten.
Als Mitch sich dem Hund näherte, begrüßte dieser ihn mit einem kurzen Schwanzwedeln.
Ein Blick auf das Opfer machte jede Hoffnung zunichte, es mit Erster Hilfe am Leben zu erhalten, bis der Rettungswagen eintraf. Ein beträchtlicher Teil des Schädels war zertrümmert.
Da Mitch keine Erfahrung mit echter Gewalt hatte, nur mit der redigierten, analysierten, entschuldigten und gezähmten Sorte, die von den Fernsehnachrichten geliefert wurde, und von der künstlichen Gewalt in Filmen, war er angesichts dieses Grauens völlig hilflos. Was ihn lähmte, war eher Schock als Furcht.
Dann ergriff ihn etwas anderes als Schock, eine Wahrnehmung von Dimensionen, die er noch nie verspürt hatte. Er kam sich vor wie eine Ratte in einem von einer Glasscheibe abgedeckten Labyrinth, die zum ersten Mal den Blick von den vertrauten Gängen hob und eine Welt jenseits der Scheibe sah, mit Formen und Gestalten, mit geheimnisvollen Bewegungen.
Der Hund, der inzwischen neben seinem Herrn auf dem Gehsteig lag, zitterte und winselte.
Mitch spürte, dass noch jemand anders in der Nähe war, und fühlte sich beobachtet, ja mehr als das. Prüfend betrachtet. Unter die Lupe genommen. Verfolgt.
Das Herz schlug ihm bis zum Hals.
Er blickte sich um, sah jedoch keine Menschenseele. Der Schuss konnte von überallher abgegeben worden sein, aus dem Fenster eines der Häuser ringsum oder von einem Dach aus. Vielleicht steckte der Schütze auch hinter einem geparkten Wagen.
Die Person, deren Anwesenheit er spürte, war jedoch nicht der Schütze. Er fühlte sich nicht aus der Entfernung beobachtet, sondern aus direkter Nähe. Es war, als würde jemand über ihm aufragen.
Kaum eine halbe Minute war vergangen, seit der Mann da vor ihm ermordet worden war.
Der Knall des Gewehrs hatte niemanden aus einer der noblen Villen gelockt. In dieser Nachbarschaft nahm man einen Schuss bestimmt als zuschlagende Tür wahr und vergaß ihn schon, während noch sein Echo hallte.
Auf der anderen Straßenseite war Iggy Barnes im Garten der Kundschaft aufgestanden. Er sah nicht erschrocken aus, sondern nur verdutzt, als hätte auch er eine Tür knallen gehört und würde nicht begreifen, was der am Boden liegende Mann und der trauernde Hund zu bedeuten hatten.
Mittwoch um Mitternacht. Sechzig Stunden. Die Zeit stand in Flammen, die Minuten brannten. Mitch konnte es sich nicht leisten, dass die Stunden zu Asche zerfielen, während er von der Polizei befragt wurde.
Auf dem Gehsteig wechselte eine Ameisenkolonne den Kurs und marschierte auf das Festmahl in dem zertrümmerten Schädel zu.
In dem fast klaren Himmel trieb eine versprengte Wolke über die Sonne. Der Tag nahm eine fahle Färbung an. Die Schatten verblassten.
Fröstelnd wandte Mitch sich von der Leiche ab, trat vom Bordstein auf die Straße und blieb stehen.
Er und Iggy konnten nicht einfach die ungepflanzten Blumen in den Wagen laden und wegfahren. Womöglich schafften sie das ohnehin nicht, bevor jemand des Weges kam und den Toten sah. Dass sie flohen, statt sich um das Opfer zu kümmern, hätte sie selbst in den Augen des naivsten Passanten schuldig gemacht, ganz zu schweigen von der Einschätzung der Polizei.
Das Handy befand sich immer noch zugeklappt in Mitchs Hand. Er betrachtete es voller Angst.
Wenn du zur Polizei gehst, schneiden wir ihr nacheinander die Finger ab …
Bestimmt erwarteten die Kidnapper, dass er in dieser Lage die Polizei rief oder darauf wartete, bis jemand anders das tat. Verboten war ihm lediglich, Holly und ihre Entführung zu erwähnen, und natürlich die Tatsache, dass der Mann mit dem Hund ermordet worden war, um Mitch als Exempel zu dienen.
Womöglich hatten seine unbekannten Gegner ihn sogar bewusst in diese Zwangslage gebracht, um seine Fähigkeit zu testen, selbst dann den Mund zu halten, wenn er unter extremem Schock stand und am ehesten die Selbstbeherrschung verlieren konnte.
Er klappte das Handy auf. Auf dem Display erschien das vertraute Bild von bunten Fischen in dunklem Wasser.
Nachdem er die ersten beiden Ziffern des Notrufs eingegeben hatte, zögerte er, drückte dann aber doch noch auf die letzte Taste.
Iggy ließ die Schaufel fallen und ging auf die Straße zu.
Erst als sich beim zweiten Läuten eine Stimme meldete, wurde Mitch klar, dass sein Atem seit dem Augenblick, in dem er den zertrümmerten Schädel des Toten gesehen hatte, stoßweise und unregelmäßig ging. Eine Sekunde lang brachte er kein Wort heraus, und dann entfuhren ihm die Worte mit einer rauen Stimme, die er kaum erkannte.
»Man hat auf einen Mann geschossen. Ich bin tot. Ich meine, er ist tot. Man hat auf ihn geschossen, und jetzt ist er tot.«
3
An den nächsten beiden Kreuzungen hatte die Polizei die Straße abgesperrt, dazwischen parkten Streifenwagen, zwei Kleinbusse der Spurensicherung und ein Leichenwagen. Die Sorglosigkeit, mit der sie abgestellt waren, wies darauf hin, dass die Fahrer sich nicht um die Straßenverkehrsregeln kümmern mussten.
Unter dem starren Blick der Sonne loderten die Windschutzscheiben. Chromteile glänzten. Nun stand keine einzige Wolke mehr am Himmel, und das Licht war gnadenlos.
Die Polizisten trugen Sonnenbrillen. Hinter deren dunklen Gläsern betrachteten sie Mitchell Rafferty womöglich argwöhnisch. Vielleicht war er ihnen aber auch völlig gleichgültig.
Vor dem Haus seiner Kundschaft saß Mitch auf dem Rasen, an den Stamm einer Phönixpalme gelehnt.
Von Zeit zu Zeit hörte er oben im Baum Ratten krabbeln. In dieser Palmenart bauten die Nager sich gern ein hohes Nest, am Ansatz der Wedel, wo man sie nicht sah.
Mitch hingegen wurde durch den durchbrochenen Schatten der Wedel kein bisschen weniger sichtbar. Er fühlte sich wie auf einer Bühne.
In den beiden vergangenen Stunden hatte man ihn bereits zweimal befragt. Das erste Mal war er mit zwei Kriminalbeamten in Zivil konfrontiert gewesen, das zweite Mal nur mit einem.
Er glaubte, sich gut herausgeredet zu haben. Dennoch hatte man ihm nicht erklärt, er könne gehen.
Iggy hingegen war bisher erst einmal befragt worden. Er hatte keine Frau, die sich in Gefahr befand, und deshalb nichts zu verbergen. Außerdem besaß Iggy weniger Talent, andere Menschen zu täuschen, als ein kleiner Junge, was den erfahrenen Beamten sicherlich sofort klar geworden war.
Vielleicht war die Tatsache, dass die Cops sich mehr für Mitch als für Iggy interessierten, ein schlechtes Zeichen. Vielleicht war sie auch ohne jede Bedeutung.
Vor über einer Stunde hatte Iggy sich wieder ins Blumenbeet gehockt. Inzwischen war er schon fast damit fertig, die Fleißigen Lieschen zu pflanzen.
Mitch wäre es lieber gewesen, sich ebenfalls mit den Blumen zu beschäftigen. Die Untätigkeit machte ihm allzu deutlich bewusst, wie die Zeit verging. Zwei der sechzig Stunden waren bereits vorüber.
Die Kriminalbeamten hatten jedoch darauf bestanden, dass Iggy und Mitch getrennt blieben. Der offizielle Grund: Selbst wenn sich die beiden in aller Unschuld über das Verbrechen unterhielten, würden sie ihre Erinnerungen womöglich unabsichtlich aneinander angleichen, wodurch in der Zeugenaussage des einen oder anderen ein wichtiges Detail verloren gehen könnte.
Das konnte entweder die Wahrheit oder reines Geschwafel sein. Vielleicht bestand der eigentliche Grund, Mitch von seinem Mitarbeiter zu trennen, darin, ihn zu isolieren und dafür zu sorgen, dass er verunsichert blieb. Keiner der Beamten hatte eine Sonnenbrille getragen, doch ihre Blicke hatte Mitch trotzdem nicht deuten können.
Unter der Palme hockend, hatte er drei Telefonanrufe getätigt. Zuerst hatte er bei sich zu Hause angerufen. Gemeldet hatte sich der Anrufbeantworter.
Nach dem vertrauten Piepton hatte er gefragt: »Holly, bist du da?«
Ihre Peiniger hatten es bestimmt nicht riskiert, sie in ihrem eigenen Haus gefangen zu halten. Trotzdem sagte Mitch: »Wenn du da bist, nimm doch bitte ab.«
Irgendwie weigerte er sich immer noch, die Lage als real zu akzeptieren, weil sie einfach keinen Sinn ergab. Kidnapper schnappten sich doch nicht ausgerechnet die Frauen von Männern, die sich Sorgen um den Preis von Benzin und Lebensmitteln machen mussten.
Mann, du hörst nicht zu. Ich bin ein Gärtner!
Das wissen wir.
Ich hab in etwa elftausend Dollar auf der Bank.
Wissen wir auch.
Die Typen mussten wahnsinnig sein. Völlig irre. Ihr Plan gründete offenkundig auf einer Fantasie, die kein vernunftbegabter Mensch begreifen konnte. Oder sie hatten einen Plan, den sie ihm noch nicht verraten hatten. Vielleicht wollten sie, dass er für sie eine Bank ausraubte.
Er erinnerte sich an eine Story, die vor einigen Jahren in den Nachrichten gekommen war. Ein harmloser Mann hatte eine Bank überfallen, weil eine Verbrecherbande ihn dazu gezwungen hatte. Man hatte ihm einen Kragen mit Sprengstoff umgelegt, um ihn gewissermaßen als ferngesteuerten Roboter zu verwenden. Als die Polizei den armen Kerl in die Ecke trieb, hatten die eigentlichen Täter die Bombe per Funk zur Explosion gebracht und ihn enthauptet, damit er nicht gegen sie aussagen konnte.
Die Strategie hatte allerdings einen Haken. In keiner Bank waren zwei Millionen Dollar in bar verfügbar, zumindest nicht in den Schubladen der Kassen und wahrscheinlich nicht einmal im Tresor.
Als zu Hause nur der Anrufbeantworter gelaufen war, hatte Mitch es auf Hollys Mobiltelefon versucht, sie dort aber auch nicht erreicht.
Zum Schluss hatte er noch bei der Immobilienfirma angerufen, wo sie als Sekretärin beschäftigt war, während sie auf ihre eigene Lizenz als Maklerin hinarbeitete.
»Die hat sich doch krankgemeldet«, hatte ihm Nancy Farasand, eine andere Sekretärin, erklärt. »Wusstest du das denn nicht?«
»Als ich heute Morgen aus dem Haus gegangen bin, war ihr ein wenig übel«, hatte er gelogen, »aber sie dachte, das geht schon vorüber.«
»War offenbar nicht so. Sie hat gesagt, es ist wohl eine Sommergrippe. Richtig enttäuscht hat sie sich angehört.«
»Dann rufe ich besser mal zu Hause an«, hatte er gesagt, obwohl das bereits erledigt war.
Dieses Gespräch hatte er nun schon vor über eineinhalb Stunden geführt, zwischen den beiden Befragungen durch die Polizei.
Uhrfedern entspannten sich, während die Zeit verging, doch Mitch fühlte sich mit jeder Minute angespannter. Es war, als würde gleich etwas in seinem Kopf platzen. Eine dicke Hummel umschwirrte ihn. Immer wieder kam sie summend herbei, vielleicht angezogen von seinem gelben T-Shirt.
Vor einem der Häuser auf der anderen Straßenseite standen zwei Frauen und ein Mann im Garten und beobachteten die Polizisten bei der Arbeit. Endlich war einmal etwas los. Die drei waren schon dort, seit die Sirenen sie herausgelockt hatten.
Zuvor war eine der Frauen ins Haus gegangen und mit einem Tablett wieder erschienen. Darauf standen Gläser mit einer dunklen Flüssigkeit, wahrscheinlich Eistee. Die Gläser funkelten im Sonnenlicht.
Schon vor einer ganzen Weile waren die Kriminalbeamten zu dem Trio gegangen, um es zu befragen. Das hatten sie nur einmal getan.
Nun standen die drei da, tranken und plauderten miteinander, als wären sie nicht weiter besorgt darüber, dass jemand, der in ihrem Viertel einen Spaziergang machte, von einem Heckenschützen umgelegt worden war. Sie schienen das Intermezzo als willkommene Abwechslung vom üblichen Einerlei zu genießen, obwohl es ein Leben gekostet hatte.
Mitch hatte den Eindruck, dass die drei mehr Zeit damit verbrachten, ihn zu beobachten statt die Polizisten und die Techniker von der Spurensicherung. Er fragte sich, ob die Kriminalbeamten sich wohl über ihn erkundigt hatten.
Kunden von Mitch waren die drei Nachbarn nicht. Allerdings hatten sie ihn bestimmt schon einmal gesehen, weil er sich in dieser Straße um vier Gärten kümmerte.
Er mochte diese Teetrinker nicht. Er hatte noch nie mit ihnen gesprochen und kannte nicht einmal ihre Namen, doch er betrachtete sie mit einer fast bitteren Abneigung.
Mitch hatte nichts gegen diese Leute, weil sie sich auf perverse Weise zu amüsieren schienen, und auch nicht, weil sie sich der Polizei gegenüber womöglich über ihn ausgelassen hatten. Seine Abneigung, die fast zum Abscheu zu werden drohte, rührte daher, dass ihr Leben noch in Ordnung war, weil sie nicht fürchten mussten, dass jemandem, den sie liebten, jederzeit Gewalt angetan werden konnte.
So irrational seine Feindseligkeit auch sein mochte, sie hatte einen gewissen Sinn. Schließlich lenkte sie ihn von seiner Angst um Holly ebenso ab wie die Tatsache, dass er unablässig darüber nachgrübelte, was das Verhalten der Kriminalbeamten zu bedeuten hatte.
Hätte er gewagt, sich der Sorge um seine Frau voll und ganz hinzugeben, dann wäre er zusammengebrochen. Das war keine Übertreibung. Er war überrascht, wie zerbrechlich er sich fühlte. So etwas hatte er noch nie verspürt.
Jedes Mal, wenn Hollys Gesicht ihm in den Sinn kam, musste er es bewusst verdrängen, weil seine Augen zu brennen begannen und er nicht mehr klar sah. Sein Herz verfiel in einen unheilvoll schweren Rhythmus.
Hätte er diese Emotionen zur Schau gestellt, die selbst für jemanden, der einen Mord mit angesehen hatte, völlig unangemessen waren, so hätte er sie erklären müssen. Er wagte es weder, die Wahrheit zu sagen, noch traute er es sich zu, eine Erklärung zu erfinden, mit der er die Cops überzeugen konnte.
Einer der beiden Beamten der Mordkommission, er hieß Mortonson, trug elegante Straßenschuhe, schwarze Slacks und ein hellblaues Hemd. Er war groß, stämmig und ganz geschäftsmäßig.
Der andere, ein Lieutenant Taggart, trug weiße Sneakers, eine legere Baumwollhose und ein rotbraunes Hawaiihemd. Er wirkte körperlich weniger einschüchternd als Mortonson und hatte auch einen weniger förmlichen Stil.
Dennoch brachte Mitch dem Lieutenant mehr Argwohn entgegen als seinem imposanteren Kollegen. Taggarts sauber geschnittenes Haar, die glatte Rasur, die perfekt glänzenden Zähne und die makellosen weißen Turnschuhe wiesen darauf hin, dass er sich bewusst lässig kleidete und locker gab, um die Verdächtigen, die das Pech hatten, ihm in die Finger zu kommen, zu täuschen und einzulullen.
Zuerst hatten die Beamten Mitch zu zweit befragt. Später war Taggart alleine wiedergekommen, angeblich, weil Mitch etwas »genauer erklären« sollte, was er vorher gesagt hatte. Tatsächlich hatte der Lieutenant jede Frage wiederholt, die er und Mortonson bereits gestellt hatten. Vielleicht hoffte er, dass Mitch sich in Widersprüche verwickelte.
Offiziell galt Mitch als Zeuge. Aus Sicht eines Cops jedoch zählte jeder Zeuge als Verdächtiger, solange der Mörder nicht identifiziert worden war.
Natürlich hatte Mitch keinerlei Grund, einen Fremden umzubringen, der gerade seinen Hund spazieren führte. Wären die beiden dennoch auf die völlig verrückte Idee gekommen, dass er das eventuell doch getan hatte, so hätten sie schließen müssen, Iggy sei sein Komplize. An dem hatten sie jedoch eindeutig kein Interesse.
Wahrscheinlich verhielt sich das Ganze völlig anders. Sie wussten zwar, dass Mitch mit dem Mord nichts zu tun hatte, doch ihr Instinkt sagte ihnen, dass er etwas vor ihnen verbarg.
Da kam Taggart schon wieder an. Seine Sneakers waren so weiß, als würden sie von sich aus leuchten.
Während der Lieutenant näher kam, stand Mitch auf, misstrauisch und krank vor Sorge. Gleichzeitig versuchte er allerdings, lediglich müde und ungeduldig auszusehen.
4
Detective Taggart trug eine Urlaubsbräune zur Schau, die zu seinem Hawaiihemd passte. Einen scharfen Kontrast dazu bildeten seine Zähne, die so weiß wie eine arktische Landschaft waren.
»Die ganzen Unannehmlichkeiten tun mir leid, Mr. Rafferty. Trotzdem muss ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen, aber danach können Sie gehen.«
Mitch hätte mit einem Achselzucken oder Nicken reagieren können. Er glaubte jedoch, einen merkwürdigen Eindruck zu hinterlassen, wenn er schwieg. Ein Mann, der nichts zu verbergen hatte, musste doch entgegenkommend sein.
Nach einem unglückseligen Zögern, das so lange dauerte, dass es bestimmt berechnend wirkte, sagte er: »Ich beklage mich nicht, Lieutenant. Schließlich hätte ja auch ich das Opfer sein können. Ich bin dankbar, dass ich noch am Leben bin.«
Der Beamte bemühte sich, lässig zu wirken, hatte jedoch die Augen eines Raubvogels. Scharf wie die eines Falken waren sie und kühn wie die eines Adlers. »Wieso sagen Sie das?«
»Na ja, wenn es eine willkürliche Tat war …«
»Das wissen wir ja nicht«, sagte Taggart. »Die Indizien weisen sogar auf kalte Berechnung hin. Ein perfekt gezielter Schuss.«
»Kann ein Irrer mit einer Flinte nicht ein geübter Schütze sein?«
»Doch, natürlich. Aber Irre wollen normalerweise ein möglichst großes Blutbad anrichten. Ein bewaffneter Psychopath hätte also auch Sie umgelegt. Dieser Kerl jedoch wusste genau, wen er erschießen wollte.«
So irrational es war – Mitch fühlte sich für den Tod irgendwie verantwortlich. Schließlich war der Mord begangen worden, um dafür zu sorgen, dass er die Kidnapper ernst nahm und sich nicht an die Polizei wandte.
Vielleicht hatte der Kriminalbeamte den Duft dieses unverdienten, aber dennoch beharrlichen Schuldgefühls wahrgenommen.
Mitch warf einen flüchtigen Blick auf die Leiche gegenüber, in deren Umgebung noch immer das Team der Spurensicherung beschäftigt war. »Wer ist das Opfer eigentlich?«, fragte er.
»Das wissen wir noch nicht. Er hatte keinen Ausweis dabei. Auch kein Portemonnaie. Finden Sie das nicht merkwürdig? «
»Wenn man bloß mal kurz mit dem Hund rausgeht, braucht man doch kein Portemonnaie.«
»Bei den meisten Leuten ist das reine Gewohnheit«, sagte Taggart. »Selbst wenn sie in der Einfahrt ihren Wagen waschen, haben sie ihr Portemonnaie dabei.«
»Wie wollen Sie ihn dann identifizieren?«
»Am Halsband des Hundes ist nicht mal eine Hundemarke. Allerdings ist das ein reinrassiger Golden Retriever, der fast bei einer Hundeschau auftreten könnte, also hat man ihm vielleicht einen Mikrochip mit den entsprechenden Informationen implantiert. Sobald wir uns ein Lesegerät besorgt haben, überprüfen wir das.«
Den Hund hatte man inzwischen auf den diesseitigen Gehsteig gebracht und seine Leine am Pfosten eines Briefkastens festgebunden. Dort lag er im Schatten und genoss gnädig die Aufmerksamkeit eines steten Stroms von Bewunderern.
Taggart lächelte. »Golden Retriever sind die besten. Ich hatte als Kind einen. Hab ihn total geliebt.«
Sein Blick richtete sich wieder auf Mitch. Das Lächeln blieb bestehen, veränderte sich jedoch. »Also, zurück zu den Fragen, von denen ich gesprochen habe. Waren Sie beim Militär?«
»Beim Militär? Nein. Anfangs hab ich für eine größere Firma auf dem Rasenmäher gesessen und andere Hilfsarbeiten gemacht, dann hab ich ein paar Gartenbaukurse besucht und mich ein Jahr nach der Highschool selbstständig gemacht.«
»Ich hab gedacht, Sie waren vielleicht mal Soldat, weil die Schüsse Sie nicht weiter aus der Fassung gebracht haben.«
»Oh, die haben mich schon aus der Fassung gebracht«, versicherte Mitch.
Taggarts direkter Blick sollte offenbar einschüchternd wirken.
Mitch hatte das Gefühl, seine eigenen Augen seien klare Linsen, durch die man seine Gedanken sehen konnte wie Bakterien unter dem Mikroskop. Am liebsten wäre er dem Blick des Beamten deshalb ausgewichen, merkte jedoch, dass er sich das nicht traute.
»Sie hören einen Schuss«, sagte Taggart, »sehen, wie ein Mann umfällt, und trotzdem laufen Sie über die Straße direkt in die Schusslinie.«
»Ich wusste ja nicht, ob er tot war. Vielleicht hätte ich etwas für ihn tun können.«
»Sehr anerkennenswert. Die meisten Leute wären schleunigst in Deckung gegangen.«
»Also, ein Held bin ich nicht. Es ist wohl einfach so, dass mein Instinkt meinen gesunden Menschenverstand außer Kraft gesetzt hat.«
»Vielleicht ist genau das ein Held — jemand, der instinktiv das Richtige tut.«
Mitch wagte es, den Blick von Taggart abzuwenden, weil er hoffte, dass sein Ausweichen in diesem Zusammenhang als Bescheidenheit interpretiert wurde. »Ich war bloß dämlich, Lieutenant, nicht tapfer. Mir ist gar nicht in den Sinn gekommen, ich könnte in Gefahr sein.«
»Wie – dachten Sie etwa, man hätte versehentlich auf diesen Mann geschossen?«
»Nein. Oder vielleicht doch. Keine Ahnung. Eigentlich hab ich gar nichts gedacht. Ich hab nicht gedacht, sondern einfach reagiert.«
»Und Sie hatten wirklich nicht das Gefühl, in Gefahr zu sein?«
»Nein.«
»Auch dann nicht, als Sie die Kopfwunde sahen?«
»Da wohl schon ein wenig. Vor allem wurde mir aber übel.«
Die Fragen kamen zu schnell. Mitch hatte das Gefühl, das innere Gleichgewicht zu verlieren. Wenn das so weiterging, ließ er es sich womöglich gleich anmerken, dass er wusste, wieso der Mann mit dem Hund umgebracht worden war.
Mit emsig summenden Flügeln kam die Hummel wieder angeflogen. An Taggart hatte sie kein Interesse, sondern schwebte vor Mitchs Gesicht in der Luft, als wollte sie seine Aussage bezeugen.
»Sie haben die Wunde im Kopf gesehen«, fuhr Taggart fort, »und sind trotzdem nicht in Deckung gegangen.«
»Nein.«
»Wieso nicht?«
»Ich hab wohl gedacht, wenn man bisher nicht auf mich geschossen hat, dann würde man das gar nicht tun.«
»Also hatten Sie immer noch nicht das Gefühl, in Gefahr zu sein.«
»Nein.«
Taggart klappte sein kleines Notizbuch auf. Es hatte eine Spiralbindung. »Sie haben der Frau in der Leitstelle gesagt, Sie seien tot.«
Verblüfft sah Mitch dem Beamten wieder in die Augen. »Ich hab gesagt, ich wäre tot?«
»Man hat auf einen Mann geschossen«, las Taggart aus seinem Notizbuch vor. »Ich bin tot. Ich meine, er ist tot. Man hat auf ihn geschossen, und jetzt ist er tot.«
»Habe ich das gesagt?«
»Ich hab mir die Aufnahme angehört. Sie waren atemlos. Völlig entsetzt haben Sie geklungen.«
Mitch hatte ganz vergessen, dass solche Anrufe aufgezeichnet wurden. »Ich hatte wohl größere Angst, als mir jetzt bewusst ist.«
»Offenbar haben Sie die Gefahr für sich also doch erkannt, sind aber trotzdem nicht in Deckung gegangen.«
Schon möglich, dass Taggart in der Lage war, einen Teil von Mitchs Gedanken zu erraten. Er jedoch war völlig undurchschaubar. Seine Augen leuchteten in einem warmen, doch geheimnisvollen Blau.
»Ich bin tot«, zitierte der Lieutenant noch einmal.
»Ein Versprecher. Vor Verwirrung, vor Panik.«
Taggarts Blick schweifte zu dem Hund hinüber, und wieder lächelte er. Mit sanfterer Stimme als bisher sagte er: »Gibt es vielleicht noch eine Frage, die ich Ihnen hätte stellen sollen? Irgendetwas, was Sie mir mitteilen möchten?«
In der Erinnerung hörte Mitch Hollys Schmerzensschrei.
Kidnapper drohten immer, ihre Geisel umzubringen, wenn man die Polizei informierte. Um zu gewinnen, musste man das Spiel nach ihren Regeln spielen.
Die örtliche Polizei würde das FBI hinzuziehen. Dort hatte man viel Erfahrung mit Entführungsfällen.
Weil Mitch keinerlei Möglichkeit hatte, zwei Millionen zusammenzubringen, zog man seine Geschichte bestimmt zuerst in Zweifel. Sobald sich die Kidnapper jedoch wieder meldeten, würde man ihm glauben.
Was, wenn kein zweiter Anruf kam? Wenn die Kidnapper merkten, dass Mitch sie verraten hatte, und daraufhin ihre Drohung wahr machten? Wenn sie Holly verstümmelten, umbrachten und nie wieder anriefen?
Dann kam man bei der Polizei womöglich auf die Idee, Mitch habe die Entführung nur erfunden, um zu verschleiern, dass Holly bereits tot war, weil er sie selbst umgebracht hatte. Schließlich war der Ehemann immer der Hauptverdächtige.
Wenn Mitch Holly verlor, dann war sowieso alles egal. Für immer und ewig. Keine Macht der Welt würde die Wunde heilen können, die das in seinem Leben hinterließ.
Aber wenn er in Verdacht geriet, ihr etwas angetan zu haben, dann würde das wie ein glühendes Schrapnell in dieser Wunde sein, das unablässig brannte und ihn versehrte.
Während Taggart das Notizbuch zuklappte und in die Hosentasche steckte, löste sich sein Blick von dem Hund und wandte sich wieder Mitch zu. »Nun, Mr. Rafferty?«
Irgendwann in den letzten Minuten war die Hummel weggeflogen. Erst jetzt merkte Mitch, dass ihr Summen nicht mehr zu hören war.
Wenn er das Geheimnis von Hollys Entführung für sich behielt, dann stand er den Kidnappern ganz allein gegenüber.
Allein taugte er nicht viel. Er war zusammen mit drei Schwestern und einem Bruder aufgewachsen, die alle innerhalb von sieben Jahren geboren waren. Sie hatten sich gegenseitig ihre Geheimnisse anvertraut, sich Ratschläge gegeben und einander verteidigt.
Ein Jahr nach seinem Highschoolabschluss war er von zu Hause ausgezogen, um sich zusammen mit einem Freund eine Wohnung zu mieten. Später war er dann in seine eigene Bude gezogen, wo er sich isoliert gefühlt hatte. Deshalb hatte er sechzig und mehr Stunden pro Woche gearbeitet, nur um nicht allein herumzusitzen.
Er hatte sich erst dann wieder vollständig, ausgefüllt und mit seiner Umgebung verbunden gefühlt, als Holly in sein Leben getreten war. Ich war ein kaltes Wort, wir hatte einen wärmeren Klang. Es schlüpfte sanfter ins Ohr.
Die Augen von Lieutenant Taggart sahen weniger furchterregend aus als bisher.
»Tja …«, sagte Mitch.
Der Kriminalbeamte leckte sich die Lippen.
Die Luft war warm und nicht besonders feucht. Auch Mitchs Lippen fühlten sich trocken an.
Dass die rosa Zunge seines Gegenübers erschienen und gleich wieder verschwunden war, kam Mitch regelrecht reptilienhaft vor. Es war, als hätte der Beamte im Geiste schon die Beute gekostet, die er gleich machen würde.
Die Vorstellung, ein Beamter der Mordkommission könnte mit Hollys Entführern unter einer Decke stecken, war ebenso irrsinnig wie paranoid. Aber wenn es doch so war, dann war dieses Zwiegespräch zwischen Zeuge und Ermittler in Wirklichkeit womöglich der letzte Test, ob Mitch bereit war, die Anweisungen der Kidnapper zu befolgen.
In Mitchs Kopf läuteten sämtliche Alarmglocken, die rationalen wie die irrationalen. Das Durcheinander aus wuchernden Ängsten und düsteren Ahnungen verhinderte jeden klaren Gedanken.
Wenn er Taggart die Wahrheit verriet, würde dieser womöglich das Gesicht verziehen und sagen: Jetzt müssen wir Ihre Frau töten, Mr. Rafferty. Wir können Ihnen nicht mehr vertrauen. Aber Sie dürfen wählen, was wir ihr zuerst abschneiden – die Finger oder die Ohren.
Wie vorher, als er vor dem Toten gestanden hatte, fühlte Mitch sich beobachtet, nicht nur von Taggart und den Tee trinkenden Nachbarn, sondern von jemandem, der unsichtbar blieb. Beobachtet und unter die Lupe genommen.
»Nein, Lieutenant«, sagte er. »Sonst gibt es nichts zu sagen.«
Der Beamte zog seine Sonnenbrille aus der Brusttasche und setzte sie auf.
Fast hätte Mitch das doppelte Spiegelbild seines Gesichts in den beiden Gläsern nicht erkannt. Deren Biegung verzerrte es so, dass es alt aussah.
»Ich habe Ihnen meine Visitenkarte gegeben«, erinnerte ihn Taggart.
»Ja, Sir. Die habe ich.«
»Rufen Sie mich an, wenn Ihnen etwas einfällt, was Sie für wichtig halten.«
Das glatte, ausdruckslose Glänzen der Brillengläser war wie der Blick eines Insekts: gefühllos, gierig, gefräßig.
»Sie kommen mir nervös vor, Mr. Rafferty«, sagte Taggart.
Mitch hob die Hände, um zu zeigen, wie sehr sie zitterten. »Nicht nervös, Lieutenant. Erschüttert. Schwer erschüttert. «
Taggart leckte sich erneut die Lippen.
»Ich hab noch nie gesehen, wie ein Mann ermordet wurde«, sagte Mitch.
»Daran gewöhnt man sich nicht«, sagte der Beamte.
Mitch ließ die Hände sinken. »Kann ich mir vorstellen.«
»Noch schlimmer ist es, wenn es sich um eine Frau handelt. «
Was Mitch mit dieser Aussage anfangen sollte, wusste er nicht recht. Vielleicht bezog sie sich einfach nur auf das, was man empfand, wenn man ständig mit Morden zu tun hatte, vielleicht war es auch eine Drohung.
»Eine Frau oder ein Kind«, fuhr Taggart fort.
»Ihren Beruf möchte ich nicht haben.«
»Nein. Bestimmt nicht.« Der Lieutenant wandte sich ab. »Wir sehen uns, Mr. Rafferty.«
»Wir sehen uns?«
Taggart drehte sich noch einmal zu ihm um. »Sie und ich, wir werden beide eines Tages als Zeugen im Gerichtssaal sitzen.«
»Sieht ganz so aus, als wäre das ein schwieriger Fall.«
»Blut schreit zu mir von der Erde, Mr. Rafferty«, sagte der Beamte. Das war offenbar ein Zitat. »Blut schreit zu mir von der Erde.«
Mitch sah Taggart davongehen.
Dann blickte er auf das Gras unter seinen Füßen.
Die Sonne war weitergezogen, wodurch der Schatten der Palmwedel nun hinter ihm lag. Er stand im Licht, ohne davon gewärmt zu werden.
5
Die Uhr am Armaturenbrett war ebenso digital wie die an Mitchs Handgelenk, und doch konnte er die Zeit ticken hören, so rasch wie das Klick-klick-klick des Dorns, der im Kasino an die Metallstifte eines Glücksrads schnappte.
Am liebsten wäre er vom Ort des Mordes sofort nach Hause gerast. Logischerweise war Holly von dort entführt worden. Bestimmt hatte man sie nicht auf dem Weg zur Arbeit, mitten auf einer öffentlichen Straße, überfallen.
Vielleicht hatten die Täter versehentlich etwas hinterlassen, das auf ihre Identität hindeutete. Wahrscheinlicher war jedoch, dass sie eine Botschaft für ihn hinterlassen hatten, die weitere Anweisungen enthielt.
Wie üblich hatte Mitch seinen Arbeitstag damit begonnen, indem er Iggy von dessen Wohnung in Santa Ana abgeholt hatte. Nun musste er ihn auch zurückbringen.
Während sie von den mondänen, wohlhabenden Villenvierteln an der Küste von Orange County nach Norden zu ihrer bescheideneren Wohngegend fuhren, bog Mitch von der überfüllten Autobahn auf die Landstraße ab. Dort war allerdings auch viel Verkehr.
Iggy wollte über den Mord und die Aktivitäten der Polizei sprechen. Dabei musste Mitch so tun, als wäre er ebenso aufgeregt über die Ereignisse wie sein Beifahrer, während er in Wirklichkeit ständig an Holly dachte und darüber nachgrübelte, was ihn als Nächstes erwartete.
Glücklicherweise nahm das Gespräch mit Iggy wie üblich bald so viele Drehungen und Wendungen wie ein Wollknäuel, den ein Kätzchen über den Boden rollte.
Sich scheinbar für dieses weitschweifige Geplauder zu interessieren, fiel Mitch weniger schwer, als über den toten Hundebesitzer zu sprechen.
»Mein Cousin Louis hatte einen Freund namens Booger«, sagte Iggy. »Dem ist dasselbe passiert. Man hat auf ihn geballert, als er mit dem Hund auf die Straße ging, bloß war es keine Flinte, und es war auch kein Hund.«
»Booger?«, wiederholte Mitch fragend.
»Booker«, stellte Iggy richtig. »B-o-o-k-e-r. Er hatte eine Katze, die er Wuschel getauft hatte. Mit der ist er rausgegangen, und dabei hat man auf ihn geschossen.«
»Seit wann geht man mit Katzen Gassi?«
»Von Gassi gehen hab ich nichts gesagt. Wuschel saß bequem in einem Transportkäfig, weil Booker sie zum Tierarzt bringen wollte.«
Mitch schaute ständig in Rück- und Seitenspiegel. Ein eleganter schwarzer Geländewagen, wohl ein Cadillac, war hinter ihnen von der Autobahn abgebogen. Seither fuhr er ständig hinter ihnen her.
»Dann war das also ganz was anderes«, sagte Mitch.
»Wieso? Er ist mit der Katze die Straße entlanggegangen, und da hat ein zwölfjähriges Bürschlein, so ein richtiger Rotzlümmel, mit einer Paintballpistole auf ihn geballert. «
»Also hat man ihn nicht umgebracht.«
»Hab ich auch nicht behauptet. Außerdem war es ’ne Katze und kein Hund, aber Booker war total blau.«
»Blau?«
»Blaues Haar, blaues Gesicht. Mann, war der sauer!«
Der Cadillac fuhr weiterhin mit zwei oder drei Fahrzeuglängen Abstand hinter ihnen. Vielleicht hoffte der Fahrer, dass Mitch ihn nicht bemerkte.
»Dann war Booker also blau«, sagte Mitch. »Was ist aus dem Bürschlein geworden?«
»Dem kleinen Scheißer wollte Booker eins überziehen, aber da hat der ihm genau zwischen die Beine geschossen und ist weggerannt. He, Mitch, wusstest du, dass es in Schottland nur blaue Ostereier gibt?«
»Nie gehört.«
»Die sind eben sparsam, die Schotten. Tragen bekanntlich auch keine Unterhosen unterm Rock.«
Mitch trat aufs Gas, um eine Kreuzung zu überqueren, kurz bevor die Ampel auf Rot umsprang. Hinter ihm wechselte der schwarze Wagen die Spur, beschleunigte und schaffte es ebenfalls noch bei Gelb.
»Kennst du eigentlich dieses schottische Gebäck?«, fragte Iggy. »Shortbread heißt das.«
»Nee. Hab ich noch nie gegessen.«
»Da ist massenhaft Butter drin, und außerdem ist es süßer als Jennifer Aniston. Ganz schön verführerisch, Kumpel.«
Der Cadillac ließ sich zurückfallen und scherte erneut in Mitchs Fahrspur ein. Nun waren wieder zwei andere Autos dazwischen.
»Earl Potter hat ein Bein verloren, weil er zu viel Gebäck gefuttert hat.«
»Earl Potter?«
»Der Vater von Tim Potter. Der war Diabetiker, hatte aber keine Ahnung davon und hat jeden Tag eine Riesenschachtel Kekse verdrückt. Sag mal, diese dänischen Kekse kennst du aber, oder?«
»Wie war das mit dem Bein von Earl?«, fragte Mitch.
»Echt ätzend, Mann. Eines Tages war sein Fuß taub, und er konnte nicht mehr richtig gehen. Da hat sich rausgestellt, dass da unten wegen dem Diabetes fast kein Blut mehr hinkam. Worauf man ihm gleich das linke Bein abgesägt hat, oberhalb vom Knie.«
»Während er Kekse gefuttert hat.«
»Nein. Ihm war schon klar geworden, dass er mit dem Süßkram aufhören musste.«
»Gut für ihn.«
»Deshalb hat er am Tag vor der Operation die letzte Schachtel Kekse gemampft. Zum Abschied war es ’ne Sorte mit extra viel Zucker obendrauf. Sag mal, hast du eigentlich diesen heißen Film gesehen, in dem Jennifer Aniston nackt unter der Dusche steht?«
So kamen sie auf dem Umweg über Wuschel, blaue Eier, Schottland, Kekse und Jennifer Aniston zu dem Wohnblock, in dem Iggy hauste.
Mitch hielt am Bordstein, und der schwarze Cadillac fuhr vorbei, ohne langsamer zu werden. Die Seitenfenster waren getönt, weshalb weder der Fahrer noch irgendwelche anderen Insassen erkennbar waren.
Iggy stieß die Tür auf, doch bevor er ausstieg, fragte er: »Alles in Ordnung, Chef?«
»Klar.«
»Du siehst ziemlich erledigt aus.«
»Ich hab gesehen, wie jemand erschossen wurde«, rief Mitch in Erinnerung.
»Stimmt. Krasse Sache, was? Rat mal, wer heute Abend im Rolling Thunder Furore macht! Meine Wenigkeit. Vielleicht solltest du auch mal vorbeischauen.«
»Reservier mir lieber keinen Hocker an der Bar.«
Der Cadillac fuhr Richtung Westen. Die Nachmittagssonne übergoss das verdächtige Fahrzeug mit einem schimmernden Glanz. Es leuchtete so grell, dass es im Maul der Sonne zu verschwinden schien.
Iggy stieg endlich aus, steckte noch einmal den Kopf herein und zog ein trauriges Gesicht. »Du liegst echt an der Kette, Mann.«
»Nein, ich hab Wind unter den Flügeln.«
»Puh. Was ’n blöder Spruch.«
»Geh nur und lass dich volllaufen.«
»Ich hab tatsächlich vor, ein klein wenig über den Durst zu trinken«, erklärte Iggy. »Und dir verschreibt Dr. Ig auch mindestens einen Sechserpack Cerveza. Sag Mrs. Mitch, sie ist ein wirklich heißer Feger.«
Iggy schlug die Tür zu und stapfte davon, groß und treu und lieb und ahnungslos.
Mit Händen, die plötzlich auf dem Lenkrad zitterten, lenkte Mitch den Wagen auf die Fahrbahn.
Auf der Fahrt hierher hatte er ungeduldig darauf gewartet, dass er Iggy loswurde, um rasch nach Hause zu kommen. Nun drehte sich ihm fast der Magen um, wenn er darüber nachdachte, was ihn dort womöglich erwartete.
Am meisten fürchtete er, Blut zu finden.
6
Mitch fuhr mit offenen Fenstern, weil er die Geräusche auf der Straße hören wollte. Sie waren ein Beweis dafür, dass das Leben weiterging.
Der schwarze Cadillac tauchte nicht wieder auf. Auch kein anderes Fahrzeug übernahm die Verfolgung. Offenbar hatte er mit seinem Verdacht schiefgelegen.
Allmählich verschwand das Gefühl, unter Beobachtung zu stehen. Von Zeit zu Zeit fiel sein Blick zwar noch in den Rückspiegel, aber nicht mehr mit der Erwartung, etwas Verdächtiges zu sehen.
Er fühlte sich allein, ja schlimmer als allein. Isoliert. Fast wünschte er sich, der schwarze Wagen würde wieder auftauchen.
Sein Haus stand in einem älteren Viertel von Orange, einem der ältesten Orte im County. Wenn er in seine Straße einbog, war es immer wie ein Zeitsprung zurück in die Mitte der Vierzigerjahre. Nur das Baujahr der am Straßenrand geparkten Autos passte nicht.
Der mit blassgelben Brettern verschalte Bungalow hatte weiße Fensterrahmen und ein Dach aus Zedernschindeln. Er stand hinter einem Lattenzaun, über den sich Rosen rankten. Manche der Nachbarhäuser waren größer und manche waren hübscher, aber keines besaß einen schöneren Garten.
Er parkte in der Einfahrt neben dem Haus unter einem großen, alten Pfefferbaum und trat in einen atemlosen Nachmittag.
Gehsteige und Gärten waren verlassen. In dieser Nachbarschaft kamen die meisten Familien nicht mit einem Einkommen aus; alle waren bei der Arbeit. Da es erst kurz nach drei war, waren auch noch keine Schlüsselkinder von der Schule heimgekommen.
Keine Haushaltshilfen, keine Fensterputzer, kein Gartenpflegedienst, der mit einem Laubbläser lautstark Wind machte. Die Hausbesitzer hier legten selbst Hand an, wenn es darum ging, den Teppichboden zu saugen oder den Rasen zu mähen.
Der Pfefferbaum flocht den Sonnenschein in seine üppig herabhängenden Zweige und übergoss den schattigen Gehsteig mit elliptischen Splittern aus Licht.
Mitch öffnete ein Seitentor im Lattenzaun. Über den Rasen ging er zur Vordertreppe.
Die Veranda war breit und kühl. Weiße Korbstühle mit grünen Kissen standen neben kleinen Korbtischen mit Glasplatte.
Am Sonntagnachmittag saßen er und Holly oft hier, um sich zu unterhalten, die Zeitung zu lesen und zuzuschauen, wie Kolibris an den Trompetenwinden, die sich um die Verandapfosten rankten, von einer purpurroten Blüte zur anderen flitzten.
Manchmal klappten sie zwischen den Korbsesseln einen Kartentisch auf. Beim Scrabble war Holly unschlagbar, während Mitch bei den Quizspielen dominierte.
Für sogenannte Freizeitaktivitäten gaben sie nicht viel aus. Kein Skiurlaub, kein Wochenende am Strand von Baja California. Selbst ins Kino gingen sie nur selten. Zusammen auf der Veranda zu sitzen, machte ihnen so viel Vergnügen, wie zusammen in Paris zu sein.
Sie sparten Geld für Dinge, die ihnen wichtig waren. Damit Holly es riskieren konnte, sich von der Sekretärin zur Immobilienmaklerin zu entwickeln. Damit er ein wenig Werbung machen, einen zweiten Pritschenwagen kaufen und sein Geschäft ausbauen konnte.
Auch für Kinder. Sie wollten Kinder haben. Zwei oder drei. An bestimmten Feiertagen, wenn sie besonders sentimental wurden, kamen ihnen selbst vier nicht übertrieben vor.
Sie wollten nicht die Welt für sich allein, und sie wollten sie auch nicht verändern. Was sie wollten, waren ihr kleiner Winkel der Welt und die Chance, diesen mit Kinderlachen zu füllen.
Vorsichtig drehte Mitch am Knauf der Haustür. Nicht abgeschlossen. Er drückte die Tür auf und zögerte auf der Schwelle.
Als er einen raschen Blick zurück zur Straße warf, hätte es ihn nicht gewundert, den schwarzen Cadillac zu sehen. Der war jedoch nicht da.
Nachdem er ins Haus getreten war, blieb er stehen, damit seine Augen sich aufs Dunkel einstellen konnten. Das Wohnzimmer wurde nur vom Sonnenlicht erhellt, das zwischen den Ästen der Bäume hindurch in die Fenster fiel.
Alles sah aus, als wäre es völlig in Ordnung. Er konnte keinerlei Anzeichen eines Kampfs erkennen.
Mitch schloss die Tür hinter sich. Einen Augenblick lang musste er sich daranlehnen.
Wäre Holly zu Hause gewesen, dann hätte er Musik gehört. Sie mochte Bigbandjazz. Miller, Goodman, Ellington, Shaw. Die Musik der Vierziger, meinte sie, würde zum Haus passen. Zu ihr passte sie auch. Klassisch.
Ein Bogen verband das Wohnzimmer mit dem kleinen Esszimmer. Auch hier war nichts anders als sonst.
Auf dem Tisch lag ein großer toter Nachtfalter. Er war grau und hatte ein schwarzes Muster auf den geschwungenen Flügeln.
Der Falter musste am vorigen Abend hereingekommen sein. Sie hatten eine Weile auf der Veranda gesessen und dabei die Tür offen gelassen.
Ob das Tier wohl noch lebte und nur schlief? Wenn er es behutsam in die hohlen Hände nahm und ins Freie brachte, flog es vielleicht unter eine Ecke des Verandadachs, um dort auf den Mondaufgang zu warten.
Er zögerte. Es widerstrebte ihm, den Falter anzufassen, weil er Angst hatte, dass die Flügel nicht mehr flattern würden. Womöglich löste das Ding sich bei der Berührung in eine Art fettigen Staub auf, wie es Nachtfalter manchmal taten.
Am Ende ließ er das Insekt einfach liegen, weil er glauben wollte, dass es noch am Leben war.
Die Tür zwischen Esszimmer und Küche stand einen Spaltbreit offen. Dahinter brannte Licht.
Der Geruch von verbranntem Toast hing in der Luft. Er wurde stärker, als Mitch sich durch die Tür in die Küche schob.
Hier fand er Anzeichen eines Kampfs. Einer der Stühle in der Essecke war umgestürzt, der Boden mit den Scherben zerbrochener Teller übersät.
Zwei Scheiben geschwärztes Brot lugten aus dem Toaster. Jemand hatte den Stecker gezogen. Die Butter war auf der Küchentheke stehen geblieben und weich geworden, als es wärmer wurde.
Offenbar waren die Eindringlinge durch die Haustür gekommen und hatten Holly überrascht, als sie sich gerade Toast machte.
Die Schränke waren glänzend weiß lackiert. Auf einer Tür und zwei Schubladenfronten sah Mitch Blutspritzer.
Einen Moment schloss er die Augen. Im Geiste sah er den Falter flattern und vom Tisch wegfliegen. Auch in seiner Brust flatterte etwas, und er wollte glauben, dass es Hoffnung war.
Auf dem weißen Kühlschrank schrie der blutige Abdruck einer Frauenhand so laut um Hilfe wie eine grelle Stimme. An zwei Hängeschränken fanden sich weitere Handabdrücke, ein ganzer und ein halber, der verschmiert war.
Auch die Terrakottafliesen auf dem Boden waren mit Blut bespritzt. Es schien eine Menge Blut zu sein. Mitch kam es wie ein Ozean vor.