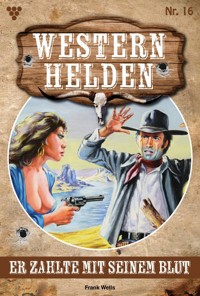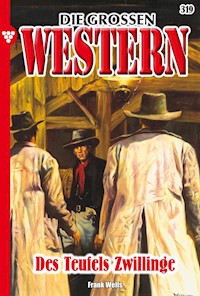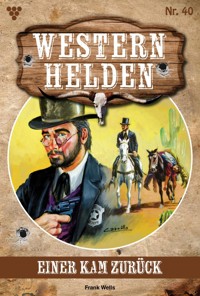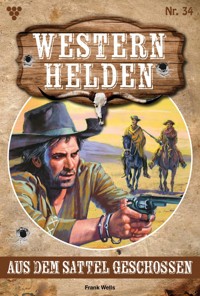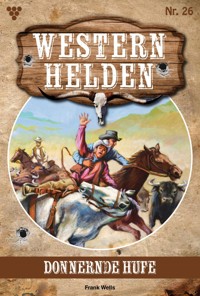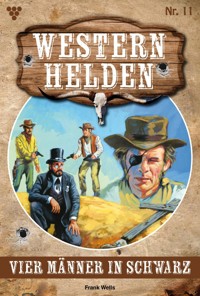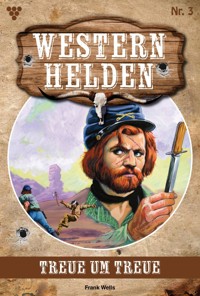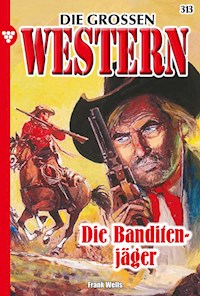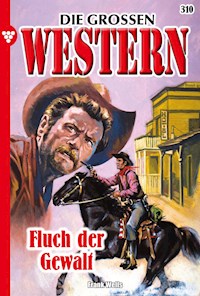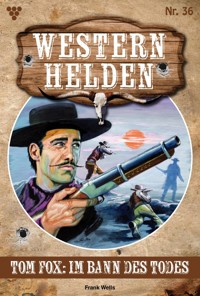
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Helden
- Sprache: Deutsch
Western Helden – Die neue Reihe für echte Western-Fans! Harte Männer, wilde Landschaften und erbarmungslose Duelle – hier entscheidet Mut über Leben und Tod. Ob Revolverhelden, Gesetzlose oder einsame Reiter auf der Suche nach Gerechtigkeit – jede Geschichte steckt voller Spannung, Abenteuer und wilder Freiheit. Erlebe die ungeschönte Wahrheit über den Wilden Westen An einem eisigen Wintertag, morgens um elf Uhr, sah Jack Steele den Armeescout Nick Shiro zum letzten Male. Später glaubte er, es wäre zum letzten Male in seinem Leben gewesen, und es sprach auch alles dafür, dass Nick Shiro genauso den Tod gefunden hatte wie die zwanzig Soldaten, die jetzt zu dieser Morgenstunde noch gesund und munter hinter dem Oberleutnant Jack Steele ritten. Wie gesagt, es war genau elf Uhr, als Nick Shiro in stiebendem Galopp einen Hügel herabgejagt kam. Der knietiefe Schnee wolkte hochauf, und Nick Shiros dampfender Mustang brach fast in die Knie, als er vor Jack Steele zum Stehen kam. »Was gibts?«, fragte Jack knapp. Nick Shiro sah wirklich aufgeregt aus, und das war bei diesem kaltschnäuzigen Mann eine Art Wunder. Er deutete in die Richtung, aus der er gekommen war, und sagte heiser: »Die Roten! Da vorn sind sie. Sie haben einen Siedlertreck in der Zange!« Oberleutnant Jack Steele schüttelte ungläubig den Kopf. Er hielt diese ganze Patrouille mitten im harten Winter für eine verrückte Idee. Jack wollte schon am frühen Morgen den Befehl zum Rückmarsch ins Fort geben, aber er musste abwarten, was der letzte Erkundungsritt des Scouts brachte. Und nun kam er mit dieser Nachricht. Sie klang unglaublich. Die Sioux mitten im Winter und ohne jeden Grund? In diesem Augenblick jedoch durfte Jack Steele die Meldung des Scouts Nick Shiro nicht anzweifeln – einerlei, wie sein persönliches Verhältnis zu Shiro war. Er überlegte, dass er von der Kuppe des nächsten Hügels vielleicht schon einen genaueren Überblick über die Lage bekommen würde – und er gab den Befehl zum Vormarsch. »Well«, grunzte Nick Shiro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Western Helden – 36 –Tom Fox: Im Bann des Todes
Frank Wells
An einem eisigen Wintertag, morgens um elf Uhr, sah Jack Steele den Armeescout Nick Shiro zum letzten Male. Später glaubte er, es wäre zum letzten Male in seinem Leben gewesen, und es sprach auch alles dafür, dass Nick Shiro genauso den Tod gefunden hatte wie die zwanzig Soldaten, die jetzt zu dieser Morgenstunde noch gesund und munter hinter dem Oberleutnant Jack Steele ritten.
Wie gesagt, es war genau elf Uhr, als Nick Shiro in stiebendem Galopp einen Hügel herabgejagt kam. Der knietiefe Schnee wolkte hochauf, und Nick Shiros dampfender Mustang brach fast in die Knie, als er vor Jack Steele zum Stehen kam.
»Was gibts?«, fragte Jack knapp.
Nick Shiro sah wirklich aufgeregt aus, und das war bei diesem kaltschnäuzigen Mann eine Art Wunder. Er deutete in die Richtung, aus der er gekommen war, und sagte heiser: »Die Roten! Da vorn sind sie. Sie haben einen Siedlertreck in der Zange!«
Oberleutnant Jack Steele schüttelte ungläubig den Kopf. Er hielt diese ganze Patrouille mitten im harten Winter für eine verrückte Idee.
Jack wollte schon am frühen Morgen den Befehl zum Rückmarsch ins Fort geben, aber er musste abwarten, was der letzte Erkundungsritt des Scouts brachte.
Und nun kam er mit dieser Nachricht.
Sie klang unglaublich. Die Sioux mitten im Winter und ohne jeden Grund?
In diesem Augenblick jedoch durfte Jack Steele die Meldung des Scouts Nick Shiro nicht anzweifeln – einerlei, wie sein persönliches Verhältnis zu Shiro war. Er überlegte, dass er von der Kuppe des nächsten Hügels vielleicht schon einen genaueren Überblick über die Lage bekommen würde – und er gab den Befehl zum Vormarsch.
»Well«, grunzte Nick Shiro. »Ich werde mich auf die Socken machen. Ich versuche, in die Flanke der Roten zu kommen. Vielleicht kann ich rauskriegen, wie viele es sind.«
Shiro riss seinen Mustang herum und jagte schräg den Seitenhang hinauf. Jack Steele sah ihn noch einmal auf der Kuppe des Hügels – dann entschwand der Scout für immer seinen Blicken. Für immer – so glaubte er. Aber das Schicksal hielt nicht nur an diesem Tage einige unfreundliche Überraschungen für ihn und seine Männer bereit. Das Schicksal, das an diesem Tage Tod hieß …
*
Es sah ganz einfach aus, da oben von der Kuppe des Hügels. Einzelne Schüsse hallten zu ihnen noch herauf, aber von den Indianern war im Augenblick nichts mehr zu sehen. Der Siedlertreck hatte seine Wagen unmittelbar unterhalb einer Felswand zur Burg zusammengefahren, und bis zur Wagenburg hin verengte sich eine zunächst noch breite Schlucht zu einem engen, schmalen Canyon, Sergeant Kimball hielt neben Jack Steele und schaute auf das im Augenblick sehr friedliche Bild. Friedlich bis auf den brennenden Wagen und die vereinzelten Schüsse. Worauf die Verteidiger der Wagenburg schossen, war nicht zu erkennen.
»Diese Idioten haben sich in eine wunderbare Mausefalle gesetzt!«, knurrte der Sergeant. »Ich wette jeden Betrag, dass die Rothäute jetzt wie die Bergziegen die Felsen raufturnen und dann von oben in die Burg schießen.«
»Yeah«, nickte Jack Steele. »Sonst müsste man ja wenigstens einen Indianer sehen. Ich denke, wir kommen gerade rechtzeitig.«
Er hob die Hand, und in stiebendem Galopp jagte die Patrouille in die Schlucht hinein, die man später die Todesschlucht nennen würde. Später? Nein, von diesem Tage an!
Oberleutnant Jack Steele ließ seine Männer breit auseinandergezogen reiten, mit starken Stoßkeilen zu beiden Flanken. Denn wenn ein plötzlicher Überfall der Roten erfolgte, so konnte er nur von rechts oder links kommen.
Noch fünfzig Pferdelängen bis zur Wagenburg. Jack Steele sah deutlich die Gewehrläufe der Verteidiger blinken, doch dafür hatte er kaum ein Auge. Er beobachtete nach rechts und vor allem nach vorn auf die zerklüftete Felswand. Immer noch hatte er, keine Rothaut zu Gesicht bekommen. Noch vierzig Längen, dann waren die Siedler da vorn in Sicherheit …
Und da geschah es! Es geschah so plötzlich, so überraschend und durch nichts vorherzusehen, dass Jack Steele es nie im Leben vergessen konnte. Diese eine entscheidende Sekunde, die sein ganzes Leben vernichtete, seine Zukunft, seine Karriere. Die Sekunde, in der die Wagenburg Feuer und Blei spie, in der mindestens dreißig Gewehre und Colts aufbrüllten – in der die braven Männer hinter Jack Steele einfach niedergemäht wurden.
Die Sichel des Todes mähte mit entsetzlicher Genauigkeit. Die erste Salve riss die Front der Lanzenreiter mitten auseinander, zersplitterte sie, warf fast die Hälfte der Männer in den Schnee und in den Tod. Und schon brüllte die zweite Salve.
Jack Steele spürte den schmetternden Schlag, der ihm den Säbel aus der Hand riss. Er hörte zwischen den brüllenden Detonationen der Schüsse die Schreie seiner Jungens, hörte den Sergeanten Hardy Kimball fluchen und dann aufbrüllen – dann wusste er nichts mehr. Er spürte weder den Sturz vom Pferd, noch wusste er, was sonst noch geschah.
*
Die Kälte weckte ihn und der Schmerz. Es war Nacht. Um ihn nichts als Stille. Eine Stille, die nur vom Heulen hungriger Wölfe durchtönt wurde. Irgendetwas drückte mit Zentnerlast auf Jacks Brust. Ein Mann – Sergeant Kimball. Er war tot wie alle anderen. So dachte Jack Steele.
Von der Wagenburg kam der beißende Rauch des Feuers herübergetrieben. Alle Wagen waren verbrannt worden. Nichts mehr deutete darauf hin, dass dort Menschen im Hinterhalt gelegen und gemordet hatten. Was für Menschen? Weiße? Rote?
Vergeblich marterte Jack Steele seinen Kopf. Er wusste es nicht. Die Erinnerung war einfach ausgelöscht. Und was noch schlimmer war: Er als einziger hatte keine nennenswerte Verletzung davongetragen. Nichts als eine Schramme an der rechten Hand und eine dicke Beule am Kopf.
Erschöpft stolperte Jack von einem seiner Männer zum anderen. Sie waren tot, alle, ohne Ausnahme. Und der Schnee, der sachte aus dem schwarzen Wolkenvorhang rieselte, deckte sie milde zu. Zwanzig Männer, junge, starke Burschen, deren Leben erst beginnen sollte – tot.
Zuletzt beugte er sich noch einmal über den Sergeanten. Und fast hätte er aufgeschrien, als er ein Streichholz anriss– denn Hardy Kimballs Augen schauten ihn groß an. Und die blaugefrorenen Lippen flüsterten: »Ist dies die Hölle? Dann ist sie aber verdammt kalt!«
In fieberhafter Eile verband Jack Steele die Wunden des Sergeanten. Ein Fünkchen neuen Lebensmutes glomm in ihm auf. Wenigstens einer, der es überlebt hatte! Er würde Kimball zum Fort bringen und mit einer neuen Patrouille wieder losziehen! Er würde den Tod seiner Männer rächen.
Aber es kam anders, ganz anders. Was fragten die strengen Offiziere des Kriegsgerichtes danach, dass der Oberleutnant Jack Steele den schwerverwundeten Sergeanten Hardy Kimball in drei Tagen und drei Nächten durch einen brüllenden Schneesturm auf einem halblahmen Pferd nach Fort Kelton gebracht hatte? Es zählte nicht. Nichts zählte als die Tatsache, dass zwanzig Soldaten den Tod gefunden hatten – auf Befehl und unter Verantwortung des Oberleutnants Jack Steele …
*
Das Kriegsgericht trat zwei Wochen nach der Rückkehr des Oberleutnants zusammen. Er wurde aus der Zelle vorgeführt. Man verlas die Aussage des Sergeanten Hardy Kimball. Sie war unbedeutend, denn Hardy Kimball hatte genauso wenig eine Erinnerung an das Geschehen wie Jack Steele selbst. Eine Patrouille, die zu der Schlucht des Todes geritten war, hatte keine Spuren gefunden – hatte nichts tun können, als die Toten der Erde zu übergeben.
Es wurde ein kurzes Gerichtsverfahren. Fragen hämmerten auf Jack Steele ein, doch er konnte nur immer wieder antworten: »Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir einen Siedlertreck befreien wollten – und dann hat es geschossen.«
Der Ankläger, ein alter Major, stellte den Strafantrag wegen erwiesener Schuld des Angeklagten, Oberleutnants Jack Steele. Es sei ihm zumindest sträflicher Leichtsinn und grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen. Wenn zwanzig kampferprobte Soldaten zusammengeschossen wurden, so könne es nur an der Führung liegen. Und es müsse sogar befürchtet und angenommen werden, dass Verrat vorliege.
»Ich beantrage deshalb«, schloss der Ankläger, »das höchstmögliche Strafmaß! Der Oberleutnant Jack Steele ist aus der Armee auszustoßen und mit einer Strafhaft von zehn Jahren zu verurteilen!«
Jack Steele hörte das wie versteinert an. Er sah die harten unpersönlichen Gesichter. Selbst Colonel Hardin, sein Kommandeur, schaute starr an Jack vorbei. Und Colonel Hardin hatte immer große Stücke auf Jack gehalten … und Colonel Hardings Tochter Yvonne war so gut wie verlobt mit Jack.
Das Urteil wurde gesprochen. Es folgte dem Antrag des Anklägers. Es gab keinen Oberleutnant Jack Steele mehr. Es gab nur noch den Strafgefangenen Steele – eine Nummer im Sträflingsanzug. Für zehn Jahre …
*
Yvonne Hardin sah Jack Steele zum letzten Male an jenem Tag, an dem er unter starker Bedeckung von Fort Kelton ins Zuchthaus überführt wurde. Sie stand bei der Wache. Ihr Gesicht war verkrampft. Sie bemühte sich um eine stolze Haltung – aber als sie Jacks Gesicht sah, machte sie plötzlich kehrt und rannte wie von Furien gehetzt davon.
Jack schaute ihr nicht nach. Er war eigentlich froh, dass sie ihn nicht in der Zelle besucht hatte. Es wäre alles nur noch schwerer geworden. Jetzt lag das Schlimmste hinter ihm. Das Schicksal hatte ihn geschlagen – aber er lebte. Sie hatten ihn schuldig gesprochen – aber er wusste, dass er unschuldig war. Es hatte eine Stunde gegeben, in der er am liebsten Schluss gemacht hätte. Eine Stunde völliger Verzweiflung. Er hatte seinen besten Freund, den Captain Oliver Gilroy, gebeten, ihm einen Revolver zu verschaffen. Oliver hatte nur den Kopf geschüttelt.
Und jetzt ritt Captain Gilroy an der Spitze der fünf Soldaten, die den Verurteilten Jack Steele in die Gefangenschaft führten.
Sie ritten an diesem Tage zwanzig Meilen und sattelten am hohen Ufer des eisigen Snake River. Die erste Vorahnung des Vorfrühlings zog durch das Land. Noch war alles tief verschneit, aber die Sonne hatte schon Kraft genug, die Schneedecke abzutauen.
Sie hockten am Feuer und wärmten sich. Jack Steele war nicht gefesselt. Wie hätte er auch fliehen sollen? Der Posten vor Gewehr würde ihn mit dem ersten Schuss treffen. Und selbst wenn er weglaufen konnte – wohin denn? In die frostklirrende Nacht? In eine Wildnis ohne menschliches Leben? Nein, unmöglich!
Nun, Jack Steeles Grundsatz war der, dass es nur wenige Dinge gab, die wirklich unmöglich waren. Wenn er erst hinter Gittern und meterdicken Gefängnismauern hockte, war es für zehn Jahre zu spät.
Jack Steele hatte den Lagerplatz sehr genau betrachtet. Er war nicht günstig, so schien es. Der Fluss umspülte auf drei Seiten den Felsvorsprung, auf dem sie lagerten. Auf der vierten Seite stand der Posten mit dem Gewehr im Arm. Er stand genau in Jacks Rücken. Mochte Captain Gilroy auch Jacks Freund gewesen sein – jetzt führte er einen Befehl aus, und da gab es keine Freundschaft mehr.
Sie aßen, und plötzlich sagte Jack mit einer ruhigen Stimme: »Ich wundere mich, dass ihr mich mit am Feuer sitzen lasst. Warum teilt ihr eure Ration mit mir – einem Verräter! Ich bin doch ein Verräter, Oliver?«
Captain Gilroy schüttelte langsam den Kopf. »Es ist hier nicht die Zeit und nicht der Ort, über das alles zu sprechen. Es tut mir leid, Jack, dass es so gekommen ist. Es spielt keine Rolle, was ich darüber denke. Vielleicht werden wir die Wahrheit nie erfahren – aber ich glaube nicht, dass du ein Verräter bist!«
»Danke. Also nur ein Versager. Ein Mann, der zwanzig brave Kerle in den Tod gehetzt hat. Well – Ich hoffe, dass ich eines Tages die richtige Antwort finden werde.«
»Ja, Jack. Wir alle hoffen es. Nur fürchte ich, dass du keine Gelegenheit bekommen wirst. Aber eins verspreche ich dir: Ich werde alles tun, um Licht in die geheimnisvolle Geschichte zu bringen!«
»Danke, Oliver«, sagte Jack. Er schob ein Stück Biskuit in den Mund und schaute sich nach dem Posten um. Es war ein ganz harmloser Blick – jedenfalls sah es so aus.
Aber dann war es nicht mehr harmlos, denn urplötzlich federte Jack Steele aus dem Sitz empor, sprang mit gewaltigem Satz über das Feuer – sprang zwischen zwei dort sitzenden Soldaten hindurch, schlug einen Haken nach rechts und war mit zwei gewaltigen Sprüngen am Steilrand des Felsabsturzes.
Dort unten schäumte und murmelte der Snake River. Dort unten knallten Eisschollen gegen die Felswand – dort unten lauerte der Tod.
»Halt!«, schrie der Posten. »Halt, oder ich schieße!«
Jack duckte sich und glitt hinter einem Strauch entlang zu dem am weitesten vorgeschobenen Punkt der Felskuppe. Er hörte Captain Gilroy rufen: »Jack – zurück, Jack! Du bist wahnsinnig!«
Und er rief zurück: »Tut mir leid, Oliver. So long!«
Der Schuss des Postens peitschte. Die Kugel pfiff sengend nah an Jack vor – über. Er schrie auf, als wäre er getroffen – und er hörte Oliver Gilroy mit sich überschlagender Stimme schreien: »Nein, Jack! Oh, verdammt …«
Dann stieß er sich kraftvoll vom Felsrand ab und flog hinaus in die schwarze gurgelnde Tiefe. Nur ein Gedanke beseelte ihn: Lass mich nicht genau auf einen Eisblock aufprallen!
Das schwarze Wasser trug phosphoreszierende Schaumkämme. Er sah es genau, ehe er eintauchte. Die eisige Kälte nahm ihm den Atem. Irgendetwas rammte seine Schulter, drehte ihn um sich selbst. Er wusste nicht mehr, wo unten und oben war. Es dauerte eine Ewigkeit, bis er wieder Luft schnappen konnte. Er schlug um sich und wurde wie ein Stück Holz herumgewirbelt. Wieder prallte er gegen etwas Hartes. Fels oder Eis – nein, Eis! Eine mächtige Eisscholle, die sich schwankend vor ihm drehte.
Verzweifelt warf er die Arme auf die glatte Fläche, strampelte mit den Beinen und brachte ein Knie hoch. Er krallte sich in das Eis und zog und stemmte und strampelte – und lag endlich mit halbem Oberkörper keuchend auf der kalten kreisenden Plattform.
Und oben auf dem Felsplateau hörte er Oliver Gilroy mit einer gebrochenen Stimme sagen: »Lebe wohl, Jack. Farewell, alter Junge.«
So kam es, dass Captain Oliver Gilroy schon am nächsten Tag zurück nach Fort Kelton ritt und dem Colonel Hardin meldete: »Der Strafgefangene Jack Steele hat versucht zu fliehen. Er wurde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erschossen.«
»Danke, Cäpt’n«, murmelte Colonel Hardin. »Vielleicht war es der beste Weg für Jack Steele.«
*
Zwei Jahre und zwei Monate gingen hin, ehe das Schicksal fast alle Personen dieses ersten Kapitels der Story wieder zusammenführte – abgesehen von den Toten natürlich.
Für Captain Oliver Gilroy begann das zweite Kapitel schon etwas früher. Er hatte nämlich den Winter in West Point auf der Militärakademie verbracht, um dort den jungen Kadetten Unterricht in der Indianerbekämpfung zu erteilen. Jetzt befand er sich auf dem Rückzug zu Colonel Ike Hardins Lanzenreiter-Regiment. Und er hatte den ehrenvollen Auftrag vom Colonel erhalten, dessen Tochter Yvonne in Cheyenne abzuholen. Dort hatte Yvonne Hardin die letzten zwei Jahre seit jener furchtbaren Enttäuschung mit Jack Steele bei einer Tante verbracht.
Für Oliver Gilroy war es nicht nur ein ehrenvoller Auftrag, er hoffte vielmehr, auf dem langen Weg von Cheyenne nach Fort Dermit – wo jetzt Ike Hardins Regiment lag – Gelegenheit zu finden, einige entscheidende Worte mit Yvonne zu sprechen. Er liebte sie schon lange, aber er hatte sich nie Hoffnung machen können, ihr Herz zu gewinnen.
Von Cheyenne bis Fort Buffalo verlief die Reise ruhig, ohne Zwischenfälle und programmgemäß.
Die Überraschung wartete in Fort Buffalo auf Captain Oliver Gilroy. Kaum war er dem Wagen entstiegen, als er die wuchtige Gestalt des Sergeanten Hardy Kimball erkannte, der sich durch die wogende Menge der Neugierigen drängte. Erstaunt wandte sich Oliver Gilroy um und half Yvonne Hardin beim Aussteigen. Er murmelte: »Was sucht denn Kimball hier? Ob der Colonel ihn uns entgegengeschickt hat?«
Der Postwagen hielt draußen vor den hohen Palisaden des Forts vor der Poststation. Unter dem Schutz des Forts war hier eine Stadt emporgewachsen – mit Bars, Saloons, Stores und Spielhöllen und sogar mit einer Tanzhalle.
Sergeant Kimball baute sich zur Meldung vor Gilroy auf, doch der winkte schnell ab. Erst als sie mitsamt dem Gepäck glücklich in Will Johnsons Bar gelandet waren und dort ein freies Zimmer gefunden hatten, konnte Hardy Kimball berichten, »Colonel Hardin schickt mich mit dem Auftrag«, sagte er, »Sie möchten sich auf jeden Fall einem sehr starken Treck anschließen, der über genügend bewaffnete Männer verfügt. Er lässt Ihnen sagen, Sie möchten den militärischen Befehl beim Treck übernehmen und geeignete Männer ständig voraus erkunden lassen.«
»Und was bedeutet das, Sergeant? Es muss doch was passiert sein!«
»Jawohl, Cäpt’n. Der erste große Treck dieses Jahres, der vor vier Wochen in Fort Buffalo aufgebrochen ist, wurde vernichtet. Er ist nicht einmal bis Fort Kelton gekommen.«
»Hölle! Wie stark war er?«
»Etwa dreißig waffentragende Männer ohne Frauen, Alte und Kinder.«
»Sie müssen geschlafen haben! Dreißig Männer kann man nicht einfach auslöschen!«
»Ich weiß nicht, Cäpt’n, ob das richtig ist. Außer den dreißig gut ausgerüsteten Zivilisten waren nämlich auch acht Soldaten dabei. Lanzenreiter von unserem Regiment unter Befehl von Leutnant Marton.«
»Und? Leben sie noch? Leutnant Marton ist ein erfahrener Kämpfer!«
»Er war es, Cäpt’n. Er ist tot. Er und alle seine Männer …«
*
Von den vielen Menschen, die sich bei der Ankunft der Postkutsche durch die schlammige Straße zwischen den Stores und Bars, Wellblechbaracken und Zelten drängten, stand auch ein bärtiger Mann in der Lederkleidung eines Waldläufers. Er lehnte drei Schritte neben der Tür zu Will Johnsons Bar und schien zu träumen oder gar eingeschlafen zu sein. Er hielt eine lange Flinte im Arm, wie seine Geliebte, und er trug einen abgegriffenen Colt im Halfter.
Er war ein großer Mann mit breiten Schultern und den schlanken Hüften des Reiters Aber das hätte ihn noch nicht in der Menge der anderen Männer auffallen lassen. Vielmehr war es die rote Narbe, die sich quer über seine rechte Backe zog und im Bart endete. Sie machte das Gesicht erstaunlicherweise nicht hässlich, sondern eher noch anziehender – zumindest aber interessant.
Dieser Mann stand schon eine ganze Weile dort an der Wand, von niemandem beachtet.
Der Mann, der hier an der Wand lehnte, nannte sich nicht mehr Jack Steele, sondern Buster. Ganz einfach Buster. So hatte ihn der Mann genannt, bei dem er damals vor zwei Jahren nach einer höllischen Woche Unterschlupf gefunden hatte: Der Waldläufer und Pelztierjäger Old Mack.
Buster – so nannten ihn viele Menschen an der Indianergrenze. Vielleicht hatte Old Mack ihm den Namen gegeben, weil Jack ein großartiger Bronco-Buster war, ein Mann, der jedes Wildpferd zuritt. Der Rotfuchs, den Buster jetzt ritt, war ein Leithengst gewesen. Ein schlaues, raffiniertes Tier, das alle Tricks und Schliche kannte und doch die Herrschaft des Mannes anerkennen musste. Buster hatte dem Hengst den Namen Red Star gegeben, und seit anderthalb Jahren waren die beiden ein unzertrennliches Gespann, Buster hatte vieles lernen müssen, und die meisten Lektionen waren bitter und hart gewesen. Davon hätte zum Beispiel die Narbe auf seiner Backe erzählen können, die von dem Messerhelden Jeff Milare stammte.
Yeah, und das war einer der Gründe, weshalb Buster an diesem Tage in Fort Buffalo war, obwohl er gewöhnlich einen großen Bogen um jeden Soldaten machte. Denn Jeff Milare war ebenfalls hier – und Jeff Milare gehörte zu einer Bande, die vom Überfall auf Siedlertrecks lebte.
»Yvonne und Oliver«, dachte der Mann, der einmal Offizier gewesen war. »Mein Freund und meine Verlobte. Nun gut. Für die beiden bin ich tot, und es ist zwei Jahre her. Sie wollen nach Fort Dermit, das steht fest. Aber warum ist Hardy Kimball ihnen bis hierher entgegengekommen – noch dazu allein? Ich muss das herausfinden!«