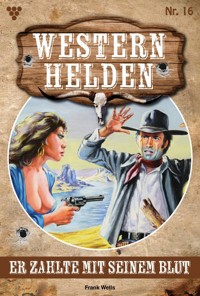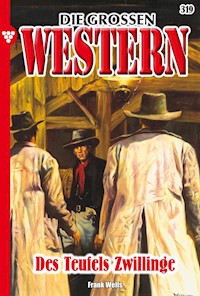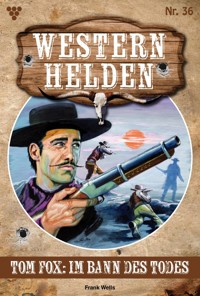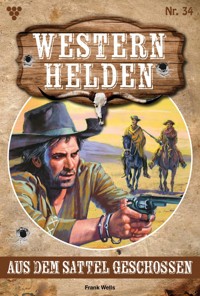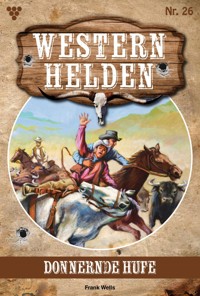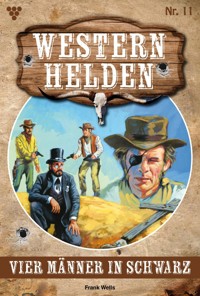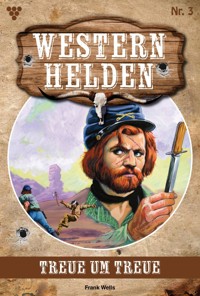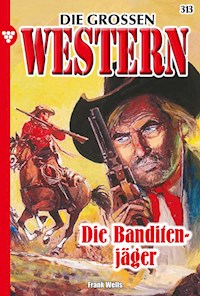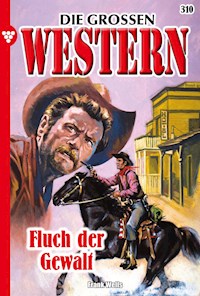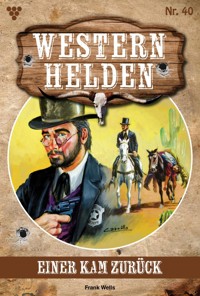
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Helden
- Sprache: Deutsch
Western Helden – Die neue Reihe für echte Western-Fans! Harte Männer, wilde Landschaften und erbarmungslose Duelle – hier entscheidet Mut über Leben und Tod. Ob Revolverhelden, Gesetzlose oder einsame Reiter auf der Suche nach Gerechtigkeit – jede Geschichte steckt voller Spannung, Abenteuer und wilder Freiheit. Erlebe die ungeschönte Wahrheit über den Wilden Westen Sie hatten sich nie verstanden, der Major und sein Scout. Sie lebten in verschiedenen Welten. Major Living, korrekt bis zur Halsbinde, der Scout Mark Ballard, voll Verachtung für Äußerlichkeiten, die von der Mode diktiert wurden. Der Krieg war vorbei, die Apachen geschlagen, die Schwadron zog in die Ruhestellung des Forts Coronado. Aber Mark Ballard würde sie nicht mehr begleiten, würde nicht mehr weit voraus die Sicherung der blauen Reiter übernehmen. Jenseits des nächsten Hügels lag seine Heimat – heute noch würde er sie wiedersehen. Zum letzten Mal trabte Mark durch das Lager, reichte Leutnant Jim Flower die Hand, und Jim sagte: »Okay, Mark, es ist besser, dass du gehst. Die Armee ist nichts für Männer wie dich. Du bist ein Unzähmbarer – ein Wildpferd, das sich nicht einbrechen lässt und weder Sporen noch Peitsche gehorcht. Ich bin stolz darauf, dich zu meinen Freunden zählen zu können. Wenn ich an den Apachenüberfall denke, als mein Skalp schon so gut wie verloren war …« »Shut up! Halt die Ohren steif, Jim!« Am langen Zügel zog Mark seinen struppig gewordenen Rappen Black Devil herum. Sergeant Greene riss ihn fast aus dem Sattel und schrie: »Whoopee, Mark Ballard! Der Teufel soll mich holen, wenn ich deine hässliche Visage jemals vergesse!« Greene machte jäh kehrt und verschwand hinter dem nächsten Wagen. Kein Mann zeigt gern eine weiche Stelle. Schon gar nicht ein Sergeant der Armee. Auch nicht ein Scout.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Western Helden – 40 –Einer kam zurück
Frank Wells
Sie hatten sich nie verstanden, der Major und sein Scout. Sie lebten in verschiedenen Welten. Major Living, korrekt bis zur Halsbinde, der Scout Mark Ballard, voll Verachtung für Äußerlichkeiten, die von der Mode diktiert wurden.
Der Krieg war vorbei, die Apachen geschlagen, die Schwadron zog in die Ruhestellung des Forts Coronado. Aber Mark Ballard würde sie nicht mehr begleiten, würde nicht mehr weit voraus die Sicherung der blauen Reiter übernehmen. Jenseits des nächsten Hügels lag seine Heimat – heute noch würde er sie wiedersehen.
Zum letzten Mal trabte Mark durch das Lager, reichte Leutnant Jim Flower die Hand, und Jim sagte: »Okay, Mark, es ist besser, dass du gehst. Die Armee ist nichts für Männer wie dich. Du bist ein Unzähmbarer – ein Wildpferd, das sich nicht einbrechen lässt und weder Sporen noch Peitsche gehorcht. Ich bin stolz darauf, dich zu meinen Freunden zählen zu können. Wenn ich an den Apachenüberfall denke, als mein Skalp schon so gut wie verloren war …«
»Shut up! Halt die Ohren steif, Jim!«
Am langen Zügel zog Mark seinen struppig gewordenen Rappen Black Devil herum. Sergeant Greene riss ihn fast aus dem Sattel und schrie: »Whoopee, Mark Ballard! Der Teufel soll mich holen, wenn ich deine hässliche Visage jemals vergesse!«
Greene machte jäh kehrt und verschwand hinter dem nächsten Wagen. Kein Mann zeigt gern eine weiche Stelle. Schon gar nicht ein Sergeant der Armee. Auch nicht ein Scout. Denn es war ein Abschied für immer
Mark Ballard galoppierte aus dem Lager, schwenkte den Stetson und rief: »Auf Wiedersehen, Freunde!«
Nur einer blieb neben ihm: Chattanooga. Der Mann, der Marks Lehrer gewesen war. Krummbeinig, mit lederner Haut, scharfäugig. Ein ungleiches Gespann, so galoppierten sie nebeneinander auf den nächsten Hügel.
Sie hielten, und Mark wandte den Kopf zu Chattanooga. Es war ihm, als nehme er Abschied von seinem Vater.
»Es ist schwerer, als ich dachte, Chattanooga. Warum kommst du nicht mit mir?« Chat zog die Schultern hoch.
»Es sind acht Jahre, seit wir uns das erste Mal gesehen haben, stimmt’s?«, sagte er halblaut. »Du hast mir oft Kummer gemacht mit deinem Dickschädel, Mark – aber noch mehr Freude. Nicht jedem Mann wird ein Schüler geschenkt, der so gut lernt wie du. Well, Mark Ballard – ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß und kann. Du bist so hart geworden, wie nur ein Mann werden kann. Du hast gegen die Apachen bewiesen, dass du nicht nur Fäuste, sondern auch einen Kopf hast.«
»Schon gut, Chat. Ich habe meine Lektion geschluckt. Und trotz allem war es schön. Wenn nicht Major Living gewesen wäre, hätte ich es vielleicht noch länger ausgehalten. Aber jetzt, wo der Krieg vorbei ist …«
»Dein Entschluss ist richtig. Du brauchst Ellbogenfreiheit, Boy. Sei froh, dass du damals nicht die Uniform angezogen hast. Und nun – adios, Caballero! Bleib, wie du bist! Und wenn ich einmal nicht mehr weiß, wohin …«
»Dann kommst du zu mir, Chat! Vergiss mich nicht! Adios.«
Chat riss seinen breitbrustigen Bronco scharf herum und preschte den Hügel hinab, zurück zum Lager. Mark schaute ihm nach, bis die Schatten des Tales ihn verschlangen. Die feurigen Pünktchen der Lagerfeuer blinkten Lebewohl. Und auf der anderen Seite des Hügels, zum Greifen nahe, winkten die Lichter Alamogordos Willkommen.
*
Eine staubige Straße, falsche Fassaden jenseits der Brettergehsteige, das Klimpern einer Gitarre im Mesquite-Saloon, müde Pferde an den Haltestangen und dem Wassertrog – das war das vertraute Bild der kleinen Stadt, die seine Jugendjahre gesehen hatte.
Es war acht Jahre her. Als Jüngling von achtzehn Jahren war er gegangen, weil … Einem achtzehnjährigen Burschen juckt’s leicht in den Füßen. Und Edna Carsons hübsche Augen mochten auch dazu beigetragen haben – die Art, wie sie Mark ein wenig spöttisch und überheblich angeschaut hatte. Die Tochter des Richters war schließlich etwas Besseres als ein Cowpunsher. Also war der Cowboy in die Welt hinausgezogen, um als ›Held‹ wiederzukehren.
Was zurückkehrte, war ein struppiger Reiter, von Kopf, bis Fuß mit Staub bedeckt. Kein Held, dem die jubelnden Bürger Alamogordos ein Denkmal setzen würden.
Mark schwenkte den Hut und lachte leise. Dann ruckte er herum, denn schräg hinter ihm huschten Schritte durch den Staub, und eine spöttische Stimme sagte: »Wenn Sie krank sind, Cowboy – der Arzt wohnt zwei Häuser weiter!«
Es war eine Mädchenstimme. Mark drückte Black Devil zur rechten Straßenseite hinüber, wo die schlanke Gestalt mit einer Hauswand verschmolz. Das Licht, das aus French Canbys Bar über die Straße fiel, reichte just aus, ihn das blasse Oval des Gesichtes erkennen zu lassen und die zerzauste Haarmähne. Sie lachte ihn an.
»Das bedeutet Glück!«, sagte Mark langsam.
»Was?«
»Dass ein so hübsches Kind mir als erstes Lebewesen über den Weg läuft. Ich sollte Sie kennen, aber ich fürchte, es ist zu lange her. Damals gingen Sie wohl noch an Mutters Schürzenband.«
»Damals? Soll das heißen, dass Sie hier nicht fremd … Holla, ich hab’s! Setzen Sie bitte den Hut ab, ja?«
Mark gehorchte. Er drehte sein Gesicht zu dem fahlen Licht hin, das über die Straße fiel, und drehte es wieder zurück. »Nun?«
»Ballard!«, rief sie. »Es ist der gleiche Kopf, das gleiche Kinn, die gleiche Nase, wie auch Jesse sie hat. Sie sind Mark Ballard, der Scout!«
»Kluges Kind! Ich wollte, ich könnte auch so gut raten. Wer also sind Sie?«
»Sie werden mich nicht kennen. Kein stolzer Yankee kennt ein armes Mexikanermädchen. Und wenn er es kennenlernt, vergisst er es gleich wieder. Ich bin Silvana Primas.«
»Doch nicht eine Schwester von Silvio Primas? Alle Wetter, du hast dich mächtig rausgemacht, Silvana. Damals reichtest du mir knapp bis zur Gürtelschnalle. Na so was!«
Sie lachte leise: »Das mit der Größe hat sich nicht viel geändert. Du siehst aus wie ein Bär, Mark.«
»Das macht nur der Bart. Ich sitze seit Wochen im Sattel und habe bloß Staub, Steine und Kakteen gesehen. Du bist der erste erfreuliche Anblick seit langer Zeit. Apachen-Squaws sind hässlich wie die Hölle!«
»Und wir dachten alle, du würdest eine heiraten und Häuptling werden. Warum bist du zurückgekommen?«
»Weiß ich selbst nicht, Silvana. Heimweh vielleicht oder … Ich weiß es nicht.«
»Du lügst, Mark. Ich weiß, weshalb du hier bist. Ich wusste es sofort, als ich dich sah.«
»Dann bist du klüger als ich. Verrat es mir.«
»Du kannst mich nicht täuschen, Mark. Es ist wegen Dexter Keene.«
Fast hätte Mark laut gelacht. Aber als ihm der Name erst richtig ins Gehirn gedrungen war, vergaß er zu lachen. Dexter Keene – das war der Mann, der einst den Ehrgeiz gehabt hatte, König dieses Landes zu werden. So jedenfalls hatte Marks Vater immer gesagt. Sein Vater war es auch gewesen, der Dexter Keenes Machenschaften durchkreuzt hatte. Die Geschichte lag lange zurück, mindestens zehn Jahre. Ja – vor fast genau zehn Jahren war Dexter Keene von einer Jury dieses Countys unter dem Vorsitz von Richter W. R. Carson zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt worden – wegen Bandenverbrechens, Rinderdiebstahls und einigen anderen Kleinigkeiten. Auch ein Mord sollte mit hinein gespielt haben, aber niemand hatte Keene die Tat beweisen können.
»Siehst du, ich habe recht!«, triumphierte Silvana Primas. »Du schweigst, weil du dich nicht herausreden kannst.«
»Ach was! Ich habe nichts mit Dexter Keene zu schaffen! Und außerdem sitzt er ja im Zuchthaus.«
»Eben nicht, und das weißt du ganz genau. Er ist vor einem Vierteljahr entlassen worden. Er ist nach Alamogordo zurückgekehrt und hat mehr Freunde als je zuvor. Und das willst du nicht gewusst haben?«
»Nein. Und jetzt, wo ich es weiß, kanns mich auch nicht aufregen. Ich kenne ihn nicht und will ihn auch nicht kennenlernen.«
»Hast du vergessen, was Keene damals nach dem Urteil geschworen hat?«
»Ich hab’s nie gewusst, Silvana. Und es interessiert mich auch nicht. Wahrscheinlich war er verrückt vor Wut. Dann sagt man manches, was man später bereut.«
»So? Ich würde das nicht so leicht nehmen. Keene hat damals geschworen, die ganze Familie Ballard auszurotten. Und nicht nur sie, sondern alle Rancher, die mitgeholfen haben, ihm einen Strick zu drehen. Und natürlich auch Richter Carson.«
»Und wie viele hat er nun schon umgebracht? Wenn er ein Vierteljahr raus ist aus dem Jail, hat er doch Zeit genug gehabt, diese ganze Stadt bis zum letzten Mann vom Erdboden zu vertilgen.«
»Lache nur, Mark. Es wird dir bald genug vergehen. Sei vorsichtig, wenn du noch länger leben willst!«
Plötzlich huschte sie davon. Nachdenklicher lenkte Mark seinen Rappen über die Straße und brachte ihn in French Canbys Stall. Er hatte sein Futter verdient.
*
Es war Ballard in all den Jahren des Grenzlandkrieges zur Gewohnheit geworden, seine Waffen stets bei sich zu tragen. Dazu gehörte der 45er Peacemaker-Colt auf der rechten Hüfte und das rasiermesserscharfe Skalpmesser im Stiefelschaft. Dazu gehörte auch die schwere Springfield-Büffelbüchse, die im Scabbard steckte.
Er trat, die Büchse im Arm, durch die Hintertür in French Canbys Bar. Mehrere Tische waren mit Pokerrunden besetzt. Die Männer schielten nur kurz zu Mark rüber und ließen sich nicht stören. Nicht einer war darunter, der ihn erkannte. Nur zwei oder drei Gesichter kamen Mark bekannt vor. Alles unwichtige Gestalten.
Bis auf den, der allein an der Theke stand und sein Innenleben schon mächtig angefeuert hatte. Es war ein Riesenkerl, ungefähr einen halben Kopf größer und sogar breiter als Mark. Er trank goldgelben Whisky, und er war so sehr damit beschäftigt, dass er nicht merkte, wie Mark auf leisen Mokassins neben ihn glitt, und sein Gewehr, an die Theke lehnte. Mark rollte einen Silberdollar über die blinkende Nickelplatte, und French Canby schob ihm flink Flasche und Glas hin. Canby erkannte ihn nicht, schielte nur verstohlen zu ihm auf.
Der Riese ruckte herum, als Mark sein Glas füllte. Er maß ihn von Kopf bis Fuß und knurrte: »He, du Pinscher! Schleich dich gefälligst nicht an wie ’ne Rothaut, wenn du gesund bleiben willst!«
Sein Gesicht gefiel Mark nicht. Schwammige Backen und dickwulstige Augenbrauen ließen die Augen zu schmalen Schlitzen werden – schwarze Augen mit gelben Punkten darin, wie Mark sie bei Pumas gesehen hatte. Gewaltige Muskeln sprangen unter den Hemdsärmeln auf und drohten sie zu sprengen. Arme und Brust waren behaart wie bei einem Gorilla. Mark füllte mit der Linken das Glas und hob es an die Lippen. Er tat, als wäre der Riese gar nicht vorhanden, Missachtung traf solche Burschen am tiefsten.
Der Riese hob seine schwere Pranke, als der erste Tropfen Marks Lippen netzte. Aus seinen Augenwinkeln sah Mark, wie der schwere Körper sich umständlich drehte, wie die rechte Schulter zurückging, um dem Schlag den richtigen Dampf mitzugeben, und wie die Faust vorschoss. Es war alles viel zu langsam.
Mark ließ das Glas fallen, glitt einen Schritt zurück und zog mit einer fließenden Bewegung das Gewehr hoch. Die Faust zischte drei Zoll vor seiner Nase vorbei und riss durch die Wucht des Schlages den Riesen so weit herum, dass er mit dem Rücken zur Theke stand.
Mit der Rechten repetierte Mark die Büffelbüchse. Der Lauf zeigte genau auf die Brust des Riesen. Er wurde erst rot und dann blass um die Nase.
»Benimm dich, Elefantenbaby!«, sagte Mark freundlich. Der Riese stöhnte und wich Zoll um Zoll zurück.
Mark drehte sich um und überblickte das Lokal. Nur zwei Männer sahen weniger freundlich zu ihm her. Sie saßen abseits von den anderen und hatten bis jetzt gewürfelt. Er kannte sie genauso wenig wie den Riesen, der jetzt am Ende der Theke stand und wie eine Bulldogge vor sich hinknurrte, der man den Knochen weggenommen hat.
»Puma«, sagte der eine der beiden Boys, »komm her zu uns und lass den Quatsch! Du bist voll wie tausend Mann. Musst du immer Krawall machen?«
Mark entspannte das Gewehr, stellte die Büchse neben sich und ließ sich von French Canby ein neues Glas geben, nahm Flasche und Glas und trottete in die andere Ecke der Bar. Nur ein Mann saß dort an einem Tisch, und ihn kannte er gut. Er hieß Old Camel – oder vielmehr hatten sie ihn immer so genannt. Old Camel versah das Amt des Babiers in Alamogordo.
Nachdem Old Camel sich einige Male geräuspert hatte, begann er das Gespräch. »Ähem – Sie sind fremd hier, wenn die Frage erlaubt ist, Mister?«
»Hm«, machte Mark und winkte French Canby. Er bestellte ein Steak, nach dem er schon lange Sehnsucht hatte.
»Das habe ich mir gleich gedacht, als ich Sie sah«, fuhr Old Camel eifrig fort. »Ich habe nämlich einen Blick für Gesichter, müssen Sie wissen, weil ich das ehrbare Handwerk des Barbiers ausübe. Wenn ich mir erlauben darf, Sie darauf hinzuweisen, dass Ihre Haare eine Schere gebrauchen könnten.«
»Hm«, brummte Mark und nahm einen Schluck. Dann stopfte er die Pfeife und setzte sie in Brand.
»Ich wohne gleich um die Ecke an der Plaza. Übrigens können Sie auch bei mir baden, zu niedrigsten Preisen. Äh – Sie kommen von sehr weit her?«
»Hm …«
»Das habe ich mir gedacht. Gleich, als ich Sie sah, sagte ich mir: Old Camel, der Mister hat einen langen staubigen Ritt hinter sich. Er braucht nichts nötiger als ein Bad und eine Schere. Well …« Er beugte sich plötzlich vor und flüsterte hinter vorgehaltener Hand: »…dem haben Sie es aber gegeben, dem Puma Killing! Donnerwetter! Aber wenn ich Ihnen raten darf, dann nehmen Sie sich in acht. Er ist gefährlich. Und die beiden, mit denen er am Tisch sitzt, sind noch gefährlicher. Kennen Sie Hink Judson und Nero Jenkins? Gefährlich wie Gift, sage ich Ihnen!«
Mark hatte von ihnen gehört. Und er konnte nicht behaupten, dass diese Nachricht ihm gefiel. Jedes Kind an der Grenze wusste, dass diese drei Kerle von der schlimmsten Sorte waren.
Old Camel flüsterte ihm zu, dass Nero Jenkins der Mann zur rechten des Riesen Puma Killings war. Jenkins hatte ein steinernes Gesicht von seltsam grauer Farbe. Er sah aus, als wäre er seit Jahr und Tag nicht in die Sonne gekommen, aber seine abgewetzte Kleidung bezeugte das Gegenteil.
Mark entsann sich, dass Hink Judson eine geheimnisvolle Rolle zu Beginn des Apachenaufstandes gespielt hatte und dann plötzlich aus Arizona verschwunden war. Das lag nun schon einige Jahre zurück.
Nero Jenkins starrte zu Mark herüber, nachdem er einige Zeit halblaut auf Puma Killing eingeredet hatte. Plötzlich erhob er sich und kam durch die Tischreihe heran. Old Camel kriegte einen blassen Schreck, blieb aber sitzen. Mark sog ruhig weiter an seiner Pfeife und schaute erst auf, als Jenkins neben ihm stehen blieb.
»Fremder«, sagte der Revolvermann, »ich möchte mich für meinen Freund entschuldigen. Er hat es nicht so böse gemeint. Aber wenn er einen getrunken hat …«
»In Ordnung, Mister. Trinken Sie einen Schluck mit mir?«
Jenkins schüttelte den Kopf und entblößte die Zähne. Fast sah es aus, als lächele er. Aber es war kein Lächeln.
»Danke, ich trinke nie, Fremder. Übrigens waren Sie ziemlich schnell mit Ihrem Gewehr.«
»Man tut, was man kann, Mister.«
»Ja. Jeder tut, was er kann.« Er lachte heiser, während seine Augen nicht von Mark abließen. »Übrigens – haben wir uns nicht schon irgendwo gesehen? Ich möchte wetten, dass Sie meinen Weg schon gekreuzt haben …«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Vielleicht liegt es daran, dass Sie Mokassins tragen. Ich kenne nur wenige Männer, die das tun – außer Indianern natürlich.«
»Sie sind bequem, Amigo.«
»Sicher. Kennen Sie einen Mann namens Chattanooga?«
Das wars. Plötzlich wusste Mark es wieder. Sein alter Freund hatte ihm von Jenkins und Judson berichtet, vor mindestens zwei Jahren. Chat war mit Judson zusammengerasselt und hatte ihn mit dem Bowie abgewehrt. Deshalb war Nero Jenkins auch so neugierig und ausgesprochen höflich!
»Wenn Sie den Scout meinen«, erwiderte Mark gedehnt, »ja – ich habe ihn einige Male gesehen.«
»Dann waren Sie in Arizona?«
»Stimmt. Ich war auch in Arizona. Und in New Mexico, in Colorado und sogar in Kansas.«
Jenkins nickte langsam, rückte die überkreuz geschnallten Waffengurte zurecht und sagte: »Okay. Sie bleiben länger hier?«
»Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich habe kein Sitzfleisch, Mister – das ist mein ganzer Kummer.«
Jenkins nickte wieder und ging ohne ein weiteres Wort. Old Camel seufzte leise, kippte seinen Brandy und ging auch. Ihm schien es unheimlich geworden zu sein.
*
Während des Essens überlegte Mark, ob er nicht Chattanooga von Judson und Jenkins Anwesenheit unterrichten sollte. Aber er verwarf den Gedanken gleich wieder.
Draußen trabte ein Pferd durch den Staub der Straße. Sattelleder quietschte, als der Reiter vor der Bar absaß. Dann knarrten Schritte auf dem Brettergehsteig, und ein staubiger Mann schob sich durch die Schwingtür herein. Er blieb mitten in der Tür stehen und blinzelte in das trübe Licht der Petroleumlampe. Es war ein Mexikaner im reich verzierten Charroanzug. Seine lose fallende schwarze Jacke war mit Stickereien versehen und hatte anstelle von Knöpfen talergroße Goldstücke. Auch die ledernen Chaps wiesen Gold- und Silberstickerei auf, und sogar der breitrandige Sombrero war mit Goldstücken besetzt. Am tollsten aber glänzte der Kolben seines Revolvers.
Ein schneller Blick aus verhangenen schwarzen Augen streifte Mark, glitt dann über die anderen Tische und Männer hinweg und blieb an Puma Killing und seinen Genossen ein wenig länger haften. Dann erst ging der Mann mit lockerem Schritt weiter zur Theke – und am Gang erkannte Mark ihn, weil er das linke Bein ein wenig nachschleifen ließ.
Silvio Primas hatte sich sehr verändert in diesen vergangenen acht Jahren. Damals, als sie noch zusammen alle möglichen Streiche ausgeheckt hatten, war er ein abgerissener Bursche gewesen, der vor Dreck starrte und selten eine heile Hose trug. Und jetzt nichts wie Gold und Silber? Er musste mindestens eine Gold-Bonanza entdeckt haben.
Sofort war Puma Killings Interesse geweckt. Er setzte die Flasche an, trank und grunzte da: »He, Freund! Wie wär’s mit einem Spielchen? Poker oder Würfel oder Penny ante – was du willst! Ich wette, dass du binnen einer Stunde keinen Goldfuchs mehr hast!«
Silvio Primas wandte sich lässig um und lächelte. Er war ein hübscher Kerl. »Sie sollten lieber nicht wetten, Amigo! Das Glück hat mich selten im Spiel verlassen. Aber wenn Sie etwas einzusetzen haben …«
»Hoh! Hör sich einer den Boy an! Komm her, zeig was du kannst!«
Mit Männern wie Puma, Judson und Jenkins spielt man nicht. Nicht, wenn man Augen im Kopf hatte. Aber natürlich nahm Silvio die Herausforderung an.