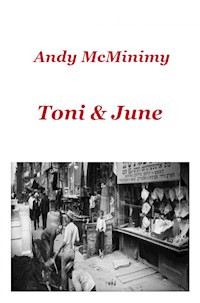
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Toni und June leben in Boston des beginnenden 20. Jahrhunderts. Das Buch beschreibt eine Familiensaga mit den Hochs und Tiefs zweier Menschen die sich lieben. Dabei wird beschrieben wie Menschen sich verlieben und wie das Schicksal sie trennt. Nebenbei werden Aspekte des amerikanischen Lebens des gesamten letzten Jaahrhunderts beschrieben, einschliesslich wichtiger politischer und historischer Ereignisse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andy McMinimy
Toni & June
Andy McMinimy
Toni & June
Impressum
Angaben
gemäß § 5 TMG
Andy Mc Minimyc/o autorenglück.deFranz-Mehring-Str. 1501237 Dresden
Kontakt
Email: [email protected]
Redaktionell Verantwortlicher nach §18 Abs. 2 MStV.:
Urheberrechtshinweis:Die in diesem Buch veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.
Die Darstellung der Buchinhalte auf Webseiten in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.
Covergestaltung und Titelschutzrechte:
Andy McMinimy.
Alle Rechte vorbehalten.
Alle in diesem Buch vorkommenden lebenden oder toten Personen sind rein fiktiv. Ähnlichkeiten mit jetzt lebenden Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
1
Ich heiße Anton Polanski und man nennt mich Toni. Ich wurde 1901 in New York als Sohn von Adamczyk und Maria Polanski geboren. Mein Vater war Schuhmacher und meine Mutter war eine Schneiderin. Sie kamen Anfang des Jahrhunderts als jüdische Emigranten aus Polen nach New York. Mein Vater erzählte mir sie seien vor den polnischen Pogromen geflohen. Trotz seines typisch polnischen Namens war er in seiner Stadt in Polen als Jude bekannt und dementsprechend beschimpft worden. Sobald er in den USA war, änderte er seinen unaussprechlichen Vornamen in Alan. Anfangs war mein Vater arbeitslos. Bis sie sich einigermaßen zurechtfanden, lebten sie von der Unterstützung wohltätiger jüdischer Organisationen.
Danach eröffnete er ein Schuhmacheratelier in der Bronx mit der tatkräftigen finanziellen Unterstützung seines wohlhabenden Onkels, der Jahrzehnte zuvor aus Russland eingewandert war.
Meine Mutter arbeitete von zuhause aus. Als ich ein Säugling war stillte sie mich und arbeitete gleichzeitig an der Nähmaschine. Natürlich kann ich mich nicht mehr an diese Zeit erinnern. Was mir aber trotzdem im Gedächtnis haften geblieben ist, ist das Geräusch der klappernden Nähmaschine.
Mein Vater war eine Seele von Mensch. In seinem großen Herz schloss er seine ganze Familie, seine Freunde, seine Bekannte und sogar den Müllmann, der draußen den Müll einsammelte. Er lachte viel, war jovial und liebte es aufgeschnappte Witze zum Besten zu geben. Zu mir und meiner später geborenen Schwester hatte er ein besonderes Verhältnis. Wir waren sein Augapfel, wie er liebevoll ausdrückte. Er nahm mich und setzte mich auf seinem Schoss. Dann lächelte er und sagte:
»Ingelchen (jiddisch), gib Papa einen Kuss, genau hier« und zeigte eine bestimmte Stelle auf seiner linken Wange. Er schob mich zu seiner linken Wange und war glücklich, wenn ich ihn geküsst hatte. Er engagierte sich später auch für die jüdische Gemeinde der Stadt. Viel freie Zeit hatte er jedoch nicht. Er musste die ganze Woche außer Samstags arbeiten, weil seine Arbeit langwierig und schlecht bezahlt wurde. Später, als er älter wurde ließen die Kräfte nach und er nahm sich einen Lehrling, der ihm half und im Laufe der Zeit fast ein Mitglied der Familie wurde. Der Lehrling war ebenfalls Jude und hieß Issac Cohen.
Meine Mutter hingegen war eine ruhige, stillere Person, aber ebenfalls freundlich und liebevoll. Außer ihrer Arbeit als Schneiderin war sie eine hervorragende Hausfrau, die sehr gut kochte, Kuchen und Brot buk und die Wohnung extrem sauber hielt. Sie sorgte immer dafür, dass wir sauber waren und mit fleckenfreier Kleidung nach draußen gingen. Sie arbeitete als Schneiderin meist für vornehme Damen der Gesellschaft, die ihr teuere Stoffe anvertrauten und mehrmals zur Anprobe bei uns zu Hause waren. Mit ihrer Arbeit verdiente sie fast so viel wie mein Vater, hatte aber mehr Zeit für ihre übrige Arbeit. Einmal pro Woche kochte sie für die jüdische Gemeinde, um die Ärmsten dort zu speisen und backte Kuchen für die wöchentliche Tombola.
Wir waren nicht religiös, eher traditionell. Freitags am Abend sprach meine Mutter den Segensspruch vorgebeugt über die Tischkerzen, anschließend sprach mein Vater den Kiddusch (deutsch: »Heiligung [des Sabbat]«) und danach die Beracha, die Segnung des Brotes. Das Essen begann stets mit einer Vorspeise mit Salaten und Fisch, danach gab es eine fette Hühnersuppe, hinterher Fleisch oder Geflügel und die Nachspeise. Serviert wurden der Fisch und das Fleisch oder das Geflügel in separaten Menügängen, auf getrenntem Geschirr und mit getrenntem Besteck. Für das Mittagessen am Schabbat-Tag wurde traditionell „Tscholent“ serviert. Dieser wird vor dem Schabbat fertig gekocht und auf einer Warmhalteplatte bis zur Mahlzeit warmgehalten, wobei ein Tscholent umso besser schmeckt, je länger er gekocht hat. Ein Tscholent ist eine Art Eintopf aus Bohnen, Kartoffeln, Fleisch und Graupen. Freitagabend wurde genauso wie am Schabbat das feinste Leinen auf dem Speisetisch im Wohnzimmer aufgelegt und das versilberte Besteck und die Kerzenleuchter herausgeholt. Meine Mutter backte das traditionelle jüdische Zopfbrot, die Challah, die warm mitten auf den Tisch kam.
Wir Kinder wurden äußerst liberal und modern erzogen, jedoch immer im Sinne solider Grundwerte, wie Ehrlichkeit, Sauberkeit und Respekt. Das dazu die jüdische Tradition gehörte, war irgendwie selbstverständlich. Meine Eltern fühlten sich durch und durch als Amerikaner und versuchten sich zu assimilieren so gut es damals möglich war. Da auch alle um uns herum Einwanderer waren, gab es nicht sehr ausgeprägte Vorurteile.
2
Mit vier Jahren ging ich in den Kindergarten. Meine Eltern waren mich los. Dafür brachte ich jede Menge Krankheiten ins Haus und steckte alle an. Im Kindergarten war es lustig. Ich machte mir jede Menge neue Freunde und wir spielten friedlich den ganzen Tag. Dort begegnete ich zum ersten Mal June. June Scarlet Marcowitz war ein kleines, mageres, jüdisches Mädchen mit blonden Haaren und Zöpfen, die ihr längliches Gesichtchen unterstrichen. Sie hatte eine alabasterfarbene Gesichtshaut, die von einer gewissen Blutarmut zeugte. Sie trug stets ein dunkelrotes Samtkleid und spielte immer allein. Am Ende des Tages verstaute sie ihr Spielzeug sorgfältig in dem dazugehörigen Regal, bevor sie abgeholt wurde. Ich versuchte mehrmals mich ihr zu nähern, um mit ihr zusammen zu spielen, sie aber wies mich jedes Mal ab und drehte sich weg von mir oder suchte das Weite. Nach der Kindergartenzeit sah ich sie viele Jahre nicht mehr. Dann wurde ich von meiner Mutter abgeholt. Einen Tag in der Woche hatten wir frei. An diesem Tag spielte ich draußen mit meinen Freunden Fußball zwischen den geparkten schwarzen Autos Typ Ford Model T auch Tin Lizzie genannt.
Eines Tages kamen zwei größere, fremde Jungs vorbei. Wir spielten Fußball.. Einer von den Jungs hielt mich an und wollte mich am Ärmel packen.
»Wer bist du?«
»Ich heiße Toni Polanski«, antwortete ich.
»Polanski, aha du bist ein Polacke, wahrscheinlich auch noch ein dreckiger Jude, nicht war?«
Einer meiner Freunde, der größer und kräftiger als ich war, schob sich zwischen uns.
»Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt, sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Er hat euch nichts getan.«
Ich rannte nach Hause mit Tränen in den Augen und erzählte meinen Eltern von dem Vorfall. Irgendwie waren sie nicht überrascht. Sie erzählten mir von den Ursachen des Antisemitismus und was sie alles selbst in Polen erlebt hatten. Sie sagten mir ich müsste mich damit abfinden, dass ich Jude sei und von den Mitmenschen belästigt werden könnte. Man könnte solchen Menschen nur mit Intelligenz und Witz begegnen und durch seine Leistungen in der Gesellschaft sich höher stellen als das gemeine Volk.
In den Ferien war ich meistens im Atelier meines Vaters und schaute ihm bei der Arbeit zu. Es roch nach frischem Leder und Klebstoff. Mein Vater trug eine Lederschürze und hämmerte kleine Nägel in die Schuhsohlen. Die Nägel hatte er zwischen den Lippen, damit es schneller ging. Ich war jedes Mal erstaunt, wie aus einem durchlöcherten Schuh mit kaputter Sohle ein wie neu aussehender sauberer und fehlerfreier Schuh wurde. Die Kunden waren stets zufrieden und unterhielten sich teilweise während seiner Arbeit mit ihm. Er machte sich viele Freunde im Viertel. Manchmal lud er diese Freunde zu uns nach Hause ein. Sie setzten sich hin und unterhielten sich über Politik, dieses und jenes. Meine Mutter servierte immer einen Kirschenlikör vorneweg, welchen sie selbst machte und in dickbäuchigen Flaschen aufbewahrte und selbstgemachten Kuchen. Dafür bekam sie stets Komplimente von den Gästen. Sie verließ immer den Raum und beteiligte sich nicht an den Diskussionen.
Meine Mutter hatte selbst viele Bekannte in der Nachbarschaft. Sie luden sich gegenseitig am Sonntagnachmittag zu Kaffee und Kuchen und tratschten über andere Frauen und über die neuste Mode und Coiffuren.
Meine Schwester, Sarah Jane wuchs zu einem hübschen Mädchen heran. Sie war stets in einem kurzen marineblauen Samtröckhen gekleidet. Dazu trug sie ein weißes Hemdchen mit Knöpfen und Ärmeln sowie eine weiße Strumpfhose mit Lackschüchen. Sie hatte ein pausbäckiges Gesicht. Trotz ihres Alters von gerade einmal drei Jahren versuchte sie gewissenhaft meiner Mutter im Haushalt zu helfen. Sie deckte den Mittagstisch trug Geschirr hin und her, usw.
Ich war ein lebhaftes Kind. Mein Vater besaß ein Grammophon und viele Schallplatten mit italienischen Opern. Da ich ein großer Liebhaber der melodischen Arienmusik war, lernte ich die Arien auswendig, ohne die italienische Sprache zu verstehen und schmetterte diese Arien mit meiner hellen Kinderstimme bei offenem Fenster. Dieses brachte mir regelmäßigen Applaus von den Nachbarn die andächtig lauschten. Meine Mutter dachte schon, dass ich später ein großer Tenor werden würde. Ich musste sie aber enttäuschen, als ich in die Pubertät kam und meinen Stimmbruch erlitt. Außerdem hatte ich einen besonderen Spaß mich als Mädchen zu verkleiden. Ich zog mir ein Röckchen meiner Schwester an malte mir die Lippen mit dem Lippenstift meiner Mutter rot an, so schlecht, dass ich aussah als hätte ich blutiges Fleisch gegessen und lief mit den mir zu großen hochhackigen Schuhen meiner Mutter durch die Wohnung. Meine Schwester hielt sich dabei den Bauch vor Lachen und quietschte vor Vergnügen. Bei dieser Tätigkeit entdeckte ich mein komödiantisches Talent.
3
Meine Eltern waren sehr fleißig. Im Laufe der Zeit hatten sie genug angespart, um sich die Wohnung in der Bronx zu kaufen, wo sie all die Jahre zur Miete gewohnt hatten. Mein Vater arbeitete weiter als Schumacher, doch langsam liefen die Geschäfte nicht mehr so gut. Deshalb eröffnete er mit einem Kompagnon ein Schuhgeschäft für Damen- und Herrenschuhe, welches ein gutes zusätzliches Einkommen einbrachte. Trotzdem gab er seine alte Tätigkeit nicht auf. Es kam dazu, dass sich meine Eltern ein Auto leisten konnten. Mein Vater nahm Fahrstunden und manchmal fuhren wir am Wochenende ins Grüne, außerhalb New Yorks zur Entspannung. Manchmal fuhren wir nach Hyannis in Massachussets wo ich zufällig auf John F. Kennedy traf. Er war ein schwächlicher und kränklicher Junge, der aus einer sehr reichen Familie kam. Er selbst war aber keinesfalls eingebildet und wir freundeten uns an. Zusammen mit seinem Bruder Robert, genannt „Bobby“ spielten wir Fußball und Baseball. Wer hätte damals gedacht, dass er später Präsident der Vereinigten Staaten werden würde und die Hoffnung einer ganzen Nation.
Das Auto wurde gehegt und gepflegt, wie sonst nichts Wichtigeres auf der Welt. Damals war es eines der wertvollsten Errungenschaften einer Familie und ein Symbol von Reichtum.
4





























