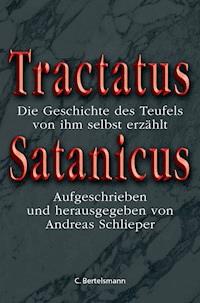
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am Anfang schuf Gott eine perfekte, makellose Welt, um sich dann sogleich zu verabschieden. Das Licht der Erkenntnis aber brachte der Teufel zu den Menschen. Endlich bricht er jetzt sein Schweigen und erzählt seine Version vom Gang der Dinge: Er schuf den Neid als revolutionäres Prinzip. Er erfand die Wollust als unstillbaren Wunsch aller Wesen, sich zu entwickeln. Denn das Sein ist das Werk Gottes, das Werden jenes des Teufels. Er setzte die Regeln und gab den Menschen die Freiheit, selbst zu entscheiden, wohin sie gehen. Zuzeiten streben sie danach, sich und die Welt zu vervollkommnen. Der Blick auf die Weltgeschichte lässt jedoch Zweifel am Gelingen aufkommen: Vom Turmbau zu Babel über die gottfernen Irrwege des Christentums bis zur Alleinherrschaft des Götzen Mammon verdichten sich die bedrohlichen Anzeichen. Inzwischen scheint es, als habe sich der Fürst der Welt entschieden: Ohne die Menschen hat seine Schöpfung größere Chancen, vollkommen zu werden.
Mit leichter Hand und überbordender Lust an der Erkenntnis bürstet Andreas Schlieper Menschheitsgeschichte gegen den Strich. Eine Lesereise durch den gewaltigen Ozean menschlicher Möglichkeiten - zwischen herrlichstem Gelingen und apokalyptischem Scheitern
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1185
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Andreas Schlieper
Tractatus Satanicus
Roman
Copyright
PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © 2003 by C. Bertelsmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
ISBN 3-89480-871-3
www.pep-ebooks.de
Inhaltsverzeichnis
PréludeErster SatzErstes IntermezzoZweiter SatzZweites IntermezzoDritter SatzDrittes IntermezzoVierter SatzViertes IntermezzoFünfter SatzCodaAnmerkungenÜber das BuchÜber den AutorCopyright
Die Geschichte des Teufels
von ihm selbst erzählt
Aufgeschrieben
und herausgegeben von
Andreas Schlieper
Prélude
Vorspiel auf der Erde
Eigentlich freue ich mich immer darüber, wenn mittags Post in meinem Briefkasten liegt und bin eher enttäuscht, wenn ich dort nichts vorfinde. Ich bekenne mich zu meiner Neugierde, die ich gar nicht für einen Defekt halte, sondern als Energie für mein Leben und meine Arbeit zu nutzen versuche. Und weil ich so neugierig bin und es kaum erwarten kann, reiße ich schon auf dem Weg zurück in meine Wohnung die ersten Briefumschläge auf. Zumeist bin ich dann jedoch eher enttäuscht, denn mit den meisten Briefen versucht man, mir irgendetwas zu verkaufen, das ich unter keinen Umständen wirklich benötige. Ich habe mich oft gefragt, ob überhaupt jemand Interesse hat an Schlafsocken, die von flinken Indiokindern aus feinster peruanischer Lamawolle hergestellt wurden, oder an echt malaiischen Luftmatratzen, die schon der kaiserlichen japanischen Armee die Überquerung reißender Dschungelflüsse ermöglicht hatten. Oder – schlimmer noch – an Versicherungen für die übelsten Wechselfälle des Lebens, von denen ich ansonsten keinerlei Ahnung hätte, weshalb ich gerade diese Art von Schreiben ungelesen wegwerfe, um mich mit diesen Dingen gar nicht weiter zu belasten. Manchmal aber sind es auch nette Briefe von Freunden, die altmodisch genug sind, noch nicht die elektronischen Techniken der Kommunikation zu benutzen, wofür man ihnen dankbar sein muss. Oder aber – worüber ich mich ganz besonders freue – es sind Einladungen zu diversen Arten von Festlichkeiten, die ich natürlich gerne annehme, sooft es eben geht.
Was ich jedoch überhaupt nicht mag, sind jene seltsamen Vordrucke der Post, mit denen man mir mitteilt, dass auf irgendeinem Amt irgendwelche Schriftstücke für mich deponiert sind, die ich umgehend abzuholen habe, jedoch nicht heute, wahrscheinlich, weil man sie im Amt selbst erst noch in aller Ruhe lesen will, bevor man sie mir aushändigt. Ich mag es nicht, weil mir inzwischen alle Lebenserfahrung sagt, dass es sich zumeist um eher unangenehme Schriftstücke handelt und es nicht nur einen größeren Aufwand bedeutet, sie beim Amt abzuholen, sondern erst recht, mit den jeweiligen Konsequenzen umzugehen. In der Regel will mich jemand unbedingt darauf aufmerksam machen, dass ich eine Rechnung noch nicht bezahlt habe, was mir ein großes Unbehagen bereitet, denn ich habe gierige Menschen noch nie ausstehen können. Oder aber eine andere Art von Amt behauptet doch allen Ernstes, dass ich meinen Wagen an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle geparkt hätte oder dass ich schneller gefahren sei, als jenes Amt es erlaube. Dabei habe ich nie wirklich verstanden, was man denn nun von mir eigentlich erwartete: dass ich meinen Wagen bewege oder eben doch nicht.
Jedenfalls verheißen diese Vordrucke im Allgemeinen nichts Gutes. Ich sinne in den folgenden Stunden und Tagen ruhelos darüber nach, welches Ungemach mir dieses Mal wohl wieder bevorstehen könnte, kann in den Nächten kaum schlafen, versuche, die ganze Angelegenheit zu vergessen, bis ich mich dann endlich doch aufraffe, um mich mit klopfendem Herzen auf den Weg zum Postamt zu machen. Und ich weiß genau, dass ich mich danach erst einmal furchtbar ärgern werde über die Boshaftigkeit der Menschen.
So auch in jenen Tagen im Frühjahr, als ich wieder einmal ein solches Formular in meinem Briefkasten vorfand. Ich nahm mir gar nicht die Zeit, um genauer zu prüfen, welche Art von Überraschung nun wieder auf dem Amt auf mich warten würde, und legte den Zettel auf irgendeinen Papierstapel in meiner Wohnung. Dort fand ich ihn erst einige Tage später eher durch Zufall wieder, als ich nach Notizen suchte, die ich dringend benötigte. Da ich ohnehin einige Besorgungen zu erledigen hatte, fügte ich mich in das Unvermeidliche und wählte meine Route am folgenden Morgen so, dass sie mich an jenem Amt vorbeiführte, wo das wahrscheinlich eher unangenehme Schriftstück für mich bereit lag.
Ich war wie immer auf das Schlimmste vorbereitet, weil mich meine Lebenserfahrung gelehrt hat, immer auf das Schlimmste vorbereitet zu sein, damit man eigentlich nur noch positiv überrascht werden kann, weil alles noch viel schlimmer hätte kommen können. So war es tatsächlich zunächst eine Erleichterung, als mir gegen Vorlage jenes Formulars ein wattierter Umschlag ausgehändigt wurde, der viel zu groß war, als dass darin allein eine Zahlungsaufforderung oder ein sonstiger leidiger bürokratischer Vorgang stecken konnte. Dass auf dem Umschlag keinerlei Absender angegeben war, weckte zwar unmittelbar meine Neugierde, aber ich wusste sie zu bezähmen und erledigte zunächst das, was unbedingt zu tun war. Erst nachdem ich mit meinen Besorgungen zu Ende gekommen war und in einem Kaffeehaus saß, um mich für meine Anstrengungen zu belohnen, öffnete ich den Umschlag und fand darin zu meinem großen Erstaunen einige Disketten und einen kurzen Begleitbrief, den ich mehrmals lesen musste, um zu begreifen, was man eigentlich von mir erwartete. Danach bestellte ich ganz gegen meine sonstigen Gewohnheiten ein Glas Cognac und versuchte, mich auf diese Weise wieder ein wenig zu beruhigen.
Ich muss an dieser Stelle vielleicht erläutern, womit ich seit einigen Jahren meinen Lebensunterhalt verdiene, damit man meinen damaligen emotionalen Zustand etwas besser verstehen kann. Wenn man mich danach fragt, antworte ich gerne damit, dass ich ein Autor sei, was insofern auch zutrifft, als ich mich selbst als einen solchen begreife. Ich muss allerdings gestehen, dass mir meine eigenen Texte kaum genügend Geld einbringen, offenbar ist es mir nach all den Jahren, in denen ich es versucht habe, immer noch nicht gelungen, mit meinen Sujets und meinem Stil eine genügend große Anzahl von Menschen zu überzeugen. Leider ist es genau das, was heutzutage wirklich zählt. Natürlich sind die Chancen gering, in unserem allumfassenden modernen Sozialsystem aus eigener Dummheit zu verhungern, aber ich stelle an mein Leben doch mehr Ansprüche, als ich sie mir allein aus einer staatlichen Unterstützung würde erfüllen können.
Und so habe ich mich irgendwann einmal darauf eingelassen, die Texte, die von anderen Menschen geschrieben worden sind, so weit zu bearbeiten, dass sie überhaupt lesbar wurden. Man nennt das einen ghostwriter, und tatsächlich bin ich so etwas wie ein Geist, denn mein Name erscheint nur sehr selten auf den Umschlägen der Bücher, was nur anfangs mein Selbstbewusstsein gestört hat, denn heute bin ich froh, dass niemand auf die Idee kommen kann, mich und mein Talent mit jenen Elaboraten zu identifizieren; zudem habe ich feststellen können, dass nur wenige Huren wirklich stolz auf ihre Profession sind.
Mir geht es nicht anders, und ich habe manchmal wirklich das Gefühl, mich innerlich und äußerlich säubern zu müssen, wenn ich wieder einmal eines jener unsäglichen Gespräche mit einem der so genannten Autoren geführt habe. Sie kommen zumeist aus Politik oder Wirtschaft, haben dort, wenn schon keinen Erfolg, so doch wenigstens einen gewissen Grad an Bekanntheit erreicht, so dass sich immer wieder ein Verlag findet, der diese Bekanntheit für seine eigenen, rein ökonomischen Zwecke ausnutzt. Ich will mich darüber nicht beschweren, denn wir alle leben nun einmal recht gut in einer Welt, die sich entschieden hat, den Gesetzen der Ökonomie zu folgen, und auch ich ziehe meine Vorteile daraus, und mein zeitweiser Ekel wird nicht schlecht entgolten.
Ich will nicht bigott erscheinen, schließlich verdiene ich mit diesen Arbeiten mehr, als mein Lebensunterhalt eigentlich erfordern würde, selbst wenn ich etwas höhere Ansprüche daran zu stellen gewohnt bin. Doch wenn man sich gewissen Freuden des Lebens hingeben will, dann sind manchmal erhebliche Beträge dafür erforderlich, auch wenn es sich bei diesen Freuden lediglich um durchaus legitime Annehmlichkeiten handelt: Bücher – beispielsweise – sind heutzutage recht teuer geworden, selbst wenn man als Autor nur wenig daran teilhat, weil die ehernen Gesetze der Ökonomie auch im Verlagswesen gelten, doch davon war schon die Rede. In den vergangenen Jahren jedenfalls habe ich mir einen gewissen Ruf in der einschlägigen Szene verschaffen können, was vielleicht damit zu tun hat, dass ich mich daran gewöhnt habe, die Launen der jeweiligen Klientel eher klaglos zu ertragen. Ja, ich kann es mir inzwischen sogar leisten, den einen oder anderen Auftrag schlichtweg abzulehnen, ohne dass es dadurch zu irgendwelchen Sanktionen kommt. Und das tue ich immer dann, wenn mir die Potentaten aus Politik und Wirtschaft besonders unangenehm, weil langweilig vorkommen.
Allerdings widerstehe ich der Versuchung, meine Rolle in diesen Projekten für wichtiger zu nehmen, als sie wirklich ist, denn niemand kauft oder liest solche Bücher wegen ihrer literarischen Qualität, sondern weil er eine angemessene Unterhaltung erwartet, was durch ein rechtes Maß an Klatsch und übler Nachrede ohne größere Probleme erreicht werden kann. Viel wichtiger als ich sind in solchen Projekten dann die Juristen der Verlage, die dafür sorgen müssen, dass die Bücher interessant genug bleiben, ohne dass sie schon vor ihrer Veröffentlichung verboten werden. Möglicherweise gründet sich mein guter Ruf auch darauf, dass ich ein gewisses Gespür dafür entwickelt habe, welches Maß an Beleidigung und Blasphemie vor den gestrengen Augen der Juristen gerade noch Bestand haben kann, was für die Verlage wiederum nicht unerheblich ist, bin ich doch deutlich preisgünstiger als eine jede Art von Jurist, selbst wenn ich meinen Marktwert sehr gut kenne und ihn durchaus auszureizen weiß.
Ich lebe also recht gut von dieser Art von Tätigkeit, denn man macht sich im Allgemeinen keine Vorstellung davon, wie viele Menschen sich zum Schreiben berufen fühlen, gerade dann, wenn sie überhaupt kein Talent dafür haben. Glücklicherweise verbleibt das meiste im ewigen Papierkorb der Geschichte, und niemand erfährt etwas davon, außer vielleicht die Familie oder die engsten Freunde, deren Freundschaft dann allerdings auf eine harte Probe gestellt wird. Bei den Prominenten jedoch sieht alles ganz anders aus, und wenn ihre literarischen Qualitäten in einem reziproken Verhältnis zu ihrer Bekanntheit stehen, dann kommen eben Menschen wie ich ins Spiel, deren einzige, aber oft übermenschliche Aufgabe es ist, das Gefasel und Gestammel jener sehr wichtigen Personen so weit zu ordnen, dass auch andere damit etwas anfangen können.
Natürlich wäre meine Aufgabe um einiges leichter, wenn die Prominenten nicht so bedenkenlos davon überzeugt wären, dass sie nicht nur etwas Wichtiges zu sagen haben, sondern zudem auch noch über die erforderlichen sprachlichen Fähigkeiten dazu verfügen, was in beiderlei Hinsicht zumeist nicht unbedingt zutrifft. Aber sie wären nun einmal keine Notabeln in unserer Gesellschaft, wenn sie nicht zugleich unerschütterlich von ihrer eigenen Kompetenz überzeugt wären. Hamlet mit seinen quälenden Selbstzweifeln würde es heutzutage kaum zu einem Sitz in einem mittleren Stadtrat oder zum Sachgebietsleiter in einem Unternehmen bringen: to be or not to be– wer interessiert sich schon dafür?
Ich will auch gar nicht abstreiten, dass man sehr wohl über gewisse Fähigkeiten verfügen muss, um auf der Leiter der Karriere Stufe für Stufe nach oben zu steigen, aber daraus leitet sich doch wohl keine ubiquitäre Kompetenz ab. Ich habe daher nie begreifen können, was denn einen Politiker oder einen Unternehmer oder einen Sportler unbedingt befähigen sollte, sich gleichermaßen kompetent über Kunst, Kultur, Geschichte oder gar den Sinn des Lebens zu äußern. Aber selbst wenn erkennbar der größte Unsinn geschwätzt wird, fühlt sich kaum jemand dadurch gehindert, mir, dem bezahlten Schreiberling, mit höchster Arroganz zu begegnen. Das aber kann ich nach all den Jahren durchaus ertragen, wenn ich danach nur die Gelegenheit habe, mich zu duschen und eine Flasche Rotwein zu trinken. Ich werde immerhin gut bezahlt, und es hätte alles noch viel schlimmer kommen können.
Aber ich war dabei, von den Ereignissen zu erzählen, die mir in jenem Frühjahr widerfahren sind. Ich saß also im Kaffeehaus und hatte gerade den ominösen Umschlag mit den Disketten und dem kurzen Begleitschreiben geöffnet. Was sich auf den Disketten verbarg, konnte ich in diesem Moment natürlich noch nicht wissen, denn üblicherweise führe ich keinen Computer mit mir, wenn ich einkaufen gehe. Das Schreiben jedoch war – nun ja: es war seltsam. Als Absender firmierte ein gewisser B. Kaempfer, der keinerlei Adresse angegeben hatte. Auch keine Telefonnummer oder einen sonstigen Hinweis darauf, wie ich mit ihm hätte in Kontakt treten können, wenn ich es denn gewollt hätte, wonach mir allerdings zunächst nicht der Sinn stand.
Der Brief war sehr höflich formuliert, und es ging darum, dass man meine Dienste gegen ein ausgesprochen üppiges Honorar in Anspruch nehmen wollte. Bei den Texten, welche ich auf den Disketten würde finden können, handele es sich um den ersten Entwurf einer Autobiographie eines nicht unbedeutenden Herren, der sich nun nach langen Jahren des Schweigens entschlossen habe, seine Erlebnisse und Erfahrungen einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Damit wolle er im Übrigen auch einige der wesentlichen und bislang ungeklärten Fragen der Geschichte der Menschheit nun endlich und abschließend beantworten.
Ich dachte sofort bei mir Aha! und überlegte schon, ob ich den Umschlag gleich wegwerfen sollte oder aber in aller Sparsamkeit die Disketten ungelesen löschen und für meine eigenen Zwecke verwenden. Aber da war doch etwas in diesem Brief, das mir die Entscheidung schwer machte, denn ich konnte durchaus die Ernsthaftigkeit, aber auch die Selbstsicherheit spüren, mit der er formuliert worden war, keine Spur von Arroganz oder Überheblichkeit, keine Schwafelei, sondern zurückhaltend, aber präzise in der Wortwahl. Außerdem war das angebotene Honorar so hoch, dass es unverantwortlich gewesen wäre, die Offerte leichtfertig abzulehnen. Was sollte denn schon passieren, glaubte ich doch, schon den schlimmsten Vertretern jener Gattung von Marktschreiern und Weltverbesserern begegnet zu sein.
Ich trank also meinen Cognac aus, zahlte die Rechnung und machte mich auf den Weg nach Hause, wo ich jedoch zunächst keine Zeit fand, mich weiter um die Disketten zu kümmern, denn während meiner Abwesenheit waren einige Nachrichten eingegangen, die alle etwas mit meinem aktuellen Auftrag zu tun hatten und deren Bearbeitung keinerlei Verzögerung duldete. Am Abend war ich bei Freunden eingeladen, blieb lange dort, fühlte mich sehr wohl, war aber danach zu keiner geistigen Arbeit mehr fähig. Ich schlief unruhig in dieser Nacht, wofür ich den reichlich genossenen Alkohol verantwortlich machte, und erledigte am nächsten Morgen, wenn auch ein wenig langsamer als sonst, die noch ausstehenden Arbeiten; den Brief und die Disketten hatte ich darüber fast wieder vergessen.
Als ich mich nach einem wegen einer Magenverstimmung eher kargen Mittagessen und einem kurzen Schlaf wieder an meinen Schreibtisch setzte und den Computer einschaltete, erwartete mich dort jedoch eine Nachricht von eben jenem B. Kaempfer, der mir Brief und Disketten zugesandt hatte. Er fragte, welchen Eindruck ich nach dem ersten Lesen der Texte hätte und wann ich mit meiner Arbeit daran beginnen könne, und er forderte mich auf, ja drängte mich geradezu, ihm umgehend eine Antwort zukommen zu lassen. Ich gebe zu, dass mich der – nun sagen wir – herrische Ton dieser Nachricht sehr verärgerte, weshalb ich sie umgehend aus dem Speicher meines Computers entfernte und mir fest vornahm, nicht mehr daran zu denken.
Zwei Tage später war ich mit meinem Wagen auf dem Weg zu einem wirklich sehr wichtigen Termin: Ich sollte einen jener Notabeln treffen, der im Labyrinth seiner unendlichen Reisen durch den Kosmos der globalisierten Wirtschaft für einige Stunden einen Aufenthalt auf dem internationalen Flughafen von Frankfurt einlegte. Ich musste in der Tat dringend mit ihm sprechen, denn es blieb nur noch wenig Zeit bis zur geplanten Veröffentlichung seines Buches, und ich hatte am Text eine Reihe von Veränderungen vorgenommen, die nur er allein autorisieren konnte. Und weil es ein wichtiger Termin war, den ich unter keinen Umständen verpassen durfte, hatte ich auch alle Eventualitäten des Verkehrs eingeplant und war entsprechend früh abgefahren. Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte, war, dass der Motor meines Wagens irgendwo mitten in der Provinz zu qualmen begann und sich weigerte, weiterhin seinen Dienst zu versehen. Um eine lange Geschichte abzukürzen: Es gelang mir nicht, rechtzeitig Hilfe zu organisieren, weil just zu diesem Zeitpunkt auch mein mobiles Telephon versagte, so dass ich schließlich und endlich den Termin in Frankfurt verpasste, ohne meinen Gesprächspartner benachrichtigen und mich entschuldigen zu können.
Man wird sich leicht vorstellen können, zu welchen Reaktionen der Verlag am nächsten Tag fähig war, als ich ziemlich kleinlaut über meine Abenteuer berichten musste. Ich war also schon in einer recht derangierten Stimmung, als ich in meinem Briefkasten zwei Briefe vorfand, in denen mir zum einen lapidar mitgeteilt wurde, dass sich zwei geplante – und höchst lukrative – Projekte nicht würden realisieren lassen, weil die vorgesehenen Autoren inzwischen ihren ökonomischen Reiz verloren hatten, nämlich der Politiker wegen erwiesener Korruption und der Sportler wegen ebenso erwiesenen Dopings. Ich hatte für die Entscheidung des Verlages durchaus Verständnis, bedauerte gleichwohl zutiefst, dass mir eine ansehnliche Summe an Geld entging. Und dieses Bedauern war umso größer, als ich mit dem anderen Brief freundlich, aber eben auch bestimmt darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass ich offenbar seit mehreren Monaten den Verpflichtungen zur Unterhaltszahlung für meine geschiedene Ehefrau einschließlich der Kinder nicht nachgekommen war, so dass man – meine Frau – sich nun also gezwungen sah, die fragliche Summe samt Verzugszinsen auf einen Schlag einzufordern, andernfalls und so weiter und so fort.
Auch wenn ich mir in den vergangenen Jahren ein wenig Geld für die Zeiten von Krise und Not auf die Seite gelegt hatte, wurde mir doch sehr mulmig ums Herz, als mir klar wurde, um wie viel Geld es hier gehen sollte: das defekte Auto, die Unterhaltszahlungen, die entgangenen Einnahmen und wahrscheinlich noch Schadensersatzforderungen in unbekannter Höhe wegen des verpassten Termins in Frankfurt. Summa summarum würde ich wahrscheinlich sogar einen Kredit aufnehmen müssen, um die Schulden bezahlen zu können, die innerhalb nur weniger Stunden aufgelaufen waren. Natürlich ängstigte mich die finanzielle Seite meiner Probleme. Aber wirklich verärgert war ich darüber, dass ich mich nun um etwas kümmern musste, das mir zutiefst zuwider war, nämlich die bürokratischen Dinge des Lebens. Ich bin schließlich gerade deshalb Autor geworden, weil ich mit solchen Sachen nie und nimmer etwas zu tun haben wollte. Meine Stimmung bewegte sich also ohnehin schon im Bereich der absoluten Verzweiflung, als am Nachmittag mein Vermieter anrief, um mir mitzuteilen, dass er nun von seinem Kündigungsrecht aus Gründen des Eigenbedarfs Gebrauch machen wolle und ich daher meine Wohnung innerhalb der nächsten drei Monate unwiderruflich zu räumen habe.
Ich muss gestehen, dass ich diese Botschaft kaum noch in ihrer ganzen Tragweite wahrnahm, weil sich in mir auf einmal eine gewisse, unnatürliche Fröhlichkeit ausbreitete, von der ich ganz genau wusste, dass sie nur der Vorbote einer umso tieferen Depression sein würde, auf deren erste Symptome ich mit dem wahrscheinlich nutzlosen Versuch reagieren würde, meine Sorgen in einer möglichst großen Menge an Alkohol zu ertränken. Nun bin ich alt genug, um zu wissen, dass man auf diese Weise keine Probleme lösen kann, aber man kann sie sehr wohl für eine bestimmte Zeit verdrängen und vergessen. Also telefonierte ich den ganzen Nachmittag, um irgendeinen Freund aufzutreiben, der bereit gewesen wäre, mich am Abend in die Trunkenheit zu begleiten, fand aber niemanden, so dass ich mich schließlich ganz allein in meinem Stammlokal fast bis zur Bewusstlosigkeit betrank und noch nicht einmal die Kellnerin dazu überreden konnte, den Rest der Nacht mit mir zu teilen. Es wäre ohnehin für keinen von uns beiden ein besonderes Vergnügen gewesen.
Ich fiel in dieser Nacht eher in eine Art von Ohnmacht, als dass ich wirklich schlief, die allerdings nach nur wenigen Stunden von pulsierenden Zahnschmerzen unterbrochen wurde. Da aber weiterhin der Alkohol über meinen Körper regierte, nutzten auch die zahlreich eingenommenen Schmerzmittel nur wenig, so dass ich mich in jener unerträglichen Mischung aus geistiger Wachheit und körperlicher Betäubung stundenlang in meinem Bett wälzte. Am nächsten Morgen waren die Zahnschmerzen immer noch höchst präsent, so dass ich keinen anderen Ausweg sah, als meine Angst vor einer jeglichen Art von Zahnärzten zu überwinden und den Arzt meines Vertrauens anzurufen. Wer aber kann die Enttäuschung beschreiben, als mir eine säuselnde Stimme auf dem Anrufbeantworter mitteilte, dass sich der Zahnarzt während der kommenden zwei Wochen in einem sicherlich wohlverdienten Urlaub befinde. Man wünsche den Patienten alles Gute und empfehle ansonsten, der örtlichen Tageszeitung die Telefonnummer des Notdienstes zu entnehmen. Ich konnte sie jedoch trotz intensiver Suche nicht ausfindig machen. Mir blieb also nichts anderes übrig, als den nächstbesten Zahnarzt in meiner Nachbarschaft aufzusuchen und dort mehrere Stunden mit qualvollem Warten zu verbringen, wobei mir im Kreise der Patienten wieder einmal sehr deutlich wurde, dass man Angst und Schmerz auch riechen kann.
Es war fast schon Nachmittag, als ich endlich zum Arzt vorgelassen wurde, der in der Zwischenzeit merkbar gut zu Mittag gegessen hatte und mich in eine Wolke aus Knoblauchduft einhüllte, so dass ich schon betäubt und beruhigt war, bevor er mit seiner Behandlung begann. Er nahm jedenfalls meine Zähne gut gelaunt, aber auch sehr intensiv in Augenschein, machte dabei einige murmelnde Geräusche und setzte mir danach umständlich auseinander, dass er im Augenblick nur sehr wenig für mich tun könne. Rein äußerlich sei kaum etwas zu erkennen, sagte er, applizierte eine Lage weißer Salbe auf mein Zahnfleisch und ließ mir dann ein Rezept für Schmerzmittel aushändigen mit der Bemerkung, ich solle mich täglich bei ihm melden, damit er den Fortgang der Krankheit – oder der Heilung, das wurde nicht ganz deutlich – auf das Genaueste würde weiterverfolgen können.
Als ich wieder zu Hause ankam, wusste ich eigentlich gar nicht, ob ich erleichtert oder verärgert sein sollte, denn die Schmerzen hatten tatsächlich nachgelassen, ohne aber völlig verschwunden zu sein. Dafür hatte ich aber einige Stunden meiner kostbaren Zeit damit verbracht, letztlich doch eher vergeblich in einem überfüllten Wartezimmer herumzulungern. Nun hatte ich aber eigentlich nichts mehr zu erledigen, denn die Aufträge, auf die ich mich vorbereiten wollte, waren ja storniert worden. Trotzdem schaltete ich den Computer ein, um wenigstens an meinen eigenen Texten zu arbeiten, selbst wenn sich niemand sonst dafür interessierte. Aus reiner Gewohnheit ließ ich mir die Nachrichten zeigen, und tatsächlich fand sich dort auch eine neue Meldung von besagtem B. Kaempfer, die ich dann aus purer Neugierde aufrief. Erneut wurde ich befragt, welchen Eindruck die Texte auf mich gemacht hätten und wann ich mit der Arbeit daran beginnen wolle. Diesmal aber war die Nachricht ergänzt um den Hinweis, dass ich nun doch wohl genügend Zeit dafür haben und das Honorar dringend benötigen sollte, zumal man nie wissen könne, wie teuer sich letztlich aufwendige Zahnbehandlungen gestalten würden.
Man kann sich vorstellen, dass ich in diesem Augenblick mehr als verblüfft war. Wie konnte jener B. Kaempfer so genau über meine derzeitige Lage informiert sein? Ich hatte mit niemandem darüber gesprochen, und der Hinweis auf die möglichen Kosten einer Zahnbehandlung war sogar für mich überraschend. Davon hatte der Zahnarzt nichts erwähnt, auch wenn ich mich nun wieder an das wohlige Lächeln in seinem Gesicht erinnerte, als er mich aufgefordert hatte, ihn demnächst möglichst häufig zu konsultieren. Aber wie konnte B. Kaempfer, den ich überhaupt nicht kannte, geschweige denn, dass ich ihn in die Intimitäten meines Lebens eingeweiht hätte, davon wissen? Was wollte B. Kaempfer eigentlich von mir? – Und da ich sonst nichts weiter zu tun hatte und sich meine Zahnschmerzen nach der Einnahme einiger starker Tabletten verflüchtigt hatten, beschloss ich, mich an diesem Abend um die Texte auf den Disketten zu kümmern und dann zu entscheiden, was weiterhin zu tun sei.
Es war ein umfangreiches Werk, das sich mir im Verlaufe jenes Abends darbot, riesige Dateien, meist unformatiert, so dass ich Mühe hatte, sie überhaupt in eine lesbare Form zu bringen, denn für mich spielt die Ästhetik immer eine ganz wichtige Rolle. Während ich also die Dateien in ein neues Format brachte, hatte ich Gelegenheit, die Texte ein erstes Mal zu überfliegen. Aber danach wusste ich immer noch nicht, was ich damit anfangen sollte. Auch beim zweiten Mal, als ich mich dann ausführlicher mit ihnen befasste, manche Passagen sogar mehrmals las, erschlossen sich mir Sinn und Absicht der Texte nicht unmittelbar. Sie waren Seite für Seite angefüllt mit obskuren Hinweisen, dazu versehen mit seltsamen Zitaten in allen möglichen Sprachen, die mir trotz all meiner Lebenserfahrung noch nie vor die Augen oder Ohren gekommen waren, und schließlich gespickt mit Namen von mehr oder minder erlauchten Personen aus allen Zeiten und Gegenden der Welt. Manche davon waren mir wohlbekannt, weil ich mich mit ihnen oder ihren Werken einmal selbst ausführlicher beschäftigt hatte, andere klangen mir durchaus glaubhaft, auch wenn ich von ihnen noch nie etwas gelesen hatte, aber es gab darunter viele Namen und Orte, die mir eher schlichtweg erfunden vorkamen.
Nun war in dem Brief, welcher den Disketten beigefügt gewesen war, davon die Rede, dass es sich bei den Texten um die Lebenserinnerungen einer hoch gestellten Persönlichkeit handeln sollte. Was ich dann aber tatsächlich vorfand, machte auf mich den Eindruck einer mehr oder minder gelungenen Form von Literatur. Jedenfalls hatte ich bei allem Verständnis für eine historische Einbettung auch des individuellen Lebens meine Probleme damit, dass jemand seine Autobiographie schon mit der Zeit vor dem Anfang aller Dinge beginnen wollte. Für mich wurde die Bewertung immer eindeutiger: Entweder machte sich jemand einen sehr aufwendigen Spaß mit mir, oder aber jener B. Kaempfer war ganz einfach –verrückt.
Beide Varianten waren mir nicht besonders angenehm, denn in meinen Gedanken klang bohrend immer noch die letzte Nachricht nach, die ich von B. Kaempfer erhalten hatte und in der ja enthüllt worden war, welche weit reichenden Kenntnisse er über mein Leben hatte. Falls also B.Kaempfer tatsächlich verrückt sein sollte (und ich hatte mich inzwischen eher für diese Möglichkeit entschieden, denn der Aufwand, den man mit der Formulierung jener länglichen Texte getrieben haben musste, schien mir eindeutig zu groß zu sein für einen einfachen Scherz unter Freunden), wenn er also verrückt sein sollte, dann war er aber auch zugleich höchst gefährlich. Offenbar hatte diese Person Zugang zu ansonsten strikt vertraulichen und geheimen Informationen über mich und meine Lebensumstände.
Also überlegte ich, was zu tun sei, und dachte dabei auch daran, dass es bei allem ja um eine recht große Summe Geld gehen sollte, ein Umstand, der mir in jenem Augenblick als nicht ganz unwesentlich erscheinen musste. Mir war klar, dass ich niemanden ins Vertrauen ziehen konnte, wenn ich nicht selbst für verrückt oder doch wenigstens überspannt gehalten werden wollte. Was konnte ich schon an materiellen Beweisen für irgendeine Theorie vorbringen? Dass ich eine seltsame Synchronizität von Zahnschmerzen und elektronischen Nachrichten erfahren hatte? Dass man mir Geld für meine Arbeit anbot? Dass ich eben dieses Geld gerade jetzt durch welche Zufälle des Lebens auch immer dringend benötigte?
Eigentlich war doch wirklich nichts vorgefallen, das der Rede wert gewesen wäre, außer eben jener seltsamen Häufung von Ereignissen, die eine Situation geschaffen hatten, in welcher ich kaum eine andere Wahl hatte, als das Angebot von B.Kaempfer so schnell wie möglich anzunehmen. Schließlich konnte es mir völlig gleichgültig sein, für wessen Inkarnation er sich schließlich und endlich halten wollte, von mir aus für den Papst und den Marquis de Sade jeweils einzeln oder zur gleichen Zeit oder für wen auch immer, solange jedenfalls das Honorar stimmte. Immerhin war ich auf genügend andere Verrückte getroffen, die sich für begnadete Politiker oder Unternehmer oder irgendetwas anderes hielten und denen man es in der Öffentlichkeit sogar geglaubt hatte.
Also entschloss ich mich, nun doch, noch in derselben Nacht, auf die Nachricht von B. Kaempfer zu antworten und um ein persönliches Gespräch zu bitten, was mir dringend erforderlich erschien, damit ich mir ein eigenes Bild von ihm machen konnte, bevor ich mich auf weitere Schritte einließe. Ich bekenne auch, dass mir die Aussicht auf das Honorar umso verlockender vorkam, je länger ich darüber nachdachte, denn – so glaubte ich – das Schlimmste, das mir überhaupt widerfahren konnte, wäre allenfalls, dass mir dieser Auftrag verloren ging, wodurch ich dann in keiner Weise schlechter gestellt sein würde als jetzt ohnehin schon. Ich setzte ein wohlformuliertes Schreiben auf und ließ darin in aller Angemessenheit mein Interesse an einer Zusammenarbeit mit jenem sehr geehrten Herrn B. Kaempfer erkennen. Es muss kurz vor Mitternacht gewesen sein, als ich meine Nachricht, versehen mit allen guten Wünschen, in die elektronische Welt entließ. Meine Zahnschmerzen hatten sich noch nicht wieder gemeldet, ob nun wegen der Schmerzmittel oder wegen der nun doch spürbaren Erleichterung, sei dahingestellt. Ich legte mich ohne weitere Verzögerung ins Bett, wo ich noch einige Seiten im Buch eines französischen Philosophen las, die ich kaum verstand, die mich aber auf eine angenehme Art so weit ermüdeten, dass ich nach wenigen Minuten das Licht löschte und sofort in einen tiefen Schlaf verfiel.
Geweckt wurde ich dadurch, dass plötzlich ein Mann mitten in meinem Schlafzimmer stand, der mit beruhigenden Gesten und leisen Worten auf mich einsprach, als er mein erschrecktes Erwachen bemerkte. Als ich meine Brille nahm und genauer hinsah, fiel mir auf, dass er gut, ja sogar elegant gekleidet war, von mittlerem Alter mit drei glänzenden Strähnen in seinem Haar und einem kleinen, sehr gepflegten Bärtchen an seinem Kinn. Was sofort einen besonderen Eindruck auf mich machte, war der Umstand, dass er eine gewisse Aura auszustrahlen schien, die im ansonsten dunklen Schlafzimmer ein angenehmes Licht verbreitete. Allmählich wich mein Schrecken einer ebenso tiefen Verwunderung, denn auch wenn der Mann keinesfalls den Eindruck eines Einbrechers oder anderer, unlauterer Absichten machte, blieben doch einige Fragen zunächst ohne Antwort, vor allem danach, wie und zu welchem Zweck er sich Zugang zu meiner Wohnung im Allgemeinen und zu meinem Schlafzimmer im Besonderen verschafft hatte.
Ich weiß nicht, wie andere Menschen darüber denken, aber für mich ist das Schlafzimmer nun einmal der Ort allerhöchster Intimität, vor allem des Nachts. Ich hüstelte also und unterbrach ihn in seinen beschwichtigenden Worten mit der wohl wichtigsten Frage, nämlich danach, was er denn hier und jetzt in meinem Schlafzimmer zu suchen habe. Er schaute mich an, als ob er meine Frage nicht verstanden hätte, schüttelte den Kopf und antwortete dann, dass ich ihn doch vor kurzem selbst zu einem persönlichen Gespräch eingeladen hätte. Er habe daraufhin nicht gezögert, sofort zu mir zu eilen, auch wenn dafür einige andere wichtige Termine abgesagt werden mussten. Darum aber solle ich mich nicht kümmern, das sei allein seine Angelegenheit. Nun sei er hier, um mit mir über das weitere Vorgehen zu sprechen. Und als ich immer noch nicht den Eindruck machte, als hätte ich alles richtig verstanden, fügte er mit einer großen Geste der Entschuldigung hinzu, dass er wohl vergessen habe, sich mir in aller Form vorzustellen: Er sei B. Kaempfer und überaus erfreut, meine Bekanntschaft zu machen.
Nun war völlig klar, dass es sich um einen Verrückten handeln musste, und um einen gefährlichen zudem, denn immerhin war er mitten in der Nacht in meinem Schlafzimmer erschienen, und wer dazu fähig ist, kann auch noch auf ganz andere Gedanken kommen. Ich musste also jegliche Gefühle verdrängen und mich allein auf die Freundlichkeit konzentrieren, weil ich darin die einzige Möglichkeit sah, möglichen Schaden abzuwenden, und so komplimentierte ich ihn in mein Arbeitszimmer, kleidete mich schnell an, denn ich wollte ihm nicht in meinem schlotterigen Schlafanzug gegenübertreten. Und zu guter Letzt zündete ich mir eine Zigarette an und folgte ihm.
B. Kaempfer hatte es sich auf dem Sessel vor meinem Schreibtisch bequem gemacht, so dass mir selbst nur der alte Holzstuhl blieb, den ich längst hatte wegwerfen wollen, der sich aber als Ablage für alle nur möglichen Papiere bewährt hatte. Um die Situation weiter zu entspannen, bot ich Getränke an, und B. Kaempfer wählte für sich den Rotwein. Inzwischen hatte er eine dicke Zigarre entzündet und blies fröhlich Rauchwolken in die Luft, was mich ein wenig störte, aber es hätte meiner Strategie widersprochen, mit ihm darüber eine wahrscheinlich eher nutzlose Debatte zu beginnen. Nein, es musste mir unter allen Umständen darum gehen, eine freundliche, wenn möglich sogar gemütliche Atmosphäre zu schaffen, um eine jegliche Aggression im Keime zu ersticken. Und weil ich es einmal so gelernt hatte, versuchte ich das Gespräch zunächst in unverfängliche Bahnen zu lenken, aber B. Kaempfer ließ sich davon nicht beeindrucken, sondern schien seine eigene Strategie zu verfolgen und kam sofort auf die Texte und meine zukünftige Arbeit daran zu sprechen.
Ihm sei sehr wohl bewusst, so sagte er, dass Stil und Sprache seiner Aufzeichnungen heutzutage wohl ein wenig altmodisch anmuten mochten, aber das sei nun einmal seine Art, und gerade deshalb wolle er mich damit beauftragen, sie moderat zu modernisieren und an den gerade gültigen Geschmack anzupassen. Dass dabei Sinn und Zweck ebenso wenig verloren gehen dürften wie die durchaus bewusst gewählte Dramaturgie, müsse selbstverständlich sein. Er, B. Kaempfer, sei sich aber sicher, dass ich inzwischen mit solchen Aufgaben genügend Erfahrung gesammelt hätte. Deshalb sei im Übrigen die Wahl auf mich gefallen, denn man habe meine Arbeiten in den vergangenen Jahren sehr genau ausgewertet und dabei auch auf diejenigen Texte und Sujets geschaut, die meiner eigenen Verantwortung entstammten.
Ich stutzte ein wenig, denn die meisten dieser Projekte sind nie veröffentlicht worden, eben weil ich keinen Verlag dafür hatte finden können. Nun saß mir mitten in der Nacht ein Herr mittleren Alters in meinem eigenen Arbeitszimmer auf meinem eigenen Sessel gegenüber und sprach davon, als seien sie in Millionenauflage erschienen. Mir wurde wieder angst und bange, und ich musste mich schon sehr konzentrieren, um mich ruhig und gelassen für all die Freundlichkeiten zu bedanken. Meine Gedanken aber kreisten allein darum, wie ich den ungebetenen Besucher so schnell wie möglich würde wieder verabschieden können, ohne seinen Zorn auf mich zu ziehen. Doch während ich mir noch darüber Gedanken machte, spürte ich, wie die Zahnschmerzen zurückkehrten, und zwar in einer Intensität, wie ich sie noch nie zuvor verspürt hatte. Er muss mir den Schmerz wohl angemerkt haben, denn sofort beugte sich B. Kaempfer zu mir und machte eine tröstende Bemerkung, allerdings verbunden mit dem Hinweis, dass Zahnschmerzen häufig psychosomatischer Natur seien und ich mich doch besser entspannen solle, auch wenn er gut verstehen könne, dass mich sein unangemeldetes Eindringen emotional wohl ein wenig aufgerührt haben müsse. Er könne mir nur dringend raten, alle unnützen Gedanken zu verscheuchen, um sich ganz auf unser Gespräch zu konzentrieren. Ich nehme an, dass diese Worte beruhigend klingen sollten, aber sie waren begleitet von einem Lächeln, wie ich es noch nie in meinem Leben gesehen hatte.
Die Schmerzen ließen wieder nach, und so konnte ich auch B. Kaempfers weitläufigen Ausführungen über die Literaturgeschichte folgen, die von höchster Sachkenntnis geprägt waren, jedenfalls so weit ich es beurteilen konnte. Er verzettelte sich hier und dort, kam aber doch immer wieder auf sein eigentliches Thema zu sprechen und endete nach einiger Zeit abrupt damit, dass er einige Papiere aus seiner Jackentasche zog, sie auseinander faltete und mit sorgsamen Bewegungen auf meinem Schreibtisch glatt strich. Er forderte mich auf, zu ihm zu kommen, und als ich mich näherte, erkannte ich, dass es sich bei diesen Papieren um einen Vertrag handelte. B. Kaempfer zeigte mir die Stelle, an welcher ich unterschreiben sollte, und blickte mich erwartungsvoll an. Nun also war der Moment der Wahrheit gekommen, und ich wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte. Stotternd versuchte ich, darauf hinzuweisen, dass ich mich üblicherweise mit einem Rechtsanwalt berate, bevor ich einen Vertrag schließe, und dass er mir doch bitte jetzt den Entwurf hinterlassen solle und ich mich dann so bald wie möglich bei ihm melden werde.
An das, was danach geschah, kann ich mich jedoch nicht mehr so genau erinnern: Ich weiß nur noch, dass ich ein leichtes Stechen in meinem rechten Zeigefinger verspürte, bevor alles um mich herum dunkel wurde. Und als ich am folgenden Morgen aufwachte, lag ich in meinem Bett, wieder in meinem schlotterigen Schlafanzug, und je länger ich über die nächtliche Begegnung nachdachte, desto mehr verschwammen die Erinnerungen, bis ich kaum mehr darüber hätte sagen können als über einen zwar realistischen, aber letztlich doch wahnhaften Traum. Das jedenfalls redete ich mir ein und war fast überzeugt davon, bis ich in mein Arbeitszimmer trat, wo rein gar nichts auf irgendeine nächtliche Unterhaltung deutete, außer dass ich im ersten Moment glaubte, noch den Geruch einer Zigarre spüren zu können. Nachdem ich aber das Fenster für einige Zeit geöffnet hatte, war auch davon nichts mehr zu bemerken. Als ich dann in meine Küche kam, hatte ich zunächst den Eindruck, es habe sich hier jemand zu schaffen gemacht, aber die Indizien dafür – wie eine im Regal möglicherweise fehlende Flasche Rotwein oder ein noch feuchtes Geschirrtuch – waren zu vage, als dass ich daraus hätte Schlussfolgerungen ziehen wollen.
Alle diese Ereignisse wären kaum der Rede wert gewesen, und ich hätte sie hier nicht in dieser Ausführlichkeit beschrieben, wenn ich nicht am nächsten Tag erneut eine Benachrichtigung der Post in meinem Briefkasten gefunden hätte. Mir blieb auch dieses Mal nichts anderes übrig, als mich auf den Weg zu machen und abzuholen, was dort für mich bereitlag. Es handelte sich um einen recht dicken Umschlag, den ich nach den Erfahrungen der vergangenen Tage sofort öffnete. In ihm steckte ein umfangreiches Schriftstück, das sich bei näherer Überprüfung als ein veritabler Vertrag erwies, abgeschlossen zwischen B. Kaempfer einerseits und andererseits –mir. Es gab auch keinen Zweifel an der Echtheit meiner Unterschrift, außer dass ich mich nicht erinnern konnte, jemals und überhaupt einen solchen Vertrag unterzeichnet zu haben und erst recht nicht mit roter Tinte. Ich war dermaßen verwundert, dass ich am Schalter wie angewurzelt stehen blieb und mir einige unfreundliche Bemerkungen anhören musste, bevor ich begriff, was um mich herum geschah. Ich steckte also alles wieder zurück in den Umschlag und beeilte mich, nach Hause zu kommen, um in aller Ruhe zu klären, was hier eigentlich vor sich ging. Wie im Traum lief ich die Straßen zurück, achtete dabei kaum auf den Verkehr, während Tausende von abgründigen und düsteren Gedanken durch meinen Kopf schossen und sich immer mehr ineinander verwirrten. In meiner Wohnung angekommen, legte ich den ominösen Umschlag erst einmal zur Seite, trank ein großes Glas Wasser und versuchte, meine Gedanken einigermaßen zu ordnen, was mir aber trotz allen Bemühens nicht so recht gelingen wollte.
Schließlich nahm ich den Umschlag wieder zur Hand, aber wenn ich gehofft haben mochte, dass sich das Schriftstück in der Zwischenzeit vielleicht verflüchtigt hätte, so wurde ich enttäuscht: Die roten Flecken auf dem Umschlag waren noch deutlich sichtbar vorhanden, ebenso wie der Vertrag, abgeschlossen zwischen B. Kaempfer und mir selbst. Ich brauchte zwei Zigaretten, bis es mir endlich gelingen sollte, den Vertrag nun auch in seinen Details zu lesen, und auf den ersten Blick machte er gar keinen schlechten Eindruck. Die Zahlungsbedingungen und die Termine waren eher zu meinen Gunsten geregelt, und meine Aufgaben waren hinlänglich genau beschrieben, so dass ich mich über den Inhalt zunächst überhaupt nicht hätte beklagen müssen.
Als ich dann aber den Vertrag zum zweiten Mal, nun etwas genauer, las, fiel mir auf, dass es einen besonderen Teil gab, der offenbar kein direkter Teil des Vertrages selbst war, sondern eine Art von Nebenabrede, in welcher unter anderem die Poenalien geregelt waren, namentlich für den Fall, dass ich meinen Verpflichtungen aus welchen Gründen auch immer nicht nachkommen sollte. Als Strafe drohten zunächst Zahnschmerzen und dann im Falle der Wiederholung der Verlust meiner Seele für alle Ewigkeit. Zudem waren dort alle anderen Rechtsmittel ausdrücklich ausgeschlossen, was konkludent damit begründet wurde, dass ich den Vertrag immerhin mit meinem eigenen Blut unterschrieben hätte.
Nur um mich ein wenig zu beruhigen, schickte ich umgehend den Vertrag zu einem Anwalt, mit dem ich auch sonst zusammenzuarbeiten pflegte. Ich unterließ es jedoch, ihm die Nebenabrede zu übermitteln, denn ich wollte mich in den Augen meiner Freunde nun nicht unbedingt lächerlich machen. Die Antwort kam prompt, verbunden mit dem Hinweis, dass aus rein juristischer Sicht keinerlei Einwendungen nötig seien. Man rate mir aber trotzdem dringend und in aller Freundschaft, in Zukunft vor dem Abschluss von Verträgen den Anwalt zu konsultieren, was ich in diesem Fall als eine vielleicht unbewusste, gleichwohl ärgerliche Form von Klugscheißerei ansehen musste. Trotzdem rief ich den Anwalt sofort an, bedankte mich für seine Unterstützung, versprach Besserung für die Zukunft und fragte dann nur noch en passant, welchen juristischen Wert etwaige Nebenabreden haben könnten, wenn sie denn ebenfalls schriftlich und von beiden Seiten unterschrieben vorliegen. Daraufhin antwortete mir der Anwalt fröhlich und unmissverständlich, dass dann auch daran kein Zweifel bestehen könne.
Nun war ich also vertraglich an B. Kaempfer gebunden, was mir für die nächste Zeit ein hohes und festes Einkommen versprach, allerdings an Kautelen gebunden war, über deren konkrete Konsequenzen ich mir keine genaueren Vorstellungen machen konnte. Die Erfahrungen der vergangenen Tage ließen es mir jedoch als nicht sinnvoll erscheinen, wirklich bis an die möglichen Grenzen des Vertrages zu gehen, denn ich hatte keinen weiteren Bedarf an Ungemach und vor allem nicht an Zahnschmerzen, und was nach dem Verlust meiner Seele würde geschehen können, wollte ich gar nicht erst ausprobieren. Ich gebe gerne zu, dass ich Angst hatte und mich nur sehr langsam an diesen Zustand gewöhnte, auch wenn über der Arbeit die Erinnerungen allmählich verblassten.
Und das Maß an Arbeit, das ich in den kommenden Wochen zu leisten hatte, war tatsächlich ungemein groß, denn mit den Disketten, die ich mit dem ersten Brief erhalten hatte, war es bei weitem nicht getan. In einem wöchentlichen Rhythmus erhielt ich immer wieder neue davon mit Texten, die sich in ihrer Qualität und vor allem Quantität kaum von den vorherigen unterschieden. Natürlich versuchte ich, mit B. Kaempfer über elektronische Nachrichten in ständigem Kontakt zu bleiben und ihn auch mit aller Vorsicht darauf hinzuweisen, dass es für alle Beteiligten viel weniger Arbeit und Aufwand bedeuten würde, wenn er seinen sehr spezifischen Stil des Schreibens von vornherein ein wenig mehr den heutigen Gegebenheiten anpassen würde.
Aber ich hatte wenig Erfolg damit und erhielt nur die lapidare Antwort, dass ich genau dafür bezahlt werde und mich ansonsten aller Kommentare zu enthalten habe, wobei er mich im Falle der Zuwiderhandlung auf die entsprechenden Bestimmungen in der Nebenabrede zum Vertrag aufmerksam machte. Also blieb mir nichts anderes übrig, als jene umfangreichen Texte Wort für Wort und Zeile für Zeile zu redigieren, und zwar mit aller gebotenen Vorsicht, um den Auftraggeber nicht übermäßig zu verärgern. B. Kaempfer war nämlich wie die meisten Autoren, die ich bislang kennen gelernt hatte, der festen Überzeugung, dass er mit seiner Art des Schreibens neue Standards in der Literatur setzen würde. Nun konnte es mir aber auch ziemlich gleichgültig sein, waren doch die von mir zu erbringenden Leistungen genau beschrieben, und ich hätte mich immer darauf beziehen können, dass ich nicht für den späteren Erfolg des Werkes verantwortlich war, aber nach all meinen Erfahrungen mit B. Kaempfer war ich mir dessen nicht mehr ganz sicher.
Und allein deshalb, nämlich um meines eigenen guten Rufes wegen, will und muss ich jetzt etwas zu meiner editorischen Arbeit sagen: Ich habe versucht, die oft sehr altmodisch klingende Sprache B. Kaempfers behutsam zu modernisieren, ohne dabei den Fluss und den Duktus allzu sehr zu verändern. Ebenso habe ich alle Zitate und Verweise in fremden Sprachen entweder übersetzt – sofern ich dazu in der Lage war oder B. Kaempfer mir entsprechende Hilfen bereitstellte, was nicht immer der Fall war –, oder ich habe sie schlichtweg ausgelassen, weil es andernfalls für den Leser kaum hilfreich gewesen wäre, sich seitenweise durch Texte in georgischer oder koptischer Sprache zu arbeiten. Deren Inhalte wären sicherlich höchst interessant und aufschlussreich gewesen, hätte man sie denn verstehen können.
Über diese und ähnliche Fragen musste ich mit dem geschätzten Autor längliche Diskussionen führen, die häufig darin gipfelten, dass ich tagelang unter furchtbaren Zahnschmerzen zu leiden hatte, doch ich habe schließlich und endlich die Debatten zu meinen Gunsten – und, wie ich hoffe, auch zugunsten des Lesers – entscheiden können, und zwar mit dem einfachen Argument, dass letztlich nicht der Autor, sondern der Leser darüber entscheidet, ob ein Buch gelesen wird. Die intentio lectoris siegt immer über die intentio auctoris– das musste selbst B. Kaempfer wohl oder übel einsehen. Es störte mich nicht besonders, dass er mich als einen schnöden Utilitaristen beschimpfte, denn wenn ich diese Aufgabe schon hatte übernehmen müssen, dann wollte ich sie erledigen, so gut ich es nur eben konnte.
Was also die von B. Kaempfer verwendeten geheimen oder vergessenen Sprachen anging, so hatte ich, wie man gleich sehen wird, einen Erfolg erzielen können; in Bezug auf die vielen Namen jedoch, die in den Texten manchmal seitenweise als Beleg für die jeweiligen Hypothesen und Theorien aufgeführt wurden, oder weil es so schien, dass sie dem Autor gerade durch den Kopf gegangen waren, hatten meine vielfachen Hinweise weniger Erfolg – diese Namen sind weitgehend erhalten geblieben, auch wenn sie für das Verständnis der Texte nicht immer erforderlich sind. Aber es bleibt dem Leser überlassen, was er daraus macht.
Auf jeden Fall aber empfehle ich die Lektüre der Anmerkungen; sie sind für das Verständnis der Ausführungen des B. Kaempfer zwar auch nur in gewissen Maßen hilfreich, weil diese seltsamen Texte eben so sind, wie sie sind, aber doch recht angenehm zu lesen, wenn man überhaupt nicht mehr ein noch aus weiß, wenn der Autor sich wieder einmal auf wahnhafte Abschweifungen einlässt. Davor habe ich ihn stets gewarnt, leider aber ohne anhaltenden Erfolg. Nur der Vollständigkeit halber will ich hier noch erwähnen, dass ich mir besondere Mühe damit gemacht und eine Reihe von Kapazitäten dazu konsultierte habe, und deshalb bitte ich den geneigten Leser sehr herzlich, davon fleißig Gebrauch zu machen.
Man wird verstehen, dass ich auf jeden Fall anonym bleiben möchte, denn die ganze Angelegenheit ist mir äußerst peinlich. Vielleicht hätte ich gar nichts weiter dazu sagen sollen, aber ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass ich mir und meiner Ehre einige Erklärungen schuldig bin, auch wenn ich mich weiterhin hinter dem Schleier der Namenlosigkeit verbergen will. Vor allem aber muss ich betonen, dass ich keinerlei Verantwortung für die Texte und die darin geäußerten Meinungen und Bewertungen übernehmen kann. Trotzdem nenne ich meinen Namen nicht, um unter keinen Umständen in irgendwelche juristischen Verwicklungen gezogen werden zu können, denn danach steht mir nach all dem, was mir in den vergangenen Wochen und Monaten widerfahren ist, nun überhaupt nicht der Sinn.
Ich will nur noch ein ruhiges Leben führen in den Jahren, die mir vergönnt sind. Was danach geschieht, wird man zu sehen haben, denn darüber mache ich mir nur selten Gedanken, auch wenn ich ihnen in manchen Nächten, wenn der volle Mond hoch am Himmel steht, nicht entgehen kann. Aber das bleibt die Ausnahme, und ich weiß inzwischen, wie ich damit zu verfahren habe. Es bleibt jedoch eine labile Balance, und so versuche ich alles zu vermeiden, was dieses mühsam erreichte Gleichgewicht in irgendeiner Weise stören könnte. Ich will nichts mehr, aber auch rein gar nichts mehr damit zu tun haben. Ich will nur noch in Ruhe gelassen werden, und ich freue mich über einen jeden Tag und eine jede Nacht, da mir dies gelingt.
Über den Inhalt der Texte will ich mich daher erst recht nicht äußern; ich habe sie so akzeptiert, wie sie mir geliefert worden sind, außer dass ich versucht habe, sie in eine gewisse chronologische Reihenfolge zu bringen, was ebenfalls einige Diskussionen mit B. Kaempfer auslöste, der seine sehr eigenen Vorstellungen über die zeitlichen und dramaturgischen Abläufe hatte. Letztendlich aber gelang es mir doch. Ansonsten habe ich auch dann nicht eingegriffen, wenn mir die Geschichten und vor allem die Bewertungen als höchst obskur erschienen und nach meiner Auffassung und Erfahrung noch nicht einmal unter die vielfältigen und gnädigen Kategorien der Literatur zu fassen waren. Auch darüber habe ich versucht mit B. Kaempfer zu sprechen, aber hier blieben alle Versuche ohne ein jegliches Ergebnis, und mit Rücksicht auf die Vertragsstrafen wollte ich nicht unbedingt als starrsinnig erscheinen.
So blieb dann letztlich mein Einfluss auf die Texte des B. Kaempfer eher beschränkt. Darüber will ich mich gar nicht weiter beklagen, denn meine Verantwortung dafür war spätestens in dem Moment beendet, als B. Kaempfer sie in einem aufwendigen Verfahren autorisiert hatte, zumal er mir die endgültige Fassungen nicht in jedem Fall noch einmal vor der Drucklegung zur Kenntnis gegeben hat, warum auch, ist es doch allein sein Werk, und mich geht es nichts an.
Für mich ist die ganze Angelegenheit damit erledigt, ich habe meinen Teil des Vertrages erfüllt und meine Arbeit geleistet. Alles, was ich jetzt noch erwarte, ist ein Brief oder eine Nachricht von B. Kaempfer, mit der er mir ausdrücklich und schriftlich bestätigt, dass er keinerlei Ansprüche mehr gegen mich geltend machen will, damit ich endlich wieder in Frieden leben kann. Ich habe zwar seit einiger Zeit keine Zahnschmerzen mehr, und inzwischen erhalte ich wieder von diversen Verlagen neue Aufträge, mit denen ich meinen Lebensunterhalt mehr als in nur angemessener Weise bestreiten kann, und meine neue Wohnung erweist sich sogar als viel angenehmer und ruhiger als die Klabache, in der ich vorher habe wohnen müssen. Auch das Honorar ist mir in vollem Umfange und rechtzeitig auf mein Konto überwiesen worden, so dass ich wirklich keinen Grund zur Beschwerde haben sollte.
Aber: Ich bin in diesen Dingen vielleicht ein wenig pedantisch, und deshalb bestehe ich auf einem solchen Schriftstück, mit dem mir die Freiheit zurückgegeben wird. Doch bislang sind alle Versuche fehlgeschlagen, B. Kaempfer noch einmal unter seiner elektronischen Adresse zu erreichen, meine Nachrichten verflüchtigen sich ohne Antwort und Spur. Ich könnte alles auf sich beruhen lassen, wenn ich nicht manchmal morgens abgestandenen Zigarrenrauch in meinem Arbeitszimmer riechen würde, aber dann öffne ich ganz weit das Fenster.
Erster Satz
Genesis
Allegro vivace
Man stelle sich einmal vor, es wäre schon jetzt der Letzte aller Tage, dann, wenn mit allem Brimborium und lautem Schellenklang, mit Pauken & Trompeten das Große Gericht beginnen wird, damit ein jeder gerichtet werde nach seinen Werken. Dann wird auch ein jeder fünfzehn Fragen zu beantworten haben, und zwar deshalb, weil nämlich Fünfzehn die wahrlich einzige heilige Zahl ist, denn Sieben steht für das Böse, so wie die Sieben Todsünden, welche sind der Hochmut und der Geiz und vor allem die Wollust und auch der Neid und die Völlerei und schließlich noch der Zorn und die Trägheit – doch halt! hat man nicht schon einmal von den Sieben Samurai1 gehört, welche man zunächst genannt hat die Shichinin no samurai, dann erst The Magnificent Seven, was jedoch nicht falsch war, und die Samurai, sieben an der Zahl, waren doch eigentlich recht gut, nicht wahr, aber eben in einer völlig anderen Kultur, und das lehrt uns überhaupt nichts, und gibt es dann nicht auch noch die Sieben Zwerge, und was ist aus denen eigentlich geworden, die waren doch auch gut, oder?, jedoch sehr klein, sonst wären es ja keine Zwerge gewesen, sondern etwas anderes, und deshalb lehren sie uns nichts, denn was soll das Große schon aus dem Kleinen lernen können, und was gehen uns schließlich die Zwerge an, wir jedenfalls sind keine Zwerge und wollen keine mehr werden, auch wenn wir alle früher einmal ganz klein angefangen haben.
Wie dem auch sei: Die Sieben ist ohne Zweifel die Sünde, das Böse, das Kranke, und der siebte Sohn wird zum Werwolf2 und heult des Nachts, wenn der Mond in vollem Lichte steht. Die Sieben weist uns auf das Infernalische, das heilige Hebdomas, das steht für die sieben Planeten, welche einst waren die Archonten3, die Obersten Anführer der Dämonen, die zuerst geschaffen haben die Welt und das Böse in ihr, weshalb man ihnen völlig zu Recht auch Hochmut und Grausamkeit zuschrieb und noch vieles mehr, von dem wir hier allerdings schweigen wollen, weil es die Imagination des modernen Menschen überschreiten würde. Doch wir nennen ihre Namen, und es waren Jaldabaoth und Ja, das Schlangengesicht mit den sieben Häuptern, Sabaoth, mit dem Gesicht der leuchtenden Flammen, und Astaphaios, die Hyäne, Adonaios, der Drache, und , der Esel, und dabei nicht zu vergessen , den Mond, denn auch er war das Kind der , welche glaubte an die Weisheit und von der man sagt, dass sie den Jaldabaoth in seiner Löwengestalt, den man sonst nennt , das ist Narr, getragen und geboren hat, ohne sich zuvor in ihrer Lüsternheit mit irgendjemandem zu paaren, was zweifellos eine große Leistung, aber auch eine große Vermessenheit gewesen war, mit welcher zugleich das Böse in die Welt eindringen konnte, was nur zu verhindern gewesen wäre, hätte sie sich in ihr Schicksal gefügt und vom Guten Gott des Himmels empfangen, um den zu gebären, welcher hätte gut sein können wie sein Vater und weise wie die Mutter. Und bedeutet schließlich nicht auch, dass man die feineren von den gröberen Teilen durch ein sorgfältiges Schütteln trennt, dass man nach strengen Kriterien auswählt und aussondert, und was anderes ist geschehen im Moment der Schöpfung, als dass das Unwürdige ungeschaffen zurückblieb, und wird es sich nicht wiederholen am Letzten aller Tage, damit auserwählt werden die Gerechten und die Engel sie auf Händen tragen und sie bekleidet sind mit den Kleidern des ewigen Lebens?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























