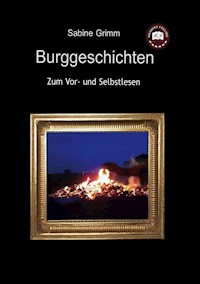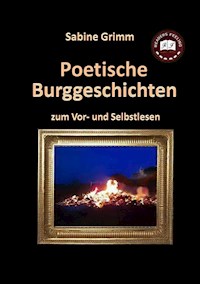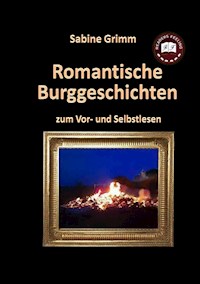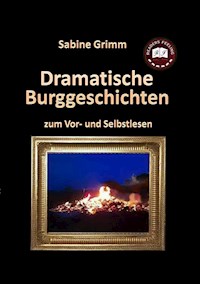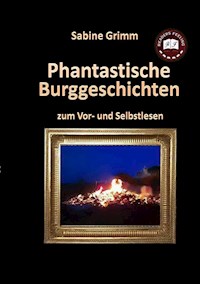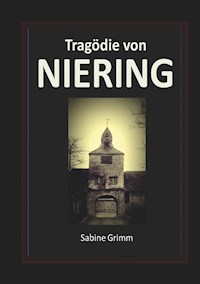
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das alte Rittergut Niering im Ortsteil Speckhorn der Stadt Recklinghausen in Deutschland gehörte zum Vest Recklinghausen. Der 6. Juni 1762 war ein schicksalhafter Tag. Zu der Zeit war es auf Gut Niering zu dem gekommen, was als Tragödie von Niering in die Geschichte eingegangen ist. Unter geheimnisvollen Umständen starb hier Franz Anton Horst, Herr zu Ost- und Westniering. Die Leute behaupteten damals, dass die junge Ehegattin den Mörder gedungen habe, um schnell in den Besitz des wertvollen Eigentums ihres Gatten zu kommen und den wahren Mann ihres Herzens heiraten zu können. Spekulation? Oder war der Mörder etwa doch der Gärtner? Dieses Buch verschafft dem Leser einen Rückblick auf das Geschehen von damals.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 88
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Mag sein Lebensalter
unvollendet geblieben sein,
sein Leben ist vollendet.“
Seneca
Der 6. Juni 1762 war ein schicksalhafter Tag.
An jenem Tag war es auf Gut Niering zu dem gekommen, was als Tragödie von Niering in die Geschichte eingegangen ist. Unter auch heute noch ungeklärten Umständen starb hier Franz Anton Horst, Herr zu Ost- und Westniering.
WAS AUF HAUS NIERING GESCHAH
Haus Niering von Südosten
Aufnahme von 1926
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Beweggründe
Geschichtliches
Im Speckfelde
Adelshochzeit
Unruhige Zeiten
Fehltritte
Mord im Juni
Mordermittlungen
Gärtner Johann Schäfer
Witwe Eleonore Horst
Inspektor Fischer alias Baumeister
Hochzeit mit Folgen
Gefährliche Zeugenaussagen
Begünstigt
Befreiung von Schuld
Eines Tages
Zum Gedenken
Rückblick
Bündnis der Liebe
Schuldig oder nicht schuldig? … vielleicht.
Erklärungen
Und später?
Quellenangaben
Danksagung
Bilderverzeichnis
Nachwort
„Unruhige Zeiten“ - Band 1 bis 5
Tipps und Internetadressen
Vorwort
Die Welt ist voller Geschichten und ungelöster Rätsel. Jeder Mensch schreibt seine eigene Geschichte, und jeder Mensch möchte nicht vergessen sein. Wie erschütternd ist es, wenn ein – in diesem Fall junges – Leben gewaltsam beendet wird. Ein tragischer Tod, der eine Legende mitbegründet; zwei Menschen schreiben die Geschichte einer Ehe, die zumindest für einen vorzeitig tödlich endet. Wie viele unerfüllte Hoffnungen und Pläne werden mit zu Grabe getragen?
In einer Ehe geht es darum, die Wunden zu heilen, Brücken zu bauen, den anderen respektvoll anzuerkennen und eine gemeinsame Basis zu finden, doch hier schließt sich die Frage auf, ob die 1. Ehe der Witwe aus gegenseitigem Respekt und Liebe geschlossen wurde. Oder gab der Charakter dieser Ehe eher eine ungesunde Diskrepanz preis, aufgrund derer sie nie hätte geschlossen werden dürfen?
Liebe sollte immer von beiden Seiten so intensiv sein, dass nichts dazwischen passt. Liebe muss miteinander blühen, nicht gegeneinander.
Die Leute behaupteten damals, dass die junge Ehegattin den Mörder gedungen habe, um schnell in den Besitz des wertvollen Eigentumes ihres Gatten zu kommen und den wahren Mann ihres Herzens heiraten zu können. Doch das war Spekulation. Tatsächlich hatten die späteren Ermittler keinen Beweis dafür, dass sie in den Mord verwickelt war.
Eleonore auf Niering traf damals die Entscheidung, den zu heiraten, den sie liebte, ... dies geschah schon sehr bald nachdem ihr erster Ehemann im Kugelhagel starb.
Ein Indiz für ihre Schuld oder auch die Mitwisserschaft am Mord ihres Mannes, jedoch kein Beweis. Dennoch wurde sie von vielen als schuldig vorverurteilt.
Neben der höchst verdächtigen Witwe präsentierte man noch zwei Männer, die des Mordes angeschuldigt waren. War der Mörder etwa doch der Gärtner?
Die Hintergründe der Bluttat wurden noch nie aufgeklärt. Niering wird uns als Ort eines tragischen Meuchelmordes, verbunden mit Gerüchten um eine unheilvolle Ehe, im Gedächtnis bleiben.
Etwa 200 Meter vom Herrenhaus entfernt steht noch heute das Kreuz, das der Nachwelt gewidmet ist, um die Erinnerung an die dunkle Tat zu überliefern.
Dieses Buch gewährt dem Leser einen Rückblick in die Zeit unserer Vorfahren, in die Vergangenheit Westfalens. Ein weiter Bogen, der sein Ende sucht, spannt sich durch unruhige Zeiten vor Jahrhunderten.
Vor 10 Jahren von mir als 5. Teil meiner Bücherreihe Unruhige Zeiten erstmals geplant, wird das Buch Tragödie von Niering erst jetzt verwirklicht und veröffentlicht.
Sabine Grimm
Beweggründe
Wenn man Geschehenes, wie die Tragödie von Niering auf immer verschweigen und der Nachwelt vorenthalten würde, könnte keine Geschichte geschrieben werden, um evtl. daraus zu lernen.
Vorübergegangene Zeit ist ein Stück Weltgeschichte, aus der unsere Zeit erwachsen ist. Auch die Gegenwart ist ein Stück Geschichte, auf deren Schultern einmal die Zukunft stehen wird.
So wie ein Wanderer ab und zu auf den Weg, der hinter ihm liegt, zurückschaut, um sich zu vergewissern, dass er seine gewünschte Richtung beibehalten hat, so kann auch dieser Rückblick ein Wegweiser in die Zukunft sein. Gleichsam gesagt, wird blind für die Gegenwart, wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt.
Schon Friedrich Wilhelm Weber sagte einmal:
„Und da sich die neuen Tage
aus dem Schutt der alten bauen,
kann ein ungetrübtes Auge
rückwärtsblickend
vorwärtsschauen.“
Sabine Grimm
Tragödie von Niering
Geschichtliches
Auf dem Speckfelde, in der heutigen Gemeinde Speckhorn, einer alten Bauernschaft im Grenzgebiet von Recklinghausen zu Oer-Erkenschwick und Marl, lag einst das freiadelige Gut Niering, erstmals 1515 urkundlich erwähnt, zudem im Verzeichnis der Rittergüter des Vesterholter Archivs aufgeführt.
Das alte vestische Familiengeschlecht der Preckels, das 1315 den Prokonsul in Recklinghausen und mehrere Male den Bürgermeister der Stadt Recklinghausen stellte (1395, 1534 bis 1538, 1544, 1545 und 1548), wurde 1515 als ältester Besitzer des ehemaligen Bauerngutes festgestellt. 1560 war ein Lukas Preckel Bürgermeister der Stadt und Besitzer von Niering. Im 16. Jh. ging das Gut durch Heirat in den Besitz der Familie Eppinghoven, gt. Preckel, über. Nach einer Urkunde von 1603 wird als letzter Besitzer aus dem Hause Eppinghoven ein Bertram vom Eppinghoven, verheiratet mit Judith von Vyffhusen, gt. Suverlich, erwähnt.
Haus Niering erschien seit etwa 1630 im jährlichen Verzeichnis der freiadeligen Güter des Domkapitels und der Vestischen Ritterschaft. Heute fast in Vergessenheit geraten, gehörte es früher zu den wichtigsten Häusern der Stadt, war sogar selbständig in den Landtagen vertreten. Später geriet das Gut in Schulden. Hauptgläubiger waren die Stadt Recklinghausen und die Recklinghäuser Familien Averdung und Schaumburg. Durch Heirat bekam der Nachbar Rensing den größten Teil von Niering und nannte sich ab 1614 Johann Rensing zu Niering. Der Sohn des Johann Rensing dem Älteren von der Borg, Johann Rensing, Herr auf Haus Niering († 1653) I. ⚭ Clara von Westerholt († 1608), II. ⚭ Elis. Hochertz, Wwe. Friedr. Averdunck zu Recklinghausen. Franz von Fyffhusen und seiner Schwester Margarete gehörten nur noch die Burg und der Garten. Der Obrist von Bodelschwingh erwarb 1660 nur das Haus und den Obstgarten. Er gab seinen Besitz dem Kurfürsten als Lehen mit dem Versprechen, ihm ein treuer Lehnsmann zu sein, um im Gegenzug vom Kriegsdienst befreit zu werden. So kam es, dass die Familie von Bodelschwingh Lehnsträger des Hauses Niering wurde und Niering seit 1661 nicht mehr als freier Hof galt, während er bis zu der Zeit landtagsberechtigt, und dessen Besitzer erbliches Mitglied des vestischen Landtages war. Ebenfalls landtagsberechtigt war das Gut Rensing, das etwas abseits der Straße, östlich von Haus Niering lag.
Heinrich von Spittael und Ehefrau, mit Stammsitz Haus Knechting bei Rhede, Kreis Borken, erwarb Niering 1665 als Altersruhesitz. Er trug die Bezeichnung geheimer Rat und war Verwalter des Stifts Elten in den Niederlanden. Nachdem er 1671 starb, erwirkte seine Witwe Agnes Juliane Dombroick, dass der Landesherr den gemeinsamen Sohn Erich Johann mit Niering belehnte, um das Erbe für ihn und seine Nachkommen zu sichern.
1678 erfolgte eine neue Veranschlagung der Rittergüter. Richter Dietherich Rensing zu Speckfeld beantragte, dass nur Rensing das rechte adelige Rittergut sei und nicht Niering, was der Kurfürst ablehnte. Erich Johann von Spittael, wohl der stetigen Streitigkeiten, u. a. wegen der Wasserrechte der Mühle, mit dem Nachbarn auf Gut Rensing müde, verkaufte 1700 an Katharina Agate Rensing, Witwe des Heinrich Horst, Bürgermeister von Recklinghausen sowie Generaleinnehmer im Vest auf Horneburg respektive Steuereinnehmer des Landesherrn, aus dem Familiengeschlecht derer von Horst, van Horst oder auch von der Horst. Horneburg war der Sitz des Oberkellners des Vestes, des hohen Verwaltungsbeamten und Einnehmer der Steuern und Abgaben (Frongeld).
Rutger Johann Horst, jur. utr. Licentiatus war 1617-1621, 1631 Bürgermeister zu Recklinghausen. Nicolaus Horst, verheiratet mit Mathilde Behnen, war Bürgermeister von Recklinghausen und vestischer Landeseinnehmer. Sein Sohn Heinrich, Recklinghausens Bürgermeister von 1683-1684 und vestischer Landeseinnehmer war der Ehemann von Katharina Agata Rensing (s. o.). Der Sohn Peter Nicolaus Horst J. U. Dr. bekleidete 1727-1731 das Bürgermeisteramt in Recklinghausen. Johann Bernard Horst ⚭ Christina Elisabeth Dücker, folgte seinem Vater als Generaleinnehmer des Vestes und kaufte am 18. Mai 1695 das adelige Gut Wilbring. Der älteste bekannte Stammvater dieser Linie war Henricus von der Horst, Richter und Freigraf der heiligen Feme zu Dorsten. Das adelige Geschlecht Horst wurde erstmals urkundlich 1142 mit Ruthger de Horst erwähnt. Ein weiteres Mitglied dieses Geschlechts erscheint urkundlich im Jahre 1223 im Zusammenhang mit einer Zeugenaussage. Die Stammreihe beginnt im Jahre 1234 mit dem Ritter Gyselbertus de Horst. Horst war der Name eines Dorfes, 15 Kilometer südwestlich von Recklinghausen liegend und seit 1928 zur Stadt Gelsenkirchen-Buer gehörig. Auf der dortigen Burg war ein Geschlecht gleichen Namens ansässig, sowie auch auf dem Familienstammsitz Haus Horst im heutigen Gelsenkirchen-Horst. Die Familien Horst und Rensing stammen aus den ritterbürtigen (*16) Geschlechtern des Vestes, den Besitzern der Häuser Horst und Rensing. Die Vorfahren, nachgeborene Söhne ohne Vermögen, machten in den Städten ihr Glück und gehörten zu den ersten Familien, den Erbmannen und Ratsverwandten, die unzählige hohe Ämter bekleideten. Der Landadel, die Ritterschaft, wollte sie jedoch nicht als ihresgleichen anerkennen, wie auch die Ritterschaft des Fürstbistums Münster den Erbännerfamilien der Stadt Münster, Droste-Hülshoff, Kerkering-Borg, Schenking, Herding, Bischoping den Adelsstand jahrhundertelang streitig gemacht hatte.
Die Union der vestischen Ritterschaft gegen den Statthalter Vincenz Rensing von 1602 (1612) ist größtenteils auf die Abneigung der meist armen und ungebildeten Ritter gegen die studierten und tüchtigen Angehörigen eben solcher Familien, wie Rensing, Horst, Westerholt zurückzuführen. Seit 1300 hatten sich die Dienstmannen, die als Burgmänner die Burgmannschaft bildeten und ihrem Burgherrn oder einem von ihm beauftragten Burgkommandanten unterstanden, zu einem eigenen Stand der Ritterschaft zusammengeschlossen. Die Ritter verloren Ende des 15. Jahrhunderts ihre Bedeutung als Wehrstand, da der Kriegsdienst aus den Händen der Ritter auf die Söldner überging, die aus allen Bevölkerungsklassen geworben wurden. Im 16. Jahrhundert traten dann die auf der Universität ausgebildeten, gelehrten Staatsbürgersöhne als Richter in höchste öffentliche Stellungen ein, die die Ritter für sich beanspruchten. Tüchtige, studierte Bürgersöhne übernahmen die Regierung und somit auch die Administration der Landesherren als Kellner, um die Finanzen zu regeln. Sie wurden Amtmann, Droste oder Statthalter, graduierte geheime Räte und Kanzler. Diese Stellungen waren vorher den ministerialen Geschlechtern vorbehalten, die nun keine Chance mehr hatten. Zu jener Zeit galt der Doktor der Rechte als adelig.