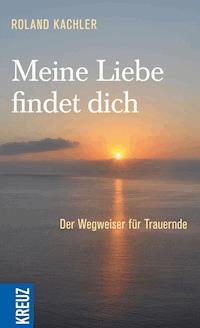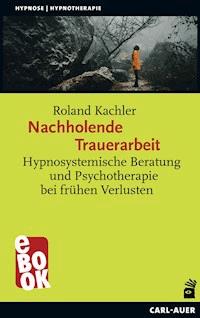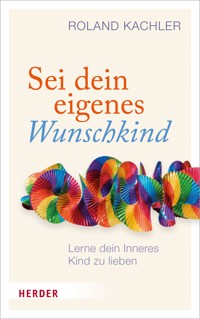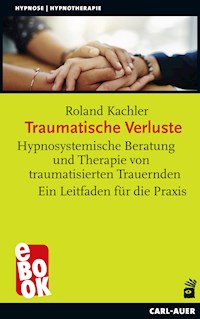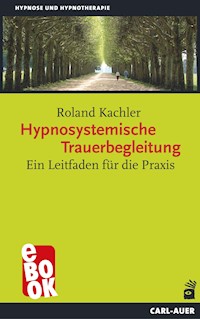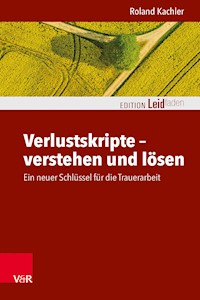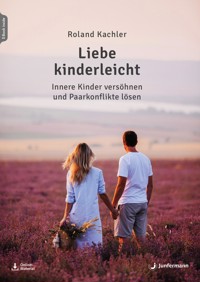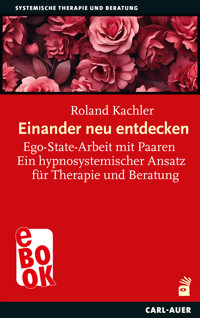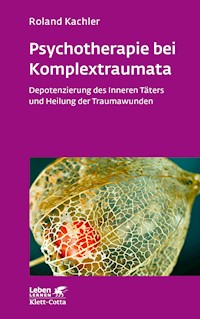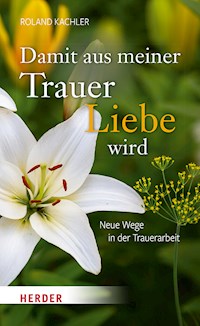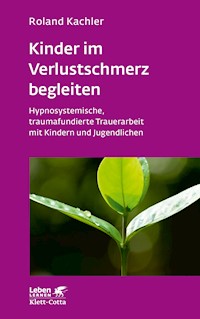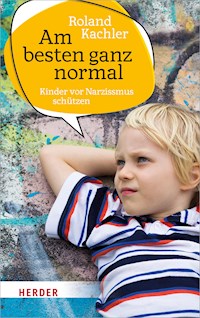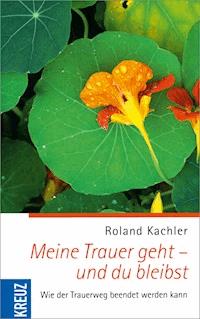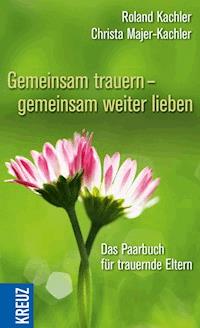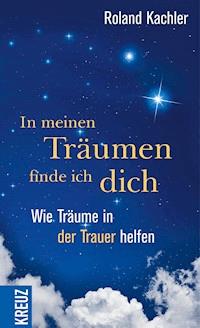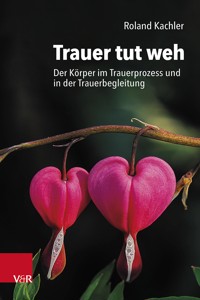
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die Brust wird eng, das Herz rast, die Kehle ist wie zugeschnürt, der Magen spielt verrückt, die Glieder sind schwer: Verlustschmerz ist nicht nur in der Seele zu spüren, sondern drückt sich auch über den Körper aus. Gelingende Trauerbegleitung unterstützt Trauernde dabei, ihre Trauer aus ihrem Körper abfließen zu lassen. Geschieht das nicht, entwickeln sich körperliche Beschwerden bis hin zu ernsthaften Symptomen wie zum Beispiel Rheuma oder Herzprobleme. Aber nicht nur die Trauer, sondern auch die Liebe zum Verstorbenen wird intensiv im Körper gespürt und durchflutet ihn. Wenn Trauernde ihre Zuneigung und den Verstorbenen oder die Verstorbene selbst in ihrem Körper verankern und bewahren können, kann die innere Beziehung zu ihm oder ihr sicher gelebt werden. Der trauernde und liebende Körper ist somit das Zentrum jeder Trauerbegleitung. Roland Kachler gibt in diesem praxisorientierten Grundlagenbuch Trauernden, Trauerbegleiterinnen und Psychotherapeuten zahlreiche konkrete Anregungen und methodische Impulse für die Arbeit mit dem Körper. Zugleich eröffnet der Zugang über den Körper ein neues, neurobiologisch fundiertes Verständnis für den Trauer- und Liebesprozess. Dies schließt die Trauerpsychologie an die aktuellen Erkenntnissen der Neurowissenschaften an und gibt ihr ein neues wissenschaftliches Fundament.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roland Kachler
Trauer tut weh
Der Körper im Trauerprozess und in der Trauerbegleitung
VANDENHOECK & RUPRECHT
Copyright
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2025 Vandenhoeck & Ruprecht, Robert-Bosch-Breite 10, D-37079 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill BV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill BV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Brill Wageningen Academic, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Pixabay
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
EPUB-Erstellung: Bookwire GmbH, Frankfurt am Main
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
E-Mail: [email protected]
ISBN 978-3-647-99240-2
Inhalt
Statt eines Vorworts ein Appell: Stellen Sie den Körper ins Zentrum der Trauerpsychologie
Kapitel 1: Der Körper – Basis des Bindungssystems und der Verlustreaktion
Kapitel 2: Stabilisierung des aktivierten Bindungssystems über den Körper
Kapitel 3: Der Körper – dissoziiert und nur noch funktionierend bei einem traumatisierenden Verlust
Kapitel 4: Mit dem dissoziierten Körper der Trauernden arbeiten
Kapitel 5: Der Körper – schmerzend und trauernd im Verlust
Kapitel 6: Aus dem schmerzenden und trauernden Körper den Verlustschmerz und die Trauer externalisieren
Kapitel 7: Der Körper – Ort der Liebe zum Verstorbenen und Ort für den Verstorbenen
Kapitel 8: Mit dem Körper weiter lieben – im Körper die Liebe bewahren und den Verstorbenen integrieren
Kapitel 9: Der Körper – wie er im Verlust Körpersymptome entwickelt
Kapitel 10: Mit dem Körper und seinen Körpersymptomen des Verlustes heilsam arbeiten
Kapitel 11: Der Körper – sich darin wieder wohlfühlen
Literatur
Statt eines Vorworts ein Appell: Stellen Sie den Körper ins Zentrum der Trauerpsychologie
Dieses Buch stellt zum ersten Mal in der Geschichte der Trauerpsychologie den Körper ins Zentrum des Trauerprozesses. Daraus ergeben sich viele neue, grundlegende Einsichten und Methoden in der Arbeit mit Trauernden.
Ein schwerer Verlust macht viel mit dem Körper, fordert ihn heraus und bringt ihn bisweilen an die Grenzen. So gibt es im Trauerprozess eine Vielzahl von Körperbeschwerden, die in der bisherigen Trauerpsychologie nicht beachtet, geschweige denn bearbeitet wurden. Es scheint so, als habe die bisherige Trauerpsychologie Angst vor dem Körper und seinen archaischen Ausbrüchen des Verlustschmerzes im Schreien, der den ganzen Körper ergreift. Die bisherige Trauerpsychologie weicht dem trauernden Körper aus, der vom Schluchzen geschüttelt wird. Die bisherigen Ansätze der Trauerbegleitung übersehen die vielfältigen Körpersignale der Trauer oder sind ihnen hilflos ausgeliefert. Doch so kann Trauerbegleitung nicht gelingen.
Es ist an der Zeit, das zu ändern – für die Trauernden selbst und für unsere konkrete Arbeit in der Begleitung von Trauernden. Denn: Ohne den Körper geht nach einem schweren Verlust in der Trauerbegleitung gar nichts. Eine Trauerbegleitung ohne den Körper ist wie ein Kopf ohne den Rumpf. Ohne Berücksichtigung des Körpers bleibt jede Trauerbegleitung im Kopf und deshalb nur Stückwerk. Wird der Körper ignoriert, verfehlen wir die Trauer und die Liebe zum verstorbenen nahen Menschen. Übergehen wir den Körper in seiner Trauer, bleiben Trauernde in ihrem Körpererleben und mit ihrem heftig reagierenden Körper allein gelassen. Alle Prozesse nach einem Verlust spielen sich im Körper ab und zeigen sich im und über den Körper. Der Verlustschmerz und die Liebe brauchen den Körper. Der Körper ist das Medium und die Basis eines Trauerprozesses, zu dem immer auch die Liebe zum verstorbenen nahen Menschen gehört.
Stellen wir uns also dem Körper der Trauernden in ihrer Trauer. Mit dem Körper kommen wir auch in einen unmittelbaren Kontakt mit der Trauer und der Liebe, zu fühlen in der Resonanz mit unserem eigenen Körper als Trauerbegleiterin. Gehen wir in die Resonanz zwischen dem Körper der Trauernden und unserem eigenen Körper. Stellen wir uns auch den möglichen Körpersymptomen bei einem schweren Verlust. Der Körper zeigt, wie sehr die Trauernden an einem schweren Verlust leiden, konkret im Körperschmerz, konkret in vielfältigen Körpersymptomen, konkret im Gefühl, krank zu sein. Nicht selten wird der Körper aus lauter Trauer und vor lauter schmerzender Liebe tatsächlich krank. Ganz wörtlich gemeint: psychosomatisch krank. Von da aus lassen sich viele psychosomatische Erkrankungen ganz neu verstehen und natürlich nun auch ganz anders heilend bearbeiten, nämlich als Transformation von somatisierten Blockaden und Störungen eines Trauer- und Beziehungsprozesses. Psychosomatische Erkrankungen und ganz normale Störungen in einem Trauer- und Beziehungsprozess nach schweren Verlusten werden nun lösbar.
Warum? Ganz einfach und doch so überraschend, weil der Körper selbst die Werkzeuge hierzu bereithält. Der Körper von Trauernden ist also nicht nur das betroffene Medium eines schweren Verlustes, sondern zugleich der Ort der Trauerbewältigung, ja noch mehr: Im Körper liegen die Heilmittel bereit. Allerdings sind sie durch einen schweren Verlust zunächst blockiert. Wir müssen in der Trauerbegleitung die körpereigenen Heilmittel wieder zugänglich machen, das ist Aufgabe und Sinn der Trauerbegleitung. Die körpereigenen Heilmittel liegen jedenfalls bereit, eben im Körper. Dieser stellt mit dem Atem und dem Weinen wunderbare Werkzeuge für die Trauer- und Liebesarbeit zur Verfügung. Im Ausatmen und im Weinen bringt der Körper diese starken Emotionen aus dem Körper und lässt sie abfließen. Im Einatmen nimmt der Körper die Liebe nach innen und gibt ihr und dem Verstorbenen selbst einen sicheren Ort in sich. Der Körper sagt den Trauernden: Die Trauer darf gehen und die Liebe bleiben, in mir und in meinen Innenräumen. Das ist das Geheimnis einer gelingenden Trauerbegleitung.
Die Trauerbegleitung bekommt erst jetzt die richtige Basis – eben den Körper. Erst jetzt kann Trauerbegleitung gelingen, und zwar mit und über den Körper.
Roland Kachler
Kapitel 1
Der Körper – Basis des Bindungssystems und der Verlustreaktion
Die untröstliche, verzweifelte trauernde Mutter
Die 30-jährige Tochter stirbt bei einem Verkehrsunfall in Afrika. Die Mutter erfährt dies vom überlebenden Partner ihrer Tochter. Die Mutter kommt sechs Monate nach dem Tod ihrer Tochter zur Trauerbegleitung. Sie sagt, dass sie seither keinen Tag gelebt habe, keine Nacht geschlafen habe. Jeden Tag, so berichtet sie, fließen die Tränen, weil ihr Schmerz so groß ist. Sie spürt diesen Verlustschmerz im ganzen Körper. Jede Berührung, und sei es eine Berührung ihrer Haarspitzen, schmerzt bis ins tiefste Innere hinein. Ihr Herz schmerzt ebenfalls, weil sie den Eindruck hat, dass ihre Tochter aus ihrem Herzen gerissen wurde. Es gibt für sie keinen Trost und kein »Morgen wird es besser«, obwohl sie noch gar nicht wirklich begriffen hat, dass ihre Tochter nie mehr kommen wird. Sie glaubt nicht, dass es jemals einen Weg zurück in das Leben geben könnte. Nichts hilft ihr, auch nicht erste Gespräche mit verschiedenen Psychotherapeuten.
Der gänzlich unerwartete, plötzliche Tod der Tochter dieser Frau trifft sie in ihrer ganzen Person, in ihrer ganzen Liebe und in ihrem ganzen Körper. Neuropsychologisch und evolutionsbiologisch verstanden, ist diese Mutter in ihrem Bindungssystem getroffen (zum gesamten Kapitel: Brisch, 2025; Bear, Connors u. Paradiso, 2018; Feldmann, 2017; Cozolino, 2014; Panksepp, 2004), dem wichtigsten und ersten Überlebenssystem des Menschen. Aus ihrem Herzen – so ihr Gefühl – ist ihre Tochter entrissen, also aus ihrem Bindungssystem, in dem ihre Tochter wie ihre anderen Familienmitglieder einen zentralen, tief verankerten Platz eingenommen hatte. Das Bindungssystem reagiert nicht nur mit tiefster Verzweiflung, sondern mit körperlich intensiv zu spürenden Schmerzen und zugleich – für viele Trauernde überraschend – mit einer intensiven Sehnsuchtsliebe. Letztere ist Grundlage des beziehungsorientierten, des sogenannten hypnosystemischen Traueransatzes, den ich in den letzten Jahren entwickelt habe (Kachler, 2022; 2021d; 2017). Dieser Ansatz ist auch der Hintergrund dieses Buches, wenngleich nun der Körper in seiner zentralen Rolle bei einem Verlust hier im Fokus steht.
Das Bindungssystem – erstes und wichtigstes Überlebenssystem des Menschen
Wenn ein Säugling zur Welt kommt, ist er allein nicht überlebensfähig. Er braucht zu seinem Überleben, dass ihn die Eltern ernähren und versorgen. Ebenso wichtig ist aber auch die körperlich vermittelte emotionale Nähe der Eltern, anfangs insbesondere der Mutter. Für diese ersten Überlebensschritte bringt der Säugling seinerseits ein biologisch und genetisch angelegtes System mit, eben das Bindungssystem (Brisch, 2025; Cozolino, 2014; Feldmann, 2017; Panksepp, 2004). Dies wird schon im Mutterleib ausgebildet und trainiert, sodass es bei der Geburt sofort funktionieren kann, sowohl aufseiten des Säuglings als auch der Mutter. Der Säugling ist dabei nicht nur Empfänger der Fürsorge- und Bindungsaktionen der Mutter, sondern bestimmt mit seinem Blickkontakt, später dann mit seinem Lächeln oder seinen nonverbalen Gesten das gegenseitige Bindungsverhalten ganz wesentlich mit. Aufseiten der Mutter und dann des Vaters wird das Bindungssystem gestärkt, wenn diese einfühlsam, in einem sogenannten Affekttuning in die Resonanz mit dem Säugling gehen, wenn sie die Bedürfnisse des Säuglings spüren und erfüllen und wenn sie die immer wieder vorkommenden kleinen Missstimmigkeiten zwischen ihnen und dem Säugling rasch korrigieren. Zentral ist auch, dass sie den Säugling trösten, wenn dieser zum Beispiel Bauchschmerzen oder andere Empfindungen des Unbehagens hat oder wenn er nachts aufwacht und sich verlassen fühlt. Wenn sich also die Eltern um den Säugling und damit um dessen Bindungssystem kümmern, dann wird ihr elterliches Bindungssystem, oft als Care-System bezeichnet (Panksepp, 2004), gestärkt. Der heimliche und für beide Seiten unbewusste Agent des Bindungssystems ist das bekannte Oxytocin, das bei allen Bindungsaktionen ausgeschüttet wird.
Vorbemerkung zu den Exkursen: In den Exkursen stelle ich neurowissenschaftliche, neurobiologische und psychophysiologische Grundlagen der Körperreaktionen und des psychischen Erlebens bei einem Verlust dar. Dabei steht der Bezug zum Verlusterleben, zum Verlustschmerz und zur Trauer im Vordergrund.
Exkurs: Oxytocin und das Bindungssystem
Das Oxytocin ist der wichtigste hormonelle Mediator des Bindungssystems (Bear, Connors u. Paradiso, 2018; Panksepp, 2004). Das Oxytocin und das verwandte, ähnlich wirkende Vasopressin werden im Hypothalamus synthetisiert und dann über die Hypophyse sowohl in das Gehirn als auch in den Blutkreislauf ausgeschüttet. Dies geschieht immer dann, wenn nahe soziale Interaktionen wie zum Beispiel die Berührung eines nahen Menschen stattfinden. Das Oxytocin ist sehr wahrscheinlich evolutionsbiologisch für die Prozesse der Geburt und des Stillens des Säuglings entstanden. Hier stellt das Oxytocin ganz früh die Bindung der Mutter zum Neugeborenen her. Sein Saugen an der Brust bewirkt eine Ausschüttung von Prolactin und Oxytocin ins Gehirn und in den Blutkreislauf der Mutter. Oxytocin fördert umkehrt auch Nähe und Bindung, beispielsweise wenn der Vater mit dem Säugling und Kleinkind interagiert. Auch beim Geschlechtsverkehr wird bei beiden Partnern Oxytocin ausgeschüttet und stärkt so die partnerschaftliche Bindung. Das Oxytocin ist eng mit dem Endorphinsystem und mit dem Dopaminsystem verbunden, beide wichtig für Belohnung und Wohlbefinden. Diese Neurotransmitter wirken beruhigend auf die Amygdala ein und dämpfen so Gefühle von Angst und Aggression, ebenso werden im Verbund mit den Endorphinen Schmerzen gedämpft.
Der Säugling erfährt die Bindungsaktionen mit den Eltern ganz auf der Körperebene. Beim Stillen erlebt er seinen Körper durch das Sättigungsgefühl; beim Streicheln, beim Wickeln, beim Eincremen spürt er seinen Körper in Reaktion auf die körperliche Stimulation der Eltern. Die ersten und wichtigsten Bindungserfahrungen sind also Körpererfahrungen, die die Basis der Bindung darstellen.
Erst allmählich entwickelt sich aus diesen frühen, ganzheitlichen Körpererfahrungen im dialogischen Prozess der Vorläufer des Ichs, oft auch als Protoselbst beschrieben (Damasio, 2012). Im gegenseitigen Anschauen und Anlächeln der Eltern, aber auch im Weinen erlebt der Säugling, dass er die Eltern beeinflussen kann. Der Säugling erfährt sich in diesen kommunikativen Fertigkeiten als selbstwirksam. Zugleich sprechen die Eltern den Säugling von Anfang an als eigenständiges Ich und Person an, sodass sich der Säugling von innen und von außen her zunehmend als eigenständig, als ein sich selbst regulierendes und andere beeinflussendes Ich verstehen lernt. Auch wenn sich nun im ersten Lebensjahr das Ich entwickelt, bleibt auch dieses in den Körpererfahrungen der weiterhin überlebenswichtigen Bindung zu den Eltern und damit im Körper verankert.
Was bedeutet das für eine schwere Verlusterfahrung? Bei einem schweren Verlust wird das tief im Körper und in unserer Kindheit verankerte Bindungssystem aktiviert. Das früheste und wichtigste Überlebenssystem eines Menschen sieht sich und seinen Träger durch den Tod eines nahen Menschen im Überleben bedroht und reagiert intensiv und massiv über die mit ihm verbundenen Körperreaktionen, die dann ihrerseits die verschiedenen Verlustemotionen auslösen, und das gilt umgekehrt genauso.
Bitte beachten
Ich spreche in diesem Buch vom »Körper« (im englischsprachigen Raum »body«) und meine damit immer auch den von innen her erlebten und gespürten Körper, der immer auch verbunden mit der Psyche ist. Er wird wie in den verschiedensten Körpertherapien somit als psycho(!)-physiologische Ganzheit verstanden. Wenn ich nur die Physiologie des Körpers meine, spreche ich vom Organismus. In der spezifisch deutschen Tradition sprach man lange vom Leib als diesem psychisch belebten Körper. Dies ist zwar berechtigt, aber veraltet.
Wo das Bindungssystem im Gehirn sitzt und wie es neurobiologisch funktioniert
Vereinfacht kann man sagen, dass das Zentrum des Bindungssystems im Gehirn dort sitzt, wo es Oxytocin und das verwandte Hormon Vasopressin und die dazugehörigen Rezeptoren gibt. Das ist vorzugsweise im Belohnungssystem, dem sogenannten Striatum, und dort besonders im Nucleus accumbens der Fall. Dieses wiederum sitzt im limbischen System, der Gehirnregion, in der unsere Gefühle und die dazugehörigen physiologischen Körperreaktionen verankert sind. Dort gibt es die meisten Rezeptoren für das Oxytocin, dessen Wirkweise besonders bei einem Verlust und bei der Trauer wir in Kapitel 7 noch näher kennenlernen werden.
Neben dem Oxytocin sind noch zwei weitere Hormone für das Bindungssystem zentral: das Dopamin und die Endorphine. Dopamin wird sowohl beim Säugling als auch bei den Eltern ausgeschüttet, wenn diese mit dem Säugling zum Beispiel im Spiel interagieren. Dies wird von beiden als lustvoll und damit verstärkend erlebt. Die dopaminergen Nervenbahnen durchziehen praktisch das ganze Gehirn. Ebenso werden bei Bindungsverhalten auch Endorphine ausgeschüttet, sodass das Bindungsverhalten selbst als lustvoll erlebt wird.
Man sieht, dass das Bindungssystem seinen Kern zwar im limbischen System hat, im Zentrum der Emotionsverarbeitung, sich aber zugleich praktisch über das ganze Gehirn erstreckt, eben weil es für das Überleben des Menschen so wichtig ist. So ist das tief im limbischen System verankerte Bindungssystem mit dem Hippocampus verbunden, der die Erfahrungen, die wir mit einem nahen Menschen machen, als Episoden im sogenannten episodischen Gedächtnis abspeichert. Des Weiteren ist das Bindungssystem mit der Gesichtswahrnehmung in der Amygdala und im Scheitellappen des Cortex verknüpft, und so werden die Gesichter der wichtigen Bindungspersonen wie die der Eltern internalisiert und als innere Personen abgespeichert. Und schließlich ist das Bindungssystem über vielfältige neuronale und hormonelle Pfade mit dem Körper verbunden, indem Bindungserfahrungen die Physiologie des Körpers verändern und umgekehrt physiologische Reaktionen wie die Erfahrung von Verlustschmerz das Bindungssystem aktivieren.
Was bedeutet das für eine schwere Verlusterfahrung? Ein Verlust, insbesondere ein plötzlicher und unerwarteter Tod eines nahen Menschen, geht mit einem plötzlichen Verlust und Mangel von Oxytocin, Dopamin und Endorphinen einher. Dies findet tief in den emotionalen Zentren des Gehirns statt und ist zunächst der rationalen und bewussten Kontrolle entzogen. Zugleich verändert jede Verlusterfahrung die ganze Physiologie und damit das gesamte Körpererleben massiv.
Wie kommen andere Menschen in das Bindungssystem?
Diese Frage klingt irritierend, wird aber sogleich verständlich, wenn wir fragen, wie die inneren Bilder, neurobiologisch die Repräsentationen von wichtigen äußeren Bezugspersonen, im Bindungssystem entstehen. Für das Kleinkind ist das eminent wichtig, weil es mit dem Entstehen dieser inneren Bilder ein Stück unabhängig von den äußeren Eltern wird, wenn diese zum Beispiel kurz aus dem Zimmer gehen. Aber auch liebende Partner entwickeln innere Bilder vom Geliebten, die sie jederzeit abrufen können, auch wenn dieser real nicht präsent ist.
Psychologisch beschreiben wir diesen Prozess als Internalisierung. Wichtige wohlwollende Interaktionspartner werden internalisiert, also als Bilder nach innen genommen. Sie werden so zu inneren Personen und inneren Gegenübern für die gefühlte innere Beziehung zu diesen Menschen. Eine zentrale Rolle spielt dabei unser visuelles System, hier besonders die Fähigkeit der Gesichtserkennung und die sogenannten Spiegelneuronen. Die im Äußeren sich befindenden Personen werden so im Gehirn und über dessen Neuronen abgebildet und gespeichert.
Exkurs: Die Internalisierung durch Spiegelneuronen und die Gesichtswahrnehmung
Neurobiologisch können wir die psychologischen Prozesse der Internalisierung nun über die sogenannten Spiegelneuronen genauer verstehen. Sie wurden in den 1990er Jahren zunächst bei Affen entdeckt (Rizzolatti u. Sinigaglia, 2007). Diese Neuronen springen dann an, wenn Affen die Handlung anderer Affen beobachten, und zwar genau in den Regionen, in denen dieselben eigenen Handlungen gesteuert werden. Springen die Spiegelneuronen an, wird die Handlung des anderen wie eine eigene, selbst ausgeführte Handlung im Gehirn abgebildet. Auch beim Menschen spielen diese Spiegelneuronen eine wichtige Rolle, zum Beispiel wenn wir beobachten, wie sich ein anderer Mensch in den Finger schneidet. Dann spüren wir auch in unserem Finger einen Schmerz und unser Finger zuckt unwillkürlich zurück. Die Spiegelneuronen sind somit die Basis unserer Empathie. Sie sind dann auch aktiv, wenn Mütter ihre eigenen Kinder beobachten und dabei mit deren Gefühlen mitschwingen.
Besonders die Gesichter von nahen Menschen werden über diese Prozesse internalisiert, und zwar in einer für die Gesichtswahrnehmung spezialisierten Region im Scheitellappen des Cortex, dem sogenannten lateralen Gyrus fusiformis, und in der Amygdala. Gesichter von feindlichen Menschen lösen Angst aus, Gesichter von wohlwollenden Menschen werden mit Oxytocin und Endorphinen verbunden und als angenehm und Sicherheit gebend erlebt. Die Differenzierung von wohlwollenden und feindlich gesinnten Menschen – was am Gesichtsausdruck zu erkennen ist – ist überlebenswichtig.
So entstehen über diese Prozesse innere Bilder von den wichtigen nahen Menschen. Zugleich werden sie mit den Spiegelneuronen auch als körperlich gespiegelte Repräsentanzen internalisiert. Sie sind also auch in uns im wahrsten Sinne des Wortes »verkörpert«. Wir sprechen hier vom Embodiment der wichtigen nahen Menschen (siehe Kapitel 7). Wichtige Menschen werden als Repräsentationen über zusammenhängende neuronale Netze im Gehirn abgespeichert, die zugleich intensiv mit unseren Körperreaktionen verbunden sind.
Werden also wichtige Personen über unser visuelles System als Bild und über unsere Spiegelneuronen als körperlich erfahrbares Abbild aufgenommen, wird dies nun im Hippocampus abgespeichert. Diese neuronale Struktur liegt tief im Gehirn und besitzt ebenfalls viele Oxytocin-Rezeptoren. Der Hippocampus überführt unsere biografischen Erfahrungen mit anderen Menschen in eine Erinnerung. Eine wichtige Episode, beispielsweise die Wanderung mit unseren Kindern, wird im Hippocampus zunächst als Erfahrung neuronal abgebildet, dann im Hippocampus zwischengespeichert und schließlich ins Langzeitgedächtnis überführt. Diese Erfahrung samt den Bildern der beteiligten Menschen kann dann später wieder als Erinnerung abgerufen werden. Die Erinnerung ist damit im episodischen oder auch als biografisch bezeichneten Gedächtnis abgelegt, in dem vor allem auch Bindungs- und Interaktionserfahrungen mit den dazugehörigen Personen gespeichert werden.
Über den Prozess der Spiegelneuronen, die Gesichtserkennung in der Amygdala und im Scheitellappen des Cortex und über die Abspeicherung von biografischen Erfahrungen über den Hippocampus werden nun die äußeren, konkreten wichtigen Menschen zu inneren Personen. Sie sind als Repräsentationen über zusammenhängende neuronale Netze im Gehirn, vorzugsweise in der Amygdala und im Bindungssystem, im Hippocampus und im biografischen Langzeitgedächtnis abgebildet und gespeichert. Bei wichtigen Menschen sind die inneren Bilder von diesen immer auch mit Gefühlen und Körperreaktionen verbunden. Beim Säugling und Kleinkind mit der Erfahrung der Berührung beim Wickeln oder Schmusen, bei erwachsenen Partnern mit den Körperreaktionen beim Küssen, bei der zärtlichen Berührung oder in der Lusterfahrung der Sexualität.
Bitte beachten
Die wichtigen Bindungspersonen sind immer mit Körperempfindungen und Körperreaktionen verbunden. Die inneren Repräsentanzen sind nicht nur als Bilder, sondern auch als innere Körpererfahrung abgespeichert. Sie sind immer auch verkörpert, also embodied (Kapitel 7).
Die beschriebenen Prozesse der Internalisierung geschehen ganz automatisch und unbewusst schon im Säuglingsalter in allen nahen Beziehungen. Zugleich schauen wir ab einem Alter von etwa drei bis vier Jahren zum Beispiel unsere Eltern ganz bewusst an, schauen in ihre Gesichter oder schauen Fotos von den Eltern und Geschwistern an. Auch später als Erwachsene tragen wir Fotos von nahen Menschen in der Geldbörse oder stellen sie auf den Bildschirm unseres Mobiltelefons. Kinder und Jugendliche schauen sich dann auch ganz bewusst bestimmte Verhaltensweisen, Sprachfloskeln und Gesten der Eltern ab und nehmen sie so als Modell nach innen. Wir internalisieren und speichern nun auch ganz bewusst die Bilder der uns nahen Menschen ab.
Was bedeutet das für eine schwere Verlusterfahrung? Beim Tod eines wichtigen nahen Menschen wird dieser im Äußeren entzogen. Er und seine mit ihm verbundene Nähe sind für das Bindungssystem nicht mehr erreichbar. Als innere Gestalt oder Person bleibt der verstorbene nahe Mensch als visuell und körperlich verankerte Repräsentanz im Bindungssystem erhalten. Je wichtiger dieser Mensch war, desto sicherer und stärker ist er unauslöschlich im Bindungssystem verankert. Der Tod nimmt uns zwar den nahen Menschen im Äußeren, im Inneren aber bleibt er als Gegenüber erhalten und bewahrt. Dies ist die Grundlage des beziehungsorientierten hypnosystemischen Traueransatzes (Kachler, 2022), der immer auch die innere Beziehung zum verstorbenen nahen Menschen umfasst.
Der Wächter des Bindungssystems – das Paniksystem der Amygdala als Teil des Bindungssystems
Das Bindungssystem wird rasch aktiviert, wenn es durch einen möglichen Verlust bedroht wird. Das ist immer der Fall, wenn eine wichtige Beziehungsperson gefährdet ist oder länger wegbleibt. Der Säugling und das Kleinkind beginnen zu schreien, wenn ein Elternteil nicht da ist und sie befürchten müssen, dass der zum Überleben notwendige Elternteil nicht mehr wiederkommt. Das Bindungssystem springt bei einem erwachsenen Partner an, wenn bei einem nahen Menschen, sei es bei einer Partnerin oder einem Kind, eine lebensbedrohliche Notfallsituation oder eine letale Erkrankung vorliegt. Zwar ist noch kein realer Verlust eingetreten, aber die drohende Möglichkeit, diesen nahen Menschen und damit seine Nähe ganz zu verlieren, alarmiert den ganzen Organismus der Betroffenen. Hier springt das sogenannte Paniksystem (Panksepp, 2004) mit der Amygdala im Zentrum an, das einen Teil des Bindungssystems darstellt und als sensibler Wächter fungiert. Dieses Paniksystem aktiviert den ganzen Körper, damit dieser den existenziellen Ernst der Situation erkennt und nun alles dafür tut, diesen drohenden Verlust abzuwenden.
Die Reaktion des Paniksystems in einer Verlustsituation macht sehr deutlich, wie Psyche und Körper und Körper und Psyche engstens zusammenhängen. Dies will ich im folgenden Exkurs aufzeigen:
Exkurs: Neurobiologische Grundlagen des Zusammenspiels von Körper und Psyche
Die Psyche und der Körper sind auf vielfältige Weise miteinander gekoppelt (Bear et al., 2018), nämlich psychosomatisch und umgekehrt auch somatopsychisch. Zunächst ist die uns bewusst zugängliche, willkürliche Ebene zu nennen, auf der wir unseren Körper willentlich steuern. Mit Yoga beispielsweise, über den Atem oder mit einer Entspannungsmethode können wir ganz bewusst bestimmte Körpervorgänge, etwa die Entspannung unserer Muskeln, beeinflussen.
Neben der willkürlichen Ebene findet die Koppelung zwischen Psyche und Körper und umgekehrt auf der unwillkürlichen, also nicht bewusst steuerbaren Ebene statt. Diese Ebene wird vom autonomen oder auch vegetativen Nervensystem gesteuert und besteht aus zwei miteinander antagonistisch verbundenen Teilen, dem sympathischen und dem parasympathischen Nervensystem. Erleben wir eine bedrohliche oder unangenehme Situation, springt das Wächtersystem über die Alarmierung der Amygdala an. Dies führt erstens zur Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin in das Kreislaufsystem, dann zweitens zur Aktivierung der sogenannten Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse mit einer Ausschüttung von Cortisol. Der ganz Organismus, aber auch die Psyche befinden sich nun in einem Alarm- und Mobilisierungszustand, der auf einen anstehenden Kampf oder eine Flucht vorbereitet. Dabei wird Glukose für die Muskeln bereitgestellt, die Muskeln werden angespannt, der Herzschlag und der Atem werden beschleunigt, der Blutdruck steigt, und die betroffene Person fühlt sich wach, erregt und energetisiert. Zugleich werden parasympathische, nun in der Kampf- oder Fluchtsituation unwichtige Funktionen wie die Verdauung ausgeschaltet.
Der Parasympathikus ist der Gegenpol zu dieser sympathischen Aktivierung. Fühlen wir uns entspannt, in Sicherheit und Ruhe, herrscht dieser Teil des autonomen Nervensystems vor. In dieser Phase verdauen wir, kommt es zur Regeneration und auch zu Heilungsprozessen bei Wunden.
Es gibt noch weitere engstens verbundene Schnittstellen zwischen Körper und Psyche und zwischen Körper und Gehirn. Ich nenne hier nur im Überblick das enterische Nervensystem in der Bauchregion, dann weitere hormonelle Reaktionen im ganzen Körper, die Reaktionen im Immunsystem bis hin zu den Genen über epigenetische Prozesse.
In einer Verlustsituation sind über das Bindungssystem, über das Wächtersystem und das Verlustschmerz- und Trauersystem alle diese Körpersysteme massiv betroffen. Dazu kommen die körperlich fundierten dissoziativen Reaktionen bei traumatisierenden Verlusten. Der ganze Körper ist das Medium einer Verlusterfahrung. Wir müssen also von einer Psychosomatik und umgekehrt von einer Somatopsychik der Trauerreaktion und des Trauererlebens sprechen. Der letztere Kunstbegriff verweist auf den großen Einfluss der Körperreaktionen auf unser Trauererleben und unseren Trauerprozess.
Zentrum unseres Wächtersystems, das als Teil des Bindungssystems bei einem Verlust anspringt, ist die Amygdala, die in unserem emotionalen Gehirn, dem limbischen System, lokalisiert ist. Wir teilen das limbische System einschließlich der Amygdala mit allen Säugetieren und damit auch archaische Emotionen wie beispielsweise eine alles beherrschende Panik. Deshalb wird hier vom Paniksystem gesprochen, das ganz spezifisch bei einer drohenden Trennung anspringt und das sich deutlich vom Angstsystem unterscheidet.
Bitte beachten
Die Panik des Paniksystems bei drohendem Verlassenwerden unterscheidet sich deutlich von anderen Angsterfahrungen. Die Panik wird durch die Bedrohung einer wichtigen Bindungsperson und damit durch eine drohende Trennung ausgelöst, die Angst dagegen bei der Bedrohung der eigenen Person. Dazu gehören solche typischen Ängste wie die Höhen- oder Platzangst. Die Panik entsteht evolutionsbiologisch vor der Angst, ist in aller Regel intensiver und gehört zum Bindungssystem.
Wird nun eine wichtige Bindungsperson bedroht oder entfernt sie sich für längere Zeit, dann springt die Amygdala mit massiven Panikgefühlen an. Die Panik gehört hier zu einer Trennungsdrohung oder einer erlebten Trennung, oft auch als Trennungsstress bezeichnet. Der Säugling, das Kind, aber auch der Erwachsene beginnen, nach der ausbleibenden Bindungsperson zu rufen. Kommt die Bindungsperson nicht, protestiert der Säugling und das Kleinkind gegen deren Abwesenheit mit wütendem Schreien. Schließlich schreit das Kind den beginnenden Verlustschmerz nach außen, um dann in ein verzweifeltes Schreien und letztlich in eine resignative Ohnmacht und Erschöpfung zu verfallen.
Mit diesen Reaktionen des Paniksystems als Teil des Bindungssystems soll die abwesende Bindungsperson alarmiert und herbeigerufen werden. Die Panikreaktion ist also ein evolutionsbiologisch alter Mechanismus, der eine bedrohte oder verloren gegangene Bindung wieder herstellen soll. Für die meisten Säugetiere, insbesondere für den Säugling, bedeutet der Verlust der Bindungsperson den sicheren Tod in einer feindlichen Umwelt.
Die Panik als Ausdruck einer Verlustbedrohung unterscheidet sich im Erleben auch von der Angst, etwa vor einer Prüfung. Panik ist auf eine Bindungsperson, die Angst dagegen ist auf uns selbst und unser eigenes Überleben bezogen. Die Panik als Reaktion auf einen drohenden, dann auch eintretenden Verlust ist mit vielen physiologischen Körperreaktionen verbunden, die über das sympathische Nervensystem ausgelöst werden (vgl. letzter Exkurs). Die Panik ist eine der intensivsten Körpererfahrungen, in der die Betroffenen ganz Panik und zugleich ganz Körper sind.
Was bedeutet dies für eine schwere Verlusterfahrung? Stirbt ein naher Mensch, bleibt dieser auf Dauer abwesend. Zwar wird bei einem Verlust durch den Tod zunächst auch das Wächtersystem des Bindungssystems, also das Paniksystem, aktiviert, aber diese Reaktion bringt den verstorbenen nahen Menschen im Äußeren nicht mehr zurück. Sobald diese Realität der endgültigen Abwesenheit wenigstens ein Stück ins Erleben tritt, werden in diesem System Ohnmacht, Hilflosigkeit und Verzweiflung erlebt.
Nun gibt es an dieser Stelle zwei mögliche weitergehende Entwicklungen. Bleiben die Trauernden in der Erfahrung von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Verzweiflung und schließlich in einer lähmenden Resignation, Apathie und Erschöpfung, dann führt dieser Prozess in eine depressive Entwicklung bis hin bis zu einer manifesten Depression. Dieser Pfad der Verlustdepression wird in Kapitel 9 kurz angesprochen.
Der zweite Entwicklungspfad besteht nun darin, dass mit dem allmählich realisierten Verlust das Verlustschmerz- und Trauersystem einsetzt. Auch dieses System gehört zum Bindungssystem und kann als Verlustmelder bezeichnet werden. Die Hinterbliebenen erleben die Abwesenheit des verstorbenen nahen Menschen und die dazugehörigen Gefühle von Verlustschmerz und Trauer. Können Trauernde diese Gefühle spüren und dann abfließen lassen und können sie statt einer äußeren zu einer inneren Beziehung zum verstorbenen nahen Menschen finden, führt dies zu einer produktiven Reorganisation des Bindungssystems. Trauernde erleben sich zunehmend als selbstwirksam, sodass die Verlusterfahrung zu einer ins Leben führenden Transformation wird. Wird dieser Entwicklungspfad gestört, blockiert oder einseitig gelebt, führt er in vielen Fällen zu Körpersymptomen und zu belastenden Körpersymptomatiken, die auch die Form von psychosomatischen und organischen Erkrankungen annehmen können. Hier wird der Körper dann Ort einer Somatisierung (vgl. besonders Kapitel 9 und 10).
Der Verlustmelder des Bindungssystems – das Verlustschmerz- und Trauersystem
Der Tod eines nahen Menschen wird als Entreißen des nahen Menschen erlebt. Er ist zunächst im Äußeren nicht mehr da, er fehlt und wird vermisst. Weil er als wichtige Bezugsperson immer auch als innere Person repräsentiert und gespeichert ist, erleben die Trauernden meist auch, dass ihnen der nahe Mensch aus dem Inneren entrissen wird, oft mit dem Ausdruck »aus meinem Herzen gerissen«. Wir haben gesehen, dass das Bindungssystem sehr wohl den nahen Menschen weiterhin bewahrt. Dies muss aber von den Trauernden erst wieder gespürt und bewusst erlebt werden.
Bitte beachten
Auch wenn der verstorbene nahe Mensch im Äußeren fehlt, bleibt er als embodied Repräsentation und innere Person weiter im Bindungssystem erhalten. Das ist die Grundlage einer inneren (!) Beziehung zu einer bleibenden (!) inneren, embodied Repräsentation des verstorbenen nahen Menschen (Kapitel 7).
In der Trauerbegleitung gebrauchen wir nicht die wissenschaftlichen Begriffe wie Repräsentanz oder inneres Objekt, sondern reden von dem oder der Verstorbenen. Dies entspricht dem Erleben der Trauernden, die den verstorbenen nahen Menschen als psychische innere Realität erfahren.
Wenn die Amygdala die Gefahr für das Bindungssystem bei einer drohenden Trennung anzeigt, braucht es nun ein weiteres System, welches das konkrete Fehlen des nahen Menschen und seine bleibende Abwesenheit signalisiert. Anfangs wird der Verlust eines nahen Menschen zunächst nur ein Stück weit realisiert, dennoch springt nun das Verlustschmerz- und Trauersystem an. Dieses meldet nun das endgültige Fehlen des nahen Menschen im Äußeren als eine konkrete Realität. Der nahe Mensch ist nicht mehr da, er ist abwesend und er fehlt in vielen konkreten alltäglichen Lebensvollzügen. Das Verlustschmerz- und Trauersystem ist also der Verlustmelder des Bindungssystems.
Bitte beachten
Werden der Wächter des Bindungssystems, also das Paniksystem, über die Amygdala und der Verlustmelder des Bindungssystems, also das Verlustschmerzsystem, alarmiert, dann wird bei schweren Verlusten ein Abschalt- und Schutzsystem mit seinen dissoziativen Reaktionen zum Schutz der Trauernden aktiviert (Kapitel 3).
Der Verlustschmerz ist nichts anderes als die schmerzende Seite der Liebe (Vitale u. Smith, 2022; Eisenberger, 2015). Ohne eine intensive Bindung an den nahen Menschen gäbe es keinen Verlustschmerz und keine Trauer. Insofern stellt der Verlustschmerz den Preis der Liebe dar. Verlustschmerz und Trauer zeigen zudem die besondere Bedeutung des verstorbenen nahen Menschen und der Beziehung zu ihm.
Bitte beachten
Das Bindungssystem reagiert bei einem Verlust nicht nur mit Verlustschmerz und Trauer, sondern mit einer unmittelbaren, ebenfalls körperlich vermittelten Reaktion der Liebe, zunächst mit einer intensiven Sehnsuchtsliebe (vgl. Kapitel 7), die sich dann zu einer liebenden Verbundenheit mit dem verstorbenen nahen Menschen entwickelt.
Wir werden das Verlustschmerz- und Trauersystem in Kapitel 5 genauer beschreiben. Wichtig dabei ist, dass der Verlustschmerz als körperlicher und körpernaher Schmerz vor der Trauer entsteht und erlebt wird. Und natürlich wird der Verlustschmerz, wie dann auch im Wesentlichen die Trauer – wie alle anderen somatischen Schmerzen – im und über den Körper in der sogenannten Schmerzmatrix (Zhang, Zhang u. Kong, 2019; Fenton, Shih u. Zolton, 2015) erfahren. Die Schmerzmatrix umfasst alle relevanten Regionen des Gehirns, die neuronal zunächst Körperschmerz, dann aber auch Verlustschmerz repräsentieren.
Über das Schmerzsystem und die dazugehörigen Körperreaktionen kann sich nun der schon erwähnte Prozess der Somatisierung entwickeln, wenn der Verlustschmerz und die Trauer im Körper blockiert und so im Körper stecken bleiben, was dann zunächst zu Körpersymptomen und Körpersymptomatiken und des Weiteren zu psychosomatischen Störungen bis hin zu organischen Erkrankungen führen kann. Dies wird in Kapitel 9 und 10 ausführlich behandelt.
Reorganisation des Bindungssystems – wie die Liebe die Beziehung zum verstorbenen nahen Menschen findet
In den bisher üblichen Traueransätzen standen die Trauer und deren Bearbeitung im Mittelpunkt mit dem Ziel, den verstorbenen nahen Menschen loszulassen. Doch dieser inzwischen veraltete Ansatz des »Loslassens« übersieht, dass das Bindungssystem auf einen Verlust durch Tod nicht nur mit Verlustschmerz und Trauer, sondern mit seiner eigenen Reorganisation reagiert, zunächst mit der körperlich erlebten Sehnsuchtsliebe und dann mit einer bleibenden inneren Verbundenheit mit dem Verstorbenen. Das Bindungssystem ist also außerordentlich resilient. Es wird durch einen schweren Verlust nicht zerstört, sondern zu einer Reorganisation angeregt. Diese Reorganisation des Bindungssystems besteht darin, dass es nun von einer äußeren Beziehung zu dem nahen Menschen auf eine nur innere, imaginative und symbolische, natürlich auch körperlich erlebbare Beziehung umstellt. Wir werden die konkreten Prozesse dieser Reorganisation, die ganz zentral auch auf der Körperebene erfolgen, in Kapitel 7 näher kennenlernen.
Wie das Bindungssystem mit und über den Körper beim Tod eines nahen Menschen reagiert – ein Überblick
Die Reaktion des Bindungssystems auf den Tod eines nahen Menschen hat nun folgende, hier im Überblick dargestellte psychophysiologische und somatopsychische Prozessebenen:
–
Embodied Repräsentanzen eines wichtigen nahen Menschen im Bindungssystem als Voraussetzung eines Verlusterlebens (
Kapitel 1
);
–
Alarmierung und Aktivierung des Bindungssystems über das Paniksystem (
Kapitel 1
);
–
Schutzreaktion des Organismus: Schock und Dissoziation des Erlebens und des Körpers (
Kapitel 3
);
–
Verlustschmerz und Trauer als körpernahes Erleben des Schmerz- und Trauersystems (
Kapitel 5
);
–
Reorganisation des Bindungssystems mit dem Finden und Gestalten einer inneren Beziehung zum verstorbenen nahen Menschen als embodied Repräsentanz (
Kapitel 7
);
–
Lösung der Verlustschmerz- und Trauerreaktion und Bewahren der inneren Beziehung (
Kapitel 11
).
In Kapitel 9 und 10 werden das Entstehen der destruktiven Somatisierung eines gestörten, blockierten oder einseitigen Trauer- und Beziehungsprozesses und deren Bearbeitung und Lösung beschrieben.