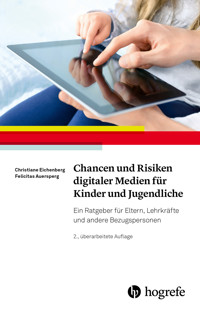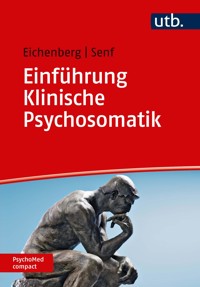48,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Traumafolgestörungen
- Sprache: Deutsch
Chancen und Risiken digitaler Angebote in der Traumatherapie Wegweiser durch die vielfältigen Optionen digitaler Angebote Praxisbezogene Empfehlungen und Entscheidungshilfen auf Basis der aktuellen Studienlage Speziell für den Einsatz in der Traumatherapie Durch die Corona-Pandemie hat die Psychotherapie und damit auch die Traumatherapie einen enormen Digitalisierungsschub erfahren. Das Angebot an digitalen Anwendungen, die traumatisierten Menschen innerhalb von Selbsthilfe, Beratung und Therapie helfen können, ist vielfältig. Es reicht von Selbsthilfeforen, Blogs, Apps und Serious Games über Online-Therapie bis hin zu Virtual-Reality-Umgebungen. Der Einsatz digitaler Medien ist mit neuen Chancen verbunden, hat aber auch Grenzen und birgt Risiken, die es abzuwägen gilt. So kann die digitale Mediennutzung z.B. auch Auslöser für traumatische Erfahrungen sein, die sogenannten »Cyber-Traumata«. Alle Berufsgruppen, die mit Prävention und Behandlung von Traumafolgestörungen zu tun haben, erhalten mit diesem Buch erstmalig einen Überblick zu den Schnittstellen von Trauma und digitalen Medien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Christiane Eichenberg und Jessica Huss
Trauma und digitale Medien
Therapiemöglichkeiten und Risiken
Klett-Cotta
TRAUMAFOLGESTÖRUNGEN – VORBEUGEN, BEHANDELN UND REHABILITIEREN
Herausgegeben von Robert Bering und Christiane Eichenberg
Krieg, Erdbeben, Hochwasser, Corona, häusliche Gewalt, Amokläufe, Gewalt im Internet – psychische Beeinträchtigungen als Folge von Gewalt, Unfällen oder Naturkatastrophen finden in der Öffentlichkeit und in Fachkreisen zunehmend Aufmerksamkeit und stellen Psychotherapeutinnen und sozialpädagogische Helfer vor besondere Herausforderungen. Die psychosoziale Versorgung nach potenziell traumatisierenden Erfahrungen reicht von der Psychosozialen Akuthilfe über eine Psychotherapie bis zur Rehabilitation am Ende einer Versorgungskette.
Die einzelnen Bände der Reihe informieren über die Methoden der psychosozialen Versorgung für einzelne Risikogruppen, die Möglichkeiten der Prävention von Belastungsstörungen und innovative Wege der Beratung und Behandlung bei unterschiedlichen Traumata und Verlaufstypen.
Die Herausgeber:innen:
Robert Bering, Prof. Dr., war Mitgründer und zuletzt Chefarzt des Zentrums für Psychotraumatologie/Klinik für psychosomatische Medizin der Alexianer Krefeld GmbH. Heute lehrt er an der Universität zu Köln und ist Chefarzt in der Regionspsychiatrie Gødstrup in Dänemark.
Christiane Eichenberg, Prof. Dr., ist Leiterin des Instituts für Psychosomatik der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien, Fakultät für Medizin.
Die Einzelbände behandeln folgende Themen:
1. Band: Trauma und moralische Konflikte
2. Band: Kompendium Traumafolgen – Verlauf, Behandlung und Rehabilitation der komplexen PTBS
3. Band: Trauma und digitale Medien – Therapiemöglichkeiten und Risiken
4. Band: Trauma und Gegenübertragung (Herbst 2023)
5. Band: Krisenintervention und Akuttherapie (Frühjahr 2024)
Weitere Bände in Vorbereitung
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Bettina Herrmann, Stuttgart
unter Verwendung einer Abbildung von Urupong/iStock by Getty Images
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Kempten
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
Lektorat: Dipl.-Psych. Mihrican Özdem, Landau
ISBN 978-3-608-98427-9
E-Book ISBN 978-3-608-12165-0
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20626-5
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Dank
Kapitel 1
Einführung – Bedeutung digitaler Medien für die Psychotraumatologie
1.1 Schnittstellen zwischen der Psychotraumatologie und digitalen Medien – zentrale Begriffe und Konzepte
1.1.1 Zentrale Begriffe im Bereich E-Mental-Health
1.1.2 Zentrale Konzepte in der Psychotraumatologie
1.2 Inanspruchnahme digitaler Medien bei psychischen Erkrankungen
1.2.1 Inanspruchnahme durch Patienten
1.2.2 Inanspruchnahme durch Behandler
Kapitel 2
Digitale Medien in Prävention und Behandlung psychotraumatischer Störungen
2.1 Gesundheitsbezogene Websites
2.1.1 Inhaltsqualität von Websites
2.1.2 Klinisch relevante Effekte auf den Nutzer
2.2 Online-Selbstdiagnostik
2.2.1 Symptomchecker
2.2.2 Psychologische Selbsttests
2.2.3 Klinisch relevante Effekte auf den Nutzer
2.3 Online-Selbsthilfe: Online-Tagebücher und Communitys
2.3.1 Online-Tagebücher: Blogs und Channels
2.3.2 Soziale Bewegungen im Internet
2.3.3 Online-Selbsthilfegruppen
2.4 Online-Beratung
2.4.1 Methoden und Formate der Online-Beratung
2.4.2 Varianten der Online-Beratung
2.4.3 Effektivität und Wirkmechanismen
2.4.4 Inanspruchnahme, Herausforderungen und Empfehlungen
2.5 Online-Therapie
2.5.1 Kognitiv-behaviorale und psychodynamische Interventionsprogramme
2.5.2 Online-Interventionsansätze bei PTBS
2.5.3 Effektivität von Online-Interventionsansätzen
2.5.4 Herausforderungen und Empfehlungen
2.5.5 Remote-Therapie mittels Videotelefonie
2.6 Apps
2.6.1 Systematisierung von Apps zu psychischen Problemen und Störungen
2.6.2 Apps zu verschiedenen Traumafolgestörungen
2.6.3 Apps zu verschiedenen Typen von traumatischen Situationen und Zielgruppen
2.6.4 Herausforderungen und Empfehlungen
2.7 Computer- und Videospiele
2.7.1 Anwendung für die psychische und physische Gesundheit
2.7.2 Einsatz in der Psychotraumatologie
2.7.3 Effektivität von Computer- und Onlinespielen
2.7.4 Inanspruchnahme, Herausforderungen und Empfehlungen
2.8 Virtual-Reality-Anwendungen
2.8.1 Einsatz in der Psychotherapie
2.8.2 Einsatz in der Behandlung der PTBS
2.8.3 Effektivität von Virtual-Reality-Anwendungen
2.8.4 Inanspruchnahme, Herausforderungen und Empfehlungen
2.9 Zukünftige Trends bei digitalen Unterstützungsangeboten
2.9.1 Robotik
2.9.2 Digitale Phänotypisierung und Smart Sensing
2.10 Therapeutischer Umgang mit Online-Interventionsangeboten
2.10.1 Medienanamnese
2.10.2 Kriterien zur Einbindung von E-Mental-Health in die Traumatherapie
Kapitel 3
Psychotraumatische Gefahren der Nutzung digitaler Medien
3.1 Cybermobbing
3.1.1 Prävalenz
3.1.2 Motive von Mobbern und Bystandern
3.1.3 Psychische Folgen
3.1.4 Prävention und Intervention
3.2 Sexuelle Gewalt im Internet
3.2.1 Formen von sexueller Gewalt im Internet
3.2.2 Prävention und Intervention
3.3 Cyberdating-Missbrauch
3.3.1 Ausgewählte Missbrauchsereignisse beim Cyberdating
3.3.2 Eigene Studie zum Cyberdating-Missbrauch
3.4 Traumatische Erfahrungen in Online-Spielen
3.4.1 Sexismus in Online-Spielen
3.4.2 Auswirkungen des Sexismus in Online-Spielen
3.4.3 Eigene Studie zum Sexismus im Online-Gaming
3.5 Rezeption von Medienberichten über traumatische Ereignisse
3.5.1 Eigene empirische Untersuchungen
3.5.2 Empfehlungen für die journalistische Arbeit
3.6 Behandlungstechnische Empfehlungen zum Umgang mit traumatischen Erfahrungen im virtuellen Raum
Kapitel 4
Ausblick
4.1 Forschungsdesiderate
4.2 Zukunftstrends
4.2.1 Berücksichtigung traumatischer Erfahrungen in weiteren digitalen Kontexten
4.2.2 Just-in-time-Interventionen
4.2.3 Auf künstlicher Intelligenz basierende Chatbots
4.3 Digitale Medien in der Aus-, Fort- und Weiterbildung
Literatur
Dank
Ein Buch kommt nicht ohne hilfreiche und sachkundige Unterstützung zustande, Studien nicht ohne die geduldige Bereitschaft der Probandinnen, an ihnen teilzunehmen. In diesem Sinne danken wir all unseren Befragungsteilnehmenden für ihre intrinsische Motivation, einen Beitrag zum Wissenszuwachs im Bereich Mediennutzung und psychische Traumatisierung zu leisten. Für die wissenschaftliche Zuarbeit danken wir den engagierten Psychologinnen Raphaela Schneider und Lilian Strobl ebenso wie unseren Studierenden, deren Erkenntnisse aus empirischen Masterarbeiten ein zentrales Fundament für die Aufarbeitung des Buchthemas darstellen.
Wir danken der hoch professionellen wie verständnisvollen Begleitung des Verlags, namentlich Herrn Heinz Beyer für die Starthilfe bei der Begründung unserer Reihe »Traumafolgestörungen – vorbeugen, behandeln und rehabilitieren« sowie Frau Katharina Colagrossi und Mihrican Özdem als Lektorinnen dieses Bands. Danke auch an Herrn Robert Lehrenfeld für die akribische Umbruchkorrektur. Nicht zuletzt danken wir all unseren Kollegen aus den Forschungsbereichen der Psychotraumatologie und E-Mental-Health, die mit uns seit vielen Jahren einen befruchtenden Dialog über unsere gemeinsamen Forschungsthemen führen. Ohne diesen Austausch und engagierte internationale Forschung hätten wir keine Basis gehabt, um den breiten Wissensfundus zusammentragen zu können und unserer Leserschaft einen wissenschaftlichen Hintergrund und praktische Hinweise zu geben, welche Chancen, aber auch Risiken mit digitalen Medien im Bereich der Psychotraumatologie verbunden sind.
Im Februar 2023,
Christiane Eichenberg, Wien
Jessica Huss, Berlin
Kapitel 1
Einführung – Bedeutung digitaler Medien für die Psychotraumatologie
Etwa seit der Jahrtausendwende steigt die Bedeutung der Digitalisierung im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen stetig an. Mittlerweile existieren unzählige Gesundheitsportale, Apps, Foren und Communitys, die von einem immer stärker wachsenden Segment der an Gesundheitsthemen interessierten und digital agierenden Gesellschaft genutzt werden. Inzwischen integrieren auch verschiedene Anwendungen künstliche Intelligenz. Was bedeutet diese Entwicklung für die Psychotraumatologie?
Dieser Frage widmen wir uns in dem vorliegenden Band. Um Antworten auf diese Frage zu finden, ist es zunächst nötig, die vielfältigen Schnittstellen zwischen der Psychotraumatologie und den digitalen Medien zu systematisieren. Unsere interessierten Lesenden werden mit dem Titel unseres Buches wahrscheinlich unterschiedliche Assoziationen verknüpfen, die Fragen in ihnen aufwerfen, wie z. B.: Können mittels digitaler Medien Traumafolgestörungen erfolgreich behandelt werden? Welche Konzepte gibt es, wie effektiv sind internetgestützte Behandlungen im Vergleich zu klassisch durchgeführten Traumatherapien? Welche Patienten präferieren welche Behandlungsmodalität? Möchte ich als Therapeutin (auch) im digitalen Setting arbeiten, oder sollte ich es, weil bestimmte Situationen, wie z. B. die aktuelle Covid-19-Pandemie, eine Öffnung des traditionellen Settings notwendig machen? Gleichzeitig begegnen uns in der Praxis Patienten, die von traumatischen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Nutzung von digitalen Medien berichten: Cybermobbing oder verschiedene Formen sexueller Gewalt sind Beispiele hierfür, die inzwischen schon unter dem Begriff des »Cybertraumas« subsumiert werden (Knibbs 2016).
Nach der Darstellung der verschiedenen Schnittstellen führen wir in zentrale Begriffe von E-Mental-Health ein, um unsere Leserschaft mit der Fachsprache digitaler Medien vertraut zu machen. Gleichermaßen stellen wir ausgewählte Konzepte der Psychotraumatologie dar, allerdings beschränken wir uns dabei auf diejenigen, die für das Verständnis des Einflusses von digitalen Medien auf das therapeutische Handeln relevant sind. Wir schließen das Kapitel ab mit dem aktuellen Forschungsstand zur Inanspruchnahme digitaler Medien bei psychischen Erkrankungen sowohl vonseiten der Patienten als auch vonseiten der Therapeutinnen. Studien belegen, dass in der psychotherapeutischen Versorgung heutzutage digitale Therapieoptionen nicht nur auf breites Interesse stoßen, sondern inzwischen einen wesentlichen Anteil darstellen. Damit ist E-Mental-Health auch ein Thema für die Psychotraumatologie, denn es wird davon ausgegangen, dass viele Menschen, die traumatische Ereignisse erleben mussten, auch bei der psychologischen Versorgung auf einen flexiblen Einsatz unterschiedlicher Technologien verstärkt Wert legen.
Umso wichtiger erscheint es uns, dass auch Traumatherapeuten hier über diesbezügliche Chancen, aber auch Grenzen fundiert informiert sind.
1.1 Schnittstellen zwischen der Psychotraumatologie und digitalen Medien – zentrale Begriffe und Konzepte
1.1.1 Zentrale Begriffe im Bereich E-Mental-Health
Betrachten wir die Schnittstelle zwischen digitalen Medien und psychischen Erkrankungen im Allgemeinen (ausführlich siehe Eichenberg & Kühne 2014), so stellen wir fest, dass zwei Perspektiven wesentlich sind, die sich selbstverständlich auch auf psychotraumatische Störungen im Speziellen anwenden lassen: zum einen die Nutzung digitaler Medien in der Prävention, Selbsthilfe, Beratung, Behandlung und Rehabilitation psychotraumatischer Störungen, was in das Forschungs- und Praxisfeld des E-Mental-Health fällt, zum anderen die klinisch relevanten Auswirkungen der Nutzung digitaler Medien, d. h. die Entwicklung psychotraumatischer Folgestörungen aufgrund traumatischer Erfahrungen im virtuellen Raum (Cybertrauma).
E-Mental-Health bei psychotraumatischen Störungen. Grundsätzlich muss unterschieden werden zwischen der Informations- und Kommunikationsfunktion digitaler Medien. Das Internet beispielsweise vereint als sogenanntes Hybridmedium beide Funktionen: Als Medium der Information ermöglicht es einen breiten Zugang zu störungsspezifischen Informationen. In seiner Kommunikationsfunktion bietet es Optionen zur Individual-, Gruppen- und Massenkommunikation. Dabei muss unterschieden werden, ob die Kommunikation zwischen Patienten und Therapeuten (z. B. Online-Einzeltherapie oder Online-Gruppentherapie) oder zwischen Betroffenen untereinander erfolgt (z. B. in Online-Selbsthilfegruppen). Bei der Kommunikation von Betroffenen ist wiederum zu unterschieden, ob die Kommunikation »many to many« erfolgt, wie in den Online-Selbsthilfegruppen, oder »one to many«, was z. B. über YouTube-Channels umgesetzt wird, in denen Betroffene über ihren Krankheits- und Genesungsverlauf berichten. Ebenso ist es möglich, dass Patientinnen ausschließlich mit dem Computer kommunizieren, wie z. B. in Therapieprogrammen, die auf Chatbots basieren, die zum Teil künstliche Intelligenz nutzen. Der Massenkommunikation kommt vor allem bei der Vermittlung von gesundheitsbezogenen Informationen eine zentrale Bedeutung zu, indem beispielsweise Organisationen entsprechende Websites veröffentlichen. Insgesamt umfassen in der Klinischen Psychologie und Psychotherapie digitale Medien inzwischen ein breites Spektrum, zu dem unter anderem Internetanwendungen, mobile Apps, Computerspiele und Virtual Reality zählen.
Gut handhabbar ist demnach die Systematisierung patientenzentrierter E-Mental-Health-Angebote nach folgenden Aspekten:
Welche digitalen Medien werden eingesetzt?
Wie viele Empfänger werden adressiert (z. B. Individual- oder Gruppenangebote)?
Erfolgt die Kommunikation zwischen professionell Helfenden und Betroffenen, zwischen Betroffenen oder zwischen Betroffenen und einer Computeranwendung?
Auf welche Störungen beziehen sie sich (akute oder chronische Traumafolgestörungen)?
Zu welchem Zeitpunkt wird die Intervention gesetzt (präventiv, kurativ usw.)?
In den nachfolgenden Kapiteln wird deutlich, dass diese erste Systematisierung noch weiter auszudifferenzieren ist. An dieser Stelle soll sie jedoch nur kurz dargestellt werden, um die vielfältigen Schnittstellen greifbar zu machen.
Cybertrauma. Während digitale Medien also eine Vielzahl an Diensten zur Unterstützung traumatisierter Menschen bieten, bergen sie jedoch ebenso die Gefahr einer Traumatisierung ihrer Nutzer. Die zweite zentrale Schnittstelle betrifft demnach die psychotraumatischen Auswirkungen, die die Nutzung digitaler Medien mit sich bringen können. Dazu zählen z. B. Cybermobbing/-bullying und Cyberstalking. Wir wissen, dass immer mehr jugendliche Nutzer sozialer Netzwerke oder Chatrooms zu Opfern von Beleidigungen oder Verleumdungen werden, häufig mit Folge massiver psychischer Belastungen. Eine weitere Quelle traumatischer Erfahrungen stellt das Internet als Austragungsort sexueller Gewalt mit vielfältigen Formen dar. Ebenso stellt sich die Frage, inwiefern virtuelle Beziehungserfahrungen traumatisierend sein können (z. B. beim Falschen Profil/Love-Scamming, →Kap. 3.3.1) und ob virtuelle Übergriffe z. B. in Online-Spielen realen Übergriffen in ihren psychischen Folgen gleichkommen. Die Forschung hat sich mit diesen Fragen beschäftigt, sodass bereits neue Begriffe wie »online dating abuse« (Missbrauchserfahrungen bei der Online-Partnersuche) oder »Cybertrauma« als Oberbegriff für psychotraumatische Folgen nach Cyberdelikten geprägt wurden.
Definition: Cybertrauma
Cybertrauma wird nach der britischen Psychotherapeutin Catherine Knibbs (2016–2021) wie folgt definiert:
»Any trauma that is a result of self- or, other-directed interaction with, mediated through, or from any electronic internet/cyberspace ready device or machine learning algorithm, that results in impact now or the future. This event/interaction can be multi-modal, multi-platform and multi-interval, delayed or immediate, legal or not, singular or plural, and may include images, sound, touch and or text and may or may not be vitriolic in nature. Events may include covert and overt typology and may be virtual and corporeal and/or at the same time.«
Um die Folgen eines Cybertraumas adäquat behandeln zu können, ist es wichtig, die Besonderheiten von Cyberdelikten sowohl aufseiten des Täters als auch des Opfers zu kennen.
Weitere Schnittstellen. Weitere Schnittstellen zwischen der Psychotraumatologie und den digitalen Medien betreffen zum einen die Möglichkeiten des kollegialen Austauschs, wie z. B. Intervision und Supervision über Videokonferenzen oder Mailinglisten, der aber auch breiter angelegt in sogenannten Online-Traumanetzwerken organisiert wird. Ebenso eröffnet das Internet Optionen zur Fort- und Weiterbildung sowie zur Forschung, indem z. B. in Online-Befragungen leicht große Stichproben rekrutiert werden können. Schließlich werden auch Fragen der Medienwirkungen virulent; so wissen wir z. B., dass mediale Berichte über Gewaltverbrechen die Einstellung gegenüber Täterinnen und Opfern verändern (Eichenberg & Ebert 2008; Huss & Eichenberg 2016), sodass vor allem dem Internet als inzwischen wichtigem massenmedialem Nachrichtenmedium auch hier eine zentrale Funktion zukommt. Dies hat zur Konsequenz, dass wir Internet-Journalistinnen psychotraumatologische Kenntnisse vermitteln müssen, sodass »gute« Berichterstattung möglich wird; d. h. Berichte entstehen, die psychische Störungen entstigmatisieren und mögliche sekundäre Traumatisierungen der Rezipienten vermeiden.
Um die Chancen der digitalen Therapie, aber auch Risiken des digitalen Raums für die Entwicklung und Chronifizierung psychotraumatischer Störungen zu verstehen, müssen zentrale Begriffe aus dem Bereich von E-Mental-Health erläutert und Konzepte aus der Psychotraumatologie herangezogen werden. Um zu analysieren, für welche Patientengruppen und in welcher Phase des traumatischen Verlaufsprozesses der Einsatz dieser Medien indiziert ist, müssen wir verschiedene Arten von Traumata und Traumafolgestörungen unterscheiden, das Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung berücksichtigen und Betroffene einteilen nach dem Kriterium des spezifischen Risikos, nach einem traumatischen Ereignis eine Traumafolgestörung zu entwickeln. Allgemeine Krankheitstheorien, kurze Hinweise zum diagnostischen und therapeutischen Vorgehen in der traditionellen Praxis sind zentral, um zu prüfen, inwiefern diese auch für das Behandeln im Online-Setting handlungsleitend sind bzw. an das veränderte Setting adaptiert werden müssen.
Im Folgenden führen wir die zentralen Begriffe im Bereich des E-Mental-Health sowie deren Rahmenbedingungen auf.
E-Health. Trotz der Uneinigkeit über die Definition von E-Health haben alle Definitionen und unterschiedlichen Schreibweisen von E-Health gemeinsam, dass diese den Einsatz von Kommunikations- und Informationstechnologien im Gesundheitswesen umfassen (Christensen et al. 2002; Lux 2018).
Definition: E-Health
Die WHO definiert E-Health als die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien im Gesundheitswesen, z. B. für die Behandlung von Patienten, die Ausbildung von Gesundheitspersonal, die Verfolgung von Krankheiten und die Überwachung der öffentlichen Gesundheit (World Health Organization 2016).
In ähnlicher Weise definiert die Europäische Kommission E-Health als Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologie zum Zwecke der Bedürfnisbefriedigung von zahlreichen Anwendergruppen, z. B. Leistungserbringer im Gesundheitswesen, Bürger, Patienten und Angehörige (European Commission 2003).
Die Definition von E-Health wurde in den letzten Jahren über den bloßen Nutzen von Kommunikationstechnologie hinaus dahingehend erweitert, dass E-Health durch die Bereitstellung geeigneter Methoden und Konzepte Akteurinnen im Gesundheitswesen vernetzt sowie patientenorientierte Prozesse integriert. Dabei sind unterschiedliche Anwendungsfälle und Vernetzungen von Akteuren denkbar, z. B. Arzt zu Patient, Leistungsträger zu Patient, Patient zu Arzt usw. Je nach Beziehung sind unterschiedliche Anwendungsszenarien sowie Dienste, Plattformen, Portale usw. möglich. Ziel der meisten E-Health-Lösungen, die auch als soziotechnische Systeme zu verstehen sind, ist es, die Menschen bei der Erfüllung von Aufgaben mithilfe von Technik zu unterstützen (Lux 2018). Als Vehikel für die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie im Gesundheitswesen fungieren die Telematikinfrastruktur sowie rechtliche Rahmenbedingungen, die einen sicheren Transfer von personenbezogenen Daten garantieren (zum Thema Datenschutz siehe Eickmeier 2018).
Rechtliches. Wie sehen die formalen Regelungen im Umgang mit und durch E-Health-Anwendungen aus? Die Beschlüsse, Richtlinien und Gesetze umfassen das Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgrundverordnung, Telemediengesetz, Strafgesetzbuch, Musterberufsordnung für Ärzte sowie IT-Sicherheits- und Medizinproduktgesetze. Ohnegleichen bietet die Digitalisierung viele Chancen und innovative Räume im Gesundheitswesen, andererseits entstehen dadurch auch Risiken, besonders wenn es um die Erhebung von personenbezogenen Daten geht (Lux 2018). Diese gelten als besonders schutzbedürftig, denn darunter fallen Informationen, wie z. B. Name, Kontaktdaten und Adresse des Nutzers, aber auch Standortdaten, Login-Daten sowie Gerätekennungen. Gesundheitsdaten zählen ebenso zu den personenbezogenen Daten, die Aufschluss über den Gesundheitszustand eines Individuums geben, enthalten in ärztlichen Behandlungen, Befunden oder Vorsorgemaßnahmen (Bauer 2018). Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) definiert den Umgang mit personenbezogenen Informationen in Deutschland. Als Grundsatz des Gesetzes gilt, dass die Erhebung, Weiterverarbeitung und -nutzung von personenbezogenen Daten nur erlaubt ist, wenn Personen ausdrücklich ihre Zustimmung geben (§ 4, § 4a BDSG). Das Gesetz folgt zudem den Prinzipen der Datensparsamkeit und -vermeidung, d. h., Datenverarbeitungssysteme sollen möglichst wenige personenbezogene Informationen sammeln. Weiterhin sollen Daten dadurch geschützt werden, in dem sie anonymisiert oder pseudonymisiert werden. Das Bundesdatenschutzgesetz gilt für öffentliche und private Unternehmen (Eickmeier 2018). Abgesehen von der Tatsache, dass Datensicherheit und -verarbeitung von personenbezogenen Informationen rechtlichen und gesetzlichen Vorlagen unterliegen, ist ein hohes Datenschutzniveau ein wichtiger Pfeiler für die Inanspruchnahme von digitalen (Gesundheits-)Anwendungen sowie für das Vertrauen bei Nutzerinnen (Weichert 2014).
E-Health stieß erst langsam auf das Interesse von politischen Entscheidungsträgern; erst vor wenigen Jahren wurden die ersten E-Health-Gesetze verabschiedet (Bundesministerium für Gesundheit 2016). Eines der ersten E-Health-Gesetze war das »Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen«, das im Januar 2016 in Kraft getreten ist (Bundesgesetzblatt I 2015, Nr. 54 v. 28. Dezember 2015; Eickmeier 2018). Mithilfe des E-Health-Gesetzes wird konkret geregelt, wie Patientendaten im Gesundheitswesen sicher genutzt und übertragen werden. Zum Beispiel bekamen Patienten durch dieses Gesetz erstmals die Gelegenheit, ihre eigenen Daten (z. B. von Wearables oder Fitnesstrackern) an Ärztinnen zu übermitteln. Das E-Health-Gesetz stellt somit auch den Einstieg in die viel diskutierte elektronische Patientenakte dar. Im Jahre 2019 wurde das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) mit dem Ziel ins Leben gerufen, fortschrittliche digitale Infrastruktur, Verschreibung von Gesundheitsanwendungen und weitere Pilotprojekte zu fördern (Beerheide 2019).
Digitale Gesundheitsanwendungen. Durch das Digitale-Versorgung-Gesetz und der spezifischen Änderung des Sozialgesetzbuches V (SGB V) haben gesetzlich versicherte Personen einen Anspruch auf die Kostenübernahme von bestimmten und geprüften digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA), die besonders durch die Covid-19-Pandemie und deren Folgen einen wichtigen Stellenwert gewonnen haben. Dennoch müssen die DiGA einige Kriterien erfüllen. Beispielsweise muss eine digitale Gesundheitsanwendung ein Medizinprodukt mit geringem Risiko sein, was zur Erkennung, Überwachung, Linderung oder Behandlung von Erkrankungen eingesetzt wird. Die Hauptfunktion der DiGA beruht auf Technologien und der medizinische Zweck wird durch diese Hauptfunktion wesentlich erreicht. Diese werden in ein neu eingerichtetes amtliches Register für DiGA aufgenommen, das vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geführt wird. Nach erfolgreicher Prüfung hinsichtlich Sicherheit, Funktionalität, Qualität des Medizinprodukts, Datenschutz, Datensicherheit sowie positiver Auswirkungen der jeweiligen DiGA auf die Versorgung können DiGA mit Genehmigung der Krankenkasse oder durch Verordnung von behandelnden Ärzten oder Psychotherapeutinnen für Patienten eingesetzt werden (Gerke et al. 2020; Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 2022). Zitat aus dem BfArM (2022):
»Das Verfahren ist als zügiger ›Fast-Track‹ konzipiert [→ Abb. 1-1]: Die Bewertungszeit durch das BfArM beträgt höchstens drei Monate nach Eingang des vollständigen Antrags. Kern des Verfahrens sind die Prüfung der Herstellerangaben zu den geforderten Produkteigenschaften – vom Datenschutz bis zur Benutzerfreundlichkeit – sowie die Prüfung eines durch den Hersteller beizubringenden Nachweises für die mit der DiGA realisierbaren positiven Versorgungseffekte. Das sind Effekte, durch die sich der gesundheitliche Zustand eines Patienten oder die Möglichkeiten zum Umgang mit seiner Erkrankung durch die Benutzung der DiGA verbessern.«
Falls positive Versorgungseffekte nach Ablauf der Frist nicht hinreichend nachgewiesen werden können, besteht auf Basis der bisher eingereichten Erprobungsergebnisse eine Wahrscheinlichkeit eines späteren Wirksamkeitsnachweises, sodass das BfArM die DiGA vorläufig in das Verzeichnis aufnehmen kann (Verlängerung der Erprobungszeit auf 12 Monate) (GKV Spitzenverband 2022). Jedoch steht vor allem das Fast-Track-Verfahren in der Kritik, da eine noch nicht vollständig nachgewiesene Evidenz den Qualitätsanspruch von Medizinprodukten untergräbt.
Kolominsky-Rabas et al. (2022) untersuchten sechs DiGA hinsichtlich ihrer methodischen Qualität mit folgendem Ergebnis: Es fehlte eine Verblindung und es gab hohe Drop-out-Raten in der Interventionsgruppe sowie keine Vorabveröffentlichung eines Studienprotokolls, was ein hohes Verzerrungspotenzial birgt.
Abb. 1-1 Antragsstellung einer digitalen Gesundheitsanwendung (DiGA) für das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2022) (»Fast-Track«)
Informationen zu den DiGA werden den Patienten, Ärztinnen und Psychotherapeuten im Rahmen des DiGA-Verzeichnisses zur Verfügung gestellt, um gut informierte Entscheidungen treffen zu können und eine vertrauensvolle Anwendung zu gewährleisten. Im aktuellen DiGA-Verzeichnis (Stand: 14. Mai 2023; einsehbar unter https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis), gibt es 51 DiGA mit dem Schwerpunkt auf folgende Erkrankungen: Geschlechtsorgane, Herz- und Kreislauf, Hormone und Stoffwechsel, Krebs, Muskeln, Knochen und Gelenke, Nervensystem, Psyche sowie sonstige Erkrankungen. Von den 51 DiGA sind 18 dauerhaft aufgenommen, die restlichen sind vorläufig aufgenommen. Insgesamt 23 (dauerhaft und vorläufig aufgenommene) DiGA für die Erkennung, Überwachung, Linderung und Behandlung von psychischen Erkrankungen, wie z. B. Depression, Panikstörung, Agoraphobie mit Panikstörung, generalisierte Angststörungen, soziale Phobien, somatoforme Störungen, psychische Verhaltensstörungen durch Tabak/Alkohol sowie nichtorganische Insomnie sind in das Verzeichnis aufgenommen worden.
Auch wenn die DiGA kritisch zu betrachten sind, da diese nur mit minimalem bzw. gar keinem therapeutischen Kontakt und somit als reine Selbsthilfe verschrieben werden (entgegen den zahlreichen Forschungsergebnissen, die zeigen, dass begleitete Online-Interventionen am wirksamsten sind), stellt das DVG und seine Erstattungsstandards für DiGA einen wichtigen Schritt dar, um das deutsche Gesundheitssystem zu modernisieren und die Qualität für Patienten zu verbessern (Gerke et al. 2020).
Eine Umfrage des Handelsblatts (2021), das die 20 größten gesetzlichen Krankenkassen befragte, ergab, dass hochgerechnet 45 000 DiGA verschrieben wurden. Es lässt sich bereits eine steigende Tendenz erkennen, da zu erwarten ist, dass es eine Zeit dauert, bis das Konzept in der Versorgung angekommen sein wird. Weitere Erhebungen werden auch Aufschluss darüber geben, welche Patienten oder Personengruppen von den DiGA besonders profitieren, gerade wenn die Unterscheidung zwischen physischer und mentaler Gesundheit (E-Mental-Health) näher betrachtet werden wird.
E-Mental-Health. Unter E-Health fällt auch der Teilbereich E-Mental-Health, der ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Informationen im Bereich der psychischen Gesundheit durch das Internet und andere verwandte digitale Technologien bereitstellt, wie z. B. internetbasierte Programme, Informations-Websites, Foren und Apps (Moessner & Bauer 2017). Angesichts der Covid-19-Pandemie ist das Interesse und der Bedarf an E-Mental-Health-Lösungen gestiegen, auch wenn die Forschung und die praktische Auseinandersetzung mit digitalen Unterstützungsmethoden in der Therapie schon mehr als zwei Jahrzehnte alt sind. Angefangen mit dem Fokus auf Telepsychologie hat sich das Feld von E-Mental-Health-Anwendungen mit therapeutischen Spielen, virtueller Realität und Robotik erweitert. Auch hinsichtlich der Gerätenutzung gibt es technologische Fortschritte vorzuweisen. Während telepsychologische Anwendungen via klassischer Kommunikationssoftware, z. B. Telefon oder Videokonferenzsysteme, angeboten und genutzt werden, sind viele digitale Angebote für die mentale Gesundheit auch über mobile Geräte verfügbar (Mobile Health [mHealth]) (Ellis et al. 2021). In Abbildung 1-2 sind die gängigsten Typen von E-Mental-Health-Angeboten gelistet, die in den folgenden Kapiteln bezüglich eines Einsatzes in der Traumabehandlung geprüft werden. Dabei reichen die E-Mental-Health-Dienste vom klassischen Wissensaustausch über Internetseiten (siehe nächsten Punkt »Gesundheitsbezogene Online-Informationen«) bis hin zu neuartigeren Tools, wie z. B. Serious Games oder Virtual Reality. Alle Angebote können dabei in unterschiedlichen therapeutischen Phasen eingesetzt werden mit jeweils spezifischen Auswirkungen auf die therapeutische Beziehung. Die diesbezüglichen Einflüsse müssen jeweils reflektiert und die individuelle Medienkompetenz der Patientin berücksichtigt werden. Gerade bei traumatisierten Personen gilt es, die Retraumatisierungsgefahr durch eine unsachgemäße Anwendung von besonders immersiven E-Mental-Health-Tools zu vermeiden.
Abb. 1-2 Gliederung der E-Mental-Health-Angebote (adaptiert und modifiziert nach Hegerl et al. 2017; Ellis et al. 2021)
Gesundheitsbezogene Online-Informationen. Neben den ärztlichen bzw. psychotherapeutischen Fachexperten ist das Internet (z. B. »Googeln« von Symptomen) die wichtigste und erste Anlaufstelle für die Auseinandersetzung mit psychischen Problemen und stellt somit den ersten Schritt in einem Online-Hilfesystem dar (→ Kap. 2.1). Vorteilhaft ist, dass man eine Internetrecherche völlig anonym, ohne Angabe von Namen oder E-Mail-Adresse, zu jeder Zeit und zudem noch relativ kostengünstig (abgesehen von den Internet- oder WLAN-Kosten) durchführen kann. Informationen können schnell und zeitnah zu verschiedenen Problemstellungen und Krankheitsbildern recherchiert werden. Dies stärkt auch die Gesundheitskompetenz und Autonomie der Patienten. Gleichzeitig kann sich dies auch nachteilig auswirken, wenn Informationen nicht aktuell, widersprüchlich oder sogar falsch sind, die Patienten verunsichern können oder diese sogar die Meinung bzw. Diagnose von Fachexperten dadurch anzweifeln können (Eichenberg & Kühne 2014). Nach Marstedt (2018) verschweigen manche Patienten ihre Internetrecherche zu ihren Symptomen oder ihrem Krankheitsbild bei ihren Behandlern, was sich problematisch auf den Aufbau einer therapeutischen Beziehung auswirken und somit auch keine Fachkorrektur erfolgen kann. Zahlreiche Studien analysierten die Qualität von gesundheitsbezogenen Informationen mit dem Ergebnis, dass die Inhaltsqualität von Texten über psychische Erkrankungen variiert. Zum Beispiel war besagte Inhaltsqualität bei Informationen über bipolare Störungen, Schizophrenie oder dysthyme Störungen höher als bei Informationen über Phobie und Panikstörungen gemäß der Studie von Grohol et al. (2014), die über 400 Websites über psychische Probleme untersuchte. Aus diesem Qualitätsanspruch heraus resultierten unterschiedliche Ansätze, um den Standard von gesundheitsrelevanten Online-Informationen zu erhöhen. So hat z. B. die Health On the Net Foundation (HON) die »HON code of conduct« erarbeitet; das sind Kriterien, mit deren Hilfe Websites nach ihrer Glaubwürdigkeit beurteilt werden können (Eichenberg et al. 2019). In einer eigenen Studie (Eichenberg et al. 2013) haben wir die Qualität von PTBS-Seiten im deutschsprachigen Raum untersucht (N = 20 Suchergebnisse bei Google), und zwar die Art des Anbieters, die Qualität und die Nützlichkeit der Informationen, die präferierten Behandlungsansätze sowie die Benutzerfreundlichkeit der Website. Das Ergebnis war, dass verschiedene Arten der Behandlung (Psychotherapie, Pharmakotherapie usw.) in einem ausgewogenen Verhältnis dargestellt wurden, jedoch innerhalb der Psychotherapieschulen kognitiv-behaviorale Ansätze im Vergleich zu psychodynamischen Verfahren deutlich überrepräsentiert waren. Die Informationsqualität war mittelmäßig, bedingt durch die mangelhafte Benutzerfreundlichkeit der Websites. Falsch- und Fehlinformationen waren jedoch eher weniger zu finden.
Gesundheitsbezogener Online-Austausch. In dem Kontext ebenfalls relevant sind die Informierung und der gemeinsame Austausch über störungsspezifische Themen entweder mit gleichgesinnten Betroffenen im Sinne einer Online-Selbsthilfegruppe (→Kap. 2.3.3) oder mit Fachexpertinnen. Dies wird über Online-Foren ermöglicht, in denen Nutzer, meist anonym mit Pseudonymen oder »Nicknames«, Inhalte ohne Zeitdruck lesen und auch verfassen können. Online-Foren gibt es für unterschiedliche Zielgruppen (z. B. Jugendliche), Erkrankungen (z. B. Depression) und mit variierender wissenschaftlicher Fundiertheit und Betreuung (z. B. durch Moderatoren). Für Traumabetroffene gibt es z. B. folgende Forenangebote:
Für sexuellen Missbrauch (https://forum.wildwasser.de)
Für Mobbing (https://www.mobbing.net)
Für Traumafolgestörungen, insbesondere PTBS (https://ptbs-selbsthilfeforum.de/forum/)
Wesentliche Vorteile von Online-Foren sind die tageszeitunabhängige Erreichbarkeit sowie die Möglichkeit des Austauschs für mobil eingeschränkte und ländlich lebende Personen (Hegerl et al. 2017). Die Einhaltung von Forenregeln (idealerweise durch Moderatoren) ist jedoch zentral, um sichere Diskussionsräume zu schaffen.
Eine andere Form des Online-Austausches stellt das (asynchrone) Vloggen, Bloggen im Videoformat, dar (→Kap. 2.3.1). Vlogs sind beispielsweise über YouTube oder über Social-Medial-Kanäle für alle jederzeit einsehbar. Bei dieser Art des Austausches ist besonders die Entstigmatisierungsbemühung erkennbar, daneben auch die Informierung über Krankheiten und die Isolierung der Betroffenen (Sangeorzan et al. 2019). Über die Kommentarfunktion können Betroffene und Interessierte in den Austausch treten, was sich förderlich für die eigene Selbstwirksamkeit auswirken und Selbststigmatisierung reduzieren kann. Gerade der Online-Austausch über eigene traumatische Erkrankungen über Social Media muss auch hinsichtlich einer Retraumatisierungsgefahr hinterfragt werden. Beispielsweise haben Studien zur Online-Bewegung #MeToo (= Teilen von Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch) (Eichenberg et al. 2022) gezeigt, dass es auch Betroffene gibt, die sich über das öffentliche Teilen von sexuellen Missbrauchserfahrungen belastet gefühlt haben (→Kap. 2.3.2). Es werden auch Vlogs zur Kommunikation über Traumata im Militärbereich genutzt. Militär-Videoblogs werden z. B. von Militär-Veteranen auf YouTube veröffentlicht, die über ihre Einsatzerfahrungen und damit verbundene Traumata berichten.
Selbstdiagnostik und Monitoring. Im Internet gibt es zahlreiche Angebote zur Online-Selbstdiagnostik von vielen Problembereichen und Störungsbildern (→Kap. 2.2). Ähnlich wie bei der eigenen Internetrecherche zu psychischen Symptomen ist die Selbstdiagnostik vor allem deshalb beliebt, weil weder Arzt noch Psychotherapeutin konsultiert werden müssen und dies völlig anonym erfolgen kann. Die Selbstdiagnostik kann entweder durch psychologische Selbsttests oder sogenannte Diagnosegeneratoren oder Symptomchecker erfolgen. Viele Tests mit seriösen Skalen, aber auch eher unterhaltungsorientierte Tests finden sich auf www.queendom.com mit Angabe zu Art des Tests, Durchführungsdauer, Art des Feedbacks und Informationen zu Qualitätsmerkmalen (z. B. Validität/Reliabilität der verwendeten Skalen). Andere Tests werden von den Entwicklerinnen auch für die eigene klinische Praxis (in diesem Fall ohne kommerziellen Nutzen) angeboten. Die Diagnosegeneratoren funktionieren, indem psychische oder körperliche Symptome eingegeben werden. Die Ergebnisse dieser Diagnosegeneratoren variieren von einfachen Kopfschmerzen bis hin zu Krebserkrankungen. Dies kann schlimmstenfalls dazu beitragen, dass Nutzer ihre Symptome entweder nicht ernst nehmen und somit keine Fachberatung erfolgt oder dass sie sich selbst behandeln. Laut unserer Studie (Eichenberg & Auersperg 2015) betreiben Frauen häufiger Selbstmedikation als Männer, zu der auch der Erwerb von sogenannten Over-the-counter-Präparaten, also rezeptfreien Präparaten gehört. Es existieren auch Angebote für die Online-Diagnostik von psychischer Traumatisierung (→Kap. 2.2), wie z. B. das »Smart Assessment on your Mobile« (SAM) (van der Meer et al. 2017). SAM ist ein Screening für traumabezogene Symptome durch eine webbasierte Anwendung. Das Ziel ist es, Betroffene zu identifizieren, die weiterer Behandlungen bedürfen. Studienergebnisse zeigten eine wesentliche Übereinstimmung zwischen SAM und der analogen diagnostischen Beurteilung (= diagnostisches Interview) von PTBS und Depression.
Online-Beratung. In der nationalen und internationalen Fachliteratur wird teilweise wenig bis gar nicht zwischen Online-Beratung und Online-Psychotherapie unterschieden. Wir halten jedoch diese Unterscheidung, wie sie auch in der Klinischen Psychologie für die Beratung und Psychotherapie im traditionellen Setting getroffen wird, für wichtig und haben zu beiden Optionen separate Kapitel geschrieben. Online-Beratung und Online-Therapie können im virtuellen Setting entweder in asynchroner oder synchroner Form erfolgen. Eine weitere Differenzierung ist die Kommerzialisierungsart, z. B. nach Profit bzw. Non-Profit-Angeboten (→Kap. 2.4), die jedoch vor allem für die Online-Beratung relevant ist, da – außer im Rahmen von Forschungsprojekten – Online-Therapie in der Regel nicht unentgeltlich angeboten wird. Ergänzend beschreibt Engelhardt (2018) die Online-Beratung als dialogisches Instrument im Gegensatz zur Online-Therapie, das oft einen festen Programmcharakter oder auch Interventionsstufen besitzt. Das wohl wichtigste Abgrenzungskriterium ist aber, dass Online-Beratung nicht bei der Diagnose und Behandlung von psychischen Erkrankungen indiziert ist, sondern höchstens als Begleitmaßnahme.
Die Online-Beratung hat jeweils zwei Phasen hinsichtlich der Institutionalisierung durchlaufen. Begonnen hat die erste Generation der Online-Beratung 1995 mit Beratungen über das Telefon und teilweise noch über unverschlüsselte und ungeschützte E-Mail-Programme (Telefon, Mail- und Chatseelsorge), was heute im Anbetracht des Datenschutzes gar nicht mehr denkbar wäre. Einer der sogenannten »early adopters« war »Sextra«, eine anonyme und deutschlandweite Mailberatung zu Themen wie Schwangerschaft, Partnerschaft, Familienplanung, aber auch sexuelle Gewalt, die nach wie vor angeboten und genutzt wird. Zirka ab 2003 kann von einer zweiten Phase von Online-Beratungen gesprochen werden, die durch eine zunehmende Professionalisierung geprägt war. Nicht nur wurde die »Deutsche Gesellschaft für Online-Beratung« 2005 gegründet, sondern es entstanden auch Fachzeitschriften, themenspezifische Kongresse und Tagungen, Lehrgänge sowie Qualitätsstandards. Nicht zuletzt sind weitere zahlreiche Online-Beratungsdienste für diverse Themen und Zielgruppen entstanden. Spannend ist sicherlich die Frage, wie sich Online-Beratungen weiterentwickeln und ob z. B. neuere Beratungsdienste über Messenger sich im Zuge der fortschreitenden Technologisierung durchsetzen werden.
Online-Therapie und Selbst-Management-Interventionen. Die erste Auseinandersetzung mit Therapie über oder mithilfe des Computers geht auf den Chatbot »Eliza« zurück, der von dem deutsch-amerikanischen Informatiker Weizenbaum 1964 entwickelt wurde. Der Chatbot simuliert einen Psychotherapeuten, der den klientenzentrierten Therapieansatz nach Rogers verwendet. Eliza reagiert auf bestimmte Schlüsselbegriffe bzw. Aussagenmuster passend, z. B. sagt der Nutzer: »Ich habe Probleme mit meiner Mutter«, und Eliza antwortet beispielsweise: »Berichten Sie mir mehr über Ihre Familiensituation«. Lustigerweise hatte Weizenbaum gar nicht die Absicht, mit künstlicher Intelligenz eine ernsthafte und neuartige Therapieoption aufzuzeigen. Bis er und auch damalige psychologische Fachkreise feststellen mussten, dass sich die Personen gerne mit Eliza unterhalten haben und nicht vermutet hätten, dass es sich um keinen echten Menschen handelt. Seitdem hat sich das Feld der Online-Therapie stark weiterentwickelt, selbst wenn strenggenommen Chatbots und Nachfolger von Eliza weiterhin noch Entwicklungsbedarf haben (Reiner & Schölzhorn 2009). Aufgrund von Engpässen in den psychotherapeutischen Versorgungssystemen erhalten Online-Psychotherapie- und Selbstmanagement-Interventionen national wie international massiv Zuwachs, nicht zuletzt auch ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie. Das Spektrum an Online-Angeboten reicht von der eigenständigen Dokumentation von Symptomen und Krankheitsverläufen in Selbstmanagement-Programmen (reine Selbsthilfe ohne Therapeutenkontakt) bis hin zu Blended-Psychotherapien, also Therapien, in denen die konventionelle Therapie durch Online-Elemente ergänzt werden (Hegerl et al. 2017; →Kap. 2.5). Bei Blended-Therapien sind unterschiedliche Anwendungsmodi in allen Behandlungsphasen denkbar, z. B. gibt es digitale Interventionen als Hausaufgabe, die in der regulären Therapiesitzung mit dem Therapeuten besprochen werden, oder sie werden als Online-Nachsorge eingesetzt für eine bessere Rückfallprophylaxe (Eichenberg 2021). Aber trotz der Möglichkeit der Online-Selbsthilfe bleibt besonders die therapeutische Begleitung entscheidend, was bereits in über mehr als 200 Studien über vor allem internetbasierten kognitiven Verhaltenstherapien inklusive positiver Wirksamkeitsnachweise nahegelegt werden konnte (Carlbring et al. 2018). Die Effekte sind mit jenen der klassischen Psychotherapie vergleichbar (Berger 2015). Laut Andersson (2018) ist eine »gemischte« Therapie mit minimalem Therapeuten-Kontakt nicht nur wirksamer, sondern wird auch gegenüber reinen Selbsthilfeprogrammen von den Patienten bevorzugt. Die meisten Interventionsprogramme sind kognitiv-behavioral orientiert und beziehen sich vor allem auf Depressionen und Angststörungen, es gibt aber inzwischen auch einige Online-Therapieprogramme für weitere Störungen, und auch solche, die auf psychodynamischen Prinzipen beruhen, z. B. KEN-Online (Zwerenz et al. 2017).
Das Online-Interventionsprogramm »Interapy« wurde ursprünglich für den Anwendungsbereich der PTBS kreiert, ist aber nun auch für viele andere Störungen und Probleme (z. B. Panikstörung, Burnout oder Trauer) adaptiert worden. Interapy nutzt Theorien der Schreibtherapie, dem sogenannten »Amsterdam Writing Project« (Lange et al. 2002). Studien über strukturierte Schreibaufgaben nach einem traumatischen Event zeigten, dass sich das Wiederholen von schmerzvollen Gedanken günstig auf den Behandlungserfolg von Trauma-Betroffenen auswirkt (Knaevelsrud et al. 2015).
Neben Online-Interventionsprogrammen als reine Selbsthilfe oder in Kombination mit einem Therapeuten (»blended treatment«) können Online-Therapien auch als Remote-Therapie ausschließlich telefonisch oder über Video erfolgen, was besonders in Zeiten von der pandemischen Krise häufiger Anwendung fand (Eichenberg 2021). Eine großangelegte Umfrage der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung (2020) während des ersten Covid-Lockdowns im Frühjahr 2020 hat ergeben, dass fast 80 % der befragten Therapeuten Videobehandlung angeboten haben, sogar 95 % erstmalig seit Beginn der Covid-19-Pandemie. Auch wenn einige Therapeuten noch Bedenken äußerten, überwogen der Wunsch und die Not, Patienten weiterversorgen zu können. Remote-Therapie kann auch gerade Traumabetroffenen entgegenkommen, die ein erhöhtes Kontrollbedürfnis in der Kommunikation haben. Mehrere Studien zeigten, dass sich die traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie und auch die EMDR-Therapie im Rahmen von Remote-Therapie als effektiv erwiesen haben, um PTBS zu behandeln (Bongaerts et al. 2022).
Serious Games. Serious Games dienen entgegen den klassischen Computer- und Videospielen nicht primär der Unterhaltung, sondern beabsichtigen das Trainieren, Erlernen und Verbessern von Verhaltensweisen in einer digitalen Lernumgebung (Shute et al. 2009). Wissensvermittlung sowie Steigerung von beispielsweise Problemlösefähigkeiten oder Aufmerksamkeitsprozessen können durch den Einsatz eines Serious Games spielerisch – ohne dass der Nutzer es explizit wahrnimmt – erreicht werden. Auch wenn der Wissenserwerb den wesentlichen Zweck von Serious Games darstellt, argumentieren viele Autoren bezüglich der passenden Gewichtung von Unterhaltungsfaktoren unterschiedlich: Michael und Chen (2006) sehen die edukative Komponente als zentral, Zyda (2005) hingegen die Unterhaltungsfunktion.
Unabhängig von den unterschiedlichen Bemühungen um eine Definition von Serious Games, werden Serious Games aufgrund ihres vielseitigen Gestaltungskonzepts in vielen Anwendungsfeldern genutzt, wie z. B. in der psychotherapeutischen Behandlung (Göbel 2016). Serious Games helfen in der Psychoedukation beim Aufbau von Wissen über psychische Störungen und unterstützen bei der Verbesserung von sozialen, emotionalen und kognitiven Verhaltensfertigkeiten im Rahmen einer Behandlung (Eichenberg et al. 2016; Fleming et al. 2016). Von Kindern bis hin zu älteren Personen erreichen Serious Games diverse Altersgruppen sowie unterschiedliche Behandlungsphasen, wie z. B. Prävention, Gesundheitsförderung- und Früherkennung, Psychotherapie oder psychologische Unterstützung bei medizinischen Beschwerden (Fleming et al. 2016). Beispielsweise ist »Camp Cope-A-Lot« als eines der ersten und bekanntesten Serious Games für Kinder mit einer Angststörung entwickelt worden. Das Computerspiel ist in 12 Levels von jeweils 35-minütiger Dauer unterteilt, hat Cartoon-Charakter und ist multimodal mit Ton, Video und Animation zu benutzen. In den ersten sechs Levels lernt der Nutzer Bewältigungsstrategien für Angstsymptome. Die letzten Levels erfolgen unter therapeutischer Begleitung und in Interaktion mit den Eltern. Für Serious Games charakteristisch ist das immersive Eintauchen in die Spielwelt, was durch ein (Fantasie-)Narrativ besonders begünstigt wird (Khanna & Kendall 2010). Während es in »Camp Cope-a Lot« ein Vergnügungspark ist, ist es in »MindLight« von Wijnhoven et al. (2020) ein gruseliges, altes Schloss. Es handelt sich dabei um ein Serious Game aus der neuen Generation, was sogar schon mittels Xbox Controller und in Kombination mit Biofeedback gespielt werden kann. Der Spieler schlüpft in die Rolle des »Arty« und muss einige Aufgaben absolvieren, um seine Großmutter, besessen von bösen Kräften, zu retten. Die Aufgaben enthalten ebenfalls unterschiedliche Strategien zum Umgang mit Angst. Das computerbasierte Spiel »Vil DU?!« (Dänisch für »Möchtest du [darüber reden]?!«) wurde für Kinder mit sexuellen Missbrauchserfahrungen entwickelt. Das nonverbale Kommunikationsspiel funktioniert so, dass Kinder ihrer Therapeutin durch eine selbst ausgewählte Figur zeigen können, was ihnen widerfahren ist. Dies erfolgt mittels zweier miteinander synchronisierter Tablets, sodass Spielaktionen auf beiden Bildschirmen sichtbar sind (→Kap. 2.7). Neben speziell für therapeutische Zwecke entwickelten Serious Games eigenen sich auch gewöhnliche Entertainment Games für die Behandlung von psychiatrischen Störungen im Allgemeinen und Traumafolgestörungen im Speziellen. Zu den bekanntesten Entertainment Games in der Traumaforschung zählt »Tetris«, das Flashbacks von Traumabetroffenen erfolgreich reduzieren konnte (→Kap. 2.7; Hagenaars et al. 2017).
Virtual Reality. Virtual-Reality-Anwendungen simulieren dreidimensionale Umgebungen, mit denen interagiert werden kann. Bereits vor 25 Jahren starteten die ersten Versuche, durch virtuelle Reize reale Ängste mit den entsprechenden physiologischen Reaktionen (Schwitzen, erhöhter Blutdruck etc.) auszulösen. Dies sollte als Ergänzung zu Expositionstherapien von Angststörungen im analogen Setting dienlich sein. In der konventionellen Expositionstherapie erfolgt die Auseinandersetzung entweder in der Vorstellung (in‑sensu) oder in der Realität (in-vivo), wonach Virtual-Reality-Anwendungen quasi einen Mittelweg beider Szenarien darstellen (Eichenberg 2021). Mithilfe von Virtual Reality können z. B. Expositionen durchgeführt werden, die logistisch und finanziell sonst nur sehr schwierig zu erreichen sind (z. B. bei Flug- oder Höhenangst). Auf diese Weise können Expositionen mehrfach wiederholt werden und garantieren trotzdem ein privates und vertrauliches Setting. Aber nicht nur für Angststörungen liegen bereits positive und vielversprechende Wirksamkeitseffekte vor, sondern auch für andere Störungsbilder, wobei auch die Kombination von Virtual Reality und unterschiedlichen Therapieansätzen (z. B. verhaltenstherapeutisch und psychoanalytisch; Eichenberg 2021) diskutiert wird. Psychotherapie mit Virtual Reality ist kein Zukunftstrend, sondern als erstattbare Leistung im DiGA-Verzeichnis zu finden: Mit »Invirto« können Personen, die unter einer Agoraphobie, Panikstörung oder sozialen Phobie leiden, ihre Ängste besser verstehen, reduzieren und bewältigen. Zunächst muss ein Erstgespräch mit einer Ärztin oder einem Psychotherapeuten erfolgen, der Invirto verschreibt. Nach dem Einlösen des Rezepts bei der Krankenkasse erhalten Betroffene einen DiGA-Code, einen App-Zugang und eine VR-Brille. Die Patienten können bereits selbständig starten, mit der App zu arbeiten. Invirto kann dann flexibel in die therapeutische Arbeit miteingebunden werden, durch begleitende Expositionsvorbereitung oder -nachbereitung. Virtual Reality kann auch in der Behandlung von traumatisierten Personen eingesetzt werden (→Kap. 2.8). Virtual-Reality-Anwendungsbeispiele und -szenarien in der Traumatherapie haben ihren Ursprung in der Nachstellung von Terroranschlägen und Kriegssituationen. Aufgrund der zahlreichen Terroranschläge auf Busse in Israel haben Josman et al. in 2006 als einer der Ersten eine spezielle Virtual-Reality-Umgebung (»BusWorld«) zur Behandlung der Traumastörung erstellt. Mit Virtual Reality können nicht nur traumainduzierende Stimuli realistisch dargestellt werden, sondern sie ermöglicht den Benutzern auch, die Perspektive anderer (traumatisierter) Personen einzunehmen. Neue Studien haben gezeigt, dass Virtual Reality auch für die Sensibilisierung von Gewalt gegen Frauen sowie für das Einfühlungsvermögen von Männern durch die Verkörperung von virtuellen, weiblichen Avataren eingesetzt werden können. Beispielweise kann die Fähigkeit bei Männern verbessert werden, Emotionen von Frauen zu erkennen (Ventura et al. 2020).
Apps. Apps werden, nicht zuletzt durch die DiGA, immer bedeutsamer für die psychotherapeutische Behandlung, so ist die Nachfrage nach sogenannten »Digital Health Apps« weltweit groß (Marshall et al. 2020). Im Verglich zu Serious Games sind Apps nicht sehr aufwendig und teuer in der Entwicklung; das hat aber den Nachteil, dass es mittlerweile viele Apps im Gesundheitsbereich gibt, die zum Großteil nicht evidenzbasiert sind. Allerdings gibt es schon offizielle Qualitätskriterien, die eine erste Einschätzung ermöglichen. Die »Mobile App Rating Scale« (MARS) von Stoyanov et al. (2015) ist eines der umfassendsten und am stärksten multidimensionalen Instrumente bzw. Standards, um eine App zu bewerten. Abgesehen von der Qualitätsbewertung lassen sich Apps danach unterscheiden, ob diese eine erste Orientierung für Psychotherapie bieten bzw. ein Präventionsangebot darstellen oder ob diese auf therapeutische Behandlungsinhalte abzielen. Darüber hinaus können Apps entweder auf eine bestimmte Störung (z. B. Depression) oder transdiagnostisch (z. B. Achtsamkeit) ausgerichtet sein. Eine der bekanntesten Apps für Meditation und Achtsamkeit und somit transdiagnostisch vielseitig einsetzbar ist »Calm«. Die App bietet Meditationsübungen für verschiedene Themen und mit unterschiedlicher Dauer. Ziel der Übungen ist die Reduktion von Stress, Ängsten und belastenden Gedanken sowie die Förderung von erholsamem Schlaf. Es gibt auch schon Effektivitätsnachweise für Calm. Die Meditations-App »Seven Mind« für den Umgang mit Stress basiert ebenfalls auf wissenschaftlich fundierten Achtsamkeitskonzepten und ist auch von der Krankenkasse erstattbar. Ein Beispiel für eine störungsspezifische App zur Nutzung vor oder während einer therapeutischen Behandlung ist »MindDoc«. Die App ist videobasiert, ist orientiert an der Kognitiven Verhaltenstherapie und geeignet für Personen mit emotionalen Belastungen bis hin zu diagnostizierten psychischen Erkrankungen, wie z. B. Depression. Mittels der App können Betroffene ihre Symptome protokollieren sowie Übungen und Kurse absolvieren – auch in Ergänzung mit einer bestehenden Psychotherapie. Auch für die PTBS und die weiteren Traumafolgestörungen wurden eine Reihe von Anwendungen entwickelt, die auf verschiedene traumatische Situationstypen fokussieren, wie z. B. Kampfeinsätze oder sexueller Missbrauch (für unterschiedliche Altersgruppen) (→Kap. 2.6). Beispielsweise ist die »Child Abuse Prevention App« basierend auf einem Serious-Games-Ansatz entwickelt worden, um Kenntnisse zu sexuellem Missbrauch zu vermitteln. In 26 Geschichten für Kinder im Alter zwischen 3 und 10 Jahren werden Präventionsregeln nähergebracht. Das Ziel ist dabei, Kinder bei der Wissensanwendung im Alltag zu unterstützen.
Die bisher genannten Konzepte (wie Serious Games) sind noch nicht in der Routineversorgung angekommen. Dennoch gibt es durch den technologischen Fortschritt schon neue digitale Trends und Entwicklungen in der psychotherapeutischen Behandlung, wie z. B. Robotik und Sensorik.
Fort- und Weiterbildung. Einer aktuellen Befragung von deutschen Psychotherapeuten (in der stationären Routineversorgung) zeigt, dass der Bekanntheitsgrad von E-Mental-Health-Anwendungen teilweise noch gering ist. Zirka 77 % der Teilnehmenden hatten noch nie eine Online-Intervention in ihrer therapeutischen Praxis genutzt (Sander et al. 2021). Auch Piening et al. (2021) wiesen mit ihrer Befragung deutscher und österreichischer Therapeuten nach, dass über die Hälfte ihrer Patienten noch nie die Möglichkeit digital gestützter Psychotherapiesitzungen vorgeschlagen hatte. Etwa 72 % der befragten Therapeuten gaben an, dass sie keine Fortbildung zum Einsatz von Medien in der Psychotherapie besucht haben.
Es wurde ein Fortbildungscurriculum »Digitale Psychotherapie« für ärztliche und psychologische Therapeutinnen entwickelt, die digitale Interventionen in ihrer therapeutischen Arbeit einsetzen möchten (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. 2022; siehe auch https://www.dgppn.de/en/Core-areas/e-mental-health.html). Im Rahmen von Workshops, jeweils verteilt auf zwei Wochenenden, werden rechtliche, technische und ethische Aspekte sowie die Evidenz digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA) und der Videosprechstunde diskutiert, begleitet von Selbsterfahrungen, Hausaufgaben und praktischen Übungen. Auch der »Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung e. V.« (2021) bestehend aus E-Health-Anbietern und anderen Förderern, informiert regelmäßig gemeinsam auf der Internetseite www.digitalversorgt.info über Fortbildungsangebote zur digital unterstützten Behandlung von Patientinnen. Dabei handeln einige Fort- und Weiterbildungen zur Einsatzmöglichkeit von einzelnen DiGA, die von den DiGA-Herstellern selbst angeboten werden. Inwieweit das Erlernen von Kompetenzen relevant für den Umgang von und mit E-Mental-Health schon in die Aus- und Weiterbildungsprogramme der Psychotherapieausbildungsinstitute integriert wurde, lässt sich abschließend nicht beurteilen, auch wenn die Vermutung naheliegt, dass die Covid-Pandemie auch hier als Katalysator gewirkt hat, um Inhalte diesbezüglich zu ergänzen.
eMEN-Projekt. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychosomatik und Neurologie (DGPPN) sowie das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit haben das transnationale Projekt »e-mental health innovation and transnational implementation platform North-West Europe« (eMEN) gegründet. Angeführt und geleitetet von den Niederlanden, europa- und weltweit in einer Vorreiterposition bezüglich E-Mental-Health-Forschung und Implementierung, sind Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland sowie Großbritannien als Länderpartner beteiligt. Mithilfe dieses Projekts soll ein internationales Netzwerk aus Wissenschaft, Produktentwicklung, Politik und Kommunikation geschaffen werden, um Personen mit psychischen Erkrankungen sowie Fachprofessionelle mit E-Mental-Health-Lösungen zu unterstützen (Gaebel et al. 2020). Mithilfe des eMEN-Projekts und Netzwerks werden auch Pilotstudien durchgeführt, um länderübergreifende E-Mental-Health-Empfehlungen für politische Entscheidungsträgerinnen (z. B. der Europäischen Kommission) zu formulieren, was die erste wichtige Voraussetzung für die Umsetzung von digitalen Gesundheitsangeboten darstellt. Erste Forschungsergebnisse zeigten, dass das Bewusstsein für E-Mental-Health noch erhöht und Potenziale aufgezeigt werden müssen. Dies trifft insbesondere auf Deutschland zu. Während beispielsweise die Anwendung von E-Mental-Health in Großbritannien, allen voran England (Gaebel et al. 2020), schon seit 2014 gezielt gefördert wird, hat Deutschland erst ein paar Jahre später überhaupt die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Möglichkeit der Fernberatung (Bundespsychotherapeutenkammer 2018) sowie das Digitale-Versorgung-Gesetz geschaffen (Beerheide 2019). Jedoch ist in fast allen beteiligten Ländern die Frage nach der Kostenerstattung noch nicht oder nur teilweise geregelt. Weitere Pilotstudien werden anhand von Best-Practice-Beispielen die Einführung von E-Mental-Health-Anwendungen für einige Störungsbilder, darunter auch für die PTBS erforschen. Diese Hinweise werden wertvoll sein, um beurteilen zu können, wie eine Integration in der Routineversorgung gelingen kann und welche Hürden antizipiert werden müssen (DGPPN 2022).
E-Mental-Health-Leitlinien. Es liegen bereits einige internationale sowie nationale Empfehlungen vor, die den korrekten Einsatz von E-Mental-Health beschreiben. Mit den »Guidelines for the Practice of Telepsychology« war die American Psychiatry Association (2013) eine der ersten Organisationen, die die Nutzung von Medien und damit verbunden die Sicherheit und den Datenschutz für telepsychologische Zwecke festgehalten hat. Auch die Organisation »The Royal Australian College of Practitioners« (2014) hat früh Leitlinien für die E-Mental-Health-Therapie veröffentlicht. Die Canadian Psychologial Association (2020) hat ebenfalls schon umfangreiche Leitlinien für den praktischen Nutzen von Telepsychologie entwickelt. Blicken wir auf die deutschsprachigen Länder, stellen wir fest, dass sowohl das Bundesministerium für Gesundheit (2017) in Österreich mit der Internetrichtlinie die ethischen Verpflichtungen bei internetgestützter Beratung als auch die Bundespsychotherapeutenkammer (2017) in Deutschland Empfehlungen für digitale Medien in der Psychotherapie sowie entsprechender Datensicherheit veröffentlicht hat.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die rechtlichen und ethischen Rahmenbedingen für einen ordnungsgemäßen und vertrauensvollen Einsatz von E-Mental-Health aufseiten der Therapeutinnen und Patienten unabdingbar ist, um Daten- und Rechtssicherheit zu gewähren und somit auch einen klaren Rahmen für die therapeutische Arbeit zu besitzen und potenzielle Grenzverletzungen zu vermeiden. Dies sollte Bestandteil in den zukünftigen Ausbildungen von Psychotherapeuten sein (Eichenberg & Küsel 2017).
1.1.2 Zentrale Konzepte in der Psychotraumatologie
Das psychische System kann durch punktuelle oder dauerhafte Belastungen in seinen Bewältigungsmöglichkeiten überfordert und schließlich traumatisiert, d. h. »psychisch verletzt« werden. Dabei ist das traumatische Ereignis von außergewöhnlicher Bedrohung oder hat ein katastrophales Ausmaß, das nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung und das Gefühl von ohnmächtigem Ausgeliefertsein auslösen würde. Die Psychotraumatologie befasst sich mit der Struktur, dem Verlauf und den Behandlungsmöglichkeiten von seelischen Verletzungen.
Typen von Traumata
Nach den Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachverbände (AWMF) werden Traumata grob in sogenannte man-made-disaster und natural-disaster unterteilt sowie nach einer unmittelbaren oder mittelbaren Betroffenheit.
Für die psychische Verarbeitung macht es einen Unterschied, ob die Traumatisierung durch einen anderen Menschen (man-made-disaster) erfolgt, also durch vorsätzliche körperliche und/oder sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung, einen gewalttätigen Angriff, Entführung, Geiselnahme, Terror, Krieg, Kriegsgefangenschaft, politische Haft, Folterung, Gefangenschaft etc., oder durch Naturereignisse wie Erdbeben oder Unwetter (natural-disaster) und in manchen Fällen auch durch Menschen verursachte Katastrophen wie Unfälle oder auch die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit. Die Nähe zum Traumaereignis spielt auch eine Rolle, also ob es sich um eine unmittelbare Betroffenheit handelt wie bei sexueller oder physischer Gewalt oder um eine mittelbare Betroffenheit, also Zeuge einer Gewalttat, eines Unfalls oder bei dem plötzlichen Tod eines nahen Angehörigen zu sein.
Eine weitere Unterscheidung betrifft die Art der traumatischen Erfahrung. So ist ein Monotrauma (Typ-I-Trauma) ein einmaliges belastendes Ereignis, z. B. eine sexuelle Gewalttat oder ein Verkehrsunfall. Komplexe Traumatisierungen (Typ-II-Trauma) sind fortgesetzte seelische Verletzungen, oft in Verbindung mit körperlicher Gewalt, die oft bereits in frühen Lebensjahren beginnen, wie Misshandlungen oder Vernachlässigung durch Personen, die oft aus dem familiären Umfeld stammen. Solche Traumatisierungen werden auch als Beziehungstraumata bezeichnet.
Unter kumulativer Traumatisierung versteht man eine Traumatisierung in sukzessiven Abfolgen von Ereignissen, die in der Regel einzeln nicht traumatisierend wirken, jedoch in ihrer Häufung. In der einsetzenden Erholungsphase wird jedoch jedes Mal die Restitutionstätigkeit der Person durch erneute Ereignisse gestört und somit auf Dauer das psychische System zum Zusammenbruch gebracht.
Traumafolgestörungen
Die Folgen psychischer Traumatisierung umfassen ein breites Spektrum an Traumafolgestörungen, die in der ICD-11 Betaversion wie folgt zusammenzufassen sind und gegenüber der ICD-10 einige Änderungen aufweisen (ausführlich siehe Augsburger & Maercker 2018).
Posttraumatische Belastungsstörung (6B40). Eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) kann sich entwickeln, wenn eine Person einem extrem bedrohlichen oder entsetzlichen Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen ausgesetzt war. Sie ist durch alle der folgenden Punkte gekennzeichnet:
Wiedererleben des traumatischen Ereignisses oder der traumatischen Ereignisse in der Gegenwart in Form von Intrusionen (z. B. aufdringlichen Erinnerungen, Rückblenden oder Albträumen). Das Wiedererleben wird typischerweise von starken oder überwältigenden Emotionen, insbesondere Angst oder Entsetzen, und starken körperlichen Empfindungen begleitet.
Vermeidung von Gedanken und Erinnerungen an das Ereignis bzw. die Ereignisse oder Vermeidung von Aktivitäten, Situationen oder Personen, die an das Ereignis bzw. die Ereignisse erinnern.
Anhaltende Wahrnehmung einer erhöhten aktuellen Bedrohung, die sich z. B. durch Hypervigilanz oder eine verstärkte Schreckreaktion auf Reize wie unerwartete Geräusche zeigt. Die Symptome halten mindestens mehrere Wochen an und führen zu einer erheblichen Beeinträchtigung in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.
Komplexe posttraumatische Belastungsstörung (6B41). Die komplexe posttraumatische Belastungsstörung (komplexe PTSD) wurde als neue Kategorie in die ICD-11 aufgenommen (ausführlich siehe Bering & Thüm 2022). Diese Störung kann sich entwickeln, nachdem eine Person einem Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen extrem bedrohlicher oder schrecklicher Natur ausgesetzt war. Es handelt sich meist um lang anhaltende oder sich wiederholende Ereignisse, denen man nur schwer oder gar nicht entkommen kann, z. B. Folter, lang anhaltende häusliche Gewalt, wiederholter sexueller oder körperlicher Missbrauch in der Kindheit. Dabei sind alle diagnostischen Voraussetzungen für eine PTBS erfüllt, allerdings ist die komplexe PTBS zusätzlich gekennzeichnet durch schwere und anhaltende
Probleme bei der Affektregulierung;
Überzeugungen über die eigene Person, wertlos zu sein, begleitet von Scham-, Schuld- oder Versagensgefühlen im Zusammenhang mit dem traumatischen Ereignis;
Schwierigkeiten, Beziehungen aufrechtzuerhalten und sich anderen nahe zu fühlen.
Diese Symptome führen zu erheblichen Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.
Anhaltende Trauerstörung (6B42). Auch die anhaltende Trauerstörung findet sich als Diagnose erstmals in der ICD-11 wieder. Die emotionale Reaktion auf den Verlust eines nahen Angehörigen ist nachvollziehbar und normal. Jeder Trauernde hat einen unterschiedlichen Ausdruck für seine Trauer und auch die Trauerphasen sind individuell. Ebenso können sich Trauerzeiten je nach Religion und Kultur unterscheiden. Kinder und Adoleszente können bei Verlust der primären Bindungsfiguren, beispielsweise der Eltern, eine intensive oder lang anhaltende Trauerreaktion zeigen. Die Trauer kann sich an verschiedenen Punkten in der Individualentwicklung reaktualisieren, z. B. am Beginn von neuen Entwicklungsschritten. Diese Reaktionen sollten als normal betrachtet werden und nicht einer anhaltenden Trauerstörung zugeordnet werden. Die Diagnose einer anhaltenden Trauerstörung sollte dann getroffen werden, wenn es eine anhaltende Trauerreaktion bei Verlust eines Partners, Kindes, Elternteils oder einer anderen nahestehenden Person gibt. Die allgegenwärtige Trauerreaktion geht mit einer intensiven Sehnsucht oder der persistierenden gedanklichen Beschäftigung mit der verstorbenen Person sowie intensivem emotionalem Schmerz einher.
Anpassungsstörungen (6B43). Die Symptome der Anpassungsstörung in der ICD-11 umfassen als Auslösekriterium psychosoziale Belastungsfaktoren, beispielsweise Scheidung, Arbeitsplatzkonflikte, Krankheit, und müssen innerhalb eines Monats nach dem auslösenden Ereignis auftreten. Die Störung ist gekennzeichnet durch die Beschäftigung mit dem Stressor oder seinen Folgen, einschließlich übermäßiger Sorgen, wiederkehrender und beunruhigender Gedanken über den Stressor oder ständiges Grübeln über seine Auswirkungen sowie durch ein Versagen bei der Anpassung an den Stressor, das erhebliche Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen verursacht.
Akute Belastungsreaktion (QE84). Die akute Belastungsreaktion findet sich in der ICD-10 noch unter den belastungsbezogenen Störungsbildern. Diese Einteilung wurde in der ICD-11 aufgegeben. Die Kategorisierung unter einer neu geschaffenen Kategorie: »Problematik in Verbindung mit schädlichen oder traumatischen Ereignissen« macht deutlich, dass hier ein viel größerer Stellenwert auf Opfer von Gewalt durch verschiedenste äußere Einflüsse gegeben ist und die diesbezüglichen Reaktionen normalisiert und nicht als psychische Störung gewertet werden. Damit bezieht sich eine akute Stressreaktion auf die Entwicklung vorübergehender emotionaler, somatischer, kognitiver oder verhaltensbezogener Symptome als Folge der Exposition gegenüber einem Ereignis oder einer Situation von extrem bedrohlicher oder schrecklicher Natur. Die Symptome können autonome Anzeichen von Angst (z. B. Tachykardie, Schwitzen, Erröten), Benommenheit, Verwirrung, Traurigkeit, Angst, Wut, Verzweiflung, Überaktivität, Inaktivität, sozialer Rückzug oder Stupor umfassen. Die Reaktion auf den Stressor wird angesichts der Schwere des Stressors als normal angesehen und beginnt in der Regel innerhalb weniger Tage nach dem Ereignis oder nach dem Verlassen der bedrohlichen Situation abzuflauen.
Spektrum an Traumafolgestörungen. Psychotraumatische Erfahrungen führen insgesamt zu seelischen Folgeschäden, oft ohne dass zusätzliche Bedingungsfaktoren erforderlich sind. Psychische Traumatisierung ist demnach als eine eigenständige ätiologische Kategorie zu betrachten. Fischer und Nathan (2002) haben verschiedene Verlaufstypen herausgearbeitet, die verstehbar machen, dass traumatische Erlebnisse in unterschiedliche psychopathologische Verarbeitungsmuster münden und somit verschiedene Traumafolgestörungen hervorbringen können, die auch über die in der ICD-11 genannten Kategorie »Disorders specifically associated with stress« hinausgehen, z. B. folgende: dissoziative Störungen, Angsterkrankungen, Suchterkrankungen (als Folge der »Selbstmedikation« bei belastenden Traumasymptomen), psychische Erschöpfungssyndrome, wenn beispielsweise durch Workaholic-Verhalten versucht wird, sich soziale Anerkennung zu verdienen, weil der Betroffene durch das Trauma an Selbstwert verloren hat, oder auch eine Persönlichkeitsstörung wie der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Somit können die Behandlungsanlässe, aufgrund derer die Betroffenen ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, stark variieren. Sie umfassen beispielsweise Schlafstörungen, Schwindel, Palpitationen, (generalisierte) Schmerzen, Verdauungsstörungen, sexuelle Funktionsstörungen.
Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung
Bei einer psychischen Traumatisierung wird die Entstehung von Symptomen aus einem prozesshaften Geschehen, d. h. einem Entwicklungsverlauf heraus verstanden.
Definition. Laut dem Verlaufsmodell von Fischer und Riedesser (2009) folgt auf das traumatisierende Ereignis zunächst eine Schockphase, aus der eine traumatische Reaktion hervorgeht. Die Einwirkphase des psychischen Schocks besteht etwa 4 bis 6 Wochen nach Erleben des traumatischen Ereignisses. Abhängig von situativen und individuellen Schutz- und Risikofaktoren kann daraufhin entweder eine Erholung von der traumatischen Reaktion oder aber ein traumatischer Prozess folgen.
In diesem Modell werden zudem subjektive und objektive Aspekte der traumatischen Situation systematisch aufeinander bezogen; Symptombilder werden prozesshaft und umwelttheoretisch betrachtet statt überwiegend aus internen Eigenschaften des Symptomträgers heraus. Das heißt, ob ein Ereignis einen traumatischen Charakter annimmt, hängt nicht nur von objektiven Situationsfaktoren, wie beispielsweise der Dauer des Ereignisses, dem Bekanntheitsgrad des Täters oder der mittelbaren versus unmittelbaren Betroffenheit ab. Auch personengebundene Merkmale wie die aktuelle und überdauernde psychische Disposition, protektive Faktoren (z. B. ein hilfreiches soziales Umfeld), Risikofaktoren (z. B. Vortraumatisierungen wie den Verlust einer Bindungsperson in der Kindheit) sowie die physiologische Disposition spielen eine Rolle (siehe auch Bender & Lösel 2005).
Risikogruppen psychisch Traumatisierter. Nach dem prognostischen Screening-Verfahren »Kölner Risikoindex« (KRI; Fischer 2000a) können von traumatischen Ereignissen Betroffene in drei Gruppen eingeteilt werden: die Selbsterholungsgruppe, die Wechslergruppe und die Risikogruppe.
Bei den Selbsterholern sind keine Folgesymptome der Traumatisierung zu erwarten, sie erholen sich von der traumatischen Reaktion. Bei dieser Patientengruppe sollte der Schwerpunkt der Behandlung auf der Vermittlung von Stabilisierungstechniken liegen und die Distanzierung vom traumatischen Erlebnis gefördert werden. Therapeutisch kommt der Psychoedukation hier eine wichtige Rolle zu, da somit die Selbstbeobachtung gefördert und die Betroffenen auf ein erneutes Auftreten oder eine Verstärkung der Symptome sensibilisiert werden können. Bei Selbsterholern kann Selbsthilfe unterstützend wirken, indem der individuelle Verarbeitungsprozess bestärkt und damit der Übergang in die Erholungsphase erleichtert wird.
Für Wechsler besteht ein höheres Risiko, unter Folgesymptomen des traumatischen Erlebnisses zu leiden. Unter günstigen Bedingungen kann diese Gruppe zur Selbsterholergruppe übertreten, bei ungünstigen jedoch zur Risikogruppe. Bei diesen Patienten ist daher eine psychologische Nachsorge notwendig. Dabei sollten die Betroffenen auch über den Zeitraum der Einwirkphase hinaus psychologisch begleitet werden. Ein Schwerpunkt sollte bei dieser Patientengruppe auf Beratung und der psychometrischen Diagnostik liegen, um mögliche zusätzliche Belastungsfaktoren frühzeitig erkennen und somit gegebenenfalls eine Traumaakuttherapie einleiten zu können.
Die Risikogruppe verfügt über eine hohe Wahrscheinlichkeit, eine Traumafolgestörung zu entwickeln. Diese Betroffenen sollten an einen psychotraumatologisch weitergebildeten Psychotherapeuten vermittelt werden. Die erste Therapiephase besteht aus einer Stabilisierung des Patienten. Im Anschluss sollte eine Konfrontation mit dem traumatischen Erlebnis stattfinden, um ein Durcharbeiten des Traumas zu ermöglichen. Ein weiteres Ziel stellt die Integration des Traumas in den Lebensentwurf des Patienten dar, was den letzten Therapieschritt bildet.
Es ist davon auszugehen, dass ein Drittel der Betroffenen nach einem potenziell traumatisierenden Ereignis eine Traumafolgestörung entwickelt, ein weiteres Drittel zählt zu den Selbsterholern und bei einem weiteren Drittel hängt es vor allem von der Unterstützung des sozialen Umfelds ab, ob sich die Person aus eigener Kraft erholt oder bei weiteren Belastungen eine Traumafolgestörung entwickelt.
Durch traumatische Erlebnisse kann es auch zu positiven Veränderungen kommen, was »posttraumatisches Wachstum« genannt wird (Tedeschi 2018). So kann die Traumabewältigung auch zu einem Zugewinn an Reife und Weisheit führen, konkret z. B. zu einer Intensivierung der Wertschätzung des Lebens und der persönlichen Beziehungen.
Diagnostischer Zugang
Das diagnostische Gespräch mit Patienten, die unter einer Traumafolgestörung leiden, stellt eine besondere Herausforderung für professionelle Helfende dar. Das traumatische Ereignis hat zu vielfältigen Veränderungen im Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen geführt, deren Erfassung eine umfangreiche klinische Erfahrung erfordert. Die Diagnostik posttraumatischer Erkrankungen stellt insbesondere beim Erstkontakt mit den Betroffenen vor das Problem, gegebenenfalls Themen ansprechen zu müssen, die zur Triggerung von Erinnerungen und damit zu erheblichen Belastungen führen können. Eine tiefergehende Exploration von Details traumatischer Situationen sollte erst dann erfolgen, wenn erste Stabilisierungsmaßnahmen erlernt und ein gutes therapeutisches Arbeitsbündnis hergestellt wurden. Andererseits kann die Beobachtung solcher, zum Teil auch vegetativer Reaktionen ein diagnostisches Merkmal sein, das darauf hinweist, dass eine stärkere traumatische Fehlverarbeitung vorliegt.
Traumadiagnostische Gespräche beinhalten aber nicht nur ein Belastungspotenzial. Das Erheben und Besprechen traumabezogener Inhalte kann für Betroffene durchaus auch eine klärende Wirkung haben, die ihnen hilft, ihre Symptomatik in einen lebensgeschichtlichen Kontext einzuordnen. Dies wiederum kann zum Abbau von Unsicherheit und Ängsten und damit zu einer Stabilisierung beitragen.
Um der Komplexität der posttraumatischen Erscheinungsformen gerecht zu werden, wird empfohlen, das fachgerechte diagnostische Gespräch durch standardisierte diagnostische Interviews und psychometrische Testung zu ergänzen (Eichenberg & Senf 2019).
Krankheitstheorien
Traumafolgestörungen sind die individuellen posttraumatischen Reaktionen von Menschen auf eine traumatisch wirksame Situation, die immer objektiv gegeben ist. Das heißt: Krankheitsauslösend trifft immer ein äußeres Ereignis auf eine spezifische Verarbeitung im Gehirn, d. h. auf personengebundene Dispositionen.
Neurobiologie. Aus neurobiologischer Sicht sind die posttraumatischen Reaktionen spezifische Verarbeitungsmuster durch eine in der traumatischen Situation maximale Aktivierung der neuroendokrinen Stressachse. Die traumatische Situation wird in Form von fragmentierten impliziten Erinnerungen abgespeichert, wodurch das Erlebte nicht integriert, d. h. in den biografischen Kontext eingebunden und kohärent verbalisiert werden kann. Traumafolgesymptome sind als eine »natürliche« Notfallreaktion zu werten. Durch ein sehr schnelles und intuitives Denken wird eine Art »Abkürzung« über den Mandelkern im Gehirn genommen mit direkten Schlussfolgerungen aus jenen Informationen, die ganz aktuell verfügbar sind, ohne nach dem Gesamtkontext zu fragen. Die Informationsverarbeitung über das Großhirn wird blockiert und es findet eine implizite (amygdaloide) statt explizite (hippocampale) Erinnerung statt mit einer Überflutung von Neurohormonen (Adrenalin, Cortisol, Endorphine) und Unterdrückung der Sprachzentren (Brocca-Region) (Bering & Thüm 2022).
Soziologie. Aus soziokultureller Sicht wird grundsätzlich von einer breiten interindividuellen Variation bei der Verarbeitung potenziell traumatischer Situationen ausgegangen. Hierbei kommt dem sozialen Umfeld eine bedeutende Rolle zu, denn zu den Schutzfaktoren gehören stabile Bezugspersonen (z. B. Partner) sowie eine verständnisvolle Umgebung (z. B. Arbeitgeberin, Funktionsträger wie Polizei, Ärztinnen), d. h. eine stabile soziale Situation senkt das Risiko, nach einem potenziell traumatischen Ereignis eine Belastungsstörung zu entwickeln.
Lerntheorie. Nach der Lerntheorie entwickelt sich eine posttraumatische Furchtstruktur im Rahmen von Konditionierungsprozessen, d. h. ein extremer emotionaler Stimulus, wie z. B. Todesangst in der traumatischen Situation, koppelt sich mit Kognitionen und körperlichen Reaktionen. So kann bei einem Bankangestellten, der überfallen wurde, beim Zurückkehren an den Arbeitsplatz oder selbst beim Vorbeigehen an einer Bankfiliale diese Todesangst reaktiviert werden. Dies ist für die sogenannte Einwirkungsphase nach dem traumatischen Ereignis normal; bleibt allerdings der darauf folgende Erholungsprozess stocken, chronifiziert diese Angst mit der für eine PTBS typischen Vermeidungshaltung, z. B. vermeidet es die Person, eine Bank aufzusuchen.
Psychodynamische Perspektive. Aus psychodynamischer Perspektive wird davon ausgegangen, dass die traumatische Situation eine Situation der maximalen Ohnmacht darstellt, in der weder geflohen noch gekämpft werden kann: Die Person ist der Situation hilflos ausgeliefert. Die Intrusionen werden verstanden als ein Versuch, die traumatische Situation doch noch zu bewältigen, »zum Abschluss zu bringen« (sogenannte Vollendungstendenz). Durch die Reizüberflutung in der traumatischen Situation können die Erinnerungen nicht adäquat abgespeichert werden, vielmehr wirken sie als nichtsymbolisierungsfähige Fragmente in unspezifischen und für den Betroffenen nicht verständlichen Symptomen und Körpererinnerungen. Zur Bewältigung des Traumas unternimmt die Person unbewusste Selbstheilungsversuche, die funktional sind, um es subjektiv erträglicher zu machen und z. B. »nie wieder in eine solche Situation zu kommen«, beispielsweise durch Vermeidung jeglicher Reize, die an das Trauma erinnern, oder durch den Glauben, Schuld am Geschehen zu haben. Wie die neurotische Kompromissbildung hat aber auch der pathologische Verlauf der Traumabewältigung seinen Preis, sodass – wenn der natürliche Verarbeitungsprozess ins Stocken gerät – traumatherapeutische Hilfe indiziert ist.
Allgemeine Aspekte der Behandlung
Die wichtigste Mitteilung an die Betroffenen ist: »Die Gefühle, Gedanken und körperlichen Reaktionen, die Sie empfinden, sind vollkommen normal. Sie stellen eine natürliche, menschliche Reaktion auf eine extreme Belastung dar.« Das ist das sogenannte »Normalisierungsprinzip«.
Traumatherapie unterscheidet sich von anderen psychotherapeutischen Verfahren unter anderem durch ein sehr strukturiertes Vorgehen, bei dem der Phasenablauf schulenübergreifend gleich ist:
Stabilisierung: In dieser Phase wird mit der Person daran gearbeitet, ihre Kontrollfähigkeit über traumabezogene Gedanken, Emotionen oder Impulse wiederzuerlangen oder zu verbessern. Hier erfolgt auch die bereits genannte wichtige Mitteilung, dass ihre Gefühle, Gedanken und körperlichen Reaktionen eine normale Reaktion auf eine belastende Situation sind.
Traumakonfrontation: Die Person wird gedanklich mit der traumatischen Situation konfrontiert und sie erlebt sie innerlich noch einmal sehr intensiv.
Integration und Neuorientierung: Die Person lernt, das Trauma als Teil seines Lebensweges zu betrachten, gegebenenfalls einen Sinn aus dem Erlebten abzuleiten und ihr Verhalten für die Zukunft zu verändern. Hier kommen auch z. B. Aspekte positiver Veränderungen wie das posttraumatische Wachstum (→