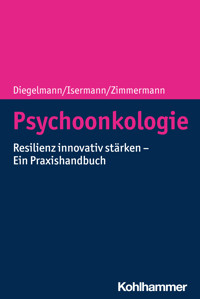Trauma und Krise bewältigen. Psychotherapie mit Trust (Leben Lernen, Bd. 198) E-Book
Christa Diegelmann
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Hilfe aus eigener Kraft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Patientinnen und Patienten, die durch eine lebensbedrohliche körperliche Erkrankung traumatisiert sind, benötigen spezielle psychotherapeutische Hilfe. Wie wichtig das Auffinden von persönlichen Ressourcen dabei ist, hat die Autorin im Laufe ihrer langjährigen therapeutischen Begleitung immer wieder erfahren. Psychotherapie mit TRUST ist ein Behandlungsansatz, der aus gängigen psychotherapeutischen Verfahren (wie EMDR, Hypnotherapie, KIP, Maltherapie) diejenigen Elemente kombiniert, die speziell zur Krisenintervention und schonenden Traumabearbeitung geeignet sind. Dazu zählen auch neue Verfahren, wie CIPBS (Conflict Imagination, Painting and Bilateral Stimulation), das sich in der Behandlung von KrebspatientInnen, bei Angststörungen, Traumafolgestörungen und Depressionen bereits seit Jahren bewährt hat und hier umfassend vorgestellt wird. Psychotherapie mit TRUST konzentriert sich auf: - Techniken der unmittelbaren Stressregulation - Ressourcenförderung und - Wege einer schonenden Traumakonfrontation. Zahlreiche Fallbeispiele und Bildsequenzen erläutern das konkrete Vorgehen einer konsequent ressourcenfokussierten Traumabehandlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Ähnliche
Christa Diegelmann
Trauma und Krise bewältigen
Psychotherapie mit TRUST
(Techniken ressourcenfokussierter undsymbolhafter Traumabearbeitung)
Unter Mitarbeit von Margarete Isermann
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta
© 2007 by J. G. Cotta'sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Hemm & Mader, Stuttgart Titelbild: Louise Bourgeois: »The Runaway Girl«, c. 1938; Oil, charcoal and pencil on canvas; 24 x 15; 60,9 x 38,1 cm. Courtesy Galerie Karsten Greve, Köln; Photo: Christopher Burke
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-89042-6
E-Book: ISBN 978-3-608-10384-7
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20016-4
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1. Psychotherapie mit TRUST – Grundlagen
1.1 Was ist Psychotherapie mit TRUST ?
1.2 Trauma und Krise behandeln
1.3 Das Gehirn als permanente Baustelle
1.3.1 Work in progress
1.3.2 Neurobiologische Hintergründe der Stressreaktion
1.3.3 Lateralisierung: Gefühl versus Verstand?
1.3.4 Schlussfolgerungen für die Psychotherapie
1.4 Salutogenese, Positive Psychologie und Resilienz
1.5 Das Resilienz-Stressbewältigungs-Modell (RSB-Modell)
2. Schonende Traumakonfrontation und Krisenintervention mit CIPBS® (Conflict Imagination, Painting and Bilateral Stimulation)
2.1 Die Wurzeln von CIPBS
2.1.1 EMDR
2.1.2 Katathym-Imaginative Psychotherapie (KIP)
2.1.3 Maltherapie
2.1.4 Pilotstudie
2.2 Worauf zielt CIPBS: Mögliche Wirkfaktoren und der klinische Benefit von CIPBS
2.3 Die neun Grundelemente von CIPBS
2.4 »Gebrauchsanweisung«: Ablaufschema für das praktische Vorgehen
2.4.1 »Ich kann doch nicht malen«: Compliance und Psychoedukation
2.4.2 Der Beginn: Ressourcen aktivieren
2.4.3 Der CIPBS-Prozess im Überblick
2.4.4 Hilfreiche Einweb- und Abschlusstechniken
2.4.5 Der Abschluss: Integration
2.5 Exkurs 1 zu CIPBS: Laurie Anderson und das Malen innerer Bilder
2.6 Exkurs 2: Louise Bourgeois: Vier-Felder-Schema 1946
2.7 Fallbeispiele CIPBS
2.7.1 Reifungskrise, Herr S., 26 J.
2.7.2 Postpartale Depression, Frau E., 42 J.
2.7.3 Angst vor Klassenfahrt bei ausgeprägter Angststörung, Sabrina, 11 J.
2.7.4 Amoklauf Gutenberggymnasium, Tanja, 12 J.
2.7.5 CIPBS-Trauerbearbeitung nach Tod des Bruders, Lea, 7 J.
2.7.6 Zahnarztphobie, Frau C., 51 J.
2.7.7 Überforderung am Arbeitsplatz und Selbstwertproblematik, Frau H., 32 J.
2.7.8 Soziale und familiäre Konflikte, Frau A., 35 J.
2.7.9 Postchemotherapeutische Übelkeit: Körpergefühle als Trigger, Frau D., 52 J.
2.7.10 Darmkrebs, Angst vor Lungenmetastasen: Fokusfindung, Herr M., 48 J.
2.7.11 Nachtschweiß als Trigger für Progredienzangst: Affektdifferenzierung, Frau U., 43 J.
2.7.12 Angst vorm Sterben »Dirigent und Chor«: Achtsamer Umgang mit Deutungen, Frau P., 68 J.
2.7.13 Traumatisierung durch Gewalterfahrungen in der Kindheit, Frau R., 38 J.
2.7.14 Traumatisierung durch medizinische Behandlungen in der Kindheit, Frau O., 44 J.
2.7.15 Sexuelle Traumatisierung in der Kindheit, aktuell: Bulimie, Frau K., 41 J.
2.7.16 Stationäre Behandlung: Schonende Traumaexposition, Frau L., 53 J.
2.7.17 Stationäre Behandlung: Ego-State-Arbeit mit Täterintrojekten, Frau N., 44 J.
2.7.18 CIPBS und die Arbeit mit Täter-Introjekten: Was ist ein Täter-Introjekt?
2.7.19 Supervision: Ressourcenstärkung, Frau T., 52 J.
2.8 Der Einsatz von CIPBS zur Prävention von Retraumatisierung und Sekundärtraumatisierung von psychotherapeutisch und psychosozial tätigen Menschen in Bethlehem
3. Kreative und imaginative Interventionen zur Stressbewältigung und Resilienzstärkung
3.1 Glückserfahrungen rund ums Essen: »Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen!«
3.2 Alltagsnahe imaginative Interventionen: Kürbiskernhonigbrötchen mit Butter, Schlager, Kino, Bier, Vanilleeis und Birchermüsli
3.3 Biografien signifikanter angenehmer Ereignisse im Lebenszyklus
3.4 Energiekuchen
3.5 Die Lichtstrom-Übung
3.6 Atmen und Lächeln
3.7 Die Innere-Helfer-Übung – Begegnung mit einem hilfreichen, freundlichen Wesen, einem inneren Helfer oder einer inneren Helferin
3.8 Der Wohlfühlort
3.9 Sensorische Achtsamkeit entwickeln mit der 5-4-3-2-1-Technik
3.10 BERLIN-Ressourcen-Checkliste
3.11 Das ABC des Wohlbefindens
4. Visionen imaginieren und malen: Interventionen mit der VIM-Technik
4.1 Ablaufschema für das praktische Vorgehen mit der VIM-Technik
4.2 Body-Scans: symbolhafte Konfrontation mit Ego-States
4.2.1 Frau D., 47 J.: Konfrontation mit Transsexualität des Partners
4.2.2 Frau E., 65 J.: Tod des Ehemannes / Beinamputation in der Kindheit
4.2.3 Frau M., 37 J.: Innere Leere / Inneres Kind
4.2.4 Frau S., 54 J.: Belastung durch Tinnitus
4.2.5 Body-Scans im Rahmen der Supervision
4.3 Frau H., 60 J.: Affektdifferenzierung als Hilfe, »trocken« zu bleiben
4.4 Die Baumübung: Das Motiv des Baumes als Übung zum Auftanken von Lebenskraft
4.5 Familie oder Selbstrepräsentanz in Tieren: Identifikation und Modifikation von Ego-States
4.5.1 Frau G., 66 J.: Identität als Chefin: Schafherde und Giraffe
4.5.2 Frau W., 81 J.: Die zweite Abnabelung: Familie in Tieren
5. Psychotherapie mit TRUST – ressourcenorientierte Elemente aus verschiedenen Therapieverfahren
5.1 Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie (PITT®)
5.2 Tiefenpsychologisch-imaginative Behandlung von traumatisierten Patienten mit der Katathym-Imaginativen Psychotherapie (KIP)
5.3 Kreative Modifikationen von EMDR
5.3.1 Resource Development and Installation (RDI) – Protokoll und Absorptionstechnik
5.3.2 Das Essential-EMDR-Protokoll
5.3.3 EMDR und Butterfly Hug
5.3.4 Ressourcenfokussiertes EMDR-Protokoll für körperliche Erkrankungen
5.4 Hypnotherapie und Techniken der Ego-State-Therapie
5.4.1 Somatische Ego-States als Zugang zu Ressourcen
5.4.2 Frasers Dissociative Table Technique
5.4.3 Hypnosystemische Therapie und Beratung
5.4.4 Impact-Techniken
5.5 Die Station als Ressource in der Traumatherapie
5.6 Traumazentrierte kognitiv-behaviorale Therapie: Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy (IRRT)
5.7 Der Körper als Ressource
5.8 Psychotherapie mit TRUST – Fallbeispiel: Lebertransplantation, Herr L., 51 J.
6. Psychohygiene für PsychotherapeutInnen zum Schutz vor Sekundärtraumatisierung und Burnout
6.1 Gegenübertragungsreaktionen bewusst registrieren
6.2 Burnout und Sekundärtraumatisierung
6.3 Kohärenzgefühl, Achtsamkeit und Flow erleben
6.4 Die therapeutische Arbeit als »Kunstwerk« oder: vom Glück, PsychotherapeutIn zu sein
7. Statements für eine Psychotherapie mit TRUST
TherapeutInnenbefragung zur Anwendung von CIPBS
Danke
Nachwort (Ulrich Sachsse)
Text- und Bildnachweis
Literatur
»Was ist Glück«: »Es ist ein sehr gutes Wort;
Glück bedeutet in gewisser Hinsicht
Gleichgewicht. Es bedeutet, dass man sich
und andere an erkennen kann.«
Louise Bourgeois 2001
Vorwort
Luise Reddemann
Seit in Deutschland das Thema »Traumatherapie« zur Kenntnis genommen wurde – vor etwa zehn Jahren –, hat sich das Wissen um posttraumatische Störungen und deren Behandlung stetig erweitert; aber auch die Erkenntnis, dass sehr viel mehr Störungsbilder, als wir früher auch nur ahnten, Folgen oder Teilfolgen von traumatischen Schädigungen sein können. In diesem Kontext spielen vor allem anhaltende seelische und körperliche Verletzungen im Sinne einer Vernachlässigung in der frühen Kindheit eine bedeutende Rolle, deren Folgen vor allem Bindungsstörungen sind. Hier wird immer deutlicher, wie sehr frühe Schädigungen sich auf das Stressverarbeitungssystem so belastend auswirken können, dass ein Mensch dauerhaft mit Stress schlechter fertig wird. Ein anderes weites Feld öffnet sich durch Erkenntnisse der Neurobiologie und vermehrtes Wissen über das, was Joachim Bauer »Das Gedächtnis des Körpers« genannt hat. Daraus ergibt sich beinahe zwangsläufig ein anderer Umgang mit auf den Körper bezogenen und diesen einbeziehenden therapeutischen Richtungen.
Christa Diegelmann hat, ausgehend von ihrer Arbeit mit Frauen nach Brustkrebserkrankung und der häufig zu beobachtenden traumatischen Wirkung dieser Erkrankung, erkannt, dass sehr viel mehr Menschen als die, die man traditionellerweise mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung in Verbindung bringt, unter posttraumatischen Stresssymptomen leiden, und daraus die Konsequenz für ihre therapeutische Arbeit gezogen. Darüber hinaus verschließt sie sich aber auch nicht der Erkenntnis, dass seelische – und körperliche – Widerstandskraft bei der Auseinandersetzung mit extremem Stress eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Man kann heute davon ausgehen, dass bei jedem Menschen, der Schweres erlitten hat, auch ein Versuch der Selbstregulation stattgefunden hat und stattfindet. Manchmal kommt dieser Prozess zum Erliegen, und dann kann Therapie helfen, die aus eigener Kraft nicht zu erlangende Balance wiederzugewinnen. Es liegt nahe, dass eine Therapeutik, die diesen komplexen Vorgängen gerecht werden will, mehr als einer Methode verpflichtet sein sollte; vielmehr geht es darum, auf der Grundlage tiefenpsychologischen Verstehens einen ganzen Koffer voll therapeutischer Interventionen anzubieten, die in sich die Möglichkeit haben, die Resilienz der einzelnen PatientInnen zu fördern und ihre Wunden zu heilen.
Christa Diegelmann lässt sich von einem Konzept des Stress-Resilienz-Modells leiten, um so für den einzelnen Menschen stimmige und möglichst genau passende Hilfen zu entwickeln.
Dabei greift sie zum einen auf bewährte Formen imaginativer Techniken wie der KIP und aus neuerer Zeit PITT zurück, zum andern verknüpft sie Imagination mit einer von Ingrid Riedel übernommenen, auf den Theorien C.G. Jungs basierenden Maltherapie. Dass Imagination und Gestalten eng miteinander verknüpft sind, leuchtet ein. PatientInnen haben so die Möglichkeit, Vorgestelltes in einer für sie passenden Weise, die eben nicht immer verbal sein muss, zum Ausdruck zu bringen. Das Werk, das dadurch entsteht, hat dann seinerseits wieder Wirkung auf die Imaginationsfähigkeit, sodass sich die Effekte verstärken können.
Christa Diegelmanns Buch bietet eine Fülle von Fallvignetten, die das Vorgehen verdeutlichen. So kann die Leserin/der Leser entdecken, wie fein abgestimmt das Vorgehen ist und wie sehr es der Autorin am Herzen liegt, mit den PatientInnen gemeinsam den für sie geeigneten Weg zu finden, nämlich das Stressmanagement zu verbessern dadurch, dass das, was bereits an Potenzial da ist, wahrgenommen und genutzt wird.
Dieses Buch ist sowohl für AnfängerInnen geeignet, die eine möglichst genaue Anweisung benötigen, wie man in bestimmten Situationen vorgehen sollte, wie auch für erfahrene KollegInnen, die sich vielfältige neue Anregungen erhoffen dürfen, um die eigene Praxis zu bereichern.
Einleitung
»Ich hätte nie gedacht, dass ich mich je wieder verlieben könnte«; »Erst jetzt kann ich die schönen Lebensmomente wirklich fühlen«; »Ich bin so froh, dass ich auch mit diesem Trauma, oder vielleicht gerade dadurch, besser mit meinem Leben klarkomme als vorher«. Diese und viele andere ähnliche Aussagen meiner PatientInnen zeigen, dass Menschen Trauma und Krise bewältigen können. Es ist möglich, ohne überflutenden Distress in der Gegenwart und Zukunft wieder handlungsfähig zu werden und zu erleben, wie das Wissen auch um die schlimmsten Erfahrungen im Leben in die eigene Lebensgeschichte integriert werden kann.
Durch die Erkenntnisse der Psychotraumatologie im Zusammenhang mit der neurobiologischen Forschung entwickelte sich bei mir zunehmend ein Fundament für mein therapeutisches Selbstverständnis, das meine Herangehensweise auch theoretisch einbettet. Da unser Gehirn sich nutzungsabhängig verändert, ist es auch von entscheidender Bedeutung, welche Aspekte des Erlebens und Verhaltens im Umgang mit Trauma und Krise Beachtung finden. Daraus ergibt sich für mich ein eindeutiges Plädoyer für eine ressourcenfokussierte Psychotherapie. Das bedeutet nicht, dass Belastungen tabuisiert und verdrängt werden sollen. Es geht vielmehr darum, heilsame Lebens- und Welterfahrungen im psychotherapeutischen Setting zu initiieren, um Traumafolgestörungen bearbeiten zu können. Dazu ist es nicht erforderlich, in allen Details Trauma- oder Krisenerfahrungen wieder durchleben zu müssen. Es ist zwar wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen, aber das Ziel der Therapie sollte sein, die Gegenwart und die Zukunft achtsam erleben zu können.
Dazu ist eine offene, interessierte und aktive Haltung als Psychotherapeutin sinnvoll. Diese sollte auch das Vertrauen vermitteln, dass Leben (wieder) in Balance kommen kann. Flourishing, im Sinne von »optimalem Lebensgefühl« oder von »Aufblühen«, ist ein neuer Begriff für psychische Gesundheit (Keyes und Haidt 2002, Fredrickson und Losada, 2005), der sich aus den Forschungen der Positiven Psychologie entwickelt hat. Dazu möchte ich auch mit diesem Buch beitragen.
Die Entwicklung und Aktivierung von emotionalen, kognitiven, körperbezogenen, psychosozialen und spirituellen Ressourcen in der Traumatherapie erfordert vielfältige, kreative therapeutische Interventionen. Grundbedingung hierfür sind das Vertrauen in die Weisheit und die Selbstheilungskräfte der individuellen »Hardware und Software« und das Vertrauen in die Möglichkeit einer gezielten Stärkung. Diese Grundhaltung ist sowohl für traumatisierte PatientInnen und deren psychosoziales Umfeld als auch für PsychotherapeutInnen ermutigend und entlastend. Die systematische Nutzung stressregulativer Mechanismen kann dabei den Blick wieder weiten und fördert bei der Bearbeitung von aktuellen oder zurückliegenden Krisen oder Traumata neue Sicht- und Erlebensweisen. Das individuelle Resilienzerleben kann so gestärkt werden, und häufig kommt es auch zum sogenannten Posttraumatischen Wachstum: »Posttraumatic Growth« (Tedeschi 1999, Zöllner und Maercker 2006).
Die etablierten Konzepte der Traumatherapie beinhalten in der Regel die drei Phasen Stabilisierung, Traumakonfrontation und Integration. Sie gewichten diese drei Phasen jedoch unterschiedlich und haben je nach therapeutischer Schule auch verschiedene Schwerpunkte, bezogen auf die Interventionen. Das intensive Wiedererleben des Traumas in der Traumakonfrontationsphase ist für die PatientInnen oftmals sehr belastend und möglicherweise im Lichte neurobiologischer Befunde auch nicht unbedingt erforderlich. Meine klinischen Erfahrungen mit PatientInnen, die durch eine lebensbedrohliche körperliche Erkrankung traumatisiert sind, haben mich veranlasst, gängige Interventionen zu modifizieren. Das Trauma ist bei dieser Klientel nicht »vorbei«, und durch oftmals monatelang andauernde medizinische Behandlungen sind diese PatientInnen noch zusätzlich belastet. Zudem sind bereits am Anfang einer Therapie häufig gezielte Kriseninterventionen notwendig.
Dazu waren Techniken der unmittelbaren Stressregulation, einer intensiven Ressourcenfokussierung und neue Wege einer schonenden Traumakonfrontation erforderlich, die ich in diesem Buch erstmals umfassend darstelle. Diese Interventionstechniken haben sich inzwischen auch in anderen Indikationsgebieten bewährt und werden bereits von PsychotherapeutInnen in unterschiedlichsten Bereichen erfolgreich angewandt. Ich habe diese Techniken, einschließlich der oben beschriebenen, von Vertrauen geprägten Grundhaltung, TRUST (Techniken ressourcenfokussierter und symbolhafter Traumabearbeitung) genannt.
Das Buch zielt darauf, durch zahlreiche Fallbeispiele und Übungsanleitungen das konkrete Vorgehen einer Psychotherapie mit TRUST zu veranschaulichen. Dabei ist mir ein schulenübergreifendes Verständnis der Interventionsangebote wesentlich.
Kernelemente der Salutogenese, der Positiven Psychologie, der Resilienzforschung und einiger traumatherapeutischer Ansätze sowie aktuelle Befunde der Neurobiologie werden in Bezug auf ressourcenorientierte therapeutische Interventionen reflektiert. Traumatherapie mit diesem Fokus ist auch für TherapeutInnen weniger belastend und somit ein Beitrag zur Prävention von Sekundärtraumatisierung. Das Kapitel sechs gibt darüber hinaus vielfältige Anregungen für eine ressourcenorientierte Gestaltung der eigenen Psychohygiene zum Schutz vor Sekundärtraumatisierung und Burnout.
Ich bevorzuge die Anwendung von Interventionen, die den PatientInnen Zugänge zu ihren ureigensten inneren Prozessen über imaginative und kreative Prozesse eröffnen. Grundlage dabei sind die größtmögliche Selbststeuerung der Patientin sowie die Transparenz im Sinne eines informed consent. Im Verlauf meiner Tätigkeit habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, die PatientInnen dabei von Anfang an als gleichberechtigte PartnerInnen in den Behandlungsprozess mit einzubeziehen. Gezielte Interventionen zur individuellen Stressregulation werden von mir auch als Beitrag zum Empowerment der PatientInnen verstanden. Diese Interventionen leben von dem konkreten Bezug zur Alltagswelt der PatientInnen, das bedeutet auch, dass TherapeutInnen den Mut und die Neugierde haben müssen, sich flexibel auf die Lebenswelt ihrer PatientInnen einzulassen. Jeweilige kulturspezifische Bedingungen, Geschlecht (sex und gender) und auch generationenspezifische Erfahrungen sind hierbei achtsam zu berücksichtigen.
Meine therapeutische Identität ist auch geprägt durch eine Zeit vor EMDR und durch eine Zeit mit EMDR.
Die Zeit »mit EMDR« hat meine therapeutischen Erfahrungen sehr bereichert und inspirierte mich dazu, besonders das EMDR-Element der bilateralen Stimulation auch bei anderen Interventionen zu nutzen. Dieses Buch vermittelt dazu praxisnah unterschiedliche Beispiele, die sich besonders in der Bearbeitung von Traumafolgestörungen und zur Krisenintervention klinisch bewährt haben.
Als spezifisches Verfahren einer schonenden Traumakonfrontation stelle ich CIPBS (Conflict Imagination, Painting and Bilateral Stimulation) vor. CIPBS integriert u. a. Prinzipien des EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Shapiro 1998), der KIP (Katathym Imaginative Psychotherapie, Leuner 1985) und der Maltherapie (Riedel 1992). Die Kombination von Symbolisierung der traumatischen Erfahrung, und der unmittelbaren aktiven bildnerischen Darstellung, verbunden mit bilateraler taktiler Stimulierung im CIPBS-Prozess, scheint eine schonende Trauma- und Krisenbearbeitung zu begünstigen.
Ich stelle sehr unterschiedliche Anwendungsbeispiele von CIPBS vor. Etliche der Fallbeispiele haben mir KollegInnen, die mit CIPBS arbeiten, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Für das Verständnis ist es nicht unbedingt erforderlich, alle Fallbeispiele zu lesen. Ich habe trotzdem diese Vielfalt gewählt, auch um für verschiedene Indikationsbereiche Anregungen anzubieten. Nicht bei jedem Fallbeispiel ist jedoch der CIPBS-Prozess ausführlich dargestellt. Die genaue Vorgehensweise ist in Kapitel 2.4 geschildert und beispielsweise auch bei der ersten Falldarstellung (Kap. 2.7.1) näher beschrieben.
Inzwischen bestätigen Befunde der neurobiologischen Forschung (Hüther 1999, 2004, van der Kolk 2000, 2003, Roth 2006, Siegel 1999, 2003, 2006, Spitzer 2005, 2006) zusätzlich die Wirksamkeit und Notwendigkeit der Aktivierung nichtsprachlicher und ressourcenfokussierter Verarbeitungszugänge, um effektivere und nachhaltigere therapeutische Veränderungen bewirken zu können. Margarete Isermann zeigt in Kapitel 1.3 praxisnah die Relevanz neurobiologischer Zusammenhänge für die konkrete Umsetzung in therapeutisches Handeln auf. Wir haben gemeinsam ein Erklärungsmodell für PatientInnen entwickelt, um die Grundprinzipien einer Psychotherapie mit TRUST zu veranschaulichen, und haben es »Resilienz-Stressbewältigungs-Modell« genannt. Wir nutzen es zur Psychoedukation und auch, um die PatientInnen zur Übernahme von Eigenverantwortung im Behandlungsprozess zu ermutigen.
1. Psychotherapie mit TRUST – Grundlagen
1.1 Was ist Psychotherapie mit TRUST ?
Man könnte postulieren statt: Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten (Freud 1914): Erinnern, Weitergehen und Vertrauen. Das Vergangene wird aktiviert und im Vertrauen auf die individuellen Ressourcenund Entwicklungspotenziale »fortgeschrieben«, »umkodiert« bzw. »neu kodiert« und »Neues wird gebahnt«.
Psychotherapie mit TRUST meint einerseits die Abkürzung von »Techniken Ressourcenfokussierter und Symbolhafter Traumabearbeitung«, aber auch die Wortbedeutung an sich symbolisiert die Grundelemente des Behandlungskonzepts. Es ist das Vertrauen darauf, dass grundlegende Veränderungsprozesse möglich sind, selbst bis ins hohe Alter. Weiter ist es das Vertrauen in vorhandene und aktivierbare individuelle Selbstheilungspotenziale eines jeden Menschen, wenn im therapeutischen Prozess die Bedingungen dafür geschaffen werden. Und es ist auch das Vertrauen in die Bedeutung der therapeutischen Beziehung, um korrigierende Erfahrungen möglich werden zu lassen.
Psychotherapie mit TRUST ist ein Behandlungsansatz, der aus den gängigen psychotherapeutischen Verfahren diejenigen Elemente kombiniert, die speziell geeignet sind, durch den gezielten Einsatz von Imaginationen, Kognitionen, Symbolen, Metaphern oder auch von körperbezogenen Interventionen die psychotherapeutische Behandlung von Traumafolgeerkrankungen und/oder subsyndromalen PTBS-Störungsbildern ressourcenorientiert zu gestalten. Dabei ist mir auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es viele PatientInnengruppen gibt, die nicht unter dem »Trauma-Begriff« einzuordnen sind, die aber in der Psychotherapie von traumatherapeutischen Interventionsstrategien profitieren können. Selbst wenn die Beurteilung der Wirksamkeit spezifischer therapeutischer Techniken für die Behandlung posttraumatischer Belastungssymptome nach Evidence-based-Kriterien nur beschränkt möglich ist (Flatten et al. 2004), so gibt es inzwischen auch vielfache klinische Evidenz für den Einsatz einer traumaadaptierten Psychotherapie für andere syndromale Störungsbilder.
1.2 Trauma und Krise behandeln
Für die Behandlung von Traumafolgeerkrankungen wurden je nach therapeutischer Schule und klinischer Erfahrung unterschiedliche Interventionen entwickelt. Meine klinischen Erfahrungen haben mir gezeigt, wie hilfreich es sein kann, auch bei PatientInnen in Krisensituationen nach traumatherapeutischen Prinzipien vorzugehen. Damit will ich keinesfalls den Traumabegriff ausweiten, denn eine Krise ist eine Krise, sie kann aber als existenziell bedrohlich erlebt werden, ohne dadurch das Kriterium der Lebensbedrohung zu erfüllen. Der Krisenbegriff ist nicht absolut sondern relativ definiert als Ungleichgewicht zwischen subjektiv wahrgenommener Belastung und individuellem Bewältigungspotenzial. »Folgende Merkmale machen eine Krise aus: Die emotionale Gleichgewichtsstörung muss schwer, zeitlich begrenzt und durch die dem jeweiligen Individuum normalerweise zugänglichen Gegenregulationsmittel nicht zu bewältigen sein.« (Kast 2000, S. 20) Ebenfalls relativ definieren Fischer u. Riedesser auch ein psychisches Trauma als ein »vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt« (Fischer u. Riedesser 1998, S. 79). Eine auf hirnphysiologische Prozesse bezogene Definition gibt van der Kolk: »Per definitionem ist ein Erlebnis dann traumatisch, wenn es anschließend die Art, wie die Betroffenen ihre Wahrnehmungen organisieren, entscheidend prägt.« (van der Kolk 2003, S. 86)
Bewältigung von Trauma und Krise
Ein Trauma oder eine Krise ist dann bewältigt, wenn ein Mensch ein Lebensereignis, welches mit vollkommener Hilflosigkeit und Ohnmacht verbunden war oder noch ist, in die eigene Lebensgeschichte einordnen kann, ohne dadurch psychisch oder körperlich von überflutendem Disstress eingeengt zu werden.
Die Bewältigung von Trauma und Krise ist auch dadurch zu kennzeichnen, dass das erschütterte Selbst- und Weltverständnis wieder in subjektiver Balance und der Mensch wieder fähig ist, Glück zu empfinden. Oder wie die in New York lebende, in der Kindheit traumatisierte Künstlerin, Louise Bourgeois, in einem Interview im Alter von 83 Jahren auf die Frage »Was ist Glück« antwortet: »Es ist ein sehr gutes Wort; Glück bedeutet in gewisser Hinsicht Gleichgewicht. Es bedeutet, dass man sich und andere anerkennen kann.« (Louise Bourgeois 2001, S. 291)
Ein Vergleich von Trauma- und Krisenerfahrungen macht deutlich, dass beide viele Gemeinsamkeiten haben:
1. das subjektive Gefühl der Überforderung durch das (traumatische) Ereignis
2. die Plötzlichkeit des Ereignisses und die damit einhergehende Unvorhersehbarkeit
3. das subjektive oder objektive Erleben von Kontrollverlust und das daraus folgende Erleben von Ohnmacht, Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein.
Das syndromale Störungsbild nach traumatischen Ereignissen ähnelt dem von Menschen, die Krisen erleben, es betrifft die drei Hauptsymptomcluster der PTBS:
1. Wiedererleben, Intrusionen, z. B.: sich aufdrängende Bilder, Flashbacks, belastende Gedanken und Erinnerungen an das Geschehene, Albträume
2. Vermeidungsverhalten, emotionale Betäubung, z. B.: Rückzugsverhalten, Vermeidung der belastungsassoziierten Stimuli, nicht wahrhaben wollen/können, was geschehen ist
3. Hyperarousal, z. B.: physiologische Übererregung, Schreckhaftigkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Affektlabilität.
Jede Krisensituation und jedes Trauma hat das Potenzial, die gewohnten Handlungs- und Problemlösemuster zu verändern und somit auch auf der Ebene der Repräsentation psychischen Erlebens im Gehirn neue synaptische Verschaltungen entstehen zu lassen. Hüther (1999) beschreibt, wie wichtig es sein kann, weg von den gewohnten »Autobahnen im Gehirn« hinzufinden zu den viel abwechslungsreicheren Nebenstraßen oder gar Trampelpfaden des Erlebens, um in der Lage zu sein, auf Veränderungen im Leben reagieren zu können und nicht an ihnen zu zerbrechen oder zu verzweifeln. »Beide Arten von Stressreaktionen, also die kontrollierbaren Herausforderungen als auch die unkontrollierbaren Belastungen, tragen in jeweils spezifischer Art und Weise zur Strukturierung des Gehirns, also zur Selbstorganisation neuronaler Verschaltungsmuster im Rahmen der jeweils vorgefundenen äußeren, psychosozialen Bedingungen bei: Herausforderungen stimulieren die Spezialisierung und verbessern die Effizienz bereits bestehender Verschaltungen. Sie sind damit wesentlich an der Weiterentwicklung und Ausprägung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale beteiligt. Schwere, unkontrollierbare Belastungen ermöglichen durch die Destabilisierung einmal entwickelter, aber unbrauchbar gewordener Verschaltungen die Neuorientierung und Reorganisation von bisherigen Verhaltensmustern«. (Hüther 1999, S. 81) Diese neurobiologische Sichtweise hilft mir als Psychotherapeutin in der Begegnung mit Menschen, die sich in ausweglosen Situationen, in Krisensituationen befinden, darauf zu vertrauen, dass die gegenwärtig erlebte Krise, die erlebte Traumatisierung, die sich als Ohnmacht, als Todesangst, als Panik oder in anderen syndromalen Bildern zeigen kann, eben auch ein jeweils individuelles Lösungspotenzial enthält. Viktor E. Frankl, der Begründer der Logotherapie, hat in unzähligen Beispielen immer wieder aufgezeigt, wie wichtig es ist, darauf zu vertrauen, dass Menschen den Zugang zu ihrer eigenen Sinnfindung bekommen. »Tätig geben wir dem Leben Sinn, aber auch liebend – und schließlich leidend … Wie wir uns also Schwierigkeiten gegenüber einstellen – darin noch zeigt sich, wer man ist, und auch damit lässt sich das Leben sinnvoll erfüllen … Das Schicksal, das also, was uns widerfährt, lässt sich demnach auf jeden Fall gestalten – so oder so. ›Es gibt keine Lage, die sich nicht veredeln ließe, entweder durch Leisten oder durch Dulden‹, sagt Goethe. Entweder wir ändern das Schicksal – sofern dies möglich ist –, oder aber wir nehmen es willig auf uns – sofern dies nötig ist. Innerlich können wir in beiden Fällen an ihm, am Unglück nur wachsen. Und jetzt verstehen wir auch, was Hölderlin meint, wenn er schreibt: ›Wenn ich auf mein Unglück trete, stehe ich höher.‹ « (Frankl 1992, S. 93)
Ich plädiere – besonders vor dem Hintergrund meiner therapeutischen Erfahrung mit lebensbedrohlich erkrankten Menschen – hier für einen erweiterten Trauma-Begriff. Dies bedeutet eine praxistaugliche Herangehensweise, ohne dadurch die Notwendigkeit der weiteren Klärung des Trauma-Begriffs und zukünftiger diagnostischer Kriterien übergehen zu wollen. Die Anwendung des Traumakonzepts mit der Aufklärung über die neurobiologischen Regulationsprinzipien in ihrem bisher bekannten Einfluss auf Denken, Fühlen und Handeln stellt den lebensbedrohlich erkrankten PatientInnengruppen ein nicht pathologisierendes Erklärungs- und Behandlungsmodell zur Verfügung. In den Worten einer Krebspatientin ausgedrückt: »Die deutsche Sprache verfügt nicht über genügend Adjektive, die meinen Seelenzustand wiedergeben könnten: hilflos, mutlos, ohnmächtig, allein, verzweifelt – und vor allem eines: überfordert.« (Herbert 2005, S. 189)
Lebensbedrohliche Krankheiten, wie z. B. Krebs, haben in der Traumatherapie und -forschung bisher erst relativ wenig Aufmerksamkeit erfahren (Schmitt 2000).
Mehnert (2005) zeigt in einer Übersicht die Häufigkeiten der Hauptsymptome der PTBS bei KrebspatientInnen aus verschiedenen Studien auf: Intrusionen: 16 – 49 %, Vermeidung: 7 – 35% und Hyperarousal: 14 – 30%. Epidemiologische Daten zeigen unterschiedliche Prävalenzraten für die Häufigkeit von PTBS in Abhängigkeit von der Art des Traumas (ca. 50% nach Vergewaltigung, ca. 25% nach anderen Gewaltverbrechen, ca. 50% bei Kriegs- und Vertreibungsopfern, ca. 15% bei Verkehrsunfallopfern und ca. 15% bei schweren Organerkrankungen wie Herzinfarkt und Malignomen) (Flatten et al. 2004). Die Lebenszeitprävalenz für PTBS liegt in der Allgemeinbevölkerung etwa zwischen 2% und 7%. Geht man von der relativen Häufigkeit des Auftretens von z. B. schweren körperlichen Erkrankungen aus, so sind das beispielsweise auf etwa 700 000 Krebsneuerkrankungen pro Jahr in Deutschland bei 15% Prävalenz etwa 105 000 PatientInnen mit PTBS. Mehnert (2005) fand in einer eigenen Studie mit Brustkrebspatientinnen, dass sogar nur 40% keines der PTBS-Kriterien erfüllte. Die Prävalenz subsyndromaler Störungsbilder ist also, nicht nur bei Menschen mit einer Krebserkrankung, wesentlich höher, und es besteht eine hohe Chronifizierungsneigung. Veranschaulicht man sich diese Datenlage, so wird deutlich, wie »normal« in der psychotherapeutischen Praxis subsyndromale PTBS-Störungsbilder zu berücksichtigen sind.
»Das Leben ist gar nicht so. Es ist ganz anders. Hundertneunzehn Tage lebe ich jetzt mit der Diagnose Krebs. Hundertneunzehn Tage lebe ich mit dem Wissen, dass sich in meiner Brust ein bösartiger Tumor befindet. Heute soll er entfernt werden. Fürs Erste? … Ich tausche meinen blauen Hosenanzug gegen weiße Thrombosestrümpfe und den obligatorischen weißen OP-Kittel. Mein blaues Tuch verdeckt meinen kahlen Kopf. Ob ich es anbehalten darf? Ich wage nicht zu fragen. Dabei hat diese Bagatelle für mich eine große Bedeutung. Ob sie mir diesen kleinen Rest an Intimität lassen? Ich werde die Etagen hinunter zum Operationssaal gefahren. Ich denke an meinen alten Vater und den Sechszeiler von Eugen Roth, den er mir mit auf diesen Weg gegeben hat: ›Ja der Chirurg, der hat es fein, er macht dich auf und schaut hinein. Er macht dich nachher wieder zu – auf jeden Fall hast du jetzt Ruh, wenn mit Erfolg für längere Zeit, wenn ohne für die Ewigkeit.‹« (Herbert 2005, S. 148 –149)
Gegen Gewohnheit
Heut bin ich von meinem gewohnten Gang
Durch die Wiese abgekommen
Und habe den jenseits liegenden Hang
Des Tals in Besitz genommen.
Zwischen Windhalm, Wolfsmilch und Wegerich
Standen Stiefmütterchen im Kraut.
Am ersten September und sommerlich!
Der Hügel war ganz überblaut
Von einem Wunder, das keiner sah.
Auch ich hätt es nicht gesehen
Ohne den Zufall, der mir geschah.
Ich wurde von andren Menschen gestört
Bei meinem üblichen Morgengang.
Und ich war zornig und dachte: Gehört
Mir das Tal nicht allein und schon lang?
Was wollen Sie hier zu so früher Stunde?
Ich brauche den Platz. Sie nicht.
Und dabei, wie ich die Wiese umrunde,
Verwandelt sich der Verzicht
In großen Gewinn. So ist es im Leben:
Gewohnheit hält uns zurück.
Und manches Mal sind wir ganz dicht daneben
Und gehen doch vorbei am Glück.
Eva Strittmatter © Aufbau Verlagsgruppe GmbH, Berlin
1.3 Das Gehirn als permanente Baustelle
Margarete Isermann
1.3.1 Work in progress
»Psychotherapie wirkt, wenn sie wirkt, darüber, dass sie das Gehirn verändert. Wenn sie das Gehirn nicht verändert, ist sie auch nicht wirksam.« (Grawe 2004, S. 18)
Die rasant zunehmenden Erkenntnisse der Hirnforschung, auch bedingt durch immer differenziertere technische Möglichkeiten, etwa durch bildgebende Verfahren, haben auch in der Psychotherapie in den letzten Jahren zu veränderten Sichtweisen geführt. Besonders die Trauma- und Stressforschung hat dazu wichtige Impulse gegeben, die einen »Paradigmenwechsel« in der Psychotherapie angestoßen haben. Über die Traumatherapie hinaus konnte auch die Wirkungsweise vieler anderer Verfahren der etablierten Therapieschulen im Lichte der neuen Erkenntnisse anders interpretiert werden. Noch sind viele der neuen Erkenntnisse sehr vorläufig und hypothetisch, sie können aber schon jetzt bereits für das therapeutische Handeln eine hilfreiche Orientierung geben.
Traumaforschung und Traumatherapie belegen, dass bereits ein einziges traumatisches Erlebnis ausreicht, um die bisherige Selbst- und Weltsicht von Menschen entscheidend zu verändern und dramatische, schwer zu beeinflussende Symptome auszulösen. Andererseits haben Erkenntnisse der Hirnforschung und neue Therapieverfahren frühere pessimistische Sichtweisen relativiert. Das menschliche Gehirn ist lebenslang auch in größerem Ausmaß veränderungsfähig, und individuelle Stress-Situationen und Belastungen sind sogar notwendig, um ein differenziertes, auf die unterschiedlichen Herausforderungen flexibel reagierendes Gehirn zu formen. »Die neuroendokrine Stressreaktion ist ein entscheidendes Instrument zur Anpassung der dem Fühlen, Denken und Handeln einer Person zugrunde liegenden neuronalen Verschaltungen an die Erfordernisse einer sich ständig ändernden Außenwelt.« (Hüther 2001, S. 96)
Entscheidend für die Auswirkung einer solchen Stressreaktion ist das Ergebnis der auf diesen Stress folgenden Verhaltensreaktion. Führt das durch den Stress ausgelöste Verhalten zum Erfolg, so stärkt dies durch die ausgeschütteten »belohnenden« Neurotransmitter wie Dopamin die an dem Verhalten beteiligten neuronalen Verschaltungen. Das an der Problemlösung beteiligte Verhalten und die damit zusammenhängenden emotionalen und körperlichen Zustände haben in Zukunft eine höhere Auftretenswahrscheinlichkeit. Allerdings können die alten Verhaltens- und Erlebensbereitschaften nur schwer durch einmalige korrigierende Erfahrungen geändert werden, »denn es müssen neue neuronale Erregungsbereitschaften gebahnt und alte gehemmt werden. Die Grundlage für eingeschliffene psychische Störungen können nicht durch Introspektion und Einsicht geändert werden, sondern durch reale neue Erfahrungen, die alte synaptische Übertragungsbereitschaften hemmen und neue bahnen.« (Grawe 2004, S. 358)
Wenn die bisher benutzten Lösungswege nicht mehr erfolgreich sind, tritt eine verstärkte Stressreaktion ein, die die bisher etablierten Verbindungen, etwa durch die Ausschüttung des »Stresshormons« Cortisol (richtiger eigentlich: der »Stressbremse« Cortisol), destabilisiert und damit die Möglichkeit für neue Wege eröffnet. Führen diese neuen Wege zum Erfolg, endet die Stressreaktion, was vom Körper als Belohnung erlebt wird. Die Verbindungen zwischen den an dieser Lösung beteiligten Neuronen und neuronalen Netzen werden entsprechend gestärkt, und in ähnlichen Situationen wird in Zukunft mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ähnlich reagiert. Je intensiver diese Prozesse ablaufen, umso intensiver werden die neuen Verbindungen gebahnt. Diese Prozesse der Destabilisierung und Stabilisierung von Bahnungen sind erforderlich, um überhaupt Lernen aus Erfahrungen zu ermöglichen, unser Verhaltensrepertoire nach und nach den sich verändernden Anforderungen anzupassen und eine zunehmende Selbst- und Verhaltenssicherheit zu erlangen.
Wenn jedoch auf Dauer keine angemessene Lösung gefunden wird, die die Stressreaktion beseitigt, wie es etwa bei einem Trauma häufig geschieht, so führt dies zu tief greifenden Veränderungen des Gehirns und entsprechend des Erlebens und Verhaltens und auch körperlicher Funktionen. Dies ist besonders bei sehr früher Traumatisierung oder frühkindlicher Vernachlässigung und bei besonders lang anhaltender oder besonders schwerer, unentrinnbarer Belastung der Fall. Die in diesen Fällen vom Individuum zur Beendigung der unerträglichen Stressreaktion gefundenen »Not-Lösungen« beinhalten in der Regel eine erhebliche Einschränkung des individuellen Verhaltensspielraums und nicht selten selbstschädigende Verhaltensweisen.
Die explizite Berücksichtigung der in Trauma- und Krisensituationen ausgelösten neurobiologischen Prozesse kann nicht nur für die Traumatherapie, sondern auch für die »normale« psychotherapeutische Arbeit einen hilfreichen Bezugsrahmen geben.
1.3.2 Neurobiologische Hintergründe der Stressreaktion
In einer diffus als bedrohlich wahrgenommenen Situation durch sensorische Kanäle erfolgt zunächst eine Aktivierung derjenigen neuronalen Strukturen, die auf die Identifizierung und emotionale Beurteilung eingehender Reize spezialisiert sind. Eine besondere Bedeutung haben dabei die (besonders rechte) Amygdala, der Hippocampus und der präfrontale Cortex. Eingehende sensorische Informationen aus dem Thalamus können in der Amygdala, die auch als »Angstzentrum« oder »Feuermelder« des Gehirns bezeichnet wird, eine sehr rasche, unspezifische Reaktion auslösen, die weitere Systeme aktiviert. Dabei kommt es u. a. durch Aktivierung des Sympathikus und den Ausstoß von Noradrenalin über den Locus coeruleus zu körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Schweißausbrüchen, erhöhtem Blutdruck etc. Diese typischen körperlichen Stressreaktionen sind angeborene Mechanismen, die in Gefahrensituationen das Überleben sichern sollen und beispielsweise auf Kampf oder Flucht vorbereiten.
Parallel dazu, aber etwas langsamer, laufen die differenzierteren Bewertungsprozesse insbesondere auf der Ebene des präfrontalen Cortex und des Hippocampus ab. Durch eine entsprechende Bewertung der Situation als weniger bedrohlich (bzw. durch das Auffinden bereits bewährter Bewältigungsstrategien) kann dann gegebenenfalls die übermäßig aktivierte Amygdala »heruntergefahren« und so die Stressreaktion beendet werden. Die Kommunikation zwischen Amygdala und Hippocampus spielt dabei eine besondere Rolle.
Offenbar benötigt der Hippocampus, um funktionsfähig zu sein, ein mittleres Erregungsniveau. Eine extreme Erregung durch eine überaktivierte Amygdala kann ihn in seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Das kann dazu führen, dass die Erfahrungen und sensorischen Informationen vom Hippocampus nicht korrekt kategorisiert, mit den dazugehörigen (z. B. zeitlich-räumlichen) Kontext-Informationen versehen und entsprechend in das biografische Gedächtnis eingespeichert werden können, sondern auf der »primitiven« Ebene der Amygdala abgespeichert, man könnte auch sagen »abgespalten« werden. Dadurch können sie jederzeit durch irgendwelche mit der Situation verbundene sensorische Reize im Sinne einer klassischen Konditionierung getriggert werden, wodurch das gesamte Stress-System wieder aktiviert wird, ohne dass eine Relativierung durch höhere corticale Strukturen erfolgt (van der Kolk 2000).
Wenn es, wie etwa beim Trauma, zu einer sehr heftigen oder lang anhaltenden derartigen Stressreaktion kommt, so wird durch die Aktivierung der HPA-Achse (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse) eine Kaskade von sogenannten »Stresshormonen« freigesetzt: Der Hypothalamus schüttet CRH (Corticotropin-Releasing-Hormon) aus, was die Ausschüttung von ACTH (adrenocortikotrophes Hormon) durch die Hypophyse bewirkt, was dann in der Nebennierenrinde die Bildung von Cortisol anregt. Wie schon bemerkt, wirkt Cortisol durch Rückkopplungsprozesse auch als »Stressbremse«; es hat aber die Eigenschaft, wenn in größeren Mengen und über einen längeren Zeitraum ausgeschüttet, bereits gebahnte neuronale Verbindungen (d. h. auch gelernte Erlebens- und Verhaltensweisen) zu zerstören, es wirkt also »neurotoxisch«. Da sich im Hippocampus besonders viele Cortisol-Synapsen befinden und der Hippocampus eine besonders »fragile« Struktur ist, kann ein lang anhaltender »Beschuss« mit Cortisol ihn in seiner Funktionsfähigkeit – wie oben beschrieben – beeinträchtigen und sogar in seiner Substanz »schrumpfen« lassen. Untersuchungen an früh oder schwer traumatisierten Menschen mit PTBS ergaben ein signifikant geringeres Hippocampus-Volumen. Allerdings wird diskutiert, ob Menschen, die nach einem Trauma eher eine PTBS entwickeln, bereits vorher ein geringeres Hippocampus-Volumen aufweisen, was u. a. Ergebnisse der Zwillingsforschung nahelegen (Yehuda 2001). Diese strukturellen Unterschiede illustrieren, wie tief greifend bei früh und/oder schwer traumatisierten Menschen die neuronalen Veränderungen sind. Interessanterweise findet man bei dieser Population nicht etwa einen erhöhten, sondern einen niedrigeren Cortisol-Spiegel im Blut als bei Nichttraumatisierten bei gleichzeitig erhöhter höherer Cortisolrezeptor-Sensitivität im Hippocampus, also möglicherweise bereits eine Anpassung des Systems (Yehuda 2001).
Die geschilderten stressbiologischen Prozesse beziehen sich auf das etablierte sogenannte »Furcht-System«. Nach einer relativ neuen und interessanten Theorie von Jaak Panksepp (zitiert nach Sachsse 2004) unterscheidet sich dieses Furcht-System, das gekennzeichnet ist durch Sympathikus-Aktivierung, Noradrenalin, Kampf/Flucht und »Beruhigung« durch Cortisol, von dem sogenannten »Panik-System«. Dieses besonders im Zusammenhang mit Bindungsprozessen und Dissoziation interessante System ist durch die Elemente Parasympathikus-Aktivierung, Glutamat, »Freeze«/Totstellreflex und Beruhigung durch Opioide sowie durch den bindungsstiftenden Neurotransmitter Oxytozin gekennzeichnet. Selbstverständlich agieren die beiden Systeme nicht unabhängig voneinander, und es kann Sinn machen, statt in dem hilflos-ausgelieferten Zustand des Panik-Systems zu verharren, in das Furcht-System zu wechseln, etwa durch die Entwicklung einer Phobie. »Durch Einsicht, Kognition und Lernen können wir uns aus der Situation der diffusen Panik herausbegeben.« (Sachsse 2004, S. 38)
Tabelle: Unterscheidung von Panik- und Furcht-System nach Jaak Panksepp, zitiert nach Sachsse 2004
Charakteristikaauf den Ebenen
Panik-System
Furcht-System
erlebte Bedrohung:
diffus
konkret
Reaktion:
Hilflosigkeit, Hilferufe
Kampf, Flucht, Aktion
Coping:
Soziale Unterstützung, Bindung
Selbstwirksamkeit, neue Erfahrungen
Primär beteiligtes ANS-System:
Parasympathikus
Sympathikus
Neurotransmitter:
Glutamat
Noradrenalin, Adrenalin
Beruhigung, Belohnung durch:
Opioide, Oxytozin
Dopamin, Opioide (Cortisol)
Solche hier vereinfacht dargestellten neurobiologischen Beschreibungen können auch PatientInnen dabei helfen, sich die eigene Symptomatik in einer nicht pathologisierenden Weise als biologisch determiniert zu erklären. Damit werden die eigenen Lösungen sowie die therapeutischen Interventionen durchschaubarer. Dies führt wiederum zu einer Erhöhung des subjektiven Kontrollgefühls und der Compliance. Diese Modelle können den Patientinnen auch helfen, die Notwendigkeit stressregulierender und ressourcenstärkender Interventionen zu erkennen, die in diesem Buch schwerpunktmäßig vorgestellt werden.
1.3.3 Lateralisierung: Gefühl versus Verstand?
Viele der in diesem Buch vorgestellten Verfahren beinhalten die Technik der »bilateralen Stimulation«. Dabei werden abwechselnd rechts und links taktile, visuelle oder auditive Reize gesetzt, was eine alternierende Stimulation der beiden Hemisphären bewirken soll. Die bilaterale Stimulation ist ein Kernelement des EMDR, ursprünglich in der Form horizontaler Augenbewegungen. Allerdings werden ähnliche Techniken auch in anderen Therapieformen benutzt, etwa beim NLP. Es scheint sich dabei um uralte Mechanismen zu handeln, die Menschen schon immer in Ritualen benutzten, etwa beim Trommeln und Stampfen bei rituellen Tänzen. Beispielsweise benutzen russische »weise Frauen« (Babuschkas) eine Kerze, die sie vor den Augen ihrer »Patientinnen« hin und her bewegen (persönliche Mitteilung einer russischen Kollegin).
Die bilaterale Stimulation hat offenbar spezifische Wirkungen bei der Verarbeitung traumatischer und belastender Erlebnisse. Shapiro (1998) konzipierte die damit verbundene Wirkung ursprünglich als Desensibilisierung, später als »beschleunigte Informationsverarbeitung«. Heute sieht sie EMDR als ein Modell der »adaptiven Informationsverarbeitung« (Shapiro 2001). Die bilaterale Stimulation soll dabei die Aktivierung des Informationsverarbeitungssystems bewirken und damit letztlich die durch den traumatischen Stress bedingten Blockaden der Informationsverarbeitung auflösen und die Integration des Erlebten erleichtern.
Die bilaterale Stimulation scheint eine beschleunigte Integration rechts- und linkshemisphärischer, vereinfacht ausgedrückt, emotionaler und kognitiver Prozesse zu fördern. Worauf diese Wirkung letztlich beruht, ist noch nicht geklärt. Es gibt dafür unterschiedliche Hypothesen, etwa die Synchronisation der Hemisphären oder die Aktivierung ähnlicher Prozesse wie im REM-(Rapid-Eye-Movement-)Schlaf, der offensichtlich auch der Verarbeitung und Integration (belastender) Erlebnisse und der Konsolidierung von Erinnerungen dient (Stickgold 2002). Andere Erklärungen beziehen sich auf eine durch die bilaterale Stimulation ausgelöste Orientierungsreaktion oder auf die Wirkung rhythmischer Stimulation, etwa der beruhigenden Wirkung des Herzschlags der Mutter für das ungeborene Kind, oder sie postulieren schlicht eine Ablenkung durch den doppelten Aufmerksamkeitsfokus während der Konfrontation mit der traumatischen Erinnerung und die dadurch bedingte Herunterregulierung des Angst-Systems (Shapiro 2001). Es ist zu erwarten, dass es in Zukunft neue empirische Befunde geben wird, die die eine oder andere Hypothese untermauern können oder auch ganz andere Erklärungen nahelegen. Allgemein kann man bereits jetzt sagen: »Offensichtlich beeinflusst die bilaterale Stimulation nicht unmittelbar das Bewusstsein, sondern wirkt eher auf subkortikale Prozesse ein, die mit Einsicht und Verstehen nur wenig zu tun haben.« (van der Kolk 2003)
Inwiefern kann eine Integration links- und rechtshemisphärischer Prozesse förderlich sein? Die beiden Hemisphären sind zwar intensiv vernetzt und interagieren ständig, es gibt jedoch gewisse Schwerpunkte in der Art, wie und welche Informationen jeweils verarbeitet werden. Die linke Hemisphäre spielt eine besondere Rolle bei der Sprache, bei »logischen« Denk- und Analyseprozessen, die rechte dagegen bei nonverbalen Signalen, bei emotionalen und körperlichen Prozessen. Strukturen der rechten Hemisphäre sind eher ausgereift und haben entsprechend in den ersten Lebensjahren die entscheidend größere Bedeutung (Siegel 2003). Außerdem scheint es eine unterschiedliche Speicherung emotionaler Inhalte entsprechend ihrer Wertigkeit zu geben. Positive Emotionen werden offenbar eher im linken und negative im rechten präfrontalen Cortex gespeichert (Damasio 2005). »Der linke PFC ›beherbergt‹ positive Ziele und generiert positive Emotionen, der rechte Vermeidungsziele und negative Emotionen.« (Grawe 2004, S. 146)
Rauch et al. (1996) fanden bei Traumatisierten bei der Konfrontation mit dem eigenen Trauma-Script eine verstärkte rechtshemisphärische Aktivität der Amygdala und des rechten assoziativen Cortex bei gleichzeitiger Unterdrückung linksseitiger Strukturen, insbesondere im Broca-Bereich, dem Sprachzentrum. Dies erklärt auch die »Sprachlosigkeit« bei der Aktivierung traumabezogener Reize bei gleichzeitiger Überaktivierung emotionaler (Angst-)Zentren und auch die oft beobachtete geringe Wirksamkeit einer nur »sprechenden« Psychotherapie. »Leider hat sich die Grundannahme, dass ein Trauma zuverlässig aufgelöst werden kann, indem man Patienten hilft, die für sie mit traumatischen Erlebnissen verbundenen Tatsachen und Gefühle in Worte zu kleiden, mittlerweile als falsch erwiesen.« (van der Kolk 2003, S. 88 – 89)