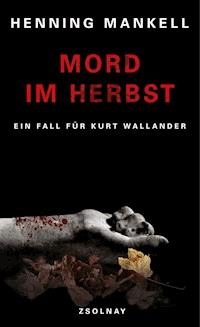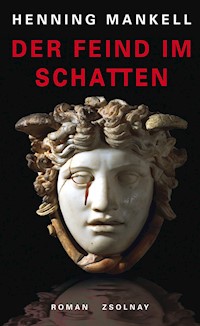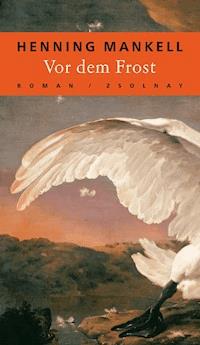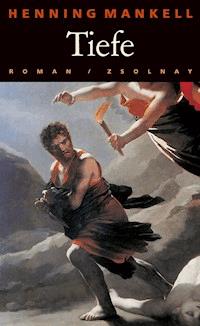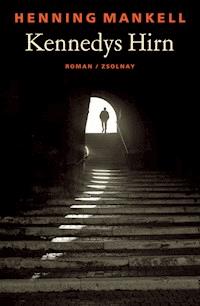Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Diagnose Krebs hat Henning Mankell an einen alten Albtraum erinnert: im Treibsand zu versinken, der einen unerbittlich verschlingt. Im Nachdenken über wichtige Fragen des Lebens fand er ein Mittel, die Krise zu überwinden. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Welche Art der Gesellschaft will ich mitgestalten? Er beschreibt seine Begegnungen mit den kulturgeschichtlichen Anfängen der Menschheit, er reflektiert über Zukunftsfragen und erzählt, was Literatur, Kunst und Musik in verzweifelten Momenten bedeuten können. Henning Mankell blickt zurück auf Schlüsselszenen seines eigenen Lebens und beschreibt Fähigkeiten und Strategien, ein sinnvolles Leben zu führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Diagnose Krebs hat Henning Mankell an einen alten Albtraum erinnert: im Treibsand zu versinken, der einen unerbittlich verschlingt. In dieser Krise half ihm das Nachdenken über die großen Fragen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Welche Art der Gesellschaft will ich mitgestalten? Daraus entstand Treibsand, sein persönlichstes Buch. Ausgehend von eigenen Erlebnissen beschäftigt sich Mankell mit den kulturgeschichtlichen Anfängen der Menschheit, reflektiert über die wichtigsten politischen Fragen der Zukunft und erklärt, was Literatur, Kunst und Musik in schweren Momenten bedeuten können. Der Treibsand ist nur ein Mythos, es gibt ihn nicht. Dass das Leben trotz privater und globaler Katastrophen lebenswert ist, davon ist Mankell überzeugt. Es kommt auf die richtige Strategie an: »Leben ist im Grunde nichts anderes als Überlebenskunst.
Zsolnay E-Book
HENNING MANKELL
TREIBSAND
Was es heißt,
ein Mensch zu sein
Aus dem Schwedischen von
Wolfgang Butt
Paul Zsolnay Verlag
Die Originalausgabe erschien erstmals 2014 unter dem Titel Kvicksand beim Leopard Förlag, Stockholm.
ISBN 978-3-552-05752-4
Copyright © Henning Mankell 2014
Published by agreement with Leopard Förlag, Stockholm, and Leonhardt & Høier Literary Agency A/S, Copenhagen
Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2015
Umschlag und Foto: © Peter-Andreas Hassiepen,
München
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
FÜR EVA BERGMAN
Dieses Buch ist auch dem Gedenken an den Bäcker Terentius Neo und seine Ehefrau gewidmet, deren Namen wir nicht kennen. Ihre Gesichter sind auf einem Fresko in ihrem Haus in Pompeji zu sehen.
Zwei Menschen mitten im Leben. Sie wirken ernst, aber zugleich träumerisch. Sie ist sehr schön, aber schüchtern. Er scheint ebenfalls schüchtern zu sein.
Sie machen den Eindruck von zwei Menschen, die ihr Leben sehr ernst nehmen.
Als im Jahr 79 nach Christus der Vulkan ausbrach, kann ihnen nicht viel Zeit geblieben sein, um zu verstehen, was geschah. Sie starben mitten im Leben, begraben von der Asche und der glühenden Lava.
Inhalt
Teil I – DER GEKRÜMMTE FINGER
1. Der Unfall
2. Menschen widerwillig auf dem Weg ins Schattenreich
3. Die große Entdeckung
4.Treibsand
5. Die Zukunft wird unter der Erde versteckt
6. Die Blase im Glas
7.Testament
8. Der Mann am Fenster
9. Hagar Qim
10. Der Löwenmensch
11. Eis
12. Die Zeit in eine andere Richtung drehen
13. Die Reise in die Welt unter
14. Der junge Medizinstudent
15. Ein Zauberer und ein Betrüger
16. Der Traum von einem schlammigen Schützengraben in Flandern
17. Die Höhlen
18. Die schwimmende Müllhalde
19. Zeichen
20. Das Floß des Todes
21. All diese vergessene Liebe
22. Timbuktu
23. Ein anderes Archiv
24. Der Mut, Angst zu haben
125. Paris 24
26. Die Flusspferde
27. Eine Kathedrale und eine Staubwolke
Teil II – DER WEG NACH SALAMANCA
28. Schatten
29. Leuchtende Zähne
30. Fotografien
31. Der Ausweg
32. Feuerball über Paris 1348
33. Wie lang ist die Ewigkeit?
34. Zimmer Nummer eins
35. Der Weg nach Salamanca – Teil I
36. Der Mann, der von seinem Pferd stieg
37. Während das Kind spielt
38. Elena
39. Wecken nach Platon
40. Winternacht
41. Erleichterung
42. Verirrt
43. Der Weg nach Salamanca – Teil II
Teil III – DIE MARIONETTE
44. Auf dem Lehmboden
45. Auf leisen Pfoten von Dunkel zu Dunkel
46. Mantua und Buenos Aires
47. Der dumme Vogel
48. Wer wird dann noch da sein, um das Echo zu hören?
49. Das salzige Wasser
50. Der Büffel mit acht Beinen
51. Das Geheimnis der Höhlenmaler gelüftet
52. Kindheitsglück – die Ankunft eines klapperigen Lieferwagens im Frühling
53. Der Kriegsinvalide in Budapest
54. Besuch an einem Ort, wo etwas beginnt und zugleich endet
55. Die Frau mit dem Zementsack
56. Ein Winter in Heraklion
57. Katastrophe auf einer deutschen Autobahn
58. Eifersucht und Scham
59. Der achtundzwanzigste Tag
60. Begegnung in einem antiken Theater
61. Ein Dieb und ein Polizist
62. Jugend
63. Der Kadaver auf der Anklagebank
64. Ein schwerer Sturm aus Nordwest
65. Fiktive Begegnung in einem Park in Wien im Jahr 1913
66. Die Marionette
67. Sich nie seine Freude nehmen lassen
Epilog
Schäm dich nicht, Mensch zu sein, sei stolz!
In dir öffnet sich Gewölbe um Gewölbe, endlos.
Du wirst nie fertig, und es ist, wie es sein soll.
Tomas Tranströmer, Romanische Bögen
Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel
Teil I
DER
GEKRÜMMTE
FINGER
1.
Der Unfall
Früh am Morgen des 16. Dezember fuhr Eva mich zur Statoil-Tankstelle in Kungsbacka, wo ich einen Wagen mietete. Ich wollte nach Vallåkra in der Nähe von Landskrona und am Abend zurückkommen und den Wagen wieder abgeben. Am Tag darauf sollte ich im Weihnachtsgeschäft in verschiedenen Buchläden in Göteborg und Kungsbacka meinen jüngsten Roman signieren.
Es war ein nasskalter Wintermorgen, aber ohne Niederschlag. Ich würde drei Stunden brauchen für die Fahrt, wenn ich wie gewohnt vor Varberg anhielt und frühstückte.
Meine Theaterchefin Manuela Soeiro aus Maputo, mit der ich seit nunmehr dreißig Jahren zusammenarbeite, war zu Besuch in Schweden. Es war das erste konkrete Arbeitstreffen über die für den Herbst des folgenden Jahres geplante Produktion. Manuela hielt sich bei Eyvind auf, der bei der Hamlet-Version, die mir bereits all die Jahre während meiner Tätigkeit am Teatro Avenida vorgeschwebt hatte, Regie führen sollte.
Schon früh war mir gerade Hamlet nahezu selbstverständlich als ein afrikanisches Königsmärchen erschienen. Es gibt etwas »Schwarzes« bei Shakespeare, das man zum Vorschein bringen kann. Tatsächlich existiert in Afrika sogar eine beinahe identische Geschichte, die im 19. Jahrhundert im südlichen Teil des Kontinents spielte. Ich hatte mir vorgestellt, dass am Ende, wenn alle tot sind und Fortinbras die Bühne betritt, er der weiße Mann sein sollte, der gekommen ist, um Afrika ernsthaft zu kolonisieren. Deshalb war es für mich auch folgerichtig, Fortinbras das Stück mit dem »Sein oder nicht sein«-Monolog abschließen zu lassen.
Wenn man Hamlet inszenieren möchte, braucht man einen Schauspieler, der die Rolle so gestalten kann, wie man sie haben will. Den hatten wir jetzt. Jorginho würde es können. Er war in den letzten Jahren gereift. Außerdem verfügte er über eine Sprachbeherrschung wie kaum ein anderer am Theater. Das Gefühl sagte uns: Jetzt oder nie.
Als ich durch Halland fahre, freue ich mich auf den Tag. Ich bin voller Erwartung.
Die Straßen nach Süden sind trocken, trotz tief hängender Wolkendecke. Ich fahre nicht besonders schnell, wie ich es sonst tue, denn ich habe eine Ankunftszeit angegeben und will nicht zu früh kommen.
Dann geht alles blitzschnell. Nördlich von Laholm schere ich nach links aus, um einen langsam fahrenden Lastwagen zu überholen. Irgendwo auf der Fahrbahn ist ein Fleck, vielleicht Öl. Ich gerate plötzlich ins Schleudern und kann den Wagen nicht mehr kontrollieren. Er kracht frontal gegen die Leitplanke. Der Airbag füllt sich. Mir wird schwarz vor Augen, und ich verliere für ein paar Sekunden das Bewusstsein.
Danach sitze ich reglos da. Was ist passiert? Ich fühle nach, ob alles in Ordnung ist. Ich bin nicht verletzt, ich blute nicht. Also steige ich aus. Autos haben angehalten, Menschen kommen gelaufen. Ich sage ihnen, dass ich nicht verletzt bin.
Ich stelle mich an den Straßenrand und rufe Eva an. Als sie abnimmt, bemühe ich mich, ganz ruhig zu bleiben.
»Du hörst, dass ich es bin«, sage ich. »Und du hörst, dass alles in Ordnung ist.«
»Was ist passiert?«, fragt sie sofort.
Ich erzähle ihr von dem Unfall. Den Aufprall auf die Leitplanke spiele ich ein wenig herunter. Keine Sorge. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber ich bin wohlauf. Ob sie mir glaubt, weiß ich nicht.
Danach rufe ich in Vallåkra an.
»Ich komme nicht«, sage ich. »Ich bin bei Laholm in eine Leitplanke gefahren. Ich bin unverletzt. Aber ich fahre nach Hause zurück. Der Wagen hat einen Totalschaden.«
Die Polizei kommt. Ich muss in den Alkomat blasen und werde für nüchtern befunden. Dann beschreibe ich den Unfallhergang. Währenddessen zieht die Feuerwehr den Wagen, der wohl schrottreif ist, von der Straße. Ein Sanitäter fragt mich, ob ich nicht sicherheitshalber zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden wolle. Ich lehne es ab. Mir tut ja nichts weh.
Die Polizei fährt mich zum Bahnhof in Laholm. Eine halbe Stunde später sitze ich in einem Zug zurück nach Göteborg. Aus der Reise nach Vallåkra ist nichts geworden.
Es ist bis heute nichts daraus geworden. Ebenso wenig wie aus den Signierstunden am Tag darauf.
Ohne genau sagen zu können, warum, datiere ich den Beginn meiner Krebserkrankung auf eben diesen Tag, den 16. Dezember 2013. Das ist natürlich nicht logisch. Meine Tumoren und Metastasen müssen über einen längeren Zeitraum gewachsen sein. Und ich hatte an eben diesem Tag auch keine Symptome oder andere Indikationen.
Es war mehr eine Warnung. Es bahnte sich etwas an.
Eine Woche später, genau zu Weihnachten, reisten Eva und ich in unsere kleine Wohnung in Antibes. Am Morgen des Heiligabends erwachte ich mit einem schmerzenden, steifen Nacken. Ich dachte, ich hätte dumm gelegen und mir dabei eine Genickstarre geholt.
Doch der Schmerz ließ nicht nach. Außerdem griff er auf den rechten Arm über. Ich verlor das Gefühl im rechten Daumen. Und es schmerzte weiterhin. Schließlich erreichte ich einen Orthopäden in Stockholm, obwohl es die Zeit zwischen den Feiertagen war. Ich reiste nach Schweden und ließ mich am 28. Dezember von ihm untersuchen. Er meinte, es könne sich um einen beginnenden Bandscheibenvorfall im Nacken handeln, dass aber ohne eine gründliche Röntgenuntersuchung keine sichere Diagnose möglich sei. Wir machten einen Termin für nach Neujahr aus.
Dann kam der 8. Januar. Es war ein kalter Morgen mit leichtem Schneefall. Ich nahm an, dass es jetzt darum ging, die Diagnose Bandscheibenvorfall zu bestätigen. Die Nackenschmerzen waren unverändert. Starke Schmerzmittel halfen nur notdürftig. Jetzt würde der Nacken behandelt werden.
Früh am Morgen unterzog ich mich zwei Röntgenuntersuchungen. Zwei Stunden später wurde aus der Nackenstarre und dem vermuteten Bandscheibenvorfall eine ernste Krebsdiagnose. Auf einem Bildschirm konnte ich einen drei Zentimeter großen Krebstumor in meiner linken Lunge sehen. Im Nacken hatte ich eine Metastase. Sie war die Ursache für meine Schmerzen.
Die Diagnose war sehr deutlich: Es war ernst. Der Krebs vielleicht unheilbar. Ich fragte lahm, ob das nun bedeutete, dass ich nur noch nach Hause gehen und auf das Ende warten konnte.
»Früher ja«, sagte der Arzt. »Aber heutzutage haben wir Behandlungsmöglichkeiten.«
Eva hatte mich ins Sophiahemmet begleitet, wo mir die Diagnose mitgeteilt wurde. Als wir hinterher draußen in der Winterkälte auf ein Taxi warteten, sprachen wir nicht viel. Wir sagten wohl überhaupt nichts.
Aber ich sah ein kleines Mädchen, das voller Energie und Freude in einer Schneewehe auf und ab hüpfte.
Ich sah mich selbst als Kind im Schnee hüpfen. Jetzt war ich fünfundsechzig Jahre alt und an Krebs erkrankt. Ich hüpfte nicht.
Als hätte Eva meine Gedanken gelesen, fasste sie meinen Arm mit einem festen Griff. Als wir im Taxi davonfuhren, hüpfte das Mädchen immer noch in seiner Schneewehe.
Heute, da ich dies schreibe, am 18. Juni, kann man die Zeit, die seitdem vergangen ist, als lang und kurz zugleich beschreiben.
Ich kann keinen Punkt setzen, weder durch einen tödlichen Ausgang, noch durch eine vollständige Genesung. Ich befinde mich mitten im Prozess. Ein endgültiges Fazit gibt es nicht.
Aber das habe ich durchgemacht und erlebt. Die Erzählung hat kein Ende. Sie findet statt.
Hiervon handelt dieses Buch. Von meinem Leben. Dem, das war, und dem, das ist.
2.
Menschen widerwillig auf dem Weg ins Schattenreich
Zwei Tage nach dem Autounfall besuchte ich die Kirche von Släp in der Nähe meines Wohnorts, am Meer nördlich von Kungsbacka. Ich spürte plötzlich ein Bedürfnis, ein Bild anzusehen, das ich schon viele Male betrachtet hatte. Ein Bild, das keinem anderen gleicht.
Es ist ein Familienporträt. Einhundert Jahre vor dem Aufkommen der Fotokunst gaben Menschen, die es sich leisten konnten, ein Ölgemälde in Auftrag. Das Bild stellt den Pastor Gustaf Fredrik Hjortberg und seine Ehefrau Anna Helena und ihre insgesamt fünfzehn Kinder dar. Es wurde Anfang der siebziger Jahre des 17. Jahrhunderts gemalt, als Gustaf Hjortberg um die fünfzig war. Er starb einige Jahre später, 1776.
Möglicherweise war er derjenige, der die Kartoffel in Schweden einführte.
Das Ergreifende und Bemerkenswerte, vielleicht auch Erschreckende an dem Gemälde ist der Umstand, dass es nicht nur diejenigen Familienmitglieder abbildet, die lebten, als der Maler Jonas Dürchs sich an seine Arbeit machte. Er hat auch die bereits verstorbenen Kinder gemalt. Ihr kurzer Besuch auf Erden ist vorüber. Aber auf dem Familienporträt sollen sie ihren Platz haben.
Die Komposition des Gemäldes entspricht den zeitgenössischen Gepflogenheiten. Die Jungen, die toten wie die lebenden, sind auf der linken Seite um den Vater gruppiert, während die Mädchen auf der anderen Seite um die Mutter versammelt sind. Die Blicke der Lebenden sind dem Betrachter zugewandt. Die meisten von ihnen zeigen ein vorsichtiges, vielleicht schüchternes Lächeln. Aber die toten Kinder wurden halb abgewandt gemalt, oder ihre Gesichter sind teilweise hinter den Rücken der Lebenden verborgen. Von einem der toten Jungen sieht man nur den Haaransatz und ein Auge. Es sieht so aus, als würde er sich verzweifelt anstrengen, dabei sein zu können.
In einer Wiege neben der Mutter liegt halb verdeckt ein Säugling. Im Hintergrund zeichnen sich Mädchen ab. Insgesamt kann man sechs tote Kinder zählen.
Es scheint, als wäre die Zeit auf dem Bild angehalten. Genau wie auf einem Foto.
Gustaf Hjortberg war einer der Schüler Linnés, auch wenn er nie zu den wirklich tonangebenden zählte. Als Schiffspastor unternahm er mindestens drei Reisen mit der Ostindien-Kompanie nach China. Auf dem Bild sind ein Globus und ein Lemur sichtbar. In seiner Hand hält Hjortberg ein beschriebenes Blatt Papier. Wir befinden uns in einer gelehrten Familie. Gustaf Hjortberg lebte und starb mit den Idealen der Aufklärungszeit. Außerdem war er weithin bekannt für seine Heilkunst. Die Menschen machten Wallfahrten nach Släp, um sich Rat und Heilung zu holen.
Ungefähr zweihundertfünfzig Jahre sind vergangen, seit diese Menschen lebten und starben. Acht oder neun Generationen, nicht mehr. Auf mancherlei Art und Weise sind sie unsere Zeitgenossen. Und vor allem gehören sie der gleichen Zivilisation an wie wir, die wir das Bild ansehen.
Alle auf dem Bild lächeln. Einige ein wenig steif, andere in sich gekehrt, wieder andere vollkommen offen und mir, dem Betrachter des Gemäldes, nahe.
Aber was in Erinnerung bleibt, sind natürlich die abgewandten oder halb verdeckten Kinder. Die Toten. Es scheint, als befänden sie sich in einer Bewegung fort vom Betrachter, hinein ins Reich der Schatten.
Das wirklich Ergreifende ist der Unwille der toten Kinder zu verschwinden.
Ich kenne kein anderes, stärkeres Bild von der wunderbaren Hartnäckigkeit des Lebens.
Ich wünschte mir, dass genau dieses Bild als ein Gruß unserer Zivilisation überdauerte. Bis in eine Zukunft, die so entfernt ist, dass ich sie mir nicht vorstellen kann. Es vereint den Glauben an die Vernunft mit den tragischen Lebensbedingungen, denen der Mensch unterworfen ist.
Alles ist darin enthalten.
3.
Die große Entdeckung
In dem Gefühlschaos, das mich überfiel, nachdem meine Nackenstarre sich in Krebs verwandelt hatte, stellte ich fest, dass mich meine Erinnerung oft in die Kindheit zurückführte.
Es dauerte jedoch einige Zeit, bis ich erkannte, dass die Erinnerung mir helfen wollte zu verstehen, einen Ausgangspunkt schaffen wollte, der mir eine Möglichkeit eröffnete, mit der Lebenskatastrophe, die über mich hereingebrochen war, umzugehen.
Irgendwo musste ich ganz einfach anfangen. Ich musste eine Wahl treffen. Und ich sah immer klarer, dass der Ausgangspunkt in meiner Jugend lag.
Ich wähle schließlich einen kalten Wintertag im Jahr 1957. Als ich am Morgen die Augen aufschlage, weiß ich noch nicht, dass der Tag die Enthüllung eines großen Geheimnisses mit sich bringen wird.
Am frühen Morgen bin ich auf dem Weg durch die Dunkelheit zur Schule. Ich bin neun Jahre alt. Gerade an diesem Tag ist mein bester Freund Bosse krank. Ich hole ihn immer in dem Haus ab, das nur wenige Minuten vom Gerichtsgebäude entfernt ist, in dem ich wohne. Sein Bruder Göran öffnet die Tür und sagt, dass Bosse Halsweh hat und zu Hause bleibt. An diesem Morgen muss ich meinen Schulweg allein gehen.
Die Ortschaft Sveg ist klein. Es gibt keine langen Wege. Obwohl seit jenem Wintertag siebenundfünfzig Jahre vergangen sind, kann ich mich an jedes geringste Detail erinnern. Die spärlichen Straßenlaternen, die langsam im schwach böigen Wind schaukeln. Bei einer Laterne vor der Farbenhandlung ist der Schirm zerbrochen. Gestern war er noch ganz. Also muss es in der Nacht passiert sein.
Es hat über Nacht geschneit. Vor dem Möbelgeschäft hat schon jemand Schnee geschaufelt. Vermutlich der Vater von Inga-Britt. Ihm gehört das Möbelgeschäft. Inga-Britt ist meine Klassenkameradin. Aber sie ist ein Mädchen, wir gehen nie zusammen zur Schule. Obwohl sie schnell laufen kann. Keiner kann sie einholen.
Ich erinnere mich sogar an das, was ich geträumt habe: Ich stehe auf einer Eisscholle im Fluss Ljusnan, der unterhalb des Hauses, in dem ich wohne, vorbeifließt. Die Eisscholle treibt nach Süden, es ist Frühling, und die Eisschmelze ist in vollem Gang. Sich allein auf einer Eisscholle zu befinden müsste erschreckend sein, weil es gefährlich ist. Nur einige Monate zuvor ist ein Junge, der ein paar Jahre älter war als ich, ertrunken, als sich plötzlich auf einem See in der Nähe ein tückisches Eisloch auftat. Er wurde hinabgezogen und ist noch nicht gefunden worden, obwohl die Feuerwehr mit Stangen und Haken nach ihm gesucht hat. Die Lehrerin ritzte ein Kreuz auf seine Bank in der Schule. Es ist immer noch da. Alle in der Klasse haben Angst vor Eislöchern und Unglücken und Gespenstern. Alle haben Angst vor dem Unbegreiflichen, das man Tod nennt. Das Kreuz auf der Schulbank jagt uns Entsetzen ein.
Aber in meinem Traum ist die Eisscholle sicher. Ich weiß, dass ich nicht ins Wasser falle.
Beim Möbelgeschäft gehe ich schräg über die Straße und bleibe am Bürgerhaus stehen. Da sind zwei Schaukästen. Ebenso oft in der Woche wechselt auch das Kino die Filme. Sie kommen in braunen Pappkisten von der Paketabfertigung am Bahnhof. Entweder treffen sie mit dem Zug aus Orsa ein, das im Süden liegt. Oder der Schienenbus aus Östersund bringt sie mit. Der Transport vom Bahnhof wird noch von einem Pferdewagen besorgt. Engman, der Hausmeister des Bürgerhauses, hebt die Kartons herunter. Ich habe es einmal versucht, aber ohne Erfolg. Sie waren zu schwer für einen Neunjährigen. Die Pappschachteln enthalten einen schlechten Western, den ich später sehe. Einen von diesen B- oder C-Filmen, in denen die Leute reden und reden und dann am Ende ein kurzes Duell austragen. Kaum mehr. Und alles in komischen Farben. Die Menschen haben oft rosafarbene Gesichter, und der Himmel ist mehr grün als blau.
Jetzt sehe ich, dass Engman Reif für den Galgen zeigen wird, was nicht besonders verlockend erscheint, sowie einen schwedischen Film mit Nils Poppe. Das einzig Gute an diesem Film ist, dass er jugendfrei ist. Ich brauche nicht durch das Kellerfenster einzusteigen, an dem Bosse und ich heimlich eine Sperre angebracht haben, damit es nicht ganz schließt und wir hineinklettern können, wenn Filme laufen, für die wir zu jung sind.
Als ich an diesem kalten Morgen vor siebenundfünfzig Jahren hier stehe, erlebe ich einen der entscheidenden Augenblicke, der mein Leben für immer prägt. Die Situation steht mir in beinahe überdeutlicher Klarheit vor Augen. Als wäre das Bild in meine Erinnerung eingebrannt. Plötzlich überfällt mich eine unerwartete Einsicht. Als bekäme ich einen Stoß. Die Worte formen sich wie von selbst in meinem Kopf:
»Ich bin ich und kein anderer. Ich bin ich.«
In diesem Augenblick erhalte ich meine Identität. Vorher waren meine Gedanken so kindlich gewesen, wie sie sein sollten. Jetzt trat ein ganz neuer Zustand ein. Identität setzt Bewusstsein voraus.
Ich bin ich und kein anderer. Ich kann nicht gegen jemand anderen ausgetauscht werden. Das Leben wird plötzlich zu einer ernsten Frage.
Ich weiß nicht, wie lange ich mit dieser neuen und umwerfenden Einsicht in der Kälte und der Dunkelheit stand. Ich weiß nur, dass ich zu spät zur Schule kam. Rut Prestjan, meine Lehrerin, spielte schon auf der Tretorgel, als ich die Schulhaustür öffnete. Ich hängte meine Sachen auf und wartete. Es war streng verboten, einfach hereinzutrampeln, wenn die Morgenandacht und der Gesang bereits angefangen hatten.
Schließlich war die Melodie verklungen. Es rumpelte in den Bänken, und ich klopfte an und ging hinein. Weil ich fast nie zu spät kam, sah Frau Prestjan mich nur forschend an und nickte. Hätte sie Leichtfertigkeit oder Trägheit vermutet, hätte sie etwas gesagt.
»Bosse ist krank«, sagte ich. »Er hat Halsschmerzen und Fieber. Er kommt heute nicht.«
Dann setzte ich mich in meine Bank. Ich sah mich um. Keiner hatte etwas von dem großen Geheimnis bemerkt, das ich von diesem kalten Wintermorgen an mit mir herumtrug.
4.
Treibsand
Plötzlich kam es mir so vor, als ob sich das Leben verengte. An diesem frühen Morgen kurz nach Neujahr 2014, an dem ich meine Krebsdiagnose erhielt: Da war es, als schrumpfte das Leben. Die Gedanken setzten aus, eine Art öder Landschaft schien sich in meinem Kopf auszubreiten.
Vielleicht wagte ich es nicht, an die Zukunft zu denken. Sie war unsicher, vermintes Gelände. Stattdessen kehrte ich immer wieder zu meiner Kindheit zurück.
Im Alter von acht, neun Jahren dachte ich eine Zeitlang intensiv darüber nach, welcher Tod mir am meisten Angst machte. Das ist nichts Ungewöhnliches. Solche Gedanken hat man in dem Alter. Leben und Tod beginnen zu entscheidenden Fragen zu werden. Kinder sind zutiefst ernste Wesen. Dies gilt nicht zuletzt für das Alter, in dem man sich anschickt, den Schritt zum bewussten Menschen zu tun. Du wirst dir bewusst, dass du eine Identität hast, die nicht austauschbar ist. Wie du in einem Spiegel aussiehst, wird sich im Laufe des Lebens ändern. Aber dahinter verbirgt sich immer die Person, die du bist.
Die Identität wird dadurch geformt, dass man es wagt, sich schweren Fragen gegenüber eine Haltung anzueignen. Das weiß jeder, der seine Kindheit nicht ganz vergessen hat.
Meine größte Angst war, auf einem See oder einem Fluss einzubrechen und unter das Eis gezogen zu werden, ohne mich aus dem Eisloch befreien zu können. Unter der Eisdecke zu ertrinken, durch die das Sonnenlicht leuchtet. Das Ersticken im kalten Wasser. Die Panik, von der dich niemand befreien kann. Der Schrei, den niemand hört. Der Schrei, der zu Eis und Tod gefriert.
Diese Angst war nicht erstaunlich. Ich bin in Härjedalen aufgewachsen, wo die Winter lang und hart waren.
In der Tat brach auch zu jener Zeit, als ich acht oder neun Jahre alt war, ein Mädchen in meinem Alter auf dem allzu dünnen Eis des Sandtjärn ein. Ich war dabei, als sie herausgezogen wurde. Es hatte sich sehr schnell in Sveg herumgesprochen. Alle kamen angelaufen. Es war ein Sonntag. Die Eltern des Mädchens standen an dem eisbedeckten See, auf dem das schwarze Eisloch gegen all das Weiße abstach. Als die Männer der Freiwilligen Feuerwehr mit ihren Hakenstangen das Mädchen erwischt hatten, verhielten die Eltern sich nicht so, wie man es im Film gesehen oder in Büchern gelesen hatte. Sie schrien nicht. Sie waren vollkommen stumm. Andere weinten. Die Lehrerin, wie ich mich erinnere. Der Pastor und die engsten Freunde des Mädchens.
Jemand erbrach sich in den Schnee. Es war sehr still. Weißer Dampf stieg aus allen Mündern auf wie unerklärliche Rauchsignale.
Die Ertrunkene hatte nicht besonders lange im Wasser gelegen. Aber sie war völlig steif. Ihre wollene Kleidung knackte und knisterte, als man sie in den Schnee legte. Ihr Gesicht war ganz weiß, als wäre es geschminkt. Das blonde Haar unter der roten Mütze stand in gelben Eiszapfen ab.
Aber es gab noch einen anderen Tod, der mir Angst machte. Davon hatte ich irgendwo gelesen. Später habe ich versucht, mich zu erinnern, wo das gewesen war. Vielleicht im Rekordmagasinet, das Sporterzählungen mit Spannung und Abenteuern mischte. Oder vielleicht war es in einem Reisebericht über Afrika oder die arabischen Länder. Ich habe die Erzählung nie wiedergefunden.
Sie handelte von Treibsand. Wie ein mit einer Khakiuniform bekleideter Mann, der ein Gewehr über der Schulter trägt und für eine Expedition ausgerüstet ist, in den verräterischen Sand tritt und sofort feststeckt. Er wird unerbittlich hinabgezogen und ist nicht in der Lage, sich zu befreien. Am Ende bedeckt der Sand Mund und Nase. Der Mann ist verloren. Er erstickt, und als Letztes versinkt sein Schopf im Sand.
Der Treibsand war lebendig. Die Sandkörner verwandelten sich in grässliche Tentakel, die einen Menschen verschlangen. Ein menschenfressendes Sandloch.
Verräterisches Eis konnte ich vermeiden. Besonders viele Sandstrände gab es weder an den Seen noch am Fluss Ljusnan. Doch Jahre später, als ich über die Sanddünen bei Skagen wanderte, oder noch später an afrikanischen Stränden konnte die Erinnerung an den heimtückischen Treibsand wieder auftauchen.
Als ich erfuhr, dass ich Krebs hatte, kehrte die Angst aufs Neue zurück. Sie schlug mit aller Kraft zu, das kann ich jetzt im Nachhinein sagen.
Das Gefühl, das mich überkam, war genau wie die Angst vor dem Treibsand. Ich sträubte mich dagegen, hinabgezogen und von ihr verschlungen zu werden, von der lähmenden Einsicht, dass mich eine schwere, unheilbare Krankheit befallen hatte. Ich brauchte zehn Tage, in denen ich nur wenige Stunden Schlaf fand, um mich zu fangen und nicht von der Angst vollständig lähmen zu lassen, die meine ganze Widerstandskraft zunichtezumachen drohte.
Ich erinnere mich nicht, ein einziges Mal so verzweifelt gewesen zu sein, dass ich angefangen hätte zu weinen. Auch nicht, dass ich aus Verzweiflung einfach losgeschrien hätte. Es war ein stummer Kampf, um den Treibsand zu überleben.
Und ich wurde nicht hinabgezogen. Schließlich konnte ich aus dem Sand herausrobben und anfangen, mich dem, was geschehen war, zu stellen. Der Gedanke, mich hinzulegen und auf den Tod zu warten, war verschwunden. Ich würde mich den Behandlungen unterziehen, die heute zur Verfügung stehen. Auch wenn ich nie ganz geheilt werden würde, so bestand doch die Möglichkeit, dass ich noch lange leben könnte.
An Krebs zu erkranken ist eine Katastrophe im Leben eines Menschen. Erst nachher weiß man, ob man in der Lage war, sich ihr zu stellen, ihr Widerstand zu leisten. Was ich in jenen zehn Tagen nach der katastrophalen Diagnose dachte und erlebte, ist mir noch nicht völlig klar. Vielleicht wird es mir nie klar werden? Jene zehn Tage nach dem 8. Januar 2014 sind mir nur schattenhaft in Erinnerung, ebenso dunkel wie der schwedische Winter mit seinen kurzen Tagen. Physisch reagierte ich mit wiederkehrenden Anfällen von Schüttelfrost, die mich im Nachhinein an die Male denken ließen, die ich an Malaria erkrankt war. Ich lag hauptsächlich im Bett, die Decke fest hochgezogen bis ans Kinn.
Das Einzige, dessen ich mir heute ganz sicher bin, ist die Empfindung, dass die Zeit stehengeblieben war. Alles war wie in einem verdichteten Universum auf einen Punkt konzentriert, an dem kein Früher oder Später existierte – nur dieses Jetzt. Ein Mensch, der sich am Rand eines Lochs mit tödlichem, saugendem Treibsand festkrallt.
Als ich schließlich die Lust, aufzugeben und mich vom Abgrund verschlingen zu lassen, besiegt hatte, las ich in Büchern nach, was es mit dem Treibsand eigentlich auf sich hat. Und ich entdeckte, dass die Geschichte vom Sand, der einen Menschen hinabziehen und töten kann, nur ein Mythos ist. Alle darüber geschriebenen Erzählungen und Berichte sind Erfindungen. Unter anderem hat eine Universität in Holland das Phänomen in praktischen Experimenten untersucht.
Aber das Bild vom Treibsand ist dennoch eines, zu dem ich mich heute bekenne.
So sahen die zehn Tage aus, die meine Lebensvoraussetzungen vollständig veränderten. Der Treibsand war der Höllenschlund, vor dem ich mich schließlich rettete.
5.
Die Zukunft wird unter der Erde versteckt
Im Herbst 2012 hörte ich das Wort »onkalo« zum ersten Mal. Damals ahnte ich natürlich nicht, dass ich zwei Jahre später an Krebs erkranken würde.
»Onkalo«ist finnisch und bedeutet Aushöhlung. Das Wort kann auch für etwas Geheimnisvolles verwendet werden, oder dass »die Trolle in den Felsenklüften wohnen«.
Zufällig stoße ich in einem Zug zwischen Göteborg und Stockholm auf einen Zeitungsartikel über das Sprengen von Tunneln und tief liegenden Felskammern im finnischen Urgestein, wo der Abfall von Atomkraftwerken bis in eine nahezu unendliche Zukunft aufbewahrt werden soll. Zumindest für einen Zeitraum von nicht unter einhunderttausend Jahren. Auch wenn der radioaktive Abfall in den ersten eintausend Jahren am gefährlichsten – tödlichsten – ist, muss die endgültige Aufbewahrung für einen Zeitraum garantiert sein, der dreitausend Generationen umfasst.
Ich habe mein ganzes Leben mit der Atomkraft gelebt. Noch aus meiner Kindheit habe ich vage Erinnerungen an Proteste und die Angst vor Atomwaffen und einen verheerenden Krieg zwischen der Sowjetunion und den USA, die sich wie zwei wilde Tiere verhielten, die nur notdürftig voneinander getrennt und nur vorübergehend friedlich waren. Danach kam die Kernkraft, es folgten das Unglück von Three Mile Island, danach Tschernobyl und nun zuletzt Fukushima. Ich lebe mit der natürlichen Überzeugung, dass schon jetzt der Countdown für eine weitere Katastrophe läuft. Ich lehne die Kernkraft ab, und jedes Unglück oder jede Beinahe-Katastrophe haben mich in meiner Ablehnung bestärkt. Natürlich waren mir die lange Zerfallszeit von Radioaktivität und die Gefährlichkeit des Abfalls, mit dem wir für Jahrtausende zu leben gezwungen sind, bekannt. Aber erst an jenem Herbsttag vor zwei Jahren wurde mir wirklich bewusst, was dies bedeutet.
Der Zeitungsartikel steht auf einer der hinteren Seiten. Andere Nachrichten, etwa über das Liebesleben von Rocksängern, wie man mit legalen Tricks Steuern spart oder wie man in vierzehn Tagen mehrere Kilo abnimmt, werden als wesentlich wichtiger eingestuft.
Natürlich fällt es mir nicht schwer, das zu verstehen. Wir leben im Jetzt.
Selten vermögen die Menschen ihre Neugier oder ihr Interesse auf mehr als die nächsten Tage, Monate oder Jahre zu richten. Sie denken lieber an die nächste Ziehung der Lottozahlen und hoffen auf einen Gewinn, um sich von allen Pflichten befreien zu können. Die Menschen in unserem Teil der Welt glauben heute nicht mehr an Gott. Sie glauben an Rubbellose und andere Glücksspiele.
Aber in dieser Zeitung stand eben auch ein Artikel über ein Versteck im finnischen Urgestein. Dort soll bis in unendlich entlegene Zeiten nuklearer Abfall gelagert werden.
Einige Tage nach meiner Zugreise schrieb ich an das Endlager namens Onkalo und bat um eine Besuchserlaubnis. Ich erhielt eine schnelle Antwort des Inhalts, dass ich nicht willkommen sei. In dem Brief hieß es, man wolle nicht, dass ich die Anlage als Schauplatz für einen Krimi verwendete. Ich antwortete empört, dass mir so etwas nie vorgeschwebt hätte. Wenn ich eine Betrachtungsweise hätte, so sei sie philosophisch. Wie könne man die Lagerung lebensgefährlichen Abfalls für einen Zeitraum von hunderttausend Jahren sicherstellen? Wo die ältesten noch erhaltenen menschlichen Bauwerke vielleicht fünf- bis sechstausend Jahre alt sind? Wie könne man eine Garantie für etwas übernehmen, das kein von uns heute Lebender jemals würde kontrollieren können?
Ich erhielt zur Antwort, dass man beschlossen habe, keine Besucher zu empfangen, weil man ihre Sicherheit unten in den Felskammern und -tunneln nicht garantieren könne. Ich fand es natürlich erschreckend und zugleich komisch, dass man für die Sicherheit eines einzelnen Besuchers nicht garantieren konnte, während man gleichzeitig erklärte, dass die Lagerung dort bis in eine unfassbar entlegene Zukunft sichergestellt sein sollte, wenn sowohl ich als auch der Direktor, der mir auf meinen Brief antwortete, schon lange in unseren Gräbern verfault sein würden.
Ich sah ein, dass ich das finnische Versteck Onkalo nie würde besuchen können. Doch in Schweden waren ähnliche Arbeiten in Gang. In der Nähe der Stadt Oskarshamn. Im Alter von achtzehn Jahren hatte ich die Stadt ein paarmal besucht. Das war lange bevor in Schweden auch nur ein einziges Kernkraftwerk errichtet worden oder die Frage nach dem Umgang mit dem Abfall auf den Tischen der Regierung und der Bürger gelandet war. Ich schrieb an das Atomkraftwerk in Oskarshamn und erhielt die Antwort, dass ich willkommen sei. Einige Monate später fuhr ich hin.
Heute, da ich mit meinem Krebs lebe, scheint es mir, als hätte ich neue und unerwartete Einsichten darüber gewonnen, wie wir mit dem nuklearen Abfall umgehen.
6.
Die Blase im Glas
Meine Tante war mit dem autodidaktischen Ingenieur Viktor Sundström verheiratet. Er wurde in meiner Jugend zu einem Freund, weil er trotz seines Alters immer noch ein politischer Rebell war. Er wurde fünfundneunzig Jahre alt und hörte nie auf, von den entsetzlichen Bedingungen zu sprechen, unter denen die armen Menschen in Värmland, von denen er abstammte, am Ende des 19. Jahrhunderts gelebt hatten.
Einmal versuchte er mir das Universum zu erklären. Damals, Mitte der fünfziger Jahre, war die Theorie vom Big Bang noch keine allgemein akzeptierte Erklärung für die Entstehung des Universums. Viktor meinte, dass es das Universum immer gegeben habe. Als ich ihn daraufhin fragte, was vorher gewesen sei, bekam ich zur Antwort, dass es kein Vorher gegeben habe.
Das war natürlich unmöglich zu verstehen. Plötzlich brach mein ganzes kindliches Weltbild in sich zusammen. Ich erinnere mich noch vage, dass Viktor einsah, dass er mich verunsichert und mir vielleicht auch Angst gemacht hatte, als er mir dieses »Vorher« genommen hatte.
»Niemand weiß es sicher«, sagte er abmildernd. »Das Universum ist ein Rätsel.«
Er glaubte nicht an Gott. Es gefiel ihm, dass mein Vater mir und meinen Geschwistern verboten hatte, auch nur in die Nähe einer Sonntagsschule zu kommen. Er ging selbst nie in die Kirche, außer wenn er an einer Beerdigung teilnehmen musste. Was nach dem Tod mit seinem Körper geschehen würde, war ihm vollkommen gleichgültig.
Für mich war Gott eine furchteinflößende Größe. Ein unsichtbares Wesen, das ganz dicht an mich heranschlich und meine Gedanken lesen konnte. Ich sah ein, dass weder Viktor noch mein Vater der Meinung waren, der unsichtbare Gott hätte die Erde und Planeten und Sterne geschaffen. Einige Jahre lang erzeugte dies bei mir ein Gefühl der Unsicherheit. Es war unbefriedigend, dass das Universum mit all seinen Sternen, die in den kalten Winternächten funkelten, nur ein einziges großes Rätsel sein sollte.
Es musste noch mehr sein. Es musste ein »Vorher« gegeben haben.
Auch wenn ich es versucht hätte, wäre es mir damals nicht möglich gewesen, mir einen zukünftigen Zeitraum von hunderttausend Jahren vorzustellen. Ich kann es immer noch nicht. Ich kann die Mathematik verstehen, ich kann Generationen zählen, aber ich begreife es dennoch nicht. Wie soll ein Mensch sich in so ferner Zukunft eine klare Welt vorstellen können? Wie soll man einen Abkömmling in einer dreitausendsten Generation, von mir aus gerechnet, vor sich sehen können? Die Zeit vor uns verliert sich in dem gleichen Nebel, wie wenn man rückwärts blickt. Wohin wir uns auch wenden, sind wir von dem gleichen Nebel oder vielleicht eher einem kompakten Dunkel umgeben. Wir können unsere Gedanken in alle Himmelsrichtungen und Zeitdimensionen aussenden, doch die Antworten, die wir empfangen, sind nicht viel wert. Wir vermögen nicht zu durchdringen, was selbst Science-Fiction-Autoren nicht besonders gut darzustellen gelingt.
Forscher können mittels mathematischer Modelle alles berechnen, angefangen bei der Entstehung des Universums und bis zu dem Tag, da die Sonne expandieren und schließlich selbst unsere Erde schlucken wird, wenn die Meere schon lange verdunstet sind und alles Leben erloschen ist. Die Leben spendende Sonne wird am Ende unser Tod. Wie ein gewaltiger feuriger Drache wird sie die Erde verschlingen, bevor sie selbst stirbt und zu einem der kalten toten Zwergsterne wird. Aber die mathematischen Modelle machen die Zeitdimensionen nicht begreifbarer.
Es gibt andere Wege, näher an das Unmögliche heranzukommen, sich eine Welt in hunderttausend Jahren vorzustellen. Einer davon sieht so aus:
Vor einigen Jahren bat ich einen guten Freund, der Glasbläser ist, mir ein Glas mit einer Luftblase zu blasen. Für einen Handwerker mit Selbstachtung und Können ist dies normalerweise ein misslungenes Glas, das gnadenlos aussortiert wird. Aber ich dachte über den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge nach, zwischen Märchen und Wirklichkeit. Im Hinterkopf bewegte mich auch die Frage nach der Zeit und den unendlichen Distanzen.
Ein Mythos besagt, dass eine in der durchsichtigen Wand des Glases eingeschlossene Luftblase sich bewegt. Die Bewegung ist so langsam, dass man sie mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Nicht einmal während eines langen Lebens bewegt sich die Blase sichtbar in die eine oder andere Richtung. Es dauert mehr als eine Million Jahre, bis sie wieder an ihrem Ausgangspunkt angekommen ist. Die Luftblase hat also eine Umlaufbahn wie die Planeten, die sich in bestimmten Kurven und Geschwindigkeiten bewegen.
Harry Martinson hat in seinem großen Raumfahrtepos Aniara. Eine Revue von Menschen in Zeit und Raum schön hierüber geschrieben. Aber wenn wir uns vorstellen, dass dies kein Mythos, sondern Wahrheit ist, stehen wir vor einem anderen Problem: Wie sollen wir es kontrollieren? Keiner, der heute das Glas in der Hand hält, wird in einer Million Jahre noch existieren. Tausende Generationen menschlicher Lebewesen können keine Erinnerungen weitergeben an das, was ihre Augen die Jahrtausende hindurch gesehen haben. Wir können nicht wissen, ob die Wanderung der Luftblase im Glas tatsächlich stattfindet oder nur ein Mythos ist.
Natürlich können Wissenschaftler ein Modell konstruieren und damit experimentieren. Aber dies kann uns nur die Andeutung einer Wahrscheinlichkeit liefern, nie jedoch eine Antwort von überzeugendem Wahrheitsgehalt.
Der Versuch, hunderttausend Jahre in die Zukunft zu schauen, wird zu einem Balanceakt zwischen dem, was wir uns aufgrund realen Wissens vorstellen, und dem, was wir durch unsere Phantasie mithilfe mythischer Erlebnisse erahnen können.
Der Mensch ist ein Wesen, das sich über Jahrtausende hinweg zu immer größerer Zweckdienlichkeit entwickelt hat. Deshalb würden wir kaum mit der großen kreativen Kapazität, die von Phantasie und Vorstellungskraft gespeist wird, ausgerüstet sein, wenn es nicht eine notwendige Eigenschaft für unser Überleben wäre, die der Fähigkeit dient, unsere Kinder zu schützen und neue Wege der Nahrungsbeschaffung bei Trockenheit oder Überschwemmungen, Erdrutschen oder Vulkanausbrüchen zu finden.
Die Geschichte des Menschen wie die jedes anderen Lebens auf der Erde dreht sich letztendlich um die Entwicklung von Überlebensstrategien. Nichts sonst ist eigentlich wichtig.
Leben ist im Grunde nichts anderes als Überlebenskunst.
Das Glas mit der Luftblase steht noch immer bei mir zu Hause im Regal. Wenn niemand es herunterstößt und zerschlägt, wird es noch lange nach mir da sein.
Und ich glaube daran, dass die Blase sich bewegt. Doch ich sehe es nicht.
7.
Testament
Eines Tages im Frühjahr 2013 schreibe ich mein Testament. Es werden noch sieben Monate vergehen, bis die Schmerzen in meinem Nacken einsetzen. Ich habe keine körperlichen oder mentalen Vorahnungen. Ich bin nicht krank, ich habe nicht das Gefühl, dass der Tod im Hausflur steht und wartet.
Der Grund dafür, dass ich mein Testament schreibe, ist ein völlig anderer.
Als mein Vater vor vielen Jahren starb, hatte er genaue Anweisungen dafür hinterlassen, was mit seinem Hab und Gut geschehen sollte. Deshalb mussten meine Geschwister und ich nie darüber nachgrübeln, was sein letzter Wille gewesen war. Welche Briefbündel sollten verbrannt werden? Was konnte aufbewahrt und sogar gelesen werden? Wie sollten Möbel und Bücher verteilt werden? Gab es jemanden, der eine Geldsumme erhalten sollte? Wir konnten den Nachlass problemlos ordnen und aufteilen und uns danach der bedeutend wichtigeren Trauerarbeit widmen.
Sein Testament zu schreiben bedeutet, seine Sterblichkeit anzuerkennen. In gewisser Hinsicht tut man es natürlich auch aus höchst egoistischen Gründen, aber meistens, glaube ich, weil man es den Weiterlebenden leichter machen will.
Wenn man tot ist, ist man tot. Dann kann man keinen Einfluss mehr nehmen.
Zu leben heißt, Ja oder Nein sagen zu können. Tot zu sein heißt, von Schweigen umschlossen zu sein.
Wann haben Menschen angefangen, Testamente zu schreiben? Natürlich, als sie begonnen haben, etwas zu besitzen, was für die Nachlebenden von Wert sein konnte. Mit dem privaten Besitzrecht kam die Notwendigkeit eines geschriebenen letzten Willens auf.
Die meisten Menschen sind wohl der Meinung, dass sie ein Testament verfassen sollten. Aber dann kommt es doch nie dazu oder höchstens nur zu einigen hingeworfenen Formulierungen in einem Notizbuch. Man schiebt es auf. In vielen Fällen beruht dies sicher auf einem einfachen Aberglauben: Man fürchtet, es könnte den Tod anlocken, der sich sogleich aufmacht, um einen zu holen. Bei anderen liegt es vielleicht mehr an dem Gefühl, dass es ganz einfach nicht so eilt. Man ist noch jung. Es bleibt noch genügend Zeit.
Man schafft die größte aller Illusionen: falls ich sterbe. Nicht: wenn ich sterbe.
Aber plötzlich kommt man bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Oder man bekommt einen rasant fortschreitenden Krebs, der dazu führt, dass jeder Gedanke an ein Testament ganz einfach verschwindet. Man hat genug mit dem Kampf ums Überleben zu tun.
Zivilisationen hinterlassen keine Testamente. Das tun nur Individuen. Weder die Maya noch die Inkas oder das Ägypten der Pharaonen und das Römerreich gingen auf einen Schlag zugrunde, wie etwa bei einem Autounfall oder einem Vulkanausbruch. Der Untergang kam schleichend und wurde bis zuletzt geleugnet: Eine so hochstehende Zivilisation wie die ihre konnte ganz einfach nicht untergehen. Dafür garantierten die Götter. Wenn man ihnen nur opferte und sich an den Rat und die Forderungen der Priester oder Schamanen hielt, gehörte man einer Zivilisation an, die für immer bestehen würde. Sie war auf ewig etabliert und würde nur allmähliche Veränderungen durchleben, ohne im Grunde zu altern.
Alle großen und klassischen Zivilisationen und Kulturen haben einen gemeinsamen Nenner: Sie erschienen den Menschen, die in ihnen lebten, unsterblich.
Ein beredtes Beispiel für eine untergegangene Kultur ist die Osterinsel. Heute ist Rapa Nui, wie sie auf Polynesisch heißt, eine in den Stillen Ozean hinausgeworfene Insel ohne jeden Baumbestand. In der welligen, grasbewachsenen Landschaft stehen riesige Skulpturen von Göttern der ehemaligen Kultur. Seit der Entdeckung der Insel durch die Besatzung eines holländischen Schiffes unter dem Kommando von Kapitän Jakob Roggeveen am Ostersonntag 1722 wird über diese Skulpturen gerätselt. Ein Teil von ihnen ist umgestürzt, andere stehen immer noch aufrecht an ihrem Platz.
Am merkwürdigsten sind jedoch die Steinbrüche, aus denen die Statuen einst herausgehauen wurden. Dort liegen halbfertige Skulpturen, unter anderem eine, die größer hätte werden sollen als alle übrigen. Es ist ein nicht fertiggestellter Gott. Er wurde offenbar nie vollendet, aber mit unendlicher Mühe und ausgeklügelter Ingenieurskunst an den von den Priestern bestimmten Platz transportiert und dort aufgerichtet.
Der Steinbruch auf der Osterinsel gleicht einem Friedhof für verstorbene Götter, die nie in Gebrauch genommen wurden. Plötzlich verließen die Steinmetze ihre halbfertigen Gestalten. Waren sie von jemandem gezwungen worden aufzuhören? Oder gingen sie freiwillig? Flohen sie in plötzlicher Panik? War ihr Glaube an das, was die Götter repräsentierten, plötzlich geschwunden? Niemand weiß es mit Gewissheit.
Doch im Fall der Osterinsel lässt sich heute mit relativer Sicherheit feststellen, was zum Untergang der reichen Kultur führte. Zumindest können die Alternativen auf ein Minimum reduziert werden. Eine bedeutende Anzahl von Forschern ist der Ansicht, dass die Menschen, die die Inseln einst besiedelten, Ratten mitbrachten – unfreiwillig, darf man vermuten –, die auf der Insel keine natürlichen Feinde vorfanden. Damit konnten sie sich drastisch vermehren und sich von den Samen der Palmen ernähren, die auf der Insel wuchsen.
Die Osterinsel war von Menschen von den Archipelen des Stillen Ozeans besiedelt worden, die auf ihren längsten Seefahrten hierhergelangt waren. Die großen Palmenwälder waren vermutlich einer der Gründe dafür, dass sie auf der Insel blieben. Zahlreichen Forschungen zufolge dürfte die Abholzung der Wälder dazu geführt haben, dass die Zivilisation auf der Insel, die sich über einen Zeitraum von vielleicht vierhundert Jahren entwickelte, sich nicht mehr zu erhalten vermochte. Ohne Bäume konnte man keine Boote bauen, weder zum Fischen, noch um die Insel zum verzweifelten Ende hin verlassen zu können – vielleicht zurück zu den Küsten, von denen man einst hergekommen war. Die Bäume waren für Brennholz gefällt worden, aber auch, um die Götter auf hölzernen Rollen zu den Plätzen transportieren zu können, wo sie aufgerichtet und angebetet werden sollten. Die Erde, die zum Nahrungsanbau gedient hatte, wurde fortgeweht, als die Palmwurzeln sie nicht länger auf dem felsigen Boden hielten. Und dann gab es eben noch die Ratten, die die Samen auffraßen, sodass die Wälder nicht nachwuchsen.
Was gegen Ende der Zivilisation der Osterinsel geschah, wissen wir nicht. Es gibt keine Schriftquellen. Aber Holzskulpturen, die gefunden wurden, deuten darauf hin, dass die Insel von Hungersnot heimgesucht wurde. Die geschnitzten Figuren lassen hungernde, abgemagerte Menschen erkennen. Die hervorstehenden Rippen waren für die Bildhauer ebenso wichtig wie die Gesichtsausdrücke.
Der Kampf um Nahrung führte zu Kämpfen zwischen den verschiedenen Gruppen. Es fällt nicht schwer, sich ein soziales Chaos vorzustellen, eine religiöse Verzweiflung und die Brutalität, zu der Menschen fähig sind, wenn die Nahrung nur für wenige reicht.
Natürlich schrieb niemand ein Testament. Es gibt auch sonst keine Quelle, die zum Verständnis dessen beitragen könnte, was in der letzten Zeit geschah, bevor die Insel wieder so menschenleer wurde, wie sie es einmal gewesen war. Die Hinterlassenschaft der letzten Menschen, die wir deuten, ist eine stumme Warnung.
Die verlassene Insel, die umgestürzten oder unfertigen Statuen waren an sich ein Testament. Und obendrein eine Bestätigung dafür, dass auch die höchstentwickelten Kulturen eines Tages untergehen.
Es gibt keine letzten Verfügungen der früheren Kulturen und Zivilisationen. Durch Archäologie, Paläontologie und andere Forschungszweige können wir immer weiter, immer tiefer eindringen, können mit ständig verfeinerten Hilfsmitteln wie Mikroskopen und Teleskopen immer mehr Details erkennen, um zu verstehen, was uns und unserer Zeit vorausgegangen ist.
Zwei Begriffe fassen alles, was gewesen ist, und wahrscheinlich auch alles, was kommen wird, zusammen: Überleben und Untergang. Indem wir die Welt im Rückspiegel betrachten, können wir sehen, worauf auch wir selbst zusteuern. Natürlich wird nichts so sein wie früher. Die Geschichte wiederholt sich nie als exaktes Imitat.
In unserem Fall kann man jedoch sagen, dass wir bereits jetzt bestimmt haben, was die entfernteste Erinnerung an unsere Zivilisation sein wird.
Nicht Rubens. Nicht Rembrandt. Nicht Rafael.
Auch nicht Shakespeare oder Botticelli, Beethoven, Bach oder die Beatles.
Wir hinterlassen etwas ganz anderes.
Wenn alles Übrige von unserer Zivilisation vergangen sein wird, werden zwei Dinge zurückbleiben: das Raumschiff Voyager auf seiner ewigen Reise in den äußeren Weltraum und der nukleare Abfall in den unterirdischen Schächten.
8.
Der Mann am Fenster
Eines Abends denke ich darüber nach, wie das Wissen über die Krankheit, die wir Krebs nennen, in mein Leben kam.
Als ich neun Jahre alt war, bekam ich eines Tages plötzlich Bauchschmerzen. Sie waren so schlimm, dass ich in das kleine Krankenhaus von Sveg gebracht wurde. Man vermutete eine Blinddarmentzündung und ging davon aus, dass ich operiert werden müsste. Aber dazu kam es nicht. Die Schmerzen verschwanden, und der Oberarzt, der Stenholm hieß und von allen gefürchtet wurde, kam zu dem Schluss, dass ich wohl nur ein wenig Flüssigkeit in den Blinddarm bekommen hätte, die dann von allein getrocknet wäre.
Aber ich blieb drei Tage im allgemeinen Krankensaal. Ganz hinten am Fenster lag ein großer Mann mit schütterem Haar und einem Hängebauch. Er hatte Krebs. Auf der linken Seite seines schweren Bauchs hatte er eine wässernde und eiternde Wunde. Jeden Morgen und jeden Abend wurde die Wunde frisch versorgt, und der blutige, eitrige Verband wurde in einen Blecheimer geworfen und fortgebracht. Von denen, die in seiner unmittelbaren Nähe lagen, hörte ich, dass die Wunde roch. Einmal, als er auf der Toilette war, wurde im Flüsterton darüber gesprochen, dass es ein Krebsgeschwür sei. Sein ganzer Bauch sei von Tumoren zerfressen. Jetzt war einer der Tumoren durch die Haut gedrungen.
Keiner sagte es geradeheraus. Aber sogar ich mit meinen neun Jahren begriff, dass der Mann sterben würde. Er war Pferdehändler und verkaufte Nordschweden und den einen oder anderen belgischen Ardenner. Ich glaube, er hieß Svante, und sein Nachname war vielleicht Wiberg, oder Wallén? Aber ich bin mir sicher, dass er mit Pferden handelte.
In den Tagen, die ich dort im Saal verbrachte, bekam er keinen Besuch. Wenn er nicht reglos auf seinem Bett lag, stand er meistens vor einem der hohen Fenster. Er verharrte dort in seinem schlecht sitzenden Nachthemd, mit seinem Hängebauch, die Hände auf dem Rücken wie ein Polizist auf Streife, und sah aus dem Fenster. Stundenlang, so kam es mir vor.
An dem Tag, an dem ich entlassen wurde, trat ich an das Fenster, um zu sehen, worauf er ständig den Blick gerichtet hatte.
Das Fenster ging auf die Leichenhalle des Krankenhauses hinaus. Ein kleines, weißgekalktes Gebäude, das neben einem Abfallschuppen und einem alten, verlassenen Stall lag. Vielleicht hatte er dort einmal seine Pferde gehabt? Als ich das Krankenhaus verließ, wusste ich, dass Krebs übel roch und blutiges und eitriges Verbandszeug zurückließ. Das hatte damals absolut nichts mit meinem Leben zu tun, höchstens als eine ferne Bedrohung, die in einem allgemeinen Krankensaal eines unbedeutenden norrländischen Krankenhauses versteckt wurde.
Ich bleibe im Dunkeln sitzen. Es ist halb fünf Uhr morgens. Eine andere Erinnerung hat sich plötzlich eingestellt. Vielleicht sollte ich lieber sagen, dass ich sie von einem Regal in meinem inneren Erinnerungsarchiv heruntergeholt habe. Ich beginne, an etwas zu denken, das vor exakt einundzwanzig Jahren passierte.
Ich weiß noch genau, wann ich meine letzte Zigarette geraucht habe. Es war unmittelbar vor dem Eingang des internationalen Flughafens von Johannesburg. Damals, im Dezember 1992, hieß er noch Jan-Smuts-Flughafen. Einige Jahre später, nachdem die Apartheid für immer auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet war, wurde er auf den Namen des Freiheitshelden Oliver Tambo umgetauft.
Einen Monat lang war ich in Maputo unterwegs gewesen und hatte mich von Tag zu Tag schlapper gefühlt. Lange dachte ich, es würde sich um eine hartnäckige Virusinfektion oder eine Malariaerkrankung handeln, die noch nicht richtig ausbrechen wollte. Am Theater war ich mit den Proben für ein neues Stück beschäftigt. Jeden Nachmittag, wenn ich mich in meinen alten Renault setzte, musste ich mich zwingen, den Motor anzulassen, um zum Theater zu fahren. Die Müdigkeit wurde allmählich lähmend, so viel ich auch schlief.
Eines Tages hielt ich vor dem Theater und schaltete den Motor aus. Aber ich vermochte nicht auszusteigen. Ich gab auf und rief den Bühnenmeister Alfredo zu mir, der vor dem Theater stand und ein Plakat aufhängte.
»Es geht mir nicht gut«, erklärte ich. »Sag den Schauspielern, dass sie heute Lesetag haben.«
Ich fuhr nach Hause, legte mich aufs Bett und schlief sofort ein. Am Abend ging ich Essen einkaufen. Vor dem Geschäft begegnete ich zufällig Elisabeth, einer schwedischen Ärztin und Freundin. Sie sah mich mit forschendem Blick an.
»Du bist ja vollkommen gelb«, sagte sie.
»Bin ich?«
»Vollkommen gelb. Komm morgen früh um acht Uhr zu mir.«
Am Tag darauf schickte sie mich in ein Labor. Ich kam mit einem Lebertest zurück, der normalerweise einen Wert von zwanzig zeigen sollte. Ich hatte zweitausend. Wie der Test hieß, weiß ich nicht mehr.
»Das kann ich nicht behandeln«, erklärte sie. »Nicht hier. Ich rufe ein Krankenhaus in Johannesburg an. Du musst noch heute hinfliegen.«
Der Flug von Maputo mit der Abendmaschine der South African Airways dauerte nicht länger als fünfundvierzig Minuten. Und jetzt stand ich vor dem Haupteingang des Flughafens und rauchte eine Zigarette. Als der Krankenwagen aus Sandton eintraf, trat ich die Zigarette mit dem Absatz aus. Ich wusste da noch nicht, dass dies die letzte Zigarette war, die ich in meinem Leben rauchen sollte.
Einige Tage später hatte man festgestellt, dass ich an einer besonders aggressiven Gelbsucht erkrankt war. Ich vermutete, dass ich sie mir beim Besuch einiger Restaurants mit zweifelhafter Hygiene auf einer Reise in die nördlichen Landesteile von Mosambik durch den Verzehr unsauberen Gemüses zugezogen hatte.
Dies war also in der Zeit um Weihnachten 1992. Es herrschte noch große Unsicherheit darüber, wie es in Südafrika weitergehen würde, nachdem das Apartheidsystem vor dem Zusammenbruch stand. In den Nächten, wenn ich wach in meinem Krankenbett lag, hörte ich dann und wann Schüsse draußen in der Dunkelheit. Johannesburg war eine von Kriminalität schwer heimgesuchte Stadt. Der Hass zwischen den Rassen saß tief, die Angst ebenso.
Am Morgen des dritten Tages trat ein Arzt in mein Zimmer, den ich vorher noch nicht gesehen hatte.
»Wir haben uns die Röntgenbilder angesehen, die wir gestern gemacht haben«, sagte er, und sein gebrochenes Englisch verriet, dass er erst kürzlich eingewandert war, wahrscheinlich aus Osteuropa. »Wir haben einen dunklen Fleck auf einer Ihrer Lungen gefunden. Noch wissen wir nicht genau, was es ist. Aber bald.«
Er verließ das Zimmer. Die Tür war kaum geschlossen, als ich schon dachte: Krebs. Dass ich die Zigarette vor dem Flughafen von Johannesburg ausgetreten hatte, würde mir nicht helfen. Das Rauchen hatte dazu geführt, dass ich jetzt sterben würde.
Eine Erinnerung aus Skellefteå vom Beginn der siebziger Jahre flirrte vorüber. Die alte Ärztin Sigrid Nygren, eine passionierte Theaterliebhaberin, hatte mich untersucht. Ich war gut zwanzig Jahre alt.
»Rauchst du?«, fragte sie.
»Ja.«