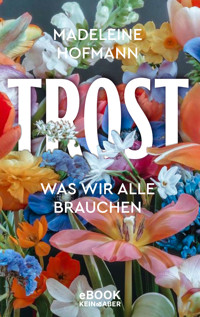
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Leben mit seinen unzähligen kleinen und großen Verlusten, die Weltlage mit ihren Krisen und Katastrophen. Es gibt heute viele Ereignisse, die Menschen untröstlich zurücklassen. Was aber, fragt Madeleine Hofmann, bedeutet Trost überhaupt? Die Autorin – gerade Anfang dreißig, als sie mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wurde – möchte ihren persönlichen Trost-Weg teilen, indem sie von ihren eigenen Erfahrungen und von Begegnungen mit Menschen erzählt, die auf verschiedene Weise sich und andere trösten – enge Vertraute, medizinische Fachkräfte, aber auch Kreative. Das Buch hat eine unverkrampfte Herangehensweise an das Trösten, die alles Pastorale beiseitelässt. Mühelos bringt Madeleine Hofmann Hochkultur und Popkultur zusammen und zeigt anhand verschiedener Themen – Essen, Humor, Kunst, Natur, Philosophie, Sprache –, wie individuell und existenziell Trost ist: Jeder Mensch sucht und findet ihn auf seine eigene Weise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Madeleine Hofmann, geboren 1987, studierte Politikwissenschaften und Soziologie. Sie lebt als Autorin und freie Journalistin in Berlin. Ihre Texte und Beiträge werden u.a. bei Deutschlandfunk Kultur und im ZDF veröffentlicht. 2018 erschien ihr erstes Sachbuch Macht Platz! Als Expertin und Rednerin für die Themen »Jugend und politisches Engagement« ist sie in den Medien und bei Veranstaltungen präsent. Für ihre Recherchen wurde sie mehrfach mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet.
ÜBER DAS BUCH
Im Grunde brauchen wir alle ständig Trost. Es sind nicht nur die großen Schicksalsschläge, Todesfälle und Krankheiten, die uns trostbedürftig machen, sondern auch die Trauer um unerfüllte Wünsche und Träume aller Art. Das Leben mit seinen unzähligen kleinen und großen Verlusten, die Weltlage mit ihren Krisen und Katastrophen. Was aber, fragt Madeleine Hofmann, bedeutet Trost überhaupt? Was hat es mit dieser Geste, dieser besonderen Fähigkeit auf sich, die vielen von uns fehlt?
Für alle Survivors, für ihre Anker und für meinen – A.
INHALTSVERZEICHNIS
PROLOG
Nicht einfach eine Zimmerpflanze.
EINLEITUNG
Ein Universum an Schicksalen, voller Welten an Leid. Und die Einladung, diese zu bereisen.
WELLNESSFÜRDIESEELE
Von Pflastern auf Knien, von Tinder-Dates und Hauptbahnhöfen. Der Trost-Zettelkasten.
LEIDEN
Von unumkehrbaren Schock-Nachrichten und dem Horror danach. Von Empathie und Hilflosigkeit – und von Haaren, die noch da sind. Die Einführung in die Misere.
FESTHALTEN
Von verstopften Toiletten und musikalischen Häusern. Von einer Begegnung mit Anastacia, von Tanzzellen und König:innenreichen. Das Kraftinsel-Hopping.
AKZEPTIEREN
Von Elefanten in Räumen und neuen Bündnissen. Von Grenzüberschreitungen und Aufbruch. Von Familien- und Rollenbildern und einem Hoch auf die Unentschiedenheit. Der harte Brocken.
DURCHHALTEN
Von schönen Dingen und Gerümpel, von UnterweltHunden und Netzwelt-Plüschmonstern. Von Berührungen und Weltverbesserern. Der Energie-Booster.HEILEN
Von kulinarischen Vulkanen und Kümmer-Cookies, von Erinnerungsrezepten und Übernatürlichem. Von Begegnungen, Besuchen aus dem Jenseits und Abschieden. Der Seelen-Heiler.
HADERN
Von Bootcamps und Bällekreisen, von der Kraft der Verbundenheit und Tapferkeitsemojis. Und von schönen Worten. In guten wie in schlechten Zeiten. Das Motivationsschreiben.
HOFFEN
Von fleißigen Ameisen und malerischen Ausblicken. Von Bibel-Zitaten und Trost-Ausbildungen, vom Zuhören und Gehörtwerdenwollen. Von tanzenden Füßen und Gerechtigkeit. Die Zuversichtsoffensive.
EPILOG
Ein neuer Platz für eine blühende Freundin.
HINWEIS
ANMERKUNGEN
DANK
ZITATNACHWEISE
PROLOG
Vielleicht war ich verrückt geworden. Der Anblick des radikal gestutzten Pflänzchens in diesem mir so vertrauten cremefarbenen Übertopf, den mein Mann da in Händen hielt, löste jedenfalls Panik in mir aus. Ich wollte das Gefäß an mich reißen, die Überbleibsel an mich drücken, ihnen gut zureden, sie beruhigend streicheln. Zum Glück starrte ich stattdessen lediglich voller Entsetzen auf die Reste meiner Lieblingspflanze. »Du hast sie umgebracht«, sagte ich trocken und konnte den Blick nicht abwenden von diesem traurigen Mix aus Braun und Dürre.
Die Orchidee stand seit sieben Jahren am immer selben Platz. Auf unserem Fensterbrett im Wohnzimmer, links außen, neben dem alten grünen Scheibentelefon, mit Blick über die Dächer Berlins, der Abendsonne zugeneigt. Meine Schwester hatte sie uns zum Einzug geschenkt. Seitdem war sie unser Blütenwunder, hatte regelmäßig so viele Knospen und Triebe und dann wunderschöne weiße Blüten mit pinken Sprenkeln, dass wir uns erstaunt fragten, wo in aller Welt sie diese Energie hernahm. Immer wieder von vorne anfangen, immer wieder die Kraft aufbringen, alle zu überstrahlen. Ein wahres Zimmerpflanzenmysterium.
Seit einigen Monaten jedoch stimmte etwas nicht mit unserer Mitbewohnerin. Nachdem die letzten Blüten abgefallen waren, folgten zum ersten Mal in der Zeit unseres Zusammenlebens keine neuen Knospen. Die Triebe vertrockneten, wir fürchteten um ihr Leben. Genau zur selben Zeit, zu der mein eigenes Leben auf der Kippe stand. Seit meiner Krebsdiagnose ging es nun also auch mit der Orchidee bergab. Kein Wunder, dass ich mich ihr verbunden fühlte wie nie zuvor, überzeugt, ihr Schicksal wäre meines und umgekehrt. Ich hatte das Gefühl, sie sei das einzige Lebewesen in meinem Umfeld, das echte, uneingeschränkte Solidarität mit mir und meinem miserablen Zustand zeigt. Dass mein Mann sie jetzt möglicherweise mit ein paar übermütigen Scherenschnitten dem Tod geweiht hatte, stimmte mich nicht gerade hoffnungsfroh.
»Das ist eine Radikalkur«, versuchte er sich zu verteidigen. »Genau wie du mit der Chemo braucht die Orchidee eine Art Zellerneuerung, damit sie wieder in voller Pracht erstrahlen kann.« Er küsste mich auf die Stirn und stellte den Topf mit Bestimmtheit zurück an seinen Platz, wo die Orchideenstummel auch den Ausblick auf den grauen, trüb dreinblickenden Klotz von Krankenhaus genossen, in dem ich meine »Erneuerung« wöchentlich verabreicht bekam. Die Chemotherapie gegen den Brustkrebs in solche Wohlfühl-Vokabeln zu verpacken, brachte mich erstaunlicherweise nicht direkt zum Explodieren, wie es andere deplatzierte Vergleiche und Sprüche über meine Erkrankung taten – und es waren viele; Menschen sind sehr gut darin, unpassende Kommentare abzugeben. Den Vergleich meines Zustands mit dem der Pflanze nahm ich an, mehr noch: Ich wurde besessen von der Observierung meines botanischen Alter Ego.
Zu beobachten, ob und wie sich die Orchidee veränderte, ob es aufwärts mit ihr ging oder nicht; traurig darüber zu sein, dass sie es vielleicht nicht schaffen würde, hoffnungsvoll, dass sie bald wieder, wenn nicht eine Blüte, so zumindest einen kleinen grünen Trieb bekommen würde, machte etwas mit mir, das ich erst rückblickend verstehen konnte: Ich projizierte alle Entwicklungsmöglichkeiten der Orchidee auf mich. Ich akzeptierte. Ich hoffte. Die Seelenverwandtschaft mit der Orchidee gab mir etwas Überlebenswichtiges, was mir zuvor wohl niemand und nichts anderes zu spenden vermochte. Die seltsame Solidarität von und mit meiner halb verdorrten Zimmerpflanze gab mir: Trost.
EINLEITUNG
»Trost«. So steht es da also auf einem meiner Notizzettel. Ich weiß weder, wann ich das Wort aufgeschrieben hatte, noch warum es mir zu diesem Zeitpunkt wichtig war, es festzuhalten. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, diesen Begriff häufig benutzt zu haben oder überhaupt jemals. Ganz offensichtlich hatte er mich nun beschäftigt. Denn es war möglicherweise die Antwort auf die Frage, was ich emotional in den Monaten, bevor mir der Zettel in die Hände fiel, zutiefst vermisst, verzweifelt gesucht und schließlich auch gefunden hatte. Fürs Erste.
Ich war gerade 31 Jahre alt, dabei, mein erstes Buch zu bewerben, mich an meinen Ehering zu gewöhnen, im Begriff, endlich diese eine lang ersehnte Südamerika-Reise zu planen, genau wie die weitere Entwicklung unserer bis dahin aus einem Paar bestehenden Familie. Doch während Freund:innen, Kolleg:innen, Verwandte in meinem Alter Familienkutschen kauften, befördert und liquide wurden, ihr erstes Eigenheim oder das Wohnmobil in Neuseeland bezogen, wohnte bei mir ein unbequemer Gast, dessen Beherbergung garantiert keinen Platz auf meiner Bucketlist fand: ein Tumor in der linken Brust, Position 1 Uhr, bösartig.
Mit einem Laborbefund war ich plötzlich nicht mehr die junge Frau in den aufregendsten Jahren ihres Lebens, mit besten Karriereaussichten, Wochenenden voller Spaß und Leichtigkeit, so vielen Freiheiten wie bisher keine Frau meiner Vorfahrinnengenerationen. Ab jetzt war ich gefangen in einem Strudel aus Arztbesuchen, invasiven Behandlungsmethoden, Entscheidungen zwischen großen und größeren Übeln. Und Angst. Sehr viel Angst.
Ich verfügte damals über das, was man ein gutes soziales Netz nennt. Nicht einmal ein Jahr zuvor hatten fast hundert Freund:innen und Verwandte mit uns die Eheschließung zwischen mir und meinem Partner gefeiert. Die Nachricht meiner Diagnose war ein nachträglicher Partycrasher. Der Spaß war vorbei, und manch ein Gast verflüchtigte sich so rasant wie noch im Vorjahr der Schlehen-Likör vom Schnapstablett.
Das Happily Ever After hatte sich ins Gegenteil verkehrt. Manche konnten nicht mit dem umgehen, was mir gerade passierte. Mir als einer, die ihnen nahesteht, an der sie nicht im Wartezimmer gesenkten Blickes vorbeischleichen oder so tun konnten, als hätten sie gar nicht mitbekommen, was sich in meinem Leben ereignet. Mir, die ich ihnen mit meinem Schicksal vor Augen führte, dass es genauso gut sie selbst erwischen könnte. Immer deutlicher dezimierte sich die Gruppe an Menschen, die mir Kraft gaben, die ihre eigene Kraft teilten, so gut es für sie eben ging. Diese illustre Gruppe von wunderbaren Menschen veränderte sich stetig: Mal kam überraschend jemand dazu, mal ließ sich ein anderer eine Weile nicht blicken. Eine Person aber ist immer dabeigeblieben: ich selbst.
Als ich jene Notiz wiederfand, erinnerte sie mich daran, wie verletzt ich durch manche der (Nicht-)Reaktionen aus meinem Umfeld war, wie wütend, wie enttäuscht. Ich erinnerte mich, wie mich die teils seltsamen oder gar ärgerlichen Begegnungen beschäftigt hatten, aber auch wie verzweifelt viele mir Nahestehende waren, von ihrer Traurigkeit und Wut so überwältigt, dass sie selbst brauchten, was sie mir gerne gegeben hätten. Ich erinnerte mich daran, wie herzerwärmend manche Nachrichten und Gesten gewesen sind, manche Worte und Berührungen. Und daran, wie mir klar geworden war, dass ich bisher selbst nicht gewusst hatte, wie ich bei schlimmen Schicksalsschlägen in meinem Umfeld reagieren sollte. Mit Entsetzen erinnerte ich mich an Situationen, an Nachrichten, in denen ich als Freundin, Familienmitglied, Kollegin nach meinen eigenen neuen Maßstäben ganz klar versagt hatte. Ich suchte Gespräche mit Menschen darüber, was ihnen damals, nach ihrem traumatischen Erlebnis gutgetan hat, was sie sich von ihrem Umfeld gewünscht hätten.
Ich fragte mich, was es mit dieser Fähigkeit, diesem Gefühl, diesem Zustand, dieser Geste auf sich hat, die vielen von uns fehlt. Was wir von anderen verlangen, zutiefst bedürfen, aber selbst nicht richtig zu geben wissen: Trost.
Bei Trost denken viele zuerst an Kinder mit Pflastern auf den Knien. Oder an Tod. Tragödien, zwischen denen Welten an Leid liegen, und doch wird über dieses Universum an Schicksalen in Zusammenhang mit Trost nicht gesprochen.
Ich war nicht zwangsläufig dem Tod geweiht, und niemand, der mir nahestand, war gerade gestorben. Durfte ich folglich nicht trostbedürftig sein? Und überhaupt: Warum spricht keiner über Trost – außer der Seelsorgerin, die einen Sterbenden begleitet? Oder der Mutter, die ihrem weinenden Kind übers Haar streicht? Gerade in einer Weltlage, die viele Menschen untröstlich zurücklässt: durch Einsamkeit, Pandemien, den Verlust der Heimat, durch Kriege, Populismus, Rassismus, durch Klimakatastrophen. Was also, frage ich mich, bedeutet Trost? Wann braucht man ihn, wie kann er aussehen, und wie können wir Trost spenden – anderen, aber auch uns selbst?
Heute weiß ich, dass Trost eine zutiefst individuelle Angelegenheit ist. Trost ist etwas, was jeder Mensch sucht, was zu finden von unschätzbarem Wert ist, und was in angebrachter Weise zu spenden eine hohe Kunst zu sein scheint. Manch ein Wort, manch eine Geste mag in der einen Situation furchtbar unangebracht, in der anderen besonders wohltuend sein. Deshalb will ich vor allem die Erfahrungen verschiedener Menschen in verschiedenen trostbedürftigen Situationen sprechen lassen, statt vermeintlich universelle Ratschläge zu erteilen. Dies ist kein Buch ausschließlich über Krebs, es ist ein Buch über meine persönlichen Erfahrungen und Begegnungen, ein Buch über Menschen und übers Menschsein. Eine Reise entlang der vielgestaltigen Trost-Inseln, die das Leben zu bieten hat. Seid herzlich eingeladen, mich zu begleiten.
WELLNESS FÜR DIE SEELE
Im großen, dicken Fremdwörterbuch, das mir meine Mutter einst geschenkt hat, das aus nostalgischen Gründen immer noch auf meinem Schreibtisch liegt und sich wunderbar als Erhöhung für den Laptop eignet, gibt es keinen Eintrag zu »Trost«. Offiziell also sollte uns »Trost« zumindest im Sprachgebrauch nicht fremd sein. Fühlt sich für mich anders an. In welchem Zusammenhang habe ich dieses Wort je verwendet? Ich muss direkt an den »Trostpreis« denken, denn der war immer schon mein Begleiter auf Jahrmärkten und Volksfesten gewesen – an Los- und Schießbuden, beim Körbe- und Pfeilewerfen. Während meine beste Freundin sich über einen lebensgroßen pinken Plüschhasen als Hauptgewinn freuen durfte und sich meine Schwester bei freier Auswahl freudestrahlend für eine gelbe Teletubby-Puppe (»Laa-Laa«) entschied, konnte ich mit einer ganzen Sammlung aus Miniatur-Plastikspielzeug und Kleinstplüschtieren aufwarten. Darunter fanden sich bei allem Groll, wieder nicht die volle Auswahl an Unsinn zu genießen, immer wieder Schätze wie ein Lineal, das nicht nur sein Motiv ändern, sondern sich sogar als Armreif ums Handgelenk schlingen ließ. Den Trostpreis zu bekommen ist also nicht unbedingt etwas Schlechtes.
»Trostpflaster« ist nicht nur eine Erinnerung an meine eigenen Kindheitstage. Durch meine Patenkinder wird mein Bewusstsein dafür immer wieder aufgefrischt, dass jede noch so kleine Wunde schneller heilt, wenn sie einen Klebstreifen trägt, der die Dramatik ihres Entstehens ausreichend würdigt.
»Ist der noch ganz bei Trost?«, steht auch auf meinem Brainstorming-Zettel. Die etwas veraltete und ziemlich harmlose Variante dessen, was am Steuer eines Fahrzeugs im Straßenverkehr gesagt oder gebrüllt wird.
Jemanden »vertrösten«, auf einen anderen Termin oder ins Unbestimmte.
»Untröstlich sein«, sagt in meinen Gedanken ein Frack tragender Butler in Disney- oder Historienfilmen, wenn er unangekündigtem Besuch erklärt, dass die Hoheit, Lord oder Lady leider gerade mit dem Pferd ausgeritten und somit nicht in der Lage ist, das Fußvolk zu empfangen.
»Seelentröster«. So heißt ein Tee im Supermarktregal. Da kommt mir mein früherer Deutschlehrer in den Sinn: »Herr Tröster«, schreibe ich auf, und daneben eine Notiz, dass ich ihn dazu befragen muss, ob er weiß, woher sein Nachname stammt.
Was noch? »Über jemanden hinwegtrösten.« Diese Formulierung ist mir zuletzt begegnet, als mir eine Freundin von ihren Tinder-Dates erzählt hat. Ob jemand mit Potenzial für »was Ernstes« dabei gewesen sei? Mit den Schultern zuckend antwortete sie: »Ach, weißt du, es ist sowieso nur, um mich über meine Trennung hinwegzutrösten.«
Dann wäre da noch die »trostlose Gegend«. Eine Befragung meiner reise- und umzugsfreudigsten Freund:innen ergibt ein Sammelsurium an Orten, wie »die Ölfelder in Kalifornien«, »eine Zeltstadt auf der sonst paradiesischen hawaiianischen Insel Oahu«, »Hauptbahnhöfe« und »die Nordstadt von Kassel«. Trostlosigkeit kennt keine Grenzen. Aber sie sieht ganz verschieden aus, entsprechend den Privilegien, die eine Person genießt, oder eben nicht. So mag eine Zeltstadt oder ein Slum für Tourist:innen trostlos erscheinen, doch ist es nicht der Ort, an dem sie leben, sondern der, den sie freiwillig besuchen und den sie verlassen, sobald sie genug gesehen haben. Das Wort »trostlos« begegnete mir noch in anderem Zusammenhang: Bezugnehmend auf eine US-amerikanische Politikerin hieß es in einem Podcast: »Einem Menschen dabei zuzusehen, wie er oder sie nicht mehr in der Lage ist, das eigene Amt auszufüllen und es trotzdem vor den Augen der Öffentlichkeit tun muss, ist trostlos.«1 Das Wort wird hier in einen Dreiklang gebracht mit »traurig« und »tragisch«. So wie in einem anderen politischen Zusammenhang: Der Begriff »Trostfrauen« meint schätzungsweise um die 200 000 Frauen und Mädchen, die im Zweiten Weltkrieg von den japanischen Truppen zwangsprostituiert wurden. Was für die Soldaten Trost bedeutete – unvereinnehmlicher Sex –, war für die Frauen, von denen viele aus Korea stammten, Angst, Leid und Trauma. Bis heute gibt es über die Aufarbeitung dieses grausamen Verbrechens Streit zwischen Südkorea und Japan.2
Ganz schön viel Stoff für ein erstes Brainstorming. Es ist Zeit für eine Expert:innenbefragung. »Trost, Substantiv, maskulin«, lese ich im Online-Wörterbuch. »Bedeutung: etwas, was jemanden in seinem Leid, seiner Niedergeschlagenheit aufrichtet.« Das passt auf fast alles, was auf meinem Brainstorming-Zettel steht – vom Kräutertee bis zur Tinder-Affäre, zumindest kurzfristig.
»Wortstamm«: Das Wort Trost ist im 8. Jahrhundert im Althochdeutschen entstanden, lese ich, es hängt mit dem indogermanischen Wortstamm »treu« zusammen und bedeutet »Festigkeit, seelischer Halt, Zuversicht und Ermutigung im Leid«.
»Beispiel: ein Trost bringender Brief.« Ich überlege, ob ich schon einmal einen Brief bekommen habe, der mich getröstet hat. Aufgehoben habe ich jedenfalls einige. Und einen für mich sehr wichtigen Brief habe ich auf jeden Fall selbst verfasst, mit der Absicht zu versöhnen, zu heilen. Mir kommen außerdem Kondolenz- und Leser:innenbriefe in den Sinn. Heute sind es wahrscheinlich eher E-Mails oder Direktnachrichten in den sozialen Medien, doch es gibt sie immer noch, die Kolumnen, die sich ein Leser:innen-Anliegen nach dem anderen vornehmen. Der australische Musiker Nick Cave führt sogar eine Art Online-Kummerkasten, den wir uns später genauer anschauen.
»Synonyme: Aufbietung, Aufmunterung, Aufrichtung, Beruhigung«, lese ich, und »Trost ist eine zwischenmenschliche Zuwendung an jemanden, der trauert oder anderen seelischen bzw. körperlichen Schmerz zu ertragen hat.« Im philosophischen Lexikon wird Trost als »freundschaftliche Hilfe, gegenseitige Unterstützung, Linderung der Trauer bei menschlichem Leid und Tod« beschrieben. In der computergenerierten Wolke der »typischen Verbindungen« zu Trost im Duden Online-Lexikon stehen vier Wörter besonders dick: »spenden«, »schwach«, »Rat« und »Hoffnung«. Anderswo lese ich als Definition von »Trost« schlicht: »Seelenmassage«. Das gefällt mir. Das ist eine treffende Beschreibung. Bleibt nur noch die Frage, mit welchen Techniken, Aromen und Hilfsmitteln man die Seele am besten massiert. Im Internet heißt es dazu: »Trost kann durch Worte, Gesten und Berührung gespendet werden.« Ungenauer geht es kaum. Zeit, diese allgemeinen Begriffe mit konkretem Inhalt zu füllen. Zeit, das Internet zu ignorieren. Zeit für echtes Leben. Nur eine Kleinigkeit will ich noch recherchieren, ganz kurz. Ich suche das »Gegenteil von trösten«. Die Antwort ist klar und simpel: »kränken, verletzen.« Das kann ich nachvollziehen, das kommt mir bekannt vor. Direkt muss ich daran denken, wie eine Freundin zwei Tage nach meiner Krebsdiagnose auf die Nachricht mit einem seufzenden »Ach Mensch, du hast aber auch immer so viel Stress« reagierte. Wollte sie mir sagen, ich sei selbst schuld an meinem Tumor? Für sie war diese Aussage ein Schutzmechanismus. Das weiß ich heute. Trotzdem: nicht okay. Gar nicht okay.
Das Gegenteil von »trösten« ist »verletzen«. Allem voran geht die Misere, wegen der man überhaupt Trost braucht. Deshalb gehts auch in dieser Geschichte erst einmal dorthin: an den Anfang meiner persönlichen Misere.
LEIDEN
Das Krankenhaus ist ein hässlicher grauer Betonklotz in bester Berliner Kiez-Lage. Zum ersten Mal waren dieser Klotz und ich uns begegnet, gleich nachdem ich in die Stadt gezogen war und meine neue Nachbarschaft erkundet hatte. Meinen ersten Geburtstag als Neu-Berlinerin feierte ich mit Freund:innen, Kaltgetränken, Straßenmusik und Schwänen auf einer Wiese unweit des Krankenhauses, wo nicht nur die Sonne am längsten hin scheint, sondern sich auch die Besuchstoiletten der Klinik in Laufweite befinden. Das, so mein damaliger Gedanke, sollte hoffentlich die einzige Gelegenheit bleiben, bei der ich dieses Krankenhaus betreten würde. Schon im Eingangsbereich tummelte sich dort die Crème de la Crème der Kiez-Freak-Parade, umhüllt von Zigarettenduft, Anti-Tauben-Musik und neonfarbenen Plüschteddys in Geschenkfolie. Das reinste Gruselkabinett. Wer hier landet, dachte ich, ist wirklich arm dran.
Gut sieben Jahre später saß ich in diesem Gebäude auf einem Holzstuhl mit roten Lederpolstern, blickte auf eine gigantische, in warmen Farben auf eine Leinwand gedruckte Blüte, aufgehängt an der rot tapezierten Wand. Neben mir stand eine Vase mit echten Blumen, daneben eine Wasserkaraffe, Trinkgläser. Hier im Brustzentrum war man bemüht, eine »freundliche« Atmosphäre zu schaffen. Unverschämt kam mir das jetzt vor, angesichts des ganz und gar unfreundlichen Tumors, den die Ärztin in meiner Brust gefunden hatte. »Es tut mir leid«, sagte sie, »aber Sie sind das eine Prozent.«
Meistens ist es erstrebenswert, zum »einen Prozent« zu gehören: die Reichsten, die Ältesten oder Jüngsten, die Schnellsten, die mit der besten Stimme, die mit Doktortitel. Die Gruppe aber, zu der ich jetzt zählte, war die der Menschen, die weder durch hohes Alter noch durch eine familiäre Vorbelastung zur Risikogruppe für eine Brustkrebserkrankung gehörten – und die es trotzdem erwischt. Der ultimative doppelte Pech-Jackpot. Für den Moment also fühlte sich dieser Ort, das Brustzentrum in der klotzigen Klinik, und seine Eigenschaft, die Besucher:innen komplett von der Leichtigkeit, der Freiheit des lebendigen Draußen abzuschirmen, genauso an, wie ich ihn damals an meiner Geburtstagsfeier eingeschätzt hatte: Grau (trotz des vielen Rot), trist, trostlos, ehrlich gesagt, einfach zum Kotzen. Ich war nun Teil dieser Freak-Parade, vor der ich mich damals gegruselt hatte, und ja, im Vergleich zu meinem früheren Leben war ich arm dran.
Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehen konnte: Mit meiner Einschätzung der Trostlosigkeit dieses Ortes lag ich völlig falsch. Klar, Leid gab es hier zuhauf; wo man hinblickte, schrie sie einen an, die Misere. Doch genau deshalb war hier so viel Raum für Hoffnung, so viel Raum für Trost. Vermutlich war das Krankenhaus der zugleich traurigste und hoffnungsvollste Ort, den ich kannte. Die meisten erhielten hier nach einer schlimmen Diagnose einen Ausblick auf Heilung oder zumindest auf Besserung. Die meisten gingen hier lebend wieder raus, oft sogar in besserem oder gesünderem Zustand als zuvor, die meisten konnten ihre Liebsten wieder in die Arme schließen. Einige wurden hier sogar geboren. Trost war hier überall, er war nur nicht so leicht zu erkennen, musste er doch erst einmal ankommen gegen all dieses Leid. Ob das vorüberging, hing von den medizinischen Fakten ab, lag mitunter in den Händen der Expert:innen und Übermittler:innen dieser Fakten; es lag an den Menschen, die hier arbeiteten, die allzu oft über »Trost« oder »trostlos« entschieden. Und so geschah es auch mir, dass ich in meiner tieftraurigen Schock-Trance wie in einer anderen Galaxie Ärzt:innen sagen hörte: »Das ist eine der besten Tumorarten, die man haben kann«, »Dass er so aggressiv ist, heißt, er ist gut behandelbar«, »Die Forschung hierzu ist sehr fortgeschritten«. Ich hörte aber auch Sprüche wie: »Da kommt was auf Sie zu«, oder: »Das ist wirklich Pech.« Empathie ist, das hat vermutlich jeder Mensch schon einmal erfahren, leider nichts, das berufsbegleitend kommt.
»Eine der besten Krebsarten, die man haben kann«, fühlte sich für mich anfangs an wie blanker Hohn. Am besten ist schließlich immer noch der Krebs, den man gar nicht erst bekommt. Und wenn »meine Krebsart« geradezu großartig war, warum reichte dann nicht eine kleine, brusterhaltende OP, warum musste ich trotzdem eine Chemotherapie machen? Es war doch Allgemeinwissen aus Filmen und Romanen, dass es einem dabei nicht gutgehen kann, dass man erst seine Haare, dann sein Gewicht, dann die Lebendigkeit in den Gliedern verliert. Würde sich das alles überhaupt lohnen? Ich war wütend. Ich war geschockt. Ich war traurig. Ich wollte mein altes Leben zurück.
Stattdessen stand mir die unsägliche Aufgabe bevor, meine Mitmenschen über meinen Zustand aufzuklären. Dafür wurde »eine der besten Krebsarten, die man haben kann« zum Strohhalm, an den ich mich klammerte. Und mit dem ich paradoxerweise alle anderen tröstete. Denn während ich das alles nicht glauben konnte und mein größter Horror die Vorstellung einer Chemotherapie war, wollten die mir nahestehenden Menschen schlicht hören, dass ich überlebe. Wahrscheinlich werde ich niemals die Orte vergessen, an denen ich stand, die Hauswände, auf die ich blickte, während ich das Unaussprechliche ins Smartphone sagte: »Ich habe Brustkrebs« – und dann ganz schnell: »Aber es ist einer, der gut heilbar ist, es wird nur ein harter Sommer, der Tumor ist super gut erforscht.« Mein Erklärungseifer konnte die Traurigkeit und die Angst am anderen Ende der Leitung nie übertönen. Das schmerzliche Gefühl, meiner Familie und meinen Freund:innen einen Kummer zu bereiten, den ich selbst nicht fassen konnte, übermannte mich. Mir war schlecht, ich war müde, wollte einfach nur schlafen, so lange, bis all das nicht mehr wahr war.
Ich war aber auch trotzig. Dass ich meinen Friseurtermin zwei Tage nach der Diagnose nicht absagen, meine Konzerttickets für denselben Abend nicht verkaufen wollte, stieß bei meiner Schwester und meinem Mann, mit denen ich gerade die deprimierteste WG der Welt bildete, auf Unverständnis. Aber sollte ich schon jetzt, wo ich gar nichts tun konnte, dieses neue Schicksal alles bestimmen lassen? »Da kommt was auf Sie zu«, hatte die Ärztin bei der Mammographie gesagt. Was das war, war zu abstrakt, zu groß, als dass ich es zu diesem Zeitpunkt hätte einschätzen können. Woher konnte ich wissen, ob ich in wenigen Wochen und Monaten noch in der Lage sein würde, auf Konzerte zu gehen, ob ich noch Haare hatte, die ich frisieren lassen konnte? Deshalb lagen sich an Tag 3 »ac« (after cancer), meiner neuen Zeitrechnung meine Friseurin und ich weinend in den Armen, bevor wir mein langes, dickes, glänzendes Haar in extra schöne Locken legten, die ich zum Konzert von Florence + the Machine trug. Die Aura von Florence Welch haute mich um, ihre Energie, die Songtexte trafen mich wie Blitze, genau wie die Erkenntnis, dass ich seit Jahren wieder anfangen wollte zu tanzen, es nie getan hatte. War diese Krankheit die Strafe dafür, dass ich all meine Träume hatte Träume bleiben lassen? Ich wollte in den Arm genommen und festgehalten werden. Am liebsten von der energiegeladenen Sängerin, so wie die Glücklichen in der ersten Reihe. An ihrer Stelle hätte ich vermutlich nie wieder losgelassen. Aber ich saß weit weg, auf der Tribüne, in Reichweite nur meine Begleitung, die emotional mit mir und meiner Diagnose überfordert war.
Alles erschien surreal. Ich ging mit den Mitgliedern meiner Depri-WG shoppen, weil sie es unbedingt wollten. Schon »bc« (before cancer) ging ich ungern einkaufen, brachte es aber nicht übers Herz, dem Vorschlag zu widersprechen. Ich hatte das Gefühl, es war ihnen wichtig, dass ich irgendein Kleidungsstück kaufte, und ich tat ihnen den Gefallen, schließlich war meine Misere der Grund für ihre Misere. Am Wochenende saß ich an zwei Geburtstagstafeln, an denen ich die Traurigkeit meiner Liebsten lauter hörte als das Stimmengewirr einer ganzen Festtagsgesellschaft. Ich passte Momente ab, in denen ich weiteren engen Familienmitgliedern die Neuigkeiten überbrachte. Ich fühlte mich ausgeschlossen, wenn ich merkte, wie sie in anderen Zimmern zusammenstanden und über »meine Situation« flüsterten. Ich baute eine Höhle mit meiner Nichte, legte mich hinein und schlief.
In der zweiten Woche versuchte ich, den neuen Mittelpunkt meines Lebens zu ignorieren. Während mein Mann Arzttermine für mich vereinbarte, waren meine Tage gefüllt mit Lesungen und Interviews zu meinem aktuellen Buch. Ich wollte keinen Platz machen für etwas, das ich nicht in mein Leben gebeten hatte. Wenn ich auf der Bühne saß, konnte ich die Diagnose vergessen, bis ich abends ins Bett stieg und im Sitzen einschlief, weil ich Angst hatte, beim Liegen den Tumor in meiner Brust zu spüren. Jeden Tag schlug ich die Augen auf mit der Hoffnung, alles sei nur ein unfassbar schrecklicher Traum gewesen. Jeden Tag wurde ich enttäuscht.
Es waren jetzt nur noch mein Mann, ich und eine schier endlose Liste an Arztterminen. Zum ersten Mal traf ich Freund:innen, die noch nichts von meiner Diagnose wussten, und denen es zu erzählen ich nicht die Kraft besaß. Dabei war es rückwirkend genauso anstrengend, nichts zu sagen, denn wie konnte ich erzählen, »was bei uns so los ist«, ohne den Tumor in meiner Brust zu erwähnen? Die Urlaubspläne von Freund:innen zu hören, machte mich traurig. Wann würde ich je wieder Urlaub machen können? Filmabende lenkten mich ab. Wir schauten Frida. Frida Kahlo, die ihr gesamtes Leben von körperlichen und seelischen Schmerzen geplagt war, die trotzdem immer vor Lebenslust strotzte, sie faszinierte mich schon lange. Jetzt wurde sie zum Vorbild, denn ich fühlte mich ihr im Leid verbunden. Und ihre Worte sind die ersten, die es schaffen, mich zu beruhigen:
Wir können am Ende des Tages viel mehr ertragen, als wir denken.
Salma Hayek als Frida Kahlo in Frida
In Woche drei nahm der Terminmarathon so richtig Fahrt auf. Während ich bei einem meiner Auftraggeber allabendlich zum Reporterinnendienst erschien, schluckte ich tagsüber radioaktive Kontrastmittel, meditierte mich durch CT, Knochenszintigraphie, Blutabnahmen. Ich wurde vorstellig beim Sozialdienst, bei der Psychoonkologie, stapelte Broschüren, Anträge, Informationsblätter. Ich begann, mir Hormonspritzen in den Bauch zu stechen, denn man hatte mir nahegelegt, vor dem Beginn der Chemotherapie Eizellen einzufrieren, da ich möglicherweise unfruchtbar würde. Es blieb mir nicht viel Zeit, Entscheidungen zu treffen, und in diesem Fall beruhigte mich der Gedanke, dass mir dies wohl nicht empfohlen worden wäre, wenn man nicht davon ausginge, dass ich so lange leben würde, bis ich mich tatsächlich mit einem Kinderwunsch befassen könnte. Wäre, würde, könnte.
Ich lernte meine behandelnde Onkologin kennen und war erleichtert, weil ich mich in guten Händen fühlte. Neben ihrer Ausbildung, ihrem Ruf in der Fachwelt war ich vor allem beeindruckt von ihrem makellosen Äußeren, ihren glänzenden, langen Haaren, ihren weichen, perfekt manikürten Händen. Später erst fiel mir auf, wie absurd diese Vollkommenheit gegenüber der Erscheinung der aus meiner Sicht eher lädierten Brustkrebspatientinnen war. Mich selbst motivierte ihr Auftreten irgendwann, mich zu jedem Krankenhaus- und Arzttermin wie zu einem wichtigen Geschäftstermin zu kleiden – wenn schon nicht mit wallender Mähne, so zumindest mit klackenden Stiefeletten und viel Schmuck. Vielleicht konnte ich die Krankheit überlisten, wenn ich mich ihrer Drohung der äußeren Verwahrlosung widersetzte?
In Woche vier stieß meine Verdrängung an ihre Grenzen. Die vielen Termine waren nicht mehr mit meinen Verpflichtungen bei manchen meiner Auftraggeber:innen zu vereinbaren, also suchte ich Gespräche mit meinen Ansprechpersonen. Die Worte »Ich habe Brustkrebs« kamen mir nicht ohne Tränen über die Lippen, und die Reaktionen waren überraschend unterschiedlich. Von Geständnissen eigener vergangener Erkrankungen bis zu als Verständnis getarnter offensiver Rücksichtnahme, die bald im Ausschluss aus Besprechungen und neuen Projekten, schließlich sogar von der Weihnachtsfeier gipfelte, war alles dabei. Schnell bereute ich, mein Arbeitsumfeld eingeweiht zu haben, denn es passierte genau, was ich befürchtet hatte: Ich wurde abgeschrieben. Was ich erlebte, war die Stigmatisierung kranker Menschen in unserer Gesellschaft, die unter anderem dazu führt, dass Unzählige ihre Leiden vor ihren Arbeitgeber:innen und Kolleg:innen verschweigen, ja sogar dazu, dass Sozialdienste teilweise davon abraten, bei der Arbeit offen mit chronischen Erkrankungen umzugehen. In meiner noch frischen Misere konnte ich dieses Muster noch nicht erkennen. Ich war sicher: Der Tumor allein war verantwortlich zu machen, er war im Begriff, mir die (berufliche) Freiheit, die Erfolge zu nehmen, die ich mir mühsam in den letzten Jahren erarbeitet hatte. Diese Macht wollte ich ihm nicht zugestehen. Und so kam es, dass ich wenige Stunden nach dem unter Narkose durchgeführten Eingriff der Eizellenentnahme (»Follikelpunktion«) vor meinem Kleiderschrank zusammenbrach, um ein paar Minuten später die Tränen wegzuwischen, mich umzuziehen und auf einem Podium mit Gregor Gysi zu diskutieren.
Unterdessen nahm der medizinische Terminmarathon weiter an Fahrt auf. Um abklären zu lassen, ob mein Herz stark genug für die giftigen Medikamente war, die meinen Körper bald durchströmen würden, saß ich – als einzige weibliche Person unter etwa 60 Jahren – im Wartezimmer eines Kardiologen und bekam einen ersten Geschmack davon, wie viel Zeit ich in den nächsten Monaten mit Warten verbringen würde. Ich führte währenddessen umständliche Telefonate mit meiner Krankenkasse darüber, warum ich nicht mit den frisch entnommenen Eizellen direkt einen Schwangerschaftsversuch starten konnte. Die Sachbearbeiterin bestand darauf, dass ich einen Antrag hätte stellen und abwarten müssen, ob dieser bewilligt wird. Dass ich meine Chemotherapie nicht von langer Hand geplant hatte, wollte sie nicht verstehen. Unter Verzweiflungstränen setzte ich mich zurück ins Wartezimmer, das perfekte Sinnbild eines »begossenen Pudels«. Mitleiderregend genug, um von der Sprechstundenhilfe endlich in das winzig kleine Herzecho-Zimmer geschickt zu werden, wo ich mich, bevor ich erfuhr, dass mit meinem Herzen alles in Ordnung war, oberkörperfrei, mit Gel beschmiert und einen Ultraschallkopf zwischen den Rippen von diesem alten Mann in Arztkittel mein Knie tätscheln und mich über meine Krebserkrankung belehren lassen musste. Ich war müde. Ich hatte resigniert. Dabei hatte die eigentliche Behandlung noch nicht einmal begonnen.
Noch am selben Tag sollte ich die Benutzung der Kühlhaube lernen, die mich vor einem Haarverlust durch die Chemotherapie bewahren sollte, weiterhin eine meiner größten Sorgen. Die Einführung in die Handhabe allerdings ließ vermuten, dass es ein hartes Unterfangen werden würde. Haube auf nassen Haaren, Helm auf Haube, Unterkühlung auf Kopfhaut, früher in den Chemoraum kommen als alle anderen, länger bleiben. Die Frau, die zeitgleich mit mir in die Geheimnisse der Haarerhaltung eingewiesen wurde, sagte, sie sei sich nicht sicher, ob sie das alles aushalten würde. »Dann machen Sie es nicht«, entgegnete ihr die Krankenschwester, und die Frau flüsterte, dass sie es auch nicht möchte, die meiste Zeit ohnehin Kopftuch trägt. Aber ihre Tochter, die wolle nicht, dass ihrer Mutter die Haare ausfallen.





























