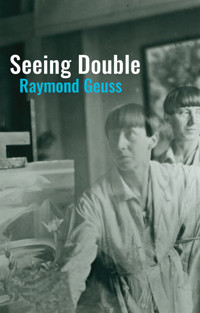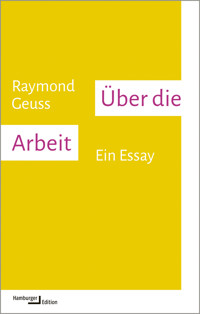
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hamburger Edition HIS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ende der 1980er Jahre schloss nördlich von Philadelphia das Stahlwerk seine Tore, in dem Raymond Geuss' Vater lange Zeit gearbeitet hatte. Sein Onkel, ein Landwirt in Indiana, brauchte bald einen zweiten Job, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Auch anhand seiner Familiengeschichte zeigt der Philosoph in seinem neuen Buch, dass Arbeit, wie wir sie in westlichen Gesellschaften kannten, verschwindet. Automatisierung und Outsourcing haben einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel in Gang gesetzt, und Geuss führt seine Leserinnen und Leser durch diese Umbrüche bis zur die Gegenwart dominierenden Amazonifizierung. Was ist Arbeit? Wie ist sie organisiert? Und wie wird Arbeit in Zukunft aussehen? In seinem hellsichtigen Essay verbindet Raymond Geuss philosophische Überlegungen mit ökonomischen und historischen Reflexionen. Auch mit der Arbeitsethik und dem Unbehagen an der Arbeit befasst er sich, das so alt ist wie die Arbeit selbst. Wir sollten uns, so Geuss, von den Pathologien unendlichen Wachstums befreien. Das bedeutet auch, Arbeit endlich nicht mehr als Konzept stetig steigender menschlicher Produktivkraft und Anstrengung zu begreifen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Raymond Geuss
Über die Arbeit
Aus dem Englischen von Martin Bauer
Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung
Mittelweg 36
20148 Hamburg
www.hamburger-edition.de
© der E-Book-Ausgabe 2023 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-488-6
eISBN 978-3-86854-489-3
© der deutschen Print-Ausgabe 2023 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-372-8
© der Originalausgabe 2021 by Cambridge University Press
This translation of »A Philosopher Looks at Work«
is published by arrangement with Cambridge University Press
Gestaltung: Lisa Neuhalfen, Berlin
Inhalt
Vorwort
1Was ist Arbeit?
Anstrengung
Körperliche und moralische Anstrengung | Müßiggang, Spiel, Ferien und Ruhestand
Notwendigkeit
Individuelle und soziale Notwendigkeit | Geld und Kredit
Objektivität
Güter und Dienstleistungen | Autotelisches
2Die Organisation von Arbeit
In unserer Welt
Berufe | Karrieren und Professionen | Berufungen
Andere Tätigkeitsarten
Die Nichtexistenz von Autarkie | Jagen und Sammeln | Pastoralismus | Landwirtschaft | Handwerk
3Die Anthropologie und Ökonomie der Arbeit
Faulenzer
Zwang | Begründen | Anreize | Solidarität | Arbeitsethik
Das aktive Tier
Rhythmus, Ausdruck und Plackerei | Arbeitsteilung | Routine und inkrementales Handeln
Die Ökonomien von »Ich und Wir«
Ökonomie im Schatten von Descartes und Locke | »Das besitzergreifende Ich« | Informative und weniger informative Varianten
4Unbehagen an und Zukunft der Arbeit
Formen radikalen Unbehagens
Arbeit abschaffen | Entfremdung überwinden | Nichtinstrumentelle Sorge
Die Zukunft der Arbeit
Automatisierung und Prekarität | Outsourcing und Amazonifizierung | Ideologie | Bullshit Jobs | Politik | Zwei Geschichten über die Zukunft
Fazit
Lektüreempfehlungen
Unverzichtbare Klassiker | Anregende jüngere Literatur | Belletristische Texte | Weitergehende philosophische Überlegungen | Geschichte und Anthropologie
Vorwort
Im Sommer 1953, ich war sechs Jahre alt, zog meine Familie in eine Siedlung etwa zwanzig Meilen nördlich von Philadelphia, die für Arbeiter der Fairless Works von US Steel errichtet worden war. Die neu gebaute Fabrik stand auf einer sumpfigen Halbinsel im Delaware, einem Fluss, der an dieser Stelle Pennsylvania von New Jersey trennte. Mein Vater war einer der ersten Arbeiter, die man angeworben hatte. In den 1960er Jahren und während der frühen 1970er beschäftigte das Unternehmen 8000 Werktätige, weitere 5000 waren in den Zulieferbetrieben beschäftigt, die um die Hauptwerkshallen verstreut lagen. Um die jüngst eingetroffenen Arbeiter, die in großer Zahl und häufig von weither gekommen waren, seelsorgerisch zu betreuen, hatte die katholische Kirche neue Gemeinden gegründet, zu denen eigene Schulen gehörten. Zur Messe gingen wir am Sonntag in die Kirche des Heiligen Josephs der Arbeiter, und ich besuchte die von dieser Kirchengemeinde betriebene Grundschule. Dass sich unsere Pfarrei auf den heiligen Joseph als einen Mann berief, der von seiner eigenen Hände Arbeit lebte, war eine religiöse Sanktionierung der Rolle, die das Leben, wie man annahm, für uns vorsah – jedenfalls für all die Jungen.
Im Jahr 1975 setzte ein massiver Rückgang der Beschäftigung ein, weil die Regierung Venezuelas die dortige Eisenerzförderung verstaatlichte. Mit dem Plan, eben dieses Eisenerz zu verarbeiten, das in Venezuela kostengünstig gefördert, über den Hafen von Philadelphia importiert und mit Lastkähnen flussaufwärts angeliefert wurde, war die Eisenhütte gegründet worden. 1981 erhielt US Steel für anstehende Modernisierungsmaßnahmen enorme staatliche Unterstützung, nutzte die Gelder jedoch für spekulative Geschäfte, die fehlschlugen. Das Unternehmen schien sein Interesse an der Stahlproduktion verloren zu haben. Die letzten vierzig Arbeiter, die in einem düsteren Winkel der Fabrik die noch verbliebenen Maschinen bedienten, verloren 1988 ihre Arbeit. Man hatte sie überflüssig gemacht. Auch die Gemeinde des Heiligen Josephs der Arbeiter löste sich auf. Das Kirchengebäude, die Schule, das Pfarrhaus sowie das Kloster der Nonnen, die als Lehrerinnen in der Schule gewirkt hatten, wurden 2017 abgerissen. Auf dem Gelände ließ ein örtlicher Immobilienentwickler dann ein Altersheim bauen.
Die Geschichte, die ich erzählt habe, ist banal. In den älteren Industrienationen könnten Millionen von Leuten Ähnliches berichten. Mein Impuls, das vorliegende Buch zu schreiben, geht nicht zuletzt auf den Wunsch zurück, mir Rechenschaft über dieses Kapitel meiner Lebensgeschichte abzulegen, schließlich weist es Parallelen zum Leben einer Menge Menschen in Gesellschaften des vormals industrialisierten Westens auf. Was war die »Arbeit« gewesen, um die sich unser Leben drehen sollte? Welche Rolle hat sie in unserem Dasein tatsächlich gespielt? Und wie haben sich die Dinge in der Zwischenzeit verändert? Lassen sich plausible Annahmen über den zukünftigen Stellenwert von Arbeit formulieren? Diese Fragen umschreiben insofern ein philosophisches Projekt, als zumindest einer der traditionellen Ansprüche, wie sie die Philosophie seit Sokrates anmeldet, darin bestand, zur Selbsterkenntnis beizutragen, das heißt ein Wissen um den eigenen Ort in der Welt, der Geschichte, der Gegenwart und in möglichen Zukünften zu gewinnen. Sich selbst und das eigene Erleben in der sozialen Welt zu verorten, heißt, diese Erfahrungen in einem Gewebe nicht nur von Tatsachen, sondern auch von Hoffnungen, Bestrebungen, Erwartungen, Werten und Ängsten zu lokalisieren, die den Rahmen für die Lebensführung von Individuen wie Gruppen aufspannen. Selbstverständlich ist es wichtig, die eigenen Wünsche oder Befürchtungen nicht mit der Wirklichkeit zu verwechseln, andererseits kann niemand das soziale Leben verstehen, ohne den Vorstellungen vom Himmel und derjenigen Hölle Rechnung zu tragen, die eine Gesellschaft für ihren größten Schrecken hält.
Leider zwingt uns der Zustand zeitgenössischen Philosophierens dazu, weiter auszuholen, soll das Thema »Arbeit« angemessen behandelt werden. Eine Garantie dafür, von der engstirnigen Philosophie, wie sie als akademisches Fach gegenwärtig in den Universitäten praktiziert wird, ein aufschlussreiches Verständnis des Phänomens Arbeit angeboten oder einen besonders erhellenden Zugang zu ihm bereitgestellt zu bekommen, gibt es nämlich nicht. Offen gesagt hat sich die Philosophie in jüngster Zeit so gut wie gar nicht mit »Arbeit« beschäftigt, wofür nach meiner Vermutung nicht zuletzt politische Gründe verantwortlich sind. Die nachhaltigsten theoretischen Überlegungen zu Arbeit und den mit ihr verbundenen Phänomenen verdanken wir Denkern und Denkerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts, die allesamt zutreffend als »sozialistisch« (in der denkbar weitesten Bedeutung des Begriffs) gelten können, wobei sich auch anarchistische Einsprengsel im Amalgam dieser Reflexionen finden. In den Augen vieler Zeitgenossen kam der Untergang der Sowjetunion 1989 – ob nun zu Recht oder zu Unrecht – einer grundsätzlichen Widerlegung eben der Sichtweise gleich, die charakteristisch für diese Gruppe von Theoretikern war. Aus naheliegenden Gründen haben die etablierten politischen, unternehmerischen und kommerziellen Interessen des Westens diese Entwicklung begrüßt. In einer solchen Atmosphäre hätte es ausgesprochen großer Entschlusskraft, Unabhängigkeit im Denken und erheblicher Konzentration bedurft, sich des Themas »Arbeit« anzunehmen.
Im Verlauf der 1970er Jahre fand ein Strukturwandel der Arbeit statt, der graduelle Veränderungen (die Trägheit des Überbaus ist erheblich) unserer Arbeitsauffassung nach sich zog. Allmählich büßte ein für unsere Gesellschaft bestimmendes Paradigma seine Zentralität ein. Es schien kein selbstverständliches Faktum mehr zu sein, dass große Bevölkerungsteile ihr erwachsenes Leben mit irgendeiner Art kraftzehrender Tätigkeit, in der Regel mit industrieller Fabrikarbeit, verbringen.
Insbesondere zwei Faktoren waren bei diesen Veränderungen wirksam. Die Mechanisierung und Automatisierung von Arbeitsprozessen, die einen deutlichen Rückgang der in der industriellen Fertigung Beschäftigten herbeiführte, war der erste Faktor. Begleitet wurde dieser Beschäftigungsrückgang von einer Zunahme der Beschäftigung im sogenannten Dienstleistungssektor. Von der Industriearbeit alten Stils unterscheiden sich Dienstleistungen in mehrfacher Hinsicht. Während es typisch für die industrielle Fertigung war, dass Metall bearbeitet, also in Naturvorgänge eingegriffen wurde, konzentrierten sich Dienstleistungen auf das Management, die Organisation oder die Kultivierung von Menschen. Der Wandel von Arbeitsvollzügen – im Vergleich zum Anteil der direkten Produktion von Dingen gewannen Verwaltung, Versorgung, Unterstützung, Beförderung, Marketing und Buchhaltung an Bedeutung – zog weitreichende Konsequenzen nach sich. Sie schlugen auf die Vorstellungen durch, die sich die Menschen davon machten, was ihr Leben sei und wie es zu führen wäre.
Werkstoffe, Stahl und industriell gefertigte Güter wurden allerdings weiterhin benötigt, weshalb sich der zweite Faktor darin bemerkbar machte, dass die industrielle Produktion aus den nationalen Zentren in die Peripherien ausgelagert wurde, am Ende so gut wie vollständig nach Asien. Selbstverständlich wirkte sich dieses »Outsourcing« in einigen Ländern deutlicher aus als in anderen – in Großbritannien etwa viel stärker als in Deutschland. Für den Westen war die Industriearbeit damit um die 1990er Jahre deutlich weniger zentral und sichtbar als zuvor. Das damals aufgekommene Klischee vom Anbruch eines postindustriellen Zeitalters besaß folglich einige Stichhaltigkeit. Auch die Politik blieb von diesem Wandel nicht unberührt, die Gewerkschaften hatten, um nur ein Beispiel zu erwähnen, eine Schwächung ihres Einflusses hinzunehmen.
Zu meiner Überraschung ging mir beim Schreiben dieses Buches auf, dass es weniger in die Gattung zeithistorischer Analysen gehört als vielmehr zum Genre der historischen Anthropologie. Es liefert eine Momentaufnahme aus derjenigen Arbeitswelt, die gerade vor unseren Augen mit bemerkenswerter Geschwindigkeit untergeht, wenn sie nicht schon vollständig verschwunden ist. Alle Auseinandersetzungen mit Arbeit, die mit Begriffen wie Ausbeutung, Bedürfnis, Arbeitsethik und Objektivität operieren, spiegeln neue Wirklichkeiten, in denen die »Gig-Economy« zu einer ganz eigenen Lebensweise geworden ist, nicht mehr wider. Auch die Vorstellung, mehr oder weniger jedes Gesellschaftsmitglied müsse – abgesehen von einer Handvoll ungemein Privilegierter – einen Großteil seiner Lebenszeit der Arbeit widmen, wirkt eigentümlich archaisch, obwohl sie für unser aller Lebensführung einmal weichenstellend war. Man muss nur erwähnen, dass Rentner wie ich im Gegensatz zu früheren Zeiten inzwischen einen nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung ausmachen. Zwar mag zutreffen, dass Rentenempfänger auch schon in der Vergangenheit über ihre Pensionsgrenze hinaus weitergearbeitet haben, doch zählen sie heute nicht mehr zur aktiven Erwerbsbevölkerung, selbst wenn sie minder bezahlten Tätigkeiten nachgehen. Die Aussicht, dass viel mehr Menschen als früher mit zehn oder sogar noch mehr Jahren rechnen dürfen, in denen sie dank ihrer Pensionen, Ersparnisse, unter Umständen auch eigener Investitionen und aufgrund unterschiedlicher Sozialleistungen von notwendiger Erwerbsarbeit entbunden sind, markiert eine bedeutsame sozialhistorische Zäsur. Dass die Rentenbezüge für viele ihrer Empfängerinnen und Empfänger unzureichend sind und derartige Transferleistungen ständig durch die politische Praxis von Regierungen infrage gestellt werden, steht außer Zweifel und ist keineswegs bedeutungslos, nur betrifft es den Punkt nicht, auf den ich hinauswill.
Während der 1960er Jahre konnten diejenigen, die diese Dekade durchlebt haben, für einen kurzen Moment auf eine Welt ohne den Zwang zur Arbeit blicken und ohne die anhaltende Sorge, womöglich keine Arbeit zu finden. Als ich 1963 mein Studium begann, kam ein Stipendium für die anfallenden Studiengebühren auf, sodass ich Geld lediglich zur Bestreitung des Lebensunterhalts brauchte, was in meinem Fall hieß, vorrangig zur Finanzierung kostspieliger Bücher aus dem Ausland. Die US-amerikanische Wirtschaft durchlief ihren (letzten) echten Boom, was mir in den Sommern erlaubte, mit sechswöchiger Arbeit in einem Stahlwerk genug Geld zu verdienen, um mich ein Jahr lang oder sogar länger selbst zu finanzieren. Solche gut bezahlten Jobs für Ungelernte waren ohne Schwierigkeiten zu bekommen, einfach verfügbar, wenn man dringend Geld brauchte. Natürlich musste man sich auch damals nach Arbeit umsehen, freilich nur, falls das Bedürfnis nach einem Job dringlich und spürbar war. Allerdings musste die Suche nach Arbeit niemanden beunruhigen, für die eigene Lebensführung war sie jedenfalls nicht bestimmend. Unter solchen Voraussetzungen schienen sechs Wochen vergleichsweise anstrengender Arbeit einmal im Jahr keine große Sache zu sein – nicht einmal während dieses einen Sommers, in dem ich bei Temperaturen von deutlich über 40 Grad täglich die Wände der Fabrikkantine abzuschrubben hatte, nur um sie gleich am nächsten Morgen wieder mit einer dicken Schicht verschmutzt zu finden, die aus verdampftem und verklumptem Bratöl, Industriefett, Kohle- und Eisenstaub, toten Fliegen und wer weiß sonst noch was bestand. Für das kurze Intervall von sechs Wochen einen Acht-Stunden-Arbeitstag damit zu verbringen, etwas anderes als sonst zu tun, fühlte sich beinahe wie eine durchaus willkommene Unterbrechung an.
Doch sollte dieser Schnappschuss aus der Mitte der 1960er Jahre, der den Bedeutungsverlustes von Arbeit in einer Welt festhält, die keine Knappheit mehr kannte, das Ende dieses speziellen Wirtschaftsbooms nicht überleben – Ende der 1980er Jahre wurde das Stahlwerk, in dem mein Vater (und ich) gearbeitet hatten, definitiv geschlossen. Zudem hatte der bereits 1972 unter dem Titel Die Grenzen des Wachstums veröffentlichte Bericht des Club of Rome offengelegt, wie unhaltbar einige der doch eher naiven Vorstellungen waren, die eine grenzenlose Steigerung der Industrieproduktion bis zu einem Zustand in Aussicht gestellt hatten, in dem es keine Knappheiten mehr geben werde. Hatte es für einen flüchtigen Augenblick so ausgesehen, als ließe sich der Durchbruch zu einer Gesellschaft bewerkstelligen, die aufgrund des Vorzugs, Knappheit irgendwie beseitigt zu haben, der notwendigen Arbeit eine im menschlichen Leben allenfalls noch untergeordnete Stellung würde beimessen können, bot sich nun der Ausblick auf eine Gesellschaft, die bestimmt nicht jenseits der Knappheit angesiedelt war, in der die Arbeit im traditionellen Sinne jedoch allmählich verschwinden würde. Der herkömmliche Beruf würde zu einer Sache der Vergangenheit und die Automatisierung im Endergebnis dafür sorgen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr beschäftigt werden könne.
Obwohl die Welt traditioneller Arbeit weitgehend untergegangen ist, hat sie die Art und Weise, wie Menschen über ihre Arbeit und ihr Leben nachdenken, noch ziemlich fest im Griff. Also verlangt diese Trägheit des Begrifflichen einen Versuch, uns (auch) mit diesem Umstand zu befassen, wollen wir unsere Gegenwart verstehen. Erst im letzten Kapitel des Buches werde ich ein paar Überlegungen zu möglichen Zukünften anstellen, wobei diese Spekulationen lediglich die Absicht verfolgen, weiteres Nachdenken anzuregen.
Bei Brian O’Connor, Lorna Finlayson und Richard Raatzsch möchte ich mich für die Lektüre und Kommentierung früherer Fassungen dieses Textes bedanken, bei Martin Bauer, Zeev Emerich und Peter Garnsey für Diskussionen der behandelten Themen. Hilary Gaskin hat die Abfassung dieses Buches in Auftrag gegeben. Mit dem ihr eigenen Scharfsinn hat sie die sich ablösenden Entwürfe gelesen und kommentiert. Für die Verbesserungen einzelner Passagen, die sie mir die ganze Zeit über empfohlen hat, sowie ihre vielen guten Vorschläge zur generellen Anlage meiner Argumentation, bin ich ihr zu großem Dank verpflichtet.
1Was ist Arbeit?
»Wir alle müssen arbeiten«, pflegte meine Mutter in einem Tonfall zu sagen, der vorgab, eine offenkundige Wahrheit auszusprechen, die keine weitere Begründung brauchte, auch keinen Widerspruch zuließ, allerdings eine Drohung enthielt.
Immerhin schien sie richtig zu liegen: Mein Großvater mütterlicherseits bediente einen Webstuhl in einer Textilfabrik im Westen Philadelphias, der väterlicherseits war Bäcker, bevor er bei der Eisenbahn arbeitete. In den 1940er Jahren heiratete einer der Brüder meines Vaters eine Frau, die eine Farm im südlichen Indiana geerbt hatte, die sie gemeinsam bewirtschafteten, am Ende zusammen mit ihren fünf Kindern. Da sich die Familie von dem, was der Hof abwarf, allein nicht ernähren konnte, produzierten sie vornehmlich für den Handel auf Märkten. Die Preisgestaltung und die erzielten Gewinne fielen so aus, dass sie meinem Onkel und seiner Familie erlaubten, vom Verkauf ihrer Erzeugnisse zu leben, ohne andere Arbeit annehmen zu müssen. Allerdings veränderte sich die ökonomische Lage während der 1960er Jahre, weshalb mein Onkel neben seiner Arbeit auf dem Hof einer Berufstätigkeit als Industriereiniger in einem pharmazeutischen Betrieb nachgehen musste, der in der Stadt angesiedelt war. Im Lauf der Zeit wurde seine Arbeit in der Stadt immer wichtiger. Mein Vater war Mechaniker in den Fairless Work von US Steel im östlichen Pennsylvania. Seine Arbeit bestand darin, Diesellokomotiven und Magnetkräne zu reparieren, mit denen Erz, Eisen und Stahl innerhalb des Stahlwerks transportiert wurden. Meine Großmutter verbrachte ihre Tage damit, das Haus zu putzen, Wäsche zu waschen und zu kochen, während meine Mutter als Schreibkraft, Buchhalterin, Stenotypistin und Sekretärin in verschiedenen Firmen arbeitete, die unterschiedliche Produkte kauften und wieder verkauften. Ich selbst hatte während der 1960er Jahre eine Reihe von Ferienjobs in dem Stahlwerk, einen Sommer verbrachte ich damit, als »Frachtagent« am Frankfurter Rhein-Main-Flughafen zu arbeiten. Zwischen dem Beginn meiner ersten Vollzeitanstellung 1971 und meiner Emeritierung im Jahr 2014 habe ich mein ganzes Berufsleben damit verbracht, zu lehren, Prüfungen abzunehmen, Gutachten und Evaluationen aufzusetzen sowie Bücher und Aufsätze zu schreiben. Trotz ihrer offensichtlichen Unterschiede verwenden wir für all diese Tätigkeiten das gleiche allgemeine Wort: Arbeit. Ist es sinnvoll so zu verfahren? Was ist diese Aktivität, die wir »Arbeit« nennen? Beginnen möchte ich damit, einiges zu diskutieren, was wir spontan äußern (und denken), wenn es um Arbeit geht, und einiges, das wir Arbeit entgegensetzen, also Entspannung, Muße, Spiel, Faulheit, Arbeitslosigkeit, Urlaub beziehungsweise Ferien sowie Ruhestand, Pensionierung oder Verrentung.
Unsere Vorstellung von Arbeit orientiert sich in erster Linie am Vorbild der Industriearbeit, die mein Vater und Großvater ausgeübt haben. Wir neigen dazu, Arbeit für einen klar ersichtlichen und einfachen Begriff zu halten, der jedem geläufig ist. Wird jedoch bedacht, wie Menschen über Arbeit sprechen, stellt sich die Sache, was ihnen selbst offenbar nicht entgeht, komplizierter dar. So kann ich mich gut an drei unterschiedliche Bemerkungen erinnern, die mein Vater gewöhnlich über seine Arbeit fallen ließ und die zumindest nahelegen, dass seine Begriffsverwendung eine interessante innere Gliederung aufwies oder auf unterschiedliche Dimensionen menschlichen Handelns Bezug nahm, auch wenn ihm dieser Umstand selbst nicht völlig klar gewesen sein mag. Einmal pro Tag nahm er eine schwere Mahlzeit zu sich und bemerkte häufig, eine ordentliche Portion nahrhafter Kost müsse er essen, »um mir meine Kraft für die Arbeit zu erhalten«. Also war Arbeit eine Aktivität, die Anstrengung verlangte, sich von Untätigkeit oder Müßiggang (für den man sich seine Kraft nicht bewahren muss) unterschied und die einiges an Aufwand forderte. Nach dem Essen, kurz bevor seine Schicht begann und er das Haus verließ, kündigte mein Vater an, »jetzt zur Arbeit gehen zu müssen«, wobei er gelegentlich hinzufügte, »um den Lebensunterhalt zu verdienen«. Damit war gesagt, dass sich »Arbeit« vom Rest des Lebens unterschied, was in seinem Fall hieß, ein separiertes Areal aufsuchen zu müssen, das Stahlwerk, ein von Drahtzäunen begrenztes, weiträumiges Gelände, das private Sicherheitskräfte überwachten und einige große Gebäude umfasste, die durch Straßen und lange Eisenbahnlinien miteinander verbunden waren. Sich dorthin zu begeben, war keine Frage der Wahl, nichts, das er hätte tun wollen, sondern eine Notwendigkeit – er »hatte« dorthin zu gehen. Seine dritte Äußerung war besonders bemerkenswert: In Reaktion auf jede Art von Verhalten, die er für übertrieben sorgfältig und pingelig hielt, angesichts von Ausflüchten, persönlichen Vorlieben oder eigensinnigen Einstellungen, auch in Situationen, in denen umständliche Gedankengänge ausgebreitet wurden, pflegte er zu bemerken, dass »wir hier arbeiten, damit etwas produziert wird«. Dieser Satz ging, wie ich irgendwann herausfand, auf das zurück, was sein Vorarbeiter den Männern seiner Abteilung sagte. Gemeint war, dass alles Nachdenken, Reden oder skrupulöses Moralisieren ohne Belang sei, sobald es ums Arbeiten ging. Was allein zählte, war die Qualität (und zumal die Quantität) des fertiggestellten Produkts. Arbeit drehte sich um etwas »da draußen« in der wirklichen Welt, sichtbar für alle, zählbar und greifbar, keine Sache bloßer Meinungen, kein Teil der Dramen, die sich im Innenleben abspielen. Tatsächlich produzierte das Stahlwerk sogar Bleistifte mit der Aufschrift US Steel: Wissen allein reicht nicht!. Wenn schon Wissen nicht genug war (im Vergleich zu vorzeigbaren Produktionsergebnissen), so galt erst recht, dass die Einstellung eines Arbeiters oder einer Arbeiterin gegenüber dem, was er oder sie tat, nicht zählte. Einige dieser Stifte landeten auch bei uns zuhause. Als ich anfing, im Stahlwerk zu arbeiten, ging mir dann auf, dass der markige Spruch Teil der Sicherheitspolitik im Werk war, denn dort war man der Überzeugung, Arbeitsunfälle fielen nicht in den Verantwortungsbereich des Unternehmens, seien vielmehr eine Folge von Sorglosigkeit auf Seiten der Arbeiter; denn die »wüssten«, dass sie ihre Helme und Arbeitsschuhe mit Stahlkappen tragen müssten, selbst wenn der August in einem Stahlwerk Pennsylvanias kaum erträgliche Temperaturen mit sich brachte, die das Tragen der Schuhe und Helme zu einer unangenehmen Pflicht machten. Mein Vater hat das Motto auf dem Bleistift allerdings nicht so eng ausgelegt. Für ihn wies der Spruch darauf hin, dass »Arbeit« eine abgetrennte Domäne ist, die von objektiven, ihr eigenen, internen Standards beherrscht wird. Verglichen mit derart imperativen Vorgaben, war der Zustand, etwas zu wissen, als Paradigma einer seriösen, gut begründeten, wiewohl bloß mentalen Einstellung zur Welt ohne besonderen Belang. Mit »Arbeit« in der Bedeutung, auf die der Satz »Wir arbeiten hier, um etwas zu produzieren« Bezug nahm, war für ihn die Arbeit als Teil des menschlichen Lebens gemeint – und zwar in all ihren Formen und Variationen. Ein menschliches Leben sollte genauso frei von Aufschneidereien, ausgefallenen Grübeleien und Gefühlsausbrüchen sein, wie es die Arbeit im Stahlwerk nun einmal war. Einer der Gründe für das Einverständnis meines Vaters mit dem Produktionsethos in seiner Arbeitswelt lag darin, dass niemand anging, was er aß, was er dachte, was er mochte oder nicht mochte, was seine persönlichen Gewohnheiten waren oder welche Einstellung er zu seiner Arbeit oder dem Management der Firma hatte, solange er nur dafür sorgte, dass die für den Produktionsablauf nötigen Lokomotiven und Kräne funktionierten. Die Arbeit war eine ernste Sache, das Leben eine ernste Angelegenheit und das Ethos der Stahlproduktion ein Ideal, das in allen erdenklichen Hinsichten und Gebieten anzustreben war, wollte man eine ernstzunehmende Person sein.
Nach meinem Verständnis illustrieren die drei Sätze meines Vaters drei bedeutsame Aspekte unserer gebräuchlichsten Konzeption von Arbeit:
(a)Sie ist ein Vorgang, der den Einsatz von Energie verlangt und kraftzehrend ist: Das Produkt wird nicht mühelos oder durch Zauber hergestellt, sondern durch menschliche Anstrengung (insbesondere durch die Anstrengung eines Einzelnen oder einer Gruppe von Individuen, über die gesagt wird, sie arbeiten, seien werktätig).
(b)Sie ist eine Lebensnotwendigkeit.
(c)Sie bringt ein äußerlich hergestelltes Produkt hervor, dass messbar ist und bewertet werden kann, ohne irgendetwas über den Vorgang, durch den es zustande kommt, oder die Leute, die es hergestellt haben, wissen zu müssen. (Mit Blick darauf werde ich abkürzend von »Objektivität« in einer Bedeutung dieses höchst mehrdeutigen Begriffs sprechen.)
In paradigmatischen Fällen dessen, was wir, d. h. Menschen im Westen zu Beginn des 21. Jahrhunderts, als »Arbeit« bezeichnen, sind diese drei Aspekte allesamt gegenwärtig. Arbeit im allgemein akzeptierten, ausgeprägten Sinne wird diese drei Bestimmungen als Teile eines integrierten Ganzen enthalten. Dennoch fallen alle drei Bedeutungsstränge nicht immer notwendigerweise zusammen. Vorstellbar ist, dass sie einzeln und getrennt auftreten. Das gilt sogar für einige Fälle, die uns aus der Alltagserfahrung bekannt sind, und trifft sicherlich zu, schaut man sich an, wie sich menschliche Aktivität in ihrer historischen Entwicklung formiert hat. Sind nur ein oder zwei, aber nicht alle drei Bedeutungen bei einer gegebenen Klasse von Fällen gleichzeitig im Spiel, wird es eine Frage der Beurteilung, Konvention, Tradition oder historischer Zufälligkeit und individueller Entscheidung sein, ob wir die betreffende Aktivität »Arbeit« nennen. In England tragen Blindenhunde bei ihren Einsätzen häufig ein Schildchen mit der Aufschrift »Blindenhund bei der Arbeit«, manchmal ist auch zu lesen: »Stören Sie mich nicht, ich arbeite«. Also stellt sich etwa die Frage, ob der Hund für seine Arbeit bezahlt werden sollte. Ob sich ein Roboter anstrengen kann, wäre eine nächste. Und wenn der Besuch eines Parks Büroangestellte entspannt, sodass sie ihre Arbeit im Anschluss erfrischt wieder aufnehmen können, stellt sich die Frage, ob der Park ein Arbeitsplatz ist. Kann ein Hund, ein Roboter oder ein Park Mitglied einer Gewerkschaft werden? Wie solche Fragen zu beantworten wären, vermag uns die Logik unseres Begriffsgebrauchs nicht vorzuschreiben. Begriffe sind offen, was jedoch keineswegs heißt, es sei Sache bloß willkürlicher Entscheidung, ob etwas als Arbeit zählt. Umgekehrt bedeutet es, dass metaphorische Übertragungen und deren Einbettung in unseren täglichen Sprachgebrauch bis zu dem Punkt, wo diese Metaphern buchstäblich wahr werden, unprognostizierbar sind. Dass der Satz »Der Roboter arbeitet« buchstäblich wahr ist, lässt sich leicht einräumen, verweist »Roboter« doch etymologisch auf eine slawische Wurzel mit der Bedeutung »arbeiten«. Aber handelt es sich bei der Auskunft »Blindenhund bei der Arbeit« tatsächlich um eine Metapher oder nicht? Und wenn es keine Metapher ist, wann wurde sie eher buchstäblich denn im übertragenen Sinne wahr? Offenbar ist ein ganzes Spektrum an geschichtlichen, linguistischen, politischen, sozialen, literarischen sowie anderen Kräften und Faktoren daran beteiligt, etwas als eine Form von Arbeit anzusehen. Wie sich solche Kräfte und Faktoren auf konkrete Situationen auswirken werden, ist keineswegs bloß zufällig, andererseits aber auch nicht mit Gewissheit vorhersehbar.
Ich gehe davon aus, dass die drei erwähnten Komponenten den Kern unserer üblichen Konzeption von Arbeit bilden, doch gibt es noch andere Aspekte, die für die Weise, wie wir über Arbeit denken, weniger wesentlich sind, allerdings eine wichtige, wenn auch untergeordnete Rolle spielen. Davon »zur Arbeit zu gehen«, sprach mein Vater, ohne lange über seine Ausdrucksweise nachzudenken. Gemeint war, dass Arbeit
(d)eine bestimmte und weitgehend in sich geschlossene Tätigkeit ist, die dementsprechend an ihrem eigenen, separaten Ort ausgeübt wird, in einer Fabrik oder Werkstatt, einer Werkhalle (oder in einem Büro), um sicherzustellen, dass sie nicht mit anderem vermengt wird.
Selbstverständlich war er sich darüber im Klaren, dass einige Leute – sonderbare Handwerker, verschiedene Männer, die einen Kleinbetrieb führten und Autos in ihren Garagen reparierten – zuhause arbeiteten. Doch selbst diese Leute, so die Annahme, besaßen einen eigenen Arbeitsplatz. Außerdem war ihm bewusst, dass einige Leute ihre Arbeit mochten, dass sie gewisse Arbeiten unbeschwert ausführen konnten, was für meinen Vater ein zufälliger Umstand war, eine glückliche Fügung für die Person, der es gefiel, das zu tun, was so oder so zu tun war. In der Regel standen Leichtigkeit, Spaß und gute Laune in einer gewissen Spannung zur Idee von Arbeit. Im Übrigen waren Schabernack und Streiche in der Eisenhütte außerordentlich gefährlich, eine Ursache zahlloser Arbeitsunfälle. Daher
(e)unterschied sich Arbeit grundsätzlich von allem, was man aus Freude, zum Vergnügen oder Spaß tat. Sie war der Inbegriff ernsthaften Tuns.
Schließlich schwang in allem, was mein Vater dachte und sagte, noch eine unausgesprochene Voraussetzung mit, die so fundamental und offensichtlich für ihn war, dass sie nicht eigens erwähnt werden musste:
(f)Arbeit ist die prototypische Tätigkeit, für die man Lohn in der Gestalt von Geld bekommt; sie ist monetarisiert.
Nun war es nicht so, als hätte mein Vater vergessen, dass einer seiner Brüder auf seinem Hof hart und viel arbeitete, ohne dafür von irgendjemanden Geld zu bekommen – tatsächlich beackerte er die Felder für den eigenen Bedarf und den seiner Familie. Nur wurde der Umstand, dafür nicht entlohnt zu werden, als neben- und untergeordnetes Phänomen wahrgenommen. Letztlich war auch die Landwirtschaft zur Selbstversorgung im Horizont bezahlter Arbeit zu begreifen. Wer sich von dem ernährte, was er selbst angebaut hatte, musste sein Essen eben nicht kaufen. Arbeit zum Gelderwerb, Getreideanbau für den Verkauf (und die Arbeit als Reinigungskraft) war das entscheidende Tun. Alles drehte sich darum und war letzten Endes auch nur daraus zu verstehen.
Wer (d) und (f) betont, wird Hausarbeit, gewöhnlich von Frauen erledigt, für ein randständiges Phänomen der Arbeitswelt halten, weil sie – obwohl die Kriterien (a), (b) und (c) klar erfüllt sind – in der Regel unbezahlt ist und auch keine räumlich separierte, in sich bestimmte Tätigkeit (im Sinne von (d) darstellt.
Die von mir oben aufgelisteten drei Grundbestimmungen von Arbeit ergeben weder eine formale Definition von Arbeit, noch käme man zu einer solchen Begriffsklärung, würden die drei weiteren Kriterien hinzugezogen. Sie verweisen insgesamt eher auf ein vages, allenfalls annäherungsweise markiertes diskursives Territorium, innerhalb dessen Arbeit diskutiert wird. Bevor wir diese Diskussion fortsetzen, dürfte der Versuch sinnvoll sein, die drei tragenden Elemente unserer Konzeption von Arbeit noch etwas weiter auszuleuchten.
Anstrengung
Körperliche und moralische Anstrengung
Zu arbeiten heißt, sich bei einer Tätigkeit anzustrengen. Etwas als »anstrengend« zu bezeichnen, meint zunächst, dass jemandem abverlangt wird, seine Muskeln dauerhaft und intensiv zu beanspruchen, wie es Leute tun, die einen ganzen Tag lang Steine schleppen, ein Boot rudern oder Getreide dreschen.
Zwei Komponenten scheinen im Spiel zu sein, eine erste, im engeren Sinne physikalische oder technische, und eine zweite, die »moralischer« Art ist. Um mit dem technischen zu beginnen, ist daran zu erinnern, dass »Arbeit« in der Physik und Technik ursprünglich die Größe des Gewichts bezeichnete, das ein Tier in eine bestimmte Höhe hieven kann. Diese Verwendung des Begriffs ist erweiterbar, indem man ihn nicht nur gebraucht, um zu bezeichnen, welches Gewicht ein Tier als Ganzes, etwa ein Pferd, wie hoch zu heben vermag, sondern auch, um anzugeben, was eine einzelne Muskelgruppe des Menschen stemmen kann. Schließlich lässt sich der Begriff »Arbeit« in der Physik formalisieren und von der Vorstellung ablösen, dass ein Tier etwas bewegt oder anhebt, wodurch man die Arbeit, die ein Boiler oder eine Maschine verrichtet, dann abstrakt als das Produkt von aufgewendeter Kraft und überwundener Distanz bestimmen kann. Wichtig ist in jedem Fall, dass Arbeit strikt durch ihr äußeres Resultat messbar wird: Das bewegte Gewicht lässt sich von außen ebenso messen wie die Höhe, zu der es angehoben wurde, sodass die Beziehung beider festlegt, worin die geleistete »Arbeit« besteht. Wieviel Arbeit ein menschliches Wesen bewältigt, ist eine Sache seiner natürlichen Ausstattung: Generell wird ein Pferd größere Gewichte anheben können als ein Mensch ohne weitere Hilfsmittel. Doch teilweise ist es auch eine Frage von Ernährung und Übung. Ein körperlich gut ausgestatteter Erwachsener, der sich ordentlich ernährt und regelmäßig Gewichte hebt, wird gewöhnlich in der Lage sein, größere Lasten weiter zu bewegen als einer, der gar nicht trainiert. Also ist eine menschliche Tätigkeit anstrengend, wenn sie einen gewissen Aufwand an körperlicher Arbeit in dem strikten Sinne verlangt, den die Technik verwendet.
Es gibt aber noch, wie schon angedeutet, eine zweite Verwendungsweise von »anstrengend«. Etwas kann auch »moralisch« anstrengend sein – in der etwas altertümlichen Bedeutung, die Philosophen dem Wort »Moral« beilegen. Dann bezeichnet das Eigenschaftswort »anstrengend« den Grad der Mühe, zu der ich mich zwinge oder zwingen könnte. Tiere, und Menschen zumal, können sich mehr Mühe geben (oder, wahlweise, auch nachlassen). Wir können versuchen, Tiere dazu zu bringen, sich mehr Mühe zu geben, etwa indem wir eine Peitsche verwenden, wie es gängige Praxis im Umgang mit Tieren, beispielsweise bei Pferden, und Sklaven war. Wie viel Mühe ich aufzuwenden habe, um ein gestecktes Resultat zu erreichen, hängt sowohl von meiner physischen und psychischen Verfassung ab als auch davon, wie geübt ich bin. Es mag ein Gewicht geben, das ich nur unter großer Anstrengung – mit sehr viel Mühe – heben kann, während es eine Person, die von Haus aus stärker und besser trainiert als ich ist, ohne jede Schwierigkeit bewegen kann. Gelegentlich bekommen wir mit einem Menschen, nennen wir ihn Peter, zu tun, der von sich aus zu weniger Arbeitseinsatz befähigt ist als ein anderer Mensch namens Paul. Doch sticht Peter, was messbare Arbeit angeht, Arbeit im technischen Sinne, Paul ständig aus. Paul ist, um es beispielhaft durchzuspielen, zwar körperlich stärker als Peter und er könnte, falls er sich ernstlich anstrengte