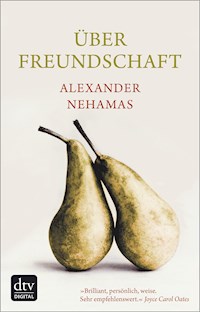
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Alle Güter dieser Erde wiegen einen Freund nicht auf.« Voltaire Was ist Freundschaft eigentlich und was bedeutet sie für uns? Eine Frage, die im Zeitalter von Facebook und Co., wo zufällige virtuelle Bekannte schon »Freunde« genannt werden, besonders wichtig erscheint. Alexander Nehamas erläutert die Ideen klassischer und zeitgenössischer Philosophen, beleuchtet Beispiele aus Literatur, Theater, Kunst und Film und lässt immer wieder persönliche Erlebnisse und Erfahrungen aus seinen Freundschaften einfließen. Er zeigt, wie sich das Verständnis von Freundschaft im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hat, privater und auch komplexer wurde. Doch eines ist gleich geblieben: Freundschaften sind ein wichtiger Bestandteil des Lebens und so individuell wie die daran Beteiligten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Alexander Nehamas
Über Freundschaft
Aus dem Englischen von Elisabeth Liebl
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Tom
Einführung
In den letzten Jahren bot sich mir die Gelegenheit, mehr oder weniger regelmäßig in mein Geburtsland Griechenland zu reisen. Diese Aufenthalte waren beruflich bedingt und meist kurz – drei Tage höchstens –, sodass ich stets einen straffen Terminplan hatte. Doch wann immer es möglich war, verbrachte ich in Athen einen Abend in Gesellschaft einer Gruppe von Freunden, die seit unserem Abgang vom Lyzeum vor über fünfzig Jahren eine ganz erstaunliche Beziehung zueinander pflegen.
Die meisten aus dem Freundeskreis wohnten im Internat, ein paar sogar mehr als zehn Jahre. Die Schule stellte hohe Anforderungen, die für die Internatsschüler auch in den Alltag hineinreichten: All unsere Aktivitäten – Aufwachen, Waschen, Essen, Lernen, Schlafen usw. – wurden von der lauten elektrischen Schulglocke reglementiert, die uns gerade genug Zeit ließ, uns auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. Wann immer wir zu spät kamen, wurden wir bestraft. Einige der Jungs stammten wie ich aus Athen, wo die Schule ihren Sitz hatte. Andere kamen aus anderen Regionen Griechenlands, nicht wenige aus dem Ausland, wohin ihre Familien aus dem einen oder anderen Grund gezogen waren. So etwas wie Privatsphäre gab es in den Schlafsälen kaum. Wir gehörten alle zum selben Zweig unseres Jahrgangs und standen unter permanenter Überwachung. Das hat uns einander nähergebracht. Die Ferien oder Wochenenden verbrachten wir bei einem der Freunde zu Hause – und knüpften starke, dauerhafte Bande der Freundschaft (und pflegten nicht weniger starke, meist allerdings nicht ganz so dauerhafte Zwistigkeiten und Feindschaften).
Diese engagierten und vertrauten Freunde sollten den Großteil ihres Lebens miteinander verbringen. Ich hingegen verließ Athen gleich nach dem Abitur, um in den Vereinigten Staaten zu studieren. Es hat eine Weile gedauert, bevor ich wieder Kontakt zu ihnen aufnahm. Erstaunt stellte ich fest, wie leicht es für mich war, wieder in ihren Kreis einzutauchen und wie entspannt und wohl ich mich dort fühlte. Vielleicht lag es daran, dass ich, während wir einander beschnupperten, bei ihnen Charakterzüge wiedererkannte, die mir schon aus der Schulzeit vertraut waren. Einer, der jetzt Chirurg ist, war schon damals der Spaßvogel der Gruppe. Sein spontaner Sinn für Humor hat sich in all den Jahren kein bisschen verändert. Ein anderer, der das Fliegen liebte, hat einen Sohn, der Pilot bei einer griechischen Fluglinie ist. Ein dritter ist immer noch begeisterter Fan des Fußballclubs, den er schon in seiner Jugend verehrt hat, und verpasst auch heute kein einziges Spiel. Und ich bin sicher, dass auch meine Freunde bestimmte Züge an mir wiedererkannten. Natürlich hat sich jeder von uns auch stark verändert, was in gewisser Weise nicht schlecht ist. Vor allem können wir uns heute gegenseitig schätzen, ohne die Unsicherheiten, die Ressentiments und die Neigung, einander zu übertreffen, die der Jugend eigen sind. Heute gehen wir lockerer miteinander um, sind milder und auch beständiger in unseren Gefühlen, auch wenn sie nicht mehr so dramatisch und leidenschaftlich sind wie einst.[1]
Meine Freunde treffen sich regelmäßig, gewöhnlich am Sonntagabend, zum Kartenspielen oder zum Plaudern. Sie gehen miteinander essen, vor allem (aber nicht nur), wenn sie alte Klassenkameraden aus dem Ausland willkommen heißen (was sie immer tun). Manchmal wird daraus auch eine Einladung nach Hause mit allen Schikanen. Dann sind auch die Frauen, die ebenfalls untereinander befreundet sind, mit von der Partie. Manche verbringen die Ferien gemeinsam, und zwar mit den Familien. Andere sind Paten der Kinder ihrer Freunde. Obwohl sie ursprünglich vielleicht nur Kontakt gehalten haben, um ihre Jugend lebendig zu halten, an die sie (und ich auch) immer noch gern zurückdenken, ist ihre Freundschaft mittlerweile doch mehr als nur die simple Gelegenheit, sich in nostalgischen Stimmungen zu ergehen: Die gemeinsamen Aktivitäten und alles, was mit einem solch engen und dauerhaften Kontakt einhergeht, haben einen umfassenden Einfluss auf ihr Leben und das ihrer Familien ausgeübt und tun das noch heute.
Und wenn ich sage, dass ihre Freundschaft ihr Leben geprägt hat, dann gilt das auch für ihr Selbst. Als mir klar wurde, dass diese Menschen das, was sie geworden sind, zumindest zu einem nicht geringen Teil ihrer Freundschaft verdanken, wurde mir klar, dass Freundschaft, selbst wenn sie von dem Wunsch nach Wiederbelebung einer gemeinsamen Vergangenheit ausgeht, auch einen prägenden Einfluss auf die Zukunft hat. Wer wir sind, bestimmt sich nicht zuletzt an unseren Freunden, die in unserem Leben eine umso wichtigere Rolle spielen, je enger die freundschaftliche Beziehung ausfällt. Unsere Freundschaften leben nicht nur vom Trägheitsmoment. Die Freundschaft meiner Klassenkameraden jedenfalls durchzieht ihr ganzes Leben: Sie erfüllt es. Unsere Freundschaften sind mehr oder weniger verknüpft mit irgendeinem anderen Aspekt von uns: Jeder unserer Freunde beeinflusst die Richtung, die unser Leben nimmt, dies natürlich umso mehr, je enger diese Freundschaft sich gestaltet. Und umgekehrt bestimmt die Richtung, die unser Leben jeweils nimmt, wen wir uns zum Freund wählen. Freundschaft ist ein entscheidender Schritt hin auf das, was wir im Leben aus uns machen.
Ich möchte hier aufzeigen, warum das so ist. Dazu allerdings brauchen wir zunächst ein etwas komplexeres Bild von der Freundschaft als solcher. Freundschaft, und hier ist von enger Freundschaft die Rede, nicht von der von Wahllosigkeit bestimmten Form, wie man sie so leicht etwa auf Facebook knüpft (und die stets den Nachteil haben wird, dass sie Freunde quantifiziert, weil letztlich nur die Menge zählt), ist ein Band, das stets als eines der größten Geschenke des Lebens gepriesen wird, zumindest seit die Menschheit sich darüber Gedanken macht. Als Beispiel mag hier der gelehrte Geistliche Robert Burton dienen, der der Freundschaft auf seine Weise Tribut zollt: »›So wie die Sonne ist dem Firmament, so ist die Freundschaft für die Welt‹ – ein höchst göttliches und himmlisches Band. Sie vervollkommnet die Menschheit, wie dies die Liebe tut, und ist der Blutsverwandtschaft vorzuziehen […] Wer dies dem Menschen nimmt, nimmt alle Freude von ihm, jegliches Glück und Vergnügen, jeglichen Trost, ja jeden wahrhaften Sinn aus der Welt; es ist dies der innigste Bund, die sicherste Übereinkunft, das stärkste Band […] Ein treuer Freund ist besser als Gold, ein Heilmittel für jedes Unglück, ein einzigartiges Gut.«[2] Oder der Dichter Ralph Waldo Emerson:
O Freund, sagt mir mein Busen,
Durch Dich allein wölbet der Himmel sich,
Durch Dich allein ist eine Rose rot,
Alles nimmt edlere Form an durch Dich,
und schaut über die Erde hinaus …[3]
Wie tief Freundschaft ein ganzes Leben beeinflussen kann, zeigen Charlotte Brontës Worte an Ellen Nussey: »Warum müssen wir getrennt werden? Ganz sicher nur, liebe Ellen, weil wir Gefahr laufen, einander zu sehr zu lieben … und den Schöpfer aus dem Auge zu verlieren vor lauter Anbetung seines Geschöpfes.«[4]
Diese Haltung geht zurück auf Aristoteles und dessen Ideen zur philia, einer Form der Liebe, die im Allgemeinen mit »Freundschaft« gleichgesetzt wird.[5]Philia war für Aristoteles ein großes, reines Gut, ohne das niemand würde leben wollen, ganz egal, was er sonst sein eigen nenne.[6] Die Tradition, die sich daraus entwickelt hat, hält Freundschaft ebenso für eine der höchsten Gaben des Lebens.
Doch die aristotelische Tradition, die so einflussreich war, dass sie noch heute das herrschende, selten hinterfragte Bild der Freundschaft bestimmt, berücksichtigt die dunklen, schmerzlichen und destruktiven Seiten der Freundschaft nicht. Wenn wir das Lob der Freundschaft singen, vergessen wir gern, dass der freundschaftliche Alltag meist recht trivial ausfällt. Und wir vergessen, wie weh es tut, wenn eine Freundschaft zerbricht. Wir sehen darüber hinweg, dass Freundschaften, selbst gute, mitunter recht schädlich sein können. Und wir übersehen, dass es nicht selten gerade die guten Freundschaften sind, die uns dazu verleiten, in moralischer Hinsicht nicht das Richtige zu tun – weil wir zum Beispiel die Treue zu unserem Freund über unsere Pflicht anderen gegenüber stellen. Das Antlitz der Freundschaft ist, wie ich zu zeigen hoffe, ein Janusgesicht.
Dass sie uns auch in Gefahr bringen oder zur Unmoral verleiten kann, zeigt, wie vielschichtig Freundschaften sein können. Ein weiteres Charakteristikum der Freundschaft wurde mir bewusst, während ich mit meinen Freunden in Athen plauderte. Unsere Begegnungen finden in ganz anderem Rahmen statt als meine sonstigen Beziehungen. So merkte ich schon bald, dass ich mich anders verhalte und anders denke, wenn ich mit ihnen zusammen bin. Obwohl zu meinem Athener Freundeskreis unter anderem Ingenieure, Journalisten und Manager zählen, sind doch keine »Berufsakademiker« darunter. Würde ich mich mit ihnen in der Form unterhalten, wie ich es, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, ganz selbstverständlich mit meinen Studenten oder Kollegen tue, wäre dies völlig fehl am Platze. Ein Tonfall, eine bestimmte Wortwahl, eine Art, sich auszudrücken, die uns mit manchen Freunden völlig natürlich erscheint, kann anderen gegenüber affektiert, pedantisch oder herablassend wirken. Dinge, die man in dem einen Zusammenhang ohne zu zögern ansprechen würde, büßen in einem anderen ihre Bedeutung ein. Wir passen uns unseren Beziehungen an, und was wir dem einen Freund zeigen, unterscheidet sich beträchtlich von dem, was wir für den anderen sind: »Wir haben so viele Seiten in unserem Charakter, wie wir Freunde besitzen, denen wir sie zeigen können. Ohne mir dessen bewusst zu werden, bemerke ich, dass ich mit einem Freund eher witzig bin, mit dem anderen großzügig und freigebig, mit dem dritten kleinlich und knauserig, weise und ernsthaft mit dem nächsten und schlichtweg frivol mit einem anderen Freund. Überrascht fallen mir diese plötzlichen und erschreckenden Wandlungen meiner selbst auf, wenn ich aus dem Einflussbereich eines Freundes in den eines anderen wechsle.«[7]
Wie unsere Freunde sich in Gesellschaft verhalten, kann uns Anlass geben, sie »weniger zu mögen«: Plötzlich bemerken wir Züge an ihnen, die nicht zutage treten, wenn sie mit uns allein sind, weil es dazu keinen Grund gibt.
Wenn jede Freundschaft jeweils andere Aspekte unseres Selbst zum Vorschein bringt, müssen wir uns fragen, was sich da jeweils unterscheidet. Was ist es denn, was unsere Freunde an uns lieben und was wir unser »Selbst« nennen? Gibt es so etwas überhaupt? Und wenn ja: Ist es nur die Summe all unserer verschiedenen und manchmal widersprüchlichen Züge oder ist es etwas vollkommen anderes als das, was unsere Freunde in uns sehen? Wenn wir also die Doppelgesichtigkeit der Freundschaft untersuchen, werden wir nicht nur ein realistischeres Bild von ihr selbst gewinnen, sondern sehen uns plötzlich mit einigen der wichtigsten Fragen des Lebens konfrontiert.
Im ersten Teil des Buches wird untersucht, was über die Jahrhunderte hinweg über Freundschaft geschrieben wurde und wie man sie künstlerisch zu fassen gesucht hat. Dabei werden wir feststellen, dass sowohl Philosophie als auch Kunst unsere Wertschätzung der Freundschaft vertiefen. Doch verweisen sie auch auf Merkmale, die bislang noch nicht ausreichend untersucht wurden. Im zweiten Teil hingegen versuche ich, mir auf den janusköpfigen Charakter der Freundschaft meinen höchstpersönlichen Reim zu machen. Ich möchte zeigen, dass trotz der Gefahren und Enttäuschungen, welche die Freundschaft mit sich bringt, also der Kehrseite der freundschaftlichen Medaille, Freundschaft etwas Großartiges ist. Dass beides zutrifft, führt uns zu einem besseren Verständnis der Freundschaft und – da unsere Freundschaften uns zu dem werden lassen, was wir sind – letztlich auch zu einem tieferen Einblick in unser Selbst.
Und natürlich beginnen wir beim Ursprung: bei Aristoteles, dessen Gedanken jeder ernsthaften Untersuchung über die Freundschaft zugrunde liegen.
Teil I
Kapitel 1»Ein Freund ist ein anderes Selbst« – die aristotelischen Grundlagen
Aristoteles zufolge würde kein Mensch je ohne Freunde leben wollen, selbst wenn ihm alle anderen Güter der Welt zur Verfügung stünden.[8] Aristoteles schrieb vor sehr langer Zeit – im 4. Jahrhundert v. Chr. –, doch die Zeit hat sein Lob der Freundschaft bisher nicht widerlegt: Freunde mögen Feinde haben, die Freundschaft aber nicht. Manche Menschen sehen ihre Freunde als Spiegel, in dem sie sich selbst auf eine Weise betrachten und erkennen können, wie es ihnen allein kaum möglich wäre.[9] Andere wiederum sehen das Wesen der Freundschaft in der Möglichkeit, den Freunden gegenüber vollkommen offen zu sein, ja die intimsten Geheimnisse miteinander zu teilen.[10] Und jeder ist sich der indirekten Vorteile einer Freundschaft bewusst. Freunde nämlich sind bereit, einander zu helfen, auf persönlicher, beruflicher und finanzieller Ebene, wenn dies nötig sein sollte. Häufig opfern sie um der Freunde willen selbst ihr eigenes Wohlergehen, manchmal sogar ihr Leben.
Aristoteles hat nicht nur die philosophische Reflexion über die Freundschaft geprägt, sondern auch das, was davon ins allgemeine Verständnis übergegangen ist.[11] Es ist diesbezüglich kaum möglich, die Bedeutung des Aristoteles zu überschätzen, da er nicht nur durch seine eigenen Schriften wirkte, sondern auch Ciceros Dialog ›Laelius über die Freundschaft‹ wesentlich beeinflusste, der im Mittelalter viel gelesen wurde, während Aristoteles’ Texte zum Teil verschollen waren und erst viel später wieder entdeckt und herausgegeben wurden.[12]
Natürlich gibt es auch zu dem großen Philosophen Gegenpositionen, doch sind dies wenige.[13] Im Großen und Ganzen – und in einem Ausmaß, das in einem Umfeld, in dem Einhelligkeit in den Ansichten schon als eine Form der Unhöflichkeit gilt, seinesgleichen sucht – stellt sich die philosophische Tradition ganz auf Aristoteles’ Seite. Sie übernimmt aus seiner Diskussion der philia – was fast immer mit »Freundschaft« übersetzt wird – zwei zentrale Vorstellungen. Erstens, dass Freundschaft ohne Wenn und Aber ein hohes Gut ist, eine makellose Form der Liebe und eine der größten Freuden, die das Leben zu bieten hat. Jedes Leben, in dem Freundschaft eine Rolle spielt, ist ein besseres Leben als eines ohne Freundschaft. Gefährten zu haben ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wird dieses nicht erfüllt, verblassen selbst die Freuden des Paradieses, wie John Milton seinen Adam gegenüber Gott klagen lässt, der ihm gerade den Garten Eden zu Füßen gelegt hat:
Nur wer mit mir soll teilen, seh ich nicht.
Was für ein Glück besteht in Einsamkeit?
Wer kann allein genießen oder wer,
Alles genießend, so zufrieden sein?[14]
David Hume stößt in dasselbe Horn: »Vollständige Einsamkeit ist vielleicht die denkbar größte Strafe, die wir erdulden können. Jede Lust erstirbt, wenn sie allein genossen wird.«[15] Für Ralph Waldo Emerson ist Freundschaft nichts weniger als »eine auserwählte, ja heilige Beziehung, die absolut ist und selbst die Sprache der Liebe gewöhnlich und verdächtig erscheinen lässt, so viel reiner ist sie. Nichts ist so sehr göttlich.«[16]
Zweitens übernahm die Philosophie der Freundschaft fraglos den Gedanken, dass die drei Arten der philia, die Aristoteles unterscheidet, drei verschiedene Arten der Freundschaft bezeichnen. Manche von uns, so Aristoteles, fühlen sich zueinander hingezogen, weil sie aus dieser Beziehung Gewinn haben, andere wegen der Lust, die man sich gegenseitig verschafft. Wieder andere fühlen sich angezogen von der aretē, der »Vortrefflichkeit« oder »Tugend«. Wir werden sehen, dass Aristoteles diese Tugend anders auffasst als wir heute.[17] Eine Geschäftsbeziehung wäre ein gutes Beispiel für die erste Art der Freundschaft, eine Liebesbeziehung für die zweite. Aristoteles aber hält die dritte Art der philia für die höchste: ein absolutes Gut.[18] Cicero folgt Aristoteles hier beinahe wörtlich: »Würdig der Freundschaft«, schreibt er, »sind die, deren Persönlichkeit der Grund dafür ist, dass man sie liebt.« Ohne dieses »Vortreffliche« gebe es keine wahre Freundschaft, ohne die wiederum das Leben nicht lebenswert wäre. Die Vortrefflichen aber brauchen die Freundschaft der Durchschnittsmenschen nicht, da sie darin – hier tritt uns wieder der Aristoteliker entgegen – bestenfalls Gewinn und sinnlichen Genuss finden.[19]
Auch lange nach Cicero begegnen uns Aristoteles’ Vorstellungen von der Freundschaft in philosophischen Schriften mit geradezu unheimlicher Beständigkeit, als habe die Freundschaft sich kein bisschen verändert, ob sie nun von den lärmenden Bürgern des klassischen Athen oder von den römischen Republikanern gepflegt wurde, von den in Abgeschiedenheit lebenden Zisterziensermönchen im England des 12. Jahrhunderts oder im 16. Jahrhundert von den Kämpfern in den französischen Hugenottenkriegen, von den Gefolgsleuten am Elisabethanischen Hof, von den Verfechtern der Schottischen Aufklärung oder den Preußen des 18. Jahrhunderts, von den Transzendentalisten des 19. oder den heutigen analytischen Philosophen. Verglichen mit den leidenschaftlichen Auseinandersetzungen über das Wesen der Wirklichkeit, über Gerechtigkeit, Erkenntnis oder Schönheit, ist die Diskussion über die Freundschaft eine ungewöhnlich ruhige Zone in den brodelnden Gewässern der philosophischen Debatte.[20] Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen von der Regel, allerdings nur wenige. Wenn Friedrich Nietzsche zum Beispiel in seiner Autobiografie schreibt, ein unglaublicher Kreativitätsschub – innerhalb weniger Monate entstanden vier große und verschiedene kleinere Werke – habe ihn »dankbar« gegenüber seinem ganzen Leben werden lassen, so haben wir keinen Anlass zu glauben, dass sein Glück nicht aufrichtig empfunden war, auch wenn er in absoluter Einsamkeit schrieb.[21]
Ob es möglich ist, ohne Freunde glücklich zu sein, ist also eine offene Frage. Sicher ist hingegen, dass gute Freunde das Leben häufig besser und glücklicher machen. Aber gilt dies in jedem Fall? Können gute Freunde uns nicht auch, selbst wenn dies ohne Absicht geschieht, in gefährliche und uns schädliche Abenteuer hineinziehen? Und hieße dies dann nicht, dass sie keine guten oder vielleicht gar keine Freunde sind? Aristoteles würde solche Fragen einfach von der Hand weisen. Er – und die gesamte philosophische Tradition in seinem Gefolge – formuliert eine ganz klare These über die Natur jedweder Freundschaft: Nur gute Menschen können Freunde sein. Die wahre und vollkommene philia ist auf die Tugendhaften beschränkt.[22] Schlechte Menschen können keine Freunde sein, gute Freunde hingegen können keine schlechten Menschen sein. Eine echte Freundschaft kann niemals Schaden verursachen.[23] Und obwohl die moderne Philosophie einräumt, dass auch nicht hundertprozentig vollkommene Menschen – also die meisten von uns – durchaus zu echter Freundschaft fähig sind, folgt sie Aristoteles doch darin, dass Freundschaft immer auf das Gute abzielt. Und dieses Gute identifiziert die moderne Philosophie mit Moral bzw. Ethik.[24] Auch dies ist eine ausgesprochen gutwillige Auffassung von Freundschaft, die sich jedoch die gleichen Fragen gefallen lassen muss, wie wir sie gerade schon Aristoteles gestellt haben.
Können schlechte Menschen gute Freunde sein? Können gute Freunde sich gegenseitig verletzen? Ist Freundschaft notwendig moralisch oder nicht? Diese Fragen werden uns das ganze Buch über beschäftigen, dessen Ziel es ist, ein komplexeres und nuancierteres Bild der Freundschaft zu zeichnen. Ehe wir uns aber an die Beantwortung dieser Fragen machen können, stellt sich eine weitere Frage, die sich vielleicht nicht unmittelbar erschließt: Meinen die aristotelische philia und die moderne Freundschaft wirklich dasselbe?
Philia ist für Aristoteles universell. Sie ist gleichermaßen nötig für Reich und Arm, Jung und Alt, Mann und Frau, ja selbst für Tiere. Sie eint Familien, politische Parteien, soziale und religiöse Organisationen, Stämme, Städte und ganze Spezies. Sie kann zwischen Menschen desselben Alters existieren, desselben sozialen oder finanziellen Status, derselben intellektuellen oder moralischen Verfasstheit, aber auch zwischen unterschiedlich gestellten Menschen: Eltern und Kindern, Männern und Frauen, Herrschern und Beherrschten, Göttern und Menschen.[25] Durch philia sind die Unwissenden mit den Weisen und die Schönen mit den Hässlichen verbunden. Erotische Liebe gehört ebenfalls zur philia. Philia kann entstehen zwischen Reisenden oder zwischen Soldaten. Sie beherrscht die Beziehungen zwischen Gastgeber und Gast, ja selbst – was für uns heute überraschend ist – zwischen Käufer und Verkäufer.
Das ist eine außergewöhnliche Bandbreite von Beziehungen. Welches Band kann so unterschiedliche Menschen verknüpfen? Aristoteles nennt hier drei Charakteristika, die auf jede Spielart der philia zutreffen: Zunächst ist da die philēsis – ein Begriff, der mit »Liebe« oder »Zuneigung« ebenso schlecht übersetzt ist wie philia mit »Freundschaft«. »Liebe« ist ein viel zu starkes Wort für die wechselseitigen Gefühle von Gläubigern und Schuldnern, Mitgliedern eines Vereins oder Bürgern eines Staates. »Zuneigung« hingegen ist zu schwach für die Gefühle, die Eltern ihren Kindern entgegenbringen, für die tiefe Verpflichtung, die Freunde empfinden, oder für die Leidenschaft von Liebenden. Philēsis ist ein Begriff mit einem weiten Bedeutungsspektrum, das eine ganze Reihe positiver Gefühle abdeckt, die von der kühlen Kalkulation des zu erwartenden Profits vonseiten eines Händlers bis hin zur hochlodernden erotischen Leidenschaft reichen. Dieses Gefühl wird von allem ausgelöst, woran uns auch nur ein bisschen liegt. Und das, woran uns etwas liegt, lässt sich nach Aristoteles in drei Kategorien einteilen: das Nützliche, das Angenehme, das Gute.[26]
Obwohl die philia also philēsis erfordert, ist philia eine wechselseitige Beziehung, wohingegen wir philēsis auch für unbelebte Objekte empfinden können. Bei der philēsis erwarten wir keine Erwiderung. Mir kann an vielen Objekten etwas liegen – Aristoteles nennt hier als Beispiel den Wein –, aber keines dieser Objekte erwidert meine Wertschätzung. Das kann nur eine andere Person.[27]
Drittens: Wenn auch meine Wünsche in Bezug auf meinen Wein das Gute zum Inhalt haben, beschränken sie sich doch darauf, dass er gut sein möge, damit ich ihn besser genießen kann. Wenn Sie und ich aber philoi sind[28], dann muss ich Ihnen Gutes wünschen, und zwar um Ihrer selbst willen und nicht, oder nicht ausschließlich, um meinetwillen. Und Sie müssen dasselbe mir gegenüber empfinden. Aristoteles nennt dieses wechselseitige Einander-Gutes-Wünschen eunoia oder »Wohlwollen«. Und wenn ich Ihnen Gutes wünsche, dann tue ich das entweder, weil ich einen praktischen Nutzen davon habe, oder wegen des Vergnügens, das unser Zusammensein mir verschafft, oder aber, weil ich mich von Ihren Tugenden angezogen fühle – von Mut, Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Großzügigkeit, Weisheit und anderen Dingen, die das Leben gut und glücklich geraten lassen.[29]
Wenn Sie mir also am Herzen liegen, wenn ich Ihnen um Ihrer selbst willen Gutes wünsche und nicht um meinetwillen, und wenn Sie dasselbe mir gegenüber empfinden, dann sind wir durch das Band der philia verknüpft, wir sind dem anderen philos.[30]
Die Vorstellung, dass uns das Wohlergehen bestimmter Menschen, für die wir etwas empfinden, genauso wichtig ist wie das eigene, dass es uns gut geht, wenn es ihnen gut geht, dass ihre Erfolge und Niederlagen auch die unseren sind, ist für unser heutiges Verständnis von Freundschaft zentral. Da diese Vorstellung auch für die Idee der philia wesentlich zu sein scheint, ist man versucht anzunehmen, dass philia das klassisch-griechische Gegenstück zur Freundschaft ist. Dies erklärt zumindest, warum beides so häufig gleichgesetzt wird.
Von den drei Arten der philia, die Aristoteles uns vorstellt, ist jedoch nur die Anziehung durch die Vortrefflichkeit des anderen »vollkommen« oder »wahr« und bildet damit das Paradigma für unsere philia gegenüber diesem Menschen, aber auch für die Tradition der Freundschaft nach aristotelischem Muster. Das Streben nach Vergnügen oder Nutzen führt zu einer minderen Kategorie von Beziehungen, die nur als philia betrachtet werden, weil sie einige der Merkmale mit dieser teilen und ihr insofern »ähnlich« sind.[31] Maßgeblich ist hier auch, dass in Aristoteles’ Augen keine Beziehung zwischen zwei Menschen auf der Bewunderung der jeweiligen Vortrefflichkeit des anderen beruhen kann, wenn die Betroffenen nicht per se selbst vortrefflich sind. Er hätte seiner hervorragenden Beobachtungs- und Analysefähigkeiten gar nicht bedurft, um sich über seine Zeitgenossen keinerlei Illusionen zu machen. »Doch sind solche Freundschaften selten«, schließt er, »denn es gibt nur wenige Menschen von dieser Art.«[32] Doch das scheint ihn nicht weiter zu stören. Es scheint ihm zu genügen, diese Vortrefflichkeit auf Perikles, den großen Athener Staatsmann, und »Menschen seiner Art«[33] zu beschränken.
Wenn alle Arten der philia auch Arten der Freundschaft wären, dann wäre die Seltenheit der Vortrefflichsten kein Problem. Denn in diesem Fall könnten die anderen beiden, weniger anspruchsvollen Formen, die auch für den Rest der Bevölkerung taugen, die Lücke füllen. Aber tun sie das denn? Führt die Wertschätzung von Vergnügen und Nutzen zu einer echten, wenn auch nicht ganz vollkommenen Freundschaft in unserem Sinne?
Wenn etwa unsere Beziehung auf Nutzen oder Vergnügen beruht, könnte man sie als – wenn auch nicht ideale – Freundschaft betrachten, falls ich Ihnen um Ihrer selbst willen alles Gute wünsche. Aristoteles sagt aber auch, dass »die Liebenden einander Gutes wünschen, im Hinblick auf den Grund, aus dem sie lieben«.[34] Das heißt, wenn wir einander durch Tugend verbunden sind, dann werde ich Ihnen Wohlwollen entgegenbringen, sofern Sie tugendhaft sind. Sind wir einander durch Vergnügen verbunden, wünsche ich Ihnen Gutes, sofern Sie mir Vergnügen bereiten. Im Falle des Nutzens ist mein Wohlwollen ganz davon abhängig, ob Sie mir nützlich sind. In den beiden letzteren Fällen, so Aristoteles, bin ich Ihnen nicht um Ihrer selbst willen zugetan, sondern nur um des Vergnügens oder Nutzens willen, den Sie mir verschaffen. Wenn ich Ihnen zum Beispiel Gutes wünsche, weil Sie mich mit den richtigen Leuten bekannt machen können, dann sind Sie selbst, also der Mensch, der Sie sind, mir herzlich egal. Ich bin nicht Ihnen zugetan, sondern dem Nutzen, den Sie mir bringen. Unsere Beziehung ist also nicht vollkommen. Für Aristoteles ist nur die Beziehung zwischen Tugendhaften bzw. Vortrefflichen vollkommen, denn unsere Tugenden machen uns zu dem, was wir sind. Unsere Tugenden, und nur sie, drücken unsere wahre Natur aus. Daher schätze ich Sie nur dann um Ihrer wahren Natur willen, wenn ich mich von Ihren Tugenden angezogen fühle. Nur dann bin ich in der Lage, Ihnen um Ihrer selbst willen Gutes zu wünschen.
Es scheint eine gewisse Spannung, wenn nicht gar ein offener Widerspruch, zu existieren zwischen dem, was Aristoteles anfangs über die philia sagt, und dem, was er gleich darauf ausführt. Wie war das noch zu Anfang? Wohlwollen sei, dem Anderen Gutes zu wünschen »um seiner selbst willen«. Weiter heißt es, dass man dem philos »um seiner Tugend, des Vergnügens oder Nutzens willen«, den er bringt, Gutes wünsche. Und dann schließt er mit der Behauptung, philoi wünschten einander Gutes, »insofern« sie tugendhaft, angenehm oder nützlich sind.[35] Doch trotz der Ähnlichkeit dieser Thesen macht Aristoteles einen eklatanten Unterschied deutlich zwischen der Freundschaft um des Angenehmen und Nützlichen willen und der Freundschaft, die auf die Tugend des anderen abzielt:
»Diejenigen nun, die einander aufgrund des Nützlichen lieben, lieben einander nicht als solche, sondern aufgrund eines Gutes, das sie voneinander bekommen. Dasselbe gilt für diejenigen, die wegen der Lust lieben: Die Menschen lieben die Umgänglichen nicht, weil diese bestimmte Qualitäten haben, sondern weil sie ihnen angenehm sind. […] Solche Freundschaften sind also akzidentiell: Denn hier wird der Geliebte nicht geliebt, insofern er ist, was er ist, sondern insofern er ein Gut bzw. Lust verschafft.«[36]
Wenn es also Ihre Tugend ist, die ich an Ihnen anziehend finde, wünsche ich Ihnen Gutes um Ihres Charakters willen, also aufgrund dessen, wer Sie als Person sind. Wenn es jedoch um Vergnügen (Lust) oder Nutzen geht, wünsche ich Ihnen Gutes aufgrund bestimmter Merkmale – Sinn für Humor, Aussehen, finanzielle Möglichkeiten oder sozialer Status. Diese sind aber, Aristoteles zufolge, nebensächlich und nicht Teil Ihres rationalen Wesens, das Sie erst zu dem macht, was Sie sind.
Das aber bedeutet, dass die minderen Formen der philia sich nicht auf den anderen als Person beziehen: »Diejenigen, deren Liebe im Nutzen gründet, lieben also den anderen wegen des für sie selbst Guten, und diejenigen, bei denen sie in der Lust gründet, wegen des für sie selbst Angenehmen.« Solche Freundschaften aber lösen sich sogleich auf, wenn die »Freunde« das Angenehme oder Nützliche nicht mehr bieten können.[37] Denn weiter heißt es: »Die wegen des Nützlichen Freunde sind, trennen sich, sobald das Förderliche endet. Denn sie waren nicht Freunde voneinander, sondern Freunde des Vorteils.«[38] Freunde, die rein erotische Gefühle verbanden, trennen sich, »wenn sie nicht bekommen, weswegen sie sich liebten. Sie liebten ja nicht die andere Person selbst, sondern ihre Eigenschaften, die nicht dauerhaft waren.«[39]
Kurz zusammengefasst geht Aristoteles also davon aus, dass jede Art der philia zur Voraussetzung hat, dass man dem Freund Gutes um seiner selbst willen wünscht. Andererseits schätzen wir bei den Formen der philia, die auf Nutzen und Annehmlichkeiten gründen, nicht den Freund selbst, sondern das, was er uns bringt. Können wir nun diese beiden widersprüchlichen Aussagen unter einen Hut bringen?
Natürlich! Nehmen wir einmal an, ich wünsche meinem Friseur Tomas alles Gute, weil er mir die Haare gut schneidet. In Aristoteles’ Augen würde ich ihm also wegen einer nicht wesensmäßig zu ihm gehörenden Eigenschaft alles Gute wünschen, da er ja jederzeit aufhören kann, mir von Nutzen zu sein, auch ohne dass sich seine Persönlichkeit verändert. Er könnte zum Beispiel umziehen. Wenn das geschähe, wäre unsere philia damit zu Ende. Wünsche ich ihm aber alles Gute, weil er ein tugendhafter Mensch ist, dann gründet mein Wohlwollen auf einem essenziellen Wesensmerkmal, auf dem also, was Tomas tatsächlich ist. Dann liegt er mir »als Mensch« am Herzen, um einen moderneren Ausdruck zu benutzen, und nicht, weil er dies oder jenes kann oder hat. Da der Nutzen, den ich aus Tomas ziehe, nicht davon abhängt, wer er als Mensch ist, sondern von dem Beruf, den er zufällig hat, würde Aristoteles davon ausgehen, dass ich Tomas nicht um seiner selbst willen schätze, sondern um des Nutzens willen, den ich von ihm habe. Anders wäre dies, wenn ich ihn um seiner menschlichen Qualitäten willen schätzte: Da diese ein wesentlicher Bestandteil dessen sind, was Tomas ist, würde meine Wertschätzung nicht auf einer anderen nützlichen Eigenschaft, seiner Tugend, beruhen, sondern auf dem, was Tomas ist.
Außerdem gibt es eine Menge guter Dinge, die ich Ihnen wünschen kann, wenn unsere Beziehung auf Nutzen oder Annehmlichkeit gründet: mehr Geld, eine gute Ehe, einen Lotteriegewinn. Ich kann mich für Sie freuen, selbst wenn ich von Ihrem Glück überhaupt nicht profitiere – solange Sie mir weiterhin geben, was unsere Beziehung in Gang gebracht hat. Da ich keinen unmittelbaren Nutzen von Ihrem neu erworbenen Reichtum oder Ihrer Ehe habe, heißt das, dass ich Ihnen nicht nur um meiner selbst willen Gutes wünsche, sondern auch um Ihretwillen. Doch natürlich kann Ihnen auch Gutes geschehen, das meinen Interessen zuwiderläuft: Vielleicht verschafft Ihr Reichtum Ihnen nun Zugang zu anderen sozialen Kreisen und Sie interessieren sich nicht mehr für mein Wohlergehen. Da ich das Gute, das Ihnen widerfährt, nur gut finde, solange es meinen Interessen förderlich ist oder ihnen zumindest nicht zuwiderläuft, wünsche ich Ihnen solche Dinge also nicht nur um Ihrer selbst willen und werde Ihnen dementsprechend nicht helfen, sie zu bekommen. In Beziehungen, die auf Nutzen oder Annehmlichkeit gründen, hängt das, was ich dem anderen wünsche, letztlich von meinen eigenen Interessen ab. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auch wenn Ihr Wohlergehen mir nichts bringt: Ich wünsche Ihnen also Gutes um Ihretwillen und nicht nur um meinetwillen. Doch ich wünsche Ihnen nicht ausschließlich um Ihretwillen Gutes.
Das ist etwas, das nur tugendhafte philoi tun können. Wenn unsere Beziehung auf Nutzen oder Annehmlichkeit beruht, dann kann etwas angenehm oder nützlich und daher gut für den einen, aber nicht für den anderen sein. Wenn dem so ist, wird die Beziehung auseinanderbrechen. Sind wir aber durch das Band der Tugend verknüpft, dann kann nichts, was für den einen gut ist, sich für den anderen als schlecht herausstellen. Wenn ich Ihnen Gutes wünsche, weil Sie tugendhaft sind, dann wird alles Gute, das ich Ihnen wünschen kann, Ihre Tugend steigern oder sie zumindest nicht verringern: Sonst wäre es ja nicht gut. Aber nichts, was das Resultat Ihrer Bemühungen ist, ein besserer Mensch zu werden, kann mir ein Leid antun oder, wie Aristoteles meint, meinen Interessen entgegenwirken.[40] Und da alles, was der Tugend dient, wenn es aus den richtigen Beweggründen heraus unternommen wird, ebenfalls tugendhaft ist[41], ist alles, was ich für Sie tue – ganz egal, welche nützlichen oder angenehmen Folgen es für uns beide haben mag –, gut und eine eigenständige tugendhafte Tat. Solange wir beide tugendhaft sind, kann nichts, was wir dem anderen wünschen oder für ihn tun, für uns schlecht sein. Am Ende wünsche ich all meinen philoi um ihrer selbst willen Gutes, und nicht nur um meinetwillen. Doch nur, wenn ich Ihnen aufgrund Ihrer Tugend wohlwill, wünsche ich Ihnen das Gute ausschließlich um Ihrer selbst willen, weil Sie der Mensch sind, der Sie sind, und nicht, weil ich etwas von Ihnen bekomme.[42]
Die vollkommene philia unterscheidet sich von ihren minderen Formen, weil die Bande der Tugend vielleicht nicht immer ewig, aber doch zumindest sehr dauerhaft sind. Ein tugendhafter Charakter durchläuft, Aristoteles zufolge, kaum je ernstliche Wandlungen. Reichtum, Macht und Schönheit hingegen gehen manchmal ohne jede Vorwarnung verloren. Daher sind Beziehungen, die darauf gründen, so kurzlebig.[43] Manchmal heißt es ja sogar: »Wahre Freundschaft ist unvergänglich. Hört eine Freundschaft auf zu bestehen, so war sie nie echt, auch nicht zu der Zeit, da sie zu bestehen schien.«[44] Das ist nun wieder übertrieben. Aristoteles meint, dass selbst die philia der Tugendhaften mitunter ein Ende hat, denn außerordentliche Umstände können selbst die Tugend zum Verlöschen bringen. Doch seiner Ansicht nach zeigt dieses Ende nicht, dass die Freundschaft keine echte war.[45]
Wenn Freundschaften zerbrechen, taucht ja häufig der Verdacht auf, dass das, was einst als echte Freundschaft erschien, die ganze Zeit über nur verdeckte Selbstsucht war.[46] Das Resultat ist, dass es uns wesentlich erscheint, dass unser Wohlwollen für den anderen uns dazu veranlasst, die eigenen Interessen zugunsten des anderen zurückzustellen, sollte dies nötig sein. Das Ausmaß des Opfers gilt dann meist als Maß für die Tiefe der Freundschaft. In Aristoteles’ Modell aber ist solch ein Opfer ausgeschlossen. Das ist klar, soweit es die Annehmlichkeits- oder Nutzen-Philia angeht: Sie endet, sobald ich feststelle, dass das für Sie Gute nicht auch für mich gut ist. Doch überraschenderweise gilt dies auch für die Tugend-Philia, die niemals ein Opfer fordern kann: Alles Gute, das ich für Sie wünsche, stärkt Ihre Tugendhaftigkeit, und nichts, was dazu führt, dass Sie ein besserer Mensch werden, kann mir Schaden oder Schmerz bereiten. Selbst wenn ich für Sie mein Leben gäbe, findet Aristoteles, dass ich mir damit nicht schade, denn in diesem Fall fällt mir etwas zu, was wertvoller ist als das Leben: Ehre (to kalon).[47] Nur in sehr seltenen Ausnahmefällen kann die Tugend-Philia jenen schaden, die sie verbindet: Für Aristoteles ist sie fast ein Gegenstand der Verehrung.
Da ich jede Nutzen- oder Annehmlichkeitsbeziehung aufkündigen werde, falls sie mir nicht gibt, was ich davon erhoffe, zählt für mich ja nur das, was ich durch diese Beziehungen gewonnen habe. Das lässt die Beziehung noch nicht zu einer selbstsüchtigen oder ausbeuterischen werden. Ich gebe ja gern, was der andere wünscht, solange es nicht meine eigenen Pläne stört. Aber es verleiht diesen Beziehungen einen instrumentellen Charakter. Doch sind Freunde nicht Menschen, die einander um ihrer selbst willen zugetan sind und nicht um der Vorteile willen, die die Beziehung ihnen bietet?[48] Das heißt, dass weder die Nutzen- noch die Annehmlichkeits-Philia tatsächlich als Freundschaft zu betrachten sind. Die aristotelische philia in ihrer Gesamtheit ist also keineswegs gleichbedeutend mit dem, was wir heute unter Freundschaft verstehen. Vor allem dort, wo die philia auf Nutzen[49] oder Lustgewinn[50] gründet, unterscheidet sie sich von unserem Freundschaftsbegriff.[51]
Die Tugend-Philia hingegen passt zu unseren heutigen Vorstellungen. Sie beschreibt sehr schön die Beziehung, die wir zu unseren engsten Freunden haben. Denn sowohl die tugendhaften Philoi des Aristoteles wie enge Freunde in unserem Sinne lieben einander »um ihrer selbst willen«. Sie schätzen vor allem den Charakter des anderen und erwarten, dass ihre Beziehungen vielleicht nicht ewig, aber zumindest eine gute Weile halten. Aber es gibt noch weitere Ähnlichkeiten. Obwohl man eine Tugend-Philia nicht um dessentwillen eingeht, was sie einem einbringt, hat sie doch ihre Vorzüge und Annehmlichkeiten.[52] Das Gleiche gilt auch für die moderne Freundschaft: Man kann sich in Zeiten der Not auf seine Freunde verlassen, und ihre Gesellschaft ist immer angenehm – obwohl Aristoteles seine scharfe Beobachtungsgabe nicht auf die Sorgen und Nöte richtet, die Freunde einander auch bereiten können.[53] Wie die Tugend-Philia ist Freundschaft immun oder zumindest widerstandsfähig gegen Verleumdungen: Tugend-Philoi (die wir von diesem Punkt an auch als »Freunde« bezeichnen können) vertrauen einander, und es braucht schon einiges, um ihr wechselseitiges Vertrauen zu zerstören. Freunde beeinflussen die Lebensform des anderen: Sie verbringen viel Zeit miteinander und tun gemeinsam Dinge, die sie allein nicht tun würden. Sie prägen auch den Charakter des anderen. Es handelt sich dabei um eine komplexe und fordernde Beziehung, die man nur mit wenigen Menschen eingehen kann: »Doch sind solche Freundschaften vermutlich selten, denn es gibt wenige Menschen von dieser Art.«[54] Freunde rechnen nicht gegeneinander auf, was der eine für den anderen getan hat.[55] Ihre Beziehung begründet keinen Anspruch an den anderen: Man sollte dem Freund immer noch geneigt sein, selbst wenn er sich verändert hat – vorausgesetzt, er ist nicht »unheilbar« lasterhaft geworden.[56] Ein Freund verhält sich, wie Aristoteles’ berühmte Formulierung lautet, »zum Freund wie zu sich selbst, denn der Freund ist ein anderes Selbst«.[57]
Doch eben weil die Tugend-Philia unserer Vorstellung von Freundschaft so nahe ist, sollten wir kurz innehalten, bevor wir wie so viele Aristoteles folgen in der Verknüpfung zwischen Freundschaft und Tugend, vor allem, wenn diese, wie es heute so üblich ist, mit Moral gleichgesetzt wird. Zum einen, weil die aristotelische Tugend, wie wir bereits gesehen haben, viel weiter gefasst ist als ihre rein moralische Form. Aber das ist nicht der einzige Grund. Viel wichtiger ist, dass Aristoteles nur einer kleinen Gruppe Athener Männer erlaubte, einander (und manchmal in eingeschränktem Sinne auch ihre Frauen[58]) zu lieben, wie Freunde dies tun. Freundschaft aber ist zum einen viel weiter verbreitet und zum anderen viel mehr mit Risiko behaftet, als er sich das vorstellte.
Dass Aristoteles’ Vorstellung der Freundschaft auf einige wenige Menschen beschränkt ist, passt nicht recht zu unseren Erfahrungen. Wir alle sind eine kuriose Mischung aus Tugenden und Unarten, und jeder von uns weiß, dass selbst unsere besten Freunde ihre Fehler haben. Es ist richtig, dass wir uns mit Menschen, die wir für böse halten, nicht anfreunden können. Doch meist haben wir kein Problem damit, die Fehler unserer Freunde – sowohl kleiner als auch großer Natur – zu entschuldigen.
Nichtsdestotrotz steckt in Aristoteles’ Sicht der Beziehung zwischen Freundschaft und Tugend eine tiefe Einsicht, die wir uns bewusst machen sollten.
In Euripides’ ›Iphigenie im Taurerland‹ reisen Orest und sein Freund Pylades nach Tauris, einer Stadt auf der Halbinsel Krim, um die den Taurern heilige Artemisstatue zu entführen und nach Athen zu bringen. In Tauris werden die beiden ergriffen und vor die Artemispriesterin geführt. Diese stellt sich als Orests Schwester Iphigenie heraus, die von ihrem Vater Agamemnon der Göttin geopfert worden war, damit die griechischen Schiffe Wind hatten, um nach Troja zu segeln. Die Göttin hatte Iphigenie damals in einen Nebel gehüllt und sie nach Tauris entrückt. Natürlich erkennt Iphigenie ihren Bruder zuerst nicht, auch Orest weiß nicht, wer die Frau vor ihm ist. In Tauris ist es Brauch, dass nur einer der beiden Gefangenen geopfert wird. Als man Orest die Wahl lässt, will er nicht, dass Pylades, »sein bester und treuester Freund«[59], an seiner Stelle stirbt. Dabei gibt er folgenden Grund an: »Ich bin der Schiffsherr dieser Unglücksfahrt, er mein Begleiter, Beistand meiner Müh.«[60] Ihre Freundschaft beruht also unter anderem auch auf Pylades’ Mut und Loyalität – seinen Tugenden.
Dies zeigt auch Orests Sicht auf Pylades. Er wäre nicht sein Freund, wenn er in seinem Charakter nichts Bewundernswertes fände. Aristoteles hebt dies klar hervor, wenn er schreibt, dass wir uns alle zu dem hingezogen fühlen, was »für uns« gut und angenehm ist – was wir gut und angenehm finden. Doch, so fährt er fort, was für uns gut und angenehm ist, muss nicht gut und angenehm an sich sein – also wesensmäßig oder objektiv gut und angenehm. Und da er denkt, dass Tugend das Einzige ist, was gut und angenehm an sich ist, geht er davon aus, dass nur Menschen, die Tugend wertschätzen, sich zu dem hingezogen fühlen, was objektiv gut und angenehm ist. Der Rest von uns, die wir nach Geld, Ehren oder überhaupt den »umkämpften Gütern«[61] streben, also – wie man hinzufügen könnte – das Falsche für Tugend halten, ist nicht so. Orest kann also nicht wirklich der Freund des Pylades sein, wenn Pylades’ Loyalität keine Tugend ist, sondern nur etwas, was Orest tugendhaft erscheint.[62]
Aristoteles hat diesbezüglich vollkommen recht: Wir können nicht mit Menschen befreundet sein, an denen wir nichts Schätzenswertes finden. Doch er glaubt auch, dass nur wenige Eigenschaften – eben die Tugenden – wirklich geschätzt werden können. Viele Philosophen jüngerer Zeit folgen ihm hierin, doch sie setzen dabei, aus den unterschiedlichsten und meist sehr komplexen Gründen, Tugend ausschließlich mit Moral gleich. In diesem Sinne wird dann geschlussfolgert, dass »Freundschaft ein moralisches Gut [ist] aufgrund ihrer Natur [und] aufgrund der Tatsache, dass das Leben mit diesem Gut, soweit es gelebt wird, ein wesentlich moralisches Leben ist.«[63]
Aber das kann nicht stimmen. Die Erfahrung zeigt uns, dass Moral häufig im Widerspruch zu unserer Liebe für unsere Freunde steht oder zumindest dafür nicht relevant ist. Einmal völlig abgesehen davon, dass sich die meisten Menschen über die Natur moralischer Tugendhaftigkeit noch weniger im Klaren sind als über ihre Freundschaften. Wir lieben unsere Freunde ja häufig nicht nur trotz ihrer Fehler, sondern mitunter gerade wegen dieser: Denken Sie doch nur mal an die Selbstherrlichkeit oder die Vergesslichkeit, die Sie an Ihrer Freundin so toll finden, auch wenn sie allen anderen damit den letzten Nerv tötet. Das ist eben Teil dessen, was wir meinen, wenn wir sagen, dass wir unsere Freunde »um ihrer selbst willen« lieben. Für Aristoteles ist dies gleichbedeutend mit: Wir lieben sie um ihrer Tugenden willen.[64] Ich glaube, dass er hier falsch liegt. Doch wenn wir seine Ansicht einmal vom Kopf auf die Füße stellen, kommen wir der Wahrheit vielleicht näher.
Tugenden existieren für Aristoteles objektiv. Sie in einem anderen anzuerkennen ist der Lebensfunke der Freundschaft: Ich möchte dein Freund sein um der Tugenden willen, die du bereits besitzt.[65] Doch obwohl wir akzeptieren können, dass Freunde einander um der Eigenschaften willen lieben, die sie aneinander bewundern, müssen dies doch keineswegs Moraltugenden sein, nicht einmal in dem deutlich weiter gefassten Sinn, der Aristoteles vorschwebte. Ihr Sinn für Humor kann für unsere Freundschaft wesentlich sein, für Aristoteles aber wäre er ein vernachlässigbarer Zug Ihres Charakters, der höchstens zu einer Annehmlichkeits-Philia führen kann. Und das gilt auch für Ihren Musikgeschmack, Ihre Lieblingsbücher, Ihren persönlichen Stil und für was weiß ich noch alles. Gleichzeitig sind die Eigenschaften, die ich an Ihnen bewundere, für mich – aber nicht notwendig für andere – Teil dessen, was Sie sind: So kann ich beispielsweise denken, dass der Verlust Ihres Humors Sie zu einem ganz anderen Menschen hat werden lassen und so unsere Freundschaft zerstört hat, auch wenn dieser Verlust – oder die Tatsache, dass Sie einmal Humor besaßen – für andere völlig irrelevant ist. Was ich an Ihnen anziehend finde, ist vielleicht gerade das, was andere völlig kalt lässt oder sogar abstößt. »Warum ist eine Besonderheit oder ein Makel bei diesem da gleichgültig oder widerwärtig und entzückt bei jenem anderen?«[66] Und nun drehen wir Aristoteles’ Gedanken einfach mal um: Statt den anderen wegen seiner allgemein anerkannten Tugenden zu schätzen, scheint uns, dass wir für Tugend halten, was wir am anderen bewundern, gleichgültig, ob diese Eigenschaften nun als Tugend an sich gelten können. Seine Bereitwilligkeit, Befehle anzunehmen und sie fraglos auszuführen, kann uns dann zu Freunden werden lassen, wenn wir beide Mitglieder einer Gang sind: Dann haben selbst schlechte Menschen Freunde.
Wenn wir Aristoteles auf diese Weise umdenken, bleibt vieles von dem erhalten, was er über die beste Art der philia herausgefunden hat. Aber natürlich entstehen damit auch weitere Fragen. Wo genau liegt der Unterschied, wenn ich Sie um Ihrer selbst willen liebe bzw. wenn ich Sie um Ihrer Großzügigkeit, Ihres guten Aussehens, Ihres Sinnes für Humor oder (ein beliebtes philosophisches Gedankenspiel) wegen Ihrer blonden Haarpracht liebe? Warum kann ich nicht sagen, dass ich Sie um Ihres Geldes willen liebe? Wie kommt es, dass ich, wenn ich Ihnen zu erklären versuche, warum ich Sie liebe, stets das Gefühl habe, den Kern nicht getroffen zu haben, obschon ich Ihnen ganze Litaneien vorbete? Wie, wenn überhaupt, ist Freundschaft mit Tugend und Moral verknüpft? Und was genau ist dieses so unglaublich bedeutsame Ding, das Selbst, das letztlich das einzig wahre Objekt der Liebe zu sein scheint und doch nie in Worte gefasst werden kann? Aristoteles hatte eine recht substanzielle Auffassung von der menschlichen Natur: Er setzte sie einfach mit unseren Tugenden gleich. Aus diesem Grund konnte er behaupten, dass wir, wenn wir unsere Freunde um ihrer Tugenden willen lieben, sie um ihrer selbst willen schätzen. Und dass Freundschaft, da sie untrennbar mit Tugend verwoben ist, uns nie auf Abwege führen kann. Doch die meisten Menschen unserer Zeit würden Aristoteles’ Sicht der menschlichen Natur ablehnen: Tatsächlich sind wir uns heute noch nicht mal einig, ob es so etwas wie eine menschliche Natur überhaupt gibt oder – falls es sie doch geben sollte – worin sie denn letztlich besteht. Und was können wir ohne ein klares Bild derselben schon über Freundschaft sagen?
Die moderne Philosophie jedenfalls hat zur Freundschaft nicht viel beizutragen, zum Teil wohl einfach deshalb, weil moderne Philosophen die Ansichten des Aristoteles übernommen haben, auch wenn sie seine Sicht der menschlichen Natur nicht teilen. Ein weiterer Grund ist wohl die Tatsache, dass im Westen das Christentum die heidnische Philosophie als Führerin in ein gutes Leben verdrängte.
Ein ganz wesentlicher Aspekt des aristotelischen Gedankengebäudes war ja, dass die philia, ob nun vollkommen oder nicht, ob auf Tugend, Nutzen oder Annehmlichkeit beruhend, in jedem Fall eine besondere, nur wenigen vorbehaltene Beziehung war. Die Menschen, denen man sich in Freundschaft verbunden fühlte, waren zwangsläufig wenige, ein winziger Ausschnitt aus dem großen Ganzen der Welt. Und man behandelte sie anders als den Rest der Menschen.[67] Für das christliche Denken stellte dies ein ernsthaftes Problem dar, daher wurde dort scharf unterschieden zwischen philia bzw. ihrem lateinischen Gegenstück amicitia auf der einen Seite und der universellen christlichen Liebe – der griechischen agapē bzw. der lateinischen caritas – auf der anderen.
Dass Freundschaft eine nur Wenigen vorbehaltene Beziehung ist, scheint uns so normal, dass wir es gar nicht erst erwähnenswert finden. Für die christliche Theologie aber war dies ein echtes Problem, denn dieser Umstand war ein direkter Widerspruch zum radikalen und zumindest zu Anfang subversiven Ideal der universellen Liebe. Als Jesus verkündete, das Gebot, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, stehe nur hinter dem Gebot zurück, Gott mit ganzem Herzen zu lieben, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken und aller Kraft, da legte er die sowohl im biblischen als auch im heidnischen Kontext überlieferte Vorstellung ad acta, dass der Nächste irgendwie zu uns gehört – weil er Teil der eigenen Familie, der Nachbarschaft, des eigenen Stammes oder Staates, der eigenen Religion war.[68]
Diese Vorstellung galt, ebenso wie das Prinzip, dass man seinen Freunden hilft und seinen Feinden schadet, der christlichen Lehre (nicht unbedingt der Praxis) als verabscheuenswert.[69] Die christliche Liebe ist Widerschein der Liebe Gottes. Die Liebe eines unendlichen Wesens, das alles und jeden uneingeschränkt liebt, wird – übersetzt ins endliche Reich des Irdischen – zur Liebe für alle, die Gott liebt. Also allen und jeden, auch und im Besonderen die eigenen Feinde. Denn indem man alle liebt, liebt man letzten Endes Gott selbst. Freundschaft aber bedeutet anders als die christliche Liebe, dass man manche Menschen mehr liebt als andere, denen man vielleicht nicht ablehnend, aber doch mehr oder weniger gleichgültig gegenübersteht. Freundschaft und christliche Liebe scheinen letztlich inkompatibel. Ihr Konflikt beruht auf dem permanenten Widerspruch zwischen der Parteilichkeit der Freundschaft und dem universellen Anspruch der religiösen Moral bzw. ihrer modernen philosophischen Ableger aus der Zeit der Aufklärung und danach.





























