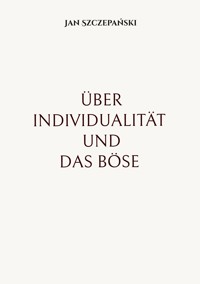
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Kann eine Theorie der Individualität in dem vorgeschlagenen Sinne überhaupt entwickelt werden? Der hier unternommene Versuch kann lediglich als Entwurf einer Formulierung von Grundannahmen angesehen werden. Allerdings kann man, meiner Meinung nach, bereits auf dieser Grundlage versuchen, Mechanismen und Funktionen der Individualität zu nutzen, um wirksame Strategien der Beseitigung des Bösen aus dem Leben des einzelnen Menschen und der Gesellschaft zu entwickeln. (Jan Szczepanski, Über Individualität und das Böse, S. 354-355)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
EINLEITUNG
INDIVIDUALITÄT: DEFINITION UND KONZEPT
Einführung
Die Existenzweisen des Menschen
Einige Fragen zu den Existenzweisen des Menschen
Grundlegende Annahmen
Bestandteile des Individualitätskonzepts
Das Konzept der Individualität
Person, Persönlichkeit und Individualität
FUNKTIONEN VON INDIVIDUALITÄT
Der Funktionsbegriff
Die Funktionen der Individualität im Leben der Person
Das Konzept der inneren Welt
Funktionen der Individualität: autonomes Handeln
Funktionen der Individualität: Wert einer Person
Funktionen der Individualität: persönliche Identität
Funktionen der Individualität: Kreativität
Funktionen der Individualität: Die Auseinandersetzung mit der Einsamkeit und der Vereinsamung
Funktionen der Individualität: Die Auseinandersetzung mit dem Leiden
Funktionen der Individualität: Die Auseinandersetzung mit der Zeit
Funktionen der Individualität: Die Auseinandersetzung mit dem Schicksal
Funktionen der Individualität: Mit dem Sterben zurechtkommen
FUNKTIONEN DER INDIVIDUALITÄT IM LEBEN DER GESELLSCHAFT
Einführung
Das Leben der Gesellschaft
Die Rolle der Individualität bei Aufrechterhaltung der Identität einer Gesellschaft
Die Funktionen der Individualität für den Wandel der Gesellschaft
Individualität und planmäßige Entwicklung der Gesellschaft
DAS PROBLEM DER BESTÄNDIGKEIT DES BÖSEN
Das Böse: eine Begriffsbestimmung
Die Arten des Bösen
Fragen nach der Beseitigung des Bösen
Der Kampf mit dem Bösen und der Kampf um das Gute
Von der Erziehung eines guten Menschen
Wie kann die Beseitigung des Bösen organisiert werden
Hilfe und Wohltätigkeit
Religion und die Beseitigung des Bösen
Die Beseitigung des Bösen durch Reformen und Revolutionen
Individualität und die Beseitigung des Bösen
VORWORT
Jan Szczepański (*14.09.1913 +16.04.2004) ist ein namhafter polnischer Soziologe. Er war Schüler von Florian Znaniecki und wirkte in der Nachkriegszeit an den Universitäten Łódz und Warschau als Hochschullehrer und Rektor. Darüber hinaus war er Mitglied der Polnischen Akademie der Wissenschaften, ihr Vizepräsident und Direktor des Instituts für Philosophie und Soziologie. Er gehörte als ausländisches Mitglied der Finnischen Akademie der Wissenschaften und als Ehrenmitglied der American Academy of Arts und Sciences sowie der National Academy of Education (USA) an. In den Jahren 1966 -1970 stand er als Präsident der Intertional Sociological Associecen vor. J. Szczepański beteiligte sich auch aktiv am politischen Leben seines Landes, war Sejmabgeordneter und Mitglied des Staatsrates, war in Beratungsgremien der polnischen Regierung tätig und mit der Leitung von verschiedener Regierungsprojekten betraut. Ihm wurden der doctor honoris causa von der Universität Brünn (1966), der Universität Łódz (1973), der Universität Warschau (1978), der Pariser René Descartes-Universität (1980) und der Schlesischen Universität Katowice (1985) verliehen. Seine umfangreichen wissenschaftlichen Arbeiten befassen sich mit der Theorie, der Geschichte und den Methoden der Soziologie. Seine Forschungsvorhaben beziehen sich vor allem auf den Wandel der Sozialstruktur, die wirtschaftliche und industrielle Entwicklung sowie die Bildung in Polen.1 Mit dem Konzept der Individualität hat sich der Autor erst am Ende seiner beruflichen Laufbahn eingehend befasst und seine Grundidee im Vortrag an der René Descartes Universität in Paris 1980 anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde vorgestellt 2, um sie anschließend am Wissenschaftskolleg in Berlin systematisch auszuarbeiten3 und in seinem Buch „O indywidualnosci“ (Über Individualität) 1988 in polnischer Sprache zu veröffentlichen.
Über die Entstehungshintergründe dieser Arbeit hat der Autor selber in einem Interview in der Reihe „Stimmen der Vergangenheit“ des polnischen Radios 4 berichtet und in Bezug auf seine früheren Publikationen gewürdigt. Er sagte: „Als ich 1945 nach Kriegsende von der Zwangsarbeit aus Deutschland nach Polen zurückkam, habe ich für mich die These formuliert, dass eines der Grundprobleme des Zwanzigsten Jahrhundert der Konflikt zwischen dem Sozialismus und der menschlichen Natur sei. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie dieser Konflikt wohl gelöst wird und wie der Sozialismus es schaffen wird, die Probleme und die Anliegen der Menschen zu lösen, die er zu lösen versprochen hat. Nun, er hat es nicht geschafft, und ich fragte mich warum? Zugleich habe ich mir eine andere Frage gestellt: Warum tritt im Leben des Menschen das Böse in der Regel so dauerhaft auf, warum können weder der einzelne Mensch noch die Gesellschaft oder ganze Zivilisationen und Kulturen sowie die großen Religionen das Böse aus dem Leben des Menschen beseitigen. Mal abgesehen davon, wie man das Böse definiert, stellte sich mir die Frage: Warum sind alle Revolutionen, die darauf ausgerichtet waren, die Gesellschaft zu verbessern, den Menschen vollkommen zu machen und einen neuen guten Menschentypus zu erschaffen, die Philosophen und Soziologen, wie beispielsweise Florian Znaniecki, der Methoden für die Erziehung eines guten und klugen Menschen vorgeschlagen hat, erfolglos geblieben. Warum hat das Christentum es nicht geschafft, einen Menschen zu erziehen, der, wenn er auf die rechte Wange geschlagen wurde, nicht seine linke hinhält, und der seinen Feind so liebt, wie sich selbst. Daher habe ich vor einigen Monaten ein Buch geschrieben, das ich als das wichtigste unter den dreißig Büchern erachte, die ich in meinem Leben verfasst habe. Mir wurde bewusst, dass der Mensch sein Leben eigentlich in zwei Existenzweisen vollzieht, als soziales Wesen und als Individualität. Als soziales Wesen wird er von der Gesellschaft bestimmt, wird erzogen und für das Leben in der Gesellschaft vorbereitet, als Individualität ist er ein autonomes Wesen, das über seine eigene innere Welt verfügt, die es ihm erlaubt, sich dem Druck der Gesellschaft und der Wirtschaft sowie allen Anforderungen der Politik und der Macht zu widersetzen, aber auch seinen eigenen biologischen Trieben und den eigenen psychischen Bedürfnissen Widerstand zu leisten. Diese innere Welt ist eine Angelegenheit eines jeden Menschen, sein eigenes inneres Werk. Immer dann, wenn wir mit einer Niederlage, einem Versagen konfrontiert und erniedrigt werden, die normalen Mechanismen, die Adler und die Individualpsychologie sehr genau beschrieben haben, uns nicht weiter helfen, dann ist die innere Welt unser einziger Zufluchtsort, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Daher interessiert mich nicht die Persönlichkeit des Menschen, da sie ein Produkt der Gesellschaft ist, es interessiert mich nicht das Individuum als handelnde Persönlichkeit, da es von vielen Faktoren der Außenwelt determiniert ist. Die Frage, die ich mir gestellt habe, lautet: Was ist die Ursache für die Tatsache, dass der Mensch gewisse Eigenschaften besitzt, die nur ihm eigen sind, und welche Rolle haben sie im Leben des Einzelnen und im Leben der Gesellschaft. Ausführungen zu diesem Thema habe ich auf 300 Seiten niedergeschrieben “.
Vorab ist anzumerken, dass der Autor bereits einige Jahre vor dem Erscheinen der vorliegenden Publikation ein anderes Buch5 herausgegeben hat, in dem er in Essays auf menschliche Anliegen wie Leiden, Einsamkeit, Hunger, Glaube einging und ihre Bewältigung mit der Individualität des Menschen in Verbindung gebracht hat. Beide Publikationen, die der Individualität gewidmet sind und vom Autor in einem relativ hohen Alter publiziert wurden, machen eine Wende in seinem Denken deutlich. Er geht auf neue Themen ein, zeichnet ein Gesellschaftsbild, das im Gegensatz zu dem steht, was er bislang vertreten hat, vertritt Ansichten, die in Widerspruch zu dem stehen, was er über Familie, Schule, Erziehung, Intelligenz, Nation und Gesellschaft geschrieben hat und wofür er sich auf vielen Feldern des öffentlichen Lebens authentisch eingesetzt hat6. Der Anlass für die Veränderung seiner Sichtweise und für seine Skepsis gegenüber den Erkenntnissen der Wissenschaft kann dem Vorwort zu seinem Buch „Über das Menschliche“ entnommen werden. Szczepański berichtet dort über seine traumatischen Erfahrungen im Krankenhaus, die ihn dazu bewogen haben, Themen aufzugreifen, mit denen sich der Mensch im Leben konfrontiert sieht. Seiner Meinung nach „muss jede praktische Tätigkeit notgedrungen dann in einer persönlichen Niederlage enden, wenn der Mensch wegen Alter, Zeit, Krankheit, Schwäche, fehlender Fähigkeiten oder aus anderen Gründen nicht mehr die Möglichkeit hat, sein Werk weiterzuführen..... Diese Essays können daher vielleicht ein Versuch sein, diese notwendige Niederlage zu überwinden, aufzeigen, dass ich auch dann, wenn ich in der stürmischen Agora nicht mehr tätig bin, in der Stille der Einsamkeit „Zeichen setze, die ewig bleiben“ (S. 8).
Im Mittelpunkt der Arbeit „Über Individualität“ steht die Frage nach der Genese des Übels und des Bösen, die den Menschen in seiner Geschichte unentwegt begleiten. Damit verbunden steht das Bestreben, nach einer Lösung zu suchen, die dafür geeignet ist, das Böse, wenn nicht zu beseitigen, so doch wenigstens zu minimieren. Die Tatsache, dass der Autor diese Frage aufgreift, scheint mitunter auch von seiner Grundgesinnung bestimmt zu sein, die in seinen familiären Erfahrungen ihre Wurzeln hat. Der deutsche Soziologe René König (1906 - 1992), der mit dem Autor befreundet war und dem er im Amt des Präsidenten der International Sociological Association 1966 folgte, sagte einmal in einem privaten Gespräch: „Den Szczepański kann man nur dann verstehen, wenn man seine pietistische Vergangenheit kennt.“ J. Szczepański hat in seinen letzten Lebensjahren seine Kindheit und Jugend sowie die Lebensverhältnisse auf dem elterlichen Bauernhof in anschaulicher Weise beschrieben.7 Nach dem protestantischen Arbeitsethos bringt die Arbeit, sei es die schwere körperliche Arbeit auf dem Acker, sei es die intellektuelle Arbeit eines Schriftstellers oder Wissenschaftlers, und nicht zuletzt die Arbeit an sich selbst, das Gute im Menschen zum Vorschein. Die Pflichterfüllung und die Verantwortung für andere verlangt von ihm darüber hinaus, mit der Zeit sparsam umzugehen, jede Minute wie einen Groschen mehrmals umzudrehen, bevor sie ausgegeben wird. Die Frucht menschlicher Bemühungen ist das Gute, das mühselig erarbeitete „Brot“, das den Menschen ernährt und am Tisch mit der Familie geteilt wird. Es sind Spuren, „Zeichen, die wir für die Ewigkeit“, hinterlassen. Das Übel und das Böse besteht dagegen im Leiden, das einem anderen Menschen zugefügt wird. Der Mensch kann sich mit Erfolg für das Gute einsetzen und sich der Macht des Bösen, die ihn bedrängt, entgegensetzen. Die Kraft dafür schöpft er aus seiner Innenwelt, aus der Tiefe seiner Seele, wo er sich in einem inwendigen Gespräch an seinen Schöpfer unvermittelt wenden kann. Dessen Gnade bewahrt ihn vor Unheil und gewährt seiner Seele das ewige Leben.
Das Böse ist nach Szczepański nicht nur eine religiöse oder ethische Kategorie, es hat vielmehr eine Vielzahl von Erscheinungen und geht mit dem Leben schlechthin einher. Die Hierarchie der Macht, des Einkommens, des Vermögens und des Prestiges sowie die Unterschiede zwischen den sozialen Klassen, Schichten und Gruppen sind die wesentlichen Faktoren, die das Böse in den sozialen Beziehungen entstehen lassen. Den Autor interessiert vor allem dieses systemische, „gesellschaftliche Böse“, das sich zwangsläufig aus dem Wirken von Institutionen und Strukturen einer Gesellschaft ergibt. Es ist das Böse, demgegenüber der Mensch oft indifferent ist und für dessen Folgen er nicht bereit ist, die moralische Verantwortung zu übernehmen.8 Szczepański definiert daher für seine Untersuchung das Böse aus der Sicht des „Opfers“ als das „unverschuldete Leiden“, das einem anderen Menschen angetan wird. Die Geschichte zeigt, dass die vielen Versuche, das Böse zu eliminieren, die von Reformen, Revolutionen, Erziehungsmaßnahmen und spezialisierten Hilfsprogrammen unternommen wurden, ohne Erfolg blieben. Sie scheiterten, weil sie verkannten, dass das Böse seinen Ursprung in der Gesellschaft hat und durch eine Veränderung der Gesellschaft und eine intensivierte Sozialisation des Einzelnen nicht behoben, sondern nur noch verstärkt wird.
Szczepański geht in seiner Analysen von der Feststellung aus, dass sich das Dasein des Menschen in zwei Existenzweisen vollzieht. Da sein Leben grundsätzlich von der Sorge, seinen Lebensunterhalt zu sichern, bestimmt ist, ist er in seiner gesellschaftlichen Existenzweise darauf angewiesen, mit anderen Menschen zusammenzuwirken und sich am Wettbewerb und an Konflikten, am Kampf um Positionen, Besitz, Macht und Ansehen zu beteiligen, die das Böse hervorbringen. Der gesellschaftlichen Existenzweise stellt der Autor die individuelle Existenzweise des Menschen entgegen. Sie bildet die Innenwelt, in die der Einzelnen sich zurückziehen kann und in der er mit sich selbst alleine ist. In ihr gibt es keinen Anderen, daher auch weder das Gute noch das Böses. Die Innenwelt des Einzelnen weist Eigenschaften auf, die nur bei einem Individuum und sonst bei keinem anderen anzutreffen sind und die mit der Außenwelt in keiner Verbindungen stehen. Die den Ausführungen zugrunde gelegte Dichotomie der Lebenswelt stellt eine Radikalisierung des ursprünglichen Konzepts des dreidimensionalen Menschen dar, das der Autor noch in seinem Buch „Über das Menschliche“ vertreten hat. Weggefallen ist „die Welt dazwischen“ ( świat między, S. 71 ff.), in der, wie beispielsweise in der Freundschaft, der Mensch dem Anderen als Menschen authentisch begegnet und in der er das „Mitsein“ in der Welt, das für das Selbstsein konstitutiv ist, intensiv erlebt. Auch wenn in dieser Begegnung der Einzelne seine spezifische, nur ihm zugängliche innere Gestimmtheit dem Anderen nicht vollumfänglich mitteilen kann, sind für ihn die Erfahrungen aus dieser „Zwischenwelt“ von existenzieller Bedeutung. Die Dichotomie der Lebenswelt bringt für die Darstellung der Rolle der Individualität zwar eine hilfreiche Kontrastierung mit sich, nimmt jedoch in Kauf, dass dadurch Aspekte ausgeschlossen werden, die für die Frage nach Möglichkeiten der Eliminierung des Bösen nicht ohne Bedeutung sind.
Im Mittelpunkt der Erörterung steht das Konzept der Individualität. Sie wird als „innere Kraft“ oder als „Lebensmechanismus“ beschrieben, und bildet den Kern der individuellen Existenzweise des Menschen. Dieser Lebensmechanismus kommt auch dann zum Einsatz, wenn sich der Einzelne seiner Wirkung nicht bewusst ist, gewinnt aber erst eine besondere Ausstrahlungskraft, wenn der Mensch sich seiner selbst bewusst wird. Die Individualität einzelner Menschen trägt dazu bei, den Bestand der Lebenswelt zu sichern, ist jedoch vor allem die entscheidende Kraft, die Neues zu erschaffen vermag. Ihre Hauptfunktion besteht darin, eine Innenwelt zu errichten, die dem Einzelnen ein für ihn spezifisches Wissen, Werte und Identität zur Verfügung stellt. Sie ist ihrer Art und ihrem Inhalt nach einzigartig und nur dem Einzelnen und keinem anderen eigen. Sie enthält nichts von dem, was in der Außenwelt vorzufinden ist, und wird als ihr Gegensatz definiert. Was in ihr vorhanden ist, kann nicht benannt werden, es kann nur gesagt werden, was in ihr nicht vorhanden ist.9 Bislang wurde Individualität in der Forschung nicht ausreichend gewürdigt und der von ihr bestimmte Existenzbereich des Menschen kaum erforscht. Ihre spezifische Wirkung wurde nicht als eigenständiger Faktor angesehen, sondern meistens als korrekturbedürftige Abweichung abgetan. Allerdings kommt hier die Frage auf, die sich der Autor in diesem Zusammenhang auch selber stellt: Kann eine so definierte Individualität überhaupt Gegenstand einer neopositivistisch orientierten Sozialforschung werden und wäre daher nicht ein anderes Paradigma für die Erforschung der Individualität vonnöten? Im Zusammenhang mit der Klärung dieser Frage, müssten auch die anthropologischen Grundannahmen, die in dem vorliegenden Konzept der Individualität nicht explizit gemacht wurden, benannt und diskutiert werden.
In den folgenden Kapiteln entfaltet der Autor die Funktionen der Individualität, und diskutiert ausführlich ihre Wirkungen, die sie für den Einzelnen und die Gesellschaft hat. In Kapitel II werden die Funktionen der Individualität behandelt, die den Einzelnen dazu befähigen, Probleme zu bewältigen, mit denen er in seinem Leben konfrontiert wird. In Kapitel III wird geprüft, welche Funktion Individualität für den Fortbestand und für die Weiterentwicklung der Gesellschaft hat oder haben kann. Dabei wird eine ganz besondere Bedeutung ihrer kreativen Kraft zuerkannt. Die Werke, die der Einzelne aus sich selbst hervorbringt, sind Schöpfungen seiner Individualität, die, dem Autor zur Folge, ohne Rückgriff auf eine wie auch immer geartete Transzendenz auskommen. In einem besonderen Kapitel (IV) wird schließlich geprüft, welchen Beitrag Individualität bei der Eliminierung des Bösen in der Gesellschaft leisten könnte.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass Szczepański nicht die Absicht hatte, in seinem Buch eine abgeschlossene Theorie der Individualität zu liefern. Er wollte lediglich eine Skizze einer solchen Theorie präsentieren, um für die Zukunft Forschungsanstrengungen in dieser Richtung anzuregen. Die aufgezeigten Defizite und offen gebliebene Fragen sind daher vor allem als Anreiz und Herausforderung zu sehen, den vorgestellten theoretischen Ansatz kritisch aufzunehmen und sowohl das Konzept der Individualität als auch die aus diesem Konzept sich ergebenen Methoden und Maßnahmen einer „individuellen Pädagogik“ weiterzuentwickeln. Ein weiterer Verdienst dieser Publikation liegt, wie ich meine, in ihrem Beitrag, die Gesellschaft zu „entzaubern“, d.h. den weitverbreiteten Glauben in Frage zu stellen, dass eine Verbesserung der Lebensbedingungen des Menschen, insbesondere die Minderung des menschlichen Leidens, alleine durch gesellschaftliche Reformen und die Optimierung von Sozialisationsprozessen zu erreichen sind. Damit einher geht die Kritik der Wissenschaftsgläubigkeit, d.h. des Glaubens, dass durch wissenschaftliche Erkenntnisse, insbesondere die der Soziologie, der Mensch in der Lage sei, Gesellschaftsstrukturen nach Belieben zu gestalten. Die zum Teil als Provokation empfundenen Ausführungen des prominenten Fachvertreters dürfte wohl ein Grund dafür gewesen sein, dass das Buch in der polnischen Soziologie keine größere Diskussion ausgelöst und eher in der Sozialpädagogik eine Rolle gespielt hat10. Bei der Würdigung des Buches ist nicht zuletzt auch zu bedenken, dass die Ausführungen, die in diesem Buch zu den fundamentalen Fragen unserer Zeit gemacht werden, bereits vor über vierzig Jahren in der Zeit des Kalten Krieges niedergeschrieben wurden. Sie waren nicht nur damals von großer Relevanz, sondern sind auch heute, angesichts bestehender Krisen, aktueller denn je.
Mein Dank gilt an dieser Stelle vor allem an Herrn PD Dr. Alexander Hesse und Herrn Prof. Dr. Christian Tesch, beide vormals Universität Siegen, die meine Arbeit an der Übersetzung mit Rat und Tat begleitethaben, jederzeit für Gespräche bereit waren und mich durch Korrekturvorschläge tatkräftig unterstützt haben. Nicht zuletzt danke ich meiner Frau Gabriele Reschka, die bereitwillig das mühsame Korrekturlesen übernahm. Die Verantwortung für die Übersetzung des Textes liegt allerdings alleine bei mir.11
Willibald Reschka
1 Das Verzeichnis seiner Publikationen bis 1983, das in der Festschrift zu seinem 70. Geburtstag zu finden ist, umfasst bereits 1102 Positionen, s. Społeczeństwo i Socjologia. Księga poświęcona Profesorowi Janowi Szczepańskiemu (Gesellschaft und Soziologie. Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Jan Szczepański), Wroclaw 1985, S. 614-662, und ist bis zu seinem Tode auf etwa 1500 gestiegen.
2 Individuality and society, in: Impact of science on society Jg. 31, 1981, Nr. 4, S. 462-466
3 Jan Szczepański, Gesellschaft – Person – Individualität ist erschienen in: Wissenschaftskolleg. Jahrbuch 1984/85, S. 423-430
4 Polskie Radio (Dwójka/Glosy z przeszłości) nagranie Bozena Moskowska https://player.polskieradio.p1/koleika:https://www.polskieradio.pl/8/755/ Artykul/948709, Czym-jest-szczęscie-Gawędy-Jana-Szczepanskiego
5 Jan Szczepański, Sprawy ludzkie (Über das Menschliche), Warszawa 1978
6 Vgl. Piotr Tobera, Człowiek wielowymiarowy, czyli o koncepcji indywidualności Jana Szczepańskiego (Der mehrdimensionale Mensch oder Über das Konzept der Individualität bei Jan Szczepański) in: Przegląd Socjologiczny Bd. 54, 2005, Nr. 1-2, S. 251
7 Jan Szczepański, Korzeniami wrosłem w ziemię (Meine Wurzeln sind im bäuerlichen Acker), Katowice 1984; vgl. hierzu auch Katarzyna Szkaradnik, Sociologist „Sketching Etemel Signs“. Jan Szczepański's Distracted Self-Portrait in: Zaganienia Rodzajów Literackich, Jg. 58, 2015, Nr. 58, H. 1, S. 41-55,
8 Hannah Arendt schließt ihre Ausführungen über das Böse mit den Worten: „Diese Indifferenz stellt, moralisch und politisch gesprochen, die größte Gefahr dar, auch wenn sie weit verbreitet ist. Und damit verbunden und nur ein bißchen weniger gefährlich ist eine andere gängige moderne Erscheinung: die häufig anzutreffende Tendenz, das Urteil überhaupt zu verweigern. Aus dem Unwillen oder der Unfähigkeit, seine Beispiele und seinen Umgang zu wählen, und dem Unwillen oder der Unfähigkeit, durch Urteil zu Anderen in Beziehung zu treten, entstehen die wirklichen „skandala“, die wirklichen Stolpersteine, welche menschliche Macht nicht beseitigen kann, weil sie nicht von menschlichen oder menschlich verständlichen Motiven verursacht wurden. Darin liegt der Horror des Bösen und zugleich seine Banalität“ (Über das Böse. Eine Vorlesung zur Frage der Ethik. 4. Auflage, München 2010, S. 150)
9 S. Andrzej Grzegorczyk, Rezension in: Studia Socjologiczne 1990, Nr. 3-4, S. 147-148
10 Vgl. Rezension: Grzegorz Lutomski, O człowieku, który się społeczeństwu nie kłaniał (Vom Menschen der sich dem gesellschaftlichen Druck nicht beugte), in: Studia Socjologiczne 1990, Nr. 3-4, S. 148-152; Tomasz Leszniewski, Indywidualność w społeczeństwie jako propozycja nowego paradygmatu w socjologii? Refleksja nad koncepcją Jana Szczepańskiego (Individualität in der Gesellschaft, ein neues Paradigma in der Soziologie? Überlegungen zur Konzeption von Jan Szczepański) in: Kulura i Edukacja 2013, Nr. 4 (97), S. 94-110; Wiesław Theiss, Stary człowiek – autobiograficzna perspektywa Jana Szczepańskiego (Der alte Mensch – die autobiographische Sichtweise von Jan Szczepański) in: Pedagogika Społeczna Jg 2013, H. 3 (49), S. 37-50
11 J. Szczepański hat seine Ausführungen zuweilen als Notizen bezeichnet und damit angedeutet, dass die inhaltliche Argumentationsführung Vorrang vor einer ausgefeilten sprachlichen Formulierung hat. Dieses Prinzip wurde auch für die Übersetzung übernommen. In den Fällen, in denen durch Straffung der Ausführung die Argumentationslinie besser zum Ausdruck gebracht werden konnte, wurde auf Wiederholungen, Zuspitzungen der Formulierung u.ä. verzichtet oder auch eine andere kontextbezogene Begrifflichkeit verwendet. Beispielsweise beinhaltet in der polnischen Sprache der Begriff „zło“, entsprechend dem lateinischen Gegensatz von bonum und malum, ein viel breiteres Bedeutungsspektrum, das in der deutschen Sprache mit den Begriffen: das Böse, das Übel oder das Unheil zum Ausdruck gebracht werden kann. Hinzu kommt, dass Szczepański das Böse in einer eigens definierten Bedeutung benutzt. In der Übersetzung wird daher je nach Kontext „zło“ entweder mit den Begriffen das Böse oder das Übel wiedergegeben. Darüber hinaus wurden die bibliographischen Angaben in der Fußnoten überprüft und gegebenenfalls korrigiert.
EINLEITUNG
Zu den „großen Fragen“, die in der Philosophie und in der Ideengeschichte des sozialen Denkens immer wieder angegangen, jedoch nie endgültig gelöst wurden, gehört zweifelsohne das Problem der Beständigkeit des Bösen in Leben des Einzelnen und der Gesellschaft. Das Böse wird dabei sehr unterschiedlich definiert. Die philosophischen und theologischen Nachschlagewerke führen hierzu eine Reihe von Definitionen auf. Desgleichen gibt es eine große Anzahl von Vorstellungen, die sich auf den Ursprung des Übels und die Möglichkeiten seiner Beschränkung oder Eliminierung aus dem Leben des Menschen beziehen. Das Übel kommt, ganz allgemein formuliert, in einer Vielfalt von negativen Erscheinungen in allen Lebensbereichen des Menschen zum Vorschein, und zwar des Menschen als eines organisch und psychisch verfassten Lebewesens, des Menschen als Mitglied einer Gesellschaft, sowie des Menschen als Schöpfer und Teilhaber einer Kultur. Alle Erscheinungen des Übels weisen einen gemeinsamen Bestandteil auf, ein unverschuldetes Leiden in Folge von Krankheit, Seuche, Hungersnot, Gefangenschaft, Krieg, Ausbeutung, Verfolgung, Tortur, Naturkatastrophen, Verletzungen, angeborenen Fehlern, die den Menschen über Jahrhunderte ununterbrochen begleitet haben und auch weiterhin begleiten.
Einzelne Menschen und Gesellschaften haben selbstverständlich eine Reihe von Methoden geschaffen und weiterentwickelt, wie mit dem Übel in ihrem Leben umzugehen sei. Im Zuge der Evolution hat die menschliche Psyche sowohl Mechanismen der Anpassung wie eine auf Prävention und Abhilfe ausgerichtete Intelligenz, Mechanismen der Entschädigung, der Geduld und Hinnahme sowie Methoden der Verteidigung im Kampf mit dem Übel ausgebildet als auch versucht, mit Hilfe von Erziehung zum Guten, von Reformen und Revolutionen sowie Religionen den Menschen vollkommener zu machen und das von ihm herbeigeführte Leid zu beschränken. Es wurde eine Vielzahl von Ideen und Ideologien, Religionen und Sekten ins Leben gerufen, die eine vom Leid befreite, bessere Welt entwarfen. Zur Verwirklichung und Umsetzung dieser Ideen wurden seit dem Sklavenaufstand im Altertum bis ins zwanzigste Jahrhundert Organisationen, soziale Bewegungen, politische Parteien, Kirchen und Orden sowie Institutionen und Vereine gegründet. Doch Geschichtswissenschaftler weisen in ihren Arbeiten darauf hin, dass keine dieser Reformen, Revolutionen, Religionen und Ideologien es vermocht hatte, das Böse wesentlich einzuschränken, geschweige denn zu verhindern. Auch alle Anstrengungen, die darauf ausgerichtet waren, den von Florian Znaniecki ersehnten „vernünftigen und guten“ Menschen zu erziehen, blieben vergeblich, wohingegen sich eine Erziehung zu unheilbringenden Handlungen, wie das beispielsweise bei den Janitscharen und der SS der Fall war, als außerordentlich erfolgreich erwies. Auch dem Christentum misslang es, seine Anhänger so zu erziehen, dass sie ihre rechte Wange entgegenhielten, wenn sie auf die linke Wange geschlagen wurden, und ihre Feinde so liebten wie sich selbst. In der nachrevolutionärer Zeit versagten ebenfalls alle Versuche einen „neuen Menschen“ zu erziehen. Damit erweist sich, dass der Kampf um das Gute massiv zum Erhalt und zur Wiederbelebung des Bösen beiträgt, zumal jedweder Kampf dem Wesen nach darin besteht, dem Gegner Leid zuzufügen, um ihn zu Fall zu bringen und zu vernichten. Wie viele Menschen in Kriegen und religiösen Verfolgungen ums Leben gekommen sind, weiß wohl Gott allein, der in einigen Religionskriegen sogar dafür zu sorgen hatte, aus denen zum Tod vorbestimmten Opfern jene auszusondern, die an ihn glaubten. Kurzum, es stellte sich heraus, dass die Art und Weise, in der gesucht wurde, das Übel zu eliminieren und das Gute herbeizuführen, wesentlich zum Fortbestand des Bösen beigetragen hat. In unserer Zeit, d.h. seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, im Zuge eines beträchtlichen Fortschritts in der wissenschaftlichen Forschung und der Technik, mit deren Hilfe eine erfolgreiche Umgestaltung der natürlichen Umwelt erreicht werden konnte, war man der Meinung, dass diese beiden Tätigkeitsbereiche die Kraft haben würden, den Menschen zu guter Letzt „mit wissenschaftlichen Methoden“, d.h. auf rationalem Wege, erfolgreich vom Bösen zu befreien. Der Glaube an den menschlichen Fortschritt durch Wissenschaft und Technik herrschte zu Beginn des 20. Jahrhundert solange vor, bis die Menschheit durch die beiden Weltkriege mit der nuklearen Zerstörung und den ökologischen Katastrophen konfrontiert wurde. Sowohl im Jahr 1918 wie auch 1945 wurde von Millionen Europäern aus tiefster Überzeugung die Losung „Nie wieder Krieg“ skandiert; trotzdem gab es zwischen 1918 und 1939 mehrere Kriege und zwischen 1945 und 1985 waren es sogar über 150. Kurzum, das Böse ist auch weiterhin ein treuer Begleiter des Menschen geblieben. Warum?
Die Frage, auf die ich versuche in diesem Buch eine Antwort zu geben, möchte ich wie folgt formulieren: Welche Methoden der Beseitigung des Übels wurden im Laufe der Geschichte eingesetzt und warum erwiesen sie sich als wirkungslos? Wie wurde das Übel definiert, und was wurde als seine Ursache angesehen? Existieren noch andere als die bislang zum Einsatz gelangten Methoden der Beschränkung und der Beseitigung des Übels? Ist das Böse ein immanentes Element der „menschlichen Natur“, und ergibt es sich aus den natürlichen Neigungen und angeborenen Eigenschaften des Individuums, also aus seinem Organismus, seiner Psyche und seinem sozialen Wesen, oder resultiert es notwendigerweise aus der „Natur der zwischenmenschlichen Beziehungen“, und wird in einem Bereich erzeugt, der erst dann zur Wirklichkeit wird, wenn der Mensch auf einen anderen Menschen einzuwirken beginnt? Wo sollte folglich nach Methoden und Kräften zur Beseitigung des Übels gesucht werden? Im Einzelnen oder in der Gesellschaft?
Für jemanden, der von der Schule des Logischen Positivismus herkommt, sind das sehr allgemein gehaltene Fragen. Jeder meiner akademischen Lehrer würde sagen, dass es schwierig sein dürfte, auf so unpräzise Fragen eine präzise Antwort zu finden. Dieser Einwand ist berechtigt, aber die Formulierung wurde von mir bewusst und mit Absicht so vorgenommen, um eine in der Ideengeschichte seit Jahrhunderten anzutreffende Frage hier wieder aufzunehmen. Um traditionelle Implikationen der Problematik einzubeziehen, ist auch die Betrachtungsweise in diesem Buch auf einem allgemeinen, wenn nicht sogar vagen Niveau gehalten worden. Die vorgeschlagene Antwort, die in einer Reihe von Hypothesen enthalten ist, ist deshalb ebenfalls von sehr allgemeiner Natur.
Ausgangspunkt der Betrachtung ist der Mensch als Einzelperson in allen Dimensionen seiner Existenz – der physikalischen, biologischen, psychischen, sozialen und kulturellen. Jede Person hat einen bestimmten Satz von Eigenschaften, die wir hier in drei Gruppen einteilen: jene, die allen Exemplaren der Gattung Homo sapiens oder größeren und kleineren Kollektiven gemeinsam sind, weiter jene, die bei vielen Menschen ähnlich geartet sind und schließlich diejenigen, die einer und nur einer Person eigen sind. Eigenschaften und Merkmale, die bei einer und nur einer Person auftreten, bilden die Grundlage ihrer Individualität. Dabei wird von uns zwischen Individualität, dem Individuum, dem Einzelnen, der Persönlichkeit und der Person streng unterschieden. Der Einzelne, die Person oder die Persönlichkeit bilden ein System, das aus allen drei Eigenschaftsgruppen zusammengesetzt ist, während Individualität ein System ist, das nur aus solchen Eigenschaften besteht, die ausschließlich dem Einzelnen eigen sind. Individualität ist somit lediglich ein Element der Persönlichkeit und daher nicht mit ihr zu verwechseln, umfasst sie doch darüber hinaus soziale Merkmale, die bei vielen Personen in gleicher oder ähnlicher Ausprägung anzutreffen sind. Persönlichkeit und Individuum sind somit soziale Gebilde, Individualität dagegen ein eigenartiges Gebilde, das, wenn es auch in irgendeiner Art und Weise von der Gesellschaft geprägt wird und umgekehrt auch auf sie einwirkt, doch ein Gebilde eigener Art bleibt.
Im Weiteren gehe ich von einer Annahme aus, die bereits seit dem Mittelalter in der Philosophie bekannt war, dass nämlich der Mensch in „zwei Existenzweisen“ lebt, als Individualität und, bedingt durch seine Mitgliedschaft in der Gesellschaft, als soziales Wesen. Vereinfacht und zugegeben sehr ungenau ausgedrückt, könnte gesagt werden, der Mensch lebe als „Ich“ und als „Wir“. Es ist eine ungenaue Formulierung, da das „Ich“ (Self, Ego u.ä.) in der psychologischen und soziologischen Theorie als ein System bezeichnet wird, das sich nicht nur aus individuellen, sondern auch aus mit anderen geteilten sowie ähnlichen Eigenschaften zusammensetzt und somit weit entfernt von der hier zugrunde gelegten Konzeption der Individualität ist.
Das Buch unternimmt den Versuch, eine allgemeine Konzeption von Individualität als einem zentralen Lebensmechanismus herauszuarbeiten, der im Leben der Gesellschaft und des Einzelnen wichtige Funktionen erfüllt. Gleichzeitig analysiert es in allgemeiner Form, die von der gesellschaftlichen Existenzweise unabhängige individuelle Existenzweise und zeigt auf, wie die Funktionen der Individualität in der individuellen Existenzweise begründet sind. Die Überlegungen finden hier auf mehreren Ebenen statt: der ontologischen, der psychologischen und der gesellschaftlichen. Die Analyse der Funktionen, die von der Individualität im Leben des Einzelnen wie auch der Gesellschaft wahrgenommen werden, bilden den Ausgangspunkt für die Formulierung von Hypothesen, die sowohl auf die Erfolglosigkeit von Methoden der Beseitigung des Übels als auch auf Gründe für das andauernde Vorhandensein des Bösen im menschlichen Leben Bezug nehmen. Die Betrachtungen der Funktionen von Individualität erscheinen stellenweise allzu weit gefasst und überschreiten sicher den Rahmen, der für eine Analyse des Übels und seiner Bekämpfung notwendig gewesen wäre. Sie wurden absichtlich so angelegt, damit sie nicht nur in dieser Publikation, sondern auch bei anderen Analysen genutzt werden können.
Die hier aufgestellten Hypothesen stehen im scheinbaren Widerspruch zu anerkannten soziologischen Theorien des Menschen, mit Theorien des menschlichen Handelns und zu vielen Vorstellungen der kulturellen und philosophischen Anthropologie. Ich vertrete die Auffassung, dass viele Methoden der Bekämpfung des Bösen, solche wie Erziehung, Reformen und Revolutionen sowie Hilfs- und Wohltätigkeitsorganisationen u.ä., im Grunde genommen lediglich solche Faktoren verstärkt haben, die eigentlich das Böse hervorbringen. Sie richten sich an soziale Eigenschaften, die in gleicher oder ähnlicher Ausprägung in großen Kollektiven vorzufinden sind und somit an die gesellschaftliche Existenzweise des Menschen, und versuchen das Übel durch eine Intensivierung der Vergesellschaftung zu eliminieren, also eigentlich durch die Steigerung jener Eigenschaften, die das Böse hervorbringen. Ich stelle dagegen die Behauptung auf, dass das Übel durch eine Stärkung der Funktionen von Individualität erfolgreich beseitigt werden könnte. Dank ihrer Fähigkeit, das menschliche Verhalten zu koordinieren, könnten nämlich in die soziale Welt Werte „übertragen“ werden, die aus der individuellen Existenzweise stammen, in der das Böse nicht existiert, weil es in dieser Existenzweise keine anderen Menschen, somit auch keine Konflikte, keine Aggressionen, keine Gewinnsucht, kein Machtstreben und keine Prestigekämpfe gibt.
Im ersten Kapitel dieser Arbeit werden unterschiedliche Konzeptionen von Individualität erwogen, und eine Definition bzw. der Abriss einer hypothetischen Konzeption von Individualität vorgeschlagen. Im zweiten Kapitel werden sodann die Funktionen einer so definierten Individualität im Leben einer Person, in den unterschiedlichen Dimensionen ihres Daseins dargestellt. Die wichtigste Funktion der Individualität besteht darin, eine innere Welt des Menschen zu erschaffen, in der ihre Autonomie gegenüber der äußeren Welt begründet ist, zu einer Außenwelt, der nicht nur andere Menschen, Gegenstände und die Natur angehören, sondern auch all das, was die Psyche einer Person von Außen in sich hineinnimmt. Die hier zugrunde gelegten Konzeptionen von Außen- und Innenwelt unterscheiden sich sowohl von den Konzepten, die im Allgemeinen in der Psychologie gelten, als auch von den Vorstellungen, die im Alltagswissen enthalten sind, da alles das, was die Psychologie, selbst die Tiefenpsychologie, für die innere, psychische Welt des Menschen als wesentlich erachtet, von mir als Außenwelt eingestuft wird. Es würde mich nicht wundern, wenn dieses Konzept sowohl Widerstand als auch Entrüstung hervorrufen würde. Dessen ungeachtet stellt die hier entwickelte Innenweltkonzeption, die sich gängiger Empfindungen und alltäglicher Erfahrungen zunutze macht, die Innenwelt als ein Bollwerk zum Schutz der Autonomie einer Person dar, das nicht nur dem Druck standzuhalten hat, der seitens der Gesellschaft und der Kultur ausgeübt wird, sondern auch dem, der sich aus biologischen und psychischen Trieben herleitet. Eine so definierte innere Welt kann bei der Beseitigung des sozialen Übels eine wichtige Rolle spielen.
Das dritte Kapitel behandelt einige Funktionen von Individualität im Leben der Gesellschaft und konzentriert sich dabei auf zwei wichtige Prozesse: auf die Wahrung von Kontinuität und Identität der Gesellschaft und auf ihre Veränderungen, insbesondere auf solche, die sich aus dem gesellschaftlichen Wandel ergeben. Beide Prozesse werden von mir unter zwei Gesichtspunkten behandelt – unter dem der Spontaneität und dem der Organisation. Das vierte Kapitel geht schließlich auf das zentrale Problem der Beständigkeit des Bösen im Leben des Einzelnen und der Gesellschaft ein. Das Böse wird definiert, es wird den Ursachen seiner Entstehung nachgegangen, nach den Gründe für die Erfolglosigkeit der angewandten Methoden bei der Beseitigung des Übels gefragt und abschließend in einer gewagten Vision auf eine Erfolg versprechende Möglichkeit der Beseitigung des Bösen verwiesen, die in der Nutzung des Individualitätsmechanismus, der individuellen Innenwelt und der Funktionen der Individualität im gesellschaftlichen Leben gesehen wird. Die hier entwickelten Konzepte sind selbstverständlich darauf angewiesen, hinsichtlich der ihnen zugrunde gelegten Hypothesen bezüglich der Individualität und der inneren Welt, verifiziert zu werden. Das Buch stellt keinesfalls eine Darlegung von Ergebnissen empirischer Forschung dar. Jedoch werden in ihm zweifelsohne Erträge aus einer fünfzigjährigen Forschung, aus Überlegungen und Lektüren, aus der akademischen Lehre sowie aus Erfahrungen zum Ausdruck gebracht, die sich seit 1935, dem Jahr meiner ersten Publikation von Analysen autobiografischen Materials, angesammelt haben. Ich bin davon überzeugt, dass auch für die Verifizierung der hier in Bezug auf Individualität formulierten Hypothesen, die Analyse von Autobiographien eine wichtige Methode bilden könnte. Doch das wäre bereits eine Themenstellung für ein weiteres Buch. Diese Publikation ist lediglich ein allgemeiner Aufriss einer Konzeption, einer Vision von Möglichkeiten, die auf systematische Forschung in der Zukunft wartet. Sie versucht die schöpferischen Fähigkeiten des Menschen zu ergründen, auf die er setzen kann, wenn er willens ist, sich von dem Bösen zu befreien, das ihn bislang ständig begleitet hat. Um sich vom Bösen zu befreien, wandte sich der Mensch jahrhundertelang an die ihm nahestehenden Menschen und suchte ihre Solidarität, Kooperation und Hilfe. Das Buch legt ihm nahe, diese Hilfe bei sich selbst zu suchen. Meiner Meinung nach würden ihm die eigene Individualität und die eigene Innenwelt hierbei einen besseren Dienst erweisen.
Das Buch entstand während meines zehnmonatigen Aufenthalts am Wissenschaftskolleg in Berlin, wo ich eine ruhige Zeit, einen guten Bibliotheksdienst und eine geeignete Atmosphäre für meine intellektuelle Arbeit vorgefunden habe. Herrn Rektor Peter Wapnewski und den Mitarbeitern des Kollegs möchte ich dafür danken, dass sie mir die notwendigen Arbeitsbedingungen für eine erfolgreiche Forschungstätigkeit zur Verfügung gestellt haben. Ich danke auch allen Kollegen, die mit mir über die hier vorgetragenen Vorstellungen verständnisvoll und wohlwollend diskutiert haben, auch wenn wir dabei in unseren Meinungen nicht immer übereinstimmten.
I INDIVIDUALITÄT: DEFINITION UND KONZEPT
EINFÜHRUNG
Jeder physische Gegenstand, jede Pflanze, jeder tierische Organismus und jeder Mensch weisen Merkmale und Eigenschaften auf, die bei der ganzen Gattung oder auch bei einer größeren Anzahl ähnlicher Individuen gleich sind, Eigenschaften, die bei einer Vielzahl anderer Individuen ähnlich sind, sowie Eigenschaften, die nur ihnen eigen sind und bei anderen Individuen nicht auftreten. Der Gegenstand, dem wir uns in den folgenden Ausführungen zuwenden, sind allerdings ausschließlich Menschen in ihrer gesamten Vielfalt und in allen Dimension ihrer Existenz. Der Mensch ist zunächst ein physischer Körper, der als solcher gleiche oder auch ähnliche Eigenschaften, wie alle anderen Vertreter des Homo sapiens aufweist und wie diese im Hinblick auf die Eigenschaft des Körpers den Gesetzen der Physik unterliegt. Als materieller Körper weist der Menschen ähnlich wie jeder andere physische Körper individuelle Eigenschaften auf, die nur ihm eigen sind. Eine physikalische Betrachtungsweise der menschlichen Existenz ist allerdings für uns nur von geringem Interesse, da dieser Aspekt – nach allgemeiner Meinung - weder den Lebensverlauf des Einzelnen noch den einer ganzen Gesellschaft wesentlich beeinflusst. Von größerer Bedeutung ist dagegen der menschliche Organismus und die in ihm - im weiteren Sinne des Wortes – sich vollziehenden Veränderungen und biologischen Prozesse. Wie immer wir das Leben und die inneren Strukturen von Lebensprozessen auch definieren, sind wir in der Lage, in ihnen ebenfalls zwischen solchen Erscheinungsformen, Merkmalen oder Eigenschaften zu unterscheiden, die der gesamten Gattung oder sogar allen Lebewesen gemein sind, Abläufen und Eigenschaften, die bei einer größeren Anzahl von ihnen ähnlich sind, und bestimmten Merkmalen, Erscheinungen und Eigenschaften, die in dieser Form nur bei einer bestimmten Person in Erscheinung treten. In der Medizin sind die individuellen Erscheinungsformen und Eigenschaften entweder Anstoß dazu, das Bild vom typischen Verlauf einer Krankheit wie auch die Behandlung einzelner Patienten abzuwandeln oder aber sie bieten Anlass, sie als eine normative Abweichung zu begreifen, wobei als „Norm“ gewöhnlich der „Durchschnittswert“, d.h. die am häufigsten anzutreffende Eigenschaft oder Erscheinung, angenommen wird.
Die biologische Dimension der menschlichen Existenz umfasst sehr komplexe biochemische, anatomische, funktionale sowie andere Erscheinungsformen und Prozesse. Sowohl die Anthropologie als auch einige Wissenschaften, von der Genetik bis hin zur Medizin, beschäftigen sich mit dem Menschen als einem Organismus und richten ihre Aufmerksamkeit vor allem darauf, was allen Lebensprozessen gemein ist, was sich wiederholt, was identisch ist, oder was sie mehr oder weniger ähnlich regeln. Individuellen biologischen Differenzen wird in der Forschung dann nachgegangen, wenn es sich um Merkmale und Eigenschaften handelt, die ein Individuum aufweist, das sich durch außergewöhnliche intellektuelle, sportliche, berufliche oder andere Leistungen auszeichnet. Von hier leitet sich auch der Begriff der biologischen, biochemischen oder sogar genetischen Individualität ab – auf diese Problematik werden wir später noch zurückkommen.
Die dritte, psychische Dimension der menschlichen Existenz ist für uns vom besonderen Interesse. Als bewusst handelndes Wesen wirkt der Mensch auf die Natur und auf andere Menschen ein, schafft kulturelle Werte, reagiert auf Naturvorgänge und soziale Prozesse, die sich um ihn herum abspielen, passt sich den angetroffenen Bedingungen an oder verändert sie usw.. Die menschliche Psyche setzt sich aus einer Reihe von Mechanismen zusammen, welche die Aktivitäten des Menschen in der Welt steuern, wodurch ihr für die menschliche Existenz eine besondere Bedeutung zukommt. Das Bewusstsein und die psychischen Prozesse erlauben dem Menschen, eigene Lebensziele für sich zu setzen und sein Handeln zielgerecht zu gestalten. Auch die Psyche weist sowohl gleiche als auch ähnliche Eigenschaften auf, die die gesamte Gattung oder menschliche Aggregate, wie Rassen, soziale Klassen, Nationen, ethnische Gruppen usw., auszeichnen, wie auch Eigenschaften, die nur einem bestimmten Individuum eigen sind. Individuelle Eigenschaften, die nur einem Individuum eigen sind, oder auch individuelle Unterschiede, die bei den gemeinsamen und ähnlichen Eigenschaften auftreten, sind für die Psychologie von besonderem Interesse und Gegenstand einer ihrer Spezialdisziplinen. Augenscheinlich wahrzunehmende Unterschiede zwischen Individuen, die in den Alltagserfahrungen in tausenden Jahren gemacht wurden, wie auch Ergebnisse psychologischer Forschung, haben wesentlich dazu beigetragen, dass dem Menschen eine psychische Individualität bescheinigt wurde, allerdings auch dazu, dass diese psychische Individualität mit seiner Individualität schlechthin gleichgesetzt wurde. In der griechischen und römischen Philosophie war der Begriff Individuum vor allem auf materielle Gegenstände bezogen, mit dem Beginn der mittelalterlichen Philosophie bezieht er sich auch auf die psychische Dimension der menschlichen Existenz.
Der Mensch ist nicht nur als physikalischer Körper, als lebendiger Organismus, als psychische Einheit, sondern auch als Mitglied einer Gesellschaft zu betrachten, die sein Leben und den Ablauf seiner Lebensprozesse weitreichend gestaltet. Der Mensch wird zwar als biologischer Organismus geboren und ist genetisch mit einer Anzahl von biochemischen und psychischen Mechanismen ausgestattet, aber seine Entwicklung, sein Wachstum, seine Reifung und sein Funktionieren wird wesentlich durch Sozialisierungs- und Erziehungsprozessen modifiziert und mitgestaltet. Kurzum, der Mensch ist ein soziales Wesen. Was bedeutet das? Von der aristotelischen Konzeption des „zoon politikon“ über viele philosophische, theologische, später auch psychologische, anthropologische und soziologische Theorien hinweg entwickelten sich Vorstellungen, die mit Nachdruck auf die Bedeutung der Anpassung des kindlichen Verhaltens an die in der Gesellschaft und Kultur seiner Eltern oder Erzieher bestehenden Bedingungen hinweisen und die Rolle der Konditionierung seiner Reflexe und die Kanalisierung seiner Triebe und Bedürfnisse in Abhängigkeit von den in seiner Gesellschaft vorherrschenden Verhaltensmustern betonen. Der Einfluss, den die Ge-Sellschaft und die Kultur ausüben, erfolgt über die Internalisierung von Verhaltensmustern, die Akzeptanz von Wertekriterien sowie die Aneignung von Regeln, die darüber bestimmen, wie, im Einklang mit den Mechanismen der gesellschaftlichen Kontrolle, „soziale Rollen zu spielen“ sind. In diesem Sinne stellt Sozialisation, die entweder als Prozess des spontanen Lernens oder als bewusste erzieherische Tätigkeit von Erziehern begriffen wird, einen Prozess der grundlegenden Umgestaltung dar, der das Kind von einem biologischen Organismus zum Mitglied einer Gesellschaft macht, was letztendlich über sein Menschsein entscheidet. Weil aber Sozialisation und Erziehung (manchmal wird Sozialisation als spontaner Lernprozess des gesellschaftlichen Lebens definiert und Erziehung als ein intentionaler Bildungsprozess des Zöglings durch einen Erzieher im Einklang mit den anerkannten Erziehungsidealen) vor allem darin besteht, dem Zögling (Kind) Eigenschaften beizubringen, die in einer bestimmten Gesellschaft oder einer kleineren Gruppe gleich oder ähnlich sind, war man folglich der Auffassung, dass diese Eigenschaften auch das Wesen des Menschseins ausmachen würden. Das Menschenideal, das in dieser Gesellschaft bei der Erziehung als wünschenswert galt und den Kindern in der Gesellschaft beigebracht wurde, war zugleich Bedingung und Absicherung für ihre Kontinuität, die Erhaltung ihrer Identität und den Fortbestand ihrer Werte. Ein Mensch, der diese Bedingungen erfüllte, war ein „vollkommener Mensch“ und in diesem Sinne auch ein „soziales Wesen“. Als soziales Wesen besaß er vor allem soziale Merkmale und Eigenschaften, darüber hinaus aber auch ganz besondere individuelle Merkmale, die nur ihn auszeichnen und die im Leben einer Gesellschaft eine wesentliche Funktion erfüllen.
Die soziale Dimension der menschlichen Existenz hat einen beträchtlichen Umfang aufzuweisen, wobei man für gewöhnlich in ihr eine Reihe von Bereichen unterscheidet. Diesen gehört der politische Bereich des menschlichen Handelns, der im Zusammenhang mit dem Phänomen der Macht steht. In der politischen Dimension streben Menschen danach, Macht zu ergreifen, auszuüben und an ihr festzuhalten, sowie Ziele durchzusetzen, die sich aus der Existenz des Staates, der politischen Parteien sowie der Regierungen herleiten usw.. Den zweiten Bereich des sozialen Lebens bildet die Wirtschaft, das heißt der gesamte Komplex von Erscheinungen und Prozessen, der daraus resultiert, dass Mittel, die zu Befriedigung von Bedürfnissen des Einzelnen und der Gesellschaft benötigt werden, nie voll gedeckt sind. Da Menschen, mit anderen Worten, um leben zu können, wirtschaften müssen, sind sie dazu gezwungen zu produzieren, zu sammeln, zu sparen, und vorausschauend die Befriedigung der Bedürfnisse zu organisieren. Wir bezeichnen diesen immensen Bereich des menschlichen Verhaltens als Wirtschaft. Obwohl dieser Bereich seinem Wesen nach eigenartig autonom wirkende Eigenschaften aufzuweisen hat, ist er zweifelsohne das Ergebnis von menschlichem Verhalten, das sich aus der Realität des gesellschaftlichen Lebens herleitet. Somit ist das wirtschaftliche Verhalten und Handeln als Teil des sozialen Verhaltens anzusehen und demzufolge in den folgenden Betrachtungen als Bestandteil der sozialen Dimension der menschlichen Existenz zu behandeln.
Schließlich gilt es noch eine Dimension der menschlichen Existenz ansprechen, nämlich die kulturelle Dimension, ist der Mensch doch auch Teilhaber und Urheber der Kultur. Die kulturelle Schöpfung vollzieht sich in der Gesellschaft und wird von ihr in einer bestimmten Art und Weise festlegt, hat aber im Vergleich zu anderen Bereichen des menschlichen Handelns oder Verhaltens eine viel größere „Autonomie“ aufzuweisen. Kulturelle Systeme sind nämlich einer „Objektivierung“ unterworfen. Einmal geschaffen, erlangen sie ein „Eigenleben“, das heißt, sie werden unabhängig vom Urheber und lassen sich nicht ohne Weiteres modifizieren. Das Gemälde, die Skulptur, die musikalische Komposition, das Architekturwerk, das religiöse Dogma wie auch jedes beliebige Kunstwerk, löst sich vom Urheber, wird von dem Betrachter nachempfunden, schließt sich dem bestehenden Kunstsystem an bzw. wird in dieses einbezogen und übernimmt darin neue Funktionen, auch wenn es weiter als Verwirklichung einer individuellen Künstlervision bestehen bleibt. Deswegen hat das Wirken einzelner Menschen in der Kultur eine so große Bedeutung für die Erforschung der Rolle, die individuelle Eigenschaften einzelner Menschen haben, da sie in den Kunstwerken manchmal in ihrer „reinen Form“ in Erscheinung treten, d.h. in ihnen ihren höchst individuellen Ausdruck finden. Der Künstler, der ein Kunstwerk hervorbringt, hat den Wunsch, dass es ein „Originalwerk“ ist, d.h. keine Ähnlichkeit zu anderen Kunstwerken aufweist und weder eine Nachahmung noch eine Wiederholung des bereits Vorhandenen ist, sondern seine persönliche Vision der Welt zum Ausdruck bringt. Selbstverständlich gab es in der Kunst auch Perioden, in denen die Künstler vor allem darum bemüht waren, idealisierte Vorbilder nachzuahmen, aber auch bei dieser Nachahmung kamen individuelle Fähigkeiten zum Vorschein. Die kulturelle Dimension der menschlichen Existenz stellt jedenfalls eine Dimension dar, in der die individuellen Eigenschaften eine außergewöhnliche Bedeutung haben.
Zum Abschluss dieser Eingangsbemerkungen, die notgedrungen trivialer Natur sind und sich mit der alltäglichen Einsicht zusammenfassen lassen, dass es weder zwei Menschen gibt, die identische Gesichtszüge aufweisen, obwohl jeder von ihnen Augen, Nase, Stirn, Kinn und Ohren hat, noch zwei Menschen, die einen identischen Fingerabdruck haben. Damit möchte ich hervorheben, dass die Eigenschaften, die den Menschen auszeichnen, in drei Grundkategorien aufzuteilen sind: In Eigenschaften, die allen Vertretern der Gattung oder einer größeren oder kleineren Anzahl von Menschen zukommen, Eigenschaften, die bei allen Exemplaren der Gattung oder einer größeren oder kleineren Anzahl von Menschen ähnlich sind und schließlich in Eigenschaften, die einem und nur einem Menschen eigen sind, nur bei ihm auftreten und ihn von den anderen vier Milliarden und 800 Millionen Exemplaren des Homo sapiens unterscheiden. Aus dem, was hier in einer großen Vereinfachung ausgeführt wurde, geht hervor, dass alle der drei Eigenschaftskategorien in jeder Dimension der menschlichen Existenz eine wichtige Funktion erfüllen. Diese Aufteilung ist für unsere weiteren Betrachtungen von entscheidender Bedeutung, da wir hier die zentrale Problematik der menschlichen Existenz berühren, nämlich die Frage nach der Seinsweise des Menschen. Bevor wir jedoch diesem Problem nachgehen, müssen wir die Begriffe Merkmal und Eigenschaft näher beschreiben, da sie in den folgenden Ausführungen eine wesentliche Rolle spielen werden.
In jeder Existenzdimension, der physischen, biologischen, psychischen, gesellschaftlichen und kulturellen, besitzt der Mensch ganz besondere Merkmale und Eigenschaften. Diese Begriffe sind der Umgangssprache entliehen und auch in ihr verständlich, jedoch ihre Bildhaftigkeit und Vieldeutigkeit erleichtert keinesfalls eine präzise Gedankenführung. Sehen wir uns daher diese drei Begriffe: Existenzdimension, Merkmal des Menschen und Eigenschaft des Menschen, etwas näher an.
Das Wort Dimension wird hier natürlich metaphorisch verwendet, um die unterschiedlichen Formen der menschlichen Existenz als physischer Körper, als lebender Organismus, als Psyche, als Gesellschaftsmitglied sowie als Teilhaber einer Kultur (kultureller Werte) hervorzuheben. Der Ausdruck wird von vielen wissenschaftlichen Disziplinen in unterschiedlicher Bedeutung verwendet. Wir könnten ihn umgehen und einfach sagen: „Der Mensch existiert als physischer Körper, als lebender Organismus usw.“, ohne das Wort Dimension zu verwenden, das sofort verschiedene ontologische Assoziationen mit sich bringt, nämlich eine Gegenüberstellung einer „geistigen und materiellen Dimension“, die ich aufs Sorgfältigste zu vermeiden suche. In der Umgangssprache versteht man unter Dimension gewöhnlich eine „messbare Dimension“ wie Stärke, Länge, Breite, Umfang usw.. In der Algebra oder Mechanik hat der Ausdruck eine den Anforderungen dieser Wissenschaften entsprechende, genau definierte Bedeutung. In der Philosophie oder der Kulturtheorie spricht man manchmal davon, dass „ein Autor der Fragestellung eine neue Dimension verliehen hat“, und meint damit, dass er für eine bekannte Problematik neue Interpretationsmöglichkeiten entdeckt hat. Für uns bedeutet die Redewendung „Existenzdimension des Menschen“ in den weiteren Betrachtungen so viel wie „der Mensch ist eine derart komplexe Einheit, dass er zum Forschungsgegenstand der Physik, der Biologie, der Psychologie sowie der Gesellschafts- und Kulturwissenschaften werden kann.“
Die Verwendung der Wörter „Merkmal“ und „Eigenschaft“ haben in der Geschichte der philosophischen Analysen, insbesondere in der Ontologie und der Erkenntnistheorie, eine lange Tradition. Trotzdem werden sie in vielen Wissenschaften, insbesondere in der Psychologie, freizügig benutzt, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, was Stoiker oder Aristoteles darüber ausgesagt haben. Auch wir werden diesem Beispiel folgen, und in unseren Betrachtungen sogar das fortlassen, was in den „Elementen der Erkenntnistheorie, formalen Logik und der Wissen-Schaftsmethodologie “von Thadeus Kotarbiński zu finden ist. Wir nehmen somit an, dass jedes in einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Raum vorhandene Objekt irgendeine Form aufzuweisen hat. Ist es ein physikalischer Körper, besitzt er (ohne hier wiederum auf eine semantische oder ontologische Analyse des Begriffes „besitzt“ einzugehen) Masse, Gewicht und andere äußerliche und strukturelle Bestandteile sowie Kennzeichen, mit deren Hilfe er beschrieben und identifiziert werden kann. Selbstverständlich kann man zwischen wesentlichen und zufälligen Merkmalen einen Unterschied machen und zwischen Eigenschaften als „äußerlichen Zeichen“ z.B. der Haarfarbe, und solchen unterscheiden, die ausschlaggebend dafür sind, was eine bestimmte Person darstellt, z.B. ihre Fähigkeiten, ihre Willensstärke und Ausdauer. Ich vertrete hier die Ansicht, dass das Verhalten des Menschen die Grundlage für die Entscheidung ist, welche Merkmale in seinem Leben als wichtig und welche als weniger wichtig anzusehen sind. Bestimmte Merkmale und Eigenschaften lassen sich demnach dann als besonders wichtig bezeichnen, wenn sie einen starken Einfluss darauf nehmen, wie eine bestimmte Person ihre Lebensprobleme löst. Weil ich den Begriff der Existenz des Menschen unter Bezugnahme auf seinen Lebensprozess definiert habe, in dessen Verlauf von seinem Organismus, seiner Psyche, und im Zuge seiner Teilhabe an Gesellschaft und Kultur laufend Probleme zu lösen sind, werden von mir auch die Merkmale und die Eigenschaften durch eine Analyse der Rollen bestimmt, die sie bei der Lösung dieser Probleme spielen. Dadurch, dass ich an das alltägliche Verständnis der Wörter „Merkmal“ und „Eigenschaft“ anknüpfe, fällt es leicht, sogar ohne dazu ein Lehrbuch der biologischen Anthropologie aufzuschlagen, die typischen Gattungsmerkmale des Menschen aufzuzählen. Schwieriger ist es dagegen, die individuellen, insbesondere die biologischen oder auch anatomischen Merkmale einer Person festzustellen, da diese erst in der Reaktion auf Medikamente, bei der Behandlung einer Krankheit oder bei einer Durchleuchtung in Erscheinung treten können. Auch beim Bestimmen individueller psychischer Merkmale können sich Unterschiede bei der Beschreibung und Interpretation von Verhalten einstellen, von denen aus auf individuelle Eigenschaften der handelnden Person geschlossen wird. Leichter ist es beispielsweise, die individuellen Merkmale eines Schriftstellers auf der Grundlage einer Stilanalyse seines Werkes zu bestimmen, obwohl auch hier außerordentlich diskrepante Interpretationen möglich sind, was leicht festgestellt werden kann, wenn man die Meinungen einiger Kritiker zum gleichen Werk miteinander vergleicht. Wir sind jedenfalls der Auffassung, dass „Merkmal“ und „Eigenschaft“ gleichbedeutende Begrifflichkeiten sind und behandeln sie „behavioristisch“, indem wir ihre Gewichtung durch die Rolle bestimmen, die sie im Handeln aufzuweisen haben.
DIE EXISTENZWEISEN DES MENSCHEN
Wir sprachen über die Existenzdimensionen des Menschen und meinten damit die Komplexität seiner Person bei gleichzeitiger Betonung der relativen Selbständigkeit ihrer einzelnen Bestandteile (sie kommen nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck, dass jeder Bestandteil Forschungsgegenstand unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen oder sogar einer ganzen Gruppe von Disziplinen eines Wissenschaftszweiges ist), sodass wir eigentlich von vielen Existenzweisen des Menschen sprechen könnten. Wir haben uns jedoch dazu entschieden, den Ausdruck „Existenzdimension“ zu benutzen, um die Einheit der menschlichen Person zu unterstreichen, die eine komplexe Ganzheit mit unterschiedlichen Dimensionen darstellt, Dimensionen, die, ähnlich den geometrischen Dimensionen, einen bestimmten Gegenstand als einen Gegenstand beschreiben.
Viel später treten in der Philosophie und den Wissenschaften vom Menschen Vorstellungen über Existenzweisen auf, die nun anders als zuvor auf unterschiedliche Seinsarten, darunter auch auf die des Menschen Bezug nehmen. Mit dem Beginnen der Philosophie der Gesellschaft kommt auch das Konzept der sozialen Existenzweise des Menschen auf, das wir unseren Überlegungen als zweiten wesentlich Gesichtspunkt der Betrachtung einer Person zugrunde legen. Die Darstellung des Menschen als soziales Wesen setzt voraus, dass er als ein teilhabendes Individuum behandelt wird, oder dass er eine Qualität darstellt, die von einer besonderen Art ist - lebt und handelt er doch als Gesellschaftsmitglied im Einklang mit den internalisierten Mustern des Denkens, des Handelns, des Strebens sowie der Werte, der Gesellschaft und Kultur, der er angehört und mit der er sich identifiziert. Als soziales Wesen handelt der Mensch vermittels jener Merkmale und Eigenschaften, die in gleicher oder ähnlicher Art auch bei anderen Mitgliedern der Gesellschaft vorhanden sind. Es ist offensichtlich, dass die individuelle Existenzweise einer Person, die aus ihren individuellen, bei anderen Personen nicht vorhandenen Merkmalen herrührt, alle Existenzdimensionen der sozialen Existenzweise „durchdringt“, dass beide aufeinander einwirken und zusammen das konkrete Verhalten bestimmen. Individuelle Begabungen eines Schülers, beispielsweise im Bereich der Mathematik, beeinflussen nicht nur die Art und Weise, wie er seine Schularbeiten löst, sondern wirken sich auch auf seine Beziehungen zu Mitschülern und Lehrern aus, ähnlich wie die individuellen Merkmale eines Politikers sein Funktionieren in Partei und Staat vorausbestimmen.
Selbstverständlich kann man auch versuchen, der Person eine andere Existenzweise zuzuweisen und sie z.B. als einen kulturellen Wert begreifen, vorausgesetzt, wir fassen die Kultur als einen Bereich des „objektiven Geistes“, also als eine Domäne gleichbleibender, idealer, jenseits von Zeit bestehender Werte auf, und dabei auch den Menschen als Element einer so definierten Kultur. Definieren wir jedoch die Kultur soziologisch, kann diese kulturelle Existenzweise einer Person auf die soziale Existenzweise zurückgeführt werden.
Die These über zwei grundlegende Existenzweisen des Menschen wirft die Frage nach der zwischen ihnen bestehenden Beziehung, auf, vor allem aber die Frage nach der Beziehung zwischen der Existenzweise eines konkreten Menschen und seinem ganz bestimmten Lebensverlauf in einer einzigartigen historischen Epoche. Die Beantwortung dieser Frage könnte meiner Meinung nach auf der Grundlage der Lektüre einer beliebigen Autobiographie, einer von einem Historiker verfassten Biographie oder auch durch einfache Beobachtung des eigenen alltäglichen Lebens bzw. des Lebens einer Person aus dem beruflichen Umfeld, gesucht und gefunden werden. In Autobiographien, von denen in Polen in den letzten Jahrzehnten eine große Anzahl gesammelt und publiziert wurde, wie auch in den Biographien, die von Historikern geschrieben wurden, können zwei Beschreibungsebenen ohne weiteres erkannt werden: die des psychischen Eigenlebens des Einzelnen einerseits und die Ebene seines „öffentlichen Lebens“, also seine Teilnahme am Leben eines Kollektivs und sein Verhalten als Mitglied unterschiedlicher Gruppen andererseits. Ohne hier die Beschreibung und die Thesen zum Begriff der„Gruppenzugehörigkeit“ zu wiederholen, die in jedem Lehrbuch der Soziologie und Sozialpsychologie zu finden sind, müssen wir uns dennoch näher mit einigen Phänomenen befassen, die mit den beiden Existenzweisen zusammenhängen. Wenn wir uns selber, unseren alltäglichen Tagesablauf, vom Aufwachen frühmorgens bis zur Bettruhe abends beobachten, können wir in unseren Empfindungen, unserer Denkweise sowie unserem Handeln ein „Sich Absondern“ des eigenen „Selbst“ von dem feststellen, was wir als Familienmitglied, als Beschäftigter eines Betriebes, als Mitglied eines Vereins oder als Staatsbürger empfinden und wie wir als solche handeln. Das Bewusstsein der Existenz eines persönlichen Denk-, Handlungs- und Empfindungsbereichs ist jedenfalls ein allgemeines Phänomen, von dem wir oft dazu genötigt werden, eine Wahlentscheidung zu treffen, zwischen diesem persönlichen Bereich und dem Bereich der sozialen Phänomene und Verpflichtungen, in dem wir als Kollektiv, als „Wir“ auftreten. Diese Problematik kann man sicher mit dem Hinweis auf eine banale, im alltäglichen Leben gut bekannte, gewissermaßen automatisch und gedankenlos funktionierende Anpassungspraxis des persönlichen an den sozialen Bereich, auf sich beruhen lassen. Für die in diesem Buch aufgeworfene Frage nach der Rolle, der Individualität für eine Besserung des sozialen Lebens, ist das jedoch eine wichtige Problematik, auf die wir noch näher eingehen werden.
EINIGE FRAGEN ZU DEN EXISTENZWEISEN DES MENSCHEN
Wir gehen davon aus, dass die beiden Existenzweisen des Menschen als „Ich“ und als „Wir“, seine zwei wichtigsten Existenzweisen sind. Bildhaft und verkürzt kann man auch sagen, dass der Mensch in zwei Bereichen lebt: nämlich im persönlichen und im sozialen, was jedoch eine allzu große Verallgemeinerung insofern wäre, als wir hier nicht nur den Bereich von Lebensbegebenheiten meinen, mit denen er zu tun hat und die für ihn selbstverständliche Alltagserfahrungen sind, sondern eher zwei unterschiedliche ontologische Seins-Arten. Mit Nachdruck wollte ich jedoch vor allem den Unterschied zwischen der hier präsentierten Auffassung und den mannigfachen Erscheinungsformen des Individualismus unterstreichen, sei es dem methodologischen Individualismus als Gegensatz zum Holismus in den Geschichtswissenschaften, sei es den anderen Erscheinungsformen des Individualismus in der Soziologie, Wirtschafts- und Politikwissenschaften oder auch den unterschiedlichen ideologischen Ausformungen des Individualismus. In allen den hier benannten Wissenschaften geht es darum, „den Einzelnen in seiner gesamten Komplexität den sozialen Kollektivgebilden oder der Gesellschaft insgesamt“ entgegenzusetzen. Sie alle konzentrieren ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die Merkmale und Eigenschaften des Einzelnen, die bei vielen von ihnen auftreten, z.B. Bestrebungen, Bedürfnisse, Streben nach Reichtum, Macht und Prestige usw. also solche, die im Zuge der Teilhabe am kollektiven Leben sowohl bei einer Einzelperson als auch bei vielen anderen in ähnlicher Art und Weise entstehen, sich weiterentwickeln, um schließlich zur Grundlage von Massenphänomenen und Massenbewegungen zu werden. Ich interessierte mich in diesem Buch dagegen nur für die Individualität des einzelnen Menschen, d.h. nur für diesen „Teil“, der diesem einen Menschen und nur diesem einen eigen ist und versuche, seine Rolle zu erforschen. Ich stelle das Individuum somit nicht sozialen Großgebilden, Kollektiven oder Gesellschaften gegenüber, sondern versuche herauszufinden, welche Rolle das spielt, was nur bei einer und nur bei dieser Person vorzufinden ist. Ich vertrete von daher weder eine neuartige Version des Individualismus, noch eine Theorie der Dominanz von Individualität gegenüber dem Kollektiv, noch behaupte ich, dass die Gesellschaft gegenüber dem Einzelnen höherwertig sei. Ich stelle lediglich fest, dass der Mensch als Individualität „und zugleich“ als Gesellschaft in einer Person existiert, eine These, die seit Jahren von Phänomenologen, Existenzialisten und anderen soziologischen Schulen vertreten wird und zugleich eine einfache und gängige Ansicht des Alltagswissens ist, die von jedem Menschen Tag für Tag unmittelbar erfahren wird.
Allerdings werden von mir an dieser Stelle nicht die philosophischen Probleme behandelt, die mit dem Begriff des Seins in Verbindung stehen. Es reicht in einer beliebigen Enzyklopädie oder einem Wörterbuch der Philosophie sich den historischen Abriss der Entwicklung dieses Begriffes von der griechischen Philosophie über die Scholastik und neuere Philosophie bis Bertrand Russell anzusehen, um in einen recht melancholischen Geisteszustand zu verfallen. Kurzum, beide Erscheinungsformen der Existenz oder beide Existenzweisen beziehen sich auf ein „objektives“, „reales Sein“. Ich gehe dabei weder auf die Bedeutung des intentionalen oder idealen Seins, noch auf die Frage nach den schwachen oder starken Formen des Seins ein. Ich halte mich an einen „Realismus“ und berücksichtige bestenfalls einen humanistischen Koeffizienten, der die Feststellung erlaubt, die Existenz der Menschen sei so ,wie sie von ihm erfahren wird. Der menschliche Körper existiert deswegen, weil er Raum für sich in Anspruch nimmt und in der Zeit fortlebt, der Organismus des Menschen existiert, weil er Stoffwechselprozesse vollzieht, sich entwickelt und beobachtbaren Veränderungen unterliegt. Die menschliche Person existiert in einer psychischen Dimension, weil sie fühlt, denkt, empfindet, Entscheidungen trifft usw. und diese psychischen Akte mit anderen Personen austauschen kann. Im sozialen Sinne existiert die menschliche Person, weil sie mit anderen Menschen in unterschiedliche Wechselbeziehungen tritt, auf sie einwirkt und auf ihr Handeln reagiert. Die Möglichkeit, kulturelle Werte wahrzunehmen und sie zu bilden, stellt schließlich das Existenzkriterium für den Menschen in kultureller Hinsicht dar. Ich führe somit den Existenzbegriff auf eine ontologische Sozialkategorie zurück, indem ich einfach annehme, dass der Mensch in irgendeiner physikalischen, biologischen und menschlichen Umgebung existiert, und dass es durch intersubjektive Erfahrung möglich sei, diese Existenz zu belegen. Dieses Kriterium bezieht sich von daher auch auf beide Existenzweisen, sie können ebenso grundsätzlich durch intersubjektive Erfahrungen bestätigt werden.
Ich möchte nochmals unterstreichen, dass die Existenz des Individuums etwas anderes bedeutet als die Existenz der Individualität. Alle mir bekannten Arten des Individualismus befassen sich mit dem Individuum unter Berücksichtigung aller seiner Merkmale und Eigenschaften. Gegenstand dieses Buches ist hingegen nur die Individualität; das, was im Individuum das Ergebnis einer gesellschaftlichen „Spiegelung“ ist, interessiert uns nicht.
Die unterschiedlichen Existenzweisen einer Person kommen in jeder Existenzdimension des Menschen zum Ausdruck. Als physischer Körper weist der Mensch viele gemeinsame Merkmale mit den Körpern anderer Menschen auf und diese physischen Eigenschaften sind ebenfalls in gewissem Sinne an seiner gesellschaftlichen Existenzweise beteiligt. Ähnlich verhält es sich mit den biologischen Merkmalen. Neben einer „biologischen“ oder „biochemischen Individualität“ stellt sein Organismus vor allem die Existenzweise des Menschen als Gattung dar. Im psychischen, sozialen und kulturellen Bereich ist dieser Sachverhalt evident.





























