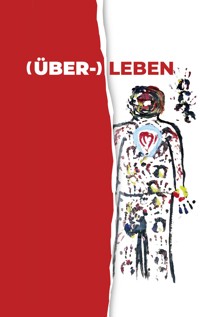
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch möchte ich ungeschönt und so offen wie möglich darüber berichten, wie ich an meine lange verdrängten Erinnerungen von Vernachlässigung, Zwangsprostitution, Folter sowie psychischem, körperlichem und sexuellem Missbrauch meiner Kindheit und Jugend herangekommen bin - und welche Folgen das für alle Bereiche meines Lebens hatte und auch heute noch hat. Möge es allen Menschen, die ebenfalls von sexuellem Missbrauch betroffen sind, ein Anker sein, um ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu leben, das jeder von uns verdient hat. Mein Anliegen ist es, Menschen, die nicht direkt betroffen sind, für dieses Thema zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig Verständnis für Betroffene ist, was die komplexen Auswirkungen von sexuellem Missbrauch betrifft. Mit der Unterstützung meines Freundes und psychologischen Psychotherapeuten habe ich mein persönliches Schicksal auf Papier gebracht. Er hat mir mit seinem psychologischen Wissen zur Seite gestanden, um wichtige Fachbegriffe zu erklären.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Du wirst weder an deinen inneren Bildern noch an deinen Gefühlen zerbrechen. Denn wenn du hättest zerbrechen sollen, dann wäre das bereits geschehen.“
(Markus Klaaßen)
Achtung:Trigger-Warnung!
In diesem Buch wirst du Dinge lesen, die explizite Schilderungen vieler Formen von Gewalt enthalten. Vielleicht vermagst du dir diese nicht einmal in deinen schlimmsten Albträumen vorzustellen. Bis vor einiger Zeit konnte ich es selbst nicht. Doch heute weiß ich: Ich habe all das überlebt.
Ich erinnerte mich lange nicht an meine Kindheit, auch nicht in Träumen. Der einzige Erinnerungsfetzen war folgender: Ich sehe mich, wie ich im Alter von etwa vier Jahren nachts in der Küche vor der Spüle stehe. Ich sehe die grelle Leuchte, die unter den Hängeschränken montiert ist. Mit einem langen Messer mit braunem Griff wollte ich mir ein Bein abschneiden. Mein Gedanke dazu war: „Wenn die Leute nun sehen, wie schlecht es mir geht, hat dieser Albtraum bestimmt bald ein Ende.“
Schon als kleiner Junge wollte ich den Schmerz in mir sichtbar machen. In diese Realität entführe ich dich mit meinem Buch mit dem Ziel, das Undenkbare auszusprechen.
Unter Umständen hast du Gleiches oder Ähnliches selbst überlebt. Achte also bitte gut auf dich! Die folgenden Inhalte können belastend oder verstörend für dich sein. Du bist nicht allein damit. Sprich mit einer Person deines Vertrauens oder deinen Ärzt:innen, wenn du das Bedürfnis hast. Wenn es dir nicht gut geht, wirf einen Blick auf die letzten Seiten dieses Buches. Dort liste ich dir Anlaufstellen und Kontakte auf, wo du Hilfe bekommen kannst.
Über den Autor
Ich bin Markus Klaaßen, 48 Jahre, lebe in Nordrhein-Westfalen und erzähle in meinem Buch ungeschönt davon, wie ich an meine lange verdrängten Erinnerungen von Vernachlässigung, Zwangsprostitution, Folter sowie psychischem, körperlichem und sexuellem Missbrauch meiner Kindheit und Jugend herangekommen bin – und welche Folgen das für alle Bereiche meines Lebens hatte und auch heute noch hat.
Mit der Unterstützung von Martin Braun, meinem Freund und Psychologen, habe ich mein persönliches Schicksal auf Papier gebracht. Er ist mir mit seinem psychologischen Wissen zur Seite gestanden, um wichtige Fachbegriffe zu erklären.
Die Namen aller Personen, ausgenommen Martin Braun und mein eigener, sind im Buch frei erfunden. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind somit rein zufällig.
Einleitung
Wir Menschen haben von Natur aus einen angeborenen Überlebensinstinkt und tun alles dafür, um am Leben zu bleiben.
Häufig ist der Lebensraum, in den wir hineingeboren werden, geprägt von Liebe, Wärme, Schutz, Rückhalt und Güte.
Manchmal sieht die Realität jedoch anders aus – und dies kommt bedauerlicherweise häufiger vor, als wir denken. Viele Menschen wachsen in einem Umfeld auf, das von Hass, Kälte, Bedrohung, Rücksichtslosigkeit und Gewalt geprägt ist.
Auch ich wurde von klein auf von meiner Familie gequält, misshandelt und missbraucht.
Mein Buch handelt von einer Hölle abgrundtiefer Quälerei, Aggressionen, Lieblosigkeit, gefühlskalten Eltern und einem sozialen Umfeld sogenannter „Vertrauten“, die gnadenlos narzisstisch ihre eigenen Bedürfnisse auslebten und ihre Rollen in der Gesellschaft benutzten, um ihre eigene sexuelle Gier zu befriedigen.
Meine Geschichte endet jedoch nicht in Verzweiflung oder der Möglichkeit, im Tal der bitteren Tränen zu ertrinken, sondern sie handelt vom puren Überlebenswillen sowie von den menschlichen Fähigkeiten, ein Trauma zu überwinden und die Folgen von Misshandlung und sexuellem Missbrauch zu bewältigen.
Mein Freund Martin Braun meinte, dass ihn kein Lebenslauf in seiner 35-jährigen psychotherapeutischen Arbeit zum Thema Bewältigung mehr erstaunt, beeindruckt und zuversichtlicher gestimmt hätte als meine Geschichte. Denn ich habe es geschafft, meine sexuellen Missbrauchserfahrungen sowohl mit therapeutischer Unterstützung als auch selbstständig zu bearbeiten, meinen Weg neu auszurichten und heute das Leben und mich selbst zu lieben, was mich mit Stolz und Dankbarkeit erfüllt.
Was dich erwartet …
Warum?
Mein Leben ohne Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend
Der Zusammenbruch
Erste Woche in der ersten Klinik
Zweite Woche:
Warum bin ich eigentlich in der Klinik?
Dritte Woche:
Sortieren und Luftholen
Vierte Woche:
Neue, teils furchtbare Erkenntnisse
Fünfte Woche:
Erste Gefühle fühlen
Sechste Woche:
Warum kann ich nicht schlafen?
Siebte Woche:
Es wird ein Bild
Achte Woche:
Nach „Wo“ und „Wer“ fehlt mir nun noch das „Was“
Kurzes Gastspiel zu Hause
Ankunft in der zweiten Klinik
Erste Woche:
Erstmal „langsam“ ankommen?
Zweite Woche:
Angst, Liebe, Trauer und die Zahl 3
Aus dem Hier und Jetzt
Dritte Woche:
Was mir Kraft gibt
Vierte Woche:
Ist alles da? Was füllt meine Leere?
Fünfte Woche:
Was soll jetzt noch passieren?!
Sechste Woche:
Wer leitet eigentlich die Geburt ein – das Kind oder die Mutter?
Siebte Woche:
Es wird ein vollständiges Bild oder der Kreis schließt sich
Achte Woche:
Noch neun Tage, dann gehe ich nach Hause
War es das?
Ich wollte immer leben
Danksagung
Wie ich meinen Prozess der Bearbeitung erlebe
Bücher, die ich gelesen habe:
Kliniken, in denen ich mich aufgehalten habe:
Was ich gesehen und gehört habe:
Adressen, die außerdem helfen können:
Warum?
Ich will LEBEN! Daher ist es für mich unausweichlich geworden, das, was ich überleben musste, Stück für Stück zu verstehen, so gut wie möglich zu bearbeiten, bewusst zu fühlen und in mein Leben zu integrieren.
Wenn du dieses Buch liest, wirst du vielleicht erkennen, dass ich Dinge, Gefühle und Situationen beschreibe, die auch du kennst. Ich bin kein Einzelfall. Es gibt viele Menschen wie mich. Und doch konnte und musste ich durch die individuellen Umstände in meinem Leben viele – wenn nicht sogar alle – Möglichkeiten ausschöpfen, die uns Menschen zur Verfügung stehen, um selbst in den schwierigsten und lebensfeindlichsten Umgebungen überleben zu können.
Heute würde ich sagen, dass ich gerade durch die frühen Misshandlungen und Missbräuche und den daraus intuitiv aktivierten Überlebensmechanismen in der Lage war, fast 16 Jahre anhaltende traumatisierende Situationen zu überstehen, ohne verrückt zu werden.
Ich denke, du hast nun einen ersten Eindruck davon bekommen, was mich antreibt: Ich wollte immer leben!
Nun bin ich in der Lage, Stück für Stück zu erkennen, wie ich es geschafft habe, psychisch und physisch zu überleben. Durch die Traumatisierungen an meinem Körper und meiner Seele blieb vieles lange Zeit unentdeckt. Unter vielen Schichten war ICH versteckt. Zum Glück verlor ich intuitiv nie diese tiefe Verbindung zu mir selbst – und zu meiner mir innewohnenden Kraft.
Mein Leben ohne Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend
Wenn mich jemand nach meiner Kindheit und Jugend fragte, war meine Geschichte schnell erzählt: Ich hatte keine Ahnung.
Meine Erinnerungen fingen damit an, dass ich mit 16 Jahren freiwillig in ein Kinderheim ging. Der Grund war, dass ich meinen Vater blutig geschlagen hatte. Erst später sollte sich herausstellen, dass dieser (Un-)Mensch nicht mein leiblicher Vater war. Er wollte wieder einmal, ohne ersichtlichen Grund, meine Mutter verprügeln, die in der Küche war. Warum er besoffen in einer von Urin durchnässten Unterhose aus dem Schlafzimmer kam, kann ich nicht mehr sagen. Er war so oft betrunken, dass er den Weg zur Toilette nicht mehr schaffte. Ich weiß nur, dass er sie angeschrien hatte und gerade zum ersten Schlag ausholen wollte, als ich dazwischen ging und ihm mit der Faust mehrfach ins Gesicht schlug. Mit Platzwunden am Auge und Lippe verkroch er sich fluchend ins Schlafzimmer.
Damit hatten weder er noch ich gerechnet. Für mich stand damit fest, dass ich gehen musste. Ich musste dieses Umfeld verlassen. Sonst wäre wohl noch Schlimmeres passiert. Mir war klar, dass er mich sonst umgebracht hätte.
Da ich schon mein ganzes Leben mit dem Jugendamt zu tun hatte, rief ich meine Betreuerin an, die zum Glück noch am gleichen Tag einen Platz im Kinderheim organisieren konnte. Ich packte meine wenigen Sachen und ging freiwillig ins Kinderheim.
Für mich und meine persönliche Entwicklung war das ein Befreiungsschlag. Im Kinderheim waren die Erzieher:innen und Mitbewohner:innen nett zu mir. Ich hatte ein sauberes Zimmer, regelmäßig zu essen, bekam Kleider- und Taschengeld, was ich auch behalten durfte, und das Wichtigste: Ich konnte mich frei bewegen und tatsächlich leben. Diese Freiheit nutzte ich. Ich kaufte mir Klamotten, verreiste das erste Mal, fand Freund:innen, machte meinen Führerschein, ging in Discos, rauchte Marihuana, ging auf Konzerte und hatte Sex mit Mädchen.
Um mein Leben finanzieren zu können, arbeitete ich an den Wochenenden, was ich schon seit meinem neunten Lebensjahr machte, auch mehrfach unter der Woche nach der Schule. Nach dem Hauptschulabschluss arbeitete ich dann einige Jahre lang sieben Tage die Woche.
Das Geld für meinen stetig steigenden Lebensstandard erwirtschaftete ich durch mehrere Jobs. Dazu gehörten anfangs einfache Arbeiten wie das Einsammeln von Müll, das Putzen von Toiletten, Kellnern und Arbeiten auf Festen, Veranstaltungen oder an Imbissständen. Schon früh besaß ich die Fähigkeit, unternehmerisch zu denken. Ich entwickelte eigene, oft erfolgreiche Geschäftsideen. Mir fielen Dinge ein, auf die andere Menschen gar nicht erst kamen – oder keine Lust hatten, sich die Arbeit anzutun. Als ich etwa zehn oder elf Jahre alt war, bemerkte ich bei Veranstaltungen, bei denen ich Papier aufsammelte, dass es zwei Dixi-Klos gab, die weder gereinigt noch mit neuem Klopapier ausgestattet wurden. Irgendwann stellte ich mich vor diese Toiletten und überprüfte jedes Mal, wenn sie benutzt wurden, ob die Toilettensitze noch sauber waren und ob noch genügend Klopapier vorhanden war. Dafür verlangte ich 20 Pfennig pro Benutzung. Anfangs nahm ich das Putzmittel und das Toilettenpapier einfach von zu Hause mit. Sobald alles aufgebraucht war, hörte ich für diesen Tag auf.
Ich tat zudem noch etwas – ich klaute Geld. Das war nicht schwer, da ich lange in Kreisen arbeitete, in denen ohne Quittung und somit ohne Nachweis gearbeitet wurde. Ich stahl zeitweise sehr viel Geld. Niemandem fiel auf, wenn bei den Abrechnungen einige Hundert D-Mark fehlten. Das dachte ich zumindest.
In manchen Monaten hatte ich gut 3.000 D-Mark, was heute rund 1.500 Euro entspricht, zur Verfügung. Das war damals viel Geld für einen jungen Mann. Heute weiß ich, dass meine Diebstähle natürlich aufgefallen waren. Ich trug angesagte Markensachen, hatte mit 18 Jahren teilweise drei Autos auf einmal, auch wenn es nicht die luxuriösesten waren, und in Windeseile hatte ich mir eine Wohnung finanziert. Ich gab das Geld mit vollen Händen aus. Aber wie sollte das alles nur mit Nebenjobs und ohne Unterstützung, wie zum Beispiel durch das Elternhaus, gehen? Jeder wusste, dass ich aus ärmlichsten Verhältnissen stammte.
Meine Diebstähle wurden lange Zeit toleriert, wie so vieles andere auch. Bei allen ehemaligen Arbeitsstellen durfte ich mir mehr herausnehmen als alle anderen, die durch solche Handlungen schon längst ihren Job verloren hätten. Wie kam es dazu? Warum durfte ich meine Arbeit behalten? Die schreckliche Antwort darauf sollte mir erst Jahrzehnte später bewusst werden.
Nachdem ich einige Jahre gut gelebt hatte, merkte ich, dass es so nicht weitergehen konnte. Ich war mit diesen einfachen Aufgaben vollkommen unterfordert, und die zum Teil sehr einfachen Menschen in meinem gesamten Umfeld waren für mich nicht mehr länger zu ertragen. Ich spürte, dass mir diese Menschen nicht mehr guttaten, hatte aber keine logische Erklärung dafür. Lange fragte ich mich, was ich mit meinem Hauptschulabschluss anfangen sollte. Ich konnte nicht einmal richtig lesen und schreiben. Auf den Bau oder in die Fleischindustrie wollte ich auf keinen Fall, auch wenn ich damals entsprechende Angebote erhielt.
Ich hatte schon immer einen guten Geschäftssinn, daher war klar, dass ich etwas Kaufmännisches machen wollte. Aufgrund meines geringen Bildungsstands war das anfangs allerdings nicht einfach. Völlig unerwartet bekam ich jedoch einen Ausbildungsplatz zum Bürokaufmann angeboten. Die Entscheidung, eine Ausbildung zu beginnen, hatte zur Folge, dass mein monatliches Einkommen um gut 50 Prozent schrumpfte. Das lag daran, dass ich ab Beginn der Ausbildung vom Ausbildungsgehalt und von ein paar Aushilfsjobs leben musste. Ich war also in der realen Arbeitswelt angekommen. Ich nahm die damit verbundenen Einschränkungen – keine Reisen, zeitweise kein Auto, Lernen statt Partys – trotzdem gerne in Kauf. Nach drei Jahren bestand ich die Abschlussprüfung mit einem Notendurchschnitt von 2,0.
In dieser Zeit lernte ich auch Sonja, meine spätere Frau, kennen. Ich absolvierte meinen verpflichtenden Zivildienst und machte mir Gedanken über meine Zukunft. Ich traute mir nichts, aber auch gar nichts zu. Mein Selbstwertgefühl war im Keller. Doch während meiner Zeit im Zivildienst lernte ich dank dem tollen Gemeindepfarrer, enger Freund und Mentor, einen Geschäftsmann, dessen bester Freund der Geschäftsführer eines Unternehmens, das europaweit tätig war, kennen. Dieser Geschäftsführer stellte mich kurzerhand ein. Es war verrückt: Von einem Tag auf den anderen erhielt ich einen Dienstwagen und ein Einstiegsgehalt von 3.500 D-Mark.
Fast 20 Jahre arbeitete ich für dieses Unternehmen. In dieser Zeit übernahm ich immer verantwortungsvollere Aufgaben, sodass ich auch ein hohes Einkommen hatte. Privat lief auch alles „normal“. Sonja und ich heirateten, unser Sohn Leon wurde geboren und irgendwann konnten wir uns sogar Eigentum leisten. Nicht schlecht für jemanden, der aus einer Familie kam, die sogar unter Asozialen einen Rekord für widrigste Umstände aufstellte.
Rückblickend gesehen ist das alles verrückt. Anfangs konnte niemand in der Firma etwas mit mir anfangen. Ich war ein Sonderling, der aus dem Nichts kam und einfach vom Geschäftsführer eingestellt wurde. Aber für mich gab es überhaupt keine Stelle! Ich war ein Macher, und so fing ich aufgrund dieser Charaktereigenschaft an, mir selbst Arbeit zu suchen. Ich hatte damals schon einige PC-Kenntnisse, die viele Menschen zu dieser Zeit noch nicht hatten. Meine Aktivitäten und kleinen Erfolge blieben nicht lange unbemerkt, und so wurde mein Chef auf mich aufmerksam. Später erzählte er mir, dass er mich anfangs testen wollte. Er stellte mein Engagement und meine Flexibilität mit meinen 25 Jahren auf die Probe. Ich punktete mit meinem Können – und das Vertrauen in meine Fähigkeiten als Mitarbeiter wuchs.
In den fast 20 Jahren, in denen ich dort arbeitete, zogen wir für das Unternehmen innerhalb Deutschlands mehrfach um. Ich arbeitete von morgens bis abends nahezu sieben Tage die Woche – und war sogar fast zwei Jahre räumlich getrennt von meiner damals jungen Familie. Bis mein Gehalt ausreichte, um nicht nur die Ausgaben decken zu können, dauerte es viele Jahre. Ein Wunder, dass Sonja das alles mitmachte.
Niemand, selbst ich nicht, wäre je auf die Idee gekommen, dass ich aus der Gosse kam – und eine unvorstellbar grausame Kindheit hatte. Ich wusste mich auszudrücken, war gut gekleidet, freundlich, fröhlich, hilfsbereit, aufmerksam und gepflegt. Ich konnte zahlreiche private und berufliche Erfolge erzielen. Dass ich bis zu 14 Stunden am Tag arbeitete, mindestens 40 Zigaretten am Tag rauchte, Entscheidungen zwischen Tür und Angel traf, am liebsten dreimal am Tag Sex haben wollte, auf jeder Party der Letzte war, jeden Abend Sport trieb, oft auf dem Sofa vor Erschöpfung einschlief und selbst im Urlaub nie ruhig sitzen konnte – all das war für mich und mein Umfeld ganz „normal“. So war ich eben. Mensch, ich hatte so verdammt gut funktioniert!
Der Zusammenbruch
Würde man eine außenstehende Person fragen, warum ich vor einigen Jahren komplett zusammengebrochen bin, hätte sie wohl vermutet, dass die viele Arbeit und mein Chef dafür verantwortlich gewesen seien. Das stimmte jedoch nur teilweise. Der Schein trog.
Meine Arbeit und ein neuer Chef hatten auf jeden Fall dazu beigetragen. Mein alter Chef ging leider in den Ruhestand. Mein neuer Chef und ich verstanden uns weniger gut. Dass ich meine Arbeit fristgerecht, korrekt und erfolgreich erledigte – und dabei auch noch beliebt bei meinen Kund:innen war –, führte nicht dazu, dass meine Leistung anerkannt wurde. Mir gefiel es hingegen überhaupt nicht, wie mein Chef mit beruflichen Problemen und seinen Mitarbeiter:innen umging. Dies verursachte natürlich Spannungen und Ärger, aber dass ich deshalb zusammenbrach und ins Krankenhaus musste? Nein, so einfach war es leider nicht.
Aber nicht alles auf einmal. Ich kam schlecht erholt aus dem Sommerurlaub zurück. Wie üblich hatte ich ein Meeting nach dem anderen, und zudem gab es pausenlos nur Probleme zu lösen. Zum Glück hatte ich mir angewöhnt, meine Mittagspause als fixen Termin zu planen. Hätte ich das nicht getan, hätte ich fast durchgehend Meetings gehabt. Das letzte Meeting vor der Pause, es war inzwischen 13 Uhr und ich hatte um 7 Uhr morgens angefangen, war mit einer meiner Mitarbeiterinnen und dem Marketingchef. Die von ihnen geschilderten Schwierigkeiten waren völlig unverständlich für mich, hatten beide doch ausreichend Kompetenzen, um die – meiner Ansicht nach – lächerlichen Probleme eigenständig zu lösen. Ich kam mir vor wie im Kindergarten.
Während des Meetings merkte ich auf einmal, dass meine Oberlippe anschwoll. Zum Glück endete es schnell. Ich ging zum Kühlschrank, nahm eine Flasche Wasser heraus und kühlte meine Lippe. Die Schwellung ging zurück. 30 Minuten später ging ich als einer der Letzten in die schon fast leere Kantine. Etwas später setzte sich eine Kollegin zu mir an den Tisch. Wie üblich sprachen wir über die Arbeit, als mein Chef sowie der Geschäftsführer mich begrüßten und sich an den Tisch nebenan setzten, um etwas zu besprechen.
Sekunden später schwoll meine Oberlippe dermaßen an (siehe Abbildung 1), als sei sie aufgespritzt worden. Meine Kollegin schaute mich fragend an. Ich zögerte einen Moment, stand auf und ging zum Tisch meines Chefs, um ihm zu sagen, dass ich ins Krankenhaus fahren würde. Ich vermutete eine allergische Reaktion auf das Essen. Der Geschäftsführer und mein Chef schauten mich mit großen Augen an und wünschten mir alles Gute.
Ich ging zurück in mein Büro, holte meinen Autoschlüssel und ging zu meinem Wagen. Im Auto gab ich die Adresse des nächsten Krankenhauses ins Navi ein. Wie ferngesteuert fuhr ich los. Dort angekommen, ging ich in die Notaufnahme. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam eine Krankenschwester und führte mich in ein Zimmer. Der behandelnde Arzt kam, untersuchte mich, fragte nach Allergien und erkundigte sich, was ich beruflich mache. Nachdem ich meine Situation geschildert hatte, klärte er mich auf, dass er mir über einen Venenzugang Kortison spritzen wolle.
Danach wollte der Arzt abwarten, ob innerhalb von 30 Minuten eine Besserung eintreten würde. Ich willigte ein. Was sollte ich auch machen? Meine Lippe wurde immer dicker. Nachdem das Kortison gespritzt war, setzte ich mich ins Wartezimmer und machte ein Foto von meiner dicken Lippe und der Nadel im Arm. Ich schickte es meiner Frau und war im Glauben, dass gleich wieder alles gut sei und ich weiterarbeiten könne.
Durch das Kortison wurde es zwar nicht schlimmer, jedoch verbesserte sich meine Lage auch nicht. Nach gut zwei Stunden verließ ich die Klinik wieder. Der Arzt sagte mir, dass er nicht mehr für mich tun könne. Die übrigen Untersuchungsergebnisse waren ohne Befund. Ich solle mich ausruhen und in den nächsten Tagen zu meinem Hausarzt gehen.
Ich fühlte mich wie nach einem Schleudergang in der Waschmaschine. Gegen den Rat des Arztes fuhr ich zurück ins Büro, machte den PC aus und ging kurz zu meinen Mitarbeiter:innen, um mich zu verabschieden. Danach fuhr ich nach Hause. Hier sollte ich auch erstmal für zehn Wochen bleiben.
Der Ausschlag wurde die ersten beiden Tage noch viel schlimmer. Mein ganzer Körper schwoll an. Die von meinem Hausarzt verschriebenen Medikamente – Kortison und ein Antihistaminikum, ein Wirkstoff, der bei Allergien den Juckreiz mildert – halfen nicht. Ich war der festen Überzeugung, verrückt zu werden. War ich etwa reif für die Psychiatrie?! Ich war irritiert und voller Zweifel. Am zweiten Tag rief ich meinen Hausarzt an. Als ich ihm erzählte, welche Mengen an Medikamenten ich einnahm, forderte er mich auf, sofort damit aufzuhören. Ich folgte seinem Rat und nahm keine Pille mehr. Stattdessen ging ich in die Badewanne, gefüllt mit kaltem Wasser, Olivenöl und Milch. Irgendjemand hatte mir gesagt, dass dies helfen würde. Und wirklich, die Schwellungen gingen zurück. Aus Angst vor einer neuerlichen Verschlechterung meines Zustandes hielt ich mich an den Rat des Arztes und fing nicht wie üblich an, sofort wieder zu arbeiten, sondern schaltete mein Handy und meinen Laptop aus. Plötzlich hatte ich Zeit. Diese Situation war komplett neu für mich.
In den ersten Wochen machte ich erstmal Urlaub, danach war ich zu Hause und hatte die großartige Gelegenheit, meinen Sohn, Leon, er war inzwischen 16 Jahre, ganz neu kennenzulernen. Wir führten viele, teils tiefgründige Gespräche. „Wow, was für ein toller Mensch!“, dachte ich. All die Jahre war ich so beschäftigt mit meiner Arbeit gewesen. Nun konnte ich mich endlich mir selbst und meiner Familie widmen.
Es passierte aber noch etwas: Ich wollte so nicht mehr weitermachen und war fest entschlossen, meinen Job zu kündigen. Sonja stand hinter mir. Auch wenn diese Entscheidung bedeuten würde, dass wir zukünftig weniger Geld zur Verfügung hätten.
So sollte es aber erstmal nicht kommen. Als ich meinen Chef nach neun Wochen Abwesenheit das erste Mal anrief und ihm sagte, dass ich bald wieder zur Arbeit kommen würde, hörte ich genau in diesem Moment ein lautes Piepsen in den Ohren, sodass ich noch am gleichen Tag zum HNO-Arzt ging. Die Diagnose lautete Tinnitus auf beiden Ohren.
Behandelt wurde ich im ersten Schritt erneut mit Kortison. Den Ablauf kannte ich ja schon. Dieses half jedoch genauso wenig wie die sieben Tage, die ich in einer ambulanten Tinnitus-Klinik verbrachte.
Bis heute ist der Tinnitus – mal mehr, mal weniger – da. Ich nehme die Lautstärke heute als Hinweis für mein aktuelles Stresslevel wahr und versuche daraufhin, den Stress zu reduzieren.
Als in der Firma alle wussten, dass ich meinen bisherigen Job nicht mehr ausüben und eine neue Aufgabe suchen würde, erhielt ich mehrere Angebote von unterschiedlichen Abteilungen. Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Die Jahre zuvor hatte ich immer das Gefühl gehabt, unbeliebt zu sein. Ich war der festen Überzeugung, meine Vorgesetzten und Kolleg:innen würden die Gelegenheit nutzen, mich loszuwerden. Aber anscheinend stimmte das nicht. Ich nahm mich selbst anders wahr als meine Mitmenschen auf der Arbeit.
Zwölf Monate lang führte ich einen anderen Job in der gleichen Firma aus. Dort hatte ich anfangs wesentlich weniger Stress, doch es war wie eine Wiederholung. Ich hatte wieder Erfolg, und bald erhielt ich mehr und mehr Verantwortung, Projekte und Aufgaben. Zudem war ich wieder von montags bis donnerstags auf Dienstreise. Mir ging es immer schlechter. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen und war unglaublich gereizt. Es war so schlimm, dass sich Sonja und Leon kaum noch in meine Nähe wagten. „Was ist los mit mir?“, fragte ich mich die ganze Zeit. Wieder wurde mir klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Ich war nicht fähig, länger arbeiten zu gehen. Zu Hause hielt ich es allerdings auch nicht aus.
Würde man mich heute fragen, warum ich zusammengebrochen bin, würde ich antworten, dass mehrere Komponenten zusammengespielt haben. Ich hatte in meinem Job und in meinem Privatleben unglaublich viel gelernt und war es gewohnt, mit komplexen Themen und schwierigen Situationen umzugehen. Meine Mutter war gerade gestorben. Mein „Vater“, der allerdings nicht mein leiblicher Vater war, hatte sich schon vor 15 Jahren zu Tode gesoffen. Ich hatte es nach fast 30 Jahren geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören. In meinem Job ging es bergauf. Ich hatte ein stabiles soziales Umfeld, Sonja hatte ihr spätes Studium abgeschlossen und ging wieder arbeiten, Leon hatte fast sein Abitur in der Tasche, die Finanzierung für unser Eigenheim war frühzeitig vollständig gesichert und ich war körperlich fit und gesund. Es war für alles gesorgt – nun war wohl die Bearbeitung meiner Vergangenheit an der Reihe.
Erste Woche in der ersten Klinik
Ich entschied mich, in eine Klinik zu gehen, die unter anderem hypnosystemisch arbeitete. Martin Braun hatte mir diese Klinik schon nach meinem ersten Zusammenbruch empfohlen.
Hypnosystemik
Hypnotherapie und hypnosystemische Techniken sind Behandlungswerkzeuge, die Veränderungen auf der unbewussten Ebene fördern, da auf dieser Ebene – bei jedem Menschen hochindividuell – Informationen, Ressourcen und Lösungen für Veränderungsprozesse angelegt sind.
Ich hatte allerdings keine Ahnung, was hier genau gemacht werden sollte. Meine Vorstellung war, dass ich für maximal vier Wochen in diese Klinik gehen würde – und dann wäre alles wieder in Ordnung. Hätte mir vorher jemand gesagt, was dort passieren würde, hätte ich ihn für verrückt erklärt.
Es war der 21. Mai 2018, Pfingstmontag, als ich in die Klinik fuhr. Schon beim Betreten der Klinik fühlte ich mich wie unter einer Glocke. Es war krass. Ich war wie erschlagen von diesem Ort. Alle Menschen waren nett und freundlich – und offensichtlich um mein Wohl bemüht. Aus meinem Alltags- und Berufsleben kannte ich das nicht. Ich fühlte mich sicher. Ich musste an keine Termine denken, niemanden versorgen, nichts organisieren und keine Entscheidungen treffen. Ich konnte endlich wirklich runterkommen.
Bei der Voruntersuchung und dem Aufnahmegespräch fragte mich der Arzt, ob ich Medikamente einnehme. Ich antwortete: „Nur manchmal Voltaren oder Aspirin.“ Dann fragte ich ihn aus heiterem Himmel: „Was ist Truxalettensaft? Den habe ich als Kind immer bekommen.“ Er schaute mich fragend an und meinte, dass er nur „Truxal“ kenne. Er schaute im PC nach und meinte, dass es sich hier um ein Antipsychotikum handele. Er fragte, warum ich das bekommen habe. Ich hatte keine Ahnung. Später recherchierte ich, dass sich Truxal (Chlorprothixen) vor allem bei hochgradiger Angst, Unruhe, Erregung, Getriebenheit und Schlafstörungen eignete. Chlorprothixen verursachte, wie alle klassischen Neuroleptika, Bewegungsstörungen. Als ich meine Taschen in mein Zimmer gebracht hatte, zog ich meine Schuhe und Socken aus und lief von nun an barfuß.
Die ersten Nächte schlief ich wie ein Baby. Ab der dritten Nacht plagten mich allerdings schlimme Albträume und Erinnerungen. Psycholog:innen sprechen hier von „Flashbacks“.
Flashbacks
In der Psychotherapie bezieht sich der Begriff Flashback auf ein plötzliches und intensives Wiedererleben eines vergangenen traumatischen Ereignisses. Es handelt sich um eine Art Erinnerung, die sich nicht nur in Gedanken oder Bildern manifestiert, sondern auch starke emotionale und körperliche Reaktionen hervorrufen kann. Flashbacks treten häufig bei Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) auf, können aber auch bei anderen psychischen Störungen oder nach belastenden Lebensereignissen auftreten.
Ein Flashback kann wie eine Art Zeitsprung sein, bei dem die betroffene Person plötzlich in die Vergangenheit zurückversetzt wird und das traumatische Ereignis erneut erlebt. Dabei kann sie die gleichen intensiven Gefühle, Gedanken und Sinneswahrnehmungen empfinden, die sie während des ursprünglichen traumatischen Erlebnisses hatte. Flashbacks können äußerst beängstigend, überwältigend und belastend sein, da die Person das Gefühl hat, das traumatische Ereignis erneut zu durchleben.
Erstmals träumte ich, wie mein Stiefvater mich als Kind brutal verprügelte. Das hatte ich all die Jahre komplett verdrängt. In den Therapien versuchte ich, die Träume zu verarbeiten. Ich rief Sonja an und sagte: „Ich glaube, ich weiß, warum ich hier bin. Es muss um meine Vergangenheit und Kindheit gehen.“ Sonja sagte nur: „Das war mir klar, denn du bist in einer Klinik, in der du dich mit deiner Kindheit beschäftigst.“ Die ganze Zeit über war ich der Meinung gewesen, einfach nur überarbeitet gewesen zu sein.
Wie in dem Gespräch mit dem Arzt sagte ich nun wieder einfach etwas, was ich bis dahin weder verstand noch bewusst gedacht hatte oder aussprechen wollte. Der Satz war: „Kaum ein:e Täter:in war vorher nicht ebenfalls Opfer von grauenhaften Taten!“
Schon an meinem zweiten Tag in der Klinik, es war ein Dienstag, hatte ich meine erste Kunsttherapiestunde. Diese Stunden berührten mich emotional sehr und machten mir zudem große Angst. Erst viel später konnte ich begreifen, weshalb. Wenn ohne Worte gearbeitet wurde, wurden Themen aus einer Zeit angesprochen, in der ich noch keine Worte hatte. Ich war entweder betäubt oder einfach noch zu klein, um mich sprachlich auszudrücken. Die Erinnerungen waren aber in meinem Gedächtnis verankert und fanden durch die nonverbalen Therapien den Weg in mein Bewusstsein.
Wir starteten jede Therapie mit einer Bewusstseinsübung. In dieser Stunde ging es darum, darauf zu achten, was im eigenen Körper passierte, welche Sinneseindrücke, Gedanken oder Emotionen man im aktuellen Moment hatte. Danach sollten wir uns Materialien aussuchen. Ich baute einen Würfel mit sechs Seiten und stellte ihn auf ein mit Gips überzogenes Podest. Es sollte eine Statue werden, die den Würfel hielt. Ich dachte für mich: „Mensch, du hast mehrere Seiten. Das Ganze hier ist wie eine Überraschungsbox.“
An den nächsten Therapietagen machten wir zu den unterschiedlichsten Themen einzelner Klient:innen – wir wurden alle als Klient:innen und nicht als Patient:innen gesehen und angesprochen – Aufstellungen.
Aufstellungen
Aufstellungen beschreiben eine Methode, die in der Psychotherapie, insbesondere in der systemischen Therapie, angewendet wird. Sie ermöglichen es, komplexe Beziehungs- und Familiendynamiken sichtbar zu machen und neue Einsichten und Lösungsansätze zu entwickeln. Bei einer Aufstellung wird eine Gruppe von Personen verwendet, um verschiedene Personen oder Elemente eines Systems darzustellen, wie z. B. Familienmitglieder, innere Teile der Persönlichkeit oder andere wichtige Bezugspersonen. Die Personen nehmen dabei unterschiedliche Positionen im Raum ein, um die Beziehungen und Dynamiken innerhalb des Systems zu repräsentieren.
Je nach Situation wurden Gegenstände oder Personen als „Thema“ positioniert. So konnten die jeweiligen Klient:innen besser verstehen, was der Kern der Sache war. Das war ein bisschen so, als wenn Kinder Rollenspiele spielten.
Bis ich mich auf diese Methoden für meine eigenen psychischen Prozesse einlassen konnte, sollte noch einige Zeit vergehen.
Ganz langsam kam mein Erwachen. Ich dachte: „Scheiße, irgendetwas passiert hier!“ Schlafen konnte ich kaum noch. Als ich am Ende meiner ersten Klinikwoche von nachts bis frühmorgens auf der Dachterrasse saß, hörte ich Musik, schaute in die Ferne und in den Sternenhimmel. Ich saß stundenlang dort. Plötzlich fühlte ich mich schlecht. Es lief das Lied „You can run“ von Adam Jones, was mir Leon vor einigen Tagen geschickt hatte und das ich nun zum ersten Mal hörte. Mir wurde schwindelig, mein ganzer Körper kribbelte – und ich verspürte einen unglaublichen Druck im Kopf.
Dann passierte etwas, was ich nur versuchen kann zu beschreiben. Es war, als würde ein Vulkan in meinem Kopf ausbrechen, und aus dem Krater flog eine Mischung aus verdrängten Erinnerungen, Gefühlen, Schocks, Schmerzen, Trauer, Selbstverachtung und Todesangst. Dieser Moment war unbeschreiblich und überwältigend. Gegen Ende des Liedes dachte ich an Sonja und Leon, und es war so, als würde alles auf einen Boden aus Liebe fallen. Anders kann ich es nicht beschreiben. Die Tränen liefen mir über das Gesicht.
Noch heute bekomme ich Gänsehaut, wenn ich an diesen Augenblick zurückdenke. Ich saß noch eine ganze Zeit regungslos da. Als es langsam hell wurde, erschrak ich mich, als die Nachtschwester mich ansprach. Sie fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich schaute in ihr besorgtes Gesicht. Ich musste ausgesehen haben, als würde ich jeden Moment von der Dachterrasse springen wollen. Ich antwortete: „Ich weiß zwar nicht, was gerade los ist, aber ich würde gerne mit einem Arzt reden. Irgendetwas stimmt nicht.“
Eine gefühlte Ewigkeit später hatte ich dann ein Gespräch mit einem Psychologen. Da ich überhaupt nicht sagen konnte, was mit mir los war, gab er mir die Aufgabe, mir selbst einen Brief zu schreiben. Da ich mir vor dem Gang in die Klinik geschworen hatte, alles zu tun, was mir die Ärzt:innen sagten, nahm ich den Vorschlag an. Am Abend setzte ich mich hin und fing an zu schreiben, was ich ab diesem Tag über drei Jahre lang fast täglich tat. Ich schrieb:
Wow, was für ein Tag. Nicht nur, dass ich von diesem Ort überwältigt bin, sondern auch von der Kraft und der Gegenwehr oder dem Schutz, den ich spüre. Was ich irgendwie immer besser verstehen kann, ist, dass ich diese Kraft auch anders, nicht gegen mich selbst, sondern für mich nutzen kann. Das ist es auch, wovon ich in der Vergangenheit oft gesprochen habe. Ich bin gespannt, wie ich damit umgehen kann. Wirklich toll ist, dass ich viel Gutes in mir habe, nicht nur für andere Menschen, sondern auch für mich und meine Familie. Der Kampf kann weitergehen. Warum auch immer ich diesen Kampf mit mir selbst führen muss. Vielleicht muss ich jetzt noch nicht alles verstehen. Danke für die Kraft. Danke an mich selbst.
In diesen Tagen wurde meine Krankmeldung für die Krankenkasse ausgestellt. Darauf stand: „Verdacht auf PTBS“, was bedeutete, dass ich verzögert auf belastende Ereignisse mit außergewöhnlicher Bedrohung reagierte.
PTBS
PTBS steht für Posttraumatische Belastungsstörung (Post-Traumatic Stress Disorder). Es handelt sich um eine psychische Erkrankung, die als Reaktion auf ein traumatisches Ereignis auftreten kann. Diese Störung kann Menschen jeden Alters und Hintergrunds betreffen, die direkt oder indirekt Zeuge oder Opfer eines einschneidenden, belastenden Ereignisses waren.
Zweite Woche:Warum bin ich eigentlich in der Klinik?
Von Albträumen geplagt, wachte ich jede Nacht gegen 2 Uhr auf. Einmal sah ich mich als kleinen Jungen, vollkommen allein, hungrig und frierend am Küchentisch sitzend. Ich wartete, aber niemand kam. In einem anderen Traum musste ich mich als Kind in ein Bett legen, das kalt und von Urin durchtränkt war. Im nächsten Traum lag ich völlig verängstigt im Bett, weil meine Eltern und fremde Personen lautstark stritten.
Am Dienstag hatte ich meine zweite Kunsttherapiestunde. Die Stunde, in der mir durch alltägliche Gebrauchsgegenstände klar werden sollte, warum ich wirklich in der Klinik war. Bis zu diesem Tag war ich noch immer der Meinung, nur ein bisschen schlechter zu schlafen als gewöhnlich. Auch dem emotionalen Vulkanausbruch schenkte ich anfangs nur wenig Beachtung. Wieder hielten wir eine Bewusstseinsübung ab. Als ich die Augen öffnete, erschrak ich. Die Menschen um mich herum hatten sich verändert. Es waren bekannte Personen aus meiner Vergangenheit. Eine Patientin glich von einer Sekunde auf die andere meiner Mutter: Haarfarbe, Statur, Mimik und Gestik. Ich traute meinen Augen kaum. Ein anderer Patient wurde in meiner Wahrnehmung mehr und mehr zu meinem Stiefvater. Und das war nur der Anfang.
Meine Art, die Welt zu sehen, hatte sich in diesem Augenblick verändert. Die Menschen hatten sich verändert. Vieles aus meiner Vergangenheit kam mit einem Mal hoch – und nahm ungebeten Platz in der Gegenwart. Ich wusste damals nicht, was mit mir passierte. Heute weiß ich, dass ich getriggert wurde.
Trigger
In der Psychotherapie bezieht sich der Begriff Trigger auf bestimmte Reize oder Situationen, die starke emotionale oder psychologische Reaktionen hervorrufen können. Diese Reaktionen sind oft mit traumatischen Erfahrungen, belastenden Ereignissen oder psychischen Störungen verbunden. Ein Trigger kann unterschiedliche Formen, wie z. B. einen Geruch, ein Geräusch, einen bestimmten Ort, ein bestimmtes Wort oder eine bestimmte Situation, annehmen. Diese Auslöser können Erinnerungen an vergangene traumatische oder belastende Erfahrungen hervorrufen und negative Gefühle, körperliche Symptome oder unerwünschte Verhaltensweisen auslösen.
Mein Körper und meine Gedanken machten gefühlt, was sie wollten. Mir wurde langsam klar, dass ich auch außerhalb der Klinik unbewusst nach ähnlichen Figuren meiner Vergangenheit gesucht hatte. Die vielen Trigger, die ich in die Klinik projizierte, führten mich zurück an den Schauplatz meiner Kindheit und Jugend. Ich hatte es in den ganzen Jahren meines doch erfolgreichen Lebens nicht erkannt. Die Erlebnisse von damals schienen vergessen zu sein. Meine Gefühle hatte ich immer sehr gut unter Kontrolle gehabt. 43 Jahre lang musste ich funktionieren, um nun meine Traumata zu bearbeiten. Verdrängen war nicht länger möglich. Ab diesem Tag war mir das zwar klar, aber ich war noch lange nicht in der Lage, alle Punkte miteinander zu verbinden.
Zurück zur Kunsttherapie. Wie erwähnt, machte ich in der ersten Einheit einen Würfel als Basis meiner Skulptur. Ich schaute mir mein Werk an und überlegte, was ich jetzt noch damit machen könnte. Ich ging zum Regal, in dem zahlreiche unterschiedliche Gegenstände und Materialien waren. Ich kramte in den Kisten und nahm unbewusst sechs Strohhalme und sechs Schaschlik-Spieße heraus, setzte mich hin und betrachtete die geometrische Form des Würfels. Nach kurzer Zeit gab ich die sechs Strohhalme auf die Spitze der Statue. Dann nahm ich einen Zahnstocher nach dem anderen und steckte sie jeweils in einen der Strohhalme. Ich war gerade fertig, da wurde mir auf einmal klar, dass ich sexuell missbraucht wurde. Was genau der Trigger war, vielleicht war es die Zahl 6, kann ich nicht sagen.
Es wurde mir in diesem Moment einfach klar. Ich legte die Strohhalme, in denen noch die Zahnstocher steckten, ganz langsam und ordentlich vor die Statue (siehe Abbildung 2) und ging völlig unaufgeregt auf den Balkon, um frische Luft zu schnappen. Meine Therapeutin folgte mir, denn sie merkte wohl, dass etwas nicht stimmte. Als sie mich fragte, ob alles in Ordnung sei, sagte ich zu ihr: „Ich wurde sexuell missbraucht. Was machen wir jetzt?“ Sie antwortete: „Bleib ruhig! Du bist in guten Händen. Wir kümmern uns darum. Du bist an einem sicheren Ort.“ Ihre ruhige Art war in diesem Moment sehr hilfreich. Ich saß erstmal eine ganze Zeit lang wie versteinert auf einer Bank und schaute in die Ferne. Ich war wie betäubt. Ich fühlte nichts, aber auch gar nichts. Ich hatte damals noch überhaupt keine Ahnung, was es bedeutete, sexuell missbraucht worden zu sein. Am Ende der Therapie stand ich auf – und machte weiter wie immer.
Aber nun ging es erst richtig los. Ich war für Tage und Wochen wie ferngesteuert. Auf einmal triggerte mich alles. Wirklich ALLES. Ich verwendete das Wort „Trigger“, ohne überhaupt zu wissen, was es bedeutete, geschweige denn was dieses Wort übersetzt hieß oder was es im Zusammenhang mit der Thematik Trauma auf sich hatte.
Trauma
Ein Trauma bezieht sich auf eine tiefgreifende emotionale, psychologische und physische Reaktion auf eine belastende oder schmerzhafte Erfahrung. Traumatische Ereignisse können extrem stressig und überwältigend sein und haben das Potenzial, erhebliche Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit einer Person zu haben.
Traumata können in verschiedenen Formen auftreten:
Akutes Trauma: Dieses bezieht sich auf einzelne, unvorhersehbare Ereignisse wie Naturkatastrophen, Unfälle, Gewalttaten oder plötzliche Verluste.
Komplexes Trauma: Dieses tritt auf, wenn eine Person über einen längeren Zeitraum hinweg wiederholt traumatischen Ereignissen ausgesetzt ist, wie etwa in Fällen von Missbrauch, Vernachlässigung oder lang anhaltenden Konflikten.
Entwicklungstrauma: Hierbei handelt es sich um traumatische Erfahrungen, die in der Kindheit auftreten und die normale Entwicklung beeinträchtigen können, wie z. B. Vernachlässigung oder Missbrauch in der frühen Kindheit.
Ich sah in den Menschen und Orten um mich herum Menschen und Orte meiner Vergangenheit. Schlag auf Schlag kamen viele verdrängte Erinnerungen ans Licht. Ein Klient hatte dieselbe Statur und ähnliche Haare wie mein Stiefvater. Ein anderer Klient sah aus wie ein Mann, der früher in unserem Haus gewohnt hatte. Eine Klientin sah aus wie eine Frau, bei der ich lange gearbeitet hatte; ein Mann sah aus wie der Pfarrer, bei dem ich Konfirmationsunterricht hatte. Die Feuerstelle in der Nähe der Klinik, umrandet mit großen Steinen und halb





























