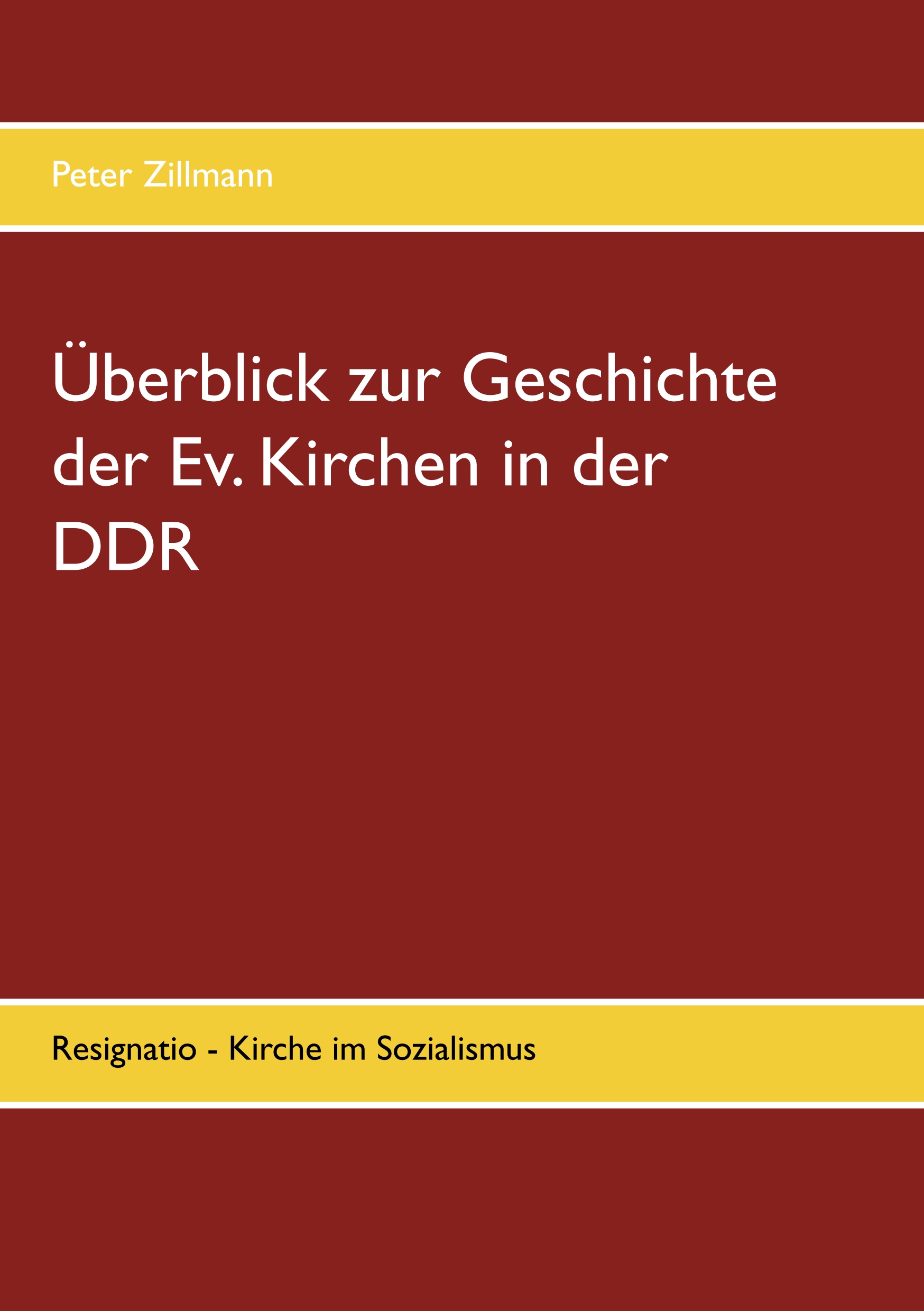
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es wurde eine kurze und streng systematische Auflistung der wichtigsten politischen und kirchlichen Ereignisse über den Zeitraum von 1945 bis 1990 erstellt, um gerade für Studierende und Lehrende eine einfache Hilfe zu bieten, die Entwicklung einer Kirche im Sozialismus zu verstehen. Mit den umfangreichen Anmerkungen und Hinweisen genügt die hier vorliegende unveränderte erste Ausgabe von 1990 auch weitergehenden Ansprüchen und ist nun, was der Wunsch vieler Rezipienten war, mit der Aufnahme als Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, für wissenschaftliche Arbeiten besser rezitierbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Da sagte Jesus zu ihnen:
»Die Könige üben Macht über ihre Völker aus, und die Tyrannen lassen sich sogar noch ›Wohltäter des Volkes‹ nennen. Bei euch muss es anders sein! Der Größte unter euch muss wie der Geringste werden und der Führende wie einer, der dient.«
(LK 22,25f)
für Richard, Johannes und Frieda
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 3. Ausgabe 2020
Vorwort zur Internetausgabe 2002
Teil I (1945 - 1949) Neubeginn
Gesellschaft
1.1.1. Aufbau des Staates
1.1.2. Enteignung – Bodenreform
Staat-Kirche
1.2.1. Trennung von Kirche und Staat
1.2.2. Bündnispartner
1.2.3. Einheitsschule
1.2.4. Antireligiöse Propaganda
Kirche
1.3.1. Evangelische Kirche in Deutschland
1.3.2. Evangelische Kirche in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ)
1.3.3. Statistik
1.3.4. Kirchliches Leben
Theologie
1.4.1. Barmen
1.4.2. Theologische Richtungen
1.4.3. Stuttgarter Schulderklärung
1.4.4. Darmstädter Bruderratswort
Teil II (1949 - 1961) Konfrontation
Gesellschaft
2.1.1. Aufbau des Sozialismus
2.1.2. Stalinismus
2.1.3. Fluchtbewegung – Mauerbau
2.1.4. Kalter Krieg
2.1.5. Ökonomie
Staat-Kirche
2.2.1. Kommuniqué 1953
2.2.2. Kommuniqué 1958
2.2.3. Kirchenkampf
2.2.4. Bildungspolitik
2.2.5. Kirchliche Jugendarbeit
2.2.6. Jugendweihe
Kirche
2.3.1. Einheit der EKD
2.3.2. Säkularisierung
2.3.3. Militärseelsorge
Theologie
2.4.1. Christ zwischen Ost und West
2.4.2. Kirchenverständnis
2.4.3. Römer 13
2.4.4. Ende des konstantinischen Zeitalters
Teil III (1961 - 1978) Entspannung
Gesellschaft
3.1.1. Mauerbau
3.1.2. Neue Verfassung
3.1.3. Entspannungspolitik
3.1.4. Ökonomie
Staat-Kirche
3.2.1. Loyalität
3.2.2. Der 6. März 1978
3.2.3. Atheistische Erziehung
3.2.4. Wehrerziehung
Kirche
3.3.1. Bund der Ev. Kirchen in der DDR
3.3.2. Kirche im Sozialismus
3.3.3. Diaspora
Theologie
3.4.1. Kirche und Gesellschaft
3.4.2. Zwei-Reiche-Lehre
3.4.3. Zehn Artikel
3.4.4. Zeugnis und Dienst
3.4.5. Lerngemeinschaft
Teil IV (1978 - 1990) Wende
Gesellschaft
4.1.1. Kontinuität – Stagnation
4.1.2. Ökonomie
4.1.3. Staatssicherheit
4.1.4. Fluchtbewegung
4.1.5. Opposition
4.1.6. Wende
Staat-Kirche
4.2.1. "Thron und Altar"
4.2.2. Geschäftspartner
4.2.3. Friedensbewegung
4.2.4. Gruppen
Kirche
4.3.1. Konkursverwaltung
4.3.2. Resignation
4.3.3. Erneuerung von Unten
4.3.4. Neue EKD
Theologie
4.4.1. status confessionis
4.4.2. Friedenserziehung
4.4.3. Gesellschaftsveränderung
4.4.4. Schuldfrage
Schematische Darstellung "Kirche im Sozialismus"
Personenverzeichnis
Abkürzungen
Literaturverzeichnis
Filmdokumentation - Schulfernsehen
Bußwort EKMD
Nachwort zu den Hintergründen - Geschichtsschreibung
Nachwort zu den Hintergründen
–
Innere Million
Nachwort zu den Hintergründen - Déjà-vu
Vorwort zur 3. Ausgabe 2020
Überblick zur Geschichte der Ev. Kirchen in der DDR.
Es wurde eine kurze und streng systematische Auflistung der wichtigsten politischen und kirchlichen Ereignisse über den Zeitraum von 1945 bis 1990 erstellt, um gerade für Studierende und Lehrende eine einfache Hilfe zu bieten, die Entwicklung einer "Kirche im Sozialismus" zu verstehen.
Mit den umfangreichen Anmerkungen und Hinweisen genügt die hier vorliegende unveränderte erste Ausgabe von 1990 auch weitergehenden Ansprüchen und ist nun, was der Wunsch vieler Rezipienten war, mit der Aufnahme als Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, für wissenschaftliche Arbeiten besser rezitierbar.
Als 1990 der real existierende Sozialismus zusammenbrach, suchten sich viele Bürger der DDR einen passenden Mythos oder eine persönliche Legende, um die Wirren der Zeit gut zu überstehen.
Die Kirchen wollten die ihr von der SED-Partei zugewiesenen ordnungs- und moralpolitischen Aufgaben am Ende auch nicht mehr erfüllen. Sie begannen sich in der Wendezeit langsam aus jahrelang geübter Bündnispolitik zurückzuziehen. Allerdings zogen sie eine deutliche Grenze. Der Sozialismus sollte reformiert und nicht abgeschafft werden, denn eine "Kirche im Sozialismus" - ohne diesen Sozialismus - wäre ein Anachronismus geworden.
Aus der Auftragsbestimmung dieser Kurzformel wurde letztendlich ein Wesensmerkmal. Innerhalb der Kirchen wird die damalige Entfremdung der Leitung von der Basis zum Spiegel der gesamten sozialistischen Gesellschaft.
Da sich diese Entwicklung heute 30 Jahre später zu wiederholen scheint und die Affinität zwischen Christlichkeit und sozialistischer Heilslehre neu aufblüht, muss diese kleine geschichtliche Darstellung der Ev. Kirchen in der DDR in unveränderter Ausgabe von 1990 herausgegeben werden, denn sie ist mittlerweile selber zu einem Zeitdokument geworden, da sie unbeeinflusst von Geschichtsklitterung und Romantisierung vor der Entstehung einer Kirche warnt, die sehr schnell der Obrigkeit untertan wird.
An guten Darstellungen über die Kirchengeschichte der DDR gibt es seit den neunziger Jahren keinen Mangel, aber die größeren sind meistens zu umfangreich und die kleineren behandeln Teilaspekte, die oft zu spezialisiert sind.
Im Ergebnis der komplizierten Entstehungsgeschichte während der Wendezeit wurde diese Arbeit in Form einer Geschichtsmatrix verfasst. Sie stellt Zusammenhänge, in denen Linearkombinationen eine Rolle spielen, übersichtlich dar und erleichtern damit Recherche- und Gedankenvorgänge.
Wird die Arbeit hintereinander gelesen, so wie es üblicherweise geschieht, kann sich für den Unkundigen ein ziemlich diffuses und mühsam zu erarbeitendes Gesamtbild ergeben. Benötigt man aber nur Teilaspekte auf einem bestimmten Hintergrund, kann die Arbeit auch Zeilen oder Spaltenweise gelesen werden. Zum Beispiel ergeben die zeitlichen Abschnitte Theologie (1.4 – 2.4 – 3.4 – 4.4) eine kleine Theologiegeschichte von 1945 bis 1990.
1
2
3
4
Gesellschaft
Staat-Kirche
Kirche
Theologie
1
Neubeginn
1945-49
1945-49
1945-49
1945-49
2
Konfrontation
1949-61
1949-61
1949-61
1949-61
3
Entspannung
1961-78
1961-78
1961-78
1961-78
4
Wende
1978-90
1978-90
1978-90
1978-90
Für ganz spezielle Anwendungen kann der Vektor auch diagonal betrachtet werden, also: Aus der gesellschaftlichen Entwicklung 1945-49 (1.1) hat das Staats-Kirchen Verhältnis in den fünfziger Jahren (2.2) letztendlich zu einer stabilisierten Kirche geführt (3.3), was sich in der Theologie der achtziger Jahre niedergeschlagen hat (4.4).
Die Hintergründe über die Entstehung der ersten Ausgabe von 1990 und die Schwierigkeiten bei der Sammlung der Dokumente in den achtziger Jahren werden im Anhang kurz erläutert. Hier kommen auch die Erkenntnisse der Stasiakteneinsicht ab 1995 zum Tragen, die in den beiden früheren Ausgaben nicht berücksichtigt wurden.
Die Internetausgabe von 2002 wurde gleich in den ersten Jahren millionenfach abgerufen und hat auch im internationalen Bereich ihre beabsichtigte Wirkung nicht verfehlt. Insofern ist eine weitere Printausgabe eigentlich überflüssig, aber dennoch wegen der besagten wissenschaftlichen Zitierbarkeit erwünscht und angebracht.
Möge dieser kleine Überblick über die evangelische Kirche in der DDR nun allen Lesern weiterhin eine Hilfe sein, die Zeichen der Zeit richtig zu erkennen.
Peter Zillmann, Berlin im März 2020
Vorwort zur Internetausgabe 2002
"Resignatio" - Wir liefern uns dem Staat aus
Mitte der achtziger Jahre diskutierte Bischof Gottfried Forck mit Vikaren aus der Landeskirche Berlin-Brandenburg über die Zukunft der Kirche in der DDR. Er beschrieb die Situation mit dem lateinischen Wort 'Resignatio' und einem Gleichnis aus der römischen Militärgeschichte: Wenn die Übermacht der Feinde zu groß wurde und man sich ergeben wollte, kam der Befehl Resignatio. Die Standarten wurden zurückgezogen und das römische Heer gab die Stellung auf.
Er übertrug dieses Bild auf die Situation der Kirche in der DDR. Die immer stärker um sich greifende Resignation unter den Christen implizierte allerdings einen Widerspruch. Bischof Forck war der Ansicht, daß die Kirche in einer sicheren Burg sitzt und nicht einmal beachtet wird. Der Feind (SED-Staat) hat mit sich selbst zu tun und greift nicht an. Paradoxerweise zieht die Kirche gerade in dieser Situation ihre Fahnen (Signum) zurück und will die Burg aufgeben. Er sah es als Fehler an, daß sowohl Christen im Lande als auch Vertreter der Kirchenleitungen sich dem Staat ohne Not willfährig hingaben.
Am Ende der sogenannten "Kirche im Sozialismus" tat sich ein Graben auf, der Kirchenleitungen und Kirchenvolk in allen Landeskirchen trennte. Wie es zur Resignation und Handlungsunfähigkeit innerhalb der Kirchen kommen konnte, soll in dieser Arbeit untersucht werden.
Die Arbeit entstand im Zusammenhang mit einem Seminar über Neue und Neueste Kirchengeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin, das der Kirchenhistoriker Dr. Ludwig als erstes Seminar nach der Wende im Frühjahr 1990 leitete. Die Arbeit wurde dann zum Schwerpunktthema einer Konventsrüste im Kirchenkreis Berlin-Reinickendorf im Jahre 1991. Pfarrer diskutierten mehrere Tage die Entwicklung der säkularen Gesellschaft und die Problematik der kommenden "Verostung" der Westberliner Stadtkirche.
Da die Legendenbildung über die kirchliche Beteiligung bei der "friedlichen Revolution 1989" weiter fortschreitet soll diese Seminararbeit als kurzer Abriß der DDR-Kirchengeschichte in seiner ursprünglichen Form von 1990 hier im Internet zur Diskussion gestellt werden. Neuere wissenschaftliche Untersuchungen und Quellen wurden nicht berücksichtigt, damit die Authentizität der zeitnahen Betrachtung erhalten bleibt.
Zur besseren Übersicht sind die 4 Zeitabschnitte jeweils in Themenbereiche unterteilt:
Gesellschaft,
Staat-Kirche,
Kirche,
Theologie
http://www.seggeluchbecken.de/kirche/ddr-kirche.htm
Berlin im November 2002, Pfarrer Peter Zillmann
Teil I (1945 - 1949) Neubeginn
1.1.1. Aufbau des Staates
Alliierter Kontrollrat: Nach dem 8.Mai 1945 existierte keine deutsche Staatsgewalt mehr. Die Siegermächte trugen nun für Deutschland die höchste politische und rechtliche Verantwortung. Am 5.6.1945 erfolgte durch die Bildung des Alliierten Kontrollrates die Übernahme der obersten Regierungsgewalt. Von 17.7.-2.8.1945 fand die Potsdamer Konferenz der UdSSR, USA, und Großbritanniens über Deutschland statt. Grundsätzliche Gegensätze der Siegermächte werden deutlich und bestimmen die weitere Politik (Ost-West Konflikt).
SBZ: Im Gegensatz zu den westlichen Zonen Deutschlands, wo die Bildung politischer Parteien und Organisationen nur zögernd erlaubt wurde, konnten in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) bereits ab dem 10.06.45 Gründungen von Parteien und Organisationen erfolgen (KPD, SPD, FDGB, CDU, LDPD, ). Zielsetzung war, eine antifaschistische demokratische Ordnung aufzubauen (Antifa-Block). Die Konstituierung eines “Sowjetsystems“ war jedoch nicht geplant. (1) Am 11.6.45 erfolgte der Gründungsaufruf der KPD (programmatisches Dokument). Noch war die Errichtung einer parlamentarisch-demokratischen Republik vorgesehen.
Bereits Ende April/Anfang Mai 1945 begannen Initiativgruppen des ZK der KPD mit dem Wiederaufbau der staatlichen Verwaltung unter Berücksichtigung der schon in Moskau ausgearbeiteten Richtlinien. Daneben bildeten sich besonders in den industriellen Ballungszentren der SBZ (auch in den westlichen Zonen) “Volkskomitees“ und “Antifa-Ausschüsse“, um akute politische Probleme zu lösen (Säuberung, Notstände, Versorgung). Diese zeitweilige Parallelität zwischen Administration und Basisinitiativen gefährdete den Führungsanspruch der KPD und wurde zunehmend unterbunden.
SED-Partei: Am 22.04.46 erfolgte auf Druck der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) in der SBZ sowie im sowjetischen Sektor von Berlin die Zwangsvereinigung von SPD und KPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). Nach dem anfangs geltenden Paritätsprinzip werden Wilhelm Pieck (KPD) und Otto Grotewohl (SPD) zu Vorsitzenden gewählt. Am 20.10.46 kam es zu den einzigen freien Wahlen in der SBZ und Gesamt-Berlin. Das Ergebnis war für die KPD (SED) trotz massiver Unterstützung durch die SMAD enttäuschend.
In der SBZ: SED 47,5%; CDU 24,5%; LDPD 24,6%; Massenorganisationen 3,4%.
In Groß-Berlin: SPD 48,7%; CDU 22,2%; SED 19,8%; LDPD 9,3%.
Am 04.06.47 erfolgte durch den Befehl der SMAD die Gründung der Deutschen Wirtschaftskommission (DWK) als zentrale Gesamtverwaltung der SBZ. Sie gilt als Vorform der Regierung der DDR. Bis 1948 wurden die Reparationsleistungen durch die sowjetische Besatzungsmacht offen durchgeführt (Demontagen und Entnahmen aus der laufenden Produktion).
Währungsreform: Am 20. März 1948 verlassen die sowjetischen Vertreter den Alliierten Kontrollrat. Da alle Entscheidungen einstimmig gefaßt werden mußten, wird er beschlußunfähig und stellt ohne förmliche Auflösung seine Arbeit praktisch ein. In den drei Westzonen wird an 20.6.48 die Währungsreform durchgeführt. In der SBZ erfolgt drei Tage später die Einführung der “Deutschen Mark der Deutschen Notenbank“. Im Zusammenhang mit den Währungsreformen kommt es zur Berlin-Blockade. Der Kalte Krieg erreicht einen Höhepunkt.
Auf der ersten Parteikonferenz der SED am 28.01.49 wurden die Richtlinien für eine “Partei neuen Typus“ beschlossen. (Dominanz der kommunistischen Partei, Demokratischer Zentralismus). Stalins Thesen von 1924 zur Bolschewisierung der Partei werden übernommen. Der eigenständige deutsche Weg der KPD (SED) ist damit nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch beendet.
Gründung der DDR: Nachdem die drei Außenminister der westlichen Besatzungsmächte ein gemeinsames Besatzungsstatut für die Westzonen beschlossen hatten, kommt es am 24.5.1949 mit dem in Kraft tretenden Grundgesetz zur Bildung der Bundesrepublik Deutschland. Am 7.10.1949 erfolgt die Gründung der DDR. Ihre erste Verfassung ist noch gesamtdeutsch orientiert. Die SMAD wird in die Sowjetische Kontrollkommission (SKK) umgewandelt und überträgt die Verwaltungsfunktionen an die Provisorische Regierung der DDR. Wenige Tage später erhebt Bundeskanzler Konrad Adenauer einen Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland für das ganze deutsche Volk. (2)
1.1.2. Enteignung - Bodenreform
Der Prozeß der Enteignung großer und mittlerer Industriebetriebe vollzog sich auf drei Ebenen.
Spontane Enteignung, “herrenlose“ Betriebe werden von Arbeitern übernommen
sowjetische Zwangsverwaltung des Eigentums von Nazis und Kriegsverbrechern
nach deutschem Recht durch Volksentscheid (30.Juni 1946, nur in Sachsen)
Volksentscheid: In Stellungnahmen der Kirchen zum Volksentscheid wurde in Anbetracht der Friedenssicherung und der Schaffung einer gerechten Wirtschaftsordnung der Enteignung zugestimmt. (3)
Otto Dibelius warnte aber schon auf dem 1. Berliner Kirchentag am 28.04.46: “...der Mensch bedarf der Freiheit, innerlich und äußerlich ... ein Staat, der den Menschen jedes mögliche Maß von Freiheit läßt, muß ein Rechtsstaat sein.“ Freiheitlich sei eine politische Ordnung aber nur dann, wenn auch das Recht an Privateigentum anerkannt werde. Da die Planung und Leitung wichtiger Entscheidungsprozesse (Erziehung, Wirtschaft, Wissenschaft) zunehmend in die Kompetenz des Staates übergingen, warnte Dibelius vor der Errichtung eines totalen Staates: “Totaler Staat und christliche Kirche sind unversöhnliche Gegensätze.“(4)
Bodenreform: Am 3. September 1945 beginnt die Bodenreform. Sie brachte im landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Bereich wesentliche Veränderungen der Besitzstrukturen. “Kriegsverbrecher, Naziaktivisten und Großagrarier“, die mehr als 100 ha Land besaßen, sollten entschädigungslos enteignet werden. Der Boden wurde dann in einem Bodenfonds zusammengefaßt und an landarme Bauern, Landarbeiter und Umsiedler verteilt (ca. 30 % des Landes fielen an den Staat). Die entschädigungslose Enteignung stieß auf Widerstand bei den Großagrariern und der bürgerlichen Parteien CDU und LDPD. Ausgenommen von dieser Enteignung waren ehemaliger Staatsbesitz und Kirchenland.
Grundsätzlich begrüßten die Kirchenleitungen der Landeskirchen in der SBZ die Durchführung der Bodenreform. Sie gingen von der christlichen Erwägung der Nächstenliebe aus, den Millionen Deutschen zu helfen, die ihre Heimat verloren hatten. Beklagt wurde aber die außerordentliche Schnelligkeit mit der die Bodenreform ins Werk gesetzt wurde. (5) Entschädigungslos sollten nur rechtmäßig festgestellte Kriegsverbrecher und Nazis enteignet werden. (6)
1.2.1. Trennung von Kirche und Staat
Bereits in Parteidokumenten der KPD, die im Anschluß an die Beschlüsse des VII. Weltkongresses der kommunistischen Internationale (1935) entstanden, befinden sich grundsätzliche Aussagen zur Rolle der Christen und der Kirche in einem neuen, demokratischen Deutschland. (7) Das Recht der Glaubens- und Gewissensfreiheit wird als eines der klassischen Grundrechte anerkannt. Schon vor Ende des Krieges arbeiten Christen und Kommunisten im Nationalkomitee Freies Deutschland zusammen.
In den späteren Diskussionen um den Entwurf einer Verfassung in der SBZ wird dann auch folgerichtig die Position der Glaubens- und Gewissensfreiheit (Weimarer Verfassung) eingenommen, obwohl bereits die ideologische Abgrenzung forciert wurde.
Bündnispartner: Die Grundrechte auf “Gesinnungs- und Religionsfreiheit“ hatten für die SED die Qualität und Funktion von Gestaltungsrechten. Sie sind somit lediglich ein Angebot des Staates (SED), am Aufbau einer antifaschistisch-demokratischen und später sozialistischen Gesellschaftsordnung aktiv mitzuwirken. Der Zusammenschluß der antifaschistisch-demokratischen Parteien in der SBZ wird 1946 vom Zentralsekretariat der SED definiert: “Vor das Trennende ihrer verschiedenen Weltanschauungen haben sie das Einigende gestellt, die Verantwortung vor der Zukunft. Am Neuaufbau Deutschlands haben auch die Kirchen aller Konfessionen teil. Das Ziel heißt: Überwindung des Faschismus durch Demokratie und Sicherung des Friedens!“ (8)
Ideologie: Die Aufgaben der Kirchen sollten aber auf den kultischen Bereich reduziert werden (Terminus: Erfüllung religiöser Aufgaben). Verantwortung für und Einflußmöglichkeiten auf gesellschaftliche oder gar politische Bereiche wurden in der Praxis nicht konzediert.
Die organisatorische Trennung der Kirche von Staat und Schule wird bereits im Programm der SED (1946) postuliert und schrittweise durchgeführt. Staatliche und kirchliche Aufgabenstrukturen sollten möglichst genau voneinander abgegrenzt werden. Einen "christlichen Sozialismus" sollte es in der SBZ nicht geben. (9) Es bestand nach der Berlinblockade sogar zeitweilig die Absicht, die kirchliche Verwaltung und das kirchliche Vermögen vom Staat treuhänderisch übernehmen zu lassen.
Die in der Ideologie des Marxismus-Leninismus konstitutiv bestimmende atheistische Komponente war auch theoretische Leitlinie bei der “Diktatur des Proletariats“. Man ging davon aus, daß Religion im Sozialismus eine absterbende Angelegenheit sei. Mit der Entwicklung der Partei neuen Typus, wird dann auch nach der Währungsreform der eigene deutsche Weg zum Sozialismus aufgegeben. Gleichzeitig drängt die SED in ihrer Parteiideologie die Kirche als Bündnispartner zunehmend zurück. (10)
1.2.2. Bündnispartner
Trotz der programmatischen Trennung von Kirche und Staat wurde die Kirche aus politischen Gründen dennoch als ein Bündnispartner angesehen. Traditionell war dieses Verhalten schon 1943 im NKFD während der Kriegsgefangenschaft angelegt. Der Arbeitskreis der Christen im NKFD erarbeitete Konzepte zur Kirchenerneuerung und nahm Stellung zu allgemeinen politischen Fragen. (11)
Umerziehung: Das Hauptziel der SED nach dem Krieg bestand in einem friedlichen Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus. Gemeinsam sollten Lehrer, Erzieher und Pfarrer für die Umerziehung der Menschen in dieser Zeit gewonnen werden. Da der Übergang ohne Störungen erfolgen sollte und der größte Teil der Bevölkerung kirchlich gebunden war, vertrat man in der Praxis die Meinung, Religion sei Privatsache und es sei Toleranz geboten.
Verantwortung: "Die SED ist ... der Auffassung, daß weltanschauliche Unterschiede keinen Anlaß geben, die verschiedenen Richtungen der auf bauenden Kräfte gegeneinander auszuspielen. ... Die frühere allgemeine Ablehnung der Kirche durch die sozialistische Arbeiterbewegung galt nicht dem christlichen Glauben. Sie galt der Kirche als Machtinstrument der herrschenden Klasse ... Der Sozialismus hat sich immer zu dem Grundsatz bekannt: Der Glaube ist eine persönliche Angelegenheit des einzelnen Menschen! ... Wir wollen keinen Kulturkampf! Es würde den Aufbau des demokratischen Deutschlands gefährden. Nicht von uns droht dem Christentum Gefahr, wohl aber von jenen Kreisen, die es jetzt wieder in den politischen Tagesstreit zerren wollen. Es geht also nicht um eine Kampffrage: Christentum oder Marxismus, sondern um die gemeinsame Verantwortung gegenüber der Zukunft Deutschlands, die in voller Größe steht vor Christentum und Marxismus." (W. Pieck und O. Grotewohl am 27.8.1946) (12)
Diktatur und Bündnis: Je nach politischer Notwendigkeit wurde in den späteren Jahren entweder die “atheistische Diktatur" oder die “Bündnispolitik“ hervorgehoben. Aus dieser Taktik von Bündnis- und Trennungspolitik konnten marxistische Ideologen und christliche Theologen das jeweils Brauchbare für ihre theoretischen und kirchenpolitischen Konzeptionen herausgreifen (Dibelius, Fuchs, Schönherr).
Für politisch uninteressierte Christen waren aber die Handlungsweisen des Staates und der Kirchen oftmals undurchsichtig und nicht berechenbar. In Runderlässen der Kirchen an die Pfarrerschaft wird eine Zugehörigkeit von kirchlichen Amtspersonen zu politischen Gruppen und Parteien zwar gebilligt, von einer Mandatsübernahme aber abgeraten, da ständig die Gefahr bestand, in dem wechselseitigen Gebrauch von Bündnis- oder Trennungspolitik von der SED politisch vereinnahmt zu werden. (13)
1.2.3. Einheitsschule
Erziehungsmonopol: Die demokratische Reform des gesamten Bildungs- und Erziehungswesens führte zum Aufbau der Einheitsschule. Allein die staatlichen Bildungsträger bestimmten Erziehungsziele, Lehrinhalte und Unterrichtsmethoden. Der Staat hatte das Erziehungsmonopol.
Private Konfessionsschulen und weltanschauungsfreie Schulen wurden nicht geduldet. Die Institution Kirche wurde auf Grund der in der Praxis radikal verstandenen Forderung nach Trennung von Staat und Kirche aus dem schulischen Erziehungsprozeß vollständig ausgegrenzt. Ebenso wurde das sogenannte Elternrecht erheblich eingeschränkt.
In dem “Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule“ vom 31.05.1946 wird festgelegt: “Die schulische Erziehung der Jugend ist ausschließlich Angelegenheit des Staates. Der Religionsunterricht ist Angelegenheit der Religionsgemeinschaften;...“ (14)
Erziehungsträger: Gegen diese Einheitsschule gab es innerhalb der Kirche erheblichen Widerstand. Zwar wurde nicht die generelle Kompetenz des Staates bestritten, auf dem Gebiet des Schulwesens dominierend zu sein, besonders was die Bereitstellung der materiellen Mittel betraf, jedoch wurde heftig gegen die Absicht protestiert, den Erziehungsträger “Eltern“ aus dem Erziehungsprozeß auszuschalten.
Widerstand: “Wer gibt dem Staat, genauer gesagt: denen, die den Staat im Augenblick regieren, das Recht, darüber zu bestimmen, in welchem Geist unsere Kinder erzogen werden sollen? Nach biblischer Lehre tragen die Eltern und niemand sonst die Verantwortung für das, was aus ihren Kindern wird.“ (Otto Dibelius in einer Rede zum Tag der Evangelischen Kirche am 27.04.1947) (15) Eine christliche Erziehung ist nach kirchlicher Auffassung nur gewährleistet, wenn Schule, Eltern und Kirche am Erziehungsprozeß beteiligt sind.
Der Kirche ging es nun aber nicht um die christliche Schule als einem allgemeinen Regeltyp. Sie wollte lediglich die Möglichkeit der Konfessionsschule (oder Simultanschule), “wo eine starke Mehrheit der Elternschaft es verlangt“, mit christlichen Lehrern und einheitlicher Ausrichtung des Unterrichts und der Erziehung, die den christlichen Grundsätzen nicht widerspricht. (16)
Ev. Schule: Theologisch begründet wurde diese Forderung mit dem bei der Taufe der Kinder abgegebenen elterlichen Versprechen, für eine christliche Erziehung Sorge zu tragen. Liegt das Erziehungsmonopol jedoch allein in staatlichen Händen, wäre dieser Erziehungsauftrag gefährdet.
Lediglich in West-Berlin kam es im September 1948 zur Gründung von fünf evangelischen Grundschulen und einem Gymnasium. An den anderen Schulen konnte Christenlehre meistens auch problemlos erteilt werden. Auf dem Lande (SBZ) sah es dagegen weit schlechter aus. Der Kirche war es nur schwer möglich, Religionslehrer zur Verfügung zu stellen. Religionslehrer, die z.B. früher der NSDAP angehört hatten, durften keinen Unterricht mehr erteilen. Ebenso wurde durch alle Arten von Schikanen verhindert, Unterrichtsräume zur Verfügung zu stellen.
1.2.4. antireligiöse Propaganda
Religionsunterricht: Die atheistisch fundierte Weltanschauung des Marxismus-Leninismus sollte zur Grundlage der Gesamtpolitik gemacht werden. Der Handlungsspielraum der Kirche, gerade bei der Erziehung und Bildung, wurde dadurch mehr und mehr eingeschränkt. Religionsunterricht an den Schulen, so wie er anfangs noch von der CDU gefordert wurde, konnte von der SED nicht akzeptiert werden.
Weltanschauung: Sie schaffte es aber nicht, einen aktiven Kampf gegen die Kirchen mit Hilfe offensiver antireligiöser Propaganda verfassungsrechtlich zu sichern. Jedoch blieb diese Zielsetzung nach dem Vorbild sowjetmarxistischer Pädagogik immer bestehen und lieferte somit besonders in den fünfziger Jahren ein gravierendes Konfliktpotential zwischen Staat und Kirche.
Später flaute die antireligiöse Propaganda ab und seit den siebziger Jahren sicherten sich dann Staat und Kirche auf ideologischem Gebiet gegenseitig Rechtgläubigkeit zu. (17)
1.3.1. Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
Der würtembergische Landesbischof Theophil Wurm hatte seit Herbst 1941 versucht, zwischen den zerstrittenen Richtungen der Bekennenden Kirche zu vermitteln. Alle bekenntnisgebundenen Gruppen in der evangelischen Kirche sollten gemeinsam handeln. Dieses Einigungswerk Wurms wurde dann nach dem Ende des Krieges bestimmend für die Neuordnung der Kirche. (18)
Konferenz in Treysa: Im August 1945 kamen die Vertreter der Landeskirchen und der Bruderräte auf Einladung Wurms zur Kirchenführerkonferenz in Treysa zusammen. Mit Mühe gelang es, die Gegensätze zu überbrücken und einen neuen Kirchenbund, die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), zu konstituieren. Man einigte sich vorerst auf eine vorläufige Ordnung und einen Rat als oberstes Leitungsgremium. Dabei wurde nicht die Ordnung der Bruderräte aufgenommen, sondern primär die überlieferten landeskirchlichen Strukturen (einschließlich Bischofsamt), welche in der Tradition des Kirchenbundes und der Deutschen Evangelischen Kirche (DEK) lagen. (19) Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren die konservativen lutherischen Kirchen (Bayern, Hannover, Hamburg, Land Sachsen, Thüringen und Mecklenburg). (20)
Der Theologe Paul Schempp schreibt 1949 in einem KTA-Rundbrief: “Soweit ich sehe, haben die Kirchen in Deutschland, einzeln und gemeinsam, mit frommen Eifer und unter gelegentlichen Hemmungen, ihre bisherige Unordnung wieder zur Ordnung erklärt und außer einer gewissen Biblifizierung des Vokabulars ist es, als ob es nie eine Bekennende Kirche gegeben hätte.“(21)
Rat der EKD: Der Rat der EKD bestand aus 7 federführenden und 5 weiteren Mitgliedern. Die ersteren waren: Landesbischof D. Wurm (Stuttgart), Vorsitzender, D. Dibelius (Berlin), Superintendent Held (Essen), Dr. Lilje (Hannover), D. Meiser (München), Pfarrer Niemöller D.D. (z.Zt. Leoni/Bayern), Lic. Niesel(Reelkirchen). Die weiteren Mitglieder waren: Pfarrer Asmussen D.D. ‚ Superintendent Hahn, Dr. Heinemann (Essen), Prof. Dr. Smend (Göttingen), Oberstudiendirektor Meier (Altona) .
Die Verteilung der Ratsmitglieder entsprechend den Besatzungszonen ergab der Zufall. So kam es, daß Otto Dibelius zunächst als einziges Ratsmitglied die Ostkirchenkonferenz, die sich als Zusammenschluß der Landeskirchenführer der lutherischen Kirchen und der Altpreußischen Provinzialkirchen im Juni 1946 herausbildete, vertrat. (22)
1. Synode der EKD: Die Grundordnung der EKD (1948) bestätigt die restaurierenden Tendenzen. Die Landeskirchen behielten ihre Selbständigkeit. Rat und Synode der EKD hatten faktisch nur eine Richtlinienkompetenz. Die neue Grundordnung kann deshalb als eine Fortführung und Weiterentwicklung der Verfassung des Kirchenbundes von 1921 angesehen werden. (23)
Die erste Synode der EKD tagte dann im Januar 1949 in Bethel. Zum Ratsvorsitzenden wurde Bischof Otto Dibelius und zum Präses der Synode wurde Gustav Heinemann gewählt. Die Wahl von Dibelius war von erregten Debatten begleitet.
Jedoch bestand allgemein ein kritisches Verhältnis zu Staat und Gesellschaft, daß sich aber in sehr verschiedener Weise äußern konnte. (24) Die inneren Spannungen der EKD treten dann 1950 bei der politischen Entscheidung zur Wiederbewaffnung offen zu Tage.
1.3.2. Evangelische Kirche in der SBZ
Trennung Ost-West: Die Landeskirchen und die EKD standen von Anfang an mit dem Problem der Teilung und der Frage der Wiedervereinigung vor einer schwierigen Situation. Die Gliedkirchen in der SBZ unterlagen zunehmend anderen Bedingungen als ihre westlichen Schwesterkirchen. Die Einführung verschiedener Währungen begünstigte die Trennung der Kirchen in Ost- und Westregionen.
In einem Wort der EKD zur deutschen Not wurde im Juli 1948 gewarnt: “Die Aufrechterhaltung der Zonengrenzen und alle Maßnahmen, die auf eine endgültige Aufspaltung Deutschlands hinauslaufen, müssen zu immer weiterer Verelendung und zur Auflösung der sittlichen Bindungen führen.“(25)
Darüber hinaus versuchte der sich in der SBZ herausbildende atheistische Weltanschauungsstaat die Einflußmöglichkeiten der Kirchen zu beschränken. Kirchenpolitische Entscheidungen waren zudem oftmals vom Antikommunismus geprägt und verschärften indirekt und ungewollt das Auseinanderleben der Kirchen.
EKU und VELKD: In den Jahren 1948-51 kam es in den einzelnen Landeskirchen zu einer Festigung der kirchlichen Ordnungen. Für die Kirchen in der SBZ war mit der Beendigung des Streites um den Fortbestand der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union (APU zur EKU) und mit der Gründung der VELKD, die mit ihrer übergreifenden Gesetzgebung den Anspruch einer Kirche erhob, der ‘Kirchenbildungsprozeß‘ vorerst abgeschlossen. (26)
Christlich-politisch: Innerhalb der Kirche wurden von vielen die neuheidnisch-germanischen Gruppen der Nazis und im nachhinein dann der gesamte Nationalsozialismus als die Höchststufe der Säkularisation betrachtet. Unter Verdrängung der eigenen kirchlichen Schuld bedeutete Antifaschismus daher: “Zurück zu Gott und unter seine Autorität“ (In diesem Punkt waren sich z.B. Kirche und CDU einig). In der Politik sollten christliche Grundsätze zum Tragen kommen.
Die Kirche nahm deshalb mit Wohlwollen die Bildung einer christlich-politischen Partei auf die dann als angebliches Ergebnis des Kirchenkampfes favorisiert wird. (27)
linke Kräfte: Gegensätze theologischer und politischer Natur traten jedoch bald zu Tage. Bereits im September 1944 hatten Krummacher und Sönnichen im Arbeitskreis der Christen des NKFD ihr Konzept zur kirchlichen Erneuerung entwickelt. (28) Die linken Kräfte sammelten sich dann später, nachdem die Bekennende Kirche von den alten und wieder neuen Kirchenführern geschickt aufgesplittert worden war, in der Kirchlich-Theologischen Arbeitsgemeinschaft für Deutschland (KTA). (29) Ihr Einfluß wurde jedoch auf Grund der politischen Entwicklung zwischen Ost und West und mit Hilfe der Kirchenbürokratie zunehmend gemindert.
Volkskirchenkonzept:





























