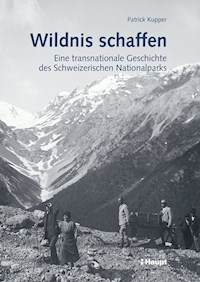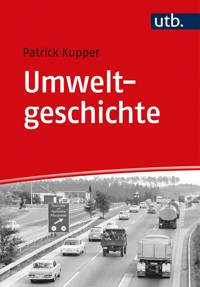
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Einführungen in die Geschichtswissenschaft. Neuere und Neueste Geschichte
- Sprache: Deutsch
Umweltgeschichte gewinnt in Lehre und Forschung immer mehr an Bedeutung. Das Buch führt in Konzepte, Felder und Methoden des Faches ein. Es behandelt die großen Themen der neueren europäischen Geschichte wie Industrialisierung, Urbanisierung oder Imperialismus aus umwelthistorischer Perspektive. Geeignet für Lehrende und für Studierende vom Bachelor- bis zum Master-Niveau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
utb 5729
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau Verlag · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Einführungen in die Geschichtswissenschaft
Neuere und Neueste Geschichte
Herausgegeben von Julia Angster und Johannes Paulmann
Band 3
Patrick Kupper
Umweltgeschichte
Vandenhoeck & Ruprecht
Dr. Patrick Kupper ist Professor für Wirtschafts-^^ und Sozialgeschichte an der Universität Innsbruck.
Online-Angebote oder elektronische Ausgaben sind erhältlich unter www.utb-shop.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.de abrufbar.
© 2021, Vandenhoeck & Ruprecht, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe (Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, Verlag Antike und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Bei Pforzheim. Autobahn, Ausfahrt zur Raststätte und Tankstelle. Bundesarchiv, Bild 194-5769-45 / Fotograf: Lachmann, Hans
Korrektorat: Sebastian Schaffmeister, Köln Umschlaggestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart Satz: le-tex publishing services, LeipzigEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
UTB‐Band‐Nr. 5729
ISSN 2625-5170
ISBN 978-3-8463-5729-3
Inhalt
Vorwort zur Reihe
I.Einführung
II.Zentrale Begriffe und Konzepte
1.Sozionaturale Verhältnisse im Wandel
2.Umwelthistorische Zeiten
3.Umwelthistorische Räume
III.Themenfelder und Untersuchungsgegenstände
4.Meliorationen
5.Klimawandel und Naturkatastrophen
6.Industrialisierung
7.Urbanisierung
8.Kolonialismus und Imperialismus
9.Naturschutz
10.Politische Regime
11.Beschleunigung
12.Umweltschutz
IV.Coda
Danksagung
Literaturverzeichnis
Register
Vorwort zur Reihe
Die in dieser Reihe erscheinenden Einführungen in die Geschichtswissenschaft behandeln zentrale Themen der europäischen Geschichte vom ausgehenden 18. bis ins frühe 21. Jahrhundert in einer nationsübergreifenden Perspektive. Die Grundidee für die Reihe ist aus einer Erfahrung entstanden, die wir im Alltag der akademischen Lehre gemacht haben: Einführungsliteratur für Bachelor-^^ oder Masterstudiengänge stellt in der Regel entweder Faktenwissen oder einen theoretischen Ansatz in den Mittelpunkt. Wir wünschten uns hier eine Verbindung zwischen diesen Ebenen, die wir in der akademischen Lehre ja regelmäßig leisten müssen. Die „Einführungen in die Geschichtswissenschaft“ sollen daher beides miteinander verknüpfen: Die Bände bieten jeweils anhand spezifischer Gegenstände eine Einführung in die Geschichtswissenschaft, also in die Arbeitsweise, die Methodik und die Denkweisen des Fachs. Geschichtswissenschaft als universitäres Fach soll zum wissenschaftlichen Arbeiten befähigen, also dazu, selbst Fakten zu analysieren, sie zu deuten und darzustellen. Es geht darum, selbständig Erkenntnisinteressen zu formulieren, und hierfür ist ein Überblick über die Pluralität und den Wandel der Zugänge des Fachs, über die Theorieentwicklung und die jeweils angemessenen Methoden unabdingbar. Diese Arbeitsweise lässt sich jedoch am besten am konkreten Beispiel vermitteln. Die Reihe bietet daher eine problemorientierte Vermittlung von Inhalten und einen theoriegeleiteten Zugang zu wichtigen historischen Themen. Ihr Ziel ist eine Einführung in wissenschaftliche Zugänge und Methoden, in Forschungsstand und Forschungskontroversen, und damit in die Arbeitsweise sowie das Wesen von Geisteswissenschaft. Gedacht ist diese Reihe jedoch durchaus auch für Lehrende als Handreichung zur Vorbereitung von Seminaren oder einzelnen Sitzungen. Der Aufbau der Bände folgt daher jeweils der möglichen Struktur einer Seminarveranstaltung und bietet eine argumentative oder analytische Gliederung, die nach einer kurzen thematischen Einführung zunächst Kontroversen und Theorien der Forschung behandelt, Leitfragen entwickelt und diese dann an Beispielen in mehreren Kapiteln systematisch anwendet. Wir hoffen, damit einen sinnvollen Beitrag zu Lehre und Studium zu leisten.
Julia Angster und Johannes Paulmann
I.Einführung
Umweltgeschichte und das Werden des modernen Europa
„Nichts ist klarer als das Mittelmeer des Ozeanografen, des Geologen oder auch des Geografen: Das sind anerkannte, etikettierte, abgesteckte Gebiete. Aber das Mittelmeer der Geschichte?“, fragt Fernand Braudel auf den ersten Seiten seiner klassischen Geschichte des Mittelmeers und lässt seiner Frage sogleich eine Warnung folgen: „Wehe dem Historiker, der glaubt, diese Vorfrage stelle sich nicht, das Mittelmeer sei keine Persönlichkeit, die erst zu bestimmen wäre, sondern längst bestimmt, klar und unmittelbar zu erkennen und zu fassen, indem man es entlang der punktierten Linie seiner geografischen Umrisse aus der allgemeinen Geschichte herausschneidet.“1
Gleiches lässt sich für eine Umweltgeschichte Europas sagen. Dabei müssen wir Braudels Anthropomorphismus nicht folgen und der europäischen Umwelt eine Persönlichkeit zusprechen wollen. Jedoch sollten wir seine Mahnung erst nehmen und, wie es sich im Übrigen für jede historische Darstellung ziemt, eingangs klären, wie wir unseren Gegenstand bestimmen und wie wir ihn ein-^^ und abgrenzen. Wo findet die vorliegende Untersuchung ihre thematischen, zeitlichen und räumlichen Grenzen, und wie sind diese inhaltlich begründet? Da eine solche Bestimmung stets von unseren Absichten abhängt, gilt es diese zunächst zu umreißen: Übergeordnetes Ziel der folgenden Abhandlung ist, ihre Leserinnen und Leser zum einen (in Teil II) mit den wesentlichen Konzepten der Umweltgeschichte vertraut zu machen und diese zum anderen (in Teil III), entsprechend der Anlage der Buchreihe, entlang zentraler Untersuchungsgegenstände der neueren und neuesten europäischen Geschichte zu vertiefen.2 Wie wir diese Aufgabe angehen, wo wir einsetzen und wo wir enden werden, welchen Pfaden wir folgen und wonach wir Ausschau halten werden, möchte ich in diesem kurzen einführenden Teil I darlegen.
Thematisch konzentriert sich dieses Buch auf die Umweltgeschichte. Die Umweltgeschichte kennzeichnet, dass sie die Natur zu einer zentralen Dimension gesellschaftlichen Wandels erhebt. Im Zentrum des Interessens stehen die Wechselwirkungen zwischen Umwelt und Gesellschaft in der Vergangenheit und wie und warum sich diese mit der Zeit veränderten. Im Folgenden spreche ich diesbezüglich vom Wandel der sozionaturalen Verhältnisse.3 Welche theoretischen und methodischen Anforderungen eine solche Perspektivierung und Schwerpunktsetzung stellen, welche historischen Einsichten sie versprechen und welche Bedeutung sie für die allgemeine Geschichte haben, wird in den folgenden Kapiteln ausführlich verhandelt: zunächst (in Teil II) anhand zentraler Begriffe und Konzepte und daraufhin (in Teil III) anhand ausgewählter Themenfelder und Untersuchungsgegenstände. Daher konzentrieren sich meine folgenden Ausführungen auf den raumzeitlichen Zuschnitt der Darstellung, und ich nutze dies zugleich, um einen Ausgangspunkt meiner Überlegungen zu definieren und eine Arbeitshypothese zu entwickeln.
In zeitlicher Hinsicht fokussiert sich das Buch auf die zurückliegenden gut 250 Jahre seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Dieser Zeitraum, der nach gängiger Periodeneinteilung die neuere und neueste Geschichte ausmacht, wird auch als die Epoche der Moderne bezeichnet.4 Das Attribut „modern“ dient mir in diesem Buch, um der zeitlichen eine inhaltliche Bestimmung beizufügen. Mit Christof Dipper gehe ich davon aus, dass moderne Gesellschaften einem grundlegenden Wandel ausgesetzt sind, der sich vom vorangehenden Wandel unterscheiden lässt, dem vormoderne Gesellschaften, die ihrerseits keineswegs statisch waren, unterlagen.5 Dieser grundlegende Wandel erfasst auch die Interaktionen zwischen Gesellschaft und Umwelt und wird seinerseits durch diese Interaktionen geprägt.
Eine (Umwelt-)Geschichte des modernen Europa muss sich folglich des profunden Wandels annehmen, den die sozionaturalen Verhältnisse in den letzten 250 Jahren erfahren haben. Das moderne Europa, so die Arbeitshypothese, hebt sich umwelthistorisch von früheren Epochen in dreierlei Hinsicht ab: Erstens erreichten die menschlichen Eingriffe in die Naturverhältnisse eine bislang unbekannte Dimension und Tiefe, und diese Eingriffe hatten weitreichende, teilweise nicht intendierte Folgen für Gesellschaften und Umwelten in Europa, aber auch weltweit. Dieser Wandel war gerichtet. Damit ist weder gemeint, dass die historische Entwicklung linear verlief, noch dass sie ein vorgegebenes Ziel ansteuerte. Gerade gegen Fortschrittsideologien, wie sie vielen Theorien der Moderne und der Modernisierung innewohnen, bietet die Beschäftigung mit Umweltgeschichte ein vortreffliches Korrektiv. Hingegen waren Prozesse wie Territorialisierung, Industrialisierung oder Urbanisierung durch materielle und kulturelle Veränderungen in den sozionaturalen Verhältnissen geprägt, die nicht reversibel sind. Zweitens war der Wandel der sozionaturalen Verhältnisse von einer intensivierten gesellschaftlichen Beschäftigung mit Natur und von mehrfachen Transformationen in den Naturwahrnehmungen begleitet. In der gesellschaftlichen Verarbeitung dieser Naturwahrnehmungen entstanden spezifisch moderne Ordnungsmuster. Diese Ordnungsmuster prägten wiederum, wie Individuen und gesamte Gesellschaften Natur zum einen wahrnahmen und repräsentierten und zum anderen auf sie einwirkten – und dies solange, bis solche vorherrschenden Muster aus Gründen, die es jeweils historisch zu erklären gilt, an Erklärungskraft verloren und in einem gesellschaftlichen Verständigungsprozess durch neue Sichtweisen abgelöst wurden. Aufklärerische und naturwissenschaftliche Leitideen transformierten hergebrachte Ordnungsmuster und mit ihnen die sozionaturalen Verhältnisse ebenso wie etwa die Konzepte des Naturschutzes und des Umweltschutzes. Drittens schließlich setzte sich der moderne Wandel der sozionaturalen Verhältnisse von der Vorepoche durch eine deutlich erhöhte Geschwindigkeit und die Tendenz ab, den regionalen und nationalen Rahmen zu sprengen und eine globale Wirksamkeit zu entfalten. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, diesen Wandel überregional und transnational zu untersuchen, um ihn in voller historischer Tragweite und Bedeutung erfassen zu können.
Damit ist bereits angesprochen, dass die Darstellung nicht an den geografischen Rändern Europas haltmacht, sondern ein globales Europa in den Blick nimmt. Im Sinne einer Verflechtungsgeschichte wird nicht nur den innereuropäischen Verbindungen und Interaktionen, sondern auch jenen Aufmerksamkeit geschenkt, die europäische mit anderen Weltgegenden in Beziehung setzten. Auf eine fein säuberliche Abgrenzung des Europäischen vom Nichteuropäischen wird verzichtet. Weder könnte eine solche Abgrenzung die zu jeder Zeit vielschichtige Natur der grenzüberschreitenden Verbindungen erfassen, noch würde sie den Dynamiken und Veränderungen, die diese Verbindungen über die Zeit erfuhren, gerecht werden. Und schließlich müsste eine solche Abgrenzung auch in Widerspruch zu den Vorstellungen treten, die sich Zeitgenossen und Zeitgenossinnen von Europa machten. Denn was „man unter Europa verstand und wie man es sich idealerweise vorstellte, war immer Ergebnis einer Verständigung über das ‚Europäische’“.6 Europa und das Europäische sind nicht zeitlose Einheiten, vielmehr unterlagen sie einer andauernden kommunikativen Aushandlung und diskursiven Deutung.
Europa bildet auch keinen einheitlichen Naturraum. Zum einen liegen zwar ausgedehnte Teile Europas in klimatisch gemäßigten Zonen. Im Norden und in den Berggebieten herrschen allerdings arktische und subpolare und im Süden teilweise subtropische Bedingungen. Ebenso tritt in Richtung Osten das feuchtkühle atlantische Klima mehr und mehr hinter einem wärmeren und trockeneren kontinentalen Klima zurück. Zum anderen wird Europas Landmasse zwar auf drei Seiten, im Norden, Westen und Süden, durch Wasserflächen begrenzt, gegen Osten geht sie hingegen nahtlos in die asiatische Landmasse über. So bildet Europa mithin den westlichen Ausläufer einer zusammenhängenden eurasischen Kontinentalplatte. Gegen Osten ist nicht nur die politische und kulturelle, sondern auch die naturräumliche Abgrenzung Europas arbiträr. Auch deshalb waren die Ansichten, wo Europa endet und Asien beginnt, historisch umstritten und fluide.
In der Darstellung versuche ich, Vielfalt und Besonderheiten europäischer Naturverhältnisse und deren Wandel über die Zeit zu berücksichtigen, und zwar im Hinblick darauf, wie sie im Zusammenspiel mit gesellschaftlichen Faktoren europäische Umwelten prägten. Meine thematischen Erkundungen gehen jedoch nicht von den Naturverhältnissen aus, sondern nehmen den Wandel der sozionaturalen Verhältnisse von der gesellschaftlichen Seite her in Angriff. Sie sind daher weder nach Klimanoch nach Vegetationszonen unterteilt und auch nicht nach Ökosystemen oder entlang unterschiedlicher Spezies. Vielmehr unterziehen sie gesellschaftshistorische Gegenstände wie den Imperialismus oder die Jahrzehnte des Wirtschaftswunders nach 1945 einer umwelthistorischen Analyse. Durch diese Perspektivierung möchte ich nicht nur andere und ungewohnte Einsichten zu bekannten Themen gewinnen, sondern auch deren allgemeine Interpretation beeinflussen und verschieben.
Während die Umweltgeschichte in Europa in den letzten Jahrzehnten einen enormen Aufschwung erlebt hat, steckt die Umweltgeschichtsschreibung zu Europa noch in den Kinderschuhen. So veranstaltete die European Society for Environmental History ESEH seit 2001 alle zwei Jahre europäische Konferenzen, die zuletzt mehrere hundert Vortragende anzogen. Diese Konferenzen machten die große Dynamik und die wachsende Menge und Vielfalt umwelthistorischer Forschung in Europa sichtbar und beförderten den Austausch unter Umwelthistorikerinnen und -historikern über die Landes-^^ und Sprachgrenzen hinweg.7 Gleichwohl mangelt es bislang an Darstellungen der Umweltgeschichte Europas.8 Meine eigenen Darlegungen in den folgenden Kapiteln basieren daher weitgehend auf räumlich und/oder thematisch eingeschränkten Fachstudien. Dass Zentral-^^ und Nordwest-europa dabei mehr Platz bekommen als Süd-^^ und Osteuropa, liegt zum einen in meinem Vorwissen und meinen Sprachkenntnissen begründet. Zum anderen hat sich die Umweltgeschichte als historische Disziplin in Zentral-^^ und Nordwesteuropa früher und stärker ausgebildet als in anderen europäischen Regionen, sodass sich die Darstellung auf einen breiteren Forschungsstand beziehen kann. Eine verstärkte Einbeziehung der vernachlässigten Gegenden ist sehr wünschenswert, und ich hoffe, dass meine vorliegende Darstellung dazu sowohl Anreize und Anknüpfungspunkte als auch Diskussionsstoff und Reibungsflächen bietet.
Die folgenden Ausführungen gliedern sich in zwei Hauptteile. Die drei Kapitel in Teil II diskutieren wichtige Begriffe und Konzepte. Kapitel 1 führt in das Arbeitsfeld der Umweltgeschichte ein und entwickelt das Konzept der sozionaturalen Verhältnisse. Zudem diskutiert es die zentralen Begriffe Natur, Umwelt, Kultur und Gesellschaft, wie diese in der Umweltgeschichte gehandhabt und in welche Beziehung zueinander sie gebracht werden. Das 2. Kapitel widmet sich der zeitlichen Dimension in der Umweltgeschichte. Es diskutiert, in welchen Zeiträumen sich die sozionaturalen Verhältnisse veränderten und wie umwelthistorische Epochen und Zäsuren zu solchen der allgemeinen Geschichte stehen. Konzepte wie das Solare und Fossile Zeitalter, das Anthropozän, die Ära der Ökologie und die Nachhaltigkeit kommen zur Sprache. Das diesen Teil abschließende 3. Kapitel thematisiert, welche Rolle der räumlichen Dimension in der Umweltgeschichte zukommt. Es erörtert die Verwendung der Begriffe Raum, Ort, Landschaft und Territorium und das Verhältnis von Raum und Zeit und plädiert dafür, umwelthistorische Untersuchungen auf multiplen Raumskalen anzulegen.
Die neun Kapitel des Teils III konkretisieren diese konzeptionellen Überlegungen anhand ausgewählter Themenfelder und Untersuchungsgegenstände aus der Umweltgeschichte des modernen Europa. Jedes Kapitel führt in ein zentrales Untersuchungsfeld der Umweltgeschichte ein. Die Kapitel sind thematisch angelegt, sie sind aber so angeordnet, dass sich der zeitliche Schwerpunkt der Darstellung allmählich von der zweiten Hälfte des 18. in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts verschiebt und damit auch eine zeitliche Entwicklung nachvollziehbar wird. Jedes Kapitel ist aber in sich geschlossen und kann daher auch einzeln gelesen werden. Kapitel 4, das Eingangskapitel zu diesem Teil, thematisiert, wie die gesellschaftliche Umgestaltung der Natur seit 1750 bis dahin unbekannte Ausmaße anzunehmen begann und welche sozionaturalen Dynamiken mit diesen Umgestaltungen einhergingen: Dynamiken, die die europäischen Gesellschaften und Umwelten bis heute und in die Zukunft hinein zutiefst prägen. Dasselbe gilt für Klimawandel und Naturkatastrophen, deren Umweltgeschichte in Kapitel 5 zur Darstellung kommt. Es legt dar, dass nicht nur die Auswirkungen klimatischer Ereignisse und Prozesse auf Umwelt und Gesellschaft umwelthistorisch interessieren, sondern zunehmend auch, wie Gesellschaften diese wahrnahmen und verarbeiteten. Das folgende Kapitel 6 schildert den epochemachenden Prozess der Industrialisierung. Es argumentiert, dass die Industrielle Revolution nicht nur die soziopolitischen und sozioökonomischen, sondern auch die sozionaturalen Verhältnisse in Europa und darüber hinaus umkrempelte. Kapitel 7 widmet sich der Schwester der Industrialisierung, der Urbanisierung. Es zeigt auf, wie sich in deren Verlauf neben den städtischen Umwelten auch jene des städtischen Umlands veränderten und wie sich der städtische Zugriff auf Natur teilweise bis in ferne Gebiete auswirkte. Das 8. Kapitel erörtert den europäischen Imperialismus und greift damit zwangsläufig weit über das geografische Europa aus. Seine doppelte Fragestellung lautet, wie sich einerseits der europäische Imperialismus weltweit auf die Umwelt auswirkte und wie andererseits Umweltbedingungen diesen Imperialismus prägten. Kapitel 9 rückt den Naturschutz ins Zentrum der Betrachtung. Es erkundet, wie sich dieser Anfang des 20. Jahrhunderts organisierte, wie er die zeitgenössischen Ansichten zu Natur und Umwelt erneuerte und welche Errungenschaften, aber auch Unzulänglichkeiten ihn auszeichneten. Das 10. Kapitel wendet sich der Umweltpolitik zu. Es diskutiert an Beispielen aus der Zwischenkriegszeit, unter anderem Faschismus, Nationalsozialismus und Stalinismus, wie stark politische Regime die Sicht auf die Umwelt, den gesellschaftlich Umgang mit ihr und letztlich die Umwelt selbst prägten. Im Zentrum des folgenden 11. Kapitels steht die von der Umweltgeschichte vorgenommene Neuinterpretation der Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Es diskutiert und befragt die zentralen umwelthistorischen Interpretationsfiguren des „1950er Syndroms“ und der „Großen Beschleunigung“. Das den III. Teil abschließende 12. Kapitel behandelt die sogenannte ökologische Revolution der Jahre um 1970. Es fragt sowohl nach den Ursachen dieser Revolution als auch nach ihrem Verlauf und ihren längerfristigen Auswirkungen bezüglich Umwelt und Gesellschaft.
Die Behandlung der Themen ist ebenso wenig abschließend wie deren Auswahl. Das Bestreben zielt vielmehr dahin, die ausgewählten Themenfelder umwelthistorisch so aufzubereiten, dass sie eine informierte Grundlage zur Diskussion bieten, zum Nachdenken anstiften sowie zum Weiterlesen und -forschen anregen. Ganz in diesem Sinne schließt der Band in Teil IV mit einer Coda zur Bedeutung der Umweltgeschichte für die Geschichte des modernen Europa.
1Braudel, F., Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II., Frankfurt a.M. 1990, Bd. 1, S. 16. Zu dessen Bedeutung für die Umweltgeschichte siehe Kap. 1 Sozionaturale Verhältnisse im Wandel.
2Der europäischen Umweltgeschichte der Frühen Neuzeit wird sich ein eigener von Martin Knoll verfasster Band widmen.
3Begriff und Konzept werden in Kap. 1 Sozionaturale Verhältnisse im Wandel entwickelt.
4Bayly, C. A., Die Geburt der modernen Welt. Eine Globalgeschichte 1780–1914, Frankfurt a.M. 2006.
5Dipper, C., Moderne. Version: 2.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, http://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok.2.1114.v2 (zuletzt eingesehen am 05.05.2021).
6Berger J., J. Willenberg u. L. Landes, EGO | Europäische Geschichte Online – eine transkulturelle Geschichte Europas im Internet, http://ieg-ego.eu/de/ego/einfuehrung (zuletzt eingesehen am 05.05.2021).
7European Society for Environmental History ESEH, Past Conferences, http://eseh.org/event/events-archive/ (zuletzt eingesehen am 05.05.2021). Nach Regionen geordnete Forschungsüberblicke zu Europa geben Kalb, M., Moving Beyond the Nation State? Reflections on European Environmental History, in: Global Environment 6 (2013), S. 130–165 und Hughes, J. D., What is Environmental History?, Malden 2016. Zudem lohnt sich die Durchsicht des viermal jährlich erscheinenden ESEH Notepads, das seit 2016 eine Rubrik führt, in der jüngere nicht-englischsprachige umwelthistorische Publikationen aus jeweils einer europäischen Region vorgestellt werden. European Society for Environmental History ESEH, Notepad, http://eseh.org/resources/notepad-newsletter/ (zuletzt eingesehen am 05.05.2021).
8An Frank Uekötters Befund von 2009 hat sich wenig geändert: Uekötter, F., Gibt es eine europäische Geschichte der Umwelt? Bemerkungen zu einer überfälligen Debatte, in: Themenportal Europäiche Geschichte, http://www.europa.clio-online.de/2009/Article=374 (2009, zuletzt eingesehen am 05.05.2021). Die bereits etwas angejahrten Gesamtdarstellungen Delort, R. u. F. Walter, Histoire de l’environnement européen, Paris 20102 (zuerst 2001 erschienen) und Whited, T. L. u.a., Northern Europe. An Environmental History, Santa Barbara 2005 (auf das nördliche Europa beschränkt) vermitteln einen Einblick in die umwelthistorischen Entwicklungen Europas, bleiben aber insgesamt im Deskriptiven stehen. Einen Überblick auf engstem Raum liefert Niels Freytag auf EGO: Freytag, N., Natur und Umwelt, in: Europäische Geschichte Online, http://www.ieg-ego.eu/freytagn-2016-de (zuletzt eingesehen am 05.05.2021). Das von McNeill und Mauldin herausgegebene Handbuch zur globalen Umweltgeschichte enthält (bezeichnenderweise) keinen Beitrag zu Europa (McNeill, J. R. u. E. S. Mauldin (Hg.), A Companion to Global Environmental History, Chichester 2012). Von den globalen Darstellungen zur Umweltgeschichte sind insbesondere Radkau, J., Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt, München 20022 und McNeill, J. R., Blue Planet. Die Geschichte der Umwelt im 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 2003 zur Lektüre empfohlen. Siehe zudem Uekötter, F., Im Strudel. Eine Umweltgeschichte der modernen Welt, Frankfurt a.M. 2020 und Headrick, D. R., Humans versus Nature. A Global Environmental History, Oxford 2020, die für diesen Band keine Berücksichtigung mehr finden konnten.
II.Zentrale Begriffe und Konzepte
1.Sozionaturale Verhältnisse im Wandel
Umweltgeschichte untersucht den Wandel sozionaturaler Verhältnisse. Sie fragt, wie in der Vergangenheit gesellschaftliche mit ökologischen Prozessen interagierten und wie sich Menschen zum Rest der Natur ins Verhältnis setzten. Wie ist dies zu verstehen? Mit der Wortschöpfung „sozionatural“ wird festgehalten, dass das Soziale und das Naturale nicht voneinander zu scheiden sind, aber auch nicht ineinanderfallen und daher Interaktionen zwischen gesellschaftlichen und ökologischen Prozessen beobachtet und interpretiert werden können. Mit der Einfügung des unscheinbaren Wortes „Rest“ wird ein Hinweis in dieselbe Richtung gesetzt.1 Die gewählte Formulierung impliziert, dass die Beziehungen zwischen Mensch und Natur dialektisch zu fassen sind: Menschen müssen zugleich als Teil der Natur und als von der Natur geschieden verstanden werden. Als biologische Wesen sind sie Bestandteil der Natur, als kulturelle und soziale Wesen heben sie sich von ihr ab. Darin ist die Dialektik der Einheit von Natur und Kultur bei einer gleichzeitigen Unterscheidung zwischen Natur und Kultur begründet.
In diesem einleitenden konzeptuellen Kapitel geht es um die Frage, welche spezifischen Perspektiven die Umweltgeschichte auf die Geschichte eröffnet. Bereits klar geworden sein dürfte, dass sich die Umweltgeschichte über den Einbezug von Natur in die historische Untersuchung charakterisiert und dass die Wechselwirkungen zwischen Umwelt und Gesellschaft in der Vergangenheit sowie deren historischer Wandel im Zentrum des fachlichen Interesses stehen. Ebenso dürfte deutlich geworden sein, dass der Einbezug von Natur in die historische Untersuchung komplexe erkenntnistheoretische Fragen aufwirft. Für eine theoretisch und methodisch reflektierte umwelthistorische Beschäftigung ist es unerlässlich, sich mit diesen grundsätzlichen Problemstellungen auseinanderzusetzen. Umwelthistoriker und -historikerinnen haben dies in den letzten Jahrzehnten denn auch ausführlich getan und das Fach auf eine solide theoretische und methodische Grundlage gestellt.2
Diese Grundlage soll im Folgenden systematisch diskutiert werden. In einem ersten Schritt wird es darum gehen, sich über zentrale Konzepte und Begrifflichkeiten Klarheit zu verschaffen. Dazu gehören insbesondere Natur, Umwelt, Kultur und Gesellschaft. Darauf aufbauend wenden sich die folgenden Abschnitte der umwelt-historischen Modellierung von Interaktionen zwischen Natur und Kultur sowie den umwelthistorischen Zugängen zu und erörtern, welche Qualitäten der Natur in der Umweltgeschichte zugeschrieben werden, unter anderem wie wandlungsfähig, eigendynamisch und handlungsmächtig Natur zu konzipieren ist. Im abschließenden Teil folgen einige Anmerkungen zur methodischen Vielfalt des Faches, die wesentlich auch seiner hohen Interdisziplinarität geschuldet ist. Zeitliche und räumliche Aspekte, die sich mit einer so verstandenen Umweltgeschichte auftun, werden in den beiden folgenden Kapiteln erörtert.
Zentrale Begrifflichkeiten
Die Dialektik der Natur ist ein komplexes Gedankengebäude und dazu angetan, philosophisch weniger geübte Geister zu verwirren; und damit wohl die große Mehrheit. Dies umso mehr, als sich diese Dialektik sowohl materialistisch als auch idealistisch entwickeln lässt. So kann schlüssig argumentiert werden, dass sich die Einheit von Natur und Kultur im menschlichen Körper manifestiert. Ebenso lässt sich aber die Trennung zwischen Natur und Kultur oder auch dem Biologischen und Gesellschaftlichen im menschlichen Körper lokalisieren, etwa als biologisches und soziales Geschlecht, als sex and gender, wobei diese Trennung wiederum hinterfragt worden ist. Im Körper und mit ihm lassen sich Einheit und Unterschied von Natur und Kultur mitunter materiell begründen. Auch sind Menschen für ihr biologisches Überleben zweifellos von der Natur abhängig, sowohl individuell als auch kollektiv im Rahmen sozialer Gemeinschaften. Die basalen Grundlagen menschlichen Lebens ebenso wie die Ausgangsstoffe jeder materiellen Produktion entstanden und entstehen in Naturprozessen. Mit dem Studium dieser Naturprozesse und ihrer evolutiven Veränderungen über sehr ausgedehnte, sich teilweise über Jahrmillionen erstreckende Zeiträume, aber auch in kürzeren und gegenwartsnahen Zeitspannen, beschäftigt sich die Naturgeschichte, die in den Naturwissenschaften eine lange, zumindest bis ins 18. Jahrhundert zurückreichende Tradition hat und heute in mehreren Disziplinen weitergeführt wird, etwa in der Geologie, der Biologie und der Ökologie.3 Welche Bedeutung diesen Naturprozessen in der von Menschen mitgestalteten Geschichte, der sozionaturalen Geschichte, zukam, damit beschäftigt sich die Umweltgeschichte.4
Natur ist, so kann aus dem Gesagten geschlossen werden, eine essenzielle Größe einer jeden menschlichen Gemeinschaft. Zugleich ist Natur aber sozial konstruiert. Was unter Natur zu verstehen ist und wie Natur zu verstehen ist, ist eine kulturelle Frage. Ebenso ist die Unterscheidung in Natur und Kultur eine kulturelle, welche gesellschaftlich ausgehandelt, validiert und tradiert wird. Wie diese Unterscheidung getroffen wird, variiert von Kultur zu Kultur und wandelt sich zudem über die Zeit. Jede Form dieser Unterscheidung ist folglich kulturell und historisch spezifisch. Davon ist auch jene Variante nicht ausgeschlossen, die sich in modernen westlichen Gesellschaften entwickelte, die stark auf wissenschaftliches Wissen rekurriert und zumeist klar zwischen Natur und Kultur trennt. Dieses spezifisch moderne Natur-Kultur-Verständnis hat seinerseits die Wissenschaften geprägt und zu ihrer Spaltung in naturwissenschaftliche und kulturwissenschaftliche Disziplinen geführt, eine Spaltung, die bis heute fortwirkt.5 Die Spezifität und Relativität der jeweiligen oder auch der eigenen Kultur-Natur-Unterscheidung lassen sich zum einen im synchronen interkulturellen Vergleich erfassen, wie er insbesondere von der Ethnologie betrieben wird.6 Zum anderen zeigen sich die Variabilität und zusätzlich die Wandelbarkeit in der diachron angelegten historischen Analyse, wozu wiederum die Umweltgeschichte berufen ist.
Wie ist in den Geschichtswissenschaften mit den Begriffen Natur und Umwelt umzugehen? Hierfür ist es nützlich, sich kurz mit der Begriffsgeschichte zu befassen. Von den beiden Begriffen ist der Naturbegriff der deutlich ältere. Er taucht bereits im alten Griechenland auf, unter anderem, aber nicht erst in den Schriften von Platon und Aristoteles. Mit Rückbezügen auf die antike Philosophie wird er im europäischen Mittelalter und der europäischen Neuzeit weitergedacht. Angesichts der Vielfalt der Bedeutungen, welche der Begriff Natur über die Jahrhunderte ansammelte, schlug der Philosoph Rudolf zur Lippe vor, den Begriff am besten gleich zu stornieren: Er sei ein „Sack für unverarbeitete Geschichte“. Des Philosophen Leid ist des Historikers Freud, eröffnet ihm ein solcher Sack doch ein reiches Betätigungsfeld.7
Der Begriff Umwelt verbreitet sich erst in der Moderne. Das deutsche „Umwelt“ wie auch das englische „Environment“ finden sich im 19. Jahrhundert sporadisch und vorwiegend in literarischen Texten, im 20. Jahrhundert dann auch zunehmend in wissenschaftlichen Abhandlungen. Seine herausragende gesellschaftliche Bedeutung gewinnt der Umweltbegriff jedoch erst um 1970. Erst in dieser Zeit findet er Eingang in die Alltagssprache und steigt zugleich im Kontext einer global geführten Umweltschutzdebatte zum politischen Leitbegriff auf. Auch das vorrangig ökologische Verständnis von Umwelt (als natürliche Umwelt) ergibt sich erst im Zuge dieser Begriffsverbreitung.8 Tauchen die Begriffe Natur und Umwelt in historischen Dokumenten auf, so gilt es, wie bei allen Quellenbegriffen, deren zeitgenössischen Bedeutungen in der Quelleninterpretation zu berücksichtigen. Bei der eigenen Verwendung der Begriffe als beschreibende oder analytische Begriffe sollte man sich der wandelnden Bedeutung der Begriffe bewusst sein, was auch bedeutet, dass die eigene Verwendung von jener der untersuchten Texte und Akteure abweicht oder, in Bezug auf die Umwelt, dieser Begriff den Akteuren selbst allenfalls nicht zur Verfügung stand.
Wenn wir uns nun den heute gängigen Begriffsbedeutungen von Natur und Umwelt zuwenden, ist Umwelt der enger gefasste Begriff. Im Gegensatz zu Natur ist Umwelt an den Menschen gebunden. Der Begriff Umwelt macht nur in Kombination mit dem Begriff Gesellschaft Sinn. So gilt nicht nur: ohne Umwelt keine Gesellschaft, sondern ebenso: ohne Gesellschaft keine Umwelt. Natur hingegen lässt sich ohne weiteres ohne Mensch oder Gesellschaft denken. Daraus folgt weiter auch, dass Umweltprobleme zwangsläufig immer Gesellschaftsprobleme sind, während der Begriff Naturprobleme keinen Sinn ergibt. Auch die Bewertung von Umweltproblemen oder der Umweltqualität ist letztlich stets eine gesellschaftliche. Ob ein Geräusch als wohlklingende Musik oder als störender Lärm empfunden und ob es als künstlich oder natürlich wertgeschätzt oder abgewertet wird, hängt von gesellschaftlichen Prägungen ab, die durchaus individuell oder sozial ausdifferenziert sein können und sich mit der Zeit verändern. In den Diskussionen, ob Natur und Umwelt anthropozentrisch zu konzipieren seien oder dies nicht vielmehr bereits der erste Schritt in die falsche Richtung sei und es eine Dezentrierung des Menschen brauche, eine biozentrierte Sicht auf die Welt, wird oft vergessen, dass unsere sinnlichen Wahrnehmungen von Natur letztlich unhintergehbar sind und wir es sind, die unsere Umwelt schaffen. Umweltschutz bedarf daher stets einer gesellschaftlichen Begründung. Für die geschichtliche Betrachtung ist anzufügen, dass die historische Analyse immer an menschliche Kognition gebunden ist. Dies gilt für die Auswertung klassischer historischer (Text-)Quellen ebenso wie für die Rekonstruktion vergangener Umwelten etwa mithilfe naturwissenschaftlicher Methoden.
Neben der umfassenden Variante wird der Naturbegriff auch in einer engeren Variante verwendet, welche gerade den Menschen und mit ihm zumeist die Umwelt ganz oder größtenteils ausschließt. So bemühen sich die Naturwissenschaften, sofern sie nicht explizit umweltwissenschaftliche Fragestellungen verfolgen, den Einfluss des Menschen grundsätzlich aus ihren Untersuchungen herauszuhalten. Der Naturschutz wiederum konzentrierte sich lange auf jene Teile der Natur, die vom Menschen nicht oder kaum beeinflusst waren (oder in den Augen der jeweiligen Akteure diese Qualität aufzuweisen schienen). Insbesondere im US-amerikanischen Raum wurden diese als Wildnis (wilderness) angesprochen, während sich im deutschen Sprachraum dafür häufig auch Bezeichnungen wie ursprüngliche, wilde oder echte Natur oder Urnatur finden. Der Ausschluss des Menschen ist in beiden Fällen programmatisch angelegt, aber nicht vollständig, da die Erforschung und der Schutz der menschenfreien Natur nicht oder nicht nur als Selbstzweck gesehen wird, sondern letztlich den lebenden Menschen und späteren Generationen zugute kommen soll.9 Im Schutzdiskurs verkehrt sich mitunter das Verhältnis von Natur und Umwelt insofern, als Naturschutz als Teil eines umfassenderen Umweltschutzes verstanden wird.
Beim Kulturbegriff finden wir ebenfalls und in ähnlicher Weise wie beim Naturbegriff zwei Hauptverwendungen: eine weite, allumfassende und eine enge, auf gewisse Ausdrucksformen eingeschränkte. Dies begünstigt die spiegelbildliche Verwendung des Begriffspaars Natur und Kultur.10 Zudem wird der Kulturbegriff in der weiten Verwendung geläufig in Abgrenzung zu Natur definiert, etwa als „die vom Menschen durch die Bearbeitung der Natur mithilfe von planmäßigen Techniken selbst geschaffene Welt der geistigen Güter, materiellen Kunstprodukte und sozialen Einrichtungen“.11
Interaktionen
Wie lassen sich die Interaktionen zwischen Natur und Kultur theoretisch fassen? Diesbezüglich sind die modellhaften Überlegungen interessant, wie sie in der Wiener Schule der Sozialen Ökologie entwickelt und von Verena Winiwarter für die Umweltgeschichte (re-)adaptiert wurden.12 Hier lege ich sie in einer leicht angepassten Variante dar (vgl. Abb. 1). Natur und Kultur werden als zwei eigenständige Felder vorgestellt, die eine Schnittmenge bilden, in der sich die Menschen und ihre Artefakte befinden. Menschen wirken zum einen auf die Natur ein, indem sie physische Arbeit an ihr verrichten. Je nach Werkzeugen, Technologien und sozialer Organisation, die sie entwickelt haben und anwenden, hinterlässt ihre Arbeit feinere oder tiefere Spuren in der Natur. Zum anderen nehmen Menschen über ihre Sinnesorgane Natur wahr. Sie sehen, hören, riechen, schmecken und spüren Natur, wobei auch hier technische Hilfsmittel eine bedeutende Rolle spielen. Jene Natur, die Menschen physisch bearbeiten und sinnlich wahrnehmen, verwandeln sie in ihre Umwelt. Die sinnlichen Wahrnehmungen können an andere Menschen weitergegeben werden. Sie können aber auch direkt in die eigene Arbeit einfließen. In diesem Fall spricht man von tacit knowledge, implizitem Wissen, das von Akteuren nicht verbalisiert wird. Unter Umständen sind sie auch gar nicht fähig, dieses Wissen weiterzugeben. In diesem Fall schließt sich der Kreis von Arbeit und Wahrnehmung. In jenen Fällen, in denen die Wahrnehmung weitergegeben wird, sei es über Worte, Gesten oder Symbole, findet eine Repräsentation der Wahrnehmung statt. Mit ihrer Kommunikation wird die Wahrnehmung zugleich gesellschaftlich relevant und kann im kulturellen System zu Programmen weiterverarbeitet werden. Solche Programme können dann für Individuen, einzelne soziale Gruppen oder ganze Gesellschaften handlungsleitend werden. Sie werden damit auch gesellschaftsbildend und können zudem auf die Formen einwirken, in denen zum einen Arbeit an Umwelt und Natur vorgenommen und zum anderen Umwelt und Natur wahrgenommen wird. Neue Programme können aber auch direkt zu neuen Repräsentationen führen oder ältere Repräsentationen in neuem Licht erscheinen lassen.
Der Soziologe Niklas Luhmann hat in seinen system-^^ und kommunikationstheoretischen Überlegungen gerade den Austausch zwischen Umwelt und Gesellschaft problematisiert, wobei er Gesellschaft als „das umfassende soziale System aller aufeinander Bezug nehmenden Kommunikationen“ versteht. „Der Zusammenhang von System und Umwelt wird […] dadurch hergestellt, dass das System seine Selbstreproduktion durch intern zirkuläre Strukturen gegen die Umwelt abschließt und nur ausnahmsweise, nur auf anderen Realitätsebenen, durch Faktoren der Umwelt irritiert, aufgeschaukelt, in Schwingung versetzt werden kann.“13 Ins Schema übertragen kann man mit Luhmann festhalten, dass sich Gesellschaften über Repräsentationen und Programme kulturell reproduzieren. Auch gravierende Veränderungen in Natur und Umwelt lösen nicht automatisch gesellschaftliche Reaktionen aus. Hierfür müssen sie erst gesellschaftlich repräsentiert und in gesellschaftlich wirksame Programme übersetzt werden. In Luhmanns prägnanter Formulierung: „Es mögen Fische sterben oder Menschen, das Baden in Seen oder Flüssen mag Krankheiten erzeugen, es mag kein Öl mehr aus den Pumpen kommen und die Durchschnitts-temperaturen mögen sinken oder steigen: solange darüber nicht kommuniziert wird, hat dies keine gesellschaftlichen Auswirkungen.“14 Andererseits kann sich der gesellschaftliche Umgang mit Umwelt vergleichsweise rasch ändern, wenn sich die gesellschaftliche Kommunikation zur Umweltthematik intensiviert. Wir können gar einen Schritt weitergehen und aufgrund dieser theoretischen Überlegungen erwarten, dass die gesellschaftlichen Repräsentationen und Programme sich nicht kontinuierlich an die Veränderungen in der Umwelt anpassen, sondern diskon-tinuierlich, in Phasen intensivierter gesellschaftlicher Kommunikation, größere Veränderungen erfahren.15
Abb. 1Interaktionen zwischen Menschen, Natur und Kultur.
Quelle: Modifiziert nach Weisz, H., Gesellschaft-Natur Koevolution. Bedingungen der Möglichkeit nachhaltiger Entwicklung, Diss. Humboldt-Universität zu Berlin 2002, S. 41.
Materialistischer und kulturalistischer Zugang
Wir können zwei grundsätzliche Zugänge der Umweltgeschichte unterscheiden: einen materialistischen und einen kulturalistischen. Beim materialistischen Zugang steht die Rekonstruktion vergangener Umweltbedingungen und materieller Interaktionen zwischen Gesellschaften und Umwelt im Zentrum. Die Gesamtheit dieser Interaktionen wird im Anschluss an Karl Marx auch als gesellschaftlicher Stoffwechsel oder sozialer Metabolismus bezeichnet.16 Dessen Form, Umfang und Wandel wird etwa mittels Stoffflussanalysen zu rekonstruieren gesucht. Der Energieumsatz einer Gesellschaft kann als generalisierte Messgröße dienen, da sämtliche Stoffumwandlungen Energie benötigen oder freisetzen: von der Photosynthese der Pflanzen über die Nahrungsverwertung in tierischen und menschlichen Körpern bis zur Produktion von Wärme und mechanischer Bewegung in Arbeitsprozessen. Über den Stoffwechsel und den Energieverbrauch können gesellschaftliche Umweltnutzungen und -beeinträchtigungen beschrieben und in ihrem Wandel analysiert werden, wobei selbstverständlich nicht nur der materielle Umfang, sondern auch die spezifische Materialität in den Blick genommen wird.17 So kann beispielsweise rekonstruiert werden, wie viel Wald in einem Gebiet gerodet wurde, aber auch wie viel Wald wieder nachwuchs (was in früheren Studien oft nicht oder zu wenig beachtet worden war). Da Wald nicht gleich Wald ist, wird zudem dem Wandel des Waldes nachgegangen, ob es sich um einen Nieder-, Mittel-^^ oder Hochwald handelte, welche Arten diese Wälder beherbergten, wie die Nutzungen aussahen und etwa auch wie sich die Preise für Bau-^^ und Brennholz und andere Waldprodukte veränderten. Untersuchungen dieser Art sind auf bestimmte Räume und meist über größere Zeiträume angelegt. Sie sind auch universalhistorisch in größtmöglicher räumlicher und zeitlicher Ausdehnung durchgeführt worden.18
Im kulturalistischen Zugriff interessiert, wie Menschen ihre Umwelt und deren Veränderungen wahrgenommen und bewertet haben und wie sie diese Wahrnehmungen und Bewertungen gesellschaftlich verarbeiteten: in Diskursen, Symbolen und Handlungen. Während der materialistische Zugang die strukturelle Ebene rekonstruiert und analysiert, rückt der kulturalistische Zugang die menschlichen Akteure und deren Bedeutungszuschreibungen in den Mittelpunkt. Welchen Wert maßen die Zeitgenossen dem Wald zu? Wie beschrieben und deuteten sie ihn? Galt er ihnen als einladend oder als unheimlich, als heilig oder als profan? Wie wandelten sich ihre Ansichten, und existierten zur selben Zeit divergierende Einstellungen, die vielleicht wiederum bestimmten sozialen Gruppen zugeordnet werden können? Zudem interessiert, wie sich politische Institutionen herausbildeten, die den gesell-schaftlichen Umgang mit Umwelt regelten, etwa Waldaufseher und Forstregale.19
Im Zuge der Etablierung der Umweltgeschichte und deren Konturierung wurden in den 1980er und 1990er Jahren ausführliche Debatten darüber ausgetragen, welcher dieser Zugänge Vorrang haben sollte.20 Mit der fachlichen Konsolidierung und Festigung sind diese Debatten abgeebbt und haben der Einsicht Platz gemacht, dass es nicht nur Raum für beide Zugänge gibt, sondern dass für eine integrale Umweltgeschichte beide Zugangsweisen vonnöten sind, da sich nur in ihrer Kombination die umwelthistorische Vision einlösen lässt, vergangene Gesellschaften in den Wechselwirkungen mit ihren Umwelten darzustellen. „That vision is inclusive – neither simply idealist nor only materialist, but always necessarily both.”21
Martin Schmid und Verena Winiwarter haben vorgeschlagen, Umweltgeschichte als „Metamorphose sozionaturaler Schauplätze, als Prozess ihres Wandels“, zu untersuchen.22 Während ich das Attribut sozionatural übernehme, ziehe ich dem Begriff des Schauplatzes den offeneren und weniger metaphorischen Begriff der Verhältnisse vor. Schauplatz mag als räumlicher Begriff für umwelthistorische Untersuchungen passend erscheinen, da diese oft, aber nicht immer, einen expliziten und spezifischen Raumbezug haben.23 Im üblichen Sprachgebrauch wird der Begriff allerdings als „Schauplatz des Geschehens“ und somit als Bühne menschlicher Aktivitäten verwendet, was, wie wir gleich sehen werden, der umwelthistorischen Konzeption einer aktiven Natur entgegenläuft. Für die Begrifflichkeit der sozionaturalen Verhältnisse spricht, dass das Wort „Verhältnisse“ dialektische Qualität besitzt: Es kann zugleich Beziehungen und Umstände meinen. Zudem können sich Verhältnisse ändern, sie lassen sich aber auch aktiv verändern.24
Dynamik und Veränderbarkeit von Natur und Umwelt
In herkömmlichen historischen Darstellungen kommen Natur und Umwelt kaum vor. Wenn sie überhaupt Eingang in die Erzählung finden, dann meist als landschaftliche Kulisse, vor der sich das eigentliche Geschehen abspielt, oder allenfalls als Begleitumstand, der das Handeln der historischen Akteure rahmt. Nur selten üben sie einen bestimmenden Einfluss aus und dann zumeist aufgrund spezifischer Eigenheiten: etwa des morastigen Bodens oder der dichten Vegetation, der Steilheit des Terrains oder der Untiefen des Gewässers. Doch selbst in dieser letzten Variante einer fortgeschrittenen Einbeziehung von Umwelt in die Narration bleibt die Natur passiv. Sie bildet lediglich die Bühne, auf der die Geschichte zur Aufführung gelangt, auf der sich die menschlichen Schicksale ereignen und Staaten oder Zivilisationen entstehen oder untergehen. Dies ist noch die Sichtweise bei Fernand Braudel, dem das Verdienst zukommt, die Umwelt als maßgebenden Faktor in die Geschichtswis-senschaften eingeführt zu haben. Den ersten Band seiner dreibändigen Geschichte des Mittelmeers widmet er Betrachtungen zur Umweltgeschichte, die er als geohistoire bezeichnet und die für ihn die unterste Schicht, eine histoire quasi immobile, bildet, auf der sich die menschlichen und gesellschaftlichen Schicksale entfalten.25 Sichtweisen auf die Geschichte, welche die Umwelt ausblenden oder nur als quasi unveränderlichen Rahmen menschlicher Aktivitäten wahrnehmen, sind nicht nur auf dem einen Auge blind, sondern sie übersehen gerade einen sehr wesentlichen Aspekt, den es für den Zusammenhang von Umwelt und Gesellschaft und dessen historischen Wandel unbedingt zu beachten gilt: die Dynamik und Veränderbarkeit von Natur und Umwelt.
Die Umweltgeschichte versucht den Wandel von Gesellschaften in der Interaktion mit ökologischen Bedingungen zu begreifen, Bedingungen, die sich selbst fortlaufend ändern, die teilweise periodischen Zyklen, etwa saisonalen oder mehrjährigen Mustern folgen, teilweise in regelhaften bis chaotischen Prozessen unterschiedlichster Geschwindigkeit und Dauer ablaufen, etwa unter dem Einfluss klimatischer Schwankungen. Historische Gesellschaften versuchten nicht nur, sich diesen wandelnden ökologischen Bedingungen anzupassen, sondern sie auch zu ihren eigenen Gunsten zu beeinflussen. Ihr Augenmerk galt gerade und insbesondere den Dynamiken der Natur, die sie zum einen zu nutzen suchten und vor denen sie sich zum anderen schützen mussten. Für das Fortkommen dieser Gesellschaften war es lebenswichtig, die natürlichen Dynamiken verstehen zu lernen, sie berechenbar und damit auch vorhersehbar zu machen, ihren Auftritt regelhafter und regelmäßiger zu gestalten und die Entfaltung der Dynamiken im eigenen Sinne zu beeinflussen. Dies kann als ein soziales Lernen verstanden werden, das eine fortdauernde Amalgamierung gesellschaftlicher und natürlicher Prozesse mit sich brachte. Das Ziel dieses Lernens, das Gesellschaften mitunter auch erreichten, kann in einer gesellschaftlichen Stabilisierung natürlicher Dynamiken gesehen werden.26 Da die natürlichen und sozialen Dynamiken fortwirkten, blieben solche sozionaturalen Stabilisierungen stets temporär.
Damit verschiebt sich der historische Blick auf Umwelt und Gesellschaft grundlegend: Wir haben nicht mehr eine bühnenhafte, quasi unveränderliche, passive Natur, sondern eine aktive, dynamische Natur, die historisch zur Umwelt vergesellschaftet wird und die sich im Prozess dieser Vergesellschaftung stabilisiert. Die Stabilisierungen bleiben allerdings prekär. Sowohl gesellschaftliche Umwälzungen als auch natürliche Dynamiken, einzeln oder in ihrem Zusammenkommen, und nicht zuletzt auch Prozesse, die gesellschaftliche Akteure absichtlich oder unabsichtlich durch ihre Interaktionen mit der Natur, in Gang setzen, können die sozionaturalen Verhältnisse, wie sie an einem Ort und zu einer Zeit vorherrschen, destabilisieren. Diesen Befund einer historisch gewachsenen Verwobenheit kultureller und natürlicher Elemente zu akzeptieren hat für die historische Praxis weitreichende Konsequenzen: Nimmt man ihn ernst, so kann es nicht darum gehen, bisherige Darstellungen lediglich um den Aspekt der Umwelt zu ergänzen, ihnen ein Kapitel zur Umweltgeschichte anzufügen. Vielmehr muss in sämtliche Schilderungen eine umwelthistorische Betrachtung eingezogen werden, was zwangsläufig zu einer, zumindest in Teilen, neuen und anderen Erzählung führen wird.27 Natur und Mensch, Umwelt und Gesellschaft als aktiv und veränderlich zu verstehen und gesellschaftliches Handeln auf gesellschaftliche und natürliche Dynamiken zu beziehen, mit dieser Sichtweise lassen sich unterschiedliche Bereiche einer fruchtbaren umwelthistorischen Interpretation zuführen, von der Herausbildung von Landnutzungssystemen über die Anlage von Siedlungen und Städten bis zur Kolonialgeschichte.28
Methoden
Je nach Fragestellung und Untersuchungsgegenstand kommen in der Umweltgeschichte unterschiedliche Methoden zur Anwendung. Insbesondere bei den materialistischen Zugängen können diese weit über das klassische historische Methodeninventar hinausgehen und etwa naturwissenschaftliche Methoden wie Dendrochronologie und Phänologie oder Erklärungsansätze aus der Geobotanik oder Evolutionsbiologie einbeziehen. Es werden aber auch quantifizierende Methoden der Wirtschafts-^^ und Sozialwissenschaften genutzt. Umweltgeschichte ist in den Worten John R. McNeills “about as interdisciplinary as intellectual pursuits can get”.29 An der Forschung beteiligen sich nicht nur Historiker, sondern ebenso Ökologinnen, Geografen und Ethnologinnen, um nur einige wenige der zahlreichen substanziell involvierten Disziplinen zu nennen. Die Methodenvielfalt und -kombination ist inzwischen so groß, dass sich hier eine auch nur überblicksartige Darstellung ausschließt.30 Es kann lediglich festgehalten werden, dass es gilt, sich spezielle Methoden mit der entsprechenden Fachliteratur gezielt anzueignen und so transdisziplinäre Kompetenzen aufzubauen, als auch den interdisziplinären Austausch und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu suchen. Solche Aneignungen und Zusammenarbeiten erfordern zwar einen hohen Arbeits-^^ und Zeiteinsatz, haben sich in der Umweltgeschichte aber als äußerst bereichernd und horizonterweiternd erwiesen. Darüber darf aber der Austausch in den Geschichtswissenschaften selbst nicht vernachlässigt werden: etwa mit der Wirtschafts-^^ und Sozialgeschichte, der Wissenschafts-, Technik-^^ und Medizingeschichte oder der Geschlechter-^^ und Globalgeschichte.31
Aufgrund dieser breiten Ausrichtung hat Uwe Lübken die Umweltgeschichte als im positiven Sinne „undiszipliniert“ charakterisiert.32 Tatsächlich dürften neben der hohen gesellschaftlichen Relevanz der Umweltthematik die vielfältigen wissenschaftlichen Anschlussmöglichkeiten zu jener akademischen Anziehungskraft beigetragen haben, welche die Umweltgeschichte seit Jahren ausübt. Andererseits scheint die ausgeprägte Interdisziplinarität des Fachs einer stärkeren Institutionalisierung an den Universitäten entgegenzustehen, deren Forschung und Lehre weiterhin größtenteils disziplinär ausgerichtet ist. Anders als in den USA ist die Umweltgeschichte an europäischen Universitäten bislang eine Randerscheinung geblieben. Umwelthistorische Professuren gibt es nur ganz wenige, zumeist und in zunehmendem Maße wird Umweltgeschichte nebenher gelehrt, etwa in Kombination mit Wirtschafts-^^ und Sozialgeschichte oder Technikgeschichte. International ist die Umweltgeschichte hingegen gut organisiert und vernetzt. Mit „Environmental History“, „Environment and History“ und „Global Environment“ bestehen gleich drei internationale Fachzeitschriften. Seit 1999 gibt es einen Kontinentalverband, die European Society for Environmental History, die alle zwei Jahre eine europäische Konferenz organisiert, die jeweils mehrere hundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammenbringt. Im fünfjährigen Rhythmus finden seit 2009 zudem globale Umweltgeschichtskonferenzen statt. Diese Aktivitäten wie auch eine wachsende Zahl von Dissertationen und anderen Fachpublikationen zeugen von der ungebrochenen Dynamik der Umweltgeschichte und führten dazu, dass das Feld in seiner Gesamtheit heute kaum mehr zu überblicken ist.33
Methodisch hat sich eine umwelthistorische Arbeit drei Kriterien zu stellen:34 erstens dem Kriterium der Wissenschaftlichkeit, das verlangt, dass die Ausführungen nachvollziehbar sind, wozu insbesondere der Anmerkungsapparat dient. Zweitens muss sie sich der kritischen historischen Methode bedienen, die in der quellenkritischen Arbeit begründet ist. Drittens, und erst dies unterscheidet sie von anderen historischen Arbeiten, darf sie etablierten ökologischen Erklärungen nicht widersprechen, wobei zu beachten ist, dass sich diese Erklärungen selbst wandeln und weiterentwickeln, in einigen Fällen auch aufgrund umwelthistorischer Erkenntnisse.35 Auch dieses dritte Kriterium unterscheidet die Umweltgeschichte aber nicht kategorial von anderen historischen Zugängen, die sich ebenfalls an der Theoriebildung und dem Wissensstand von Fachdisziplinen orientieren, etwa der Soziologie, der Ökonomie oder der Medizin.
Neben diesen methodischen Anforderungen erkennt man eine umwelthistorische Arbeit zudem daran, dass sie Natur und Kultur eine eigenständige Wirklichkeit und ein unabhängiges Handlungsvermögen zuschreibt und somit weder radikal umweltdeterministisch noch radikal sozialkonstruktivistisch argumentiert, sondern einem kritischen Realismus oder begrenzten Konstruktivismus folgt, wie er auch im benachbarten Feld der Politischen Ökologie mehrheitlich vertreten wird.36 Sie akzeptiert, dass Natur auch außerhalb von Kultur besteht und Kultur ihrerseits auch außerhalb von Natur. Sie interessiert sich letztlich aber für die Schnittmenge, die sozionaturalen Verhältnisse (auch wenn sie eine andere Bezeichnung dafür verwendet), in denen Natur und Kultur unauflöslich verbunden und geschieden sind, und sie sucht zu verstehen und zu erklären, wie und warum sich diese sozionaturalen Verhältnisse historisch wandelten.
2.Umwelthistorische Zeiten
Im vorangehenden Kapitel habe ich argumentiert, dass das Bestreben, zu verstehen und zu erklären, wie und warum sich sozionaturale Verhältnisse historisch wandelten, den Kern der Umweltgeschichte bildet. Dabei stellt sich, wie für jede historische Betrachtung, die zentrale Frage nach der zeitlichen Dimension dieses Wandels. In welchen Zeiträumen veränderten sich die sozionaturalen Verhältnisse? Lassen sich historische Phasen oder Epochen ausmachen, in denen der Wandel rascher ablief als in anderen? Wollen wir solche Geschwindigkeitsänderungen festmachen, bedingt dies, dass wir systematische Beschleunigungen oder Verlangsamungen nachweisen. Können wir aber von einer einzigen jeweils vorherrschenden Zeitstruktur ausgehen, oder müssen wir innerhalb derselben Phase oder Epoche verschiedene Wandlungs-prozesse nach ihnen je eigenen Zeitstrukturen unterscheiden? Und weiter: Folgen soziale und naturale Prozesse je eigenen zeitlichen Logiken, und, falls dem so ist: Wie lassen sich dann Zäsuren für den Wandel sozionaturaler Verhältnisse bestimmen? Gelten solche Zäsuren immer nur für Teilprozesse, oder gibt es auch Zäsuren, welche das Gesamte der Verhältnisse revolutionierten? In diesem Zusammenhang gilt es auch, das Verhältnis von Umweltgeschichte und Allgemeiner Geschichte zu thematisieren und zu fragen, wie umwelthistorische Zäsuren zu Epochengrenzen stehen, wie sie in der Allgemeinen Geschichte oder in anderen historischen Teildisziplinen vorgebracht worden sind. Schließlich ist die zentrale Frage nach den Kausalitäten zu stellen: In welchem Verhältnis steht der Wandel der materiellen Interaktionen zwischen Gesellschaften und ihren Umwelten zu jenem der ideellen Wahrnehmungen und Bewertungen von Umwelt? Passten Gesellschaften ihre Umweltwahrnehmung den veränderten materiellen Umständen an, oder veränderten sie diese Umstände auf Grundlage neu gewonnener Einsichten oder Ansichten bezüglich ihrer Umwelt?
Wie im Folgenden gezeigt werden soll, treffen sich umwelthistorische und allgemeingeschichtliche Zäsuren. Dies rührt her von der Verwobenheit umwelthistorischer mit wirtschafts-, sozial-^^ und technikhistorischen, aber auch mit politikge-schichtlichen Vorgängen und bezeugt zugleich die große Bedeutung, die umwelt-historische Prozesse für den allgemeinen Gang der Geschichte haben. Gleichwohl fordert die Umweltgeschichte zum Überdenken etablierter Chronologien und Epocheneinteilungen heraus: zum einen dadurch, dass sie ihre Epochen in Abfolgen von langer zeitlicher Dauer situiert, und zum anderen, indem ihre Einteilungen nicht ereigniszentriert sind, sondern auf Umwälzungen und bleibende Änderungen in materiellen Prozessen und (Denk-)Strukturen verweisen.37
Im vorangehenden Kapitel haben wir mit dem materialistischen und dem kulturalistischen Zugang zwei grundsätzliche Herangehensweisen der Umweltgeschichte unterschieden. Während der materialistische Zugang sich mit den materiellen Interaktionen zwischen Gesellschaften und Umwelt und deren Auswirkungen auf die Umweltbedingungen beschäftigt, interessiert sich der kulturalistische Zugang dafür, wie Menschen ihre Umwelt und deren Veränderungen wahrnahmen, bewerteten und gesellschaftlich verarbeiteten. Je nach Zugang rücken andere Aspekte des Wandels sozionaturaler Verhältnisse in den Vordergrund. Wenig erstaunlich hat dies auch zu unterschiedlichen Periodisierungsvorschlägen geführt. Im Folgenden wenden wir uns zunächst der materiellen Perspektive zu, führen sodann das Konzept des Anthropozän ein, um abschließend auf kulturalistische Sichtweisen zu sprechen zu kommen.
Solare und fossile Zeitalter und Epochen
Bei einem materialistischen Zugriff bietet sich Energie als Größe an, um umwelt-historische Epochen zu bestimmen. Als Grundlage dient die allgemeine Definition von Energie als Kapazität, Arbeit zu verrichten. Wieviel Energie eine Gesellschaft verbraucht, gibt eine erste grobe Auskunft darüber, wieviel Arbeit sie verrichtet. Damit ist die Menge an Energie, die eine Gesellschaft zu mobilisieren weiß, zugleich ein guter Indikator für das Vermögen dieser Gesellschaft, ihre Umwelt zu bearbeiten, sie zum einen nach ihren Vorstellungen zu gestalten, sie zum anderen aber auch darüber hinaus zu verändern. Die Analyse lässt sich maßgeblich verfeinern, wenn neben der bloßen Menge an mobilisierter Energie differenziert erhoben wird, welche Energieressourcen unterschiedliche Gesellschaften wie zu nutzen wussten und welche Technologien sie hierzu entwickelten und zum Einsatz brachten. Lassen sich dominante Muster der Energienutzung ausmachen, die über längere Zeit bestimmend blieben, läßt sich von Energieregimen sprechen, die sich wiederum heranziehen lassen, um energie-^^ und zugleich umwelthistorische Epochen und Umbrüche zu definieren.38
Rolf Peter Sieferle und andere haben vorgeschlagen, in universal-^^ und umwelt-historischer Perspektive zwischen solaren und fossilen Energieregimen zu unterscheiden.39Erstere beruhen zur Hauptsache auf der Nutzung von Biomasse, letztere auf der Nutzung von fossilen Brennstoffen. Die große umwelthistorische Zäsur bildet der Übergang von den solaren zu den fossilen Energieregimen, welcher mit der Industriellen Revolution verknüpft war. Sowohl die solaren als auch die fossilen Energieregime lassen sich weiter unterteilen. So können im Solaren Zeitalter verschiedene Epochen oder Stadien von Jäger-und-Sammler-Gesellschaften und Agrargesellschaften unterschieden werden. Die Kunst des Feuermachens eröffnete den Menschen ganz neue Möglichkeiten, ihr Leben und dasjenige ihrer Gemein-schaften zu gestalten. Am Feuer konnten sich Menschen wärmen, und sie konnten nun Speisen kochen und backen, was ihr Nahrungsspektrum enorm erweiterte. Zudem konnte Feuer für die Bearbeitung von Werkzeugen und Waffen eingesetzt werden oder auch für die Treibjagd. Und schließlich spielte Feuer eine wichtige Rolle bei der Rodung und Kultivierung von Land.
Herausragende Bedeutung kommt sodann der Neolithischen Revolution zu. Der Ackerbau bedingte die Sesshaftigkeit und warf höhere Erträge als das Jagen und Sammeln ab. Dies erlaubte wiederum die Produktion von Überschüssen und die Anlage von Nahrungsreserven. In der Folge wuchsen die Bevölkerungen, was größere Ansiedelungen bis hin zu Städten möglich machte. Die zweite umwälzende Neuerung neben dem Ackerbau war die Domestizierung von Nutztieren, welche die verfügbare Arbeitskraft erheblich vergrößerte. Bis ins 19. Jahrhundert hinein lieferten das Sammeln von Holz und essbaren Pflanzen beziehungsweise der Anbau von Nahrungs-^^ und Futtermitteln den überwiegenden Teil der energetischen Ressourcen, die in der Form von Wärme sowie menschlicher und tierischer Arbeitskraft konsumiert wurden. Wind-^^ und Wasserkraft wurden seit der Antike in Mühlen genutzt und erleichterte beziehungsweise ermöglichte erst den Transport von Waren und Menschen über größere Distanzen. Gewässer waren bis zur Einführung der Eisenbahn die mit Abstand günstigste Reise-^^ und Transportmöglichkeit, zum Befahren mit (Segel-)Schiffen, aber auch zum Triften und Flößen von Holz. Auch wenn die eingesetzten Technologien über die Jahrhunderte etliche Fortschritte machten, blieb der Anteil von Wasser und Wind am gesamten Energieeinsatz vormoderner Gesellschaften gering und dürfte selbst in Ländern, in denen diese Technologien vergleichsweise weitverbreitet waren, wie den Niederlanden, unter zehn Prozent gelegen haben, in den meisten Gegenden wohl unter einem Prozent.40 Fossile Energieträger waren nicht unbekannt, insbesondere Torf und Kohle erlangten in einigen Regionen eine gewisse Bedeutung. Insgesamt fielen diese Energieträger jedoch nicht ins Gewicht, sodass die Bezeichnung der Großepoche als Solares Zeitalter ihre Berechtigung hat.
Energetischer Treiber des Fossilen Zeitalters war zunächst die Kohle, zu der sich zunehmend Erdöl und in jüngerer Zeit Erdgas gesellten. Eng mit der Kohle war die Dampfmaschine verbunden, die es erstmals erlaubte, Wärme in mechanische Energie umzuwandeln und sowohl den Aufstieg der Schwerindustrie als auch der Eisenbahn und Dampfschifffahrt im 19. Jahrhundert ermöglichte. Der Siegeszug des Erdöls war an die Erfindung und Verbreitung des Verbrennungsmotors gekoppelt, auf dessen Basis sich im 20. Jahrhundert der Personen-^^ und Güterverkehr revolutionierte. Erweitert wurden die fossilen Energieregime ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert durch die Elektrizität, die sich mit ihren vielfältigsten Anwendungs-möglichkeiten, von der Beleuchtung über den Antrieb für Motoren und Maschinen bis zur Übertragung von Signalen und als Wärmequelle, für moderne Gesellschaften bald unentbehrlich machte. Das Fossile Zeitalter hob sich in dreierlei Hinsicht vom vorangehenden Solaren Zeitalter ab. Erstens stieg der Energieverbrauch stark und von temporären Schwankungen abgesehen kontinuierlich an. Unter solarenergetischen Bedingungen waren gesellschaftliche Wachstumsprozesse immer wieder an Schranken gestoßen. Der massenhafte Einsatz fossiler Energieträger war maßgeblich an deren Beseitigung beteiligt. Zweitens beruhte der steigende Energieverbrauch wesentlich auf (in menschlichen Zeiträumen) nicht erneuerbaren Ressourcen. Damit begannen Gesellschaften endliche Lager fossiler Rohstoffe, die über Jahrmillionen entstanden waren, in rasantem Tempo abzubauen und zu verbrauchen, was zum einen in einer absehbaren, wenn auch nicht genau bestimmbaren und daher umstrittenen Zeitspanne zur Erschöpfung dieser Lager führen muss und was zum anderen enorme Mengen an gespeicherten Kohlenstoffen freisetzte, die wiederum den CO2-Gehalt der Atmosphäre global ansteigen ließen und weiter lassen. Drittens entkoppelte sich der Energieverbrauch tendenziell von den lokal vorhandenen Ressourcen. Größere, billigere und kompaktere Formen des Warentransports erlaubten es Gesellschaften, längerfristig mehr und andere Ressourcen zu verbrauchen, als das eigene Territorium produzierte. Das Fossile Zeitalter zeichnet sich daher durch eine Entwicklung aus, die weder in zeitlicher noch in räumlicher Hinsicht nachhaltig war.41
Bedeutsam für die Einordnung und Einschätzung historischer Umbrüche ist, ob sie als reversibel oder irreversibel und als additiv oder kumulativ zu bewerten sind.42 Bei den energiehistorischen Umbrüchen handelte es sich um stark gerichtete Prozesse, die kaum umkehrbar waren. So sind zwar wenige Fälle dokumentiert, in denen der Ackerbau wieder aufgegeben wurde. Dies geschah aber fast ausschließlich unfreiwillig und ging mit einem zivilisatorischen Kollaps und einem Bevölkerungs-einbruch einher. Ohne Ackerbau ließ sich die auf höherem Energieinput beruhende Lebensweise ebenso wenig aufrechterhalten wie die dichte Besiedlungsform.43 Das Fossile Zeitalter brachte eine irreversible Umgestaltung der Welt mit sich, welche den gegenwärtigen Gesellschaften die enorme Herausforderung bescherte, dessen verschwenderische und (selbst-)zerstörerische Entwicklungsrichtung zu brechen und in eine nachhaltige Entwicklung zu überführen. Wegen der laufenden Klimaerwärmung muss der Verbrauch von fossilen Energieträgern rasch und massiv gesenkt werden. Wenn von der derzeit realistischen Annahme ausgegangen wird, dass die erneuerbaren Energieträger trotz rascher Fortschritte die fossilen nicht vollumfänglich ersetzen können, ist mit der Abkehr vom Fossilen Zeitalter nicht nur das seit zweihundert Jahren anhaltende Wachstum des Energieverbrauchs zu stoppen, sondern eine historisch singuläre Transformation zu einem niedrigeren Energielevel zu schaffen.44
Diese umwelt-^^ und energiehistorische Chronologie mit Daten zu versehen, ist herausfordernd. Denn weder war das Aufkommen eines neuen Energieregimes ein plötzliches Ereignis, wie der ubiquitäre Gebrauch der Revolutionsmetapher glauben machen könnte, noch lösten Energieregime einander einfach ab. Vielmehr haben wir es mit mitunter sehr langfristigen, sich über viele Jahrzehnte, ja teilweise über viele Jahrhunderte hinziehenden Übergängen kumulativer Art zu tun. Zudem setzten diese Übergänge in verschiedenen Weltgegenden, aber auch innerhalb Europas, zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten ein, verliefen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Rhythmen und wiesen unterschiedliche Eindringungstiefen auf. Jäger-und-Sammler-Gesellschaften koexistierten über Jahrtausende mit Agrargesellschaften und sind bis heute nicht gänzlich verschwunden. Die fossilen Brennstoffe erfassten ländliche Gegenden in vielen Teilen Europas erst viele Jahrzehnte nach ihrem Durchbruch in den industriellen Zentren, und das Erdöl ließ die Kohle nicht etwa verschwinden, sondern verdrängte sie lediglich an bestimmten Orten und aus gewissen Anwendungen. So stieg der globale Kohleverbrauch auch nach 1945 weiter, die (Wachstums-)Dynamik ging aber auf den Erdölsektor über. Das Fortbestehen hergebrachter Regime ist daher stets ebenso mit zu berücksichtigen wie die geografischen Unterschiede, und es muss entschieden werden, zu welchem Zeitpunkt eines Übergangs die Zäsur gesetzt wird. Angemessen scheint jenen Augenblick zu wählen, zu dem ein neues Regime zur gesellschaftlichen Dominanz aufsteigt. Für das Kohleregime zum Beispiel geschah dies in Großbritannien in den 1830er Jahren, während es auf dem europäischen Kontinent erst im Laufe der zweiten Jahrhunderthälfte einsetzte. Die Anwendung von Erdöl verzeichnete zwar bereits im Europa der Zwischenkriegszeit eine dynamische Entwicklung, von einer Dominanz des Erdölregimes lässt sich aber erst seit den ausgehenden 1950er Jahren sprechen.45
In Zeiten des Anthropozän
Äußerst anregend ist es, eine energiehistorische Periodisierung mit einer klimahistorischen Periodisierung zu kombinieren. Während vormoderne, agrarisch geprägte Gesellschaften sowohl auf kurzfristige Klimaanomalien als auch auf längerfristige Klimaschwankungen stark reagierten, gelang es sich industrialisierenden Gesellschaften, die Verwundbarkeit gegenüber klimatischen Bedingungen – zumindest mittelfristig – zu senken. Im Gegenzug setzten Industriegesellschaften ihre Mitglieder erhöhten Risiken aus. Beispielsweise konnten „Jahrhunderthochwasser“ oder „Jahrtausendbeben“ aufgrund der ausgeweiteten, verdichteten und vernetzten Besiedlung hohe Opferzahlen und enorme materielle Schäden verursachen. Auch erhöhte sich mit der Industrialisierung und dem Bevölkerungswachstum der anthropogene Einfluss auf das globale Klima markant. Der menschgemachte Klimawandel wiederum äußerte sich in jüngster Zeit in zunehmenden Klima-^^ und Wetterextremen, die sich laut den Modellen der Klimawissenschaftler in Zukunft weiter häufen und verschärfen werden.46
Gegenwärtig wird kontrovers diskutiert, inwieweit bereits der Temperaturrückgang in der um 1300 einsetzenden sogenannten Kleinen Eiszeit durch menschliches Handeln akzentuiert wurde. Klimawissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sank und 1610 den tiefsten Wert seit der letzten Eiszeit erreichte, um danach allmählich wieder anzusteigen. Dieses Phänomen dürfte zu den selbst für die Kleine Eiszeit außerordentlich tiefen globalen Durchschnittstemperaturen beigetragen haben, welche die Zeit von 1550 bis 1700 prägten. Das Absinken des CO2-Gehalts wurde wiederum mit dem durch die europäischen Eroberungen verursachten Zivilisationszusam-menbrüchen in Verbindung gebracht: Infolge der gesellschaftlichen Desintegration und der demografischen Katastrophen, welche die Gesamtbevölkerung der Amerikas um 80–90 Prozent reduzierten, breitete sich die Vegetation aus und band zusätzliches atmosphärisches CO2. Während diese These nicht ohne Widerspruch blieb, ist die Sachlage für das Ende der Kleinen Eiszeit im 19. Jahrhundert und den seitherigen Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen inzwischen eindeutig: Beides ist im Wesentlichen auf den stark ansteigenden Ausstoß von Klimagasen aus anthropogenen Quellen zurückzuführen, welche wiederum größtenteils aus der Verbrennung fossiler Energieträger stammten.
Dieser in den Klimawissenschaften seit Jahrzehnten akzeptierte Zusammenhang bewog den holländischen Klimaforscher und Nobelpreisträger für Chemie Paul J. Crutzen, zusammen mit dem Biologen Eugene F. Stoermer, vorzuschlagen, von einer neuen geologischen Epoche zu sprechen: dem Anthropozän. In einem einflussreichen Aufsatz, der 2002 in der Zeitschrift Nature erschien, führte Crutzen aus: „For the past three centuries, the effects of humans on the global environment have escalated. Because of these anthropogenic emissions of carbon dioxide, global climate may depart significantly from natural behaviour for many millennia to come. It seems appropriate to assign the term ‚Anthropocene‘ to the present, in many ways human-dominated, geological epoch, supplementing the Holocene — the warm period of the past 10–12 millennia.“47 Crutzens Vorstoß löste eine breitgefächerte Diskussion aus, die eine Vielzahl von Disziplinen erfasste. Sie wird nun schon seit Jahren intensiv geführt und ist in ihren zahlreichen Verzweigungen kaum mehr überblickbar.48 Für die hier behandelte Frage umwelthistorischer Zeitstrukturen ist von besonderem Interesse, welche Epochengrenzen aufgrund welcher Kriterien vorgeschlagen worden sind. Die Lektüre der einschlägigen Literatur fördert eine Vielfalt an Angeboten zutage, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Dazu gehören die Beherrschung des Feuers (ca. 1.800.000 v. Chr.), die Einführung beziehungsweise Verbreitung landwirtschaftlicher Anbauweisen (ca. 10.000–3000 v. Chr.) und 1492 als Beginn der anthropogenen (Wieder-)Vereinigung der „Alten“ und der „Neuen“ Welt. Vorgebracht wurden aber auch 1610, als die CO2